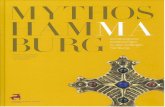Bertolt Brechts Exilleben und Parallelen zur Entstehung des ...
Max Schiendorfer: Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 – Die verlorene Liederhandschrift...
Transcript of Max Schiendorfer: Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 – Die verlorene Liederhandschrift...
Sonderdruck aus:
Entstehung und Typen mittelalterlicherLyrikhandschriftenAkten des Grazer Symposiums, 13.-17. Oktober 1999
Jahrbuch für Internationale GermanistikReihe A-Band 52
2001Verlag Peter LangBern • Berlin • Bruxelles • Frankfurt am Main • New York • Oxford -Wien
Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121
Die verlorene Liederhandschrift Heinrich Laufenbergs
Von Max Schiendorfer (Zürich)
Historische Forschung befaßt sich mit historischen Quellen, die sie kritischbeurteilt und adäquat, d.h. den historischen Produktions- und Rezeptionsum-ständen entsprechend einzuschätzen versucht. Nun ist Quellenkritik per senur dort möglich, wo ein Objekt sich bis in die historische Jetztzeit erhalten hat.Bei mittelalterlichen Quellen ist jedoch prinzipiell mit namhaften Verlustenim Verlauf der Jahrhunderte zu rechnen. Dieses methodische Problem der Zu-fälligkeiten und Chancenungleichheiten schriftlicher Überlieferung, welchesder Historiker Arnold Esch1 grundlegend aufgearbeitet hat, ist an sich durch-aus auch der altgermanistischen Forschung bekannt. In der Praxis freilich wirdes nur allzu oft vernachlässigt und wird die aktuelle Quellenlage stillschwei-gend als historisch repräsentativ behandelt. Ein Zyniker könnte es daher ge-radezu als methodisch heilsamen (Un-)Glücksfall begrüßen, daß wir in man-chen Fällen konkret den Verlust literaturgeschichtlich unersetzlicher, weilbuchstäblich einmaliger Codices nachvollziehen können - wie etwa im Falleder Laufenberg-Liederhandschrift B 121. Und zu guter Letzt gilt es die Be-deutung subliterarischer (und subliterarisch bleiben wollender) Traditionenzu bedenken: Gerade Texte gesungener Lyrik haben wohl weit häufiger alsgemeinhin angenommen überhaupt nie den Weg aufs Pergament oder dasPapier gefunden. Davon weiß namentlich die Kontrafakturforschung ein etwasmelancholisches Lied zu singen. Zahllose geistliche Neuvertextungen ver-weisen auf weltliche Vorbilder zurück, die wir nicht kennen. Dies galt bis vorkurzem auch für Laufenbergs Kontrafakt Sjch het gebildet in min hercz, undin gewisser Hinsicht gilt es noch heute. Immerhin kann man jetzt schwarz aufweiß belegen, daß ein weltliches Lied mit diesem Initium tatsächlich existierthat und daß demnach Laufenbergs Stück — was zuvor ja nur vermutet wer-den konnte - in der Tat ein Kontrafakt ist. Der Beleg fand sich einst in einerLiedersammlung des frühen 16. Jahrhunderts, Cgm 5919, von der sich ledig-lich das Inhaltsverzeichnis erhalten hat; der ganze Hauptteil des Codex gingirgendwann im Laufe der Zeiten verloren. Zu mehr als der Hälfte der 68registrierten Stücke vermerkt der Herausgeber mit lakonischem Bedauern,
224 Max Schiendorfer
sie seien "anderweitig nicht bekannt" und demnach wohl den Unbilden derÜberlieferung zum Opfer gefallen. Dazu zählt auch Lied Nr. 11 des Registersmit dem Incipit: Sich hat gepilt in mein hercz / jr liplich gestalt nach irfigur.2 Damit vergleiche man Laufenbergs entsprechendes Zeilenpaar: Sjchhet gebildet in min hercz / ein lieblich nam in hoher kür. Schon in diesenersten Versen schimmert die bei Laufenberg andernorts deutlich aufzeigbareKontrafaziertechnik durch; deren prägnanteste Merkmale sind das Zitat desInitiums (oft auch bei den Folgestrophen), das Zitat markanter Einzelwörter(im vorliegenden Falle lieblich) sowie die Übernahme weiterer Reimwörterbzw. -klänge (ßgur:kur). Trotz des großen zeitlichen Abstands dürfte dieAufzeichnung des Cgm 5919 der von Laufenberg wohl im Jahre 1434 be-nutzten Liedfassung noch relativ nahe gestanden sein.3
Der wissenschaftliche Wert des von Zimmermann publizierten Lieder-registers beschränkt sich aber natürlich nicht auf Detailerkenntnisse dieserArt. Es vermittelt darüber hinaus einen wertvollen Einblick in den Gesamt-aufbau der verlorenen Sammlung, deren Inhalt mit Hilfe verschiedenerParallelzeugen zumindest tendenziell nachgezeichnet werden kann. Daß einesolche Rekonstruktion für bestimmte Fragestellungen der Forschung - wonämlich das Augenmerk auf die Makrostruktur eines Repertoires gerichtetist — durchaus fruchtbar sein kann, versteht sich von selbst.
Einen Schritt weiter gelangt man mit der Rekonstruktion von Quellen,deren einstige Existenz lediglich aus sekundären Bezeugungen hervorgeht.Dies ist etwa der Fall bei der sogenannten Liederhandschrift X, deren Auto-renbestand in einer Notiz der "Zimmerischen Chronik" resümiert wird.4
Kann man den Augenzeugen der Liederhandschrift X noch relativeNähe zum verlorenen Original attestieren - allerdings mit Betonung auf re-lativ: der Abstand beträgt immerhin 200 Jahre -, so handelt es sich bei denfolgenden Beispielen um Gewährsleute des 18. und 19. Jahrhunderts. Ge-stützt auf die Teilabschriften verschiedener älterer Forscher - Oberlin,Myller, Graff - sowie besonders auf die offenbar sehr gewissenhaften Kol-lationen Franz Roths, gab zuletzt Eckhard Grunewald einen bilanzierendenÜberblick über die ehemalige Straßburger Märenhandschrift A 94. Sie ist imAugust 1870 ebenso in Flammen aufgegangen wie der vor allem musiko-logisch hochinteressante Codex C 22 der gleichen Bibliothek.5 Auch in die-sem Falle standen vor dem deutsch-französischen Krieg abgenommene Teil-kopien zur Verfügung, insbesondere jene von Edmond de Coussemaker.6Einzelne auf Pergamentpapier durchgepauste Handschriftenseiten erlaubtenzudem eine Annäherung an den einstigen visuellen Eindruck des Schrift-und Notenbildes.7
Übrigens enthielt Codex C 22 unter anderem mindestens ein Werk Hein-rich Laufenbergs, nämlich seine Übertragung der Mariensequenz Ave prae-clara — Bis grüest, maria, schöner merstern (WKL II 763);8 auch das unmittel-
Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 225
bar daran anschließende Dictamen Sunt festa celica dürfte ihm zuzuschrei-ben sein.9 Daß die teilweise im schweizerischen Zofingen entstandene Hand-schrift gar aus Laufenbergs Besitz in die Straßburger Johanniterbibliothekund von dort in die 1870 eingeäscherte Bibliotheque de la ville eingegangensei - in den 1430er Jahren hatte Laufenberg als Dekan am Zofinger Mau-ritiusstift geweilt, ab 1445 zog er sich in die vita contemplativa im Straß-burger Johanniterstift "Zum grünen Wörth" zurück —, ist freilich eine heutenicht mehr zu haltende ältere Forschungsthese.10 Hingegen scheint diese An-nahme bei einer Reihe weiterer Handschriften der Johanniterbibliothek un-mittelbar plausibel. Mit ihnen, fast durchwegs Unikaten und vielleicht Auto-graphen, ist der Großteil des stattlichen Laufenberg-OEuvres nahezu spurlosuntergegangen. Es handelt sich im einzelnen um die ehemaligen StraßburgerCodices
D 13: Henrici Loeffenburg Sermones duplices de tempore et de sanctis,cum Passione Domini (1425);11
B 141: Regimen sanitatis (rund 6000 Verse, 1429);12
B 94: Speculum humanae salvationis (rund 15000 Verse, fertiggestellt am6. 11. 1437);
A 80: Liberfigurarum (l5370 Verse, 1441).
Zu erwähnen bliebe last not least Codex B 121, in welchem Laufenbergseine überaus fleißige Produktion geistlicher Lieder wohl ziemlich vollstän-dig und mit größter Wahrscheinlichkeit eigenhändig13 dokumentiert hat. Dasälteste datierte Stück stammt von 1413, das bei weitem jüngste entstand 1458,d.h. zwei Jahre vor Laufenbergs Tod. Neben der geistlichen Lyrik enthieltCodex B 121 auf den ersten 16 Blättern drei didaktische Reimpaardich-tungen, nämlich einen nicht von Laufenberg selbst verfaßten "DeutschenCato", dazu seine eigenen Übersetzungen des "Facetus" sowie von "DerSeele Süßigkeit". Ferner enthielten die Blätter 161-238 umfangreiche Prosa-texte — Ermahnungen zur Beichtmeditation und Gebete - nebst einer zugehö-rigen Federzeichnung. Sämtliche dieser nichtlyrischen Werke sind, vonwenigen Zeilen abgesehen, für immer verloren.
Da ich kein Zyniker zu sein hoffe, halte ich es für ein außerordentlichesGlück, wenn diese Überlieferungskatastrophe wenigstens Laufenbergs Lyriknahezu verschont hat. Denn die entsprechenden Handschriftenteile lassensich mit Hilfe von Forschungszeugnissen über weite Strecken recht genauermitteln. In theoretischen Studien wurden entsprechende Versuche schonmehrmals unternommen, am umfassendsten 1888 von Eduard Richard Mül-ler;14 zu dieser Basisarbeit konnte Burghart Wachinger 1979 manche Kor-rekturen und Ergänzungen nachliefern,15 und 1995 habe ich selbst ein paarweitere Beobachtungen mitgeteilt,16 denen an dieser Stelle nochmals die
226 Max Schiendorfer
eine oder andere folgen soll. Vielleicht hat man aber mein eigentliches Kern-anliegen unterschwellig bereits mitschwingen hören, die Überzeugungnämlich, daß es an der Zeit wäre, den theoretischen Untersuchungen diepraktische Umsetzung folgen zu lassen. Meines Erachtens hätte HeinrichLaufenberg den Freundschaftsdienst einer Rekonstruktion seines persön-lichen Liederbuchs - und damit hoffentlich vermehrte Aufmerksamkeitseitens der Forschung - redlich verdient.
Auf welchen indirekten Quellen müßte ein solcher Versuch fußen? Der mitAbstand wichtigste Gewährsmann ist allgemein bekannt. 1867, sozusagenam Vorabend des deutsch-französischen Kriegs, hatte Philipp Wackernagelden Mittelalterband seiner monumentalen Kirchenliededition publiziert, inwelchem er zu Recht auch Heinrich Laufenberg und dem Codex B 121 eineprominente Stellung einräumte.17 Die Druckausgabe basierte fast ausschließ-lich auf eigenhändigen Abschriften, die Wackernagel im Juni 1861 vorge-nommen hatte; das entsprechende Manuskript befindet sich heute unter derSignatur M. 2371 in der Straßburger Nationalbibliothek und kann demnachals Korrektiv herangezogen werden. Da es sich dabei wohl kaum um diedirekte Druckvorlage gehandelt hat, ist der Vergleich beider Fassungen kei-neswegs nur zur Behebung von (übrigens sehr seltenen) Druckfehlern vonNutzen. Darüber weit hinausgehend finden sich nämlich im Manuskript ge-legentlich Strophen, die in der Edition unberücksichtigt blieben, sowiemanche zusätzlichen Erläuterungen und Hinweise, etwa auf rubrizierte Über-schriften von Autorsignaturen oder Datierungen einzelner Stücke. Besonderswertvoll sind auch die - gleichfalls von Wackernagel selbst angefertigten -Kopien von insgesamt 15 Melodienotationen18, von denen 5 mit Durchpaus-zeichnungen aus dem Nachlaß von Karl Riedel verglichen werden können.19
Da beide Kopisten den Notensystemen lediglich die Initien der entsprechen-den Liedtexte beischrieben, und zwar ohne sie den Noten zu unterlegen, istzu vermuten, daß die Melodien den Texten jeweils separat vorangestelltwaren, jedenfalls soweit es sich um strophische Gedichte handelte. Die Ver-mutung wird dadurch erhärtet, daß in zwei Fällen Wackernagels Folioanga-ben für Melodie bzw. Liedtext um eine Seite variieren: vgl. Ein lerer ruoftv/7 lut vs hohen sinnen (Bl. 46b bzw. 47a) sowie Ach döhterlin, min sei ge-meit(El 129abzw. 129b).
Bei nichtstrophischen Stücken war der Text dagegen offenbar den Notendirekt zugeordnet, wie eine dritte Melodiequelle nahelegt: Bereits 1841 pub-lizierte Ferdinand Wolf Laufenbergs Salve regina-Tmpus Bis grust, maget
Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 227
reine, wobei er das handschriftliche Erscheinungsbild offenbar möglichstexakt mit drucktechnischen Mitteln zu imitieren suchte.20 Bei dem unter bzw.über die Noten gesetzten Text sind ihm zwar Verlesungen und vor allem Un-terlassungssünden vorzuwerfen, wie der Vergleich mit Wackernagels Ab-schrift ergibt.21 Wenn jedoch Wackernagel gerade diese Melodie selbst zukopieren unterließ und lediglich notierte, das Stück stehe in der Handschrift"unter Noten von vier Linien" (WKL II, S. 586) - während Wolf/Schmidmoderne Fünfersysteme benutzt hatten -, kann man wohl annehmen, daß erdie bereits edierte Übertragung ansonsten als hinreichend zuverlässig be-trachtete.
Nochmals etwas anders verhält es sich mit einer siebzehnten und -soweit bekannt- letzten Melodie aus B 121, die Wackernagel ebenfalls nichtkopiert hatte. Es handelt sich um das weltliche Lied Man siht lovber tovbersowie dessen ebenfalls weltliche lateinische Bearbeitung lam en trenaplena,die Wackernagels Interesse verständlicherweise nicht wecken konnten. Min-destens war ihnen dies nicht auf Anhieb geglückt, als er im Juni 1861 denCodex in Straßburg studierte. Einen Monat später bat er jedoch den Straß-burger Professor Charles Schmidt um eine Abschrift auch dieser Melodie.Sie landete gleichfalls in Wackernagels Nachlaß. Dort entdeckte sie WaltherRoll und edierte sie in seiner "Vom Hof zur Singschule" betitelten Monogra-phie dieses bereits um 1340 erstmals bezeugten Tons, den die KolmarerLiederhandschrift demnach zu Unrecht als Bara(n)tton des erst später wir-kenden Peter von Sachs bezeichnet hat.22
Übrigens bilden zumindest einige von Laufenbergs Melodienotationen diewohl gravierendste Crux einer neuen Gesamtausgabe von B 121. So hat esdenn seinen guten Grund, wenn Burghart Wachinger zur "Kontrolle der bis-herigen teilweise unzulänglichen Melodieeditionen" anhand der von ihmfaksimilierten Notationen Wackernagels aufrief und sich selbst nur an dieTranskription eines einzigen Liedes wagte, mit der bezeichnenden Begrün-dung: "Die Textunterlegung scheint hier relativ problemlos".23 Tatsächlichverhält es sich damit in manchen Fällen ganz anders, zumal dort, wo zurUnterlegung der einzelnen Silben eines Tons schlicht zu wenig Notenmate-rial vorliegt, ohne daß jedoch an mechanische Verluste zu denken wäre.
Als erstes von zwei Beispielen diene das Tagelied-Kontrafakt Ein lererruoft vil lut vs hohen sinnen (WKL II 717), dessen Notation durch drei senk-rechte Trennstriche untergliedert ist, während die Textstrophen sechszeiligsind.24
228 Max Schiendorfer
£^üj-5
•firt («rtr ruff:
Die Unterlegung der Zeilen 1-3 stellt keine Probleme. Hier stehen einandergegenüber:
Zeile 1: 13 Noten 11 SilbenZeile 2: 12 Noten 8 SilbenZeile 3: 9 Noten 7 Silben
Bis hierhin kann der leichte Notenüberhang problemlos zur Bildung einfa-cher Schlußmelismen verwendet werden. Die restliche Melodieaufzeichnungumfaßt hingegen eine nicht weiter untergliederte Periode von 20 Noten,während in den verbleibenden Textzeilen 4-6 noch insgesamt 23 (8/8/7) Sil-ben folgen. Hier liegt also ein Notendefizit vor, welches Friedrich WilhelmArnold "durch willkürliche Zuthat" der benötigten Notenzahl zu beseitigenversuchte.25 Demgegenüber zog Franz Magnus Böhme es vor, "die Melodiedurch Wiederholen der vorletzten Zeile dem Text anzupassen"26. Angesichtsdessen, daß bei diversen weiteren Notationen Laufenbergs ähnlich prekäreSituationen bezüglich Text/Melodie-Zeilen (bei offenkundigem Notendefizit)vorliegen, scheint mir Böhme der Lösung wohl einen Schritt näher gelangt zusein. Es ist ja nicht allzu naheliegend, daß ein in metricis ungewöhnlichsorgfältig arbeitender Dichter wie Laufenberg sich beim analogen Abzählender erforderlichen Musiknoten geradezu chronisch vertan haben sollte. Weiteher dürfte er in der Tat, wohl aus arbeitsökonomischen Gründen, musikali-sche Dublettenzeilen übersprungen haben. Ist dabei aber mit Böhme zwingendan eine unmittelbare Repetition zu denken? Beim vorliegenden Fall wohleher nicht. Hier halte ich es für viel wahrscheinlicher, daß in Analogie zumRundkanzonen-Prinzip die Schlüsse der beiden Strophenteile überein-stimmen sollten: Ebenso wie es dort meist üblich ist, wurde auch hier dieSchlußzeile 6 in Reim und Metrum exakt der korrespondierenden Zeile 3nachgebildet; und die Zweiteilung als solche wird ja auch durch konsequenteMajuskel-Setzung in Zeile 4 eigens angezeigt. Vor allem aber ist zu monie-ren, daß bei Böhme ebenso wie bei Arnold die Melodie auf eine Finalis eausmündet, was angesichts der voraufgehenden Periodenschlüsse auf g bzw.zweimal d schlichtweg unwahrscheinlich ist.27 Ich schlage daher folgendeTranskription vor:
Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 229
Ein le-rer tuoft vil tut vs ho-hen sin-nen: ,wer sich zuo got nun ke-ren well,
der sol daz schier be-gin-nen, daz er in zi-te daz bestell, e im der tod den weg ver-uell,dazrotich im ussmin-nen.'
Nach analogem Muster müßte meines Erachtens auch bei einer Reihe wei-terer Lieder vorgegangen werden.28 Mein zweites, komplizierteres Beispielbetrifft das bekannte Lied Jch wölt, daz ich do heime -wer (WKL II 715),welches gemäß Heinz Menge "noch heute [...] zum Kanon der evangelischenKirchenlieder"29 zählt. Dabei steht aber leider zu befürchten, daß diese neuepraktische Rezeption als Gemeindegesang sich einer Melodie und Strophen-form zu bedienen pflegt, die Laufenberg so wohl nicht vorgesehen hatte.Zwar sind diesmal genügend Noten vorhanden, nämlich deren 20 gegenüberden beiden 8-Silblern jeder Strophe. Die Notation zeigt aber andere Merk-würdigkeiten: So findet sich der einzige Distinktionsstrich nicht etwa eini-germaßen in der Mitte der Aufzeichnung, sondern bereits nach den ersten 6Tönen, und unter dem handschriftlichen Notensystem liest man die geheim-nisvolle Notiz .bis. Was hat sie zu bedeuten?30
• . . /.V.
Weitere Verunsicherung provoziert die deutlich jüngere Parallelquelle desLiedes im Berliner Codex Mgo 224, fol. 99r, die nämlich einen dreizeiligenStrophenbau bei wörtlicher Wiederholung des jeweils ersten Verses vorsieht(WKL II 716). In meinen früheren Ausführungen zum Thema vertrat ichnoch die Ansicht, es handle sich hierbei wohl um eine sekundäre Umfor-mung unter Einfluß der Ballade von "Peter Unverdorben", zu der Jch wölt,daz ich do heime wer jedenfalls in irgendeinem Verwandtschaftsbezug ge-standen sein muß. Zunächst zum Verhältnis der beiden Kontrafakt-Re-daktionen: In B 121 umfaßt das Stück insgesamt 13 Strophen, in Mgo 224deren neun. Darunter finden sich Gegenstücke zu den älteren Strophen 1-3sowie 5-8, dazu folgende Umformung der ursprünglichen Schlußstrophe 13:
B 121, Str. 13: Alde, weit! got gsegen dich,ich var do hin gen himelrich.
Mgo 224, Str. 6: Got gsegen dich, weit, ich far da hin,got gsegen dich, weit, ich var da hin,ich var da hin gen himelrich.
230 Max Schiendorfer
Daß die zu repetierende Zeile in Mgo 224 sekundär ist, zeigt bereits der dortverlorengegangene Reim. Und woher die Anregung zu dieser Umformungstammte, läßt wiederum die gleich folgende Strophe 7 erkennen, die nämlichin B 121 ohne Vorbild ist:
Mgo 224, Str. 7: Got gesegen dich, sun, got gesegen dich, man,Got gesegen dich, sun, got gesegen dich, man,ich wil zuo got minem schöpffer gan.
Damit vergleiche man Strophe 12 der erwähnten Ballade von "Peter Unver-dorben"31:
Gott gesegen dich, sunn, got gesegen dich, mon,gort gesegen dich, schönes lieb, wa ich dich hon:ich muos mich von dir schaiden.
Soweit die Ausgangslage, die mich seinerzeit die erwähnte Vermutung he-gen ließ. Jene Deutung ließ aber zum einen die mysteriösen Begleitumständeder Melodienotation in B 121 unerklärt; zum anderen bin ich mittlerweileauf ein weiteres Vergleichsstück aufmerksam geworden, welches als eineArt missing link zur Lösung des Problems (oder zu seiner weiteren Kompli-zierung?) beizutragen vermag. Es handelt sich um ein Lied aus dem "Ho-henfurter Liederbuch"32, und zwar aus jener Partie der Sammlung, die lautÜberschrift lauter Kontrafakta enthält.33 Es umfaßt 13 dreizeilige Strophen,wobei wie in Mgo 224 die erste Zeile jeweils wörtlich repetiert wird. Dieseist in den ersten zwei Strophen denn auch tatsächlich doppelt ausgeschrie-ben; im weiteren hat der Scriptor darauf dann allerdings verzichtet (es fehlenauch etc. - oder ähnliche Hinweise). Strophe 12 des Lieds mit dem IncipitWol auf, auff, wer sich schaiden well lautet:
Gesegen dich got, ich schaid von dir,gesegen dich got, ich schaid von dir,wan nymmermer kum ich zw dir.34
Zu diesem offenbar gleichfalls mit "Peter Unverdorben" und/oder Laufen-berg in Bezug stehenden Stück wird folgende Melodie mit direkter Text-unterlegung von Strophe l geboten:
-— . ' ' 1 1 '^Tl i-^EfrEWol auf, auff, wer sich schei-den well, wol auf, auff, wer sich schei-den well,
der komm her-nach, sey mein ge-sell!
Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 231
Die Melodie der Zeilen l und 3 mündet in eine Finalis d, während sie in derMittelzeile nach anfänglich linearem Abstieg g-g-f-d-c durch die prägnanteGegenbewegung zur oberen Quint f-g-a (letztere durch die Wechselnote gverziert) abgeschlossen wird. Es handelt sich nahezu exakt um dieselbenMelodiefuhrungen, die in der Notation zu Laufenbergs Jch wölt, daz ich doheime wer den ominösen Distinktionsstrich flankieren: Vor diesem findetsich die Folge d-g-f-d-cc, dahinter der Aufstieg zur Quint f-g-a. Nun läuftallerdings auch schon die erste Zeile des "Hohenfurter Liederbuchs" in einerhier um einen Ton nach oben verschobenen Abwärtsbewegung aus: a-g-f-d,das heißt, es kommt in beiden Zeilen zu einer partiellen Melodiewiederho-lung g-f-d. Und eben dies, nämlich partielle Melodiewiederholung (ent-sprechend der rubrizierten Anweisung .bis.), wäre ja das für LaufenbergsLied zu ermittelnde fehlende Bindeglied. Falls meine Überlegungen nichtvon komplett falschen Prämissen ausgehen - das heißt: wenn Laufenberg essich tatsächlich erspart hat, die identischen Textzeilen doppelt aufzuschrei-ben, und wenn er zudem die musikalische Wiederholung in rationeller Ab-kürzung signalisieren wollte (anders als im "Hohenfurter Liederbuch" sindbei ihm die Texte ja nicht den Noten unterlegt!) -, dann müßte die erste Me-lodiezeile mit dem Abstieg vor dem Distinktionsstrich, die zweite mit demnachfolgenden Aufstieg zur Quint geendet haben, was in etwa zu folgenderLösung fuhrt:
Jch wöft, daz ich do-hei-me wer,> i
Jch wölt, daz ich dc-hci-mc wer
vnd al-ler wel-te trost en-ber.
Gewisse Details wie die exakte Plazierung der Ligaturen mögen sich einerdefinitiven Festlegung auch fortan entziehen; tatsächlich scheint mir aberLaufenbergs Lied - ganz unwissenschaftlich gesprochen - erst in einersolchen dreizeiligen Version zu seiner musikalischen Ausgewogenheit zufinden. Meiner Meinung nach hat also schon Laufenberg selbst, nicht erstsein späterer anonymer Bearbeiter, eine ihm bekannte Fassung der dreizei-ligen Balladenmelodie von "Peter Unverdorben" benutzt und umgeformt.35
Eine letzte Bemerkung zu den Melodien betrifft die spezifischen Noten-formen, die im Verlauf der Jahrzehnte bei Laufenberg eine markante Ent-wicklung zeigen: Während die ältesten Aufzeichnungen aus den 1420er Jah-ren in schwarzer gotischer Choralschrift notiert sind, läßt sich etwa ab 1435"ein zunehmendes Eindringen mensuraler Elemente feststellen"36. Am präg-nantesten zeigt sich dies bei Puer natus ist uns gar schon, das fast voll-ständig in weißer Mensuralnotation erscheint.37 Das Lied ist ebenso 1439
232 Max Schiendorfer
entstanden wie das daran anschließende, das gleiche Melodiegerüst variie-rende Ein adler höh han ich gehört, dessen Aufzeichnung ebenfalls weißeNotenkörper verwendet.38 Nur schon von daher fällt die von der älteren For-schung vorgenommene Datierung39 eines dritten Stücks, Ach döhterlin, minselgemeit, ins Jahr 1421 ganz außer Betracht.40
jfr_l.l..T:«^ *•r * »,*7)t
'C\JkWa
¥ *J
<i«
/ A"/./, A k/ f/ ^
^j\*
Das Stück selbst ist nicht datiert. Nun findet sich zwar die Jahrzahl 1421 tat-sächlich einige Seiten weiter vorne in der Handschrift, doch ist genau indieser Region eine der Bruchstellen anzusetzen, die sich durch nachträglicheUmschichtungen ergeben haben. Zudem ist Ach döhterlin auf die gleicheMelodie gedichtet wie das eingangs erwähnte Sich het gebildet in min hercz,und dieses ist mit höchster Wahrscheinlichkeit 1434 entstanden (das direktvoraufgehende Weihnachts-/Neujahrslied WKL II 724 trägt diese Jahrzahl).Etwa demselben Zeitraum wird demnach auch das naturgemäß etwas jün-gere Sekundärkontrafakt Ach döhterlin zugehören. Es drängt sich der Gedan-ke auf, Laufenberg sei mit den modernen Notationstypen vermutlich erst inZofingen bekannt geworden, wohin er zwischen 1430 und 1433 übersiedeltwar. Ob hierin vielleicht doch ein (indirekter) Einfluß des Doctor decreto-rum Felix Hemmerli greifbar ist, sei dahingestellt. Sicher ist jedoch, daßvom damals tagenden Basler Konzil her, das "zweifellos ein höchst wich-tiger 'Umschlagplatz' von mehrstimmiger Musik jener Zeit"41 (und demzu-folge mensuraler Notationsweisen) gewesen ist, neue Trends und Technikenleicht ins ca. 60 Kilometer entfernte Zofingen ausstrahlen konnten. Und daßLaufenberg sich gerade zu jener Zeit offenbar gerne in gelehrter Gesellschaftbewegte, bezeugt seine Widmung einer 1436 entstandenen Ave, regina celo-rw/M-Glossierung: Heinrici miseris ingenüs hoc compilaui, / sed tuis studiis,mifrater, hinc destinaui, /Euellas, dissipes ac plantes, quod deuiaui, /Etdominum rogites pro me, quodsemper optaui (WKL II 775).
Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 233
IV.
Neben Wackernagels Manuskript vom Juni 1861 und der davon abhängigenEdition von 1867 sind weitere Sekundärzeugen zu berücksichtigen:
*B 121
*WM-142
(1840)
WKL-14
(1841)
WM-243
(1861)Maßmann44
(1832)Banga45
(1833)Schmidt46
(1861?)
WM-2a50
(vor 1877)
ALL51
(1867)Böhme52
(1877)
Zu den von Wackernagel 1867 edierten Texten aus B 121 - die meisten alsWerke Laufenbergs, dazu einige als anonymes Gut oder unter anderen Au-tornamen gedruckt - lassen sich mit Hilfe der Vergleichszeugen weitereStücke ermitteln:
Schon 1841 hatte Wackernagel selbst das "Goldene ABC" des Mönchsvon Salzburg nach B 121 publiziert (unter Nr. 769). Weiter erwähnt er imManuskript von 1861 drei nicht in die Ausgabe übernommene Texte, näm-lich zunächst Heinrichs von Mügeln Lied von den vier complexiones Wiltumenschen art; es wurde 1429 oder 1430 aufgezeichnet, also gerade zu derZeit, als Laufenberg an seinem "Regimen sanitatis" arbeitete.53 Ferner er-wähnt das Manuskript einen lateinischen Gesang De sancto Mauritio etsociis ejus mit der Jahrzahl 1439. Dies war das Jahr, in welchem Reliquiendes Heiligen aus St. Maurice im Wallis feierlich ins Zofinger Mauritiusstiftüberfuhrt wurden. Zwar war Laufenberg wahrscheinlich schon im Jahr zuvornach Freiburg zurückgekehrt, doch wird er diesen für seine zeitweilige Wir-kensstätte so bedeutsamen Vorgang gewiß auch aus der Ferne mit Anteil-nahme verfolgt haben. Da Wackernagel leider nur die Liedüberschrift undnicht das Textinitium nennt, ist nicht ganz sicher, ob es sich um eine eigeneDichtung Laufenbergs handelte oder ob er aus aktuellem Anlaß den bekann-ten Text Konrads von Haimburg mit dem Incipit Salve, sancta beatorumThebaeorum legio aufzeichnete.54 Immerhin hat Laufenberg ja zwei weitereGedichte Konrads, das Crinale BMV sowie den Annulus BMV bearbeitet.55
234 Max Schiendorfer
Andererseits scheint es sich bei allen übrigen datierten Liedern des Codex B121 um Eigenschöpfungen Laufenbergs gehandelt zu haben, was demnachauch hier zutreffen dürfte.
Das dritte in Wackernagels Manuskript zusätzlich genannte Stück über-gehe ich für einen kurzen Moment und ziehe einen Mariengruß vor, der beiWackernagel nirgendwo vermerkt ist, von dem aber immerhin Maßmann dasIncipitAue, bis grüest, on sünden we mitteilt.56 Aus Maßmanns Artikel kön-nen überdies einige zusätzliche Zeilen zu Dichtungen gewonnen werden,von denen Wackernagel lediglich Textauszüge abgedruckt hat.
Mit dem eben zurückgestellten Lied erweitere ich den Betrachtungshori-zont und beziehe nun auch die Laufenberg-Streuüberlieferung mit ein. ImManuskript erwähnt Wackernagel eine Ave Maria-Glossierung, von der erdie ersten beiden Strophen festgehalten (letztlich aber nicht ediert) hat. Die-ser Text nun, Biss grüest, du edly yerarchy, findet sich in einer vollständi-gen, 16-strophigen Fassung im Codex X der Zwickauer Ratsschulbibliothekund kann von dort her ergänzt werden. Selbstverständlich müßte man ineiner Edition von B 121 solche anderswoher stammenden Ergänzungen gra-phisch kennzeichnen. Sie nicht an Ort und Stelle einzufügen, sondern ineinen Anhang oder Anmerkungsteil zu verbannen, hielte ich aber für über-trieben skrupulös, zumal zwischen diesem Teil der Zwickauer und der Straß-burger Handschrift offensichtlich eine engere Verbindung besteht:
fol. 76V-81V = B 121, fol. 93r[-93v]: Ich grüess dich, muoter vnsers heilantzfol. 81v-83r fehlt in B 121: Wilkom, lobes werdefol. 83r-84r = B 121, fol. 55r[-56v]: Biss grüest, du edly yerarchyfol. 84V-88V =B 121, fol. 96V-103V: Bjs grüest, du himelfarwer schinfol. 89r-92v fehlt in B 121: Maria, gottes höchsti wunnefol. 93r = B 121, fol. 130r-131r: O mary, du berendes zwy
Von den 6 Stücken, die auf fol. 76v-93r der Zwickauer Handschrift direkt auf-einanderfolgen, standen immerhin 4 auch in B 121,57 Und auch die zwei rest-lichen schließen sich sprachlich und stilistisch nahtlos an das Laufenberg-Corpus an.58 Erfreulicherweise können aus dieser Parallelquelle zwei weiterevon Wackernagel nur teilpublizierte Texte vervollständigt werden: Die Salveregina-Glossierung Bis grüest, du himelvarwer schin sowie das als Frowengürtelin bezeichnete Reimpaargedicht O Mary, du berendes zwy. Die übrigeStreuüberlieferung bietet, abgesehen von Mügelns Wiltu menschen art, an-scheinend kein weiteres Ergänzungsmaterial, doch kann sie natürlich gege-benenfalls textkritische Hilfestellungen leisten.59
Für den lyrischen Textbestand von Codex B 121 ergibt sich damit fol-gende Bilanz:
Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 235
- 96 Texte sind in Wackernagels Manuskript und Ausgabe vollständig ver-treten;
- 5 weitere können aus Parallelquellen komplettiert werden;— von 11 Dichtungen bietet Wackernagel mehr oder weniger ausführliche
Textproben, wovon eine dank Maßmann ergänzt werden kann;- von 2 verbleibenden Texten liefern Maßmann bzw. Wackernagels
Manuskript immerhin den Existenznachweis in Form einer Initiumzeilebzw. einer rubrizierten Überschrift.60
Damit stehen wir bei einem Total von 114 lyrischen Dichtungen, derenhandschriftliche Anordnung wir kennen und wiederherstellen können; undauch die Foliozahlen zumindest der Textinitien sowie der Melodien lassensich eindeutig bestimmen. Hinzu kommen die (leider rudimentären) Anga-ben über die didaktischen Reimpaargedichte, die Prosatexte, die wohl eben-falls von Laufenbergs Hand stammende Federzeichnung sowie den Besitzer-vermerk auf dem inneren Buchdeckel. Alles in allem läßt sich somit dochein weithin repräsentatives Abbild von Laufenbergs Liederbuch, seinem per-sönlichen Handexemplar gewissermaßen, wiedergewinnen - eine Chance,die es wahrzunehmen gilt.61
Anmerkungen
1 Arnold Esch: Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodi-sches Problem des Historikers. In: Historische Zeitschrift 240 (1985), S. 529-570.
2 Manfred Zimmermann: Das Liederregister im cgm 5919. In: ZfdA 111 (1982),S. 281-302, hier 287.
3 In anderen Fällen ist dies offensichtlich anders: So vergleiche man etwa das vonLudwig Uhland, Franz Magnus Böhme und anderen als Vorbild für LaufenbergsKontrafakt Es stet ein lind in himelrich propagierte Volkslied Es stet ein lind injenem tal (Ludwig Uhland: Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder. Stuttgart1844/45, Nr. 15A). Dieses hat außer den Anfangswörtern keine erkennbarenBerührungspunkte mit dem Kontrafakt, so daß es sich dabei seinerseits um eineweitestgehende Neuvertextung der von Laufenberg ca. 1425/27 benutzten Vor-lage gehandelt haben dürfte; vgl. dazu Max Schiendorfer: Der Wächter und dieMüllerin verkert, geistlich. Fußnoten zur Liedkontrafaktur bei Heinrich Laufen-berg. In: Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis von Literatur undSpiritualität. Hrsg. von Claudia Brinker u.a. Bern u.a. 1995, S. 273-316, hier285f., Anm. 31.
4 Vgl. dazu ausführlich Frieder Schanze: Zur Liederhandschrift X. In: DeutscheHandschriften 1100-1400. Oxforder Kolloquium 1985. Tübingen 1987, S. 316-329.
5 Eckhard Grunewald: Zur Handschrift A 94 der ehemaligen Straßburger Johanniter-bibliothek. In: ZfdA 110 (1981), S. 96-105; Lorenz Welker: Untersuchungen zu
236 Max Schiendorfer
den Traktaten der Handschrift Strasbourg, Bibliotheque municipale, 222 C 22.Zürich, Lizentiatsarbeit 1987 [Masch.]; ders.: Heinrich Laufenberg in Zofmgen.Musik in der spätmittelalterlichen Schweiz. In: Schweizer Jahrbuch für Musik-wissenschaft NF 11 (1991), S. 67-77; Martin Staehelin: Bemerkungen zum ver-brannten Manuskript Straßburg M. 222 C. 22. In: Die Musikforschung 42 (1989),S. 2-20. Zur Entstehung der redundanten Doppelsignatur M. 222 C. 22 vgl. Wel-ker 1991, wie Anm. 5, S. 72 und dort Anm. 16.
6 Edmond de Coussemakers Teilabschrift befindet sich im Conservatoire royal deBruxelles (Ms. 56.286); eine Reprint-Ausgabe wurde kommentarlos und ohnejeden Hinweis auf de Coussemaker herausgegeben von Albert vander Linden:Le Manuscrit musical M 222 C 22 de la Bibliotheque de Strasbourg, XVe siecle.Bruxelles [1976]. (= Thesaurus musicus. II.) Vgl. dazu Charles van den Borren:Le Manuscrit musical M 222 C 22 de la Bibliotheque de Strasbourg, XVe siecle.Antwerpen 1928.
7 Vgl. Auguste Lippmann: Essai sur un manuscrit du quinzieme siecle decouvertdans la Bibliotheque de la ville de Strasbourg (M. 222, C. 22.). In: Bulletin de laSociete pour la conservation des Monuments historiques d'Alsace 2 (1869), p.74-76 (nach p. 74: handschriftliche Kopie von fol. 78V); Monatshefte für Musik-wissenschaft 33 (1901), Notenbeilage zu Heft 6 (handschriftliche Kopie vonfol. 116r, aus dem Nachlaß von Karl Riedel hrsg. durch den Redaktor der Zeit-schrift, Paul Eimer).
8 WKLII = Philipp Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeitbis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts, 5 Bde, Leipzig 1864-1877, hier Bd. II,1867.
9 So zuletzt Welker 1991, wie Anm. 5, S. 72.10 Vgl. Staehelin 1989, wie Anrn. 5, S. 18-20. Ebenso zufällig dürfte sich die
Nachbarschaft mit Codex C 23 der Johanniterbibliothek ergeben haben, einerAbschrift von Felix Hemmeriis streitbarem Traktat "De nobilitate et rusticitate".Zwar war Hemmerli seit 1427 Chorherr in Zofmgen gewesen und arbeitete 1436neue Statuten für das Mauritiusstift aus. Doch hat er sich dort offensichtlichhöchstens ausnahmsweise aufgehalten und residierte seit 1428 permanent amZürcher Großmünsterstift. Zudem befand sich der Musikaliencodex C 22 imJahre 1442 offenbar in Basel (Staehelin, S. 16), während Hemmerlis Traktat erst"etwa 1444-1450" entstanden ist (Katharina Colberg in: 2VL 3, 1981, Sp. 997;Erich Kleinschmidt in: 2VL 5, 1985, Sp. 239). Beides ist mit LaufenbergsLebensdaten wohl nicht in Einklang zu bringen.
11 Vgl. Johan Jacob Witter: Catalogus codicum manuscriptorum in bibliotheca sacriordinis Hierosolymithani Argentorati asservatorum, Argentorati 1749, S. 41. Dain Witters Verzeichnis alle deutschen Texte als solche gekennzeichnet sind,handelte es offenbar um eine lateinische Predigtsammlung Laufenbergs.
12 Zum "Regimen sanitatis" vgl. Heinz H. Menge: Das "Regimen" Heinrich Lau-fenbergs. Textologische Untersuchung und Edition (= Göppinger Arbeiten zurGermanistik 184), Göppingen 1976. Die Angaben zu den folgenden zwei Co-dices richten sich zur Hauptsache nach Christian Moritz Engelhardt: Der Rittervon Stauffenberg, Straßburg 1823, S. 15-43.
13 Der Codex enthielt verschiedene offenkundige Autorkorrekturen: vgl. z.B.Wackernagels Anmerkungen zu WKL II 732, Str. 25,32; WKL II 736, Zeile K;
Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 237
WKL II 756, Str. 1,2; WKL II 764, passim; WKL II 765, Str. 6,1; WKL II 777,Str. 10 (in Wirklichkeit Str. 9, da die Zählung in diesem Lied versehentlich bei 2beginnt). Die am unteren Rand nachgetragene Teilstrophe wurde von Wacker-nagel sicher irrig an dieser Stelle eingefügt, und dies wohl einfach deshalb, weilder Seitenwechsel zwischen den Strophen 9 und 10 (recte 8 und 9) erfolgte.Beim vierzeiligen Nachtrag handelt es sich aber offensichtlich um eine revidierteFassung zu Str. 7 (recte 6), die vom ursprünglichen Text lediglich die Refrain-zeilen beibehalten sollte.
14 Eduard Richard Müller: Heinrich Loufenberg, eine litterar-historische Untersu-chung, Diss. Straßburg, Berlin 1888.
15 Burghart Wachinger: Notizen zu den Liedern Heinrich Laufenbergs. In: MediumjEvum deutsch. Beiträge zur deutschen Literatur des hohen und späten Mittelal-ters. Festschrift für Kurt Ruh zum 65. Geburtstag. Tübingen 1979, S. 349-385.
16 Schiendorfer 1995, wie Anm. 3.17 Wackernagel 1867, wie Anm. 8.18 In Abbildungen ediert von Wachinger 1979, wie Anm. 15, S. 380-385.19 In: Monatshefte für Musikwissenschaft 33 (1901), Notenbeilage zu Heft 6 (hrsg.
vom Redaktor Rudolf Eitner); wieder reproduziert bei Welker 1991, wie Anm.5,8.71.
20 Ferdinand Wolf: Über die Lais, Sequenzen und Leiche. Mit Übertragungen vonA. J. Schmid, Heidelberg 1841, S. 491 f. und Noten-Beilage IX.
21 Vgl. WKL II 764: Sicher korrekt schreibt Wackernagel in Zeile 34 har statt herbei Wolf/Schmid; weitere Zusatzinformationen sind Wackernagels Anmerkun-gen zu entnehmen, wo insbesondere eine ganze Reihe von nachgetragenen Über-setzungsvarianten registriert ist, die mit höchster Wahrscheinlichkeit von Lau-fenberg selbst stammen.
22 Walter Roll: Vom Hof zur Singschule. Überlieferung und Rezeption eines Tonesim 14.-17. Jahrhundert. Heidelberg 1976, S. 63-85. Vgl. dazu die wichtige Re-zension von Gisela Kornrumpf in: AfdA 90 (1979), S. 14-22, welche die Genesedes Liedkomplexes in entscheidenden Punkten zurechtgerückt hat (überliefe-rungsmäßige Priorität der gegen 1340 bezeugten Cantio Digna lande, gaude, diejedoch ebenso wie lam en trena ein Kontrafakt auf das noch ältere Man siht lov-ber gewesen sein dürfte).
23 Wachinger 1979, vgl. Anm. 15, S. 359; seine vorbildliche Melodietranskriptionzu WKL II 726 (Got geh uns allen ein glükhaft jor) vgl. ebd., S. 385. Da dieInterpretation verschiedener der übrigen Melodien diffizil ist und mindestensstreckenweise spekulativ bleiben muß, wäre es auf alle Fälle angezeigt, einerneuen Gesamtedition von B 121 sämtliche der auf Autopsie basierenden älterenAbschriften nochmals faksimiliert beizufügen.
24 Notationskopie aus dem Nachlaß Riedel, vgl. Anm. 19.25 So urteilt Franz Magnus Böhme: Altdeutsches Liederbuch. Volkslieder der Deut-
schen nach Wort und Weise aus dem 12. bis zum 17. Jahrhundert. Leipzig 1877,S. 203, über Friedrich Wilhelm Arnold: Das Locheimer Liederbuch nebst der ArsOrganisandi von Conrad Paumann. In: Jahrbuch für Musikalische Wissenschaft2(1867), S. l-224, hier 37.
f238 Max Schiendorfer Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 239
26 Ebd.; es ist daran zu erinnern, daß die Abgrenzung der Melodiezeilen in diesemzweiten Strophenteil nicht mehr von der Quelle vorgegeben ist, sondern still-schweigend von Böhme selbst vorgenommen wurde.
27 Eine nochmals andere Lösung versuchte Josef Müller-Blattau: Heinrich Lau-fenberg, ein oberrheinischer Dichtermusiker des späten Mittelalters. In: Elsaß-Lothringisches Jahrbuch 17 (1938), S. 143-163, hier 154f. Er transponierte dieganze Melodie um einen Ton nach unten, wobei er jedoch z.T. die handschrift-lichen Distinktionen ignorierte; da er Text und Melodie separat abdruckt, bleibtüberdies unklar, welche Silbenzuordnung ihm bei den siebensilbigen Zeilen 3(bei Müller-Blattau 4 Noten) sowie 6 (6 Noten) vorschweben mochte.
28 Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse etwa bei den cum grano salis melodieglei-chen Liedern In einem krippfly lag ein kind und Es sass ein edly maget schon.Erneut "fehlt" eine Melodiezeile, die Böhme (vgl. Anm. 25, Nr. 519/520) durchunmittelbare Repetition der Schlußzeile beizubringen suchte. Für wahrschein-licher halte ich auch hier das Rundkanzonen-Prinzip mit abschließender Reprisevon Melodiezeile 2. Vergleichbar ist weiter Jch weiß ein lieplich engelspil, woBöhme (Nr. 653) sich nun seinerseits nicht scheute, ein Notendefizit "durchwillkürliche Zuthat" auszugleichen. Auch hier schlage ich stattdessen Repriseder Melodiezeile 2 mit einfacher Endendifferenzierung vor (Schlußnote c' stattg). Weiter kommt Es stot ein lind in himelrich in Betracht, welches Lied inWackernagels Erstedition (Das deutsche Kirchenlied von Martin Luther bis aufNicolaus Hermann und Ambrosius Klauer. Stuttgart 1841, Nr. 771) noch dieBinnenrefrainzeile gang (bzw. denk) ihesu nah aufgewiesen hatte. Wenn er siein der großen Ausgabe von 1867 (WKL II 789) in die Fußnoten verbannte, so istdies wohl ein Zeichen dafür, daß er inzwischen unter musikologischen Einfluß(Arnolds, Böhmes?) geraten war. Das Problem ist das bekannte (vgl. Böhme Nr.582): Den inklusive unterschlagenem Refrain also 5 Text- entsprechen lediglich3 Melodiezeilen, die m. E. entweder nach dem Schema ABCAC oder ABCBC(mit einfachem Splitting der Schlußnote) angeordnet werden können. Einige derverbleibenden Melodienotationen sind problematischer, doch dürfte auch dortder hier vorgeschlagene Lösungsweg prinzipiell in die richtige Richtung weisen.
29 Menge 1976, wie Anm. 12, S. 550; richtiger Wachinger 1979, wie Anm. 15, S.349: Es handelt sich nicht um eine seit dem Mittelalter andauernde Rezeption,sondern um eine Wiederbelebung im Gefolge der Kirchenlied-"Volksausgabe"von Philipp Wackemagel: Kleines Gesangbuch geistlicher Lieder für Kirche,Schule und Haus. Stuttgart 1860, Nr. 74.
30 Notationskopie aus dem Nachlaß Wackernagel, vgl. Anm. 18, die außerdem dreikorrigierte Noten aufweist; offenbar hat Wackernagel hier schwarze Notenkör-per ohne Änderung der Tonhöhe in weiße umgewandelt. Merkwürdigerweisezeigt die durchgepauste Kopie aus dem Nachlaß Riedel, vgl. Anm. 19, an der ent-sprechenden Stelle weder weiße Noten noch sonst irgendwelche Besonderheiten.
31 Badische Landesbibliothek Karlsruhe, Cod. St. Blasien Nr. 77, fol. 31 lv; vgl. dieEdition in: Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Balladen. Bd. I. Hrsg. vomDeutschen Volksliedarchiv. Berlin 1935, Nr. 26; dazu den Artikel von BurghartWachinger in: 2VL 10, 1997, Sp. 106f., sowie Hans Joachim Moser und FredQuellmalz: Volkslieder des 15. Jahrhunderts aus St. Blasien. In: Volkskundliche
Gaben. Festschrift für John Meier. Berlin / Leipzig 1934, S. 146-156. Übrigensenthält derselbe Codex auch das weltliche Gegenstück zu einem weiteren Kon-trafakt Laufenbergs, Es taget minnecliche; vgl. dazu meinen in Anm. 3 genann-ten Beitrag, S. 282-284.
32 Budweis, Stätni Vödeckä Knihovna, Cod. l VB 8b, fol. 86r-87r; ediert von Wil-helm Bäumker: Ein deutsches geistliches Liederbuch mit Melodien aus dem 15.Jahrhundert nach einer Handschrift des Stiftes Hohenfurt. Leipzig 1895, Nr. LI;vgl. dazu den Artikel von Burghart Wachinger in: 2VL 4, 1983, Sp. 94-99.
33 Vgl. die diesen zweiten Handschriftenteil (enthaltend Bäumkers LiednummernXL bis LXVIII) einleitende Rubrik auf fol. 64V: Hy her nach volgen geistlich lie-der doch in weltlichen weysen.
34 Angesprochen ist hier natürlich nicht Gott, sondern die weltliche Liebe bzw. dieLiebe zur Welt, welcher der Sänger auf immer valet sagt; vgl. Str. 13: Pestätmich got in ewigkait, /nun aller weit sey widersayt.
35 Zu Laufenbergs Technik der Umformung vorgefundener Melodien vgl. meinenin Anm. 3 genannten Beitrag, S. 287f.
36 Welker 1991, wie Anm. 5, S. 70.37 Vgl. die Abbildung bei Wachinger 1979, wie Anm. 15, S. 382, unterstes Noten-
system, sowie die Schlußnoten oben auf S. 381.38 Wachinger 1979, wie Anm. 15, S. 381, zweitoberstes System.39 Wackemagel 1860, wie Anm. 29, Nr. 70; Arnold 1867, wie Anm. 25, S. 36.40 Notationskopie aus dem Nachlaß Riedel, wie Anm. 19.41 Staehelin 1989, wie Anm. 5, S. 19.42 Wackernagels erstes, verlorenes Manuskript; vgl. dazu sein Kleines Gesangbuch
von 1860, wie Anm. 29, S. 219, Anm. 17.43 Wackernagels zweites Manuskript: Strasbourg, Bibliotheque nationale, Cod. M.
2371.44 Hans F. Maßmann: Heinrich von Loufenberg. In: Anzeiger für Kunde des deut-
schen Mittelalters l (1832), Sp. 41-48.45 J. J. Banga: Geistliche Lieder. In: Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters
2(1833), Sp. 269-271.46 Charles Schmidt, Abschrift des Liedes Jch weiß ein vesti gross vnd klein (WKL
II 480): Strasbourg, Bibliotheque nationale, Cod. M. 3897, Bl. 181f; möglicher-weise zusammen mit der Melodie zu lam en trena plena im Juli 1861 aufge-zeichnet (s. u.).
47 Wackemagel 1841, wie Anm. 28, Nr. 743, 746-785.48 Wackemagel 1860, wie Anm. 29, Nr. 70, 74, 114, 220.49 Wackernagels große Kirchenliedausgabe, vgl. Anm. 8.50 Teilkopie der Melodien von WM-2, welche Wackernagel Böhme überlassen hatte;
heute im Böhme-Nachlaß der Sächsischen Landesbibliothek Dresden, Samm-lung älterer Volkslieder Bd. l a und Ib.
51 Arnold 1867, wie Anm. 25, S. 36f.52 Böhme 1877, wie Anm. 25, Nr. 17,43b, 106, 519, 520, 582, 600, 651-653.53 Zum Thema der complexiones im "Regimen sanitatis" vgl. insbesondere die
Verse 2071-2316 der Edition von Menge 1976, wie Anm. 12.54 Vgl. Analecta Hymnica medii aevi, hrsg. von Guido Maria Dreves und Clemens
Blume, 55 Bde. Leipzig 1886-1922, Bd. 3, Nr. 41.
240 Max Schiendorfer
55 Vgl. ebd. Nr. 2 und 3 bzw. WKL II 727 und 797.56 Maßmann 1832, wie Anm. 44, Sp. 45.57 Zu dieser Partie des Zwickauer Cod. X vgl. erstmals Georg Buchwald: Eine
neuentdeckte deutsche Liederhandschrift der Zwickauer Rathsschulbibliothek.In: Leipziger Zeitung vom 31. 12. 1886, Wissenschaftliche Beilage, S. 662f.;ferner Paul Runge: Der Marienleich Heinrich Laufenberg's "Wilkom lobeswerde". In: Festschrift für Rochus von Liliencron zum 90. Geburtstage. Leipzig1910,8.228-240.
58 Buchwald 1886, wie Anm. 57, S. 663, und Runge 1910, wie Anm. 57, S. 230,zweifeln denn auch nicht an Laufenbergs Verfasserschaft für beide Stücke.Burghart Wachinger möchte vorsichtiger "zumindest an den L[aufenberg]-Um-kreis denken" (2VL 5, 1985, Sp. 614-626, hier 623), den er freilich nicht näherbeschreibt.
59 Daß übrigens punktuelle Textemendationen gegenüber Wackernagel sehr wohlmöglich sind, sei wenigstens an ein paar Beispielfällen demonstriert: In WKL II780 schreibt Wackernagel als Initium von Str. 8 Sancta parens, mit dem Ver-merk, im Codex stehe Sara statt Sancta. Nun bieten die Parallelquellen Cgm18921 und 18964 beide Parens cara, was für B 121 auf den ursprünglichenWortlaut Cara parens hinführt. Zugegebenermaßen ist natürlich nicht ausge-schlossen, daß im Codex tatsächlich eine falsche Initiale in den freigehaltenenLeerraum eingefügt worden war. Andererseits ist aber zu beobachten, daß Wacker-nagel auch sonst gelegentlich mit analogen Schwierigkeiten kämpfte. So gestehter zu WKL II 708, Str. 2, explizit ein, die Initiale nicht eindeutig bestimmen zukönnen. Schließlich entschied er sich für den Wortlaut Nein, frimd, vatter vndmuoter din mit dem Vermerk, für Nein sei jedenfalls nicht Dfein] zu lesen.Letzteres ist sicher richtig, zumal Laufenberg das Pronomen sonst ausschließlichin der monophthongen Form din kennt (vgl. das Reimwort derselben Zeile!). Daihm andererseits die alemannische Nasalverschiebung im Tonsilbenauslautvöllig geläufig ist, wird im Codex wohl (Heim >) Kein gestanden sein (vgl. etwaWKL II 715, wo neben der Schreibung des Initiums-/cft wölt, daz ich do heimewer — gleich dreimal die "verschobene" Form auftritt, zweimal davon im Reimauf dein). Zu vergleichen wäre femer WKL II 711, Str. 13, wo WackernagelGrübel her gelesen hatte; gemeint ist natürlich das bekannte mariologische Bildder Weinrebe, also Trubel her. — Weitere Beispiele, in denen VergleichstexteEmendationen ermöglichen, bieten etwa WKL II 727 oder 585. Im ersten Fallkonnte Wackernagel wiederum ein Wort nicht sicher entziffern und beließ esbeim vorsichtigen Abdruck der Anfangs- und Schlußbuchstaben: p k (Str.41,3). Da es sich bei dem Stück um die Bearbeitung des Crinale BMV Konradsvon Haimburg handelt, führt der Vorlagentext (vis malorum punicorum) auf dieLösung von punik vns din öpfel nart. In WKL II 585, Str. 9, schließlich ersetzteWackernagel das Schlußwort der Strophe, um damit einen Reim mit dem vor-hergehenden Vers herzustellen. Aber auch die Zwickauer Parallelquelle bietetden gleichen Wortlaut wie B 121. Die zweitletzte Zeile muß demnach als Waisegedeutet werden (Reimschema: aabbccxb), ebenso wie übrigens in Str. 11, wasWackernagel übersehen hatte. — Mit meinem letzten Beispiel nähere ich michbewußt jenem Grenzbereich, in dem es behutsam abzuwägen gilt, ob eine Emen-
Johanniterbibliothek Straßburg, Cod. B 121 241
dation in den Lesetext aufgenommen oder nur im Kommentar propagiert werdensoll: Im schon erwähnten Lied WKL II 715 lautet Wackernagels Str. 5: Doheinist leben one tot / vnd ganczi fröiden one not. Dazu merkt er an, der Codexschreibe in der zweiten Zeile alle statt one. Natürlich wäre die von Wackernagelentzifferte Formulierung fröiden alle not unsinnig. Wie steht es aber um diekorrigierte Lesart? Würde Laufenberg nicht singularisch ganczi fröid(e) one notsagen wollen, ja müssen? Ich konjiziere daher ganczi fröid on alle not, wobei dieWörter fröid on im Codex vielleicht etwas näher als üblich aneinander gerücktgewesen sein mögen (für apokopiertes fröid/fröud bietet die Handschrift zahl-reiche Belege, ebenso für apokopiertes on; vgl. etwa die in Sinn und Formulie-rung verwandte Stelle WKL II 748, Str. 3,7f: Jch kund uchfröud/on alles leyd).
60 Müller 1888, wie Anm. 14, S. 14, moniert, Wackernagel habe einen von Maß-mann und Banga für Bl. 16b-c bezeugten Text übersehen (O ihesu süsser brun-ne, ausmündend in die Automennung Heinrich). Wahrscheinlich handelt es sichdabei um ein von Laufenberg an das Lehrgedicht "Der Seele Süßigkeit" ange-hängtes Schlußgebet — so wie er dem "Facetus" umgekehrt eine selbstverfaßteEinleitung vorangestellt hatte -, als welches Wackemagel es erkannte, währendMaßmann und Banga es trotz der Reimpaarform als selbständigen (Lied-)Textinterpretierten. Eine gewisse Unsicherheit bleibt aber in der Tat bestehen. Hinge-gen argwöhnt Müller zu Unrecht einen Widerspruch, wenn der Anfang der dar-auf folgenden Salve regma-Glossierung, Bjs grüest, du engelschi natur, vonMaßmann auf Bl. 16d, von Wackernagel hingegen auf Bl. 16b verwiesen wird,da Wackernagel konsequent nur zwischen Recto- und Versoseite, Maßmanndagegen (fast) durchwegs zwischen den einzelnen Spalten unterscheidet.
61 Bei der Grazer Tagung fügte ich an dieser Stelle abschließend ein vündelin be-treffend die Lagenumschichtung des ersten Handschriftenteils mit den didakti-schen Reimpaardichtungen hinzu. Aus Raumgründen mußte es am vorliegendenOrt wegfallen. Es ist stattdessen als Miszelle in ZfdPh 119 (2000), S. 421-426,erschienen.