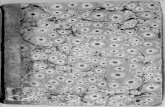MAGISTRSKO DELO - CORE
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of MAGISTRSKO DELO - CORE
UNIVERZA V MARIBORU
FILOZOFSKA FAKULTETA
Oddelek za germanistiko
MAGISTRSKO DELO
Maja Kajbič
Maribor, 2015
UNIVERZA V MARIBORU
FILOZOFSKA FAKULTETA
Oddelek za Germanistiko
Magistrsko delo
SLIKA NEMČIJE - BESEDJE, VEZANO NA DEŽELOZNANSTVO V
UČBENIŠKEM KOMPLETU OPTIMAL
Masterarbeit
DAS BILD VON DEUTSCHLAND - ZUR VERMITTLUNG LANDES- UND
KULTURSPEZIFISCHER LEXIK IM LEHRWERKBAND OPTIMAL
Mentorica: Kandidatka:
Red. prof. dr. Vida Jesenšek Maja Kajbič
Maribor, 2015
DANKSAGUNG
An dieser Stelle möchte ich mich gerne bei meiner Mentorin, Red. Prof. Dr. Vida
Jesenšek für die Betreuung und Kritik bedanken.
Ein großer Dank geht an meine Familie, da ohne ihre Unterstützung diese
Masterarbeit für mich nicht möglich wäre.
Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija
PRILOGA 6B
IZJAVA
Podpisani-a Maja Kajbič, rojen-a 14.08.1989, študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru,
študijskega programa 2. stopnje Nemščina kot tuji jezik (ped.) in Poučevanje angleščine (ped.),
izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Das Bild von Deutschland - Zur Vermittlung landes- und
kulturspezifischer Lexik im Lehrwerkband Optimal pri mentorici red. prof. dr. Vidi Jesenšek avtorsko
delo.
V magistrskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso prepisani brez
navedbe avtorjev.
______________________________ (podpis študenta-ke)
Maribor, 13.10.2015
POVZETEK
Cilj magistrskega dela je prepoznati in analizirati besedje, vezano na
deželoznanstvene in kulturnospecifične prvine v učbeniškem kompletu Optimal.
Analiza se osredotoča na besedila, namenjena bralnemu razumevanju, saj so ta
besedila vsebinsko najbolj bogata in zaradi tega primerna za analizo. Namen
magistrskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri besedila vsebujejo besedje, vezano
na deželoznanstvene vsebine o Nemčiji, in kakšno celostno sliko Nemčije s tem
ustvarijo.
Naloga je členjena na dva dela. Teoretični del se ukvarja s teorijo leksikologije,
kulturnospecifičnih izrazov in besedil namenjenih bralnemu razumevanju kot
besedilne vrste. Nadalje je predstavljena disciplina deželoznanstva in stereotipov
ter kratek pregled konteksta nemščine kot tujega jezika v Sloveniji. Empirični del
naloge je namenjen analizi besedil in je nadalje členjen na posamezna tematska
področja, ki so obravnavana v učbeniškem kompletu Optimal.
Ključne besede: deželoznanstvo, Optimal, leksikologija, besedni zaklad.
ZUSAMMENFASSUNG
Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit war die Analyse der Lesetexte im
Lehrwerkband Optimal, mit besonderem Fokus auf die landestypische und
landeskundliche Lexik. Die Analyse beruht auf den Lesetexten aus dem
Lehrwerkband Optimal, da diese dem Leseverstehen dienen, besonders reich am
Wortschatz sind und daher gut geeignet für die Analyse. Die Masterarbeit
verfolgte die Absicht herauszufinden, ob und wie die Lesetexte im Lehrwerkband
Optimal landestypische und landeskundliche Lexik beinhalten, und was für ein
Bild von Deutschland sie damit erstellen.
Die Arbeit ist inhaltlich in zwei Teile gegliedert. Der theoretische Teil befasst sich
mit der Theorie der Lexikologie, kulturspezifischen Ausdrücken und Texten
sowie der Landeskunde. Im empirischen Teil folgen die Analyse der Lesetexte
und die Ergebnisse.
Schlüsselwörter: Landeskunde, Optimal, Lexikologie, Wortschatz.
INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG.................................................................................................................. 1
2 THEORETISCHER TEIL ............................................................................................... 2
2.1 LEXIKOLOGIE ........................................................................................................ 2
2.2 KULTURSPEZIFISCHE AUSDRÜCKE ................................................................. 3
2.3 TEXTE UND IHRE FUNKTION............................................................................. 4
2.4 TEXTSORTE „LESETEXT“ ................................................................................... 6
2.5 LANDESKUNDE ..................................................................................................... 8
2.6 STEREOTYPE UND VORURTEILE ...................................................................... 9
2.7 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN SLOWENIEN ....................................... 10
3 EMPIRISCHER TEIL ................................................................................................... 11
3.1 DAS UNTERSUCHUNGSMATERIAL ................................................................ 11
3.2 ÜBERBLICK DER LESETEXTE .......................................................................... 12
3.3 KULTURSPEZIFISCHE MERKMALE ................................................................ 14
3.3.1 SICH VORSTELLEN UND BEGRÜßEN ...................................................... 14
3.3.2 DER ALLTAG ................................................................................................. 16
3.3.3 ARBEIT UND BERUF .................................................................................... 20
3.3.4 FESTE UND FEIERLICHKEITEN ................................................................ 22
3.3.5 REISEN ............................................................................................................ 25
3.3.6 WOHNEN ........................................................................................................ 30
3.3.7 FREIZEIT ........................................................................................................ 33
3.3.8 ESSEN UND TRINKEN ................................................................................. 37
3.3.9 GESUND- UND KRANKHEIT ...................................................................... 39
3.3.10 MODE ............................................................................................................ 41
3.3.11 AUSBILDUNG .............................................................................................. 42
3.4 STEREOTYPE UND VORURTEILE .................................................................... 43
4 SCHLUSSWORT .......................................................................................................... 44
5 LITERATUR ................................................................................................................. 46
6 ANHANG – AUSGEWÄHLTE TEXTE ...................................................................... 49
1
1 EINLEITUNG
Die vorliegende Masterarbeit untersucht Lesetexte im Lehrwerkband Optimal.
Das Lehrwerkband Optimal, bestehend aus den Lehrwerken A1, A2 und B1, wird
an vielen slowenischen Mittelschulen und Gymnasien beim Deutschunterricht
verwendet.
Die vorliegende Arbeit basiert auf der Analyse von Lesetexten aus dem Lehrwerk
Optimal mit der Absicht, um festzustellen, inwiefern diese landeskundliche und
landestypische Lexik beinhalten und damit Informationen, die landeskundliche
Bilder von Deutschland vermitteln. Aus dem Lehrwerkband wurden Texte
ausgesucht und analysiert um festzustellen, ob sie eventuelle Inhalte vermitteln,
die die Bildung von Stereotypen, Vorurteilen und negativen, falschen
Vorstellungen auslösen können.
Das Ziel der Masterarbeit ist es die landeskundliche und kulturspezifische Lexik
zu erkennen und zu analysieren. Die vorliegende Arbeit beinhaltet auch
Verbesserungs- bzw. Erweiterungsvorschläge.
In Anlehnung an Müller (2011) werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit
folgende Hypothesen überprüft:
1. Landeskundlicher Wortschatz und landeskundliche Informationen sind im
Deutschunterricht ständig präsent, da sie einen Großteil der Lehrwerke
darstellen.
2. Der Wortschatz vermittelt landeskundliche und interkulturelle Inhalte.
3. Das Sprachniveau hat Einfluss auf die landeskundliche Lexik im
Lehrwerk.
Die Arbeit ist inhaltlich in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil befasst sich die
Masterarbeit mit der Theorie der Lexik und Landeskunde, im zweiten,
empirischen Teil, werden die Lesetexte analysiert und interpretiert.
2
2 THEORETISCHER TEIL
Dieses Kapitel befasst sich mit der Klärung theoretischer Begriffe, die für die
Analyse im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wichtig sind.
2.1 LEXIKOLOGIE
Im Lexikon der Sprachwissenschaft ist Lexikologie als ein Teil der
Sprachwissenschaft, „der sich mit der Erforschung und Beschreibung des
Wortschatzes einer Sprache beschäftigt“ definiert (Bußmann 1990, 455).
Im Gegensatz zu Bußmann betonnt Lutzeier, dass Lexikologie eine eigene
sprachwissenschaftliche Disziplin ist. Diese entstand durch ständiges Interesse am
Wortschatz und Wörtern, und basiert auf der Theorie und Praxis der
Wortschatzstrukturen (Lutzeier 1997, 5).
Römer und Matzke gehen in ihrer Theorie noch weiter und sprechen von
mehreren verschiedenen Lexikologien; neben der allgemeinen Lexikologie
unterscheiden sie die spezielle Lexikologie, die historische Lexikologie, die
kognitive Lexikologie und die computerlinguistische Lexikologie (Römer und
Matzke 2005, 2).
Teildisziplinen der Lexikologie sind folgende (Römer und Matzke 2005, 4):
a) die Wortschatzkunde, die sich mit den semiotischen, grammatischen,
kognitiven, soziolinguistischen und strukturellen Aspekten des
Wortschatzes einer Sprache beschäftigt,
b) die Wortbildung, deren Interesse in der Bildung und Struktur der
komplexen Wörter liegt,
c) die lexikalische Semantik, die sich mit Lexemen und deren Bedeutung
beschäftigt und
d) die Phraseologie, die sich mit Wortgruppen, die im Langzeitgedächtnis
gespeichert sind, aber unterschiedlich von den freien Wortgruppen sind
(feste Wortgruppen) beschäftigt.
3
Wie bereits erwähnt, liegt der Fokus der Lexikologie im Wortschatz. Die
lexikalische Einheit, das Wort, trägt verschiedene Bedeutungen.
Herbermann deutet daraufhin, dass der Ausdruck Wort im Alltag öfter gebraucht
wird, doch der hat mehrere Bedeutungen. So kann Wort den Zusammenhang von
Ausdruck, Inhalt und Einheiten einer Sprache, die man erlernen kann, darstellen.
Andererseits ist Wort ein Begriff für sprachliche Äußerung in einem Dialog
(Herbermann 2002, 15). In der aktuellen Linguistik sieht man den Terminus Wort,
so wie schon im Strukturalismus, als eine grammatische Einheit. Jedoch wird in
der letzten Zeit zwischen der phonologischen, grammatischen und lexikalischen
Einheit differenziert (Herbermann 2002, 17). Um den Ausdruck Wort näher zu
bestimmen und von den Ausdrücken, die z.B. Komposita oder Derivate sind,
abzugrenzen, ist der Terminus Lexem entstanden (Herbermann 2002, 21).
Im Lexikon der Sprachwissenschaft ist Lexem als „eine abstrakte Basiseinheit des
Lexikons auf Langue-Ebene, die in verschiedenen grammatikalischen
Wortformen realisiert werden kann“, beschrieben (Bußmann 1990, 446).
Herbermann definiert Lexeme als semantisch einfache, aber in der
Ausdrucksstruktur komplexe Einheiten (Herbermann 2002, 23).
2.2 KULTURSPEZIFISCHE AUSDRÜCKE
Jede Sprache stellt eigene Weltbilder, die auch die eigene Etnopsychologie,
Denkweise und soziokulturelle Struktur beinhalten, dar. Dass die verschiedenen
Sprachstrukturen zu unterschiedlichem Denken, Wahrnehmungen und
Bewertungen führen, besagt die Sapir-Whorf-Hypothese (Yu 2013, 49 zit. nach
Arens/Hersfeld 2000). Relevante kulturelle Konzepte sind im Wortschatz bzw.
der Lexik einer Sprache zu erkennen. Das heißt, gemeinsame linguistische
Hintergründe stellen die Voraussetzung zur Verständigung innerhalb eines
Weltbildes dar (Yu 2013, 49 zit. nach Whorf 1963). Die
Wirklichkeitsinterpretation, d.h. die Wirklichkeit einer Sprachgemeinschaft, wird
laut Koller als eine Harmonie zwischen der sprachlichen Sichtweise, den Normen
4
und Einstellungen angesehen. Die Interpretation wird vor allem von der
Weitergabe des Wissens und der Erfahrungen in einer Sprachgemeinschaft
bestimmt. Die Erfahrungen wurden schriftlich fixiert, sodass man sie in einer
Sprachgemeinschaft erlernen konnte und als Erfahrung, die auf unseren
implizierten Erwartungen beruht wahrnimmt (Yu 2013, 50 zit. nach Koller 2011).
2.3 TEXTE UND IHRE FUNKTION
Auf die Frage, was macht einen Text aus und welche Merkmale er hat, gibt es
verschiedene Antworten und Theorien.
Habscheid definiert sie als „kommunikative Okkurenzen“ d.h., sie dienen der
Kommunikation und sollen die Textualitätskriterien erfüllen. Ein weiteres
Kriterium für Textualität ist die Intentionalität; die Intention des Autors muss von
dem Rezipienten zu erkennen sein, sonst ergibt der Text keinen kommunikativen
Sinn. Akzeptabilität ist kein Kriterium für die Textualität, sondern eine Grundlage
für die Kriterien, die einen Text ausmachen. Ein Text muss auch informativ sein;
er knüpft neues Wissen an schon Vorhandenes an. Des Weiteren soll ein Text
Situationalität enthalten (in welcher Situation es geschrieben bzw. Angesprochen
wurde – die Umgebung, Zeit, personelle Umstände usw.). Ein wichtiger Teil der
Textualität ist die Kohärenz, die auch oft als roter Faden eines Textes dargestellt
wird. Eng mit der Kohärenz verbunden ist die Kohäsion – hierbei geht es um den
Zusammenhang und Verbundenheit der sprachlichen Ausdrücke oberhalb der
Satzebene. Ein letztes Kriterium für Textualität ist die Intertextualität, die besagt,
dass ein Text auf andere ähnliche Texte verweist; d.h., wenn man auf einen neuen
Text stoßt, setzt man frühere Erfahrungen ein, um komplexe Texte oder Aufgaben
zu lösen oder verständlicher zu machen (Habscheid 2009, 29).
Durch Texte wird nicht nur das Verhältnis zwischen Wissen und Handeln,
sondern auch die Gesellschaftsstruktur vermittelt. Der Text wird hierbei als
Kommunikationsmittel, das in der Gesellschaft die Normen festlegt, angesehen
(Habscheid 2009, zit. nach Link 2006, 409). Texte können verschiedene
5
Auswirkungen an das Handeln der Menschen haben. Äußerst stark ausgeprägt
wird das in Massenmedien, wie etwa in Zeitschriften und politischen Texten, aber
auch in nicht-sprachlichen Texten (in Grafiken, Tabellen oder Bildern).
Habscheid betonnt, dass Texte nur dann ihren kommunikativen Sinn erfüllen,
wenn sie in einem Kontext eingebettet sind. Um das zu erfüllen, muss ihren Teil
der Textproduzent, dessen Rezipient, das Medium und die Gegenstände des
Textes erfüllen (Habscheid 2009, 14).
De Beaugrande und Dressler sprechen von kommunikativen Texten, die die
sieben Kriterien der Textualität erfüllen müssen, sonst gelten sie als Nicht-Texte
(Vater 2001, zit. nach De Beaugrande und Dressler 1981, 3). Vater meint jedoch,
dass die Grenze zwischen Texten und Nicht-Texten nicht so scharf zu ziehen ist
und die Erfüllung aller Textualitätskriterien problematisch ist. Vor allem die
Akzeptabilität ist ein Kriterium, das er als relativ ansieht: So kann ein Leser einen
Text als akzeptabel ansehen, ein anderer nicht (Vater 2001, 28).
Kirsten Adamzik (2004, 11) definiert Texte aus der Sicht einer
Sprachgemeinschaft. Für die Angehörige einer Sprachgemeinschaft sind Texte
Sinnträger. Ein Text ist demnach von Inhalt her interessant, seine sprachlichen
Eigenschaften aber nicht relevant. Man muss aber in vielen Situationen dazu
plädieren die sprachliche Gestalt unter die Lupe zu nehmen, vor allem wenn man
einzelne Wörter oder längere Absätze einer Fremdsprache nicht versteht. Mit
Hilfe von Grammatiken und Wörterbücher kann man mit Texten arbeiten und
seine Kompetenzen entwickeln. Adamzik warnt aber vor Nutzung solcher Texte,
die man nur als „Reservoir von Beispielfällen“ betrachtet und nicht als eine
Einheit (Adamzik 2004, 11).
Texte zu definieren ist problematisch, meint Adamzik (2004, 31). Der Ausdruck
wird oft im Alltag benutzt und somit ist nur eine Definition nicht möglich.
Wissenschaftler meinen, dass Text „als überaus komplexes, vielgestaltiges und
vielschichtiges Objekt der wissenschaftlichen Betrachtung durchaus in Blick
bleiben soll“ (Adamzik 2004, 31).
6
In dieser Masterarbeit wird das Untersuchungsmaterial, das nicht nur aus langen,
zusammenhängenden Passagen, sondern auch aus Bildunterschriften und Titeln
besteht, als Text bezeichnet.
2.4 TEXTSORTE „LESETEXT“
Texte in Textsorten zu gliedern und diese mit entsprechenden, spezifischen
Regeln zu definieren ist problematisch in der Hinsicht, dass die Merkmale und
Kriterien für die Typologie der Texte miteinander vermischt wurden und deshalb
keine einheitliche, vollendete Theorie zur Verfügung steht (Vater 2001, zit. nach
Brettschneider 1972, 125).
Nach Heinemann und Viehweger (Vater 2001, 158) wurden Textsorten und
Textklassen auf der Basis von Klassifikationen der Texte (mündlicher und
schriftlicher) existierend in einer Sprachgemeinschaft, die sie mit Lexikonzeichen
gestützt und gängig gemacht hat, definiert.
Habscheid (2009, 57) schreibt, dass Textsorten aus typisch bestimmten Zeichen
bestehen, die durch ihre Außenstruktur und Binnenstruktur realisiert werden. Eine
Textsorte ist also an einen Zweck und deren Kontext sowie an ihre Form
gebunden.
Wenn in der vorliegenden Masterarbeit der Begriff Lesetext vorkommt, meine ich
damit jeden Text im behandelnden Lehrwerk, das zur Erweiterung der
Lesefertigkeit dient. Obwohl es keine theoretische Grundlage, die solche Texte
definiert gibt, kann man typische Merkmale erkennen.
Texte, die in Lehrwerken veröffentlicht sind, werden meist auch für diese
geschrieben oder umgeschrieben. Das Vokabular wird der jeweiligen Zielgruppe
angepasst und somit wird auch das Thema der Texte ausgesucht und angepasst.
Vater ist Vertreter der Meinung, dass das Thema eines Textes schwer zu
bestimmen ist, da es meistens nicht eindeutig ist und zudem manche Texte auch
mehrere Themen beinhalten, oder sie erscheinen implizit (2001, 63).
7
Adamzik (2004, 125) warnt, dass das Thema abstrakt sein kann, doch soll nicht
als das Hauptmerkmal eines Textes festgelegt werden. Vielmehr soll das Thema
als eine Beschreibungskategorie dienen, die aber nicht direkt den Text
charakterisiert. Das heißt, Themen wie z.B. Politik, Essen usw. werden im Text
mit bestimmten Subthemen behandelt.
Neva Šlibar weist darauf hin, dass das Wichtigste bei der Arbeit mit Texten der
Kontext ist. Wenn der fehlt, bedeutet das sowohl eine Isolierung als auch eine
Hervorhebung. Die Hervorhebung ist eine Andeutung auf die Botschaft des
Textes und den Text selbst (2001, 22). Šlibar spricht von Texten allgemein, doch
ihre Theorie kann man schwer auf nicht-literarische Texte beziehen, weil diese
andere Intentionen haben als z.B. Lyrik oder Prosa. Die Texte im Lehrwerk kann
man nicht isolieren, weil sie Ihren Sinn dadurch verlieren.
Texte oder einzelne Segmente ohne Kontext lösen bei dem Leser verschiedene
Interpretationen aus. Solche Texte erzielen Polyvalenz – Mehrdeutigkeit und
damit verbundene Bildungsvielfalt. Dies ist aber vor allem bei der Arbeit mit
literarischen Texten möglich, da diese Texte Aktivität der Rezipienten fördern
und hohen Bildungspotenzial haben (Šlibar 2001, 22).
Wie bereits erwähnt ist es wichtig, die Texte in einen Kontext einzubetten. Šlibar
beschreibt das Verfahren, bei dem man aus Texten ihren Sinn konstruiert, um die
Bedeutungen herzustellen – die Kontextualisierung. Für die erfolgreiche
Kontextualisierung braucht man Informationen, die für den Text relevant sind.
Das Weltwissen ist hierbei sehr hilfreich – die Allgemeinbildung ist nützlich, um
sich in der Textwelt zurechtzufinden (2001, 33).
Šlibar (2001, 34) hebt auch die Intertextualität hervor. Sie sei ein Kenntnis das auf
andere Texte anknüpft, und somit auch an andere Genres, wie etwa Musik, Filme
usw. Ein Problem kann das mangelnde Weltwissen der Lernenden sein, die in
verschiedenem kulturellen Umfeld aufgewachsen sind und viele „Textsignale, die
nach externer Kontextualisierung verlangen“ nicht erkennen.
8
2.5 LANDESKUNDE
Landeskunde wird als Disziplin mit mehreren verschiedenen Namen bezeichnet,
wie etwa Kulturkunde oder Landesstudien. Dies ist zutreffend, da es sich bei
Landeskunde um die „Kunde vom fremden Lande“ handelt. Sie beinhaltet Kultur
eines fremden Landes, zu der auch Geschichte, Politik, Kunst, Soziales, Sport,
Wissenschaft, Produkte usw. gehören (Erdmenger 1996, 12).
Landeskunde ist eng mit dem interkulturellen Lernen verbunden. Sie bringt dazu
bei, dass man nicht nur andere, fremde Länder besser kennenlernt, sondern auch
das eigene (Kekesi 2009, 5).
Im Fremdsprachenunterricht ist der Zusammenhang zwischen Sprache und
Landeskunde eine wichtige Voraussetzung, da die Schüler durch ihr
Sprachenlernen von selber an der Kultur des Landes interessiert sind. Erdmenger
betonnt jedoch, dass es bei der Vermittlung von der politischen Lage, diese nur
mit Fakten zu unterstützen ist, ohne Ideologie (Erdmenger 1996, 16).
Erdmenger (1996, 17) geht auch auf sozialpsychologsiche Ansätze der
Landeskunde ein, da er vor allem vor Stereotypen warnt. Diese sollen im
Unterricht angesprochen werden und das Wichtigste - korrigiert werden.
Erdmenger schreibt über vier Ziele, die Landeskunde im Fremdsprachenunterricht
erreichen soll (1996, 25):
a) Kommunikationsaspekt: Landeskunde soll die Gebiete der Zielkultur
vermitteln, mit denen der Lernende in Berührung kommen wird.
b) kognitiver Bereich: das Vermitteln von Informationen über den Alltag bis
hin zu Staat, Gesellschaft und Wirtschaft.
c) Sozialwissen: stellt die Grundlage für angemessenes sprachliches
Verhalten in konkreten Situationen sowie Verhaltensnormen in der
Zielkultur dar.
d) Aspekt der Völkerverständigung: Landeskunde kann zu einer
aufgeschlossenen Haltung und Revision von Vorurteilen dem Fremden
gegenüber führen.
9
Ein gutes Verfahren beim landeskundlichen Unterricht, so Erdmenger (1996, 40)
ist der vom Bekannten zum Unbekannten zu gehen. Das heißt, die Lernenden
sollen zuerst was allgemein Bekanntes vermittelt bekommen, und danach das
Fremde, Neue aus der Zielsprache bzw. Zielkultur. So ist es auch sinnvoll, die
Universalia zu kennen, damit man sie richtig beim Sprachunterricht verwenden
kann. Universalia sind Sachverhalte, die allgemeine Gültigkeit besitzen. Es
handelt sich aber entweder über die wirklichen Universalia (überall Gültige, wie
z.B. Zahlen, Farben usw.) oder die oberflächlichen Universalia, die man nicht
konkretisieren kann und daher nur oberflächlich universal erscheinen (Haus und
Leben im Hause, Reise und Verkehr usw.). Die oberflächlichen Universalia sind
zum Beispiel Festtage, wie etwa Weihnachten, das eine bestimmte Zeit im
Dezember benennt, aber dennoch bestehen Unterschiede zwischen Ländern. In
England feiert man anders als in Deutschland, da es unterschiedliche Sitten gibt.
Kekesi weißt daraufhin, dass Landeskunde nicht nur Faktenvermittlung bedeutet,
sondern wichtigere Ziele verfolgen soll, wie etwa Unterschiede zu akzeptieren
und auf sie eingehen können, auf Stereotype aufmerksam sein und sie
differenzieren usw. (Kekesi zit. nach Krechel 1989, 10).
Das allgemeine Ziel des Fremdsprachenunterrichts, die Kommunikationsfähigkeit,
ist auch landeskundlich, da die Schüler die Situation richtig einschätzen müssen,
um die Sprache einzusetzen. Durch die Kenntnisse sind Schüler fähig
Beziehungen zu erkennen und sie richtig zu verwenden; diese sind auch eine
Basis für die Kommunikation mit Anderen, ohne Informationsbeschaffung
(Erdmenger 1996, 45).
2.6 STEREOTYPE UND VORURTEILE
Bei der Arbeit mit landeskundlichem Inhalt, sei es im Unterricht oder im
Arbeitsalltag, stoßt man immer wieder auf Informationen, die sich als Wertungen
gegenüber Fremdgruppen entwickeln können. Dieses Unterkapitel befasst sich
deswegen mit der Klärung der Begriffe Stereotyp und Vorurteil.
10
Die Begriffe Stereotyp und Vorurteil lösen ohne weiteres bestimmte, eher
negative Kollokationen aus. Vor allem Stereotype sind ungenügend spezifiziert
und werden als abstrakte Vorstellungen, Lippmman definiert sie als „pictures in
our heads“, umschrieben (Ganter 1997, 2 zit. nach Lippmann 1922). Ganter
betonnt, dass Stereotype nicht der alltäglichen Bezeichnungen für
Generalisierungen und unerwünschte Auswirkungen auf soziales Verhalten
gleichen, was ein Problem der Begriffsbestimmung aufweist. Die letzten
Versuche einer Begriffserklärung sind deswegen zutreffender, weil sie abstrakter
und einfacher sind und Stereotype als eine Art subjektive Klasse der Meinungen
definieren. Stereotype sind aber auch Verallgemeinerungen über bestimmte
Zusammenhänge zwischen Personen und Attributen, die für alle Personen in
dieser Kategorie zugeordnet sind (Ganter 1997, 3).
Ähnliche Schwierigkeiten bei der Begriffsbestimmung bestehen auch bei dem
Begriff des Vorurteils. Dieser wird oft mit negativen, nicht der Realität
entsprechenden, ethnischen Urteilen verglichen. Nach Ganter sind Vorurteile eine
spezifische Variante von Einstellungen, die sich auf bestimmte Objekte (meist
Gruppen, oder die in die Gruppen zugeordneten Personen) beziehen. Die
Einstellungen sind negative oder auch positive Bewertungen, die auf Gefühlen
oder Meinungen über den Gegenstand beruhen (Ganter 1997, 21).
Sowie Stereotypen als auch Vorurteile sollten in dem Bildungsumfeld keinen
Platz finden, jedoch stellt sich die Frage inwiefern dies implizit passiert.
Stereotype und Vorurteile hängen von der Subjektivität des Autors und des Lesers
ab, deswegen kann man behaupten, dass sich diese auch in Lehrbüchern befinden.
2.7 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN SLOWENIEN
In dem Kapitel will ich erörtern, wie die Lernenden in Slowenien Deutsch
erlernen können, da es sich um ein Lernen im interkulturellen Kontext, ohne
richtigem Kontakt zur Zielsprache handelt. Alle Angaben sind aus dem
11
slowenischen Lehrplan (Učni načrt), erschienen beim zuständigen Ministerium,
entnommen.
Es gibt mehrere Gründe, warum Deutsch im slowenischsprachigen Raum gelehrt
und gelernt wird, einer der Wichtigsten mag wohl die Verbindung durch den
mitteleuropäischen Kulturraum sein. Slowenische Schüler lernen Deutsch in der
Grundschule von der vierten bis zur neunten Klasse; das ergibt 656 Stunden
Deutschunterricht. Deutsch wird in Slowenien nur als Fremdsprache unterrichtet,
wobei der Unterricht nach einem vorgeschriebenen Lehrplan verläuft. Die Ziele,
Zwecke und Auswirkungen werden mithilfe des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen festgelegt. In der Grundschule kann Deutsch
entweder als erste Fremdsprache (Pflichtfach) oder als zweite/dritte Fremdsprache
(Wahlfach) erlernt werden (Holc 2011).
An berufsbildenden Mittelschulen besteht die Möglichkeit Deutsch als erste, oder
zweite Fremdsprache zu wählen. An Gymnasien wird Deutsch ebenso als erste
oder zweite/dritte (entweder Fortgeschrittenenkurs oder Anfängerkurs)
Fremdsprache unterrichtet. Globale Ziele sind die Entwicklungen von Fähigkeiten
und Fähigkeit für interkulturelle und interlinguale Kommunikation (Holc 2008).
3 EMPIRISCHER TEIL
In dem zweiten Teil der vorliegenden Masterarbeit wird auf die Analyse der
ausgewählten Texte eingegangen. Das Ziel dieses Verfahrens ist es zu zeigen, wie
die landekundliche Lexik Informationen vermittelt, welche das sind und wie sich
die Informationen für verschiedene Sprachniveaus unterscheiden.
Die Analyse ist in unterschiedliche Themenbereiche, die in Lesetexten
angesprochen sind, gegliedert.
3.1 DAS UNTERSUCHUNGSMATERIAL
12
Das Lehrwerkband Optimal besteht aus drei Bänden: Optimal A1, Optimal A2 und
Optimal B1, die jeweils zum Sprachniveau A1, A2 und B1 führen. Die Lehrwerke
sind für Anfänger ab 16 Jahren geschrieben und orientieren sich an den
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Der Herausgeber (Klett Sprachen
2014) versichert, dass die „Lebenswirklichkeit von allen deutschsprachigen
Ländern“ thematisiert wird.
Ausgewählte Texte sind Lesetexte mit der Absicht die Lesefertigkeit zu erweitern
und globales Leseverstehen zu erzielen. Solche Texte eignen sich gut für die
Analyse, da sie meist länger als andere Texte in Lehrbüchern sind, und viele
landeskundliche Informationen beinhalten.
Die Entscheidung für die Analyse des Sammelbandes Optimal fiel aus dem
Grund, da das Band seine Verwendung an vielen slowenischen Mittelschulen
gefunden hat und eine Analyse daher nützlich für alle, die in diesem Kontext
Deutsch lernen und lehren sein könnte.
3.2 ÜBERBLICK DER LESETEXTE
Die Analyse befasst sich mit 34 Lesetexten. In der Tabelle sind diese knapp
zusammengefasst.
Tabelle 1: Überblick der Lesetexte
Lehrbuch Text Aktualität
Optimal A1 Adresse, Telefonnummer Veraltet
Tagesablauf – Arbeit – Freizeit Aktuell
Ein Tag in Essen Aktuell
Ferien an der Nordsee Aktuell
Die Rückfahrt Aktuell
13
Wohnen in Bern Aktuell
Freizeit Veraltet
Herbert Grönemeyer – Das
Comeback
Veraltet
Im Bistro Aktuell
Einkaufszentrum, Supermarkt,
Tante-Emma-Laden
Aktuell
Du musst zum Arzt Aktuell
Kleider machen Leute Aktuell
Optimal A2 Familien heute Aktuell
Von der Großfamilie zur
Kleinfamilie
Veraltet
Generationen Aktuell
Die Firma Rad-Rapid Veraltet
In die Fremde gehen Aktuell
Feste feiern Aktuell
Berliner Luft Aktuell
An der Mauer Aktuell
Potsdamer Platz Aktuell
In der Schule Aktuell
Optimal B1 Was mache ich, wenn… Aktuell
Bikulturelle Ehen und
Beziehungen
Aktuell
Arbeitsplatz Krankenhaus Aktuell
Wien Aktuell
Die lieben Nachbarn Aktuell
Die Alten-WG Aktuell
Macht Fernsehen glücklich? Aktuell
Erholung in der Stadt Aktuell
Joggen zu jeder Jahreszeit? Aktuell
Sonntagsfrühstück Aktuell
14
Esstraditionen Ade Aktuell
Modechronik Aktuell
3.3 KULTURSPEZIFISCHE MERKMALE
Die Kulturspezifik eines Volkes oder eines Landes ist im Lehrwerk Optimal
mehrere Male zu erkennen. Vor allem die deutsche Kultur wird vorgestellt, indem
die Lesetexte oft deutsche Personen im Vordergrund stellen.
3.3.1 SICH VORSTELLEN UND BEGRÜßEN
Beim ersten Lesetext ‚Adresse, Telefonnummer‘ (8) in Optimal A1 ist die
Begrüßung zwischen zwei Fremden vorgestellt. Im Beispiel treffen eine Deutsche
und ein Grieche aufeinander. Der Dialog verläuft wie folgt:
Guten Tag, ich bin Gertrud Steiner.
-Angenehm, ich heiße Jorgos Papadopoulos.
Woher kommen Sie, Herr Papadopoulos?
-Aus Patras.
Patras? Wo liegt das?
-Im Westen von Griechenland!
Aha.
-Und woher kommen Sie?
Aus Deutschland, ich wohne in Berlin.
Die Deutsche beantwortet die Frage, woher sie kommt mit „Aus Deutschland, ich
wohne in Berlin!“. Dieses Beispiel zeigt gleich zu Beginn des Kapitels, dass die
deutsche Hauptstadt wichtig ist und die Schüler gleich aufmerksam auf den Fakt
sie sei aus der Hauptstadt, Berlin, gemacht werden. Zu betonen ist die Tatsache,
dass der Grieche nicht aus der Hauptstadt kommt, sondern einer eher unbekannten
Stadt (Patras), was auch durch die Nachfrage der Deutschen wo die Stadt liegt,
15
einen deutlichen Unterschied darstellt. Der Grieche fragt nicht nach, wo Berlin
liegt, da es für ihn anscheinend keine wichtige Frage in dem Kontext darstellt.
Der Ausdruck „Angenehm“ sticht in Dialogen raus. Die Schüler sollen lernen, wie
man sich richtig vorstellt, wobei die Floskel benutzt werden sollte. Diese wird
aber in Deutschland und deutschsprachigen Ländern sehr selten benutzt. Der
Ausdruck ist formell, sehr höflich, doch nicht für ein Lehrbuch geeignet, da die
Information über seinen Gebrauch fehlt. Horst Hanisch schreibt, die Antworten
„Angenehm“ oder „Sehr Angenehm“ nach einer Vorstellung sind längst veraltet
(Hanisch 2011, 31). Solche Begrüßungen fanden ihren Gebrauch in formellen
Kreisen unter fremden Leuten, was den Lernprozess durch diese Information nicht
unbedingt interessanter macht und sollte eigentlich dazu geschrieben werden oder
gar ausgelassen.
Beim Lesetext mit der Comicfigur Werner, der dem deutschen Leser bekannt ist,
einem nicht-deutschen aber völlig fremd erscheint, stößt man auf die Begrüßung
„Guten Tach!“;
Guten Tach! Mein Name ist Werner. Ich bin eine Comicfigur. Ich komme
aus Kiel und wohne in Knöllerup. Kiel liegt im Norden von Deutschland,
in Schleswig-Holstein. Ich spreche Deutsch – Comicdeutsch.
Der regional gefärbte Ausdruck wird auch nicht näher erklärt oder von den
Anderen, vorher aufgelisteten Floskeln abgegrenzt, sondern dient als Begrüßung
des Comic-Helden. Diese Information beinhaltet kulturelle Merkmale, da es sich
um eine sprachliche Variation handelt, die man als Deutschlerner nicht versteht.
Außerdem gibt es auch keine Sprache, die Comic-Deutsch heißt, sondern eine
Fantasiesprache darstellt. Diese Sprache ist dennoch gar nicht mit dem Dialekt
verbunden, was in dem Fall für Verwirrung sorgt und könnte in dem Teil des
Lehrwerkes ausgelassen sein.
Im Lehrwerk Optimal B1, im zweiten Kapitel, das sich mit den Rechten der
Konsumenten und mit dem Wortschatz in Verbindung mit Verkauf und Mode
befasst, findet man im Lesetext ‚Was mache ich, wenn…‘, einem Dialog (19)
zwischen einer Verkäuferin und einer Kundin, interessante Floskeln.
16
Guten Tag. Sie wünschen?
-Ich möchte diese Jacke umtauschen.
Gefällt sie Ihnen nicht mehr?
-Doch, aber die Jacke hat einen Fehler.
Leider haben wir diese Jacke nicht mehr. Aber ich kann sie reparieren
lassen.
-Nein, ich möchte lieber mein Geld zurück.
Die Verkäuferin fängt an: „Guten Tag. Sie wünschen?“ und die Kundin setzt mit
„Ich möchte diese Jacke umtauschen.“ fort. Die Floskel, mit der die Verkäuferin
die Kundin anredet, ist laut Luise Lutz eine, die wir als Gesprächsteilnehmer in
der Situation erwarten. Mit dem Satz erkennen wir nämlich die Höflichkeit und
Respekt der Verkäuferin, die sie uns nicht zeigen würde, wenn sie mit „Hier bin
ich“ ansprechen würde (Lutz, 1996). Die Kundin zeigt mit ihrer Aussage, dass sie
nicht so respektvoll ist wie ihre Gesprächspartnerin. Das kann man beobachten, da
sie mit „ich möchte“ anfängt. Obwohl es sich um ein Modalverb handelt, das
Wünsche ausdruckt, fehlen jegliche Höflichkeitswörter, wie etwa bitte, bitte sehr
oder ähnliche. Auch auf die Anfrage der Verkäuferin, ob die Kundin was Anderes
nehmen möchte, antwortet die Kundin mit „Nein, ich möchte mein Geld zurück“.
Diese Äußerungen erscheinen sehr unhöflich, negativ der Verkäuferin entgegen.
Laut Canoo, ist die Hauptbedeutung vom Modalverb mögen die Äußerung von
Wünschen, deswegen erscheint das Verb im Konjunktiv II Präteritum (canoo.net).
Das heißt, die Kundin will mit ihrer missglückten Äußerung „ich möchte das Geld
zurück“ mitteilen, dass ihr Wünsch ist, das Geld zurück zu bekommen.
3.3.2 DER ALLTAG
Im Optimal A1 verfolgen wir im Text ‚Tagesablauf-Arbeit-Freizeit‘ (30) eine
junge Frau, die sich für ihren Arbeitstag vorbereitet und später ihre Freizeit
verbringt. Am frühen Morgen „duscht sie, dann holt sie die Zeitung und macht
17
das Frühstück. Sie kocht Wasser und macht Kaffee. Etwa um sieben Uhr
frühstückt sie. Sie isst Cornflakes und liest die Zeitung.“
Hier erkennt man schon erste kulturelle Merkmalle. Es ist immer noch häufig,
dass man in Deutschland seine Zeitung abholt. Tägliche Zeitungen werden
einfach vor die Haustür oder in den Briefkasten geworfen. Diese lesen die
Deutschen dann beim Frühstück. Weiter, viele arbeitstätige Deutsche reisen mit
der U-Bahn, doch was für eine Art von Bahn das ist, wissen viele ausländische
Lernenden, die diese selber in ihrem Land nicht haben, nicht. Laut der Definition
aus dem Duden ist die U-Bahn eine Kurzform für Untergrundbahn; eine Bahn, die
im Untergrund fährt. Im Lehrwerk ist diese Information mit einem Bild
verdeutlich, so dass man eine bessere Vorstellung hat.
Im Optimal A2 ist das Kapitel ‚Zusammen leben‘ (46) mit vielen kürzeren Texten.
Alle handeln über das Familienleben und den Alltag. Zuerst werden Lernende in
das Thema eingeleitet, indem sie drei sehr knappe Texte über Familie im
Lehrbuch haben. Diese drei Texte mit dem Titel ‚Familien heute‘ beinhalten aber
schon viele Begriffe, die zum Thema Familienleben passen und die schon im
Optimal A1 beinhaltet waren; z.B. Kinder, Babys, Haushalt, Beziehung.
Eine richtige Familie muss mehrere Kinder haben. Unsere vier Kinder
machen das Leben interessant, im jeden Alter: als Babys, in Kindergarten,
in der Schule oder im Beruf. Und Kinder brauchen Zeit. Es ist nicht immer
einfach mit vielen Kindern! Allen müssen im Haushalt mithelfen.
Der nächste Text (‚Von der Großfamilie zur Kleinfamilie‘) ist von der Wortwahl
her komplexer und anspruchsvoller, da es sich um eine Grafikerklärung handelt.
Die Begriffe darin sind dementsprechend anders, werden aber eingeführt, indem
der Text zuerst eine Beschreibung des Begriffes bietet und erst danach den Begriff
selbst;
Die Haushalte in den Deutschsprachigen Ländern haben sich stark
verändert. So gab es in der Schweiz vor etwa 50 Jahren mehr Haushalte
mit drei oder mehr Personen. Heute bestehen die meisten Haushalte nur
18
aus einer oder zwei Personen. In der Schweiz gibt es heute 36 Prozent
Einpersonenhaushalte, im Jahr 1960 waren es nur 14 Prozent.
Der Begriff Haushalt wird zuerst eingeführt, danach folgt die Beschreibung des
neuen Begriffes: die meisten Haushalte nur aus einer oder zwei Personen. Als
Letztes wird der neue Begriff verwendet: Einpersonenhaushalte. Dies ist ein guter
Weg neue Ausdrucke in einem Text einzuführen, vor allem wenn sich diese auf
schon vorhandenes Wissen anknüpfen.
Ähnliche Vorgehensweise bei der Einführung neuer Begriffe gibt es auch im
letzten Teil des Kapitels, mit dem Titel ‚Generationen‘, das aus zwei Perspektiven
geschrieben ist: einmal beschreibt ihre Familie die Tochter, einmal deren Mutter.
Somit wird die Familie aus der Perspektive zweier Generationen beschrieben. Das
hat auch einen Grund: so bekommen die Lernenden neuen Wortschatz vermittelt;
z.B. Schwiegertochter oder Enkel. Die Frau erzählt; Das ist die Frau von Max,
meine Schwiegertochter. So erschließen die Lernenden den Sinn von dem Wort –
die Frau von meinem Sohn ist meine Schwiegertochter.
Das Thema Alltag und Beziehungen findet man auch im Optimal B1, im Lesetext
‚Bikulturelle Ehen und Beziehungen‘ (48). Den Text kann man als einen Artikel
beschreiben, da er sehr viele Fakten und Zahlen auflistet, wie im folgenden
Abschnitt:
Mit der Globalisierung und der Migration nimmt die Zahl bikultureller
Partnerschaften ständig zu. In Deutschland sind 4% der Einheimischen
mit Ausländern verheiratet. In Frankreich ist jede fünfte Ehe bikulturell,
das sind 20%, und in der Schweiz sind es etwa 35%.
Der Text ist länger als andere bisherige Texte im Lehrwerk und beinhaltet viele
komplexe Wörter, die bisher noch nicht vorkamen, z.B. bikulturelle Beziehungen,
Wohlbefinden, Aufenthaltserlaubnis, usw. Das Hauptthema des Textes sind
bikulturelle Beziehungen. Der Ausdruck wird im Text mehrmals wiederholt, aber
auch mit anderen Wörtern beschrieben, dass die Lernenden den Begriff verstehen
können und sich merken. Der Ausdruck bikulturelle Partnerschaften kommt im
Text weiter unter folgenden Begriffen vor:
19
- In Deutschland sind 4% der Einheimischen mit Ausländern verheiratet.
- Bikulturelle Partnerschaften
- Fast jeder dritte Schweizer heiratet eine Ausländerin.
- Ehen, bei denen einer der Partner aus dem Ausland kommt.
An dem Beispiel kann man sehen, dass der Begriff zuerst erwähnt wird, danach
folgt eine kurze Erklärung (Einheimischer mit Ausländerin), Wiederholung,
wieder ein Satz mit der Bedeutung von bikultureller Partnerschaft, wobei der
Begriff nicht erwähnt wird und zum Schluss, eine vollständige Erklärung des
Begriffes. Dieses Verfahren ist wichtig für die Schüler, aber auch für andere Leser
eines komplexen Textes, weil der Begriff somit mehrmals, auch mit anderer
Wortwahl und Synonymen, erwähnt wird und in Erinnerung bleibt. Ähnlich wird
auch das Wort Heimweh erklärt. Es kommt zuerst im Text in folgendem Satz vor:
Gründe für Probleme sind vor allem Geld und Arbeit, Sprache und
Kommunikation, Heimweh und psychisches Wohlbefinden, aber auch Religion.
Nach ein paar Zeilen wird der Begriff erklärt: Viele Menschen, die in eine neue
Welt auswandern, denken oft an ihre Heimat und werden dabei traurig. Darauf
folgt noch einmal die Erwähnung des Begriffes: Gegen Heimweh hilft ein soziales
Netz mit neuen Freunden und Freundinnen.
Ein Begriff, das sich im Text ständig wiederholt ist Ausländer(n/in). Da dieser ein
erwarteter Begriff in dem Text ist, ist es verständlich und nachvollziehbar.
Überraschenderweise wird der Begriff mehrmals wiederholt und nur drei Mal
beschrieben, oder mit einen anderem Wort erwähnt:
- Person aus dem Ausland
- eine Person, die ihr Heimatland verlässt
- Menschen, die in eine neue Welt auswandern.
Dazu muss man sagen, dass die Bezeichnung Ausländer auch diskriminierend ist.
Duden Wörterbuch (duden.de) weist daraufhin, dass die Benennung für Personen,
die in demselben Land leben aber anderer Herkunft sind, als Diskrimination gilt.
20
Darauf muss man im Klassenzimmer besonders achten, leider auch deswegen,
weil die Definition laut des Textes fehlerhaft und vor allem, mangelhaft ist.
3.3.3 ARBEIT UND BERUF
Der Text ‚Die Firma Rad-Rapid‘ (54) ist im Optimal A2 zu finden und beschreibt
eine Fahrradkurierfirma und deren täglichen Verlauf. Wie schon der Titel des
Textes sagt, spricht der über die Firma Rad-Rapid. Der Begriff Firma zieht sich
durch den ganzen Text wie ein roter Faden, der aber an einer Stelle mit dem
Synonym Betrieb ersetzt wird. Weitere neue Begriffe werden vorgestellt, indem
die Eigentümerin der Firma ihren Alltag beschreibt:
Ich bin die Chefin. Ich organisiere die Arbeit, bin für das Telefon
verantwortlich und muss die Rechnungen schreiben. Ich organisiere und
Plane gern und spreche gern mit Mitarbeitern. Was ich nicht mag: mit
Behörden verhandeln, Rechnungen schreiben, Steuern bezahlen. Das
Spannende an der Arbeit ist, dass es immer andere Kunden und andere
Probleme gibt.
In dem kurzen Text erkennen die Lernenden, was ein Chef machen muss. So
lernen sie auch neuen Wortschatz, wie etwa Behörden und Steuern. Was die
Lernenden nicht mitgeteilt bekommen ist, was das bedeutet. Die Informationen
sagen ihnen nur, dass man mit Behörden verhandelt und dass man die Steuern
bezahlen muss. Daraus kann man aber keinen vollständigen Sinn ergeben und es
ist an der Tat so, dass der Lehrende diese Begriffe erklären muss.
Das achte Kapitel im Optimal A2 ist der Fremde gewidmet und beinhaltet einen
Text mit dem Titel ‚In die Fremde gehen‘ (62). Darin schildern ein Mexikaner
und eine Armenierin ihre Geschichte und Gründe, warum sie nach Deutschland
gehen:
Ernesto Rodriguez lebt in Mexiko, in einem Dorf in der Nähe von Puebla.
Er arbeitet bei VW Mexiko, in der Autofabrik. Einige Jahre hat er als
21
Schweißer gearbeitet. Aber das machen jetzt Maschinen. „Die Technik in
einer Autofabrik wird immer moderner, die Automatisierung geht immer
weiter. Es gibt immer weniger einfache Arbeiten“, sagt Ernesto Rodriguez.
Lilit Sarkisian ist aus Armenien, aus Jerewan. „Seit ich mich erinnern
kann, liebe ich Geschichten: armenische Geschichten, russische Märchen,
georgische Lieder. Darum wollte ich Sprachen lernen.“ […] Jetzt studiert
sie Sprachen und will für ein Jahr nach Deutschland. In einer Woche soll
sie fahren, und sie ist ein bisschen nervös. Denn das Visum ist noch nicht
da.
Wenn man über das Fremde spricht, muss man jedoch zuerst die Definition des
Begriffes aufklären. Duden Wörterbuch definiert als fremd „nicht dem eigenen
Land angehörend; im Sinne von Besitz einem anderem gehörend; ungewohnt und
unbekannt“ (duden.de). Nun hat jede Person in dem Text eigene Vorstellungen
von Fremde. Der Mexikaner fährt nach Deutschland, um einen
Weiterbildungskurs bei VW zu machen und die Armenierin, um eine Arbeit zu
finden. Der Mexikaner findet die automatisierten Maschinen und die deutsche
Sprache fremd, während die Armenierin die Bürokratie und den Papierkram als
ungewohnt bezeichnet. In dem Text kann man aber auch über landeskundliche
Merkmale sprechen, weil sie besonders in dem ersten Teil vorkommen.
Der Mexikaner in unserem Text arbeitet bei VW in Mexiko und muss deswegen
nach Deutschland in die Autofabrik. Das typisch Deutsche ist hier aber implizit
ausgedrückt, weil das Auto und sogar VW deutsche Merkmale sind. Deutsche
identifizieren sich gerne mit ihren Autos und ihren Landesmarken, so wie
Volkswagen (VW). In einer Umfrage (Drösser 2015) äußerten sich deutsche über
typisch deutsche Sachen, in der die Mehrheit der Befragten (63%) meint, dass
Volkswagen für Deutschland steht; mehr als Goethe oder die Kanzlerin. Diese
Information wäre auch eine gute Motivation für einen Einstieg in die Arbeit mit
dem Lesetext, da dadurch viele interessante Aspekte der deutschen vermittelt
werden und die Lernenden ohnehin schon was über die Deutschen wissen und
damit ihr Wissen anknüpfen könnten.
22
Im Optimal B1 ist ein Lesetext mit dem Titel ‚Arbeitsplatz Krankenhaus‘ (86),
dessen Ziel ist es die Lernenden dazu zu bewegen, über einen Arbeitsplatz zu
sprechen und einen Arbeitsplatz zu beschreiben. Eine Mitarbeiterin im
Krankenhaus berichtet über ihren Arbeitsplatz und ihren Aufgaben:
Ich arbeite auf Station A, in der chirurgischen Abteilung. Wir betreuen
vierzig Patienten rund um die Uhr, in drei Schichten. Der Frühdienst
beginnt um 6 Uhr und endet um 14 Uhr. Der Spätdienst dauert von 12 Uhr
mittags bis 20 Uhr 30 und der Nachtdienst dauert von 20 Uhr bis 6 Uhr
30. Meine Aufgaben sind sehr unterschiedlich und abhängig von meinem
Dienst. Der Frühdienst sieht zum Beispiel so aus: Ich wecke die Patienten
um 6 Uhr 30, einigen helfe ich beim Waschen und um 7 Uhr gibt es
Frühstück. Anschließend räume ich ab und mache die Betten. Dann messe
ich Fieber und den Puls, erneuere Verbände und gebe Medikamente.
Andere Patienten bereite ich für die Operation vor. Jeden Vormittag ist
Visite, aber daran brauche ich nicht teilzunehmen.
Wie erwartet enthält der Text Wortschatz rund ums Thema Krankenhaus;
chirurgische Abteilung, Patienten, Fieber, Puls, Verbände, Medikamente,
Operation, Visite, Therapie, Röntgen, Stationsschwester, Oberarzt usw. Diese
Begriffe werden an die bisher genannten Begriffe und Wortschatz aus Optimal A1
angeknüpft und erweitert. So können die Lernenden ihr Wortschatz, der bisher
eingeschränkt war und mit Basis Begriffen geprägt war (mein Hals tut weh), jetzt
erweitern, indem ihnen der Text darstellt, dass man Fieber messt, Verbände
erneuert usw.; Dann messe ich Fieber und den Puls, erneuere Verbände und gebe
Medikamente. Anhand dessen werden die Grundbegriffe mit einem Verb
verbunden, so dass die Lernenden lernen, welche Verben zum Substantiv passen.
3.3.4 FESTE UND FEIERLICHKEITEN
23
Der Text ‚Feste feiern‘ (88) aus Optimal A2 befasst sich mit Festen und wie diese
in Deutschland gefeiert werden. Beschrieben sind drei Feste; Weihnachten, Ostern
und Neujahr. Weihnachten wird folgenderweise beschrieben:
In vielen Familien schmückt man einen Tannenbaum mit bunten Kugeln
und Lichtern. Am Heiligabend, am 24. Dezember ist das Weihnachtsfest.
In vielen Regionen werden Weihnachtslieder gesungen. Unter dem
Weihnachtsbaum liegen die Geschenke für Kinder und Erwachsene. […]
Aus dem Text kann man herauslesen, wie der Tannenbaum geschmückt wird, und
später die Rede vom Weihnachtsbaum ist. Tannenbaum und Weihnachtsbaum
sind Synonyme und benennen den gleichen Baum, den man an Weihnachten mit
Kugeln schmückt. Beide Begriffe sind im deutschen Sprachraum in Gebrauch und
wahrscheinlich deswegen im Text angeführt, damit die Lernenden beide Begriffe
kennenlernen. Weiter steht es im Text:
In vielen Familien geht man am frühen Abend oder um Mitternacht in die
Kirche. An den Weihnachtsfeiertagen (25. / 26.12) gibt es ein Festessen.
Verwandte und Bekannte besuchen sich. Am Nachmittag zum Kaffee gibt
es oft Weihnachtsgebäck. Mit diesem Fest feiern die Christen die Geburt
von Jesus. Die Leute wünschen sich „Frohe Weihnachten!“
Daraus kann man die deutschen Bräuche zum Weihnachten erkennen. Diese sind
ähnlich wie die Slowenischen; die Leute gehen in die Kirche, essen
Weihnachtsgebäck und feiern. Interessant ist der Gebrauch von Komposita mit
dem Erstglied Weinacht-; Weihnachtsgebäck, Weihnachtsfeiertag,
Weihnachtsfest, Weihnachtslieder. Diese Nomen sind Zusammensetzungen und
wahrscheinlich für Lernende schwieriger und komplexer. Deswegen findet man
diese auch in dem Lesetext, der ganz zum Schluss des Lehrbuches vorkommt, wo
man davon ausgeht, dass die Lernenden fähig sind, solche Wörter zu verstehen
oder einen Sinn daraus zu ziehen.
Was man noch im Zusammenhang mit Weihnachten erwähnen könnte, das aber
nicht im Text steht, wären die Weihnachtsmärkte. Die sind in deutschsprachigen
Raum sehr häufig und populär, man kennt sie aber mittlerweile auch in
24
Slowenien. Weihnachtsmärkte sind die gesellige Art Weihnachten zu feiern und
diese ist den Lernenden am nächsten.
Der Text handelt weiter von Ostern:
Ostern wird am Frühlingsanfang Ende März oder Anfang April gefeiert.
Am Ostersonntag verstecken die Eltern bunte Eier und Süßigkeiten im
Haus oder im Garten, die die Kinder dann suchen dürfen. In vielen
Wohnungen steht ein Strauß mit den ersten grünen Zweigen. Mittags isst
man in vielen Familien das traditionelle Osteressen: Lamm. Mit dem
Osterfest endet die Fastenzeit. Die Christen feiern die Auferstehung von
Jesus Christus. In vielen Gemeinden brennt in der Osternacht vor der
Kirche ein großes Feuer, das Osterfeuer. Man wünscht sich „Frohe
Ostern!“
In dem Text erkennt man kulturspezifische Merkmale. Das Verstecken von Eiern
kennt man in Slowenien nicht. In Deutschlang hingegen hat diese Tradition eine
lange Geschichte. Krüskemper (2015) berichtet, dass Kinder mit viel Freude die
versteckten Eier und Neste mit Geschenken suchen. Danach folgt am
Frühstückstisch das Spiel, das unter verschiedenen Namen bekannt ist (Ostereier-
Ticken, Ostereier-Düpfen, usw.), indem man zwei hart gekochte Eier aneinander
schlägt – der Gewinner ist derjenige, deren Ei nicht kaputt geht.
Ein weiteres kulturspezifisches Merkmal ist das Osterfeuer. So wie im Text schon
geschrieben, brennt dieses vor der Kirche. Der Ursprung dieser Tradition, so
Döring (2006, 104), ist unklar. Fakt ist, dass sich an dem Osterfeuer sowie
Christen als auch Nichtchristen versammeln. Das Osterfeuer ist zu einer
fröhlichen Gelegenheit, die meist von verschiedenen Vereinen organisiert wird,
geworden.
Der letzte Teil vom Lesetext beschreibt das Neujahr. Dieses Fest ähnelt am
meisten zu den slowenischen Bräuchen am Neujahr und enthält keine
landestypischen Merkmale, die sich von den slowenischen unterscheiden. Neujahr
wird auch mit dem Synonym Silvester benannt, sodass die Lernenden auch den
Ausdruck kennenlernen.
25
3.3.5 REISEN
Im Optimal A1, Kapitel ‚Ein Tag in Essen‘ (16), gibt es ein Dialog zwischen zwei
Freundinnen, die ihre Pläne in der Stadt besprechen. Der Dialog geht so:
-Hast du morgen Zeit, Beatrix?
Nicht viel. Nur zwei Stunden. Wir gehen zuerst in die Altstadt. Dort siehst
du das Münster, das ist sehr alt. Und die alte Synagoge. Die ist sehr
bekannt.
Das Adjektiv ‚alt‘ wiederholt sich in den kurzen Dialog gleich zwei Mal. Obwohl
die Sprecherin bereits von der Altstadt spricht, die eine Komposition ist;
zusammengesetzt aus dem Adjektiv alt + dem Nomen Stadt, was die Bedeutung
von ‚dem alten Teil der Stadt‘ trägt, betont sie, dass das Münster und die
Synagoge sehr alt sind. Hierbei ist das Ziel des Wiederholens wahrscheinlich,
dass die Lernenden über Eigenschaftswörter (d.h. Adjektive) mehr erfahren und
diese lernen.
Auch im Kapitel Reisen im Optimal A1 findet man einen Text (‚Ferien an der
Nordsee‘, 54), der vorwiegend durch den Gebrauch von Adjektiven ins Auge
sticht. Die Verfasserin des Textes schreibt über ihre Erlebnisse im Urlaub an der
Nordsee:
Samstag, 7. Juni
Allein in St. Peter-Ording – allein! Ich bin mit dem Zug gereist, fast 7
Stunden. In Hamburg am Bahnhof habe ich zwei Stunden auf Robert
gewartet. Ich habe ihn überall gesucht, aber ich habe ihn nicht gesehen –
oder er hat mich nicht gesehen. Ich habe zwei SMS geschickt – aber er hat
nicht geantwortet. Ich bin dann allein weiter nach St. Peter-Ording
gefahren. Wir haben hier ein Hotel am Meer gebucht. Es ist sehr
gemütlich und die Aussicht ist phantastisch! Der Himmel und das Meer
26
sind entlos weit. Am Abend habe ich mit Robert telefoniert. Er ist immer
noch in München. Stau! Er ist zu spät zum Flughafen gekommen. Schade.
Sie berichtet sehr detailliert und verwendet Eigenschaftswörter, wie etwa
gemütlich, phantastisch, endlos weit, berühmt, endlos, lecker, schön. Das Adjektiv
phantastisch wird laut Duden nun mehr als ‚fantastisch‘ geschrieben, obwohl die
Alternativvariante, wie oben, auch noch vorkommen kann. Da die
Veröffentlichung des Optimal A1 nicht mehr als elf Jahre zurückliegt, würde man
dennoch erwarten, dass die Autoren die von Duden empfohlene Schreibung
beibehalten und im Lehrwerk stellen. Vor allem deswegen, da es sich um ein
Lehrwerk handelt, dass laut dem Verlag aktuell sei. Die benutzten Adjektive
werden alle in deutschen Texten recht häufig gebraucht und die Lernenden
bekommen somit die Basis wie man über einen Urlaub berichtet und welche
Wörter bei so einem Thema häufig vorkommen.
Es folgt ein kurzer Text (‚Die Rückfahrt‘, 56), eher Dialog zweier Frauen, die sich
im Zug begegnen:
-Entschuldigung, ist hier noch frei?
Ja bitte. Ich nehme die Tasche weg.
-Nein, bitte lassen Sie sie da.
Kann ich Ihnen helfen?
-Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Darf man hier rauchen?
Nein, hier ist Nichtraucher. Gehen Sie doch ins Bistro…
Die Lernenden werden mit einer alltäglichen Situation konfrontiert und sehen, wie
man auf andere Passagiere im Zug zugeht und Hilfe anbietet. Ein Problem könnte
das Substantiv ‚Nichtraucher‘ darstellen. Als Lernender der Stufe A1 würde man
wahrscheinlich nicht ganz verstehen, was man mit Nichtraucher bezeichnet.
Logischerweise könnte ein Lernender den Sinn daraus erschließen, dass es eine
Antwort auf die Frage, ob man hier rauchen kann, ist. Aber, Nichtraucher
(duden.de) hat mehr als nur eine Bedeutung; eine Person, die nicht raucht, und
einen Nichtraucherabteil. In unserem Fall benennt es das Letzte, einen Abteil im
27
Zug, in dem Rauchen nicht erlaubt ist. Nichtraucher ist eine Kurzform und wird
umgangssprachlich verwendet. Daher ist es ein Begriff, auf das man näher
eingehen könnte, um den Lernenden ein richtiges Bild zu schildern.
Der zweite Dialog sieht folgendermaßen aus (56):
-Die Fahrkarten bitte!
Hier bitte.
-Darf ich bitte die Bahncard sehen?
Moment mal, wo – in Hamburg habe ich die Fahrkarte gekauft, da habe
ich sie noch gehabt. Ah, hier!
-Danke, und gute Reise!
Entschuldigen Sie, ich habe eben die Durchsage gehört…
Der Dialog zeigt eine sehr häufig vorkommende Situation, auch in jenem Land, in
dem die Leute Bahn fahren. Somit kann man behaupten, die Lernenden können
sich mit den Passagieren identifizieren und ihre eigenen Erfahrungen in der
Verbindung mit dem Dialog schildern. Ein Begriff ist jedoch landeskundlich
bedingt und begrenzt sich an Deutschland – ‚Bahncard‘. Aus der Schreibweise
kann man erkennen, dass es sich um eine Art der Fahrkarte der Bahn handelt,
doch was genau das sein soll, weiß man dadurch noch nicht. So ist es auch hier
erforderlich, den Lernenden mehr über den Reisestill der Deutschen zu schildern.
Die BahnCard ist eine Art Fahrkarte der Deutschen Bahn, mit der man
verschiedene Vorteile und Ermäßigungen genießen kann. Auf der BahnCard ist
ein Lichtbild der Person, die der Träger der Karte ist und daher einen Ausweis
ähnlich ist (Bahn.de). Empfehlenswert wäre es diese Information mit einem Foto
zu unterstützen, um das Interesse der Lernenden zu steigern oder sogar mit
Realien zu arbeiten; eine echte BahnCard mit in die Klasse zu bringen.
Im Optimal A2 ist ein längerer Text mit dem Titel ‚Berliner Luft‘ (38), der über
Berlin handelt zu finden. Ein Paar besichtigt Berlin als Touristen und sieht sich
die Sehenswürdigkeiten an. Der Text ist als ein Dialog zwischen den beiden
28
aufgebaut und enthält viele Fotos aus Berlin. Der Text beinhaltet viele Begriffe
zum Thema Reisen, die die Lernende schon mit Hilfe von Optimal A1 erworben
haben, z.B. Hauptstadt, Sehenswürdigkeiten, Innenstadt, Stadtzentrum, Stadtplan
usw. Im Gegensatz zum Text im Optimal A1, ist dieser Text mit vielen
umgangssprachlichen Ausdrucken geprägt und beinhaltet Informationen über
Berlin, die man aus dem Kontext auslesen muss, um den Sinn zu verstehen.
Vielleicht genau deswegen ist ein kleiner Stadtplan abgebildet, so dass die Leser
verstehen, was die zwei meinen, wenn sie sprechen. Ein kurzes Beispiel wie folgt:
-Was machen wir jetzt?
Erst mal eine Pause! Bitte denk an meine Füße. Wir sind bestimmt schon
50 Kilometer gelaufen.
-Quatsch! Wir waren erst am Brandenburger Tor und jetzt am Hackeschen
Markt…
..und auf dem Reichstag. Erinnerst du dich?
-Tja, mein Schatz. Berlin ist eben größer als Konstanz. Wir können eine
Stadtrundfahrt machen. Oder hast du Lust auf eine Bootsfahrt? Auf der
Spree kann man durch das alte Stadtzentrum fahren.
Ich weiß nicht. Gehen wir lieber ins Museum.
-In welches?
Ich schau mal im Stadtplan. Die Museumsinsel ist ganz in der Nähe. Die
liegt gleich neben dem Hackeschen Markt.
-Und was gibt es da?
Da sind mehrere Museen. Oder wir gehen ins historische Museum.
-Mir ist es egal. Was magst du?
Dich und Berliner Luft!
Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft,
so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft…
Ein umgangssprachlicher Ausdruck aus diesem Abschnitt des Textes ist mein
Schatz. Diesen Ausdruck benutzt man umgangssprachlich für einen geliebten
Menschen, jemanden der uns sehr nahe ist. Dieser Ausdruck wird häufig
29
gebraucht, deswegen benötigt er nähere Erläuterung des Lehrenden, wie auch der
Ausdruck Quatsch. Der ist, laut Duden (duden.de) auch häufig im Gebrauch,
benennt was abwertendes, Blödsinn.
Umgangssprachliche Ausdrucke wie z.B. mein Schatz sind im Text integriert mit
der Absicht die Lernenden über diesen Sprachstil zu informieren, und zwar in
Texten, die ein Dialog enthalten, da es sich um eine täglich verwendete Sprache
handelt, die aber anders ist als Standardsprache.
Ein kulturelles Merkmal in dem Text ist das Zitat am Schluss - Das ist die
Berliner Luft, Luft, Luft, so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft…Ein unwissender
Leser oder Lernender wird nicht wissen, um was es sich genau handelt, deswegen
ist es mehr als nötig, diese zwei Zeilen näher zu erläutern.
Die zwei Zeilen stammen aus dem berühmten Marsch ‚Berliner Luft‘, der in der
Operette ‚Frau Luna‘ aus dem Jahr 1899 zu hören war. Das Lied schrieb Paul
Lincke, und gilt als die muntere Hymne von Berlin (Funken 2011).
Die beiden nächsten Teile des Textes ‚An der Mauer‘ (39) und ‚Potsdamer Platz‘
(40) erzählen die Geschichte von Berlin und der DDR. Im Text ‚An der Mauer‘
erfahren wir vieles über die Berliner Mauer, in der Form eines Dialoges zwischen
den beiden Touristen und einem Einheimischen:
-Sind das hier Reste von der Berliner Mauer?
Ja, genau! Sehen Sie die Linie auf der Straße? Hier war die Mauer und
hat Berlin in Ost und West geteilt.
-Habe ich Sie richtig verstanden, die Mauer hat die ganze Stadt geteilt?
Ja, fast dreißig Jahre, von 1961 bis 1989. Die Mauereröffnung am 9.
November 1989 war für uns DDR-Bürger wie ein Wunder.
Der Text ‚Potsdamer Platz‘ ist wie eine Orts-Beschreibung geschrieben:
Am Potsdamer Platz war die erste Verkehrsampel Deutschlands. Nach
dem Zweiten Weltkrieg war die ganze Gegend zerstört. Die Sieger
England, Frankreich, USA und die Sowjetunion teilten Berlin in vier Teile.
Seit der Gründung der Bundesrepublik und der DDR gab es in
Deutschland zwei Staaten. Weil viele DDR-Bürger in den Westen flohen,
30
baute die DDR-Regierung eine Mauer um Westberlin. Die Mauer teilte
auch den Potsdamer Platz. Im Westen konnte man von einem Turm über
die Mauer in den Osten sehen.
Wie zum Thema passend, enthalten die zwei Texte viele landeskundliche
Informationen, die besser zum Fach Geschichte passen würden, doch es ist mehr
als angemessen, dass die Lernenden bei Deutsch auch über die Geschichte des
Landes lernen. Der Wortschatz im Text ist landeskundlich, d.h. Begriffe wie z.B.
Berliner Mauer, Mauereröffnung, Bundesrepublik, DDR, Westberlin,
Wiedervereinigung sind erwartete Begriffe im thematischen Feld der deutschen
Geschichte. Diese ist ein wichtiges Thema zum Ansprechen, da es sich bei den
Lernenden, für die dieses Lehrwerk geschrieben ist, um junge Leute handelt, die
meist noch nicht geboren wurden, als die Mauer fiel.
3.3.6 WOHNEN
Das Kapitel acht im Optimal A1 beinhaltet einen Lesetext mit dem Titel ‚Wohnen
in Bern‘ (63). Der besteht aus vier Abschnitten und beschreibt den Wohnstil der
Einwohner in Bern, z.B.:
Ella Z. ist in Girona in Spanien geboren. Sie ist mit zwölf Jahren in die
Schweiz gekommen. Ella Z. hat drei Jahre in Bern gewohnt. Sie hatte eine
Wohnung im Zentrum. Dort hat sie viel Miete bezahlt. Früher war sie ein
Stadtmensch. Sie ist oft ausgegangen. Heute wohnt sie auf dem Land, in
einem Bauernhaus, und hat gerne Ruhe…
Wenn man sich die Lexik in dem Lesetext ansieht, kann man schnell erkennen,
dass es sich um erwarteten Wortschatz in dem thematischen Feld handelt;
Altstadt, Hauptstadt, Wohnung im Zentrum, Miete, Bauernhaus, Wohnblock,
Einzimmerwohnung, Stadtrand, Siedlung usw. Somit lernen die Schüler neuen
Wortschatz zum Thema Wohnen im Kontext, was für einen Lesetext das
Wichtigste ist.
31
Über Wohnen handelt auch der Text ‚Wien‘ (39) im gleichbenanntem Kapitel im
Optimal B1. Eine Einwohnerin erzählt über ihren Wohnort, dabei erwähnt sie
sowohl die Vorteile als auch die Nachteile Wiens;
Wien ist eine ideale Stadt für mich: es ist schön, hier zu leben, und so
zentral in Europa. Ich liebe Theater und Tanz, und da gibt es ein großes
Angebot und auch tolle Festivals. Wien ist aber auch sehr angenehm wenn
ich an den Alltag denke. Der öffentliche Verkehr ist bequem und sicher,
deshalb kann meine Tochter allein mit der U-Bahn zur Schule fahren.
Darauf ist sie auch sehr stolz. Aber die Geschäfte schließen am Abend viel
zu früh und sind am Sonntag geschlossen.
Dieser Text erweitert den Wortschatz zum Thema Wohnen. Im Vergleich zum
Optimal A1 bietet er den Lernenden ein breites Spektrum an Begriffen, die man
täglich verwendet, wenn man über eine Stadt und Wohnen spricht.
Der zweite Teil des Textes spricht über die Wiener Kultur aus der Sicht derselben
Frau. Sie beschreibt ihre zwei Lieblingscafés. Zum ersten sagt sie: „Es ist ein
Kaffeehaus für alle, die Kaffeehäuser lieben. Die Besucher nehmen sich Zeit und
genießen diesen kleinen Luxus. Die Zeitungen sind international, die Ober sind
charmant, wenn sie wollen. Der Kaffee ist ausgezeichnet, die Mehlspeisen auch.
Im Extrazimmer spielen ältere Damen Bridge.“
Der Text enthält viele landeskundliche Informationen über die österreichische
Hauptstadt. Vor allem, was man in einem Kaffeehaus macht und wie es dort
aussieht. Sie spricht von den Obern, was ein veraltetes Wort für Kellner ist, den
man aber noch heute in Österreich, besonders in Kaffeehäusern in Wien,
verwendet. Ein weiteres Wort, das typisch österreichisch ist, ist Mehlspeise.
Österreicher benennen damit Süßspeisen, Nachtischgerichte, auch ohne Mehl
vorbereitete Süßspeisen.
Auch später im Optimal B1 hat das Thema Wohnen ihren Platz gefunden. Der
Lesetext ‚Die lieben Nachbarn‘ (98) besteht aus drei verschiedenen Erzählungen
32
der Bewohner eines Wohnblocks, die alle ihre Nachbarn beschreiben. Ein kurzes
Beispiel:
Endlich eingezogen! Obwohl mir mal jemand gesagt hat: „Wenn du eine
Wohnung suchst, sieh dir zuerst die Nachbarn an“, habe ich einfach die
Wohnung hier im ersten Stock genommen, ohne viel nachzudenken. Wenn
ich noch länger gesucht hätte, hätte ich vielleicht eine Wohnung mit einer
größeren Küche gefunden. Das ist wichtig für mich. Aber diese Wohnung
ist günstig. Die Nachbarn kenne ich noch nicht, aber der ältere Mann von
nebenan, der scheint ganz sympathisch zu sein.
Der Wortschatz besteht meist aus Substantiven, wie zum Beispiel Wohnung,
Küche, erster Stock, Balkon, Haustür, Stadtrand, Einfamilienhaussiedlung. Was
auffällt, sind die Komposita: Stadtrand, Haustür, Einfamilienhaussiedlung. Diese
Wörter sind oft gebrauchte Begriffe zum Thema Wohnen, deswegen sind sie nicht
fehl am Platz. Da es sich aber um Komposita handelt, wäre es gut diese Begriffe
zu erklären oder beschreiben, da der Text wieder keine Erklärungen bietet.
Der nächste Text ‚Die Alten-WG‘ (100) ist ein Bericht über eine
Wohngemeinschaft zwischen älteren Frauen. Auch dieser Text enthält viele
Begriffe zum Thema Wohnen, wie zum Beispiel:
Eine alte Villa in Göttingen, elf Frauen zwischen 65 und 91 Jahren und ein
mutiges Projekt: die Alten-WG, in der die Frauen als Untermieterin für
sich und alles andere selbst verantwortlich sind. jede beginnt den Tag
wann sie möchte und wie sie möchte. Feste Zeiten gibt es nicht in dieser
WG. „Die WG ist ein lebendiges Wesen“ sagen die Frauen.
Man kann beobachten, dass die Abkürzung WG wiederholt wird und später auch
erklärt (mehrere Frauen als Untermieterin). Eine Erläuterung der Abkürzung gibt
es im Text nicht. Auch wenn die Lernenden die obere Erklärung lesen, können sie
eine falsche Definition rauslesen, denn eine WG ist nicht nur unter Frauen
möglich, sondern zwischen beiden Geschlechtern, ebenso wie zwischen
verschiedenen Altersgruppen.
33
Jede Frau hat eine Aufgabe, so dass alle Verantwortung übernehmen. Eine
ist für den Garten verantwortlich, eine für die WG-Kasse aus der
Beispielsweise die gemeinsame Putzfrau bezahlt wird. Eine kümmert sich
um die zwei kleinen Gästewohnungen, die an Verwandte vermietet werden.
Eine ist für das Schließen von Fenstern und Türen zuständig. „Die kleinen
Pflichten sind das Rückgrat der WG“, sagt Waltraud Klar, und sie
zwingen jede Einzelne Bewohnerin sich nicht hängen zu lassen.
An dem Beispiel sieht man, dass wieder der Wortschatz zum Thema Wohnen
erweitert wird (Gästewohnungen, vermietet, Bewohnerin, Garten). Zudem findet
man auch ein Verb, dass oft im Gebrauch ist und als eine Redensart bekannt ist:
sich nicht hängen lassen. Laut Duden bedeutet sich hängen lassen die
Selbstdisziplin zu verlieren, sich gehen lassen (duden.de).
3.3.7 FREIZEIT
Ein kurzer Text (‚Freizeit‘, 32) über der Freizeit von Sara ist im Kapitel vier aus
Optimal A1 zu finden. Sara geht ins Berliner Tiergarten und der Text handelt über
ihren Eindruck. Im Vordergrund stehen die Freizeitaktivitäten der Leute;
„Sie essen und trinken, sie diskutieren und lachen. Viele machen Sport: Sie
joggen oder spielen Fußball. Eine Gruppe macht Yoga und da vorne ist
ein Konzert. Da links liest eine Frau ein Buch, und da rechts schläft ein
Mann.“
Aus dem Text kann man erschließen, dass die Deutschen ein sportliches Volk sind
und gerne Fußball spielen. Das wäre wahrscheinlich der erste Eindruck für die
Lernenden. Synonyme und erste Assoziationen zum Thema Freizeit im
Deutschland sind auch mit Fußball verbunden. Doch in dem Text will uns die
Verfasserin auch über andere Aktivitäten berichten, die im Park geschehen, wie
etwa Bücher lesen, schlafen und essen und trinken. Für slowenischen Lernenden
ist es nicht gewohnt, dass man im Park essen und trinken kann, vor allem nicht in
diesem Ausmaß wie in Deutschland. Für die Deutschen ist es nämlich üblich, dass
34
sie in öffentlichen Parks grillen dürfen. Deswegen verbinden Deutsche mit dem
Begriff Park auch essen und trinken.
Im dritten Kapitel des Lehrwerkes Optimal A1 ist das Hauptthema Musik. Ein
kurzer Zeitungsartikel (‚Herbert Grönemeyer – Das Comeback‘) spricht über den
Musiker Herbert Grönemeyer (25):
Nach einer langen Pause ist der Rocksänger Herbert Grönemeyer endlich
wieder auf Tour. Er gibt im November Konzerte in Deutschland und in der
Schweiz. Grönemeyer geht mit seiner Platte „Mensch“ auf Tour. Er sagt:
„Die Platte ist traurig, aber auch optimistisch“. Grönemeyer ist sehr
bekannt, nicht nur in Deutschland: mit elf Millionen Platten ist er ein Star.
Man kann feststellen, dass im Text viele themagebundene Begriffe vorkommen,
z.B. auf Tour gehen, Fans, Platte, Comeback. Es fällt auf, dass diese Begriffe aus
dem Englischen kommen, und häufig im Gebrauch sind. Man kann davon
ausgehen, dass die Mehrheit der Lernenden diese Wörter ohne weiteres verstehen
würde, obwohl man auch deutsche Varianten dazu schildern kann. Ein Comeback
kann als die Rückkehr beschrieben werden, und Fans sind die Anhänger des
Musikers.
Im Optimal B1 ist ein ganzes Kapitel dem Glück gewidmet. Der Text ‚Macht
Fernsehen glücklich? ‘ (70) ist ein kurzer Artikel, der die wesentlichen Ergebnisse
aus einer Umfrage zusammenfasst:
Die Studie Television verfolgt seit mehreren Jahren den Fernsehkonsum
sowohl in Europa als auch in den USA. Ein wichtiges Resultat: Generell
nimmt der Fernsehkonsum zu.
Der Text ist auch mit einem Fernsehprogramm visuell unterstützt, sodass die
Lernenden auch ein Eindruck davon bekommen, welche Sendungen in deutschem
Fernsehen laufen. Im Text kommt der Ausdruck Fernsehkonsum am häufigsten
vor; entweder wird er mehrmals wiederholt oder anders ausgedrückt, wie zum
Beispiel mit den Sätzen vor dem Fernseher sitzen / Zeit vor dem Fernseher zu
verbringen. Aus dem kurzen Text erfahren die Lernenden, wie hoch der
Fernsehkonsum der Deutschen, Österreicher und der Schweizer ist. Neben dieser
35
Information können sie aber auch eigene Meinungen darüber äußern und lernen,
wie man Informationen vergleicht. Im Text findet man nämlich viele Vergleiche,
die wie folgt ausgedrückt sind:
Dass ‚Kinder nur noch vor dem Fernseher sitzen‘, bestätigt die Studie
nicht. Österreichische Kinder unter 14 sitzen täglich 81 Minuten vor dem
Fernseher, deutlich kürzer als die Erwachsenen. auch im Europavergleich
zählen die österreichischen Kinder zu den Wenigsehern: In Westeuropa
liegt der tägliche Fernsehkonsum der Kinder bei 128 Minuten, in
Osteuropa sogar bei 158 Minuten.
Der Text ‚Erholung in der Stadt‘ (106), auch aus Optimal B1, besteht aus
Aussagen drei Deutschen über ihre Erholungsstrategien. Jeder hat seine eigene
Vorstellung von Erholung. Die erste Frau sagt, sie erholt sich im Garten:
Im Frühling warte ich immer schon ungeduldig bis ich beginnen kann.
Pflanzen einsetzen und pflegen, gießen und dann natürlich ernten. Im
Garten kann ich am besten abschalten und entspannen.
Die zweite Gefragte berichtet so:
Ich fahre lieber mit der Familie mit dem Fahrrad in den Rheinpark und
kann dort laufen oder spazieren gehen, faulenzen, in der Sonne liegen und
lesen oder schlafen oder auf den Rheinterrassen im Biergarten einkehren.
Die dritte Person sagt:
Ich spiele zweimal pro Woche Volleyball. Wenn ich müde bin oder glaube,
dass ich keine Zeit habe, dann gehe ich trotzdem hin, weil wir mindestens
zwölf Leute sein müssen. Sonst macht das Spielen keinen Spaß.
Daraus kann man den Entschluss ziehen, dass die deutschen sowohl sportlich als
auch naturbewusst sind. Laut den Texten joggen sehr viele Deutsche und
verbringen ihre Freizeit im Park. Die wichtigsten Bezeichnungen zum Thema
Freizeit aus dem Text sind daher: abschalten, entspannen, faulenzen, Spielen,
laufen. Die Wörter laufen, Spielen, entspannen werden den Lernenden
wahrscheinlich schon bekannt sein, da sie ähnlich klingen wie die slowenischen
Begriffe. Die Verben abschalten und faulenzen hingegen sollten mit einer
36
Erklärung eingeführt werden. Das Verb abschalten hat mehrere Bedeutungen. Zu
einem (duden.de) benennt es ein ausmachen mit der Hilfe eines Schalters, zu
anderem umgangssprachlich sich zu entspannen. In dem Fall wird im Text das
letzte zutreffend. Für die Lernenden kann dies nicht eindeutig erscheinen, obwohl
der Kontext hier eine sehr große Hilfe sein kann. Faulenzen bedeutet Nichtstun
(duden.de) und ist auch ein sehr oft vorkommendes Verb, das eine Erklärung
braucht.
Der nächste Text im selben Lehrwerk ‚Joggen zu jeder Jahreszeit?‘ (107) ist ein
knapper Text zum Thema joggen. Der Text enthält sehr viele Wörter, die zum
Thema Sport und Laufen passen. Vor allem das Substantiv Joggen wird mehrmals
wiederholt, auch mit dem Synonym Laufen:
Laufen hat den Vorteil, dass man sehr schnell positive Auswirkungen auf
den ganzen Körper spürt. […] Wer regelmäßig joggt, nimmt auch ab.
Außerdem findet man im Text viele neue Begriffe, die man bisher noch nicht
gelesen hat, die aber zum Thema passen:
Joggen an der frischen Luft ist ein idealer Ausgleich nach einem langen
Arbeitstag, nicht nur für den Körper, auch für den Geist: allein sein mit
sich und seinen Gedanken. Auch im Winter spricht nichts gegen joggen,
wenn man die richtige Kleidung trägt, und dazu gehört unbedingt eine
warme Mütze. Aber das Wichtigste sind die Laufschuhe. Sie müssen gut
passen und die Gelenke schützen.
Wie man sehen kann, sind im Text Wörter wie Kleidung, Laufschuhe, Körper,
Geist, Ausgleich. Diese Wörter sind aus verschiedenen Bereichen, die das
Lehrbuch bereits angesprochen hat – Mode, Gesundheit, Körperteile. Diese
Themen verflechten sich auf jeder Ebene und der Wortschatz ebenso. Es ist
gerade deswegen wichtig, dass die Lernenden den Wortschatz mit
entsprechendem Kontext vermittelt bekommen, sodass sie den verstehen und
richtig verwenden können.
37
3.3.8 ESSEN UND TRINKEN
Im Kapitel Essen-Trinken-Einkaufen des Optimal A1 gibt es zuerst einen kurzen
Dialog (‚Im Bistro‘, 38), das in einem Bistro stattfindet:
Guten Tag, was möchten Sie?
-Tee, bitte!
Mit Zitrone?
-Ja, gerne.
*Und ich nehme ein Mineralwasser und ein Käse-Sändwich, bitte!
Ist das alles?
-Kann ich auch ein Sandwich haben, mit Salat, bitte?
Also, zwei Sandwichs, einmal mit Salat und einmal mit Käse, einen Tee
und ein Mineralwasser.
Die Kellnerin nimmt die Bestellung zweier Gäste entgegen. Der Gast bestellt „ein
Mineralwasser und ein Käse-Sandwich“. Mineralwasser an sich ist nichts
Besonderes und wird in vielen Ländern gern getrunken, doch die Lernenden
wissen wahrscheinlich nicht, dass es was typisch deutsches ist, wenn man in
Bistros oder Restaurants Mineralwasser in der Flasche, statt Leitungswasser
bestellt. Deutsche sind laut der Welt (2010) sogar am ersten Platz der
Mineralwasserkonsumenten, weil sie die Kohlensäure mögen und kein stilles
Wasser.
In demselben Kapitel gibt es auch einen kurzen Text mit dem Titel
‚Einkaufszentrum, Supermarkt, Tante-Emma-Laden‘ (39), der die Eigenschaften
des jeweiligen Geschäftes kurz zusammenfasst. Jeder Lernende wird wissen, wie
es in einem Supermarkt und Einkaufszentrum aussieht, da es keine Unterschiede
zwischen Deutschland und Slowenien gibt. Tante-Emma-Laden ist ein Begriff,
der schon als problematisch dargestellt sein könnte, weil es nicht näher
beschrieben oder erklärt wird, obwohl es sich um eine landestypische Sache
handelt. Im Text erwähnt der Verfasser ein Tante-Emma-Laden folgendermaßen:
In Tante-Emma-Läden bekommt man auch Lebensmittel, aber die sind oft teuer.
Daraus kann der Entschluss gezogen werden, dass ein Tante-Emma-Laden ein
teures Geschäft mit Lebensmittel ist. Die Bezeichnung ist eine Komposition
38
zweier Nomen, die wortwörtlich einen Laden von Tante Emma benennt. Der
Begriff sowie das Konzept der Läden entstanden in den fünfziger Jahren, als die
Besitzerinnen der Läden hinter der Theke standen und den Kunden bedienten.
Weil sich die Kunden und die Verkäuferinnen gut kannten, bezeichnete man
solche Läden als Tante-Emma-Läden (Grimm 2015).
Auch im Optimal B1 gibt es ein Kapitel, das sich mit Essen und Trinken befasst.
Der Lesetext ‚Sonntagsfrühstück‘ (76) ist ein kurzer Text zur Einleitung in das
Thema und ist eigentlich ein Gespräch zwischen Familienmitgliedern beim
Frühstück. Daraus kann man entnehmen, dass ein Sonntagsfrühstück in
Deutschland sehr laut und lang ist. Die Unterhaltung verläuft wie folgt:
Kannst du mir mal den Kaffee rübergeben?
-Komm, ich schenk dir ein. Oh, ich glaube, ich mache noch mal Kaffee,
der ist ja schon fast leer. Ist noch genug Tee da?
Ja, die Kanne ist noch halb voll. Wer möchte noch Schinken? Niemand?
-Brauchen wir sonst noch was?
*Papa, gibt’s keinen Honig? Die Marmelade schmeckt so komisch.
-Findest du? Ich habe nichts gemerkt.
Wer möchte ein gekochtes Ei?
-Oh ja, sei so nett. Wenn wir schon mal Zeit haben und in Ruhe
frühstücken können…
*Ich will auch eins!
Man kann also rauslesen, dass ein deutsches Frühstück aus gekochtem Ei,
Schinken, Marmelade, Honig und reichlich Kaffee besteht. Außerdem isst man
das Sonntagsfrühstück lange in Ruhe. Nimmt man diesen Text als die Grundlage
für ein typisch deutsches Frühstück, liegt man nicht falsch. Laut Experten (n-tv)
besteht ein deutsches Frühstück nämlich aus verschiedenen Brotsorten,
Marmelade und Kaffee. Die Dauer eines Sonntagsfrühstücks ist auch deutlich
länger: Unter der Woche frühstücken die deutschen 15 Minuten, an Sonntagen
fast eine Stunde.
39
Obwohl der Text kurz ist, findet man umgangssprachliche Ausdrücke, die für
gesprochene Texte typisch sind und hier auch einpassen, da es sich um eine
alltags Situation handelt; z.B. ich schenk dir ein, oder gibt’s kein Honig?
Der nächste Text im Lehrwerk mit dem Titel ‚Esstraditionen Ade‘ (79) beschreibt
die deutschen Esstraditionen und ihren Wandel durch die Zeit. Der Text ist sehr
informativ und kann als eine gute Grundlage für Diskussionen im Klassenzimmer
dienen. Das Frühstück wird hier als sehr schnell zu sich nehmende Mahlzeit
beschrieben, da die Deutschen unregelmäßig, schnell und wenig in der Früh essen.
Ein Gegenteil zu dem, was man bisher im Lehrwerk lesen konnte.
Ein Merkmal für die typische Mahlzeit in der Schule ist das Pausenbrot, das
Abendessen wird hier als Abendbrot beschrieben. Man kann sehen, dass die
Bezeichnungen beide Komposita sind. Beide haben als Zweitglied das Substantiv
Brot. Das Erstglied ist jeweils anders, benennt aber die Zeit am Tag, wann man
die Mahlzeit zu sich nimmt; am Abend oder in der Pause. Man sieht also, dass
Kompositionen mit Brot häufig vorkommen und, so wie das Zweitglied selbst,
auch Lebensmittel benennen. Ein weiteres Kompositum kommt in den nächsten
Satz vor: das Abendbrot eben, das so typisch war für die deutschen
Essgewohnheiten wie die Kaffee-Kuchen-Pause am Nachmittag. Die Kaffee-
Kuchen-Pause ist eine Zusammensetzung dreier Substantive, die logischerweise
eine Pause mit Kaffee und Kuchen benennt. Für die Deutschen ist es eine typische
Mahlzeit, die man am Nachmittag nach dem Mittagessen zu sich nimmt. Diese
besteht aus Kaffee und Kuchen und ist auch in Österreich und der Schweiz zu
finden.
Der Text enthält viele Komposita, wie etwa Tiefkühlpizza, Lammbraten,
Dosentomaten. Das kommt davon, dass viele Bezeichnungen für Essen und
Trinken Kompositionen sind, d.h. Zusammensetzungen aus zwei schon
existierenden Wörtern.
3.3.9 GESUND- UND KRANKHEIT
Der Lesetext ‚Du musst zum Arzt‘ (78) im Optimal A1 handelt über Adrian, der
sich bei der Arbeit schlecht fühlt und zum Arzt gehen muss. Der Text beinhaltet
40
auch zwei Dialoge; den Ersten zwischen Adrian und seinen Kollegen, und den
Zweiten zwischen Adrian und seinem Arzt. Der Dialog mit dem Kollegen verläuft
so:
Du siehst schlecht aus, Adrian.
-Ach..
Was ist los mit dir?
-Mir geht’s nicht gut. Ich habe schlecht geschlafen. Und mein Hals tut
weh.
Willst du dich nicht hinlegen?
-Nein, ich will nicht. Das geht vorbei.
Möchtest du einen Tee?
-Nein danke.
Willst du eine Schmerztablette?
-Ich habe schon eine genommen.
Du musst zum Arzt gehen.
-Nein, ich habe zu viel Arbeit. Ich muss ins Büro.
Die Ausdrücke, die im Text vorkommen, sind erwartete Begriffe im Themenfeld;
z.B. Schmerztablette, Arzt, Tee usw. Allerdings handelt es sich nicht nur um Lexik
bestehend aus einem Wort, sondern vorwiegend um Phrasen, die man im Alltag
verwendet: Was ist los mit dir?; Mein Hals tut weh.; Mir geht’s nicht gut.; Das
geht vorbei.
Weiterhin enthält der Text landestypische Merkmale, die sich in der Lexik
widerspiegeln. So muss Adrian bei der Anmeldung beim Arzt seine
Versicherungskarte zeigen. Diese kann man mit der slowenischen ‚zdravstvena
kartica‘ vergleichen, was auch zum Vorteil der Lernenden ist, dass die
Versicherungskarte im Lehrbuch bildlich vorgestellt wird. Aus dem Text kann
man weiter rausfinden, dass sich Adrian mit dem Rezept vom Arzt Medikamente
in der Apotheke kaufen soll. Dies ist wieder ein Merkmal kultureller Differenzen.
In Deutschland bekommt man ein Rezept, mit dem man Medikamente kaufen
muss, in Slowenien hingegen, sind die meisten Medikamente mit dem Rezept
41
kostenlos. Der Text kann damit als eine gute Quelle für die Darstellung dieses
Unterschiedes im Klassenzimmer dienen.
3.3.10 MODE
‚Kleider machen Leute‘ (86) ist ein interessanter Text im Optimal A1, in dem
verschiedene Leute über ihren Kleidungsstill berichten, z.B.:
Anne K., 35, Geschäftsfrau
Bei der Arbeit trage ich fast immer einen Rock, eine schicke Bluse und
eine Jacke, die dazu passt. Aber auch in meiner Freizeit trage ich gerne
schöne Kleider! Jeans und T-Shirts mag ich nicht. Das ist mir zu lässig
und sieht nicht gut aus. Da ziehe ich lieber ein modisches Kleid an.
In dem Text kommen viele Begriffe vor, die sich auf Bekleidung beziehen, somit
können die Lernenden Wortschatz zum Thema Bekleidung erwerben, z.B. Jeans,
Hemd, Pullover, Sakko usw.
Das Thema findet seine inhaltlich-logische Fortsetzung im Optimal B1, im
Lesetext ‚Modechronik‘ (16). Der zeigt einen kurzen Überblick der größten
Modeereignisse der letzten sechzig Jahre, z.B.:
1955 – Der Schauspieler James Dean stirbt bei einem Autounfall. Er war
das Jugend-Idol der 50er Jahre. Seine Kleidung – Jeans und Lederjacke –
und sein Auftreten werden zum Vorbild.
In dem Text findet man Begriffe, die mit Mode verbunden sind und die die
Lernenden noch nicht kennen: Jeans, Lederjacke, Minirock, Moonboot,
Designerin. Diese Begriffe knüpfen an die bisher schon präsentierten Begriffe
(aus Optimal A1) und stellen eine Art Einführung in das gesamte Kapitel dar. Der
Text geht dann nämlich weiter mit einem Porträt einer Modemacherin (17):
„Bei meinen Kreationen achte ich besonders auf die Qualität der
Materialien. Ich verwende fast nur Naturmaterialien, wie Wolle, Seide,
Leinen – keine Synthetik! Meine Stricksachen sind sehr feminin. Zarte,
weiche, fließende Linien, wie eine zweite Haut. Als Teenager habe ich
42
angezogen, was auch die anderen getragen haben. Meine
Lieblingskleidung waren enge, gestreifte Zebrahosen oder lange Röcke,
aber ich habe immer eigene Dinge dazu kombiniert.“
In dem Text findet man vor allem Adjektive, die die Kreationen der
Modemacherin beschreiben: feminin, zart, weich, fließend, eng, gestreift. Der
Wortschatz zum Thema Mode wird hiermit erweitert. Bei dem Text fehlt jedoch
der Gebrauchsfaktor, d.h. der Text ist nicht auf eine Situation im Alltag zu
übertragen. Im Gegensatz zum nächsten Text, der ein kurzer Abschnitt mit
rechtlichen Gesetzen für Kunden darstellt. Der Text beinhaltet viele Begriffe, die
für die Lernende neu sein könnten; Ware, Kassenzettel, Umtausch,
Rechtsanspruch, Sonderangebot usw. Dieser Text hat aber die Authentizität und
ist für die Lernende wissenswerter, da sie das neu erworbene Wissen im Alltag
anwenden können.
3.3.11 AUSBILDUNG
Der Text mit dem Titel ‚In der Schule‘ (30) aus dem Lehrwerk Optimal A2
handelt über den schulischen Alltag einer 18-Jährigen aus Bregenz. Der Text ist
wie ein kurzes Interview aufgebaut, mit Steckbrief, der die wichtigsten
Informationen über die Schülerin enthält.
Der Text ist interessant in dieser Hinsicht, da es auf landestypische Unterschiede
aufmerksam macht. Bregenz liegt nämlich in Österreich, daher kann man schon
erwähnen, dass die Sprache und gewisse Ausdrücke von den deutschen
abweichen. In dem konkreten Text stößt man zwar nur auf einen Ausdruck, der
sich wiederholt, und ein typisches Merkmal der Unterschiedlichkeit zwischen
Hochdeutsch und Österreichisch ist. Die Schülerin spricht von Matura. Matura ist
im Gebrauch in der Schweiz und in Österreich, in Deutschland verwendet man
den Begriff Abitur, somit wird das Wort nicht häufig gebraucht (duden.de). Es ist
jedoch wissenswert zu erwähnen, dass in Österreich die Schüler mit Matura eine
Hochschule beenden, und in Deutschland mit einem Abitur. Vor allem deswegen,
43
weil auch die slowenischen Mittelschüler und Gymnasiasten eine Matura ablegen
müssen; das Wort wird ähnlich ausgesprochen und geschrieben.
3.4 STEREOTYPE UND VORURTEILE
Das Kapitel Freizeit im Lehrwerk Optimal A1 stellt die Deutschen als ein
sportliches Volk dar. Denn immer wieder bekommen wird aus dem Lesetext den
Eindruck, dass jeder in Deutschland entweder Fußball spielt oder Yoga macht: Sie
joggen oder spielen Fußball (32). Auch im Optimal B1 berichtet ein Deutscher,
dass er in seiner Freizeit Volleyball spielt: Ich spiele zweimal pro Woche
Volleyball (107).
Als Lernender kann man das Stereotyp entwickeln, dass die Deutschen eine
sportliche Nation sind, die sehr oft Fußball oder Ähnliches spielt. Solche
Vorstellungen entstehen im Kopf, so Ganter (1997), und beziehen sich auf das,
was wir beobachten und verallgemeinern. Obwohl Stereotype meist negativ sind,
können sie auch positiv ausgedruckt sein, so wie in diesem Beispiel.
Auch das nächste Beispiel ist ein positives Stereotyp, das sind die Deutschen und
ihre Vorliebe für Autos. Im Optimal A2 weist das Kapitel Fremd(e) darauf (62):
ein Mexikaner fährt nach Deutschland, um einen Weiterbildungskurs bei VW zu
machen. Ein häufiges Stereotyp, dass die Deutschen ihre Autos lieben, wird auch
hier vermittelt. Zwar geschieht dies implizit, indem nur daraufhin gewiesen wird,
dass Deutschland das Ursprungsland der Automarke Volkswagen (VW) ist und
daher der Mexikaner nach Deutschland reisen muss; „Die Technik in einer
Autofabrik wird immer moderner, die Automatisierung geht immer weiter. Es gibt
immer weniger einfacher Arbeiten“, sagt Ernesto Rodriguez. Die Arbeiter
brauchen heute eine bessere Ausbildung. Die findet zum Teil in Puebla statt, aber
auch bei VW in Deutschland.
Negative nationale Stereotype findet man im Lehrwerk nicht. Das wurde auch
erwartet, da sich in Bildungskreisen und Lehrwerken kein Platz für negative
Wertungen befinden darf. Ziel eines Deutschunterrichtes ist unter anderem auch
44
auf eventuelle Stereotype einzugehen, diese klar und deutlich als unangebracht zu
bewerten und eine Korrektur der Stereotype im Unterricht durchzuführen.
4 SCHLUSSWORT
Landeskundliche Informationen über deutschsprachige Länder sind im
Lehrwerkband Optimal stet präsent. Überwiegend findet man Informationen über
Deutschland, da die meisten Lesetexte entweder deutsche Personen oder Fremde,
die sich in Deutschland befinden, beinhalten. Das Lehrwerkband vermittelt auch
viele landestypische Merkmale, die sich vor allem auf die Festtage und Bräuche
begrenzen. Dies ist in Texten, die über Ostern, Weihnachten und Neujahr handeln
sehr deutlich zu erkennen. Hierbei handelt es sich um sogenannte oberflächliche
Universalia (Erdmenger, 40), Sachverhalte, die man nicht konkretisieren kann.
Solche Feiertage sind dementsprechend deutlich zu erklären und auf Unterschiede
in den Bräuchen und Sitten zwischen zwei Kulturen aufmerksam zu machen. Ein
sehr beliebtes Thema zur Vermittlung landestypischer Unterschiede ist auch
Essen und Trinken, das nicht nur explizit angesprochen wird, sondern auch
implizit, indem Protagonisten deutsche Speisen genießen und die Aufmerksamkeit
der Leser auf das Essen lenken, obwohl das Thema weit entfernt ist. Somit kann
man die erste Hypothese, dass landeskundliche Informationen und
landeskundlicher Wortschatz einen großen Teil der Lehrwerke darstellen, und
folglich auch im Deutschunterricht ständig präsent sind, bestätigen.
Interkulturelle und landeskundliche Informationen werden durch ausgewählten
Wortschatz deutlich. Texte, die alltägliche Situationen darstellen, sind meist
diejenigen, die am meisten landeskundlichen Informationen vermitteln. Folglich
wird auch der Wortschatz kulturell geprägt und kann bei slowenischen Lernenden
als unverständlich und problematisch erscheinen. Landeskundlicher Wortschatz
wird im Lesetexten im Lehrwerkband Optimal selten erklärt. Der Begriff U-Bahn
wird schon im ersten Band des Lehrwerkes eingeführt, ohne Erläuterungen, was
das überhaupt ist, aber mit einem Foto visuell unterstütz. Immerhin ist dies eines
der seltenen Beispiele. Vor allem im ersten Band mangelt es an Erklärungen,
45
sowie auch an Aktualität; Begriffe und Floskeln sind veraltet und unpassend, wie
man gleich am Anfang des Lehrwerkes sehen kann, wo die Floskel 'Angenehm'
richtig eingesetzt werden soll. Weitere landestypische Ausdrücke, die
Unverständlichkeit auslösen sind z.B. Bahncard oder sogar Zeilen aus einer
Operette. Das Lehrwerk weist auch auf typisch deutsche Merkmale hin, wie etwa
die Automarke VW oder den Tante-Emma-Laden. Daraus kann man den
Entschluss ziehen, dass der Wortschatz im Lehrwerkband Optimal
landeskundliche und interkulturelle Inhalte vermittelt und daher die zweite
Hypothese bestätigt ist.
Im ersten Lehrwerk des Bandes, Optimal A1, sind mehrere umgangssprachliche
Ausdrücke zu finden. Vor allem im ersten Kapitel des Lehrwerkes findet man
Protagonisten, die im Dialekt sprechen, was für Anfänger auf dem Niveau A1
ungewohnt sein kann. Man muss auch darauf aufmerksam machen, dass solche
Äußerungen ohne jegliche Erklärung im Text stehen und diesen Teil die Lehrkraft
übernehmen sollte. Im Optimal A1 ist der Wortschatz für Anfänger angepasst – es
handelt sich um einfache Wörter, sehr kurze Texte und öfters Dialoge. Das
Optimal A2 knüpft an das schon vorhandene Wissen an, indem die Texte
Wortschatz aus Optimal A1 beinhalten und neue, noch unbekannte dazu fügen.
Das gleiche findet im Optimal B1 statt, aber mit einer Ausnahme. Optimal B1
bietet den Lernenden im Texten schon komplexere Wörter, meistens sind das
Kompositionen. Somit lernen die Schüler neuen Wortschatz allmählich und ihren
Sprachfähigkeiten entsprechend.
46
5 LITERATUR
Adamzik, Kirsten (2004): Textlinguistik. Eine einführende Darstellung. Tübingen
Bahn. DB Vertrieb GmbH. Letzter Abruf 16.08.2015. <www.bahn.de>
Biechele, Markus/Padros, Alicia (2003): Didaktik der Landeskunde. München.
Bohn, Rainer (2000): Probleme der Wortschatzarbeit. München
Bußmann, Hadumod (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart
Christine Römer/Brigitte, Matzke: Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung.
Tübingen
Cools, Dorien/Sercu, Lies: Die Beurteilung von Lehrwerken an Hand des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Eine empirische
Untersuchung von zwei kürzlich erschienenen Lehrwerken für Deutsch als
Fremdsprache. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 11/3
(2006), 1–17.
Döring, Alois (2006): Rheinische Bräuche durch das Jahr. Köln
Drösser, Christoph: Das ist typisch Deutsch, 2015. In: ZEIT online.
<http://www.zeit.de/wissen/2015-08/deutschland-studie-wie-wir-deutschen-
ticken-christoph-droesser> (26.08.2015)
Erdmenger, Manfred (1996): Landeskunde im Fremdsprachenunterricht.
Ismaning.
Ganter, Stephan (1997): Stereotype und Vorurteile: Konzeptualisierung,
Operationalisierung und Messung. Mannheim.
47
Funken, Peter: Berlin – Choreographie einer Stadt, 2011. <
http://www.kunstserviceg.de/funken/text/40.html> (23.08.2015)
Griesbach, Heinz (1993): Die Bundesrepublik Deutschland. Lesetexte zur
Landeskunde. Berlin
Grimm, Hanna: Tante-Emma-Laden, 2015. In: dw. <http://www.dw.com/de/tante-
emma-laden/a-1630030> (17.08.2015)
Habscheid, Stephan (2009): Text und Diskurs. Paderborn
Hanisch, Horst (2011): Der kleine Business-Knigge. Bonn
Helbig, G. et. al. (Hrsg) (2001): Deutsch als Fremdsprache. New York
Herbermann, Claus-Peter: Das Wort als lexikalische Einheit, in: Cruse, D.A. et.
al. (Hrsg.): Lexikologie, Berlin 2002, [14-34]
Holc, Nada (2011): Učni načrt. Program osnovna šola. Nemščina. Ljubljana
Holc, Nada (2008): Učni načrt. Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna
gimnazija. Nemščina. Ljubljana
Iser, Julia Angela (2006): Vorurteile: Zur Rolle von Persönlichkeit, Werten,
generellen Einstellungen und Bedrohung. Dissertation, Justus-Liebig-Universität
Gießen.
Kekesi, Petra (2009): Landeskunde und Literatur im DaF-Unterricht.
Saarbrücken.
Krüskemper, Elena: Ostern in Deutschland – Tradition und Frühlingsvergnügen,
2015. In: Alumniportal Deutschland. https://www.alumniportal-
deutschland.org/deutschland/traditionen-feste/artikel/ostern-in-deutschland.html
(27.08.2015)
Luscher, Renate (2001): Deutschland nach der Wende. Ismaning
Lutz, Luise (1996): Das Schweigen verstehen. Heidelberg
Lutzeier, Peter Rolf (1997): Lexikologie. Heidelberg
Müller, Bernd Dietrich (2001): Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung.
München.
Šlibar, Neva (2011): Wie didaktisiere ich literarische Texte? Neue Maturatexte
und viele andere im DaF-Unterricht. Ljubljana
Vater, Heinz (2001): Einführung in die Textlinguistik. München
48
O.V. Optimal, 2014. In: Klett Sprachen. <http://www.klett-sprachen.de/optimal/r-
388/197#reiter=konzeption> (12.06.2015)
O.V. Deutsche sind Weltmeister im Mineralwassertrinken, 2010. In: Die Welt.
<http://www.welt.de/wirtschaft/article9082943/Deutsche-sind-Weltmeister-im-
Mineralwasser-trinken.html> (13.07.2015)
O.V. Das deutsche Frühstück: Von süß bis üppig, 2011. In: n-tv. < http://www.n-
tv.de/ticker/Ernaehrung/Das-deutsche-Fruehstueck-Von-suess-bis-ueppig-
article3436581.html> (05.09.2015)