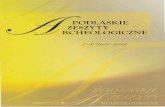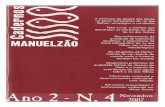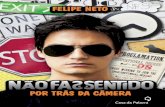MÄNNER SPEZIAL - FAZ
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of MÄNNER SPEZIAL - FAZ
PH
OT
O:G
REG
WIL
LIA
MS
OLYMP.COM/SIGNATURE
GERARD BUTLER’S CHOICE
DAS HEMD, DAS SICH WIEKEIN ANDERES TRÄGT.
EDITORIAL 9
FOTO
DIE
TE
RR
ÜC
HE
L
Verantwortlicher Redakteur:Dr. Alfons Kaiser
Redaktionelle Mitarbeit:Dr. Kim Björn Becker, Beatrice Behn, Claus Eckert,Leonie Feuerbach, Timo Frasch, Aylin Güler, Jörg Hahn,Martin Häusler, Jasmin Jouhar, Andreas Krobok,Fridtjof Küchemann, Ulf Lippitz, Melanie Mühl,Dr. Josef Oehrlein, Dr. Günter Paul, Andreas Platthaus,Andreas Ross, Boris Schmidt, Peter-Philipp Schmitt,Florian Siebeck, Kai Spanke, Bernd Steinle, ArturWeigandt, Jennifer Wiebking, Maria Wiesner,Matthias Wyssuwa, Niklas Zimmermann
Bildredaktion:Christian-Matthias Pohlert
Art-Direction:Peter Breul
E-Mail Redaktion:[email protected]
Alle Artikel werden exklusiv für das „FrankfurterAllgemeine Magazin“ geschrieben. Alle Rechtevorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH,Frankfurt am Main.
Eine Verwertung dieser urheberrechtlich geschütztenRedaktionsbeilage sowie der in ihr enthaltenen Beiträgeund Abbildungen, besonders durch Vervielfältigungoder Verbreitung, ist – mit Ausnahme der gesetzlichzulässigen Fälle – ohne vorherige schriftlicheZustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.Besonders ist eine Einspeicherung oder Verbreitungvon Inhalten aus dem Frankfurter AllgemeineMagazin in Datenbanksystemen, zum Beispiel alselektronischer Pressespiegel oder Archiv, ohneZustimmung des Verlags unzulässig.
Sofern Sie Artikel dieses Magazins nachdrucken, inIhr Internet-Angebot oder in Ihr Intranet übernehmenwollen, können Sie die erforderlichen Rechte bei derF.A.Z. GmbH erwerben unter www.faz-rechte.de.Auskunft erhalten Sie unter [email protected] telefonisch unter (069)7591-2901.
Redaktion und Verlag:(zugleich ladungsfähige Anschrift für die im Impressumgenannten Verantwortlichen und Vertretungsberechtigten)Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbHHellerhofstraße 2-460327 Frankfurt am Main
Geschäftsführung:Thomas Lindner (Vorsitzender)Dr. Volker Breid
Verantwortlich für Anzeigen:Ingo Müller, www.faz.media
Hersteller:Andreas Gierth
Layout:Verena Lindner, Anja Tschulena
Einzelhefte können zum Preis von €5,– [email protected] bezogen werden.
Druck:Prinovis GmbH&Co.KG – Betrieb NürnbergBreslauer Straße 30090471 Nürnberg
WIIW R SINDDOCHGARNICHT SO
ie werden es am Titel vielleicht nicht sofort erkannt haben,aber in dieser Ausgabe geht es um Männer. Das ist eingroßes Thema, das aber nur Sinn hat, wenn man auch auf
die Frauen schaut. Mir wurde diese Binsenweisheit wieder einmalam 30. Juni bewusst, einem wunderschönen Sommer-Sonntag, inder Métro-Station Bonne Nouvelle in Paris. Wir hatten für dieseAusgabe, um in Zeiten von gender fluidity nicht nur einen Mannin Männersachen fotografieren zu lassen, Esther Heesch angefragt,eines der am besten gebuchten deutschen Models. Und weil geradeauch Alpha Dia in der Stadt war, der neue Star der deutschenMännermodels, hatten wir ihn gebeten, auch dazuzukommen.Die beiden, man erahnt es auf den Modeseiten, verstanden sichblendend; Fotograf und Stylist hatten einen entspannten Tag.Und die Männermode steht ihr so gut wie ihm. Womöglich sindwir gar nicht so verschieden? Leonie Feuerbach hat in ihrem Essayüber Missverständnisse der Evolutionsbiologie dafür Argumente;von der Untreue bis zur Homosexualität ist auch den Tieren nichtsMenschliches fremd. Bonne Nouvelle, gute Neuigkeit: Männerund Frauen können gut zusammenarbeiten, diesseits aller körper-lichen Beziehungen, die wir auf dem Titel des Hefts, wie es unserStil ist, nur zart andeuten. Daher ist es kein Zufall, dass die un-glaubliche Geschichte der DDR-Flucht, die wir zum dreißigstenJahrestag des Mauerfalls ausgegraben haben, im Zusammenspielvvvooonnn MMMaaannnnnn uuunnnddd FFFrrraaauuu zzzuuu eeeiiinnneeemmm ggguuuttteeennn EEEnnndddeee kkkaaammm. DDDaaahhheeerrr iiisssttt eeesss aaauuuccchhhkein Zufall, dass sich Wolf Wondratschek, den Timo Frasch vorder Buchmesse zur Literaturszene befragt, mit seinem Großgedicht„Carmen“ in meine Lebensgeschichte eingeschrieben hat. Wirgehen in diesem Heft aber auch, ohne Geschlechterstereotypezu bedienen, den alten Werten nach, die in Amerika beschworenwerden: Andreas Ross hat auf einem riesigen Jahrmarkt in Iowadie Familie aufgetan, die mit dem „The Way We Live Award“
ausgezeichnet wurde. VonTraditionsfamilien bis zur Evolutions-biologie, von Willy Brandt bis zu Martin Suter, von
den Weiten Patagoniens bis in die Tiefen einerPariser Métro-Station: Wir sind gar nicht so.Wir sind eigentlich ganz anders. Aberlesen Sie selbst! Alfons Kaiser
S
Tel.06
929
9934
67
NEUE E-BOUTIQUE. DIOR.COM
MITARBEITER 11
FOTO
SE
VE
LYN
DA
PP
A,P
HIL
IPP
BR
EU
,RE
NE
GE
BH
AR
DT,
ALF
ON
SK
AIS
ER
,FLO
RIA
NS
IEB
EC
K,P
RIV
AT
(2)
KIM BJÖRN BECKER wurde1986 geboren und kann deshalbvon sich sagen, dass er die „alteBundesrepublik“ noch selbsterlebt hat. Vielleicht fasziniert ihndie Ästhetik dieser Zeit, die mitder Wende vor 30 Jahren zu Endeging, deshalb so sehr. Er sammeltFotos von Schriftzügen, Werbe-tafeln und Gegenständen, dieihn an diese Epoche erinnern.Viele sind auf seinem Instagram-Account @altebundesrepublik zusehen, einige der schönsten Retro-Fotos in diesem Heft. (Seite 32)
ANDREAS ROSS saß vorJahren am kleinen Flughafen vonDes Moines im amerikanischenBundesstaat Iowa im Schnee-sturm fest. Es war am Tag nachden Vorwahlen im Februar 2016,die er damals als Amerika-Korres-pondent dieser Zeitung beobach-tet hatte – wie Hunderte weitereJournalisten aus der halben Welt,die nun mit ihm am Flughafengegen die unfreiwillige Entschleu-nigung kämpften. Umso besserfür unseren mittlerweile wiederin Frankfurt lebenden Autor,dass das andere Großereignis imKalender des Bundesstaatesin den Sommer fällt: die IowaState Fair, die er für dieses Heftbesucht hat (Seite 70). Da gehtes um Mastschweine, um eineButterkuh – am Ende aber auchwieder um Politik.
BEATRICE BEHN (rechts oben)wuchs in den achtziger Jahrenim Neubaugebiet Fritz Heckertin Karl-Marx-Stadt auf, derdrittgrößten Plattenbausiedlungder DDR. Die Kulturjournalistinist nach 20 Jahren Abwesenheitgemeinsam mit unserer Gesell-schaftsredakteurinMARIAWIESNER und dem Designer,Fotografen und Dokumentar-filmer RENÉ GEBHARDTnach Chemnitz zurückgekehrt(Seite 36). Dort versuchten diedrei herauszufinden, wie ausder sozialistischen Idee, moderneWohnungen für jedermann zubauen, ein stigmatisiertes Gebietwurde, in dem soziale Spannun-gen herrschen.
MITAR
BEITER ALPHA DIA ist den Leserndieses Magazins schon bekanntaus der Modestrecke, die wirfür das März-Heft 2017 über denDächern von Frankfurt aufge-nommen hatten. Dieses Mal ginges mit dem Hamburger Jung, derin der internationalen Szene gut
Unter-THERn, diel arbeitetHeftr neue8). Diesich sohlen,
Modegessenrnnten
im Geschäft ist, in den Ugrund von Paris. Mit ESTHEESCH, der Lübeckerischon seit 2011 als Modelund auch im September-Hzu sehen war, probierte erMännermode an (Seite 58
beiden hattenviel zu erzähdass die Mschnell vergwar. Daherdie entspanFotos.
13INHALT
ZUM TITELUnser Titelbild zeigt Fruchtfliegenbei der Paarung.
MODE Mit diesen Jackengehen Männer durch dickund dünn. Seite 17
ARCHITEKTUR In Chemnitzerzählt eine Plattenbausiedlung einStück DDR-Geschichte. Seite 36
SCHUHE Der Designer InanBatman hat einen Sneaker fürBerlin entworfen. Seite 47
KUNST Lanzarote feiert denhundertsten Geburtstag vonCésar Manrique. Seite 76
KOCHEN Dieses Rezept schmecktnach Herbst: Serviettenknödel mitWildschweinbraten. Seite 78
REISE Der Stadtteil BrooklynHeights zeigt eine andere SeiteNew Yorks. Seite 82
Die nächste Ausgabe des Magazins liegt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 26. Oktober bei.Im Netz: www.faz.net/stil Facebook: Frankfurter Allgemeine Stil Instagram: @fazmagazin
FOTO
SS
TE
PH
AN
PIC
K,P
ICT
UR
EA
LLIA
NC
E,F
LOR
AP
RE
SS
/AN
IMA
LIM
AG
ES
,GE
TT
Y,H
ER
ST
ELL
ER
Diese Zeilen gehen unterdie Haut: Viele Prominentetragen literarische Zitateals Tattoos (Seite 46) – undvermitteln damit vielfältigeBotschaften.
Aktenkundig: HansBaumans verhalfvor 50 Jahren seinerLebensgefährtinunter abenteuerlichenUmständen zur Fluchtaus der DDR. (Seite 28)
34 THORBJØRN JAGLAND42 WOLFWONDRATSCHEK48 MARTIN PUDENZ62 MARTIN SUTER86 MATTEOTHUN
Japan Open: Mit demMMMaaazzzdddaaa MMMXXX-555 (((SSSeeeiiittteee 888444)))nahm vor 30 Jahren dasInteresse an zweisitzigenoffenen Sportwagenwieder Fahrt auf.
Deutschland suchtdas Superfood: DerErnährungsmedizinerAndreas Michalsen sagt,wie wir uns gesund essenkönnen (Seite 80) – zumBeispiel mit Walnüssen.
BOSS.COM
HUGO
BOSSAG
PHONE+4971
23940
15BILDER AUS DER ZEITUNG
Aus der F.A.Z. vom 10. Oktober 1969: Während der Frankfurter Buchmesse debattieren beim Luchterhand-Verlagsabend Frank Benseler, Otto F. Walter und Günter Grass (von links). Foto Barbara Klemm
enn die Herren auf diesem FotoRitterrüstungen trügen, könnte mansich in ein Burgverlies versetzt fühlen.Doch Barbara Klemm nahm es am8. Oktober 1969 in einem Frankfurter
Kellerlokal auf, das der Kabaretttruppe „Die Maininger“als Spielstätte diente. Zum Scherzen war den Beteiligtender Veranstaltung, die als geselliger Verlagsabend vonLuchterhand am ersten Tag der Buchmesse gedacht war,aber gar nicht zumute – das kann man schon den ernstenMienen ablesen. Den Herrn rechts braucht man wohl auchheute nicht vorzustellen: Mehr Schnauzbart als bei GünterGrass war nie. Ganz links steht Frank Benseler, seinerzeitLeiter des Soziologischen Lektorats bei Luchterhand,zwischen beiden mit dunkler Brille der Luchterhand-Chef-lektor Otto F. Walter, also gewissermaßen der Chef vonBenseler und der erste Diener von Grass, dem prominen-testen Autor des Verlags. Seine Mittlerrolle sollte an diesemAbend gefragt sein, aber wenn man den Berichten derdamals Anwesenden glaubt, hat er sie nicht ausgefüllt.Grass und Benseler standen sich unversöhnlich gegenüber.
Berufllf ich hatten sie gar nichts miteinander zu tun –politisch umso mehr. Beide verstanden sich als Exponen-ten eines aufgeklärten Gesellschaftsverständnisses, wie esschon damals mit dem Schlagwort „Achtundsechzig“ ver-bunden war. Ein Jahr vor der Aufnahme, im Epochenjahr1968, waren während der Buchmesse Polizisten gegenDemonstranten eingesetzt worden, die den Stand desSpringer-Verlags gestürmt hatten. Der Höhepunkt derProteste war aber außerhalb des Messegeländes erreichtworden: bei der Verleihung des Friedenspreises des Deut-schen Buchhandels an den senegalesischen Dichter undStaatspräsidenten Sédar Senghor, der den deutschen Lin-ken als Büttel des Kolonialismus galt. Aus diesem Aufruhrheraus entwickelte sich im Lauf der nächsten Monate eine
Fundamentalopposition innerhalb der Verlage, die vonden Lektoraten ausging, aber auch andere Angestellte,Autoren und Buchhändler umfasste und zur Gründungeines Zusammenschlusses namens „Literaturproduzenten“führte. Zur Buchmesse 1969 kündigten sie viele Veranstal-tungen an, erhielten aber auf dem Messegelände keineGenehmigung. Der Luchterhand-Verlagsabend wurde zueiner spontanen Ersatzveranstaltung, weil Benseler eine dertreibenden Kräfte der „Literaturproduzenten“ war.
Wenn er allerdings gehofft hatte, in Grass einen Für-sprecher zu finden, sah er sich getäuscht. Der Schriftstellerschlug sich auf die Gegenseite und verteidigte die von den„Literaturproduzenten“ als Kapitalsknechte geschmähtenVerleger gegen ein Flugblatt, das die Gruppe zum Auftaktder Buchmesse verteilt hatte, in dem eine Demokratisie-rung der Verlage und Mitbestimmung im Buchhandel ge-fordert wurden. Grass witterte hinter dem nicht nament-lich gezeichneten Text einen Tugendterror, der ihm aus derGeschichte des linksradikalen Aktivismus vertraut war,und erklärte die individuelle schriftstellerische Leistung fürunvereinbar mit dem im Flugblatt proklamierten kollekti-vistischen Ideal. Dabei mag eine Rolle gespielt haben, dassGrass’ kurz zuvor erschienener Roman „Örtlich betäubt“zwiespältig aufgenommen worden war, weil man ihn als zupolitisch empfand. Daher bemühte sich Grass, seine Rolleals Autor von der des Propagandisten zu trennen – wasmanche Kritiker mit ihm versöhnte, wie Friedrich Ferdi-nand Hommel, der sich in seinem F.A.Z.-Bericht über denAbend in der Katakombe begeistert darüber zeigte, dassGrass die „politische Überheblichkeit, politische Ignoranz,politische Einseitigkeit“ des Flugblatts gezeigt habe.
Von den „Literaturproduzenten“ hat man tatsächlichnach der Buchmesse von 1969 nicht mehr viel gehört.Günter Grass war einfach nicht ritterlich genug gewesen,ihnen beizustehen. Andreas Platthaus
Vorfüüf nfzzf igJahha ren
17PRÊT-À-PARLER
Vergangenen Winter, als die damalige britische Premier-ministerin Theresa May Woche für Woche erfolglos fürihr Austrittsabkommen warb, trug sie immer wieder die-sen Mantel: mittelblau, von innen mit Daunen gefüttert,von außen mit Wolle beschichtet. Ein Stück, das sie nichtvor der Eiseskälte der zahlreichen Gegner schützen konn-te, aber immerhin vor echtem Frost und somit vor einemheftigen Schnupfen. Der Mantel sah trotzdem offiziellgenug aus, um die Route schon auf Bildern abzustecken– von London in Richtung Brüssel.
Nun hinterlässt Theresa May ein überschaubares poli-tisches Erbe. An ihren Mantel vom vergangenen Winter
kann man sich aber in diesem Herbst schon noch malerinnern. Sie ist damit auch Männern ein Stilvorbild.Denn das Beispiel May imMantel zeigt, wie man sich mitein bisschen Materialmix die Optionen offenhält, dassselbst ein Mantel, ein denkbar unflexibles Kleidungs-stück, in dem man von Anfang Oktober bis Ende Märzgleich aussieht, mehr als eine Seite haben kann.
Mode ist eben überhaupt ein schönes Stilmittel, wennes um die Frage geht, wie man sich der Welt präsentierenmöchte. Die zwei Seiten dieser Jacken undMäntel für denHerbst und Winter bieten somit immerhin mehr als eineMöglichkeit. Zum Beispiel, wenn optisch beide zur Gel-
tung kommen wie bei der Jacke aus Denim und Lamm-fell von Levi’s Made & Crafted (2). Oder demModell ausLeder und Lammfell von Porsche Design (1). Wenn mansie auch praktisch einmal wenden und auf links tragenkann, wie die Jacke von Moncler 1952 aus Teddystoff undDaunen (4). Oder den Parka aus Daunen und Woll-gemisch von Woolrich (3). Oder die Daunenjacke vonHerno (5), die auch eine Strickjacke ist.
Auch Theresa Mays Mantel kam aus dem Haus Her-no, also aus Italien. Glück gebracht hat er ihr nicht. Wasman aber selbst von einem Mantel mit zwei Seiten wohlkaum erwarten kann. (jwi.) Fotos Frank Röth
ZWEI SEITEN EINES MANTELS
PRÊT-À-PARLER1
2
3
4
5
18 PRÊT-À-PARLER
FOTO
SA
YLI
NG
ÜLE
R,H
ER
ST
ELL
ER
VOR 50 JAHREN LANDETEN DIE MONDFAHRER IN BONN
ZICKZACK ZUM SITZEN
Auf dem Mond waren Neil Armstrong und Buzz AllA drinpünktlich gelandet, und auch den Rückfllf ug zur Erde hattensie zusammen mit Mike Collins genau nach Zeitplan an-getreten. Aber vor der Beethovenhalle in Bonn mussten dieMenschen, die dort auf sie warteten, Geduld aufbbf ringen.Man schrieb den 12. Oktober 1969. Erst gut drei Monatewaren vergangen, seit Armstrong und AllA drin als erste einenanderen Himmelskörper betraten. Der übrigens nicht, wiein Amerika gelegentlich behauptet wird, aus grünem Käsebesteht – das hatten die Astronauten sofort erkannt.
Statt der drei Helden aus Amerika waren es vorerst nurzwei unbekannte Raumfahrer, die vor der Beethovenhallezu sehen waren. Gerade mal Buben, aber in Raumanzügegekleidet. Wohl Relikte vom rheinischen Karneval. Dannaber brach Jubel aus, als die drei richtigen Raumfahrer inder Staatskarosse mit den „Weißen Mäusen“ davor, denMotorradfahrern der Eskorte, die Halle erreichten. Bei allder Begeisterung entging mir, wie ernst die drei Männersich gaben. Da mochte eine gewisse Erschöpfung durch dieStrapazen der letzten Tage im Spiel sein. Dem Volk war esegal, Hauptsache, sie waren endlich da. Die offizielleGoodwill-Tour, auf der sie mit dem spektakulären Mond-fllf ug für Amerika und seine Raumfahrt warben, führte siein 37 Tagen in 24 Länder auf fünf Kontinenten. Bonn, die„provisorische“Hauptstadt der Bundesrepublik, das „Bundes-dorf““f , war wohl die kllk einste der Städte, die sie besuchten.
Der Terminplan in Bonn lässt erahnen, was die Heldenauf ihrer irdischen Tour zu erdulden hatten. Als sie vorgenau 50 Jahren zusammen mit ihren Ehefrauen vor-mittags auf dem Flughafen Köln-Bonn ankamen, wurdensie gleich zum Kölner Rathaus gebracht, wo sie sich insGoldene Buch der Stadt einschrieben. Danach weiter zur
Beethovenhalle in Bonn, wo noch ein Goldenes Buch aufsie wartete. Nach einer Ruhepause mittags im Hotel folgtedie Bundespressekonferenz mit einer Mondfilm-Vorfüh-rung, kommentiert von Armstrong und Aldrin. DanachWiedervereinigung mit ihren Frauen und Gespräch mitBundespräsident Gustav Heinemann, abends Staatsbankettmit Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Am nächstenTag ging es für Armstrong und Aldrin von Bonn aus füreinen etwwt as ruhigerenTag nach Berlin, wo sie Collins wieder-trafen. Der dritte im Bunde hatte schon an der Presse-konferenz nicht teilnehmen können, sondern sich hastigverabschiedet, um nach Genua zu fllf iegen. Dort sollte derin Rom als Sohn des damaligen amerikanischen Militär-attachés geborene Astronaut Goldmedaillen einer wissen-schaftlichen Gesellschaft für die drei in Empfang nehmen.Mit Deutschland verbindet Collins, dass er – wie Aldrin –eine Zeitlang auf dem amerikanischen Luftwaffenstütz-punkt Bitburg stationiert war. Vielleicht waren ihre Ge-danken dort, als sie sich in das Goldene Buch der StadtBonn eintrugen. Und Armstrong? Dachte er an seine Vor-fahren aus Ladbergen im Tecklenburger Land, von deneneiner seiner Urgroßväter im 19. Jahrhundert nach Amerikaausgewandert war?
Überall in der Welt waren die drei Mondreisendendamals willkommen – nur nicht in Ungarn. Denn 1945hatte die amerikanische Armee die von den Ungarnverehrte Stephanskrone übernommen, um sie vor demZugriff durch Hitlerdeutschland und die Sowjetunion zuschützen. Man hatte sie aber immer noch nicht zurück-gegeben, weil Ungarn kommunistisch regiert wurde. Erst1978 traf die heilige Stephanskrone wieder in Budapestein. Günter Paul
Mit einer Isolierkanne wurde Erik Magnussen berühmt:Der zylindrische Entwurf EM77 für den dänischen Her-steller Stelton mit seinem Kippverschluss ist seit den Sieb-zigern in vielen Haushalten zu finden. Magnussen, 1940in Kopenhagen geboren, schätzte funktionales Design.Der Däne, der sich an der Kunsthåndværkerskolen zumKeramiker ausbilden ließ, arbeitete zunächst für den Por-zellanhersteller Bing & Grøndahl. Zugleich beschäftigteer sich mit Möbeln. Zu seinen schönsten Arbeiten zähltder Klappstuhl Zdown aus dem Jahr 1968. Das Gestellbesteht aus einer von zwei Z-förmigen Rohren gebildetenZickzackstruktur, die an auseinandergebogene Büro-klammern erinnert. Sitzfläche und Rückenlehne sind ausNaturleder. Engelbrechts hat das Stahlrohr-Möbel nunneu aufgelegt – fünf Jahre nach Magnussens Tod. (pps.)
2019 war ein großes Jahr für Asics. Nach zahlreichenNeuerscheinungen wie dem Gel-Kayano 5 setzt der japa-nische Sportbekleidungsriese seine Bemühungen mit derNeuerscheinung eines weiteren Archiv-Schuhs fort:Knapp 13 Jahre nach der ersten Veröffentlichung kommtder legendäre Gel-Kinsei zurück. Die neuaufgelegte Sil-houette ist eines der technologisch fortschrittlichsten Pro-dukte in der siebzigjährigen Ära von Asics. Das Designdes 2006 erstmals erschienenen Gel-Kinsei-Schuhs wurdedamals schon als revolutionär gefeiert. Sein Designer His-anori Fujita ließ sich stark von den Samurai und ihremEquipment inspirieren. Von der Rüstung, die den Körperschützt und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bietet, biszum Katana-Schwert, das die Form der Ferse des Gel-Kinseis bestimmt. Der Schuh vereint also traditionellejapanische Werte mit den technischen und mechanischenStilelementen des frühen Jahrtausends.
Als einer der ausgereiftesten Schuhe auf dem Marktkombiniert er das Asics I.G.S. (Impact Guidance System)mit einer Discreet Heel Unit, an der drei große Gel-Segmente angebracht sind. Das ist der wohl markantesteUnterschied zu anderen Asics-Modellen. Die ersten Asics-Turnschuhe mit Gel erschienen zwar bereits 1986 in einerkleinen Auflage, die maßgeblich für den Erfolg von Asicsverantwortlich war. Doch die Technologie wurde in denneunziger Jahren immer weiter entwickelt, bis das end-gültige System erreicht war. Das Ergebnis kam 2006 mitdem Asics Gel-Kinsei in den Handel und war anders alsalles, was bisher von Asics entwickelt worden war.
Drei Bereiche der sichtbaren Gel-Technologie dämp-fen den Rückfuß beim Aufprall und passen sich denStabilitätsanforderungen des Läufers an. Dabei wird dieFerse zum einen fest in einer Kunststoffwiege gehalten,während zum anderen der Läufer von einem idealen Ab-
rollverhalten profitieren kann. Die gewichtsreduzierendeTrusstic-Technologie, die erstmals im Gel-Kinsei vor-gestellt und unter dem Schuhgewölbe plaziert wurde,reduziert außerdem das Gesamtgewicht des Schuhs undverlängert so die Lebensdauer der Sohleneinheit. Beider Entwicklung wurde ein Hochdruckwasserstrahl ein-gesetzt, um die Schuhe zu teilen.
Mit seinem technoiden und futuristischen Style, deran die Anfänge des Jahrhunderts erinnert, bringt derSchuh für mich alles zurück, was ich bereits am Original-Schuh von 2006 liebte. Was damals noch ein revolutionä-rer Sportschuh war, passt dank der klobigen Retro-Optikperfekt in den Modelook von heute. Trotz des Laufschuh-Designs sind die Schuhe für mich also lässig genug, umsie auch im Alltag zu tragen. Ob im Büro, im Fitness-studio, zum Laufen oder als Lifestyle-Sneaker – der Gel-Kinsei ist ein Allrounder. Aylin Güler
SNEAK AROUND (12)ASICS
GEL-KINSEI
Auf Goodwill-Tour in Bonn: Buzz Aldrin, Michael Collins und Neil Armstrong (von rechts) Foto Günter Paul
PRÊT-À-PARLER
Aufgeklappt: Stahlrohr-Stuhl von Erik Magnussen
PRÊT-À-PARLER20
GESTERN SKINNY, MORGEN SCHLAG
ALS ICH MITLUIGI COLANI KNIFFELTE
Jeden Morgen zwängten sich Männer und Frauen in ihreSkinny Jeans. Beim Anprobieren verzweifelten sie oft ander Zwei-Finger-Regel, die dem Träger mit jeder Finger-breite ein schlechtes Körpergefühl vermitteln konnte. ZurFreude vieler und zur Trauer einiger sind die Zeiten dieserSelbstgeißelung seit diesem Jahr endgültig vorbei.
Bevor die Jeans ein Ausdruck von körperlichen Maß-stäben wurde, war die enge Hose aus robustem Baumwoll-stoff etwas anderes: der Ausdruck eines Indie-Lebens-gefühls, das sich zum letzten Mal aufbbf äumte.
„I just wanted to be one of the Strokes, now look atthe mess you made me make“: Mit diesen Worten stiegAlex Turner, Frontsänger der Arctic Monkeys, 2018 mitseinem sechsten Studioalbum ein und meinte damit wohlmehr als nur die Musik. Vor zehn Jahren wurde einemein anderes Lebensgefühl vor Augen geführt: Locken,Jeansjacke, Skinny Jeans, Band-T-Shirts und ein destruk-tiver Lebensstil – man wollte die Rock-Bewegung dersiebziger Jahre imitieren, nur irgendwie anders.
In der „Indie-Szene“ durften – im Gegensatz zu Punkoder Rock – auch die Braven Rebellen sein, ohne zu sehrvon der Norm abzuweichen. Der Indie-Rock war ein Teildes Mainstreams, in dem jeder seiner Individualisierung
nachgehen konnte, ohne dabei abseits stehen zu müssen.Die Jugend trug dazu Halstücher und Schmuck. Sie mach-te sich Dauerwellen oder färbte sich die Haare. Männerund Frauen trugen gleichermaßen die Skinny. Sie spieltenmit Geschlechterrollen, Jahre bevor der Begriff der genderfllf uidity überhaupt aufkkf am.
Indie-Rock-Bands wie Libertines, Bloc Party, ArcticMonkeys undThe Kooks trugen maßgeblich dazu bei, dassdie Skinny Jeans eine Renaissance erlebte. Die Jeans wurdedurch sie ein guter Kompromiss für Menschen, die so seinwollten wie die Musiker, aber das Rampenlicht vermieden.
Doch was, wenn die Hose nicht passt? Dann sendet sieeine negative Botschaft an den Träger: Die Skinny Jeanskann nämlich nicht nur befreiend sein, sondern auch de-primierend. Ihre Aussage: „So wie dein Körper zur Zeit ist,ist er nicht akzeptabel.“ Das fördert zusätzlich Unsicher-heiten, denn die Jeans räumt nicht nur Geschlechterrollenaus dem Weg, sondern schließt auch aus, was nicht passt.
Das haben die Indie-Ikonen bemerkt. Heute tragen sieSchlaghosen, Hawaii- oder Vintagehemden aus den Sieb-zigern – und die Rebellion, die sie verkörperten, wurde sodünn wie der Abstand zwischen Skinny Jeans und den zweiFingern zwischen Hosenbund und Bauch. ArturWeigandt
Der Typ hat mich sofort beeindruckt. Buschiger Schnäuzer,bis zu den Kinnwinkeln hinuntergezogen, dichte schwarzeHaare, an den Seiten und hinten lang. Musiker sahen inden Achtzigern so aus, Leslie Mandoki von DschingisKhhK an zum Beispiel, auch Fußballspieler oder Rocker, aberniemand, den ich persönlich kannte.
Dass ich mit so einem Mann stundenlang ein Zug-abteil teilen sollte, passte zu meinem kleinen Abenteuer.Es muss zu Beginn der Osterferien 1981 gewesen sein. Ich,zehn Jahre alt, ebenfalls mit Mittelscheitel und dunklenHaaren, sollte zum ersten Mal ganz allein eine weite Streckemit dem Zug fahren. Es ging von Düsseldorf, wo meineGroßmutter wohnte, nachMünchen, womich meine Elternin Empfang nehmen sollten. Oma brachte mich in den Zugund schob mich auf den nächstbesten freien Platz. Gegen-über saß dieser Typ, zwinkerte mir freundlich zu und ver-sicherte der Großmutter, dass er ebenfalls bis Münchenfahre und gerne so lange ein Auge auf mich habe.
Die nächsten sechs oder sieben Stunden, so langebrauchte der Intercity damals für die Strecke, spielten wirKniffel, Mau-Mau und Stadt, Land, Fluss. Zwischendurchzog er sich immer mal wieder hinter Mappen, Zeitschriftenund Zeitungen zurück. Das Warten, bis er wieder zu einerRunde bereit war, kam mir endlos lang vor. Aber ich wolltenicht drängeln. Mir war wohl die Gefahr zu groß, dass erdie Lust am Spielen verlieren könnte.
In München nahm er mich mit aus dem Zug und über-gab mich auf dem Bahnsteig meinen Eltern. Mein Vater,der damals auch einen Schnauzbart trug, wenn auch einenkonventionellen (er ist Ingenieur), erkannte ihn sofort:„Sind Sie nicht Luigi Colani, der Designer?“ Mein Spiel-gefährte bejahte, gab uns die Hand und entschwand.
Worüber wir während der Fahrt geredet haben, weißich leider kaum noch. Aber auf meinen Berufswunsch Fuß-ballprofi reagierte er viel positiver als andere Erwachsene.Er machte mir sogar Mut, es unbedingt zu versuchen.
Einige Wochen danach kauften meine Eltern die vonColani entworfene Vase „ab ovo“. An dem Tisch mit derVase erzählte mein Vater die Geschichte von der Zugfahrtspäter immer wieder, jahrelang. Andreas Krobok
Fast wie in den Siebzigern: Die Arctic Monkeys – vorne Alex Turner – zwängten sich 2009 für einen Auftritt in Köln in echt enge Jeans.
Andreas Krobok, Leiter der FAZ.NET-Audio-/Videoredaktion,links im Alter von zehn Jahren, trauert um einen Spielgefährten.Der Designer Luigi Colani, rechts im Jahr 1997 zu sehen, istam 16. September im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe gestorben.
Sie kann ihn förmlich riechen: Das neue Parfum von HediSlimane für Celine verbindet dieses antike Paar. FO
TOS
TH
OM
AS
BR
ILL
,PR
,DP
A,P
RIV
AT
PRÊT-À-PARLERVIELE DÜFTE, ABER KEIN ACCENT MEHR BEI CELINE
Hedi Slimane hat mehr Ideen, als in eine Modekollektionpassen. Es verwundert also nicht, dass er für Celine nunauch Parfums entworfen hat. Grundlage für die neunDüfte, die in diesem Herbst im Münchner Flagshipstoreund der neuen Boutique in Frankfurt erhältlich sind, wardas Tagebuch des Designers. Darin hatte er Momente sei-ner Reisen und seiner Streifzüge durch Paris festgehalten.Die spiegeln sich nun in den Namen der Düfte wieder:Dans Paris, La Peau Nue, Eau de Californie.
All diese Düfte durchzieht eine pudrige Note, der Restist eine Hommage an olfaktorische Erinnerungen desMode-machers und an französische Parfums der sechziger undsiebziger Jahre. Saint-Germain-Des-Près zum Beispiel feiertdas Pariser Viertel mit weißen Neroli-Blüten, cremigerIriswurzel und vanillewarmem Heliotrope. La Peau Nuebeschwört den Duft nackter Haut mit Rose, Reispuderund Vetiver. Reptile wird mit Pfeffernoten, Moos undLeder animalisch. Slimanes Düfte sind androgyn – sowohlMänner als auch Frauen können sie tragen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Slimane Parfums entwwt irft.Als er im Sommer 2000 Kreativdirektor für die Männer-linie von Dior wurde, brachte er nicht mal ein Jahr später
das Dior-Homme-Parfum Higher auf den Markt. Nebenklassischer Mode auch Accessoires und Düfte anzubieten,erweitert die Zielgruppe auf jene, die für weniger Geldein bisschen Luxus besitzen wollen. Bei Dior wuchs derUmsatz unter Slimane stark. Und in seiner Zeit als Kreativ-direktor von Saint Laurent (2012-2015) verdreifachte sichder Umsatz des Hauses auf rund eine Milliarde Euro.
Auch Celine richtet Slimane nun neu aus. Im Januarbrachte er für das Label die erste Männerkollektion heraus.Gegen den Streetwear-Trend setzt er schmale Silhouetten,statt Sneaker trugen die Models polierte Lederschuhe. DieDamenkollektion holte klassische Celine-Schnitte zurück:Seidenblusen, Faltenröcke, Halstücher. So geradlinig wiediese Mode kommt auch das Design der Flakons und derVerpackung daher. Rechteckig geschliffene Flaschen, aufden weißen Etiketten der schwarze Celine-Schriftzug, der2018 von Slimane um den Accent aigu gebracht wurde.
Preislich liegt diese Haute Parfumerie über der Kon-kurrenz: 100 Milliliter gibt es ab 190 Euro. Am ehesten istes zu vergleichen mit Sondereditionen wie Les Exclusifs vonChanel oder Les Créations des Monsieur Diors. Fans vonNischendüften wittern hier ihre Chance. MariaWiesner
22 PRÊT-À-PARLER
FOTO
SH
ER
ST
ELL
ER
(2),
SIM
EO
NO
RT
MÜ
LLE
R
Alter Maaann mit Mantel: GGGrcicsZeichnunnngen auf T-Shirts von Boss.
„WER WÄRE ICH, DAS JACKETT NEU ZU ERFINDEN?“Herr Grcic, Sie sind eigentlich Möbeldesigner, haben jetztaber Kleidungsstücke für Boss entworfen. Wie unterscheidetsich diese Zusammenarbeit von Ihren sonstigen Projekten?Die Arbeit an diesem Projekt war ganz anders als sonst.Normalerweise fängt ein Entwurf mit der Konzeptionan: Was ist das überhaupt, was ich entwerfen will?Für Boss habe ich nicht etwas von Grund auf neuentworfen. Es gab klare Vorgaben: Es sollten ein Jackettund ein Mantel sein, als Teil der Herbst-Winter-Kollek-tion 2019. Und wer wäre ich zu sagen: Ich erfinde dasJackett neu? Ich habe die Kleidungsstücke mit dem Blickvon außen und mit meiner Erfahrung aus verwandtenDisziplinen kommentiert, in Form von Interventionen.Mir hat diese Arbeit großen Spaß gemacht, weil ichdabei viel gelernt habe.
Was für Interventionen sind das?Für Hugo Boss ist das Herren-Jackett eines der Schlüssel-stücke jeder Kollektion. Mein Entwurf sieht aus wieein richtiges Jackett und ist auch wie ein richtiges Jackettkonstruiert. Die wichtigsten Veränderungen haben wirbei den Taschen vorgenommen. Mit ihnen markierenwir eine Art horizontalen Schlitz am Oberkörper.Deswegen verläuft die Brusttasche auch gerade undnicht wie gewöhnlich schräg. Dasselbe Detail findetsich an den Ärmeln wieder. Außerdem haben wir einenKnopf weggelassen. Das Jackett ist eigentlich ein ty-pisches Zwei-Knopf-Modell, aber den unteren brauchtman doch sowieso nicht. Die erste Reaktion des Teamsin Metzingen war: Das können wir nicht machen!Für mich war das keine große Sache, aber für Hugo Bossstellte das eine Art Bruch dar.
Das Thema der Herbst-Winter-Kollektion 2019 ist Reisen.Inwiefern hat das eine Rolle gespielt?Wenn man unterwegs ist, hat man viele Dinge dabei,die man nah am Körper tragen möchte. Gleichzeitigleicht erreichbar und gut geschützt. Deshalb haben wirim Jackett so viele Innentaschen untergebracht, wiewir nur konnten. Sie bestehen aus einem durchsichtigenMaterial und sind eingeklebt, nicht genäht. Genausobeim Mantel, nur dass einige der Taschen hier mitReißverschlüssen geschlossen werden.
Was macht den Mantel sonst noch aus?Den Mantel kann man auf zwei Arten tragen.Wenn man die Front wie ein Revers umklappt, wirkter wie ein richtiger Mantel. Geschlossen, mit hoch-geklapptem Kragen, wirkt er wie ein Outdoor-Teil,sehr funktional.
Sie haben auch mit Illustrationen gearbeitet.Es gibt diese Figur des alten Mannes mit Mantel undHut, die ich schon vor vielen Jahren erfunden habe. Ertaucht in der Kollektion auf den Innentaschen auf und indrei Illustrationen für T-Shirts. Ich finde, der alte Mannist eine interessante Figur. Einerseits hat er viel Lebens-erfahrung, er ist weise. Andererseits ist er ein wenigbefremdet. Ab einem gewissen Alter halten wir ja nichtmehr mit den neuesten Entwicklungen mit, zum Bei-spiel in der Technologie. Die Zeichnungen haben etwasSchrulliges. Ich sehe das als etwas sehr Spielerisches.
Warum hat Hugo Boss Sie denn gefragt?Wir haben schon einmal zusammengearbeitet, bei derGestaltung der Yacht für den britischen Segler AlexThomson, mit der er an der Vendée Globe teilgenommenhat. Boss ist Thomsons Sponsor und lud mich ein, dasÄußere des Boots zu gestalten. Sie wussten also, dassman mit mir gut zusammenarbeiten kann. Weil es mirnicht darum geht, nur mein eigenes Ding durchzuziehen.Ich versuche immer, mich stark auf eine Kooperationeinzulassen.
Sie haben schon mehrfach für Modeunternehmen gearbeitet,etwa für Prada oder kürzlich für das junge Label Aeance.Was interessiert Sie an Mode?Mode mag und verfolge ich, aber ich bin nicht Teil derModewelt und habe auch keine Ambitionen, Mode zumachen. Was mich interessiert, ist Kleidung, sie ist essen-tiell, hat viel mit unserem Körper zu tun und ist Aus-druck davon, wer wir sind und was wir sein wollen. Esgibt so viele Parallelen zum Produktdesign. Das gilt auchfür das rein Handwerkliche: Man baut etwas aus einemMaterial. Ich habe schon seit 15 Jahren eine Nähmaschineim Büro, wir nähen viel. Die Frage ist: Wie geht esjetzt weiter? Nach diesen Erfahrungen möchte ich gerneMöbel aus Stoff machen. So wie man eine Jackekonstruiert, könnte man ja auch Möbel konstruieren –denke ich mir jedenfalls. Das wird Spaß machen.
Die Fragen stellte Jasmin Jouhar.
Konstantin Grcic führt seit 1991 ein Studio fürIndustriedesign, seit vergangenem Jahr in Berlin.Er entwirft Möbel und Produkte, aber auchSzenografien für Ausstellungen. Seine Kollektionfür Boss ist jetzt online und in ausgewähltenBoss-Geschäften erhältlich.
PRÊT-À-PARLERDAS BESTE
ZUM ABSCHLUSS,WENN MAN
ES DENN SIEHT
Obwohl Designhochschulen Abschlussarbeiten oft imRahmen von Jahresausstellungen präsentieren, ist es fürtalentierte Schulabgänger schwer, öffentliche und fach-liche Aufmerksamkeit zu bekommen. Gerade für inter-nationales Publikum fehlte bislang ein Überblick. Des-halb entstand die Idee, einen Verbund vieler deutscherDesign-Hochschulen zu gründen. Den gibt es jetzt, undseine gemeinsame Ausstellung trägt den Namen „GermanDesign Graduates“. Die Ausstellung will nicht nur talen-tierte Studenten auszeichnen, sondern hat auch das Ziel,Design, Alltag und Forschung in Einklang zu bringen.Dafür zeigt sie acht Themen, mit denen sich die jungenAbsolventen auseinandergesetzt haben – alle vor demHintergrund des Klimawandels.
Im Themenbereich „Alltag“ werden Alltagsobjektepräsentiert, die in Verbindung mit Funktionalität, Nach-haltigkeit und Produktion das tägliche Leben positivbeeinflussen. Mit Greta Thunbergs Ozean-Überquerungrückt auch der Themenbereich „Freizeit & Reisen“ in dengesellschaftlichen Fokus. Reisen sind einerseits zu einemGut geworden, das sich jeder leisten kann. Andererseitsfragen sich viele, wie Reisen nachhaltiger werden können.
Im Themenbereich „Transport“ beschäftigen sich jun-ge Designer mit der Frage, wie sich die Infrastruktur aufdas Leben des Einzelnen und auf die Umwelt auswirkt.Dabei bekommt das Thema „Material“ einen besonderenRang. In einer Wegwerfkultur, die besonders mit Umwelt-problemen zu kämpfen hat, versuchen die Designer, alter-native und nachhaltige Materialien für unsere Zukunftaufzuzeigen.
Wie man sich in der digitalen Welt bewegen kann,ohne die Verbindung zum Realen zu verlieren, erklärendie Designer im Themenbereich „Analog & Digital“. Inden vergangenen Jahrzehnten erklang in den meistenClubs der Großstädte digitale Musik. Natürliche Klängeverschwinden aus dem Wahrnehmungsspektrum. Das istein Thema im Bereich „Ton & Musik“. Immer kleinerwerdende Lebens- und Arbeitsräume und deren Aus-wirkungen werden im Bereich „öffentlicher Raum“beleuchtet.
Bei alledem spielt der aktuelle Stand der Wissenschafteine große Rolle, und deswegen lautet der letzte Themen-block „Forschung“. Hier fragen die jungen Designerdanach, wie man in Zukunft mit nachhaltigen Methodendie Lage für Design und Designer verbessern kann. Dieerste „German Design Graduates“-Schau ist im Kunst-gewerbemuseum in Berlin zu sehen. Eröffnet wurde sieam Donnerstag. Sie wird etwa einen Monat lang gezeigtund von Veranstaltungen begleitet. Artur Weigandt
Simeon Ortmüller hat das Projekt „CAPTin Kiel“ (CleanAutonomous Public Transport in Kiel) entwickelt. Autonomeund emissionsfreie Busse und Fähren sollen die BewohnerKiels mobiler machen – und ihnen mit der „Floating Platform“ein neues Wahrzeichen schenken.
Ducale
24 PRÊT-À-PARLER
FOTO
SA
FP
(3),
DP
A
DIESES GEMÜSE KÖNNTEDIE INSEL RETTEN
Die spinnen, die Briten! Tun sie es nicht? Auf die Hilfe desGalliers Obelix, der in den Zaubertrank fiel und seitherüberirdische Kräfte hat, hätte Richard Mann wohl nurzu gern zurückgegriffen – um seinen 291,7-Kilogramm-Kürbis (Bild unten) zur Harrogate Autumn Flower Showin der englischen Grafschaft North Yorkshire zu bringen.Sogar der elektrische Palettenschieber kapitulierte unterder Last der übergroßen Panzerbeere. Also musste Mann,der seinen Namen offenbar vollkommen zu Recht trägt,selbst mit anschieben. Der Körpereinsatz zahlte sich aus:Überlegen gewann der Gemüsezüchter aus Leeds denersten Preis in der Kategorie der schwersten Kürbisse.
War es seine Freude an der vielsamigen Frucht? Oderwar dieser Mann einfach nur erschöpft? Jedenfalls machteer es sich nach der verdienten Ehrung erst einmal aufdem unförmigen Ungetüm bequem.
Craig Pearson hingegen hatte von vornherein gutlächeln. Denn auch wenn ein Kohlkopf schwer ist, wiegt ergerade einmal 27,4 Kilogramm. Von einer Person vomSchlage Pearsons ist er also leicht mit der Schubkarre aufsWettbewerbsgelände zu schieben (Bild oben). Platz einsin der gewichtigsten Kohlkategorie!
Auch die Frage „Wer hat die längste Gurke?“ musstein Harrogate geklärt werden, denn seit 2011, seit demhundertsten Geburtstag der Blumenschau, gibt es denWettstreit um alle möglichen Riesengemüse. GrahamBarratt aus Gloucester (Mitte rechts), dessen bestes Stück92 Zentimeter misst, war den anderen eine Nasenlängevoraus. „Ich fühle mich geehrt, der Gewinner der längstenGurkenkllk asse zu sein“, sagte er derWebsite „GloucestershireLive“, die nebenbei aufdeckte, dass der Züchter auf einbiologisches Potenzmittel namens Carbon Gold BiologyBlend zurückgreift.
Vielleicht ist die Show im Norden Englands, wo eineMehrheit für den Austritt aus der Eurpopäischen Unionvotierte, aber nicht nur sinnbildlich für ein Volk, das sicham Bizarren erfreut. Vielleicht sind die Unwägbarkeiten –Brexit? Nicht Brexit? Wie Brexit? – leichter zu ertragen,wenn man schon mal eine Anbauschlacht vorbereitet.Auch wenn manches prämierte Riesenerzeugnis kaum inden Garten einer insularen Doppelhaushälfte passt.
Ein Mittel zur Lösung dieses Platzproblems wärewomöglich der Anbau von Lauch. Denn wie weit auchimmer sich Allium ampeloprasum in alle Richtungenentfaltet: Die Blätter, die diesen beiden Herren die Weltbedeuten (Mitte links), lassen sich, thank God, schönordnen. Und leicht ist der Lauch auch. Man braucht nichteinmal übernatürliche Kräfte, man kann ihn sogar mitspitzen Fingern halten. Niklas Zimmermann
PRÊT-À-PARLERWWW.STONEISLAND.COM
SPOR
TSWE
ARCO
MPAN
YGE
RMAN
YGM
BH_+49(0
)8935
8927
30KE
ITUM
/SYL
T_C.
-P.-HA
NSEN
-ALL
EE1
MÜNC
HEN_
MAXI
MILI
ANSTRA
ßE27
HAMBU
RG_H
OHEBL
EICH
EN22
711PA PAINTBALL CAMO_COTTON/CORDURA®FISHTAIL ANORAK MADE OF A RESISTANT COTTON REP BLENDED WITH ULTRA-TWISTEDCORDURA® YARNS. CORDURA® LENDS EXTRA STRENGTH AND TENACITY TO THE FABRIC. THEGARMENT IS DYED WITH THE ADDITION OF AN ANTI-DROP AGENT. THE EXCLUSIVE CAMOUF-LAGE APPEARANCE, DIFFERENT ON EACH GARMENT, IS OBTAINED BY ‘SHOOTING’ COLOURSON THE FINISHED GARMENT THROUGH AN INNOVATIVE TECHNIQUE. ALSO THE STONE ISLANDBADGE. THE PIECE IS PADDED WITH PREMIUM FEATHERS. LARGE PROTECTIVE HOOD WITHDRAWSTRING AND THROAT FLAP WITH SNAPS, WITH INNER SECOND DETACHABLE HOOD INWOOLLEN FELT. THE FISHTAIL BOTTOM CAN BE SHORTENED USING THE SNAPS.
26 PRÊT-À-PARLER
FOTO
SP
RIV
AT,
AT
ELI
ER
ME
ND
INI
PRÊT-À-PARLER
„ZUERST DIESE WAGENREIHUNG – UND JETZT DAS“Es war ein ungewöhnlich kalter Oktobertag, an demsich im ICE 105 von Köln auf dem Weg nach Basel, eineViertelstunde vor dem Halt am Fernbahnhof des Frank-furter Flughafens, zwischen einer älteren Dame und ihremGatten folgender Dialog entspann:
Sie: „Wir sind gleich da, hol doch bitte schon maldie Koffer.“
Er geht zur Koffff erablage und kommt mit einem Koffff er zurück.Er geht wieder zur Koffff erablage, sucht kurz, dreht sich um,sucht weiter und kommt kopfschüttelnd zurück.Er: „Ich finde nur einen Koffer.“Sie: „Und wo ist der andere?“Er: „Den finde ich ja nicht.“Sie: „Der wird ja nicht weg sein.“Er: „Ich schaue noch mal.“Sie: „Ja, schau doch noch mal.“Er geht den ganzenWagen ab. Überprüfttf Stauräume,Ablagen zwischen den Sitzen. Nichts.Er: „Der ist nicht da.“Sie trinkt Apfelschorle.Sie: „Hast du den Anhänger drangemacht, den ich
gekauft habe?“Er: „Ja, habe ich.“Sie: „Und das Kofferband?“Er: „Ja, das auch.“Sie: „Schau doch mal in dem anderen Wagen.“Er verlässt denWagen und kommt einige Minuten späterwieder.Er: „Der ist da auch nicht.“Sie: „Wo ist er denn dann?“
Früher wurde sie nur von Drogendealern getragen, umStoff zu verkaufen, heute ist sie en vogue: Die Bauchtascheist innerhalb von vier Jahren zum Massenphänomen ge-worden. In der Tschechischen Republik wird sie „die tsche-chische Geschmacklosigkeit“ genannt. Das trifft es gut.
Wo die Ursprünge der Bauchtasche liegen, ist bis heuteungeklärt. Womöglich ist sie auf die Gürteltasche des5000 Jahre alten Ötzi zurückzuführen. Wahrscheinlicherist jedoch, dass die urbane Bohème ein altes „Bravo“-Heftaus den Zeiten der Eltern gefunden oder ein Polaroidbildvon einemMallorca-Trip gesehen hat. Da hätte die Bauch-tasche auch Sinn, nämlich handlich, praktisch und sicherzu sein.
Doch wenn man heutzutage in Berlin, Köln oderHamburg aussteigt, sieht man Jugendliche, die in ihrenRaver-Jacken, weißen Buffalo-Sneakern und Bauchtaschenfast uniformiert durch Kreuzkölln, Ehrenfeld und Schanzen-viertel spazieren. Dann merkt man, dass der Drang zurIndividualisierung seine eigenen Kinder frisst.
Burberry, Gucci, Louis Vuitton und natürlich dieBilliganbieter haben sich den Trend umgebunden. Dabeiergibt sich aus den Taschen keinerlei ästhetischer Mehr-wert. Sie lenken den Blick weg von der KllK eidung hin zu derTasche und machen damit das restliche Outfit obsolet.Jeder, der eine Bauchtasche trägt, sieht plötzlich aus wie einübermüdeter Raver oder ein seltsamer Drogendealer.
Vor allem zeigt der Trend, dass die Generation derBauchtaschenträger keinen großen Drang zur Innovationzu haben scheint. Eher wollen sie das Bestehende reformie-ren, immer in Richtung achtziger Jahre.
Auch andere Retro-Phänomene wie die Wiederverwer-tung vonModernTalking durch Capital Bra oder Kay Onesind modern geworden. Der Bauchtaschenträger begreiftsich absichtlich als rückwärtsorientiert. Er will sich gerade-zu verzweifelt von der Hochkultur abgrenzen, obwohl dieBauchtasche schon seit 2015 imMainstream angekommenist. Und dort ist er auch geblieben.
Denn kaum eine Tasche bietet nur vermeintlich soviel modischen Handlungsspielraum wie die Bauchtasche,sei es leger mit Jogginghose und T-Shirt oder klassisch mitRollkragenpullover und Chinohosen.
Es funktioniert, und es ist praktisch. Aber nur weil espraktisch ist, muss es nicht ansprechend sein. Vor allem,
Vor 25 Jahren wurde der Neubau des Groninger Museumseröffnet. Chefarchitekt war Alessandro Mendini, beteiligtwaren zudem die Architekten Michele De Lucchi, PhilippeStarck und Coop Himmelb(l)au. Das Kunstmuseum aufeiner Insel der niederländischen Stadt Groningen setzt sichaus unterschiedlich gestalteten Pavillons zusammen, dermarkante gelbe Turm beherbergt Teile des Depots. Mendi-ni, der im Februar im Alter von 87 Jahren in Mailand ver-starb, hatte anlässlich des diesjährigen Jubiläums schon vorzwei Jahren begonnen, eine Ausstellung über sein eigenesSchaffen vorzubereiten. Museumdirektor Andreas Blühmließ dem großen italienischen Designer freie Hand. An die-sem Samstag wird die Schau „Mondo Mendini – Die Weltvon Alessandro Mendini“ fürs Publikum geöffnet.
Die Ausstellung zeigt einen Querschnitt durch Mendi-nis umfangreiches Werk, darunter eine drei Meter hoheRiesenversion des kuriosen Kitschsessels Poltrona di Proustaus der Fondation Cartier. Auch die aus drei Kreisen beste-hende LED-Leuchte Amuleto darf nicht fehlen, Mendinihatte sie eigens 2013 für seinen Enkel entworfen. Sie sollteihm Glück bringen, die drei Kreise symbolisieren Sonne,Mond und Erde. Zu Ehren Mendinis stellte der KoreanerBang-ung Song bereits am Freitag mit dem Hersteller derLeuchte Ramun eine limitierte Sonderedition im Gronin-ger Museum vor: Amuleto Pearl. Jede der 17 Leuchten istmit schwarzem Lack und 1566 Perlmuttsplittern verziert.Die dafür verwendete Technik heißt Najeon-jang – und sieist mehr als 1000 Jahre alt. (pps.)Die Ausstellung „Mondo Mendini“ ist bis zum 5. Mai 2020 im GroningerMuseum zu sehen.
WARUM BAUCHTASCHEN VERBANNT GEHÖREN
MONDO MENDINI
Er: „Ich weiß es nicht. Der Schaffner sagt, der kann nichtweg sein, der Koffer.“
Sie: „Dann würde er ja da sein, wenn er nicht weg wäre.“Er: „Der Schaffner sagt . . .“Sie: „Lass mich jetzt einfach in Ruh’.“Er: „Der Schaffner . . .“Sie: „Schluss mit den Erklärungsversuchen!“Sie schweigen sich an. Sie trinkt Apfelschorle.Er: „Der Schaffner hat gesagt, dass Taschendiebe in Köln
unterwegs waren.“Sie: „Und was wollen die mit meinem Koffer?“Er: „Es besteht die Möglichkeit . . .“Sie: „Schieb dein Eigenversagen jetzt nicht auf andere.
Ich warne dich!“Er: „Ich . . .“Sie: „Ruhe!“Der Mann verzweifelt zusehends. Er kramt in der Netztascheam Sitz.Sie: „Denkst du, da findest du ihn?“Sie trinkt Apfelschorle. Er versucht, versöhnliche Töneanzuschlagen.Er: „Vielleicht schaffen wir es ja mit einem Koffer.“Sie: „Wir fllf iegen nach KENIA!“Er: „Lass uns doch die Reise davon nicht verderben lassen.“Sie: „HANS-HERBERT! Da sind Kosmetika drin!
Schuhe! Das brauche ich alles!“Er: „Das passiert halt manchmal.“Sie: „DEIN Koffer ist ja auch noch da!“Er: „Wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen.“Sie: „Zuerst diese Wagenreihung – und jetzt das. Tut mir
leid, aber das ist zu viel.“
Sie schweigen sich an. Ein Zugbegleiter kommt vorbei und sagttg ,er habe den beschriebenen Koffff er im ganzen Zug nicht gefunden.Sie: „Hast du den Koffer überhaupt eingepackt?“Er: „Ich meine ja.“Sie: „Meinst du also.“Er: „Wir haben doch gemeinsam das Taxi zum Bahnhof
genommen.“Sie: „Und war da der Koffer noch da?“Er: „Ich meine ja.“Sie: „Und weißt du es auch?“Er: „Du warst doch dabei!“Sie: „Ich habe nicht darauf geachtet.“Er: „Aber kannst du dich erinnern . . .“Sie: „Die Koffer unterlagen die ganze Reise über deiner
Verantwortung, Hans-Herbert.“Der Zug fährt in den Flughafenbahnhof ein.Sie: „Und jetzt? Ich steige hier nicht aus.“Er: „Jetzt komm.“Sie: „Du kannst ja aussteigen mit deinem Koffer.“Er: „Wir kaufen dir alles neu im Urlaub.“Sie: „Das gibt es da alles nicht, was ich brauche.“Er: „Früher wäre das doch auch kein Problem gewesen!“Sie: „Das kann nur jemand sagen, dessen Koffer nicht
verloren ging.“Dem Mann platzt der Kragen: „Man kann mit dir auchnicht verreisen. Du bist nur gut zum Zuhausebleiben. Dumeckerst zu viel.“Das sitzt. Sie steigt schweigend, aber erhobenen Hauptesaus, er hievt den Koffff er hinterher.„Du hast recht, Hans-Herbert“, sagt sie. „Flieg du nachKenia. Ich bleibe hier.“
Aufgezeichnet von Florian Siebeck.
Aus „Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf“.Das Buch, herausgegeben von Maria Wiesner, erscheint am 14. Oktoberbei Harper Collins, hat 208 Seiten und kostet zehn Euro.
wenn die Bauchtasche bei manchen Trägern so wirkt, alswäre sie ein übergroßer Tumor.
Die Bauchtasche ist ein Mainstream-Produkt einerZeit, in der Alltagsmode nicht davon geprägt ist, dass siehandhabbar ist, sondern davon, dass man seine Einzig-artigkeit ausdrücken möchte. Damit führen die Trägerden Sinn der Tasche ad absurdum: Sie sprechen ihr dasdeutsche Urlaubsklischee ab und nehmen dem Drogen-dealer, dem Rapper und dem Gangster seine Credibility.
Denn wenn jeder eine Bauchtasche trägt, kann auchjeder Drogendealer sein. Dann kann im Umkehrschlussjeder gleich sein – und das ist sicherlich nicht der Zweckder Mode, denn das ist Gleichmacherei.
Man könnte auch, nur zum Beispiel, seine Wertsachenin die Innentasche einer Jacke stecken. Dafür wurdenschon vor Jahrhunderten Innentaschen entwickelt.
Oder, wow, wie wär es mit einer Umhängetasche? Undwenn man eine Bauchtasche auf dem Rücken trägt, dannkann man sich auch gleich einen Rucksack anschaffen.Oder, um das Hipster-Bedürfnis zu befriedigen: Mit einemkllk assischen Seemannsbeutel kann man zumindest auf einenRave gehen. Artur Weigandt
27VITA OBSCURA
Von Simon Schwartz
28 GESCHICHTE
rüfung bestanden“. Als Marianne Burbott diezwei dürren Worte auf dem Telegramm liest,das am Mittag des 6. September 1969 in ihremBriefkasten liegt, ist sie erleichtert. Geradehatte sie an der Erweiterten Oberschule BadFreienwalde zwei Doppelstunden Deutsch undEnglisch unterrichtet, als wäre es der normalsteSamstag der Welt, danach ihre Tochter Anja
von der Krippe abgeholt. Doch nun, endlich: „Prüfungbestanden!“ Das vereinbarte Codewort. Nach 15 Mona-ten zähen Wartens, drückenden Schweigens, fehlgeschla-gener Pläne und Drohungen der Stasi soll die perfekteFlucht beginnen. „Irgendwann willst du nur noch, dasses losgeht“, sagt sie, „egal wie die Sache ausgehen wird.“
Der Achtundzwanzigjährigen ist zu diesem Zeitpunktlängst klar, dass sie in der DDR unter Beobachtung steht.Sie hatte sich verdächtig gemacht, weil sie Abzeichen derwestlichen Friedensbewegung trug, weil sie ins kommu-nistische Ausland gereist war und dort Westdeutschenbegegnete, was ihr als Lehrerin eigentlich verboten war.Erst recht war sie verdächtig, als die Stasi Wind davonbekommen hatte, dass für ihre Schwangerschaft ein HansBaumans aus Leverkusen verantwortlich war.
Für eine DDR-Lehrerin war das eine außergewöhnli-che Situation. Daher muss an jenem Samstag im Septem-ber alles so wirken wie immer. Die Wohnung, so hatten esBaumans und Burbott abgesprochen, muss aussehen, alswürde die junge Mutter nur eben ein paar Besorgungenmachen. Keine Reisetaschen dürfen beim vermeintlichenSpaziergang mit Kinderwagen darauf hindeuten, dass essich um den Beginn einer Flucht handelt.
Das Kind, das gerade an Durchfall leidet, wird gefüt-tert und gewickelt, ein Sedativum aus dem Westen soll esspäter beruhigen. Marianne Burbott hat vier Stunden, umrechtzeitig am Bahnhof Michendorf im Südwesten Ber-lins zu sein. Dort soll Baumans sie abholen und in derDämmerung durch ein Wäldchen zu seinem VW Käferführen, der auf dem Rastplatz Michendorf am Rand derTransitstrecke geparkt sein soll. Mit einem gefälschtenPass für sie im Gepäck sowie den passenden Ein- undAusreiseformularen – sofern alles so geklappt hat, wie sich
Vor 50 Jahren verhalfHans Baumans seinerLebensgefährtin undihrem gemeinsamenKind zur Flucht ausder DDR – mit einemprivaten Fälscherzirkel.Von Martin HäuslerFotos Stephan Pick
FreieFahrt
PBaumans das gedacht hat. In den vergangenen Monatenhatte der Beamte aus demWesten die Lücken im Ein- undAusreisesystem der DDR untersucht und war dabei aufeine clevere, aber auch riskante Lösung gestoßen.
Ihre Liaison hatte im Sommer 1967 am Goldstrandvon Varna begonnen, dem Ort, der damals der Welt vor-machen sollte, dass man auch im sozialistischen Bulgarienauf Augenhöhe mit Miami sein kann. Marianne Burbottund Hans Baumans waren beide ohne große Absichtenans Schwarze Meer gereist. Sie wollte mit ehemaligenStudienfreundinnen den Sommer genießen, er musste voneinem Freund überredet werden, mit in eine Region zureisen, die er bisher gemieden hatte. Schon nach wenigenTagen begegneten sich West und Ost in einer Diskothek,alle mochten einander, besonders Marianne und Hansfanden sich sympathisch.
Der unsichtbare Reisebegleiter der Stasi schrieb in sei-nem Bericht: „Burbott hat Kontakt zu westdeutschenBürgern unterhalten und über ihre Verhältnisse gelebt.Sie verkehrte ständig mit ihnen im Hotel. Nachtbar bisca 4 Uhr geöffnet.“ Sie selbst sagt heute: „Ich bedauertees sehr, dass wir Abschied nehmen mussten nach demUrlaub.“ Und als müsste er sich heute noch einmal recht-fertigen, sagt Hans Baumans: „Es war zwecklos, dass mansich weitergehende Gedanken machte. In den Sechzigernwar es sehr schwierig, Ost-West-Beziehungen zu führen,geschweige denn den Anderen rüberzuholen. In dieserZeit wurde die DDR schon als Bedrohung empfunden,damit wollte niemand etwas zu tun haben. Und in denOsten überzusiedeln kam für mich nie in Frage, ich wäredort grenzenlos gescheitert.“
Ende Mai 1968 besuchte Hans Marianne für einigeTage in Bad Freienwalde. Beide haben den Besuch inschöner Erinnerung. Er tauchte in eine andere Welt ein.Gleichzeitig schien beiden eine dauerhafte Beziehungnicht möglich, zu krass waren die politischen Gegensätze.Der Mauerbau, gerade einmal sieben Jahre her, ersticktejeden Gedanken an ein Miteinander zweier deutscherStaaten. Die vielen Fluchtversuche, die tödlich endeten,zeigten, dass die Mauer ein fast unüberwindbares Boll-werk war.
um mit der neuen Situation zurechtzukommen.“ Nochmehr beschäftigte ihn der Gedanke, wie es weitergehensollte. Telegramme wurden geschrieben, sie vereinbartenein schnelles Treffen am Bahnhof Friedrichstraße in Ost-berlin. „Erwarte mich Samstag ab 11 Friedrichstraße“,protokollierte die Stasi mit.
An besagtem Datum wurde Hans Baumans nicht nurvon seiner Urlaubsbekanntschaft erwartet. Er musste dieSchlange der Einreisenden am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße in Ostberlin verlassen und wurde befragt.Beim Entleeren der Taschen kam der Brief zum Vor-schein, den Marianne ihm Anfang des Monats geschrie-ben hatte. An diesem 31. August hielt die Stasi fest: „Auseinem Brief der DDR-Bürgerin ging hervor, dass sie sichin einem tiefen seelischen Konflikt befindet und ein Kindvon B. erwartet. Sie sieht dadurch ihre berufliche Lauf-bahn als zerstört. Bei der kurzen Unterhaltung gab der B.Auskunft, war aber nicht besonders zugängig. Aus demGespräch ging hervor, dass er sich nicht mit der Absichtträgt, die DDR-Bürgerin zu heiraten.“
Hilflosigkeit überschattete das Treffen. Baumans undBurbott gingen spazieren, um nicht belauscht werden zukönnen. Sie waren sich einig, dass sie zusammenbleibenwollten. In den folgenden Wochen lotete das Paar aus, aufwelchen Wegen eine offizielle Übersiedlung von Marian-ne in die BRD möglich sein könnte. Sie versuchten es beidem bekannten DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel. Erhatte von sich reden gemacht, weil er an der Zusammen-führung von Bürgern mit ihren Familien in der Bundes-republik beteiligt war. Vogel war es auch, der in densiebziger und achtziger Jahren im großen Umfang denFreikauf politischer Gefangener aus DDR-Haft in denWesten organisierte – für Sachleistungen und Geld imWert von mehreren Milliarden Mark.
Das erste Treffen mit dem Anwalt verlief ernüchternd.Die politische Situation sei katastrophal, alles werde ab-gelehnt. Beide konnten nicht ahnen, dass Vogel ihr An-sinnen unmittelbar der Stasi übermittelte. Auch Fach-anwälte in Westberlin machten keine Hoffnung. Dass
sich mit Baumans’ Anliegen an Heinrich Köppler zu wen-den, damals Parlamentarischer Staatssekretär im Innen-ministerium. Köppler schrieb wenige Wochen später: „Imgegenwärtigen Augenblick kann ich Ihnen nur wenigHoffnungen auf eine schnelle Regelung machen, da demerhebliche politische Schwierigkeiten entgegenstehen.“
Es war inzwischen Dezember, Marianne Burbott imsiebten Monat, und die Phantasie schien ausgeschöpft.Baumans wurde bewusst, dass eine legale Zusammenfüh-rung kurzfristig nicht möglich war. Also begann er, übereine Flucht nachzudenken. 1968 arbeitete er als Organisa-tionsberater bei der Stadt Leverkusen, betreute mehrereDienststellen. Er hatte einen guten Draht zu Hans Ge-rold, dem Leiter des Einwohnermeldeamts. Mit dessenHilfe beschaffte er einen Westpass für die Mutter seineskünftigen Kinds. Mit dem Dokument würde MarianneBurbott über ein sozialistisches Drittland problemlos aus-reisen können. Doch zwei Anläufe scheiterten vorzeitig:Erst musste die Warschauer Variante abgeblasen werden,da Baumans im Gegensatz zu seiner Partnerin keine Ein-reisegenehmigung nach Polen erhielt. Dann scheiterte dieAusreise aus Budapest im letzten Moment, weil die Stasidurch die Beantragung der beiden Auslandsreisen miss-trauisch geworden war.
Vier Tage vor dem geplanten Flug nach Budapeststand ein Mitarbeiter der Stasi vor der Tür von MarianneBurbott. „Ich bat ihn hinein, kochte sogar Kaffee für ihn“,erinnert sie sich. „Ich musste mich sehr zusammenreißen,da ich zu dem Zeitpunkt starke Wehen hatte. Ich steheunter Fluchtverdacht, eröffnete er mir. Das würde fünfJahre Gefängnis bedeuten. Er sei da, um mich zu warnen.Ich sagte ihm, dass wir uns nur treffen wollten, und ver-suchte, alles zu verharmlosen. Ich war bemüht zu zeigen,dass ich vor einer Flucht unglaubliche Angst haben würde.Und natürlich vergaß der geschulte Offizier nicht zusagen, dass in Anbetracht der Schwangerschaft auch dasLeben des Kinds auf dem Spiel stehen würde.“
Die Situation war zu viel für sie, die Wehen wurdenstärker. Kurz nach der Begegnung wurde Marianne Bur-
im Bett würde liegen müssen. Sie telegrafierte nach Lever-kusen: „Wiedersehen jetzt nicht möglich. Krankenhaus.Mao in Gefahr. Deine Marianne.“ Mao, das war derDeckname für ihr ungeborenes Kind.
Auch Oberleutnant Hoppe, der unerwartete Besucher,brachte etwas zu Papier. In fehlerhaftem Deutsch tippte erin seine Schreibmaschine: „Ihr wurde zu verstehen gege-ben, das Sie, sollte sie sich bei ihrer bevorstehenden Reisenach Budapest tatsächlich mit den Gedanken tragen dieDDR zu verlassen, von diesen zurücktreten soll und alleFolgen aus ihrer Situation tragen müsse da sie bei einerVerwirklichung evtl. Gedanken des illegalen Verlassensder DDR ihr und des Kindes Leben aufs Spiel setzenkönnte, bzw. mit den Gesetzen der DDR in Konflicktkäme. Sie sagte, sie habe nicht die Absicht illegal zu gehen,wüsste auch keine derartigen Wege und Möglichkeiten.(...) Ihre Worte und Darlegungen klangen keineswegsüberzeugend.“
Oberleutnant Hoppe täuschte sich nicht. „Seit derUnterhaltung mit der Stasi war mir klar: Es geht jetztnur noch durch die Höhle des Löwen, über eine der inner-deutschen Grenzen“, sagt Marianne, die heute Baumansheißt. Und das mit einem Säugling, denn vor der Geburtwürden sie nichts mehr unternehmen können. Zwarwagte Hans Baumans am 21. Dezember 1968 noch einenÜberraschungsbesuch im Krankenhaus, eine Stunde lang.Doch Weihnachten und Silvester verlebten Burbott imOsten und Baumans imWesten, niedergeschlagen.
Ende Januar 1969 wurde Marianne von ihrer Mutter,die bei der Volkspolizei arbeitete, nach Hause geholt.Während eines Manövers der Roten Armee in Branden-burg wurde am 1. März Tochter Anja Regis geboren.Sechs Wochen später hielt Baumans sein Kind bei einerTante seiner Partnerin am Ostberliner Müggelsee erstmalsin den Armen. Gefühle? „Es war alles unterkühlt, weil wiralle so unter Druck standen“, sagt er. „Die ganze Euphoriewurde direkt durch den Gedanken erstickt, was nun wer-den würde.“ Und sie sagt: „Jetzt waren wir zu dritt. Aberdie Freude war niedergepresst. Alles war überschattet.“
29GESCHICHTE
Die Einstellung von Hans Baumans änderte sich erst,als er im August 1968 einen Brief von Marianne erhielt, indem sie ihm mitteilte, dass sie von ihm schwanger sei. DieNachricht machte ihn konfus. „Ich brauchte einige Tage,
einer Ausreise zugestimmt werde, sei äußerst unwahrschein-lich. Einen letzten Anlauf nahm Baumans über einennordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten, der aufeinem Flug nach Westberlin neben ihm saß. Er versprach,
bott ins Krankenhaus im 13 Kilometer entfernten Wrie-zen gebracht. Eine Frühgeburt drohte. Es war der 16. De-zember, am 20. hätte sie über Ungarn fliehen wollen. Jetzthieß es plötzlich, dass sie bis zum 1. März bei totaler Ruhe
Dokumente der Flucht:Auch ein verschlüsseltesTelegramm (oben) hatHans Baumans (linksunten) aufbewahrt.
Varna 1967: Marianne Burbott trifft Hans Baumans (ganz rechts).
Marianne steigt mit dem Kind an einem vereinbarten Treff-punkt am Rand der Transitstrecke in den Wagen. Ausreisemit drei Personen und passenden Ausreisedokumenten.
Der banal klingende Plan konnte nur gelingen, wennman die wenigen Nachlässigkeiten im System ausnutzte.Sie ermöglichten es, die DDR über offizielle Grenzstationenzu verlassen. Das ging so: Bei der Einreise von West nachOst bei Marienborn musste das Fahrzeug auf einem Park-platz abgestellt werden. Der Fahrer stieg aus, um in einemGebäude das Transitvisum zu beantragen. Die Mitfahren-den blieben im Auto sitzen. Obwohl allein unterwegs,würde Baumans neben seinem auch den Westpass vonMarianne vorlegen, als würde jemand im Auto auf ihnwarten. Auf den am Schalter auszufüllenden Ein- undAusreisekarten würde der DDR-Beamte „2/1“ – zweiErwachsene, ein Kind – notieren, sie abstempeln und dieKarten für den Transit in die Pässe legen. Danach würdeBaumans zum Auto gehen, die Ein- und Ausreisekartengegen gefälschte Ein- und Ausreisekarten mit der Perso-nenanzahl „1/0“ – ein Erwachsener, kein Kind – tauschen,um dann die Passkontrolle, die nicht im gleichen Gebäudewar wie die Visumstelle, zu absolvieren und in die DDReinzureisen. Mit der danach abermals ausgetauschten –nicht gefälschten – Ausreisekarte mit der Personenanzahl„2/1“ würden Baumans und seine mit dem Kind zugestie-gene Freundin dann nach Westberlin weiterfahren.
Die größte Schwierigkeit war die Fälschung der Ein-und Ausreisekarte für den allein einreisenden Baumans.Dafür war ein Stempel nötig, den sonst der DDR-Beamtebei der Einreise auf das Formular drückte. Dieser Stempelglich einem Kunstwerk. Er war mit filigran gearbeitetenMustern versehen, in die eine Zahl von 1 bis 9 integriertwar. Diese Zahlen und Muster rotierten jeden Tag will-kürlich. Baumans hatte bei seinen Fahrten über die Grenzezahlreiche Stempelabdrücke gesammelt. Nun brauchteer bestechend gut gemachte Stempelimitate, die exakte
der die Gummiprofile der Stempel nachahmte. Ein Freund,der in den Bayer-Werken arbeitete, erklärte sich bereit,im Labor das Tintengrün der DDR-Grenzbehörden her-stellen zu lassen. Baumans’ Bruder Heinz würde amMorgen des Fluchttags vorausfahren und die aktuelleStempelnummer durchgeben. Und zwei weitere Freundewürden die Flucht aus der Entfernung begleiten, umim Notfall den Behörden das Schicksal des deutsch-deutschen Paars zu melden.
Falls er dabei von der Bildfläche verschwinden sollte,hatte Baumans schon seine Besitzstände geregelt. EinemFreund erteilte er eine Vollmacht, die mit den Wortenbegann: „Für den Fall, dass mir die Flucht nicht gelingt,verfüge ich Folgendes.“ Dann listete er auf, wie sein Lebenabzuwickeln sei: Wohnung kündigen, Strom kündigen,Abonnement des „Kölner Stadt-Anzeigers“ kündigen,Versicherung kündigen, Auto abmelden.
Am 6. September 1969 trug der Einreisestempel eine6 im Muster. Eine Variante, die Baumans’ Verschwörer-zirkel im Repertoire hatte. Das vorausgefüllte Einreise-formular, das ihn später als Alleinreisenden ausweisensollte, bekam in Leverkusen das gefälschte DDR-Signet
unseren Plänen gewusst, wäre es für die Stasi ein Leichtesgewesen, ihr eine Mittäterschaft zu unterstellen. Das hättefür sie zu erheblichen Konsequenzen geführt.“
Um halb drei zog Marianne Burbott die Tür zu ihremalten Leben zu. Um drei stieg sie mit dem Kinderwagen inden Bus nach Straußberg, von dort nahm sie die S-Bahnnach Karlshorst. Hier wartete für das letzte Teilstück nachMichendorf der Sputnik, ein Zug, der nach dem Mauer-bau eingerichtet wurde und wie ein Trabant um dieHauptstadt zirkulierte. Um halb acht musste sie amvereinbarten Treffpunkt sein. Michendorf, südlich vonPotsdam gelegen, hatte sich bei den Fluchtplänen alseinzig denkbarer Zusteigepunkt erwiesen. Im Dorf gab eseinen Bahnhof, sodass Marianne und das Kind schnelldort hinkommen konnten, und einen Autobahnrastplatz,auf dem sich West- und Ostdeutsche begegnen konnten.So war es Marianne problemlos möglich, zu Hans in denKäfer zu steigen – theoretisch.
Der Weg von Hans Baumans und die Anreise vonMarianne Burbott mit dem erkrankten Kind verliefenohne Zwischenfälle. Die Grenzer gingen der Stempel-fälschung auf den Leim. Anstandslos wurde die Einreise-karte bei der Passkontrolle am Übergang Helmstedt/Marienborn eingezogen. Die Stasi würde sogar später diemit Tinte von Bayer in Leverkusen abgestempelten Unter-lagen für echt halten und die echten Einreiseformulareals nachgemacht einstufen.
Am Rasthof Michendorf wurde es kritisch. In derDämmerung stellte Baumans seinen Käfer im hinterstenWinkel des Parkplatzes ab, unweit eines Wäldchens, daser über einen Wirtschaftsweg zu Fuß durchquerte. Nacheinigen hundert Metern erreichte er auf einer Landstraßeden Bahnhof. Dort warteten Mutter und Kind auf ihn.Wieder war für große Gefühle keine Zeit. TochterAnja erhielt das Schlafmittel. Gemeinsam gingen sie dieLandstraße entlang, bogen in den Wirtschaftsweg ein.
In dieser bleiernen Zeit zwischen Weihnachten 1968und Pfingsten 1969 nahm der Fluchtplan konkrete For-men an. Für Baumans kamen Versuche, die das Leben derjungen Familie gefährden würden, nicht in Frage. Durchdie nach der Geburt häufigeren Ein- und Ausreisen inseinem VW Käfer kannte er die Abläufe an den Grenz-übergängen Helmstedt/Marienborn und Drewitz/Drei---linden sowie entlang der Transitstrecke. Er konstruiertein Gedanken mögliche Fluchtoptionen, verwarf die Pläneaber immer wieder, weil sie irgendwo einen Haken hatten.Am Ende landete er bei einer einzigen möglichen Stra-tegie: Einreise als Einzelperson per Auto in die DDR.
d d b ff
Tintenfarbe sowie die Information eines am Fluchttagvorausfahrenden Freunds darüber, welcher Stempel andiesem Tag an der Reihe war.
Baumans weihte einen kleinen Kreis von Verschwörernein, unter ihnen Hans Gerold vom Einwohnermeldeamt.Gerold verwies Baumans an einen Grafiker in Leverkusen,d d f l d l h h d
verpasst. Baumans setzte sich in seinen vollgetanktenKäfer. Es konnte losgehen.
„Prüfung bestanden“ hatte der Rheinländer kurz vor-her nach Bad Freienwalde telegrafiert. „Dann ging ich ineine Art Automodus“, sagt er. „Angst vor einem Scheiternder Flucht hatte ich nicht.“ Und sie sagt: „Bis dahin hatteich unter ungeheurer Anspannung gestanden. Man hättemich stechen können, ich war gefühlsfrei. Am meisten hatmich belastet, dass ich mich mit niemandem austauschenkonnte, alles allein machen musste. Meine Mutter weihteich nicht ein. Mir war bewusst, dass sie nach der gelun-genen Flucht von der Stasi verhört würde. Hätte sie von
l f d h
Fluchtpläne, Reisepass,Stasi-Unterlagen: Baumansnutzte eine der wenigenLücken im Ein- undAusreisesystem der DDR.
Im Westen: Familie Baumans in den siebziger Jahren
sonst wäre die Flucht in diesem Tannenwald zu Ende.Dann, endlich, war der Radler außer Hörweite.
Anja schrie weiter. Die Eltern legten ihr den Windel-vorrat aufs Gesicht, um das Geschrei zu dämpfen. Es gingweiter auf dem Waldweg, aus der Schwärze hob sich dieRaststätte, dann auch das Weiß des Käfers ab.
Noch hieß die junge Mutter Marianne Burbott. Aufdem Beifahrersitz hieß sie dann Marianne Adams – daswar der Name im gefälschten Pass. Schon an der Rast-stätte hatte sie sich von Teilen ihrer alten Identität trennenmüssen. Den DDR-Ausweis, das Papiergeld und denHaustürschlüssel steckte sie in einem an ihre Mutteradressierten Umschlag in den Briefkasten, das Münzgeldlandete unter einer Tanne.
Auf der Transitstrecke waren es nur noch wenige Kilo-meter bis zur Westberliner Grenze. Eigentlich konntenichts mehr schiefgehen. In den Pässen lagen die korrektenAusreisekarten, zwei Erwachsene, ein Kind. In Drewitzmusste Hans Baumans erst einen Warteplatz ansteuern,auf dem sich der Verkehr staute. Offiziell fand hier amWagen eine Zollkontrolle statt, inoffiziell durchsuchtedie Stasi alle Fahrzeuge nach DDR-Flüchtlingen.Zwei davon saßen im VW Käfer mit dem KennzeichenLEV-MZ 51.
Zu erkennen waren sie aber nicht. Baumanns durftebis zur Passkontrolle weiterfahren, hielt, reichte die Pässehinaus. Der Grenzer blätterte in den Dokumenten,entnahm die Ausreisekarten, schaute ins Auto. Die Blicketrafen sich, ungewöhnlich lange, wie sich Baumans er-innert. Marianne kniff das auf ihrem Schoß liegendeKind in den Po, damit es schrie. Der Soldat schiengenervt: „Fahr’n Se weiter!“ Noch zwei Fahrbahn-verengungen und zwei rote Ampeln lagen vor ihnen. DieAngst wuchs. Zweimal sprangen die Lichter von Rot aufGrün. Dann die letzte Kontrolle an einem westdeutschenPosten. Formsache. Freiheit.
beeindruckt war, nach Leverkusen zurückgefahren.Zuvor, zwölf Stunden nach der Flucht, war der Kin-
derwagen in der Apfelplantage gefunden worden. Auf-grund des Namens, der im Inneren vermerkt war, wurdeer direkt zugeordnet. Die Behörden gingen erst von einerKindesentführung nach Westberlin aus. Eine der ersten,die von der DDR-weiten Fahndung nach dem Kind er-fuhr, war Burbotts Mutter, die bei der brandenburgischenVolkspolizei in der Poststelle eingesetzt war und denFernschreiber bediente. „Sie ahnte gleich, dass wir ge-flohen waren“, sagt Marianne Baumans. „Das war einherber Schlag für sie.“
Die Mutter wurde verhört und vom Dienst suspen-diert. Ihre Tochter schrieb später einen Brief an diePolizeidienststelle, um zu versichern, dass ihre Mutternichts gewusst habe. Die Behörden reagierten relativmilde und vermittelten ihr eine Stelle bei der kommuna-len Gebäudewirtschaft. Die Wohnung der Tochter hattesie nicht mehr betreten können. Das Inventar wurde kon-fisziert und verkauft. Schon wenige Tage nach der Fluchtliefen Nachbarinnen in den Kleidern von Marianne Bur-bott umher. Am 20. Oktober 1969 legte die Stasi einen
hat uns geprägt, sie hat uns verändert. Für mich war es einUmsturz, ein Verlust, ein Neubeginn bei null. Ich hattevor dem Mauerbau in Berlin studiert und kannte West-berlin hinlänglich. Aber jetzt war vieles anders. Ich betrateine Apotheke, legte das Rezept hin, nahm das Medika-ment und ging, ohne zu bezahlen“ – in der DDR warenvom Arzt verschriebene Medikamente kostenlos. „Ichging in eine Telefonzelle und kam nicht mehr heraus, weilich den Türmechanismus nicht verstand. Ich kam mir invielen Momenten unbeholfen vor. Ein Arzt sagte mir mal,man bräuchte fünf Jahre, um sich zu sortieren. Zehn Jahrehabe ich bestimmt benötigt. Das Schlimmste aber wardie Einsamkeit. Ein Jahr später bekam ich eine Stelle aneinem Gymnasium. Ich war froh, dass ich rauskam.“
Die Familie wuchs. 1971 kam die zweite TochterJudith zur Welt. Zwei Jahre später wurde unter der Re-gierung Brandt der Grundlagenvertrag ausgehandelt.Danach wäre eine Flucht, wie Baumans sie geplant hatte,nicht mehr möglich gewesen. Der Ablauf an den Grenz-übergängen war von DDR-Seite geändert worden. Den-noch erlaubte der Vertrag gefahrlose Reisen in den Osten,denn darin war auch eine strafrechtliche Amnestie für bisEnde 1969 Geflohene und Fluchthelfer festgeschrieben.
1975 bezog die Familie bei Leverkusen ein eigenesHaus mit Garten, pendelte aber jährlich in die DDR.„Durch unsere ständigen Reisen erlebten wir den unauf-haltsamen Verfall von Mariannes Heimat mit. Es war nureine Frage der Zeit, wann die DDR zusammenbrechenwürde“, sagt Baumans. „Auch heute noch empfinde iches als nicht hoch genug einzuschätzendes Privileg, nie inder DDR gelebt haben zu müssen, sondern immer in derBundesrepublik gelebt haben zu dürfen.“
Den 6. September, den Tag der Flucht, feierten Hansund Marianne Baumans lange als ihren Hochzeitstag.Ihr eigentlicher Hochzeitstag spielte kaum eine Rolle. DieEhe währte 31 Jahre. 2001 ließen sie sich scheiden.
Inzwischen war es fast dunkel. Burbott nahm dieTragetasche,in der Anja lag, aus dem Kinderwagen, Baumans warf denKinderwagen in eine Apfelbaumplantage. Jetzt waren esnur noch wenige hundert Meter durch das Wäldchen.
Da sahen sie aus der Ferne das Licht eines Fahrradsnäherkommen. Sie schlugen sich ins Dickicht und war-teten. Das Schlafmittel wirkte nicht, Anja begann zuschreien. Baumans wusste sich nicht anders zu helfen, alsseiner sechsmonatigen Tochter den Mund zuzuhalten.Zehn Sekunden, 20 Sekunden. Anja fing an zu zappeln.Doch der Fahrradfahrer war noch nicht vorbei. Baumansdrückte noch ein paar Sekunden länger zu. Er wusste,
d l h d ld d
Am ersten Rasthof auf der Berliner StadtautobahnAvus fuhr Baumans raus. Wenig später trafen die Freundemit dem Begleitfahrzeug ein. Sie fielen sich in die Arme.Aus dem Kofferraum holte Baumans eine Flasche Sektund vier Gläser, jemand besorgte in der RaststätteSchnitzel mit Pommes. „Ich habe nichts angerührt“, er-innert sich Marianne Baumans. „Ich konnte mich nichtfreuen. Ich war kaputt nur vom Konzentriertsein.“
Am übernächsten Tag wurden Baumans und Burbottvon den Fluchthelfern mit Transparenten am Düssel-dorfer Flughafen empfangen. Der Käfer wurde von einemBeamten der Berliner Polizei, die von der Flucht tiefb d k h k k f h
„Sachstandsbericht“ über die gelungene Flucht in dieAkten. Daraus wird klar, dass trotz gründlicher Ermitt-lungen die falschen Schlüsse gezogen worden waren. WieBaumans und Burbott den Überwachsungsstaat aus-getrickst hatten, blieb jahrzehntelang ihr Geheimnis.
Das Paar wurde auch im Rheinland noch beschattet,begann dort aber ein neues Leben. Drei Wochen nach derFlucht heirateten sie im Altenberger Dom. Marianne Bau-mans erhielt Ende Oktober die Aufenthaltserlaubnis undeine einmalige Unterstützung der Bundesrepublik von300 Mark. „Es war ein schwerer Start mit viel Arbeit,wenig Geld und großer Einsamkeit“, sagt sie. „Die Fluchth h d h
WESTDEUTSCHLAND32
Auf Zeitreise in die deutscheVergangenheit: Noch heuteentdeckt man das Lebensgefühlder alten Bundesrepublik.Von Kim Björn Becker
iese Zeit scheint lange vorbei zu sein, unddoch grüßt sie an mancher Ecke freundlichwie ein alter Bekannter – vorausgesetzt, man
schaut genau hin. Die „alte Bundesrepublik“, die mitder Wiedervereinigung 1990 zu Ende ging, lebt wei-ter, zumindest ein bisschen. Bruchstückhaft wird siein alten Werbetafeln und Gebrauchsgegenständen alsverloren geglaubtes Fragment der Geschichte greif-bar, als vage Erinnerung an eine vergangene Zeit.
Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, dassdie Artefakte exakt historisch bestimmt werden kön-nen. Gut möglich, dass mancher Schriftzug erst kurznach der Wiedervereinigung angebracht wurde oderdass ein Gegenstand ursprünglich aus Ostdeutsch-land stammte. Das verbindende Element der Grüßeaus dem Gestern, die auf dieser Seite dokumentiertsind, besteht darin, dass sie an ein bestimmtes Lebens-gefühl erinnern – das zumindest jene noch erlebenkonnten, die in den achtziger Jahren in Westdeutsch-land geboren wurden.
Es war eine Zeit ohne Internet und Handys. EineZeit, in der man nicht ständig erreichbar war, son-dern nur dann, wenn man das wollte (oder musste).Eine Zeit, in welcher der Satz „nach Diktat verreist“noch eine Bedeutung hatte und nicht durch Mailsoder Whatsapp-Nachrichten der Irrelevanz preis-gegeben wurde. Die „alte Bundesrepublik“ erinnertan eine Zeit, in der das Leben aus heutiger Sicht ein-facher gewesen zu sein schien, kleiner, überschau-barer und auf beruhigende Weise langsamer.
Die Sehnsucht nach Vergangenem wird auch inder Kunst gerne thematisiert. Eine besondere Formder Nostalgie erfasste – unter etwas anderen Vor-zeichen natürlich – einen gewissen Gil Pander, denProtagonisten in Woody Allens Film „Midnight inParis“, der sich als Zeitreisender ins Paris der zwanzi-ger Jahre zurückträumt. Dort trifft der Schriftstellernicht nur die Idole seiner Zunft, Ernest Hemingwayund F. Scott Fitzgerald, er verliebt sich auch in Adriana.Und verliert die Angebetete dann prompt an eineandere, frühere Epoche. Denn Adriana hat ihrerseitsein Faible für das Vergangene, und die Zeit, die GilPander so leuchtend erscheint, ist der ZeitgenössinAdriana längst zu fad – sie träumt sich fort, von Pan-der und den zwanziger Jahren, und entschwindet insParis der Belle Époque.
Die Vergangenheit wurde eben schon immer ver-klärt, das ist bei der Faszination für die „alte Bundes-republik“ nicht anders. Denn klar ist auch, dassfrüher vielleicht manches besser, aber gewiss nichtalles gut war. Die Überschaubarkeit des Lebens zeigtevielen Menschen enge Grenzen auf: Frauen hattenlängst nicht so viele berufliche Chancen wie heute,Schwule und Lesben konnten noch nicht heiraten,der Klimaschutz war als Begriff zwar bekannt, abernoch nicht virulent – die Fortschritte in diesen Fra-gen datieren erst auf spätere Jahre.
Und doch übt die Ästhetik des Vergangenen eineFaszination aus, sie weckt Erinnerungen an die früheKindheit, an ein jüngeres Ich. Wir halten die Dingevon gestern fest, bevor sie entschwinden in eine nochtiefere Vergangenheit.
Leuchtend: Der Schriftzug einer Apotheke in der MainzerOberstadt hat schon viele Jahre überdauert.
Die kleine Kneipe: Eingang zu einem Tanz- und Nachtclub imIserlohner Stadtteil Letmathe. Tagsüber ist die Tür zu.
Leichtgängig: Die Schreibmaschine des Herstellers Olympia ausWilhelmshaven ist aus den fünfziger Jahren und in Privatbesitz.
Zum Wohl: Der verspiegelte Barschrank ist historisch, die Befüllung ganz klar zeitgenössisch – aufgenommen in einer Privatwohnung inFrankfurt.
Ost trifft West: Das alte Schild einer im Westen ansässigenFirma hat ein Lichthaus in Potsdam an der Fassade angebracht.
GrüSSeaus demGestern
D
WESTDEUTSCHLAND 33
Es wurde Licht: Eine Lampenkonstruktion beleuchtet dasBürgerhaus in Bruchköbel, die Wände sind holzvertäfelt.
Guter Ton: Dieses Mikrofon von Telefunken, „made in WesternGermany“, fand ein Kollege auf dem Dachboden der Eltern.
Zurückbleiben, bitte: Die Fahrt in den alten Waggons der U6 inMünchen kommt einer Zeitreise gleich.
Bestens verbunden: Ein einsamer Telefonhörer hängt an derWand eines kleinen Hotels in Sasbachwalden im Schwarzwald.
Zimmer frei? Die Pension im Frankfurter Westend ist in denSechzigern stehengeblieben, aber auch online buchbar.
Blank poliert: Der Kronleuchter blinkt und das Schild, das den Weg ins Café und zur Bar weist, auch. Die Inneneinrichtung eines Hotelsin Lindau am Bodensee erinnert an den Glanz vergangener Zeiten.
Guter Stern: Auf dem Kühlergrill eines alten Mercedes klebt eine Plakette des Automobilclubs ADAC aus dem Jahr 1973. Der Wagenmit hellgoldener Lackierung stand in diesem Sommer in der Ortenau bei einem Händler zum Verkauf.
34 POLITIK
as norwegische Nobelinstitut liegt im Zen-trum von Oslo, nicht weit weg vom Schloss.Thorbjørn Jagland wartet schon draußen.Er führt hinein, die Treppe hinauf und
durch dicke Türen: in das Herz des Hauses, den Saal, indem über den Friedensnobelpreis entschieden wird.Dunkles Holz, grüne Tapete. Ein kurzer Blick an dieWand, wo die Porträts all der Friedensnobelpreisträgerhängen, dann hat Jagland ihn entdeckt: Da ist er, inSchwarz und Weiß, die Haare streng nach hinten ge-kämmt, da ist Willy Brandt. „Wir haben ihn in gewisserWeise auch als einen von uns betrachtet.“
Willy Brandt und Norwegen, das ist eine ganz beson-dere Beziehung. Der junge Herbert Frahm kam 1933 indas Land, keine 20 Jahre alt. Ein Land, in dem er politischagitierte und dazulernte, aus dem er 1940 fllf üchten musste,als die Nazis kamen, und in das er immer wieder zurück-kehrte, als er schon längst Willy Brandt hieß und zu denwichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegs-politik gehörte. Im Oktober vor 50 Jahren wurde WillyBrandt zum Kanzler gewählt, im November vor 30 Jahrendurfte er noch, bevor er 1992 starb, als „elder statesman“den Fall der Mauer erleben. Norwegen hat seinen Wegbeeinflusst. Und er das Land und seine Politiker.
Thorbjørn Jagland führt wieder hinaus und eine Etagehöher im Institut, um über sich und Willy Brandt zusprechen. Jagland gehört zu den bekanntesten norwegi-schen Politikern in den vergangenen Jahrzehnten. Er istMitglied der sozialdemokratischen Partei in Norwegen,der Arbeiterpartei. Er war Ministerpräsident, Außen-minister und bis vor wenigenWochen noch Generalsekretärdes Europarates. Zudem ist er seit vielen Jahren Mitglieddes Nobelpreiskomitees. Jetzt steht er vor seiner politi-schen Rente. „Willy Brandt war immer mein Vorbild“,sagt er. Als junger Politiker ist er immer wieder auf Brandtgetroffen, hat mit ihm diskutiert und später hin undwieder in Bonn hoch über dem Rhein mit ihm zusammengegessen. Viele seiner Überzeugungen hat der ehemaligedeutsche Bundeskanzler mitgeprägt.
Als Brandt 1933 nach Norwegen kam, hatten die Na-tionalsozialisten gerade die Macht in Deutschland über-nommen. „Ich musste weg, wenn ich nicht Leib und Seeleriskieren wollte, und den Blick nach draußen wenden“,schreibt Brandt in seinen „Erinnerungen“. Er war zwar derSPD beigetreten, aber hatte sich wenig später schon ab-gewendet und einer linkssozialistischen Abspaltung ange-schlossen, der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands(SAP). Sie schickte ihn nach Oslo, um einen Auslands-stützpunkt der Partei im Norden aufzubauen. Er sollte inden kommenden Jahren viele Artikel und Berichte schrei-ben, Vorträge halten, für die Arbeiterpartei in Norwegenarbeiten, und gefährliche Reisen durch Europa antretenfür seine Mission, für den Widerstand. Sein Decknamewurde ihm sein richtiger Name und Norwegen zu einerzweiten Heimat. Ob seine Reise 1933 schon eine nötigeFlucht war aus Deutschland oder zuerst doch eine Missionfür die Partei, sollte Historiker später beschäftigen. Selbstwenn es Anfang April 1933 keine dringliche Gefährdunggab, schreibt Peter Merseburger in seiner Brandt-Bio-graphie, „hätte es sie nur zu bald gegeben“. Kurz daraufwurden Parteifreunde von ihm verhaftet.
Die Reise begann jedenfalls bei miesem Wetter, überDänemark führte ihn sein Weg. Sein Großvater hatte ihm
100 Mark gegeben, er hatte in seiner Aktentasche Hem-den und den ersten Band des „Kapitals“ von Karl Marx.Am 7. April 1933 kam er in Oslo an. Schnell lernte erdie Sprache und beherrschte sie den Rest seines Lebensso gut, dass er keinen Unterschied mehr gemerkt habe,erzählt Jagland. Brandt habe ohne Akzent gesprochen.
Jagland ist erst nach dem KrrK ieg geboren, in eine ArrA beiter-familie in einer kleinen Stadt bei Oslo. Brandt lernte er inZeitungen kennen und im Fernsehen. „Willy war überallund immer präsent.“ Sein politischer Aufstieg, die Kanz-lerwahl, der Kniefall in Warschau, der Nobelpreis. „Wirwaren natürlich auch stolz hier.“ Das Königreich hattetiefe Narben aus der Zeit der deutschen Besetzung imZweiten Weltkrieg davongetragen. Zur Versöhnung habeauch Brandt beigetragen, sagt Jagland. Dass es Deutsch-land so schnell möglich gewesen sei, eine Person zu akzep-tieren, die das Land verlassen hatte, sei etwas Besonderes.„Das zeigte uns, dass Deutschland sich wirklich gewan-delt hatte, das war wirklich neu.“ Dass Brandt in Deutsch-land aber auch zu tragen hatte an seiner Vergangenheit,dass er immer wieder angegriffen wurde vom politischenGegner, weil er im Exil war, weiß Jagland. Die letztenJahre des Krieges nach der deutschen Besetzung Nor-wegens 1940 verbrachte Brandt in Schweden. NachDeutschland kehrte er als Berichterstatter für norwegischeZeitungen zurück, später war er norwegischer Presse-attaché in Berlin. 1957 wurde er zum Regierenden Bürger-meister von Berlin gewählt.
In den sechziger und frühen siebziger Jahren wurdeJagland durch die Anti-Atom-Kampagnen politisiert unddurch den Protest gegen den Vietnam-Krieg. Wie vieleJugendliche in Norwegen ging er zum Jugendverbandder Arbeiterpartei, der AUF. Er verbrachte dort viel Zeit,erlebte seine politischen Lehrjahre und spielte auch ein-fach nur im Sommerlager auf der Insel Utøya Fußball.Das Jugendlager der Partei sollte 2011 in der ganzen Weltbekannt werden, als ein Rechtsterrorist schwer bewaffnetauf die Insel fuhr und 69 Menschen tötete.
Brandt war in den dreißiger Jahren bei der Jugend-organisation aktiv, die Partei unterstützte ihn finanziellund setzte sich für ihn ein, damit er der Ausweisung ent-ging. Zumindest anfangs aber hatte Brandt noch andereZiele. Er trat radikaler auf, kritisierte die Parteiführungund versuchte, den linken Flügel von seinen Ideen zuüberzeugen. Die Parteiführung nahm es hin. Mit denJahren wandelte sich Brandts Blick auf das, was er tat undwas die Arbeiterpartei leisten konnte. In seinen „Erinne-rungen“ schreibt er davon, wie die Arbeiterpartei inNorwegen 1935 in die Regierung eintrat. „Ob ich wollteoder nicht, der Eindruck war nachhaltig“, schreibt er. „Erweckte in mir den Wunsch, auch selbst zu gestalten undDenken und Trachten nicht mehr nur auf Minderheitenauszurichten, sondern darauf, Mehrheiten zu gewinnen.“
Willy Brandt habe die Sozialdemokratie in Norwegenbeeinflusst, sagt Jagland, „aber es war auch andersherum“.Hier habe er seine Dogmen aufgegeben, hier sei er einpragmatischer Politiker geworden. Im Exil fand Brandtwieder zur Sozialdemokratie. Merseburger schreibt, dassbei ihm als Parteivorsitzender der SPD manches vomHabitus seiner norwegischem Genossen erkennbar werde,etwa „in seinem duldsamen Umgang mit Parteiflügelnoder den radikal orientieren Jungsozialisten, den ihmKritiker als Führungsschwäche auslegen werden“.
Vor 50 Jahren wurde Willy Brandt Bundeskanzler.Ohne seine Zeit in Norwegen ist er nichtzu verstehen. Der frühere Ministerpräsident
Thorbjørn Jagland redet darüber, wie das Land Brandtformte – und wie er Norwegen beeinfllf usste.
Von Matthias WyssuwaFotos Daniel Pilar
Der Altkanzler schautihm über die Schulter:In Thorbjørn JaglandsArbeitszimmer in seinerWohnung in Oslo hängtein Brandt-Porträt von
Andy Warhol.
WILLY WOLLTEESWISSEN
D
35POLITIK
Das erste Mal traf Jagland ihn in Oslo, da war Brandtschon längst Friedensnobelpreisträger. In Norwegen hattesich die AUF wegen des Vietnamkriegs gegen Amerika ge-wendet, eine Mitgliedschaft Norwegens in der Nato lehntesie ab. So sah es auch Jagland. Brandt wollte mit demNachwuchs der Arbeiterpartei reden, etwa 20 Abgesandtewurden in die Parteizentrale in Oslo eingeladen. „Wenn erzu Besuch kam, saß er gerne mit jungen Leuten zusam-men, um zu reden“, sagt Jagland. „Es war beeindruckend,er wollte uns wirklich zuhören.“ Also sagten sie ihm, wassie gegen die Mitgliedschaft einzuwenden hatten. Brandthabe ihnen erklärt, was passiere, wenn Norwegen nichtin der Nato sei. Sollten die anderen Länder das auchmachen? Deutschland zum Beispiel? Das habe man dochschon einmal gehabt. Jagland hat das überzeugt. „Wegendieses Treffens habe ich meine Meinung geändert.“
Als Jagland später in seiner Partei immer weiter auf-stieg, wurde er auch zur Sozialistischen Internationaleentsandt. Dort arbeitete er regelmäßig mit Brandt zusam-men, der von 1976 bis 1992 Vorsitzender war. Jaglanderlebte, wie Brandt schon mal die Sitzung verließ, wenner seinen Willen durchsetzen wollte, und ihm das so auchgelang. Wie er hochgestreckte Hände anderer Teilnehmereinfach durch einen Blick auf die Tischplatte ignorierte,weil er den Widerspruch nicht hören wollte. Einmal, dawar die Mauer in Deutschland gerade gefallen, schickteBrandt ihn nach Osteuropa. Es galt Gespräche zu führen,um die alten sozialdemokrrk atischen Parteien wiederzubeleben.
In Prag, sagte Brandt zu ihm, solle er unbedingt zum Volks-haus gehen, er kannte es noch aus seinen frühen Jahren,es gehörte einst den Sozialdemokraten. Als Jagland aberin Prag war, musste er feststellen, dass aus der Zentraleder Sozialdemokratie ein Lenin-Museum geworden war.Brandt soll traurig gewesen sein. Als Außenminister warJagland dann Jahre später wieder in Prag, um eine Redezu halten. Er staunte, dass er im Volkshaus sprechensollte, es gehörte wieder den Sozialdemokraten. Da warBrandt aber schon lange tot.
Jagland kann sich auch an ein Essen mit Brandt sehrgut erinnern, es war in einem Restaurant bei Bonn. „Ersprach wie der Vater zu einem Sohn“, sagt Jagland. Brandtverwies auf den Rhein unter ihnen, auf die nahe Brückevon Remagen, über die Alliierte im Frühjahr 1945 zuerstden Fluss überquert hatten. Er sprach von der Katastrophedes Zweiten Weltkriegs. Davon, dass er sich immer erin-nern müsse. Als die Nazis die Juden in Lager schickten,hätten die meisten anderen weggeschaut, sich sicher ge-wähnt. Wenn es aber nicht Menschenrechte für alle gebe,dann gebe es gar keine, wenn nicht Sicherheit für alle,keine Sicherheit. „Das habe ich mit mir genommen“, sagtJagland. „Ich habe es vielen und immer wieder erzählt.“
Als Jagland 1996 seine Antrittsrede hielt als Minister-präsident, nannte er Brandt sein Vorbild. Er war nicht nurin Fragen der kollektiven Verteidigung von Brandt beein-flusst, er war auch zu einem Verfechter von NorwegensWeg in die Europäische Gemeinschaft geworden. Nur die
Norweger konnte er davon nicht überzeugen. Eine wichtigeRolle spielte auch die Ostpolitik Brandts, der „Wandeldurch Annäherung“. Für Norwegen war sie im KaltenKrieg wichtig, schließlich grenzte das Land direkt an dieSowjetunion. Aber für Jagland ist sie wichtig geblieben.
Russlands Annektion der Krim 2014 hatte den Europa-rat in eine Krise gestürzt. Der russischen Delegationwurde das Stimmrecht entzogen, sie blieb daraufhin denVersammlungen in Straßburg fern, und Russland stellteseine Zahlungen an den Europarat ein. Jagland setzte sichals Generalsekretär dafür ein, dass Russland wieder zurück-kommt. Seit dem Sommer ist Moskau wieder Mitgliedmit allen Rechten und Pflichten. Eine umstrittene Ent-scheidung. „Wenn Russland gegangen wäre, hätte es dieSpannungen erhöht“, sagt Jagland aber. „Es hätte desaströseKonsequenzen für Europa gehabt.“ Willy Brandt habe ihndabei die ganze Zeit über inspiriert.
Zum Schluss geht es wieder raus aus dem Nobelinsti-tut, hinüber zu seiner Wohnung. Ein kurzer Weg nurdurch den Park und am Schloss des Königs vorbei. SelbstWilly Brandt soll die norwegische Monarchie einst be-eindruckt haben. In seiner Wohnung zeigt Jagland einPorträt von Brandt, das Andy Warhol gemalt hat. EineZigarette in der Hand, ein Schatten im Gesicht. Es hängtin seinem Arbeitszimmer. Auch Thorbjørn Jagland hatviel erreicht in seinem politischen Leben, er will es jetztaufschreiben. Willy Brandt wird ihm dabei über dieSchulter schauen.
OSTDEUTSCHLAND36
DIE PLATTEN-STORYVon der sozialistischen Utopie zur postindustriellen Landschaft: Das ehemaligeFritz-Heckert-Gebiet in Chemnitz ist ein Stück DDR-Architekturgeschichte.Von Beatrice Behn und Maria Wiesner, Fotos René Gebhardt
OSTDEUTSCHLAND 37
rtwin Meister ist Zaubererund wohnt im neunten Stock.Im Hausflur riecht es nachdem Linoleum aus DDR-Zei-
ten, das in vergilbtem Beigeton den Bodenvom Aufzug über den langen Gang bis vorseine Tür bedeckt. In seiner Ein-Raum-Wohnung braucht Herr Meister keinezehn Schritte, um von der Haustür bis aufden Balkon zu gelangen. Dort will er den„schönen Blick aufs Erzgebirge“ zeigen,den man von hier oben, aus 25 MeternHöhe, am südlichen Stadtrand von Chem-nitz hat, und auf den sie hier im Fritz-Heckert-Gebiet so stolz sind.
Als Besucher schaut man aber vorallem auf ein riesiges Plattenbaugebiet unddirekt auf das Nachbargebäude, das inGrundriss, Höhe und Aussehen vollkom-men identisch ist mit dem Haus, in demHerr Meister lebt. „Mein Adventskalen-der“, sagt Meister und lacht. Abendskönne er zusehen, wie nach und nach dieLichter in den Wohnungen angehen unddie erleuchteten Fenster den Blick auf dasPrivatleben der Nachbarn freigeben, wiebeim Adventskalender mit seinen Tür-chen, hinter denen sich immer eine andereSzene verbirgt. Er sieht sie alle, und siesehen ihn. „Aber bitte“, sagt er, und jetztflüstert er nur noch: „Nicht direkt Fotosvom Balkon machen, nicht dass die Nach-barn sich noch beschweren.“
Der Wohnblock, in dem Herr Meisterwohnt, ist einer der wenigen unsaniertenBauten, die im einst drittgrößten Neubau-gebiet der DDR noch stehen. Ein StückDDR-Architekturgeschichte in Grau mitelf Geschossen. Vieles wurde um- und ab-gebaut. Nicht nur Häuser verschwanden,auch der Name Fritz Heckert – das war einChemnitzer Kommunist, der 1918 bei derGründung der KPD mitgewirkt hatte –wurde durch Stadtteilnamen ersetzt. DochGeschichte lässt sich nicht so leicht tilgen.Für Einheimische ist es noch immer dasHeckert-Gebiet. Die meisten Bewohnerleben hier aus Gewohnheit, oder weil siesich nichts anderes leisten können.
Stefan Richter ist hier aufgewachsen.Heute nennt er sich Trettmann, arbeitetin Berlin und rappt über seine Herkunft.In seinem Song „Grauer Beton“ heißt esüber das Heckert-Gebiet: „Seelenfängerschleichen um den Block und machen Ge-schäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder
Tür lauert ’n Abgrund. Nur damit duweißt, wo ich herkomm’.“ Es ist ein Ortsozialer Spannungen. Die AfD hat hier beider Landtagswahl im September durch-weg die meisten Stimmen geholt, mehrals 30 Prozent in Helbersdorf, Hutholz,Kappel, Markersdorf und Morgenleite,wie die Stadtteile des ehemaligen Heckert-Gebiets heute heißen. Es wird viel geglotztund wenig geredet.Wennman nicht von hierist, spürt man Argwohn an allen Ecken.
Das sieht selbst HerrMeister so: „Chem-nitz“, sagt er, „ist nicht weltoffen.“ Als zau-bernder Künstler sei er in Dörfern im Erz-gebirge unterwegs gewesen, in denen dieMenschen herzlicher seien und mehr auf-einander zugingen.
Vor 45 Jahren, als die ersten Bagger1974 den roten Lehm in Karl-Marx-Stadt,wie Chemnitz seit 1953 hieß, beiseiteschoben, damit der Grundstein für dasPlattenbaugebiet gelegt werden konnte,galt das Projekt als Verwirklichung einerrealsozialistischen Utopie. In acht Bau-gebieten auf 700 Hektar Ackerfläche soll-ten 41.000 Wohnungen für 160.000 Men-schen entstehen. So wollte man ein fürallemal das Wohnungsproblem in Karl-Marx-Stadt und Umgebung lösen. „Jedemeine Wohnung“ hieß das Motto beimVIII. Parteitag 1971, auf dem ein riesigesWohnungsbauprogramm beschlossen wurde.Drei MillionenWohnungen wollte die Re-gierung bauen oder sanieren.
Die Wohnungsfrage war politischhoch brisant geworden, lebten die meistenDDR-Bürger doch in äußerst schlechtenWohnverhältnissen – meist im Altbau,unsaniert. Auch in Karl-Marx-Stadt wardas in den Siebzigern der Standard: Miets-kasernen, die vom Krieg verschont geblie-ben waren, mit Klo auf halber Treppe. ImSommer war es heiß, im Winter sehr kalt,geheizt wurde mit Kohle. Wohnraum warMangelware und „Vollkomfortwwt ohnungen“wie die, die im Neubaugebiet entstanden,daher begehrt und nur auf Zuteilung er-hältlich.
Doch es ging um mehr als nur darum,Wohnraum zu schaffen und den Missmutder Bevölkerung einzudämmen. Wie alleanderen Neubauprojekte in der DDR solltedas Fritz-Heckert-Gebiet aus sozialisti-scher Theorie sozialpolitische Tatsachenwerden lassen. Durch Architektur undInfrastruktur wollte man eine sozialisti-
O
Gesichter der Platte:Kinder auf einemSpielplatz im Neubau-gebiet Fritz Heckert imJahr 1986 (links), Blickauf die Fassaden derSiedlung 1994 (oben)
OSTDEUTSCHLAND38
sche Gemeinschaft schmieden, indem mansie in eine neue „kollektive Wohnform“goss.
Dafür sollte die bisherige Idee des indi-viduellen Wohnens so stark wie möglichzurückgeschraubt werden. An ihre Stellesollte eine kollektive Versorgung materiellerund kultureller Art treten, die den Einzel-nen in ein sozialistisches Gesamtkollektiveinfügt und gleichsam die bourgeoise unddamit überholte Idee der Familie auflöst.Doch wie diesen Anforderungen gerechtwerden, wenn zugleich so kostengünstigwie möglich gebaut werden musste undzudem geeignete Orte für solche Großbau-projekte rar waren?
In Karl-Marx-Stadt, einem der wich-tigsten Wirtschaftsstandorte für Maschi-nenbau des Landes, fand man schließlichim Süden ein gutes Stück Ackerland inbester Lage, das die Auflagen in SachenLärmbelästigung, Feinstaub, Bodenstruk-tur und Anbindung an den Rest der Stadterfüllte. Die Bauern, die in den Dörferndort lebten, wurden enteignet, die Platten-bausiedlung teilweise um die Bauernhöfeherum errichtet.
Gebaut wurde nach der „Komplex-richtlinie“ der Bauakademie der DDR, dieden Architekten und Bauherren kaumMöglichkeiten zur Individualisierung gab.Alles war bis ins kleinste Detail vorge-geben, der Neubau sollte vor allem schnellvoranschreiten. Angelegt wurden die Neu-baugebiete wie eine eigene, autarke Stadt.Zuerst wurde die Fläche so effektiv wiemöglich für Wohneinheiten genutzt,denn, so hieß es mahnend in der Richt-linie, „Grund und Boden sind nicht ver-mehrbar“. Häuser mit fünf, sechs oderelf Stockwerken wurden im Abstand vonwenigen Metern mit vorgegossenen Plat-ten aufgebaut. 19 Quadratmeter Boden-grundfläche pro Bewohner waren imDurchschnitt vorgesehen. Für einen „Elf-geschosser“ waren 62 Arbeitstage vomKeller bis zum Dach geplant, dann sollteer bezugsbereit sein. Raufasertapete undLinoleumboden, Einbauküche und Bad-ausstattung inklusive.
DieWohnungen, zu knapp drei Viertelnmit drei oder vier Räumen ausgestattet,waren vor allem für Familien ausgelegt. Ineiner der Wohnungen wuchs Sven Eisen-hauer auf. Als seine Familie 1983 ins Fritz-Heckert-Gebiet zog, war er knapp sechs
Jahre alt. Die Familie, Mutter Bauingeni-eurin, Vater Elektroingenieur, hatte zuvorim Stadtteil Sonnenberg im unsaniertenAltbau gewohnt. Für die Wohnung imPlattenbau mussten sie sich bewerben.„Die Wohnungen waren in der DDRetwas Besonderes, mit Zentralheizungund Warmwasser und WC in der Woh-nung“, sagt Eisenhauer. Er erinnert sichvor allem an die vielen Kinder, mit denener spielen konnte. „Wir wohnten in einemElfgeschosser, pro Etage lebten drei Fami-lien mit Kindern.“ Er fand schnell Freun-de, der beste wohnte im Nachbarblock.„Bei den Elfgeschossern gab es auf demneunten Stock einen Übergang zumnächsten Gebäude. Wenn ich meinen bes-ten Freund besuchen wollte, musste ichnicht mal Straßenschuhe anziehen, es gingeinfach mit dem Aufzug hoch in denneunten, über den Verbindungsgang undrunter in seinen Stock.“
Der 41 Jahre alte Eisenhauer, der heuteein Seniorenheim im Heckert-Gebiet lei-tet, beschreibt eine idyllische Kindheit, inder er auf den Wiesen und Spielplätzenzwischen den Plattenbauten mit Gleich-altrigen herumtobte. „Die Eltern wusstenoft nicht, wo ich war.“ Die Schulen imGebiet waren so verteilt, dass kein Kindlänger als 15 Minuten laufen und im Ideal-fall nicht einmal eine verkehrsreiche Straßeüberqueren musste. Dank der Kinder-betreuung konnten Mütter und Vätereinem Vollzeitberuf nachgehen. Es gabein flächendeckendes Angebot an Kinder-krippen und Kindertagesstätten mit Öff-nungszeiten von fünf bis 19 Uhr. Zusam-men mit Schulspeisung und Hort war dieKinderversorgung fast ganz ausgelagert.Die Kinder waren frei unterwegs undkamen selbständig wieder heim – voraus-gesetzt, sie hatten gelernt, ihr Haus vonden vielen anderen zu unterscheiden, dennsie sahen alle irgendwie gleich aus.
Gabriele Meinels Kinder konnten ihrePlatte leicht von den anderen unterschei-den: Es war die längste. Wie ein Riegelschloss eine Reihe Elfgeschosser dasHeckert-Gebiet nach Süden ab, was ihnenunter den Bewohnern den Namen „Stadt-mauer“ einbrachte. Die heute 70 Jahre alteMeinel zog hier 1981 mit ihrem damaligenEhemann und zwei Kindern in eine Vier-Raum-Wohnung. 1988 kam eine weitereTochter zur Welt. Das Paar trennte sich
Die Platte heute: DieWohnungen in densanierten Häusern sindwegen der niedrigen Preiseund der guten Verkehrs-anbindung vor allem beiSenioren beliebt.
OSTDEUTSCHLAND 39
DIE PLATTEN-STORY
Frankfurter Allgemeine Digitec: Die Nachrichten Appzu Digitalisierung und Technologie.Frankfurter Allgemeine Digitec: Die Nachrichten-App
Nehmen Sie die digitaleZukunft selbst in die Hand.
Für F.A.Z.-Digital-abonnenten gratis
• Das Neuste zu digitaler Wirtschaft, Indu
OSTDEUTSCHLAND 41
Sven Eisenhauer zog 1983 ins Heckert-Gebiet... ...und fand als Kind (links) schnell Freunde.
Axel Viehweger war 1990 DDR-Bauminister.Gabriele Meinel erfuhr viel Nachbarschaftshilfe.
Grau war gestern: Heute ist die Plattenbausiedlung vielerorts bunt geworden.
kurz nach demMauerfall, Gabriele Meinelblieb mit den Kindern in Chemnitz.Zu DDR-Zeiten hatte ihr die homogeneAltersstruktur der Bewohner geholfen,Alltägliches zu erledigen: Es waren vielejunge Paare mit Kindern da, immer fandsich ein Nachbar, der auf die Kleinenaufpassen konnte. „Eine Nachbarin warOpernsängerin am Theater, zu der gingendie Kinder sehr gern, weil sie immerMusik mit ihnen machte und sang“, sagtMeinel. Die Nachbarschaftshilfe gehörtezum Konzept. Die Hausgemeinschaft sollteals Kollektiv-Familie fungieren.
Es gab Feste im hauseigenen Trocken-raum, man ging zusammen auf Veranstal-tungen, hatte aber auch immer ein wach-sames Auge auf den Nachbarn. Im Haus-buch mussten alle Mieter vermerkt sein.Wenn Besuch kam, der länger blieb, muss-te er verzeichnet werden. Wer die Haus-ordnung nicht einhielt, wessen Kinder zusehr lärmten, wer die Musik zu laut auf-drehte, bekam kollektiven Ärger. Jedersollte gleich sein in Rechten und Pflichten.In der Gemeinschaft sollten Klasse undPrivileg aufgehoben sein, der Handwerkerund die Professorin leben wie die Putzfrauund der Arzt. Hier kam auch die staatlicheSubvention der Mieten ins Spiel: Niemandzahlte mehr als fünf Prozent des Lohns fürdie Miete, Strom und Wasser inklusive.
Nicht nur die Kinderbetreuung wurdeaus der Kernfamilie in die Gemeinschaftausgelagert. Reinigungen und Wäsche-reien, Bibliotheken, Wohngebietklubs undFeierabendheime, Jugendklubs und Gast-stätten standen zur Verfügung. Sie durftenhöchstens 30 bis 45 Gehminuten vonder Wohnstätte entfernt sein. Damit dieBewohner das Gebiet außer für Arbeit undMüßiggang am Wochenende im Grünennicht verlassen mussten, kamen Verwal-tungsgebäude, Reparaturangebote, Poli-kliniken, Apotheken, Sporthallen undSchwimmbäder sowie Postämter undSparkassen hinzu. Viele davon ballten sichin sogenannten Versorgungszentren, mitgeringem Zeitaufwand sollte man alleEinrichtungen, die im Alltag notwendigwaren, erreichen und nutzen können.
Der Grundgedanke der Gemeinschaftspiegelte sich auch in der Architektur derWohnungen wider. Sie waren alle gleichaufgebaut. Eine Handvoll Grundrissenach der zentral entwickelten Wohnungs-bauserie 70 (WBS 70) standen zur Ver-fügung. Sie wurden von Rostock bisChemnitz genutzt und ließen kaum Platzfür individuelle Wohnideen, auch wennmanche sich wenigstens auf dem Balkondurch Blumen und Dekoration abzuhebenversuchten. Die Nutzung der Zimmer warvorgeschrieben und entsprach den Priori-täten des Staats. Das Wohnzimmer warnoch relativ groß, Platz gespart wurde vorallem im Schlafzimmer und im Kinder-zimmer, die eher Kammern glichen.
Den Bewohnern sollte vor allem einesermöglicht werden: so viel wie möglichzu arbeiten. Deshalb achtete man auch pe-nibel auf einen dicht getakteten Anschlussan öffentliche Verkehrsmittel, damit dieArbeiter mühelos zur Fabrik oder in dieBüros pendeln konnten.
Mit der Wende änderte sich das schlag-artig. In Chemnitz, wie Karl-Marx-Stadtvon 1990 an wieder hieß, wurden vieleehemalige volkseigene Betriebe geschlos-sen, die Arbeitslosigkeit stieg. Jeder Fünfteverlor seinen Job. Gabriele Meinel war eineder wenigen, die es nicht so schlimm traf.Als Buchhalterin eines Buchungsmaschi-nenwerks war sie 1989 in Babypause ge-gangen. Als dort 1991 die Abwicklung mit
einer Entlassungswelle begann und vieleder 8000 Angestellten gehen mussten,weigerte sich ein Mitarbeiter der Personal-abteilung, die junge Mutter, die eben ausder Babypause kam und mitten in einerScheidung steckte, zu entlassen. Also halfsie bei der Abwicklung des Betriebs. „Eskamen viele Firmen aus den westlichenBundesländern, und alles mögliche, vonden Maschinen bis zum Mobiliar, wurdeverkauft.“ Für Meinel war die Zeit geprägtvon „Untergangsstimmung“.
Das galt auch für ihren Wohnblock.Die ehemaligen Hausgemeinschaften zer-brachen. Aus der einstigen sozialistischenUtopie des Fritz-Heckert-Gebiets wurdeeine postindustrielle Landschaft mit ein-geschlagenen Fenstern, Graffiti und ein-gestürzten Gebäudeteilen. Sven Eisen-hauer erinnert sich an diese Übergangszeittrotzdem nicht nur negativ. „Teilweisewar das eine gesetzlose Zeit“, sagt er. „Wirfanden immer mehr Autowracks, weil dieLeute einfach gegangen sind und allesmögliche zurückgelassen haben.“ In denWracks spielten Jugendliche, schlugen dieScheiben ein, kletterten darauf herum.Manchmal fanden sie zurückgelasseneMopeds, in deren Tanks noch Benzin war.Mit ihnen fuhren sie durch den Wald oderauf den Straßen zwischen den Platten-bauten, die immer leerer wurden.
Neben der Arbeitslosigkeit trug auchder Anstieg der Mietpreise zum Leerstandbei. Axel Viehweger, Bauminister der 1990gewählten letzten DDR-Regierung, hattedie Aufgabe, die Wohnungsfrage zu lösen.„Die Mieten waren das schlimmsteThema, weil es natürlich unpopulär war.Ich habe eine erste symbolische Miet-
erhöhung durchgeführt, die also über-haupt noch nicht kostendeckend war.“Doch der Schock war groß – Wohnen kos-tete plötzlich mehr als nur einen symbo-lischen Preis. Die Kosten für Strom, Gas,Wasser mussten zusätzlich entrichtet wer-den. Wer Geld hatte, baute sich ein Eigen-heim. Wer keine Arbeit hatte, ging in denWesten. 2001 stand die Hälfte der Woh-nungen im Fritz-Heckert-Gebiet leer.
Um die Jahrtausendwende begannendie Wohnungsgenossenschaften, die diePlattenbauten verwalteten, mit dem Ab-riss. 11.000 Wohnungen, ein gutes Dritteldes Bestands, wurden platt gemacht. Gab-riele Meinel wollte zunächst mit ihrenKindern bleiben. „Unser Haus war Endeder neunziger Jahre noch teilsaniert wor-den, neues Bad, neue Elektroinstallation,neue Fenster. Es war sinnlos, das abzurei-ßen.“ Die Bürger demonstrierten. Auf derJohann-Richter-Straße hielten sie Schilderin die Luft: „Wir bleiben hier!“ MeinelsTöchter schnitten aus großen Papierkar-tons Buchstaben für die Losung aus undklebten sie in die Fenster der Wohnung. Eshalf am Ende nichts – die Familie mussteumziehen. Die „Stadtmauer“ musste denBaggern weichen.
Nicht nur an den Wohnhäusern warenLeerstand und Arbeitslosigkeit abzulesen.Wo weniger Jugendliche waren, fielenauch Jugendklubs weg. Der größte, „Bun-ker“ genannt, vor dem in den achtzigerJahren die Jugendlichen stundenlangSchlange standen, um tanzen zu gehen,wurde „durch rechte Gruppen okkupiert“,wie sich Sven Eisenhauer erinnert. „Es gabauch den ein oder anderen Vorfall, dassAusländer mit Baseballschlägern durch
das Wohngebiet gejagt wurden.“ Er selbsthabe das zwei oder drei Mal beobachtet.
Dem Abriss und der Arbeitslosigkeitfolgte der Frust. Die sächsische Staats-ministerin für Integration, Petra Köpping(SPD), führt das in ihrem Buch „Integriertdoch erst mal uns!“ unter anderem auf dieBedeutung der Arbeit in der DDR zurück.„Gerade weil die Arbeitsstelle in der DDReinen enorm wichtigen Stellenwert hatte,resultieren aus der Ignoranz gegenüberdem Schicksal vieler Ostdeutscher nach-haltige Kränkungs- und Demütigungs-gefühle.“ Doch ist es wirklich so einfach?
Mittlerweile haben sich viele Wissen-schaftler mit dem Thema Identität in Ost-deutschland beschäftigt. Einer von ihnenist der Anthropologe Felix Ringel. „Identi-tät wird gern als Erklärungsmuster für dasherangezogen, was gerade passiert. Aberdamit muss man vorsichtig sein, denn eineostdeutsche Identität an sich gibt es nicht.“
Ringel hat 16 Monate in Hoyerswerdaverbracht, einer weiteren Plattenbau-Utopie der DDR, und sich angesehen, wieRückbau und Schrumpfung die Bewohnerder Stadt veränderten. „Auch in Hoyers-werda steht das gebaute Erbe der sozialisti-schen Moderne, und auch dieses Platten-gebiet wurde mit einem gewissen Men-schenbild im Kopf errichtet.“
Ist aus der sozialistischen Utopie alsoeine Dystopie geworden? „Dystopischheißt nicht, dass es eine Idee einer schlech-teren Zukunft ist“, sagt Ringel. „Als dys-topisch kann man ja nur etwas beschrei-ben, das zuvor eine Utopie war.“ Mit Blickauf Ostdeutschland gebe es da zum einendie Verschlechterung nach der Wende.„Zum anderen musste man hier von einerUtopie Abschied nehmen, die vorher dasBild für die Zukunft gesetzt hat.“ Letzt-lich sei der Umgang mit Plattenbausied-lungen und Fabrikschließungen jedochkein ostdeutsches Problem, sondern eingesamtgesellschaftliches. „Wir haben nochnicht gelernt, uns von der industriellenModerne zu verabschieden“, sagt Ringel.
Auch viele ehemalige Bewohner desHeckert-Gebiets tun sich bis heute schwermit dem Abschied. Die Facebook-Gruppe„Unser Chemnitz und Karl-Marx-Stadt“hat sich der Erinnerung verschrieben.Regelmäßig werden alte Fotos der Stra-ßenzüge hochgeladen und von HundertenNutzern kommentiert. Wer hier auf-gewachsen ist, dem stehen die Lücken, diedurch den Abriss entstanden sind, immernoch vor Augen, auch wenn die Woh-nungsgenossenschaften viel dafür getanhaben, den grauen Beton zu verdecken.Wenn Plattenbauten stehen blieben, wur-den sie Teil von Umbaumaßnahmen.Grauer Beton wurde bunt gestrichen, dieHäuser teils rückgebaut, die Wohnungs-schnitte verändert.
Von der Platte, in der Zauberer Ort-win Meister wohnt, blickt man hinunterauf die neuen Eigenheime, die auf derRasenfläche der ehemaligen „Stadtmauer“-Plattenbauten entstehen. Unweit davongibt es den Seniorentreff „Bei Heckerts“.Meister hat den Ort zu DDR-Zeiten insLeben gerufen. Damals war das der ersteJugendklub des Gebiets. „Nur Musikdurfte dort nicht gespielt werden“, sagt er.Das wäre zu laut gewesen. Wo sich früherdie Jugend traf, sitzen heute ältere Damenzur „Strickrunde“ und unterhalten sichbei Bockwurst und Kartoffelsalat. Diesanierten und rückgebauten Häuser desehemaligen Heckert-Gebiets sind vorallem bei Senioren beliebt. Auch OrtwinMeister kommt auf der Suche nach einbisschen Gemeinschaft vorbei.
DIE PLATTEN-STORY
FOTO
SP
ICT
UR
EA
LLIC
AN
CE
/ZB
(2),
SV
EN
EIS
EN
HA
UE
R/P
RIV
AT
42 LITERATUR
Herr Wondratschek, es gibt namhafte Literaturkritiker,die glauben, Sie hätten längst den wichtigsten deutschenLiteraturpreis, den Georg-Büchner-Preis, verdient.Sehen Sie das auch so?Ich werde Ihnen sicher nicht sagen, es sei an der Zeit, mirden Preis zu geben. Aber ich frage: Wenn man ihn mirgäbe, wäre es ein Fehler?
Selbst Leute, die es nicht gut mit Ihnen meinen, sind derMeinung, dass Sie auffällig wenige Preise bekommen haben.Ihre Zeitung schrieb einmal: Der selten Gerühmte. Dasist eine sehr präzise Beschreibung.
Konnten Sie sich denn über die wenigen, eher unbedeutendenPreise freuen, die man Ihnen dann doch verliehen hat?Als ich 2012 die Nachricht bekam, ich solle den Preisder Hirschmann-Stiftung bekommen, habe ich gezögert,ob ich ihn annehmen sollte. Ich wollte das Vergnügenverteidigen, als nie zu seinen Lebzeiten preisgekrönterAutor zu gelten. Da kam mir ein Preis, der eben nicht derKafka- oder Kleist-Preis war, ungelegen. Aber mich hatdie Preissumme von 20.000 interessiert – insofern, alsdie es damals ermöglichte, dass mein Sohn anständigstudieren konnte. Dann hatte ich herausgefunden, dasses gar keine Jury gab, sondern dass ein Unternehmeraus Franken die Entscheidung ganz allein getroffen hat.Vor der Übergabe des Preises habe ich ihn besucht.Ich erinnere mich, wie er mir seine sehr umfangreicheBibliothek zeigte: „Da die Romane, dort die Sachbücher,unten die Pornografie.“ Der alte Herr sagte das ganztrocken, ohne Kommentar. Das hat mir gefallen.
Auch der erste Preis, den Sie bekommen haben, bevor Siedann mehr als 40 Jahre lang keinen mehr bekamen, derLeonce-und-Lena-Preis, ging auf einen einzigen Mannzurück, den Schriftsteller Wolfgang Weyrauch. Im Jahr 2017haben Sie dann auch den Alternativen Büchner-Preisbekommen – wieder verliehen von einem einzigen Mann,einem Unternehmensberater.Offenbar bin ich nicht jurytauglich.
Was könnte der Grund sein?Durch dieses Rätsel dringt kein Licht.
Sie haben Sätze geschrieben wie: „Willst du, dass die Liebeglückt, nimm ein Mädchen, das sich bückt“. Derlei wirdheute gern als sexistisch betrachtet, auch von Jurys.Ach, diese Welt freudloser Notare und Sachverwalter, überdie sich schon Flaubert mokiert hat. Warum erinnern siesich nicht an anderes? „Für eine große Liebe / braucht eszwei Einzelgänger / und ein Gebet. / Sei meines, / wenndie Liebenden schlafen / und in den Häusern die Stillesteht. / Dann komm, dann geh! / Tu beides mit derHeftigkeit / eines Sommergewitters.“ Oder: „Ohne Liebewird niemand / Etwas verstanden haben vom Ruhm /ein Mensch gewesen zu sein.“ Mögen sie doch glauben,dass sie im Recht sind! Dann frage ich mich allerdings,was sie mit einem Pasolini machen, einem Genet, einemRimbaud, einem Brecht. Alle kalt stellen? Hätte manT. S. Eliot, Nobelpreis 1948, abstrafen sollen, weil er ineinem Gedicht geschrieben hat: „Jeder Mann könnteein Mädchen kaltmachen / Jeder Mann muß das brauchtdas will das“? Aber ich will nicht polemisieren. Ich habedas nie getan. Ich habe diese Entscheider immer in Ruhegelassen, wie ich es vorzog, in Ruhe gelassen zu werden.Ich war dabei, aber ich gehörte nicht dazu. Ich bin keinMitglied im Pen-Club, kein Mitglied in der DeutschenAkademie für Sprache und Dichtung, kein Mitglied eineranderen Akademie. Irgendwer sagte einmal über mich, ichsei ein Ein-Mann-Indianerstamm. In Kriegsbemalung?Darüber kann man streiten. Wenn Kritiker auf jemandenwie mich treffen, der keinen Ehrgeiz hat, fühlen sie sich,glaube ich, durchschaut, auch gekränkt. Das wollen sienicht verzeihen.
Sie wollen ernsthaft sagen, Sie seien ohne Ehrgeiz?In Bezug auf unser Thema, das der Preise, ja! Mehr noch:überhaupt auf eine Karriere! Man handelt sich dabei,wie es Puschkin über den Ruhm sagte, doch nur das ein:„irrige Auslegungen, Lärm und Schelte“. Ich habe einenanderen Ehrgeiz: der Würde gerecht zu werden, die von
großen literarischen Figuren und Werken abstrahlt. Da istin jeder Bibliothek, groß oder klein, so viel wunderbaresWissen und großartiges Können aufbbf ewahrt, davor willich bestehen. Ich möchte nicht preisgekrönt werden voneinemMilieu, das nicht halb so viel Intelligenz, Eleganzund Respekt hat wie das vergangener Zeiten, als es nochdie Gelehrten gab, die hommes de lettres. Die fanden es,nebenbei gesagt, nicht unangenehm, von klugen, elegantenFrauen bewundert zu werden und abends mit ihnen dienächste Hotelbar anzusteuern. Es gab diese Welt mal, undkeiner kannte sich in ihr besser aus als mein FreundGregor von Rezzori, der dort zu Hause war und mir davonerzählte, von Fritz Raddatz Arm in Armmit Inge Feltrinelli,von Ledig-Rowohlt oder einem Lord Weidenfeld. DieseWelt ist verschwunden.
In Ihrem jüngsten Buch „Erde und Papier“ schreiben Sie:„Was ein Autor ist, nimmt nur auf dem Papier sichtbareGestalt an. Es bedeutet nichts, was er sonst noch sein mag:wortkarg, rücksichtslos, ein Liebhaber des Boxsports.“Was auf dem Papier steht, ist der Mann. Deswegenwünsche ich mir – ein Wunsch, der bisher nicht inErfüllung gegangen ist –, aufmerksam gelesen zu werden,langsam, in glutvoller Ruhe. Ich wünsche mir Leser,die ein Buch besser zu deuten verstehen als ich, der esgeschrieben hat, es je könnte.
Halten Sie es für legitim, dass jemand über den AntisemitenLouis-Ferdinand Céline sagt, er mag ein guter Autor gewesen
Der Schriftsteller Wolf Wondratschek übersein Schicksal, bei Auszeichnungen übergangenzu werden, die Anerkennung, die er trotzdemerfahren hat, und seinen idealen Leser –mit einigen ausgewählten Zitaten des AutorsInterview Timo Frasch
Junger Dichter: Wolf Wondratschek, geboren 1943 in Rudolstadt, im Jahr 1972
„Her mit demNobelpreis“
FOTO
SJU
LIA
ZIM
ME
RM
AN
N(2
),B
RIG
ITTE
FRIE
DR
ICH
,IS
OLD
EO
HLB
AU
M/L
AALIF
43LITERATUR
Selten gerühmt: Dass ihm ein Literaturpreis verliehen wird, kann sich Wolf Wondratschek heute nur noch als Oper oder Märchen vorstellen – „allerdings in bester Besetzung, versteht sich“.
sein, aber er hat sich unmöglich gemacht durch seinenAntisemitismus?Nein. Wenn er ein guter Autor ist, dann bleibt er das,ein guter Autor. Dann soll man seine Bücher lesen.Das war das Gleiche mit Ezra Pound. Auch bei ihm wares der Antisemitismus. Natürlich, was für eine Verirrung!Das schmälert aber nicht im Geringsten seine literarischeLeistung. Dagegen haben Schurken und Mörder guteKarten. Man sieht das am momentanen Kult umden Maler Caravaggio, der jemanden, wahrscheinlichbetrunken, ins Jenseits befördert und überhaupt einwüstes Leben geführt haben soll. Apropos schlechteKarten. Als am 11. September islamistische Terroristenein Flugzeug ins World Trade Center gesteuert haben,sprach Stockhausen, der Komponist, von einem Kunst-werk. Ein Aufschrei! Ich verstehe ihn. Ich hatte einähnliches Gefühl bei einem Vulkanausbruch, den ichauf Island erlebt habe; ich bin extra deshalb angereist.Ich dachte: Großartig! Jetzt bricht das Innere der Erdeauf. Wie anders sollen Menschen erfahren, dass ihre Weltnicht nur aus Parkplätzen und Shoppingmalls besteht?
In der Kunst wie in der Literatur wird im Moment sehr aufdie richtige Haltung geachtet. Auch bei vielen Literaturpreisenwird neben dem Literarischen explizit oder implizit diemoralische Vortrefflichkeit von Werk und Autor prämiert.Ich habe nichts gegen moralische Vortrefflichkeit, wenndamit bürgerliche Tugenden gemeint sind und nichtmoralische Rechthaberei. Aber ich weiß, was Sie meinen.Ich bin nun mal nicht im Banat großgeworden unterCeauŞescu. Ich bin kein Flüchtling aus Syrien, keinchinesischer Dissident, keine Iranerin, der die Todesstrafedroht. Ich bin auch nicht der Sänger der Tropen.
Zum Nicht-Preisträger wird man nicht von heute aufmorgen. Gab es Zeiten, in denen Sie auf Preise hofften?Mein Debüt mit „Früher begann der Tag mit einerSchusswunde“ wurde von Marcel Reich-Ranicki be-sprochen. Damit war mein Bedürfnis an Gekröntsein vollbefriedigt. Was kann einem jungen Dichter Besseres
passieren, als eine Seite vom wortgewaltigsten deutschenKritiker zu bekommen, der das Buch nicht nur wahr-nimmt, sondern es auch noch auf eine sehr intelligenteWeise den Lesern vermittelt? Ein Erfolg war ja schon, dassich Hanser-Autor geworden war, aus dem Stand heraussozusagen. Und dann hab ich es mir, nicht sehr viel später,geleistet, eben diese große Anerkennung zu ignorieren,aus freien Stücken. Auch das bewerte ich als Erfolg.
Warum?Ich konnte nicht bei einem Verlag bleiben, dessen Verlegermich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, enttäuscht anschaut,weil ich ihm keinen Roman vorlege. Aber ich schrieb ebendamals, Anfang der siebziger Jahre, wozu ich Lust hatte,nämlich Gedichte.
Über den früheren Hanser-Verleger Michael Krüger habenSie mal gesagt, Sie wollten keinen Verleger haben, der selbermehr Literaturpreise bekommen habe als Sie. Wo ist dasProblem?Ein Verleger soll sich aufs Verlegen von Büchern konzen-trieren und nicht selbst noch schreiben und seinenAutoren imWeg herumstehen. Ich hätte von ihm andereserwartet. Er hätte der Jury, der Akademie oder dem Stiftermitteilen sollen, er nehme den Preis nur an, wenn er ihnan einen Besseren weitergeben darf.
An Sie.Richtig.
Es geht Ihnen also schon um Preise?Reden wir von Anerkennung. Die ist mir abseits derVergabe von Literaturpreisen in hohemMaße zuteilgeworden. Als ich mit Friedrich Dürrenmatt beimAbendessen saß, blätterte er in meinem gerade bei seinem
Verlag Diogenes erschienenen Buch „Die Einsamkeit derMänner“ – und war beeindruckt. Ich höre heute nochseine Stimme, wie er den Anfang des ersten Sonetts vorlas.Ich schmecke noch den Pauillac auf der Zunge, dennDürrenmatt verstand auch vomWein etwas. Ein Abenddes Glücks. Anerkennung ist aber auch, dass es, wie icherfahren habe, in der Nähe von München einen privatenLesekreis gibt mit einemDutzend an Literatur Interessierter,die sich meinen letzten Roman „Selbstbild mit russischemKlavier“ vorgenommen und dann diskutiert haben – mitdem Ergebnis, das Buch, jeder für sich, noch ein zweitesMal zu lesen, um danach das Gespräch darüber nocheinmal aufzunehmen.
Dass Sie eine Figur im Dietl-Film „Rossini“ sind, ist dasauch eine Form der Anerkennung?Nein.
Weil Sie mit dem Film nicht so glücklich waren?Ich habe ihn gar nicht gesehen. Darin kam ja nicht nurich vor. Da war Bernd Eichinger, da war unsere gemeinsamegroße Liebe Jane Seitz, der mein Carmen-Gedichtgewidmet ist und die sich das Leben genommen hat.Ich wollte doch nicht die Kinoversion einer, wenn manso will, Tragödie sehen.
Sie haben den Film tatsächlich nie gesehen?Mich hat das nicht interessiert. Ich habe dem Helmut,dem Dietl, den ich als Filmregisseur sehr schätzte, carteblanche gegeben: Mach, was du willst. Ursprünglich sollteich ja von Heiner Lauterbach gespielt werden, den ichgut kenne, der sollte das spielen, dagegen hatte ich nichts.Dann wurde aber umbesetzt, dann hat mich dieserLiefers gespielt: unrasiert, mit Rockerjacke und schlechtenManieren, na ja – sehr klischeehaft. Im Film wohnte erauch noch im Bordell. Ich habe Bordelle besucht, abernie in einem gewohnt.
Angenommen, Sie könnten sich einen Literaturpreisaussuchen – welchen würden Sie wählen?
44 LITERATUR
Wie lange dauert es, bis Sie mir mal eines glauben: dassich mir solche Gedanken niemals gemacht habe. Ichkann mir die Vergabe eines Preises an mich deshalb nurals völlig unrealistische Situation vorstellen, als Oper oderMärchen, allerdings in bester Besetzung, versteht sich.Träumen wir also. Ich kriege einen Preis, sagen wir:den Kleist-Preis. In dem Fall würde ich mir AlexanderKluge als einzigen Juror und Laudator wünschen.Ich würde mich sehr geehrt fühlen.
Warum Kleist, warum Kluge?Beides sind große Autoren. Und noch nie hat michgelangweilt, was aus Kluges Mund kam – oder aus seinemComputer.
Wie fänden Sie es, einen Publikumspreis zu bekommen?Bambi oder was?
Das wäre doch was.Auf der Bühne mit Frau Fischer? Ich bitte Sie.
Man könnte auch eine Abstimmung im Internet machen.Da würde ich schlecht abschneiden.
Sie haben mit Ihren Büchern sensationelle Auflagen erreicht.Das betrifft nur die siebziger und frühen achtziger Jahre.Aktuell finde ich die Umsätze meiner Bücher alles andereals zufriedenstellend.
Warum sind die Verkäufe zurückgegangen?Die Leser, die ich in den Siebzigern hatte, sind mir nichttreu geblieben, weil sie sich selbst nicht treu gebliebensind. Das waren Leute, die früher lange Haare hatten,Rock ’n’ Roll gehört und Drogen durchprobiert haben.Wie sich ein Jahrzehnt später herausstellte: Sie gehörtenzur Masse der Mitläufer, der Nachahmer. Sie habeneiner Mode gehuldigt, mehr nicht. Sie gingen dann zumFriseur, haben geheiratet und aufgehört, sich für Wond-ratschek zu interessieren. Ich treffe immer wieder welche,die sich an meine Gedichte erinnern, an die siebziger
Jahre. Dass ich seither andere, eine ganze Menge andererBücher publiziert habe, interessiert die so wenig wie daseinmal Geträumte.
Sie selbst haben in diesem Jahr in „Erde und Papier“geschrieben: „Dass ich endgültig nicht mehr in Mode war,merkte ich, als Bob Dylan den Nobelpreis zugesprochenbekam – und das Telefon keinen Mucks machte.“Verstehen Sie das nicht falsch: Das Aus-der-Mode-Seinwar ein Glücksfall. Es bedeutet, dass Sie mal in Modewaren und nicht in der Mode verreckt sind. Sie sind auchkein Mann, der sein Schiff neu anstreicht, um in Modezu bleiben, sondern Sie gehören ganz sich selbst. Ich habeden Erfolg nie als verdient angesehen. Ich habe gestaunt,dass damals – unter der Sonne, die nur nachts scheint –plötzlich alle meine Gedichte lesen wollten, Hundert-tausende, und gesagt haben: schön, ein schönes Gefühl.
Wie fanden Sie es, dass Bob Dylan den Literaturnobelpreisbekommen hat?Ich habe mich gefreut: Da ist mal einer von uns preis-gekrönt worden. Ich finde überhaupt, dass am Literatur-nobelpreis zu viel herumgemäkelt wird. Camus hat ihnbekommen, Claude Simon. Das sind sicher nicht dieFalschen. Schön fand ich auch, dass der Preis für Dylannicht zu Geld zu machen war. Es gab ja gar keine Bücher,die man hätte verkaufen können – und kaum jemanden,der über ihn schreiben konnte. Wer sollte das denn bitte
machen? Die Branche saß da und war ratlos. Das Geschäftmit dem Nobelpreisträger ist in die Binsen gegangen – daswar wunderbar: der Einbruch des Undergrounds in dieWelt der Schutzumschläge.
Würde es Sie wie der Blitz treffen, wenn Sie den Nobelpreiszugesprochen bekämen?Es würde mich treffen wie ein Unwetter aus heiteremHimmel. Wie in Deckung gehen? Andererseits: Ichkönnte den Traum meiner unschuldigen Jugend wahr-machen und von der Kohle eine kleine Landvilla imSüden mieten.
Sie würden den Nobelpreis nicht ablehnen?Ich glaube nicht.
Sartre hat zur Begründung, dass er ihn abgelehnt hat, gesagt,jeder Preis mache abhängig.Jeder Preis, klar, hat einen Domestizierungseffekt. BeiSartre hatte die Ablehnung aber einen ganz anderenGrund. Er hat den Preis abgelehnt, weil Camus ihn vorihm bekommen hat.
Thomas Mann war nicht glücklich darüber, dass er denNobelpreis für die „Buddenbrooks“ bekam und nicht für den„Zauberberg“, den er literarisch höher einschätzte. WelchesIhrer Werke halten Sie für am preiswürdigsten?Es gibt Stunden, nächtliche Stunden, und nicht einmalStunden, sondern kurze helle Augenblicke, wo ich, dieeine Erzählung, den einen Roman, das eine oder andereGedicht im Gedächtnis, sage, her mit dem Nobelpreis.
Welche Ihrer Erzählungen? Und welches Gedicht?Die Erzählung „Auf dem Graben“, aus dem Band „Diegroße Beleidigung“. Aus dem gleichen Band die Erzählung„Giotto“. Da ist mir viel gelungen. Man vergibt denNobelpreis ja meistens für Romane oder ein Lebenswerk.Warum nicht mal für eine Erzählung oder einen Gedicht-band? Oder, warum nicht, für nur ein Gedicht? EineMillion für einen Vierzeiler! Das wäre doch was.
45LITERATUR
Plädoyer für Poesie: Wolf Wondratschek(links 1976, rechts 2015) empfiehltGedichte – weil dort alles nachzulesen sei,was man übers Leben wissen sollte.
Schon Ende der Sechziger schrieben Sie: „Ich habe mirabgewöhnt, Quantität zu bewundern.“ Aber ist es nicht eineviel größere Leistung, „Krieg und Frieden“ zu schreiben alseinen Vierzeiler?Doch.
Dann spielt Quantität also doch eine Rolle.„Krieg und Frieden“ ist nicht deshalb gut, weil es1200 Seiten hat, sondern weil es 1200 Seiten großartigeLiteratur sind.
Wenn Sie selbst einen Nobelpreis vergeben dürften: Wemwürden Sie ihn geben?Posthum, wenn das erlaubt ist, würde ich ihn JosephRoth geben oder Isaac Babel oder dem französischenSchriftsteller Romain Gary für den Roman „Die Wurzelndes Himmels“.
Begründung?Ein starkes Buch.
Und unter den lebenden Autoren?Milan Kundera.
Es gibt den Nobel-Effekt, der besagt, dass Schriftsteller, dieden Preis bekommen, danach entweder verstummen oder niemehr alte Höhen erreichen. John Steinbeck soll gesagt haben:Der Nobelpreis ist der Todeskuss. Könnte da was dran sein?Als Camus von der Verleihung des Nobelpreises an ihnerfuhr, wurde er krank. Er zog sich zurück und notierte insein Tagebuch: „Seit jeher hat jemand in mir mit allenseinen Kräften versucht, niemand zu sein.“ Er wusste, erhatte den Kampf verloren. Becketts Frau stürzte, nachdemsie im Radio vom Nobelpreis für ihren Mann gehörthatte, auf diesen zu und rief: „Jetzt sind wir erledigt.“
In einem Gedicht von Ihnen heißt es: „Erzähl den Verlierernvom Ende der Sieger.“ Wie ist deren Ende?Die monumentale Anerkennung, die mit dem Nobelpreiseinhergeht, kann die Preisträger aus der Balance bringen.
Die Frau von Alfred Nobel ist ja bekanntlich mit einemMathematiker durchgebrannt, weshalb es keinen Nobel-preis für Mathematik gibt. Besser wäre gewesen, sie hättesich mit einem Schriftsteller eingelassen – dann gäbe esheute keinen Literaturnobelpreis.
Man sollte doch meinen, der Sieg befördere ein Gefühlder Zufriedenheit, weil er die Anerkennung bedeutet, dieman sich immer gewünscht hat.Gott erhalte Ihnen Ihre naiven Vorstellungen! DasWünschen allein nützt nichts. Sie müssen sich für denSieg einer Mühe unterziehen, die Sie mehr Substanz kostetals Sie es je für möglich gehalten hätten. In der Sehnsuchtnach Triumphen liegt eine fatale Überschätzung dereigenen Kräfte, es kostet zu viel, zu viele Leichen, und dasErsehnte stellt sich nicht ein: Wer siegen will, wird nie dasGefühl haben, oben zu sein – er will immer noch höher.Die „taz“ hat mich mal um einen Kommentar zum Thema„Erfolg“ gebeten. Ich habe geschrieben: nur den, der nichterwartbar war. Also nicht den, auf den man hingearbeitet,für den man die Weichen gestellt, für den man einJury-Mitglied angerufen hat.
Man sollte sich dem Wunsch nach Erfolg und Anerkennungalso gar nicht unterwerfen?So ist es. Das einzusehen, dass darin kein Heil liegt,sondern dass es der Königsweg in die Katastrophe ist,gehört zu den Lebensleistungen, die jedemMenschenabverlangt werden.
Janis Joplin sang: „Freedom’s just another word for nothingleft to loose“. Können Sie damit etwas anfangen?Das ist ein Credo, das an Weisheit schwer zu überbietenist. Eigentümlich ist nur, dass es solche Sätze gibt, indenen alle Weisheit steckt, und dass zugleich dieBuchhandlungen vor Lebensratgebern bersten. Offenbarsind die Menschen voller Sorge, Angst und Beklemmung.Warum lesen sie keine Gedichte? Da steht alles drin.
Mancher Schriftsteller, der sich mit Preisgeldern undStipendien mühsam über Wasser hält, wird sich bei derLektüre des Interviews sagen: Der Wondratschek hatleicht reden. Der hat einen Mäzen, der ihm einen Romanabkauft, und der macht in Berlin eine Ausstellung, woer ein Gedicht für 10.000 Euro veräußert.Sie sprechen hier, ohne dass es Ihnen bewusst sein dürfte,ein weiteres Motiv an, warum man mir keine Preiseverleiht. Die denken sich: Der Wondratschek, der sorgt sowunderbar für sich selbst und wird dann auch noch vonreichen Gönnern verwöhnt, der braucht unser Geld nicht.
Ist das ein Zerrbild?Nein.
Sie haben den Literaturbetrieb mal als „übersubventioniert“bezeichnet. Stehen Sie noch dazu?Absolut.
Was ist das Problem daran?Es hindert einen Menschen doch nichts, der Leidenschaftdes Schreibens nachzugehen und gleichzeitig einenanderen Beruf zu haben, der ihn unabhängig macht…
Die fehlende Zeit?Einer meiner guten alten Freunde ist Jürgen Ploog, einCut-up-Autor, enger Freund auch von Jörg Fauser undBurroughs. Der war Langstreckenpilot bei der Lufthansa.Wenn der vom Fliegen kam, ging er in seine Kammerund hat geschrieben. Der Literatur von heute fehlt es anWelthaltigkeit. Heinrich Heine hat mal gesagt: Manmuss als Autor auf den Rummelplatz gehen, wo sich dieSchatten vermengen, wo man die Lichtquellen nichtmehr genau ausmachen kann. Die Schriftsteller von heutesitzen gemeinsam in der Villa Massimo oder im Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades. Mir fällt dazu ein Satzvon Nelson Algren ein: „Writers never go in a group.“
Was halten Sie von Wettbewerben wie dem Bachmann-Preis?Als Autor sind Sie nur in einemWettbewerb: dem mitden großen Autoren und Büchern aller Zeiten. Erfolg istder, den Sie nicht mehr mitbekommen, wenn Ihre Büchernoch 50 Jahre nach Ihrem Tod gelesen werden.
Sie sind jetzt Mitte 70. Der Literaturkritiker VolkerWeidermann hat vor ein paar Jahren geschrieben, Sie, derselten Preisgekrönte, rechneten mit der Nachwelt. Ist das so?Ich hoffe auf ein gerechtes Urteil, das nicht vom Tage,nicht von einer Jury abhängt, nicht von der Politik, nichtvon moralischen Moden. Zu Lebzeiten kann Erfolg allesund nichts bedeuten: dass Sie gut verdienen, dass SiePreise bekommen oder auch nur, dass ein Unbekannterfreundlich und mit einer leichten Verbeugung den Hutlüftet oder eine Frau im Vorbeigehen leise, sehr leise eineZeile aus einem Gedicht von Ihnen zitiert. Die kleinenGeschenke! Einmal, ich erinnere mich, stand ein Rauch-fangkehrer vor meiner Tür, in der Hand meinen Roman„Selbstbild mit russischem Klavier“ und die gerade beiUllstein erschienene Kassette mit meinen GesammeltenGedichten, und bat um eine Signatur. Im „Schumann’s“in München oder in Wien im „Café Hawelka“ geht derKaffee, den ich bestelle, aufs Haus.
Vor drei Jahren haben wir beide ein Interview übers Rauchengeführt. Es war für den Deutschen Reporterpreis nominiert.Ehrlich? Das wusste ich nicht…Wie schön! Aber nichtgekriegt?
Nein. Hätten Sie es denn angemessen gefunden?Das weiß ich nicht. Aber ich hätte es Ihnen gegönnt.Tut mir leid, dass Sie da übergangen worden sind.
46 TATTOOS
FOTO
SD
PA
(2),
DD
P,G
ET
TY,
PR
ISM
A,T
SU
NI/
GA
MM
AU
SA
/LA
IF
attoos und Literatur – das einewird, sofern man zu Pauschalisie-rungen neigt, gerne mit KrrK iminellenassoziiert, das andere mit Intellek-
tuellen oder zumindest solchen, die vorgeben,Intellektuelle zu sein. Doch seit der Menschdurch Zeichen kommuniziert, spielen Täto-wierungen eine besondere Rolle in der Gesell-schaft. Sei es zu rituellen, sozialen, politischenoder ästhetischen Zwecken: Tattoos sind einKainsmal der Menschheit, sowohl Schutz-zeichen als auch Schandfllf eck. Daran hat sichbis heute nicht viel geändert.
Tätowierungen und Literatur haben vielgemein. Beide Ausdrucksformen sind aus Kul-turen in aller Welt bekannt, beide wurdenauf Haut festgehalten, beide wollen Geschich-ten erzählen. Die gestochenen Augenblicke,die vomTattoo-Träger präsentiert werden, sindNarrative wie die Literatur. Aber währendTätowierungen weiter auf Haut gestochenwerden, sind die Schriftsteller längst vomPergament aufs Papier gewechselt.
Wie ein literarisches Werk, so sind auchTattoos, sei es in Bild oder Schrift, vieldeutig.KllK are Aussagen über die Bedeutung für denTräger sind meist nicht zu bekommen. Es kön-nen – wie bei einer Interpretation – nur mehroder weniger treffende Wahrscheinlichkeits-aussagen gemacht werden. So hat sich die ame-rikanische Sängerin Lady Gaga nicht etwa einTribal oder eine Sonne tätowieren lassen, son-dern einen übersetzten Auszug aus RainerMaria Rilkes „Briefen an einen jungen Dich-ter“ über den Grund, warum man schreibt:„Prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle IhresHerzens seine Wurzeln ausstreckt, gestehen Siesich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnenversagt würde zu schreiben. Dieses vor allem:Fragen Sie sich in der stillsten Stunde IhrerNacht: Muss ich schreiben?“
Durch die Tätowierung öffnet sich für dieLiteratur eine neue Zwischenwelt. Wenn siegestochen wird, bewohnt sie gleichzeitig dieInnenwelt des Trägers und die Außenwelt desBeobachters. Durch den Prozess des Stechensentsteht eine vierfache Interaktion zwischenAutor und Leser, Leser und Tätowierer, Täto-wierer und Autor, Kunde und Tätowierer. Wiedie Zeichen zu lesen sind, muss also immerwieder neu ausgehandelt werden. In diesemProzess konstruiert sich die Bedeutung erstdurch die Wahrnehmung eines anderen.
Tattoos wollen von vielen Blicken wahr-genommen werden. Das Buch dagegen will inKontakt mit dem Leser treten, es offenbart sichnicht in der Gesellschaft, sondern in stillerZweisamkeit. Literatur und Text auf der Hautenthalten also, wie bei Lady Gaga, eine perfor-mative Komponente. Im Augenblick des Auf-tritts auf der Bühne oder auf dem roten Tep-pich konstituiert sich zwischen Betrachter undTattoo ein Sinnfeld, das mit Inhalt und Deu-tung zur Person Lady Gaga gefüllt wird. DasTattoo erhält seinen ästhetischen Wert aus derSituation heraus. Denn das Ziel des Tätowier-ten ist es, den Blick des Betrachters zu bindenund damit Aufmerksamkeit zu erregen.
Indem sich Menschen Textstellen auf dieHaut stechen lassen, bewahren sie die Literaturauch vor dem Vergessen. Denn die Rezeption,die Bestandteil des literarischen Akts ist, ver-gegenwärtigt und aktualisiert die Literatur.Womöglich beschert diese Aktualität sogarRilke oder Brecht neue Leser. Und vielleichtkann man sich ja bald auch auf der FrankfurterBuchmesse tätowieren lassen. Um es mit BradPitts linkem Arm zu sagen: „Absurdités del’existence“ – das Leben ist seit Jean-Paul Sartreabsurd. Und Selbstverwirklichung geschiehtvielleicht in einem Tattoo mit einem Satz vonGoethe. Warum auch nicht?
Literarische Tattooseröffnen neue Welten –und einen ganz neuenBlick auf Bücher.Von Artur Weigandt
Zitate von James Joyce(„Silence Exile Cunning“) und
William Shakespeare(„Man is a giddy thing“) zierenJohnny Depps rechten Arm.
Megan Fox trägt Shakespeare aufdem Rücken: „We will all laugh atgilded butterflies“ stammt aus
„König Lear“ und heißt etwa: „Esist nicht alles Gold, was glänzt“.
Lady Gaga hat sich in Japan einRilke-Zitat auf den Arm stechenlassen. Auf Deutsch: „Fragen Siesich in der stillsten Stunde IhrerNacht: Muss ich schreiben?“
Den Rücken von Evan RachelWood zieren die Zeilen: „All thatwe see or seem is but a dream
within a dream“. Sie entstammeneinem Gedicht Edgar Allen Poes.
Seit dem Tod seines Freunds MacMiller mahnt Lil Xan mit einemGesichts-Tattoo: „Memento Mori“.Der Rapper ist sich also stetsseiner Sterblichkeit bewusst.
Auf dem linken Arm trägt BradPitt das Tattoo „Absurdités del’existence“. Ist er wirklichAnhänger des französischen
Existenzialismus?
T
47SNEAKER
SCHAUTAUF DIESEN
SCHUH
S„Inspiration von überall her“: Inan Batman ist Sohn türkischer Eltern, hat Mode und Design in seiner Geburtsstadt Stuttgart studiert und lebt inzwischen in Berlin.
Inan Batman erfindet Sneaker,entwirft Mode – und richteteine Plattform ein, auf der manGetragenes tauschen kann.
Von Aylin GülerFotos Matthias Lüdecke
chon im Alter von 15 Jahren wusste Inan Batman,dass er Modedesigner werden wollte. Dabei hatte erbis dahin nur seine Großmutter nähen sehen. Aberihre Arbeit regte ihn an. Als Kind türkischer Gast-
arbeiter wuchs Batman in den neunziger Jahren in einemVorort von Stuttgart auf. Seine Nachmittage verbrachte erim Jugendzentrum, tanzte zu Hip-Hop-Musik, sprühteGraffiti und legte Musik auf. „Damals in unseremJugendhaus gab es einen DJ-Kurs, und ich wollte es ein-fach mal ausprobieren“, sagt Batman, der inzwischen30 Jahre alt ist. So kam alles zusammen. „Durch dieganzen Hip-Hop-Musikvideos bin ich irgendwann zurKleidung gekommen, die all die Rapper und Sängerdamals getragen haben.“
Bis 2010 studierte Inan Batman am Staatlichen Berufs-kolleg für Mode und Design in Stuttgart. „Nach dem Ab-schluss war ich total overloaded und habe erst mal einePause von der Mode gebraucht“, erzählt er. Fortan kon-zentrierte er sich wieder mehr auf die Musik. Nach kurzerZeit war sein Netzwerk so groß, dass er als DJ Batmansogar von namenhaften amerikanischen Künstlern ge-bucht wurde. Erste Auftritte in den Vereinigten Staatenfolgten. „Für jeden DJ, der aus dem Hip-Hop-Bereichkommt, ist das ein Traum.“
2013 kehrte Inan Batman seiner Heimatstadt denRücken und zog nach Berlin. Im selben Jahr gründete erdort sein Modelabel „INAN“. Batmans Vorname kommtaus dem Türkischen und heißt so viel wie „Glaube“. „DieLeute in Berlin konnten meinen Gedanken folgen“, sagter. „In meiner Heimat habe ich nur auf Granit gebissen.Die Stuttgarter sind nicht dafür bekannt, besonders offenzu sein, was Kreativität angeht.“
Zwei Jahre später war Inan Batman bereit für eineerste eigene Kollektion. Die Bestätigung, die er als DJbekam, hatte ihn auch als Modedesigner reifer und selbst-bewusster werden lassen. Von seinem musikalischenNetzwerk profitierte auch seine Mode: Bekannte Künstlerwie Nas, French Montana und The Weeknd trugen dieKleidung seiner ersten Kollektion.
In seiner Mode spiegeln sich verschiedene Kulturen.„Unsere Kleidung ist für jeden, der sich damit identifizie-ren kann“, sagt er. Wenn er von „uns“ und „wir“ spricht,meint der Designer sein Team, das vor allem aus Familieund Freunden besteht. Sein Bruder kümmert sich umdie Finanzen, Freunde um die Vermarktung. Er selbst istCreative Director von „INAN“.
Neben seinem eigenen Modelabel und Auftritten alsDJ betreibt der Wahlberliner auch einen Vintage- undReselling-Store in Mitte. Dort bietet er Jugendlichen einePlattform an, um sich zu treffen, auszutauschen und vorallem um getragene Schuhe und Kleidung zu verkaufenoder zu tauschen. „Der Konsum von Mode muss bewuss-ter werden“, sagt Inan Batman. „Es geht nicht darum,20 verschiedene Jeanshosen im Kleiderschrank zu haben.Das sollen die Kids lernen.“
Inan Batman gehört zu den aufstrebenden Designernin Deutschland. In den vergangenen Jahren hat er schonmit Lee Jeans, Eastpak und Alpha Industries zusammen-gearbeitet. Erst kürzlich hat er sogar einen Sneaker fürAdidas entworfen. In einem Wettbewerb hatte er sichgegen andere Designer aus Berlin durchgesetzt. Es gingum limitierte Sneaker, die die „DNA der Hauptstadtrepräsentieren“. Sein siegreiches Konzept stellt Vergangen-heit, Gegenwart und Zukunft der Hauptstadt dar.
„Berlin ist bekannt für seine Geschichte der Tren-nung. Es ist eine Stadt, die von Mauern, Grenzen undStacheldrahtzäunen bestimmt wurde.“ Deshalb das Motivdes Stacheldrahtzauns auf dem Schuh. „Der Bereich, inden die Neon-Farben einfließen, steht für die Berliner, diees immer geschafft haben, die dunklen Mauern zu durch-brechen.“ Schwarz-weiß also für Berlins dunkleGeschichte, Grün für die Gegenwart, für die Kreativitätund den Geist der Berliner, die die Stadt so einzigartigmachen.
Wie um das zu bekräftigen, trägt das Design eineLasergravur auf der Ferse mit der Aufschrift „the World’stoo small for Walls“. Die 3D-gedruckte Silhouette selbstzeigt einen großen Schritt in die Zukunft. Die Schuhe,vom 1. Juni an erhältlich, waren binnen kürzester Zeitausverkauft. Jedes Paar wurde in einer speziellen Samm-lerbox geliefert, darauf ein Bild der Hauptstadt.
Berlin als unerschöpfliche Inspirationsquelle? „DieHauptstadt ist auf jeden Fall meine Wahlheimat gewor-den. Aber als DJ verreise ich so viel, dass ich mir meineInspiration inzwischen überall hole.“ Das spiegelt sichauch in seinen Designs wider. Um Kraft zu tanken, ziehtes Inan Batman aber auch immer wieder in die Heimat,nach Stuttgart. „Mit meinen Jungs muss ich nicht immerüber Musik oder Mode reden. Dieser normale Boys-Talktut mir einfach gut.“ Die Energie braucht er auch: Imnächsten Jahr will Inan Batman seine zweite Kollektionauf der Modewoche in Paris vorstellen.Hauptstadt-Schuh: Das Grün steht für die Gegenwart.
REISE48
on Weitem schon ist es zu vernehmen: ein dunklesGrollen, ein mächtiger Donnerschlag und ein langeanhaltendes Zischen und Rauschen. Wieder einmalhat sich an der Kalbungsfront des Gletschers Perito
Moreno ein mächtiges Stück Eis gelöst und ist ins Wassergeplatscht. Das gehört zu den gewöhnlichen Aktivitätender Eismasse, die sich in der patagonischen AndenregionArgentiniens immer wieder zutragen. Das ganz großeSchauspiel hält der Gletscher nur alle zwei bis vier Jahrebereit, zuletzt am 11. März 2018, und nun wohl in einpaar Monaten oder vielleicht auch erst in ein oder zweiJahren wieder. Da ist er dann von neuem so weit an dasUfer vorgerückt, dass er im Lago Argentino, einem Seevon der dreifachen Größe des Bodensees, zwei Armevoneinander abtrennt und den einen, den Brazo (Arm)Rico, derart aufstaut, dass er mit tosender Gewalt demWasser den Weg zu dem anderen Arm, dem Canal de lostémpanos (Kanal der Eisberge) freigeben muss.
Wenn dieser Moment gekommen ist, bildet sich unterdem bis an das Festland vorgerückten Eisblock ein Durch-lass, durch den dasWasser strömt. Die darüber entstandeneBrücke bröckelt danach Stück für Stück ab und stürztschließlich ganz ein. Danach beginnt der Zyklus vonneuem. Der Perito-Moreno-Gletscher ist freilich rechtlaunisch. Über einen Zeitraum von 16 Jahren, von 1988bis 2004, enthielt er seinen Besuchern, die ihn von einem
Mächtige Eismassen, gewaltige Granitfelsen, kargeVegetation, geheimnisvolle Stimmung: Zu Besuch inder erhabenen Landschaft Argentiniens.Fotos Martin PudenzText Josef Oehrlein
DAS GROLLENVON PATAGONIEN
V
REISE 49
gegenüber seiner Kalbungsfront errichteten Steg aus beob-achten können, das Spektakel vor: Es hatten sich immerwieder kleine Kanäle gebildet, über die das Wasser konti-nuierlich von einem zum anderen See-Arm fllf ießen konnte.Am 5. März 2012 ließ der Gletscher dann nachts um3.45 Uhr die Eisbrücke kollabieren, ganz ohne Zuschauer.
Der Perito-Moreno-Gletscher scheint seltsamerweisenicht unter dem Klimawandel zu leiden wie viele anderein aller Welt. Er bleibt in einem wundersamen Gleich-gewicht, das alle paar Jahre das Drama der ruptura bietet,des Bruchs der Eisbrücke. Eine eindeutige Erklärung fürdieses Phänomen hat die Wissenschaft noch nicht. DieDruckverhältnisse des Eises könnten sich so verändert
haben, dass das Innere des Eisfeldes mehr Nachschuberhält als in früheren Zeiten und so eine Eigendynamikentwickelt hat, die zu einem verstärkten Eisfluss führt;immerhin bewegt sich die Gletscherzunge täglich umzwei Meter auf das Festland zu. Nach einer anderenHypothese könnte ein System von Brüchen, die durchErdbeben oder andere Ereignisse verursacht wurden, dieBewegung des Gletschers verändert haben. Immerhinscheint er genug Nachschub an Schneemassen zu erhalten.
Der Gletscher, den 1879 ein für Chile tätiger britischerKapitän zum ersten Mal gesehen und zunächst nach demLeiter des damaligen hydrographischen Dienstes derchilenischen Marine benannt hatte, durfte kurzzeitigauch einmal den Namen des deutschen ReichskanzlersBismarck tragen. Seit 1899 heißt er endgültig PeritoMoreno. Das spanische Wort „Perito“ bedeutet „Sach-verständiger“ oder „Experte“, ist also ein Ehrentitel, unddas beschreibt genau, weshalb Francisco Pascasio Morenodem Gletscher seinen Namen leihen durfte.
Moreno war eine faszinierende Gelehrtengestalt imArgentinien des 19. Jahrhunderts. Schon in seiner Kindheithatte er sich für die Natur zu interessieren begonnen. Lauteiner Anekdote wurde er beim Umzug seiner Familie in einneues Haus in Buenos Aires auf die seltsamen schnecken-förmigen Figuren in dem rötlich geäderten Marmoraufmerksam. Man erklärte ihm, dass es sich um fossile
Der Perito-Moreno-Gletscher ist derspektakulärste aller
Gletscher in Patagonien –und gehört zu dengrößten Attraktionen
Argentiniens.
Auf dem See NahuelHuapi bei Bariloche fährt
ein Ausflugsschiff.
REISE50
Der Granitberg Fitz Roy heißt in der Sprache der Tehuelche-Indianer Chaltén, „der Rauchende“ – wegen der oft an der Spitze zu sehenden Wolken.
REISE 51
REISE52
Der Puente Negro(„Schwarze Brücke“) desIngenieurs David Rowellgeht über den Rio Paine.
Der Weg zu den Torresdel Paine, den Granit-bergen in Chile, ist weit.
Reste von Tieren aus Urzeiten handele. Damit war seineNeugier auf erdgeschichtliche und geologische Zusammen-hänge geweckt.
Als Fünfzehnjähriger baute Francisco Moreno in seinemElternhaus ein kleines „Museum“ mit paläontologischenFundstücken auf, mit 20 publizierte er seine erste wissen-schaftliche Schrift. Ihn faszinierten die Objekte, vor allemFossilien, die ihm ein befreundeter Militär aus Patagonienmitbrachte. Also erkundete er die damals noch fast men-schenleere Region. In unzähligen Expeditionen sammelteer Materialien, erforschte die Naturräume und die Lebens-bedingungen der Ureinwohner. Er suchte nach Übergängenüber die Anden von Argentinien nach Chile und nachTrassen für mögliche Eisenbahnlinien.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stand dieGrenze zwischen Argentinien und Chile in der verschneitenund vergletscherten Region der Anden in manchen Zonennoch nicht endgültig fest. Moreno erhielt den Auftrag,als Sachverständiger, eben als Perito, an der Spitze einerKommission Vorschläge für eine Fixierung der Grenze zuChile zu unterbreiten. Seinem Land brachte der Argentinierdurch sein Verhandlungsgeschick einen Zugewinn von42.000 Quadratkilometern in den Gebieten, die zwischenden Ländern umstritten waren.
Für seinen Einsatz und den Landgewinn zugunstenArgentiniens wurde Moreno ein großes Terrain in Patago-nien als Geschenk überlassen. Etwa 7500 Hektar gab erdem Staat wieder zurück, mit der Maßgabe, dass dortein Naturreservat eingerichtet werden solle. Das war dieGeburtsstunde der Nationalparks. Damit war Argentiniendas dritte Land der Welt nach den Vereinigten Staatenund Kanada, das solche Naturschutzzonen einrichtete;1904 wurde Morenos Idee mit der offiziellen Gründungdes Parks westlich des Nahuel-Huapi-Sees bei der StadtBariloche Wirklichkeit. Heute gibt es in Argentinien35 Naturschutzparks in den verschiedenen KllK imazonen,einer von etwa 120.000 Hektar Größe trägt den Namen desPerito Moreno. Der nach ihm benannte Gletscher wieder-um liegt in dem Park Los Glaciares (Die Gletscher) bei derpatagonischen Stadt El Calafate.
Francisco Moreno starb 1919 überschuldet und verarmt,einen Teil seines Vermögens hatte er für wohltätige Zweckeausgegeben. Der Nationalpark Los Glaciares gehört seit1981 zu den von der Unesco als Weltnaturerbe deklariertenRegionen und inzwischen zu den größten touristischenAttraktionen Argentiniens. Mit monumentalen Gletschernund dem 3405 Meter hohen Granitberg Fitz Roy bei ElChaltén ist der Park ein Dorado für Wanderer, Bergsteiger,Eiskletterer und Trekkingenthusiasten. Für die patagonischeProvinz Santa Cruz wie für den argentinischen Staat ist ereine schöne Einnahmequelle.
Früher musste man von Buenos Aires aus meist in dieProvinzhauptstadt Rio Gallegos an der Atlantikküste fllf iegen
REISE 53
DAS GROLLEN VON PATAGONIEN
REISE54 REISE 55
An der Bushaltestelle beiPuerto Natales (Chile)wartet niemand.
Der Piedras-Blancas-Gletscher, als hätte
Caspar David Friedrichihn gemalt.
DAS GROLLENVON PATAGONIEN
und von dort fast vier Stunden lang über die Landstraßein die Gletscherregion fahren, weil der Flughafen von ElCalafate nur von kleinen Maschinen angeflogen werdenkonnte. Der erweiterte neue Flughafen „ComandanteArmando Tola“ schwemmt mit gut einemDutzend täglicherFlüge Tausende Touristen nach El Calafate.
Das frühere Präsidentenehepaar Néstor und CristinaKirchner, das von 2003 bis 2015 Argentinien regierte,bezeichnete Santa Cruz immer wieder als seine Herzens-heimat. Néstor Kirchner war von 1991 bis 2003 Gouverneurmit Sitz in der Provinzhauptstadt Rio Gallegos, und inEl Calafate besitzt die Familie ein luxuriöses Ferienhaus,das während ihrer Präsidentschaftszeit immer wieder alsRückzugsort und für Klausursitzungen des innerenMachtzirkels diente. Bei einem Aufenthalt dort starbNéstor Kirchner am 27. Oktober 2010 an einem Herz-infarkt. Ein Baulöwe, der von dem Herrschaftssystemprofitiert hatte, errichtete dem vormaligen Präsidenten eingewaltiges Mausoleum auf dem Friedhof von Rio Gallegos.
Néstor Kirchners Witwe Cristina, bei den im Oktoberanstehenden Wahlen Kandidatin für die Vizepräsident-schaft, zog sich auch nach dem Tod ihres Mannes gernenach El Calafate zurück. Immer neue Enthüllungen zeigen,wie stark das Präsidentenehepaar von dem Tourismus-boom profitiert hat, schon bei Bau und Ausbau des Flug-hafens. Die Kirchners erwarben in El Calafate auch Hotels,die mutmaßlich Teil eines Korruptionssystems waren.Gegen Cristina Kirchner wird deshalb in mehreren Ge-richtsverfahren ermittelt. Ihre Hotels in El Calafate sindfast alle geschlossen, auch ihr Lieblingshotel Los Sauces(Die Weiden), das sie selbst ausgestattet hatte.
Touristen, die nach El Calafate reisen, bekommen vonden skandalösen Vorgängen wenig mit. Es zieht sie aus derwinddurchtosten Ebene Patagoniens, die einst ein Paradiesfür Saurier war und immer wieder neue überraschendeFossilfunde freigibt, zu dermajestätischenWelt der Gletscherund Bergmassive. Der Fotograf Martin Pudenz hat imargentinischen Spätsommer Patagonien bereist und diemächtigen Eismassen undGranitfelsen, die karge Vegetationund die geheimnisvolle Stimmung in der von gelegentlichenLichtblicken erhellten Landschaft mit der Kamera ein-gefangen. Er hat dabei das Kunststück vollbracht, mit derDigitalkamera, einer Fuji XT20, eine ähnlich magischeWirkung zu erzielen wie bei seinen früheren analogenFotografien, etwa mit Hilfe des aufwendigen Bromöl-drucks. Manmuss kein Sachverständiger sein, um in diesenSchwarzweißbildern die grandiose Schönheit der patago-nischen Berg- und Gletscherwelt zu erspüren.
56 PSYCHOLOGIE
FOTO
MA
UR
ITIU
S
rauen wollen einen zuverlässigen Part-ner fürs Leben finden, Männer wollensich nicht festlegen, lieber mit vielen
Frauen schlafen: Diesen Eindruck vermittelnRatgeber und romantische Komödien.Männer kommen demnach vom Mars,Frauen von der Venus. Die Titel solcherBücher: „Warum Männer nicht zuhörenund Frauen schlecht einparken“ oder„Warum Männer immer Sex wollen undFrauen von der Liebe träumen“. In „Ersteht einfach nicht auf dich“ (2009) sagtBradley Cooper: „Männer wollen nichtwirklich heiraten. Tun sie es doch, denkensie nur an all die Frauen, die sie deshalbnicht haben können.“ Ist das wirklich so?Und wenn nicht, warum glauben wirtrotzdem daran? Vermutlich hat es mitDarwin zu tun und mit einem von ihminspirierten Experiment zum Sexualver-halten von Fruchtfliegen.
1. Darwin und die Fruchtfllf iegen„Die Männchen fast aller Arten habenstärkere Leidenschaften als die Weibchen.Deshalb sind es die Männchen, die mit-einander kämpfen und ihre Reize verfüh-rerisch vor den Weibchen präsentieren.Die Weibchen auf der anderen Seite sindfast ohne Ausnahme weniger begierig alsdie Männchen. Sie will umworben werden,sie ist spröde und versucht häufig für langeZeit dem Männchen zu entkommen.“ Sobeschreibt Charles Darwin das Sexual-verhalten der Tiere 1871 in „Die Abstam-mung desMenschen und die geschlechtlicheZuchtwahl“. 70 Jahre später experimen-tierte der Biologe Angus Bateman, inspi-riert von Darwin, mit Fruchtfliegen. DasErgebnis: Zwischen verschiedenen Männ-chen gab es größere Unterschiede in derZahl der Sexualpartner und in der Größedes reproduktiven Erfolgs als zwischenden Weibchen. Dabei hing der reproduktiveErfolg bei den Männchen von der Anzahlder Sexualpartner ab, bei den Weibchenhingegen nicht. Weniger wissenschaftlichausgedrückt: Während manche männli-chen Fruchtfliegen gar nicht zum Zugekamen, waren andere bei vielen Fliegen-damen erfolgreich und zeugten besondersviele Nachkommen. Die weiblichenFruchtfliegen hingegen wurden fast alleträchtig, egal, mit wie vielen männlichenFliegen es zum Akt kam. Merke: Einwildes Sexleben lohnt sich nur für Männ-chen. Und: Was für die Fruchtfliegen gilt,muss auch für andere Tiere gelten – undfür den Menschen, der biologisch gesehenauch nur ein Tier ist.
2. Trivers und der ElternaufwandUngefähr das muss sich Robert Trivers ge-dacht haben, als er 1972 seine Theorie desElternaufwands aus Batemans Beobach-tungen ableitete. Sie lautet in etwa so:Männer investieren bei der Fortpflanzungweniger als Frauen, nämlich ein winzigesSpermium im Vergleich zu einem viel
größeren Ei. Sie können insofern mitwenig Aufwand viele Kinder zeugen. FürFrauen ist selbst der minimal notwendigeAufwand groß: Neben dem Ei umfasst dernämlich auch Schwangerschaft, Geburtund Stillzeit. Sie können deshalb nur einebegrenzte Anzahl an Kindern bekommen.Während Männer die Reproduktion ihrerGene steigern können, indem sie Konkur-renten ausstechen und viel Sex mit vielenFrauen haben, gelingt dies Frauen, indemsie Partner wählen, die gesund und wohl-habend sind und in die Kinder investieren.Während Männer recht wenig verlieren,wenn sie Frau und Kinder sitzen lassen,gilt das für Frauen nicht. Merke also:Männer sind von Natur aus kompetitivund promisk, Frauen monogam, häuslichund auf der Suche nach einem Versorger.
Die Ideen von Darwin, Bateman undTrivers wurden von der Wissenschaftscheinbar immer wieder bestätigt. So sagenin Umfragen mehr Männer als Frauen aus,schon einmal fremdgegangen zu sein, undMänner geben die Zahl ihrer Sexualpart-nerinnen höher an als umgekehrt. Es schienalles zusammenzupassen. Die evolutionäreErklärung dafür, dass Männer immer nuran Sex denken und Frauen von der Liebeträumen, ist schlicht, einleuchtend undelegant. Sie hilft außerdem, ein gesell-schaftliches System, in dem Frauen sichum Kinder und Haushalt kümmern, dieMänner ums Geldverdienen und um ihreSekretärinnen, als natürlich zu legitimieren.Kein Wunder, dass jahrzehntelang einwichtiges Detail übersehen wurde: DieTheorie ist Unsinn. Das zeigt ein genauererBlick ins Tierreich.
3. Untreue in der TierweltNäher als die Fruchtfliegen kommen demMenschen Arten, die monogam leben.Viele Singvögel etwa galten lange alsmonogam, weil sie sich oft gemeinsam umden Nachwuchs kümmern. Tatsächlichpflegen zum Beispiel bei den Blaumeisenaber auch die Weibchen die außerpaarlicheKopulation. Bei den Männchen ergibt dasnach Bateman und Trivers Sinn: DieWeibchen können in einer Saison nur einebestimmte Anzahl an Eiern legen und aus-brüten. Fortpflanzung mit anderen Weib-chen erhöht deshalb für Männchen denReproduktionserfolg. Forscher haben aberschon vor Jahren nachgewiesen, dass sichim Nest einer Meise meist ein paar Eierfinden, die nicht vom Partner stammen.Diese Art der weiblichen Promiskuität istebenfalls evolutionär bedingt: Je mehrverschiedene Väter, umso höher dieWahrscheinlichkeit, dass ein paar derHalbgeschwister gute Gene mitbekommenund ein langes Leben vor sich haben. BeimFortpflanzungserfolg geht es also nichtnur um die Zahl derNachkommen, sondernauch um die genetische Qualität derselben.Auch den Königinnen der Tiere ist Poly-amorie nicht fremd. Erobert ein neuer
Löwe im Kampf das Rudel, in dem sieleben, sind ihre Nachkommen in Gefahr.Denn der neue Rudelführer tötet oft dieJungen seines Vorgängers. Den Nach-wuchs der promisken Löwinnen aber wirdein neuer Rudelsführer schonen: Es könnteja der eigene sein.
Weniger brutal geht es bei den Gib-bons zu. Auch diese Affen in Südostasiensind monogam, ein Paar und sein Nach-wuchs leben zusammen in einem Revier.Der Biologe Ulrich Reichard hat beobach-tet, dass sowohl Männchen als auchWeibchen in den Gebieten, in denen sichihr Revier mit dem anderer Tiere über-schneidet, gelegentlich „fremdgehen“. „DieWeibchen, die länger als drei Jahre ineinem Revier gelebt haben, haben alleschon mindestens mit einem Partner ko-puliert, der nicht der eigene war“, sagt er.„Nach Bateman sollte das nicht so sein,aber ich beobachte, dass die Weibchen in-teressiert sind an diesen verschiedenensexuellen Beziehungen.“ Und nicht nurdas: Ihr Verhalten zeigt, dass die weiblicheSexualität auch bei Tieren nicht nur aufFortpflanzung ausgerichtet ist. So habendie Gibbondamen auch Sex, wenn sienicht fruchtbar sind. Beim Partner kanndas der Beziehungspflege dienen, beianderen Affen der guten Nachbarschaft.„Wenn eine Affendame sich mit einemNachbarmännchen paart, lässt der sievielleicht künftig länger am Obstbaumsitzen, ohne sie wegzudrängen.“ Ob auchLust eine Rolle bei den Gibbons spielt,kann die Wissenschaft bisher nicht beant-worten. „Es gibt aber Hinweise darauf,dass Primatenweibchen einen Orgasmusempfinden können.“ Das ergab die Mes-sung von Gehirnströmen und Muskel-kontraktionen.
4. Homosexualität in der TierweltNur bei den wenigsten Sexualkontakteneines Menschen geht es um Fortpflan-zung. Trotzdem basieren fast alle Theorienzu Partnerschaft, Sex und Elterndaseinauf evolutionären Überlegungen, also derVorstellung, dass es letztlich immer darumgeht, das eigene genetische Material indie nächste Generation zu retten. Was,wenn das nicht mal bei den Tieren sowäre? Dafür spricht neben dem munterenSexleben nicht-fertiler Gibbondamen auchHomosexualität bei Tieren. Sie ist beiimmerhin 500 Arten dokumentiert undbei bis zu 1500 Arten beobachtet worden.
Weibliche Bonobos zum Beispiel rei-ben ihre Geschlechtsteile aneinander undschreien dabei lustvoll. Forscher hieltendas lange für einen Begrüßungsritus.Bestieg eine männliche Giraffe eine andere,vermutete man einen Revierkampf –selbst wenn es sich offenkundig um einenSexualakt handelte. Die Wissenschaftwollte homosexuelles Verhalten bei Tierenlange nicht als solches erkennen. „Wenigeraus Homophobie, denke ich, als aus man-
Frauen sind in der Liebe vorsichtig und monogam, Männerdraufgängerisch und promisk. Das wusste schon Darwin. Allein:Es stimmt nicht. Geschichte eines Irrtums. Von Leonie Feuerbach
gelnder Vorstellungskraft für die Vielfaltder Tierwelt“, sagt der norwegische Zoo-loge Petter Bøckman, der Homosexualitätin der Tierwelt erforscht hat. Bei Sexzwischen männlichen Tieren gehe es oftum Spannungsabbau, sagt Bøckman. Esgibt aber einige Arten, bei denen etwazehn Prozent der Tiere ausschließlichgleichgeschlechtlichen Sex haben, etwaHausschafe. Sogar schwule Lebenspartner-schaften kommen in der Tierwelt vor:Männliche Flamingos brüten gemeinsamEier aus und ziehen die Küken auf.Schwule Paare sind bei den monogamlebenden Flamingos sogar im Vorteil, weilzwei Männchen stärker sind als gemischtePaare und ihr Territorium besser verteidi-gen können. Es gibt aber auch lesbischeFlamingopaare.
Dass homosexuelles Verhalten vorallem bei Vögeln gut dokumentiert ist,liegt laut Bøckman daran, dass sichMännchen und Weibchen optisch meisteindeutig unterscheiden lassen. Wenn zweimännliche Füchse oder Ratten Sex haben,lässt sich das hingegen nicht ohne weitereserkennen. Er vermutet deshalb, dassHomosexualität in der Tierwelt noch weiterverbreitet ist als bisher bekannt.
Die Vorstellung, Tiere hätten Sex nurzur Fortpflanzung, findet Bøckman ab-surd. „Wenn man mal darüber nachdenkt,gibt es nur eine Spezies, die Elternschaftplanen kann: Menschen! Wissen Delfine,dass aus Sex Babydelfine entstehen? Ichglaube nicht. Tiere haben Sex, weil sie Sexhaben wollen.“ Dafür spricht auch, dassauch Selbstbefriedigung im Tierreich vor-kommt – bei Männchen und Weibchen.
NICHT MALMANNER SIND TIERE
. .
F
57PSYCHOLOGIE
Fruchtfliegen paaren sich:Lohnt sich Sex mit vielenPartnern nur für Männchen?Und wenn ja: Gilt das auchfür Menschen?
5. Noch mal die Fruchtfllf iegenDie amerikanische Biologin Patricia Go-waty untersucht seit Jahrzehnten das Paa-rungsverhalten von Tieren. Immer wiederhat sie beobachtet, dass auch Weibchensich kompetitiv und Männchen wähle-risch verhalten. Irgendwann kam sie aufdie Idee, sich Batemans Studie von 1948noch einmal anzuschauen. 2007 vollzogsie mit einem Studenten seine Methodiknach – und war schockiert. „Wir saßentagelang an meinem Küchentisch, gingenZeile für Zeile des ursprünglichen Artikelsdurch, und am Ende hatten wir mehrerezentrale Fehler entdeckt, im Design seinesExperiments und bei der Auswertung.“
So zeigte sich bei einer Versuchsreiheein größerer Reproduktionserfolg beimehr Sexualpartnern auch bei Weibchen.Diese Daten analysierte Bateman aber ge-trennt von denen aus seinen letzten zweiVersuchsreihen, die besser zu seiner Thesepassten. Und in die Lehrbücher ging vorallem der Graph zu den beiden letztenExperimenten ein, der nur bei den Männ-chen eine steile Kurve zeigt beim Zusam-menhang von „number of mates“ und„reproductive success“. Später wiederholteGowaty sein Experiment mit zwei Kollegen.Obwohl das Bateman-Prinzip eine beacht-liche wissenschaftliche Karriere gemachtund das vorherrschende Geschlechterbildunserer Zeit mitgeformt hat, war derVersuch in fast 70 Jahren nie wiederholtworden. 2012 erschien der Artikel in den„Proceedings of the National Academy ofSciences“. Darin wies Gowaty nach, dassBatemans Methodik die Ergebnisse ver-zerrt hatte (siehe Text rechts).
Obwohl seine Methoden tendenziösund seine Ergebnisse fehlerhaft waren,wird sein Prinzip selten angezweifelt.„Viele Forscher glauben Bateman einfach,weil seine Theorie so gut zu der Doppel-moral passt, mit der wir Männer undFrauen bewerten. Unsere Normen wirkenin der Untersuchung von Geschlechter-unterschieden verzerrend. Studien werden,bewusst oder unbewusst, so aufgebaut,dass sie immer wieder dasselbe bestätigen.Tun sie es nicht, wird davon ausgegangen,dass die Daten falsch sind, nicht diezugrundeliegende Theorie.“
6. Der perfekte promiske MannSelbst wenn männliche (und weibliche)Fruchtfliegen ihren reproduktiven Erfolgdurch ein promiskes Sexleben erhöhenkönnen: Gilt das tatsächlich auch fürMenschen? Nein, sagt die kanadisch-briti-sche Wissenschaftsautorin Cordelia Fine.Und führt das auf amüsante Weise inihrem Buch „Testosterone Rex“ vor. EineFrau kann im Lauf ihres Lebens kaummehr als durchschnittlich zehn Kinderbekommen. Nun könnte man denken:Ein Mann kann in einem Jahr 100 Frauenschwängern! Nur: Er müsste diese 100Frauen nicht nur finden, sie dürften auchweder schwanger sein, noch unfruchtbar,weil sie gerade stillen – und müssten beimSex mit ihm auch tatsächlich schwangerwerden. Die Wahrscheinlichkeit dafürbeträgt bei einem Akt drei Prozent. Einpromisker Mann müsste laut CordeliaFine mit mehr als 130 Frauen schlafen,um mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeitdas eine Kind zu zeugen, das ein mono-
gamer Mann nach einem Jahr wöchent-lichem Sex mit seiner Partnerin erwartenkann. „Und den Feministinnen wirdWunschdenken vorgeworfen“, schreibt Cor-delia Fine ironisch.
Und was ist mit den Umfragen, die be-sagen, dass Männer öfter fremdgehen undmehr Sexualpartnerinnen haben? Nun:Zum Sex gehören immer zwei. Es istdenkbar, dass Männer öfter betrügen, weilsie es auch in homosexuellen Beziehungentun oder öfter aus einer Beziehung herausmit einer Frau schlafen, die gerade Singleist. Ein Ding der Unmöglichkeit aber ist,dass laut manchen Umfragen die Zahlder Sexualpartnerinnen heterosexuellerMänner in ihrem bisherigen Leben vier-mal so hoch ist wie die Anzahl der Sexual-partner heterosexueller Frauen. Hier liegtsozial erwünschtes Antwortverhalten vor:Die Normen, die Bateman in der Naturzu beobachten glaubte, führen noch heutedazu, dass beim Thema Sex die Frauenunter- und die Männer übertreiben.
7.Wie viel Tier steckt imMensch?Evolutionäre Erklärungen sind beim Sexviel beliebter als zum Beispiel bei denThemen Nahrungsaufnahme oder Schlaf.Dabei gibt es Phänomene, bei denen esnicht weiterhilft, in die Tierwelt zu bli-cken: Schlafstörungen wegen nächtlichenGrübelns sind bei Tieren nicht bekannt,ebensowenig Essstörungen, die sich aufSchönheitsideale zurückführen ließen.Wieso wollen wir ausgerechnet beim Sexnicht anerkennen, dass unser Verhalten oftgenuin menschlich ist? Über Sex in derTierwelt wurde vieles herausgefunden, was
Batemans und Darwins Beobachtungenwiderspricht. Schon Darwin selbst sprachspäter geschlechtsneutral vomWettbewerbum Sexualpartner. Heute gilt als gesichert,dass es Wettbewerb zwischen Weibchengibt: Bei Primaten bekommen ranghöhereWeibchen etwa mehr Nachwuchs, dermit höherer Wahrscheinlichkeit überlebt,was unter anderem daran liegt, dassdie dominanten Weibchen die rangniedri-gen schikanieren und ihrem Nachwuchsden Zugang zur Futterstelle erschweren.Außerdem weiß man, dass die Produktionvon Sperma kein ganz kleiner Aufwandist. Die Männchen einer Spinnenartkönnen nach der ersten Paarung niewieder Sperma produzieren. (SchwarzeWitwen fressen ihren Partner nach demAkt sogar auf.) Man weiß auch, dassMännchen wählerisch sein können – selbstbei Fruchtfliegen. Sie verwehren Weib-chen manchmal den Sex; offenbar wollensie ihre Spermien für die passende Partnerinaufbbf ewahren. Je wählerischer beide Ge-schlechter, so Patricia Gowaty, umso ge-sünder der Nachwuchs.
Nur: Was bedeutet all das für denMenschen? Wohl vor allem eines: dassdie Betrachtung von Fortpflanzung in derTierwelt nur bedingt zum Verständnis derPartnerschaft zwischen Mann und Frautaugt. Denn Frauen versuchen natürlichnicht zu verhindern, dass ihre AngestelltenKinder bekommen. Und natürlich fressensie weder ihre Sexualpartner noch derenNachwuchs. Zum Glück, lässt sich alsosagen, gibt es Tierisches, was demMenschen fremd ist. Schwule Schafe,onanierende Schimpansen und untreueMeisen zeigen hingegen: Es gibt offenbarnichts Menschliches, was den Tierenfremd ist.
Bei Batemans Experiment trug jede Frucht-fliege eine sichtbare Mutation, sozusagenein Namensschild, wie gekrümmte Flügeloder fehlende Augen. Nachdem Bateman dieFruchtfliegen ein paar Tage lang zusammeneingesperrt hatte, untersuchte er den Nach-wuchs. Das Problem: Da Bateman die Fliegennicht bei der Paarung beobachtete, schätzteer die Anzahl an Sexualpartnern der Fliegenüber diejenigen Nachkommen, die zwei Muta-tionen hatten, also die Namensschilder vonMutter und Vater. Weil die Mutationen aber soheftig waren, starben viele der Nachkommenmit zwei Mutationen, bevor sie dem Larven-stadium entwachsen waren. Das führte zuverzerrten Ergebnissen: Auch Fruchtfliegen,die aufgrund der höheren Sterblichkeit beiVorliegen zweier Mutationen vermeintlichkeine Sexualpartner hatten, hatten zahlreicheNachkommen – und zwar die, die nur ihreMutation geerbt hatten. Bateman überschätztealso die Zahl an Fruchtfliegen, die keinenSexualpartner hatten, und unterschätztediejenigen mit einem oder mehreren Sexual-partnern. Die Unterschiede im reproduktivenErfolg führte er auf die unterschiedlicheAnzahl an Sexualpartnern zurück – diese waraber verzerrt. Außerdem hatten laut Batemandie männlichen Fruchtfliegen mehr Nach-kommen gezeugt als die weiblichen: einebiologische und statistische Unmöglichkeit,weil natürlich jede Fliege eine Mutter undeinen Vater hat.
Patricia Adair Gowaty, Yong-Kyu Kim und Wyatt W.Anderson (2012): No evidence of sexual selection ina repetition of Bateman’s classic study of Drosophilamelanogaster. In: PNAS 109, 11740-11745.
BATEMANS STUDIE
58 MODE
Alpha: Jacke, Top, Hose, Schuhe von Giorgio Armani. Esther: Hemd, Hose, Schuhe von Givenchy
59MODE
as Privileg, ein neues Jahrzehnteinzuläuten, hatten die Männer-schauen im Juni 2019. Da wur-
den zum ersten Mal die Kleidungsstückegezeigt, die vom Frühjahr 2020 an in denLäden und auf den Seiten der Online-händler zu sehen sein werden. Der Marktder Männermode wächst, holt also lang-sam gegenüber den Frauen auf, die nochimmer viel mehr Geld für Bekleidungausgeben. Daher wird nun zum Beispielauch die Onlineboutique Mytheresa dasGeschäft mit Anzügen angehen.
Damit ist auch schon der wichtigsteneue Trend angesprochen. Es geht wiederein bisschen klassischer zu. Streetwear hatin Form von Sweatshirts und Sneakern inden vergangenen Jahren immer mehr An-teile am Umsatz erobert. Vielleicht ist derKunde nun mal wieder reif für Anzüge,die auf einmal in Mode sind.
Es geht hier nicht unbedingt um denAnzug, wie ihn sich ein Geschäftsmannvielleicht vorstellt, sondern um einen AnnA zug,wie ihn auch Frauen tragen können – wes-halb wir für die Fotos, die diesen Textillustrieren, nicht nur Alpha Dia gebuchthaben, den Shooting-Star unter den deut-schen Männermodels, sondern auch dieaus Lübeck stammende Esther Heesch,der die neue Männermode mindestensgenauso gut steht.
Die Deutungshoheit in der Männer-mode hat Kim Jones von Dior. Seit HediSlimane das Label Dior Homme für
Männermode wird sostark von Damenmodeangeregt wie nie zuvor.Daher trägt nicht nurAlpha Dia für uns dieHerrenentwürfe fürHerbst und Winter.Auch Esther Heeschsieht in dieser Modeaus, als wäre sie eigensfür sie entworfen worden.Fotos Arturo AstorinoText Markus Ebner
Esther: Anzug und Hemd von Celine. Alpha: Mantel, Hemd und Hose von Burberry
Pullunder, Hemd, Hose, Gürtel, Schuhe vonAlexander McQueen; Hut von Giorgio Armani;Socken von Falke
Bernard Arnault und seinen LVMH-Kon-zern erfolgreich in die Welt gesetzt hat, istDior auch wegweisend bei den Männern.Slimanes minimale und extrem körper-betonte Schnittführung hatte vor fast zweiJahrzehnten Karl Lagerfeld dazu gebracht,mehr als 40 Kilogramm abzunehmen – biser in Slimanes Entwürfe passte.
Von 2011 bis 2018 hat Kim Jones beiLouis Vuitton die Streetwear salonfähiggemacht, indem er für die Luxusmarkeeine Kooperation mit dem König der Street-wear einging, James Jebbia von Supreme,und zum Bestseller machte. Frisch beiDior, hat Jones gleich mal den Namengeändert: Dior Homme heißt nun DiorMen. Interessanterweise schaut der briti-sche Designer vor allem ins Archiv vonChristian Dior, wenn er seine Kollektionengestaltet. Das bedeutet: viele Blumen-stickereien und florale Drucke sowieAnzüge aus purer Seide in weiblichenPastelltönen. Statt Krawatte, die bei HediSlimane kurz und dünn war, werden femi-nine Schals unter die Jacken drapiert.
Ein viel weicherer Look als noch vorwenigen Saisons bestimmt das Geschehen.So ist es denn auch keine Überraschung,dass bei den Dior-Men-Schauen Frauenwie Kate Moss und Naomi Campbell inder ersten Reihe sitzen – und bei der letz-ten Männerschau sogar mit Jones beimFinale über den Laufsteg gingen, gekleidetin Dior Men. Jones legt Seide am Reversein und versieht die meisten Jacken mit
TWOINONED
60 MODE
Hemd, Hose, Schuhe von Prada; Hut von Giorgio Armani; Socken von Falke
Hemd, Hose, Gürtel, Boots von Saint Laurent by Anthony Vaccarello; Hut von Giorgio Armani
Hemd, Hose, Gürtel, Boots von Saint Laurent by Anthony Vaccarello; Hut von Giorgio Armani
Blumenschmuck statt mit Einstecktuch.Das ist nicht nur ein Styling-Trick, son-dern eine subtile Botschaft an asiatischeMänner, die viel offener mit Geschlechter-rollen umgehen und zum Beispiel auchmit Nagellack und Damenhandtaschenexperimentieren.
Kein Wunder, dass Jones auch in Tokioseine Dior-Pre-Fall-Kollektion präsentierte,gleich beim richtigen Kunden. Damit ister der erste Herrenmodemacher, der dasvon Lagerfeld für Chanel erfundene Prin-zip des globalen Schauenwanderzirkuseingeführt hat, das es so in der Männer-modeszene noch nicht gab.
Trotzdem vergisst Jones nicht seineJungs. So trägt Kylian Mbappé, der Stardes Weltfußballs, regelmäßig Dior-Men-Anzüge zu großen Veranstaltungen. UndDavid Beckham war im vergangenen Jahrbei der Royal Wedding von Harry undMeghan in England in einen eng geschnit-tenen Cutaway gekleidet, den Jones seinenWünschen angepasst hatte – mit schwarzerHose statt Stresemann-Streifen sowie mitdunkelgrauer statt silbergrauer Krawatte.Und schon galt er als der am besten geklei-dete männliche Gast.
Kim Jones war der erste offizielleTransfer des Geschäftsführers Pietro Beccari,als er von Fendi zu Dior kam. Seitdemwächst die Marke so schnell, wie man dassonst nur von Gucci aus dem konkurrie-renden Kering-Konzern kennt.
Die Inspiration für die Männermodealso kommt heute von den Frauen. Mansieht es an unserem Shooting: Ob Hoseund Hemd für einen Mann wie Alpha Diaoder eine Frau wie Esther Heesch gemacht
sind, ist Jacke wie Hose. Und immer öfterwird sie nun auch von Frauen entworfen.Nicht mehr nur von Véronique Nichanian,die seit sage und schreibe 31 Jahren alsHermès-Männermode-Designerin arbeitet.Nun auch von Clare Waight Keller beiGivenchy. Sie hat eigentlich keine Erfah-rung in der Männermode, denn bei Chloé,wo sie vorher arbeitete, ging es nur umFrauen – das heißt um coole Kleider fürvielbeschäftigte Frauen. Aber sie hatteauch schon die Couture für Givenchywiedereingeführt, da sollten die Männerkeine Schwierigkeit darstellen.
Mit der Givenchy-Männermode warsie gleich im Sommer Gastdesignerin aufder Pitti-Messe in Florenz, wo sie ihre vonasiatischem Streetstyle inspirierten Track-suits zeigte. Auch gibt es bei Givenchy nunHaute Couture für Männer. Diesen Trendhat Pier Paolo Piccioli von Valentino ein-geführt, als er noch zusammen mit MariaGrazia Chiuri das Design verantwortete.In einem boomenden Markt für Maß-schneider an der Savile Row, in Neapeloder Wien ist es eigentlich logisch, dassdie großen Couture-Häuser aus Paris diehöchste Schneiderkunst den Männernzugänglich machen.
Auch in dieser Hinsicht lernen dieHerren also von den Frauen.
TWOINONE
Fotograf: Arturo AstorinoStyling: Markus EbnerStylingassistenz: Evelyn TyeModels: Alpha Dia (Modelwerk),Esther Heesch (Modelwerk)Fotografiert am 30. Juni 2019 in Paris
MUNCH EN . H AM BU RG . F R ANK F U RT . D U S S E L DOR F . L E I P Z I G . Z U R I C H
HACKETT.COM
62 STIL
Herr Suter, in Ihren Büchern formulieren Sie gerneStilregeln. Im neuen Krimi „Allmen und der Koi“ schreibenSie: „Wie es sich gehört für sommerliche Abendgarderobe,trug Allmen schwarze Seidenhosen mit Galons an denSeitennähten und ein weißes Dinner-Jacket.“Das ist natürlich aus der Sicht meines Detektivs JohannFriedrich von Allmen gesehen. Der neue Roman spieltauf Ibiza, ein formeller Anlass im Süden erfordertfür ihn ein weißes Dinner-Jacket. Ich habe selbst langeauf der Insel gelebt, leider nie in Kreisen, in denenman sich zum Abendessen umzog. Ich bedauere denVerlust der Tradition.
Hängen viele weiße Jackets in Ihrem Schrank?Nein, gar keines. Ich habe zu selten Gelegenheit, siezu tragen.
Warum halten Sie sich mit solchen Tipps zur Etikettenicht zurück?Der Allmen ist eine Figur, die halt Wert auf dasÄußere legt.
Sie nicht?Doch, ich auch. Ich habe diese Form der Eitelkeit.Ich finde, ein Mann im Anzug ist gut gekleidet.
Heute tragen Sie einen anthrazitfarbenen.Korrekt heißt es mitternachtsblau.
Maßgeschneidert?Ja, sicher. In Zürich im Geschäft bestellt, die schicken’sdann nach Portugal zumMaßschneider. Gelegentlichbringe ich mir einen Anzug aus Singapur mit, guteQualität. Nur leider sind manche Details nicht immerberücksichtigt. Schauen Sie sich meine Ärmelknöpfeam Sakko an. Eigentlich müssten die sich küssen,das heißt, sie müssten ganz dicht beieinander liegen,sodass sie sich berühren. Das tun sie nicht.Schwerer Fehler.
Sie haben einmal gesagt, dass Gewalt und Dummheitbei anderen Menschen Sie aufregen. Was ist mit schlechtsitzender Garderobe?Da bin ich tolerant. Es stört mich nicht, wenn jemandnicht gekleidet ist wie ich. Kürzlich habe ich nur einbisschen die Nase gerümpft über kurze Hosen für denMann.
Auf Twitter haben Sie gereimt: „Der Sommer ist ja keineganz üble Jahreszeit / Mich stört daran nur eine / Ich nenn’smal Kleinigkeit / Es ist diese Chose von Mann in kurzerHose.“ Was nervt Sie daran?Ich finde, kurze Hosen an Männern haben schnellwas Lächerliches. Habe ich das nicht in meinem neuenAllmen-Fall sogar geschrieben? Der findet, selbsteine militärische Bermudashorts hat etwas Monty-Python-Haftes. Man muss relativ jung sein, damitman solche Hosen tragen kann.
Schriftsteller Martin Suterüber seine Vorliebe für Anzüge,seine Abneigung gegen denCasual Friday, gleichmacherischeBärte und argentinische FrisurenInterview Ulf LippitzFotos Frank Röth
„Ich bedauereden Verlustder Tradition“
Er lebt Stil auf seine Weise: Den ersten maßgeschneiderten Anzug leistete sich Martin Suter im Alter von 19 Jahren. Auch heute trägt ermeistens eines der 20 Modelle, die in seinem Schrank hängen.
In Marrakesch haben wir noch ein Haus, da kann ichohne zusätzliche Garderobe anreisen.
Sagt Ihre Frau nie: „Jetzt reicht es, Martin!“Doch, das sagt sie. Wir haben in Zürich keinen Platzmehr. Im Schrank hängen schon um die 20 Anzüge.
Sind Sie etwa „überinvestiert“, wie es über Ihren DetektivAllmen einmal im Roman heißt?Nein, nein, das heißt ja auf vornehme Art, man sei fastpleite. Das habe ich mal vor vielen Jahren gehört, als einwohlhabender Mann über einen anderen gesagt hat: Erist leider ein wenig überinvestiert. Ein Obdachloser kanndas von sich nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeitsagen wie ein ehemaliger Banker, der bei irgendeinerSchweinerei erwischt wurde und nun Schulden hat.
Bei Ihnen fing die Liebe zum Anzug früh an. Ihren erstenhaben Sie sich mit 19 Jahren für 300 Franken in Baselschneidern lassen.Mit Hahnentrittmuster und abgestepptem Revers,stimmt. Das war eine Maßkonfektion, da hatte mangewisse Wünsche offen, zum Beispiel richtige Knopf-löcher am Ärmel. Ich weiß noch, dass ich mich für einenDreiteiler entschieden habe und es mich gestört hat,dass mein Bauch die Weste nicht ausgefüllt hat. Ichdachte, die muss ein bisschen rund sein. Das würdemich längst nicht mehr ärgern.
Was bedeutete Ihnen damals der Anzug?Früher war Kleidung sehr bestimmend. Ein Bauer konntesich nicht wie ein Graf kleiden. Die Zünfte hattenRegeln, was wer nach Stand und Beruf anzuziehen hatte.Heute kann man die Identitäten leichter wechseln. DerBankdirektor fährt amWochenende in der Lederkluft aufder Harley-Davidson herum und ist dann nicht mehr derBanker. Das ist das Thema meiner Arbeit. Der Zusam-menhang von Schein und Sein. Wer bin ich? Wer könnteich noch sein? In diesem Zusammenhang war es damalsvielleicht wichtig, als Lehrling in einer Werbeagentur eineMaßkonfektion zu bestellen und wie ein Werber auszu-sehen. Aber der wahre Grund war damals wie immer:Ich mag Anzüge.
Sie wollten sich mit der Kleidung eine Identität zusammen-schustern. Sind Sie ein Mitläufer der Mode?Quatsch. Was ich trage, ist doch das Gegenteil von Mode.Wäre ich ein Mitläufer, würde ich mich anders kleiden,wie ein Dandy, mit mehr Farben.
Welche Identität tragen Sie heute zur Schau?Die des urbanen Schriftstellers. Anzug, weißes Hemd,dazu eine gepunktete Krawatte. Das ist übrigens einVintage-Modell, vor 30 Jahren im „Brockenhaus“gefunden, einem Schweizer Trödelgeschäft. Wenn SieIhren Schrank ausräumen oder einen Nachlass verwerten,rufen Sie das „Brockenhaus“ an.
Ihr Hemd stammt bestimmt nicht vom Flohmarkt. An derBrusttasche ist Ihr Monogramm eingestickt.Wenn man das nicht von der Stange kauft, gehört dasdazu. Ist eigentlich die falsche Stelle. Das Monogrammmüsste vorne kurz über dem Bund sein. Das Erkennungs-zeichen stammt aus der Zeit der Wäschereien oderder großen Häuser, in der mehrere Herren ihre weißenHemden der Wäscherin gaben.
Hatten Sie schon immer eine Vorliebe für gestärkte Hemden?Die Hemden, die ich trage, sind nicht gestärkt. Sie habenweiche Kragen und Manschetten. Ich hasse Gestärktes.In den siebziger Jahren trug ich auch bunte Secondhand-Modelle. Für unsere große Reise durch Afrika habeich mir Safarihemden aus dem Army-Surplus-Storegeholt, dazu schöne Khakihosen von der Portobello Roadin London.
Mit Ihrer damaligen Freundin reisten Sie 1972 ein Jahrdurch Afrika und Asien.Ich weiß noch, am Ende saßen wir in Sri Lanka undhaben überlegt, wie wir günstig zurück nach Zürichkommen. Damals flog die Aeroflot von Colombo überMoskau in die Schweiz, die Fluggesellschaft hatteso ein Angebot, weiterreisenden Passagieren den Auf-enthalt in der Sowjetunion zu bezahlen. Rucksack-touristen wie wir haben dann nach der schlechtesten
Ist schon bequem an heißen Tagen.Die Hitze schlägt doch nicht auf die Beine! ImWintertragen wir lange und oftmals dünne Hosen. DieTemperatur der Beine hat keine großen Auswirkungenauf den Rest des Körpers.
Was ist mit dem Gefühl der Beinfreiheit?Dann würde ich lieber ein Röckchen tragen. Es gibt inZürich einen Arzt, der regelmäßig in der Kronenhallespeist, und er trägt einen fast bodenlangen Rock. Geht.
Diesen Sommer war es auch in der Schweiz irre heiß.Haben Sie trotzdem Anzüge getragen?So ab 30 Grad erlaube ich mir Ausrutscher. LeichteBaumwollhosen und ein Hemd. Keine Jeans, die findeich nicht altersgemäß. Ich habe mich sogar mit T-Shirtauf die Straße gewagt, ohne Jackett. Als wir früherauf Ibiza gelebt haben, kam es selbst vor, dass ichBermudas angezogen habe. Schreiben Sie das bloß nicht!
Ihr Detektiv Allmen tritt seine Reise auf die Insel mitsagenhaften acht Anzügen im Gepäck an...... ja gut, er dachte, er bleibt weniger lang. Es war einbisschen knapp.
Wie viele nehmen Sie normalerweise auf eine Reise mit?Wenn ich nur übernachte, kommt es vor, dass ich keinenAnzug mitnehme, sondern den gleichen wie auf derReise trage. Sonst packe ich vier für den Urlaub ein.
63STIL
Persönlicher Ausdruck: Martin Suter legt Wert auf das Äußere.
Aufgewachsen ist Martin Suter in Zürich und Freiburg(Schweiz). Von 1968 an arbeitete er als Werbetexter, späterwandte er sich dem Schreiben zu – zunächst als Journalist,dann auch als Schriftsteller. Sein erstes Buch „Small World“erschien 1997 und wurde ein Bestseller. Bislang hat derEinundsiebzigjährige zehn Romane geschrieben und sechsKrimis um den verarmten Kunstdetektiv Johann Friedrich vonAllmen. Dessen neuer Fall, „Allmen und der Koi“, ist geradeerschienen. Suter ist zum zweiten Mal verheiratet und hat eineAdoptivtochter, die Familie lebt in Zürich. Wenn er keine Lustauf das Schreiben langer Texte hat, macht er mit dem Chan-sonnier Stephan Eicher Musik und schreibt kleine Verse.
Verbindung gesucht, um noch möglichst lange in Moskauzu bleiben und in einem guten Hotel zu übernachten. Wirverbrachten schließlich drei Tage in Moskau. Wir hattenzwei Sätze KllK eider, eine Jeans und eine Jeansjacke. Aufdem Roten Platz wurden wir von jungen Leuten angehal-ten, die uns fragten, ob wir ihnen unsere KllK amottenverkaufen würden. Wir konnten sie leider nicht abgeben,weil wir nichts mehr hatten.
Kleidung kann eben auch ein Zeichen des Protests sein.Natürlich ist Stil immer ein persönlicher Ausdruck. DieWeigerung, im Konfirmandenanzug herumzugehen, warein Protest. Heute gilt es vielen Männern als unglaublichspießig, eine Krawatte zu tragen. Ich hingegen findees eine unglaublich spießige Form des Protests, keinenSchlips zu tragen und den Casual Friday im Büro zufeiern: „Heute müssen wir nicht elegant gekleidet sein,heute kommen wir locker.“ Das ist doch nur eineÄußerlichkeit. Man ist nicht weniger spießig, wennman keine Krawatte trägt.
Noch nie abgewiesen worden, weil Sie keine trugen oder gardas falsche Outfit?Einmal wurde ich in Basel nicht in einen Club ein-gelassen. Wegen meiner Kleidung. Da hatte ich einenDesigneranzug aus Leinen an – von Armani! Der warganz zerknittert, wie das für Leinen normal ist. Unddamit durfte ich nicht rein. Können Sie sich das vorstellen?
Tom Wolfe trat immer im weißen Anzug auf. SamuelBeckett trug gern eine Frauen-Handtasche von Gucci überseiner Schulter. Haben Sie eine Martin-Suter-Marotte?Wenn man so alt ist wie ich und sich nicht sehr veränderthat, hat man sicher seinen Look gefunden. Vielleicht sindes meine Haare: streng nach hinten gelegt.
Finden Sie gegelte Haare geschmackvoll?Ich mag längere Haare, mir haben sie immer gefallen,weil sie einem so was Argentinisches geben. Der andereGrund ist banal: Ich habe unglaublich lockiges Haar.Wenn ich da nicht Brillantine, nicht Gel reinmache,sehe ich aus wie ein Komparse im „Hair“-Musical.
Sie könnten die Frisur unter einem Hut verstecken!Ich wäre gern ein Hutträger, ich warte auf das Comebackdes Herrenhuts. Allerdings befürchte ich, ich werde esnicht mehr erleben.
Warum beginnen Sie nicht einfach und setzen den Trend?Wissen Sie, ich habe keine Vorliebe für die Originalität.Trotzdem halte ich Hüte für schöne Objekte, eineneleganten Borsalino oder einen Panama, den manzusammenrollen kann. Hüte sind leider immer auffällig.Ich sehe manchmal diese Reisenden im Flugzeug, die miteinem Sombrero aus Mexiko zurückkommen und dieGepäckablage verstopfen. Tragen kann den dochniemand zu Hause, höchstens wenn er ein bisschenangetrunken beim Grillieren ist.
Eine andere Sache, die Sie bei Männern stört, ist der Hangzum Bart. Wieso?Weil Bärte so gleichmacherisch sind. Sie sehen das auch,wenn Sie alte Fotos anschauen aus der Wende zum20. Jahrhundert. Diese Herren können Sie kaum mehrunterscheiden. Man muss schon zweimal schauen.Ich habe jedoch Verständnis für diese Neugier heraus-zufinden, wie man mit Bart aussieht, ich habe einWeilchen einen Schnauzer gehabt.
Ein bisschen wie Freddie Mercury in den Siebzigern?Mehr gezwirbelt. Das war auf der Afrikareise und damalsin Mode. Ich habe ihn mir während des Militärdiensteswachsen lassen. Da standen wir einmal an einemBauernhof, ich rasierte mich am Brunnen, und ein Soldathat gefragt: Spinnst du, warum machst du das? Einanderer, etwas erfahrener Soldat, sagte zu ihm: Siehst dudenn nicht, dass er will, dass man sieht, dass er sich einenSchnurrbart stehen lässt?
Um was beneiden Sie junge Männer, wenn Sie diese auf derStraße sehen?Um den Zustand der Jugend an sich. Wenn man sichdarin befindet, genießt man es gar nicht richtig. Es gibtdieses Zitat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat: Es seischlimm, dass die Jugend an Minderjährige verschwendetwerde. Dieses Gefühl kenne ich. Ich schaue mir alte Fotosan und denke: Wenn ich gewusst hätte, wie ich damalsausgesehen habe, hätte ich sicher mehr davon profitiert.
Hat sich das Benehmen der Jugendlichen in den vergangenenJahrzehnten verändert?Ach, ich weiß nicht. Ich finde gewisse junge Männerunerträglich, aber das dachte ich vor 50 Jahren auch.Vielleicht gab es früher andere Umgangsformen, weil wiralle aus strengeren Verhältnissen kamen, von Schule undElternhaus mehr indoktriniert, oder man sagte: erzogenwurden. Das Unfllf ätige war weniger verbreitet. Ich binimmer gerührt, wenn ich höfllf iche junge Menschen treffe.
MODE64
nderswo hätten sie Alice vielleichteinen Superstar genannt. Super-models waren noch nicht er-funden, als die Graz-Berliner
Mode-Melange namens Lisa D. mit Kühn-heit, Party- und Provokationslust, mitwachem Blick über die Szene hinaus mitder Mode zu spielen begann wie mit un-seren Frauen- und Männerbildern. Undunseren Frauen- und Männerblicken.
Blonde Lockenmähne, ebenmäßigesGesicht, Schwanenhals, 94–57–89 bei1,73 Meter Körpergröße: „So viel Schön-heit und Verletzlichkeit in einer Person“hatten Lisa D. sofort ins Schwärmen ge-bracht. Also buchte sie Alice von Mitte derachtziger Jahre an für viele ihrer spektaku-lären Shows: in einer Grazer Strip-Bar, ineiner Geisterbahn in Berlin, bei der Zwan-zig-Jahr-Feier des deutschen „Playboy“ inMünchen. Wobei: buchen? Alice ließsich nicht buchen, wie man Models heutebucht, über eine Agentur. Der Schrift-steller Walter Grond hatte sie 1984 ineinem Grazer Café angesprochen, so gehtdie Geschichte, im festen Wissen, die Stu-dentin sei ganz nach dem Geschmack sei-ner Freundin Lisa, einer Modeschöpferin.
Die Geschichte lässt sich nachlesen indem Buch „Klääsch – Zusammenstößemit Kunst, Mode und anderen Diszipli-nen 1984 – 1994“, das im Maro-Verlag er-schienen ist und kaum Text zu bietenscheint. Erst wer die Doppelseiten mit denvielen Fotos aus zehn Jahren performativerUmtriebigkeit aufschlitzt, bekommt AlicesErinnerungen zu lesen – an Tage undNächte mit Lisa und ihrer Entourage, antollkühne Pläne, an die Momente derPanik vor den Schauen, die sich aus Thea-ter, Literatur, Musik und Kunst ebenso zunähren scheinen wie aus der Mode selbst.
Und erst wer das Buch am Ende auf-schlägt, erfährt, dass es sich bei dieserAlice, der man fast 300 Seiten lang gefolgtist, um eine Kunstfigur handelt, um einenKunstgriff, damit sich Lisa D. nicht selbsterklären muss. Damit die um Kunstgriffenicht verlegene Modeschöpferin das an sieherangetragene Ansinnen, ein Erinnerungs-buch zu schreiben, weder ablehnen nocherfüllen musste.
Vielleicht liegt dieses Spiel aus Erfül-len und Verwehren vielen Einfällen derKünstlerin zugrunde: in feiner Form,wenn sie, ehemals Mitglied der roten Frau-enbrigade, zum Entsetzen selbst ihrerengsten Mitstreiter im September 1992 imMünchner Botanikum herausfinden will,ob Männer Spaß verstehen, beim Jubiläums-Verspielt: Lisa D. (Mitte) und Fiona Bennett in Rot beim Heimspiel nach dem „Playboy“-Event
Tarnfleck in der Geisterbahn: Entwurf für die Berliner Schau im Juni 1990
fest der deutschen Ausgabe des Männer-magazins „Playboy“. Statt auf Bunnyssetzt sie mit der Hut- und ModedesignerinFiona Bennett in ihrem Garten Eden auf20 „ausgebuffte Individualistinnen“ ineigens dafür entworfenen Kleidern, vomweißen Hosenanzug mit elegantem Aus-schnitt über Tutu-Varianten bis zur schul-terfreien Bondage-Draperie. In der Mitte:ein Model in einer Sanduhr, langsam frei-gegeben durch die verrinnende Zeit selbst.Die Aufgabe der übrigen Grazien: diemännlichen Festgäste anzuziehen, um sichihnen dann geschickt zu entziehen. Aberwie: Richtiggehend verschwinden solltensie – und die überraschten Mannsbildermit sich allein lassen.
„Denn mal ehrlich“, so Lisas These,„was wollen denn Männer bei so einem Er-eignis anderes, als sich gegenseitig zu be-eindrucken?“ Die Sache geht aufs Schönsteschief – und liest sich mehr als ein Viertel-jahrhundert später, in einer Zeit, in derimmer noch Bunnys für die Zeitschriftüber Events stöckeln müssen, als Coup,gerade, weil sie gescheitert ist. Allein derWerbechef von Benetton, so heißt es imBuch, war begeistert: „What a blast-a! Youare a natural born-a playboy-kiiilller!“ Esist ein Glück, dass die Entwürfe für denAbend nicht nur in München den ratlosenPartygästen vorgeführt wurden, sondernein paar Wochen später noch einmal inBerlin bei der Show „Gans in Weiß“, übereinem halben Meter Daunen, vor wenigerselbstbezüglichen Leuten.
Nicht nur das Risiko, auch der Ausrut-scher, der Fehltritt hat es Lisa D. angetan:Immer wieder bittet sie bei Probe-WalksModels, sich zu merken, wenn sie wankenoder stolpern. Eine der großen Anfangs-szenen des Buchs gehört einer Party An-fang 1985 in einem ehemaligen Landgast-hof am Rande von Graz, deren Gäste inunmöglicher Garderobe erscheinen odersich unmöglich benehmen sollten: „Hierwaren praktisch alle Modesünden versam-melt, die die Welt und die Hüter des gutenGeschmacks in den nächsten Jahren rei-cher machen sollten.“
In einer Show im Herbst 1996, von derim Buch nicht mehr die Rede ist, hat LisaD. ihre Models gleich über Eis laufenlassen. Ihr scharfer Blick blieb bei den Be-dingungen der Vorführung von Modenicht stehen: Strampelanzüge von H&Mschneiderte sie Jahre später zu Abendklei-dern um, ein bissiger Kommentar zu denEntstehungsbedingungen von Mode. DassLisa D. seit 2011 in Berlin das Verände- FO
TOS
JOA
CH
IMG
ER
N,A
NN
ET
TE
HA
US
CH
ILD
/OS
TK
RE
UZ
,FR
AN
ÇO
ISC
AD
IÈR
E,I
RE
NE
NIG
G
Was diese Mode aus den Frauen macht? FalscheFrage! Lisa D. will mit ihrer Graz-Berliner Melangedie Augen öffnen für andere Frauenbilder undfür seltsame Ansichten von Männern.Von Fridtjof Küchemann
Max VerstappenAston Martin Red Bull Racing driver
MODE66
rungsatelier „Bis es mir vom Leibe fällt“betreibt, in dem nicht etwa Wegwerf-stücke umgenäht werden, sondern Lieb-lingsstücke, von denen wir uns nicht tren-nen können, ist da nur konsequent.
Ein feiner Streich mit dem Handschuhwar die paradiesische Provokation desMünchner Fests im Herbst 1992 für denmännlichen Voyeurismus, deutlicher zuspüren war der Schlag bei Kleidern wie derCorsage aus der Show „Servus Kaiser“, beider ausgestopfte grüne Hände aus denBrüsten zu wachsen scheinen. Überhaupt,die Kleider: In „Wo tanzt die Gans“, derSchau im Grazer Strip-Lokal „Triumph-Bar“, ist im Oktober 1988 ein dunkelgrüneskurzes Samtkleid zu sehen, von dessenSaum aus spiralförmig ein Reißverschlussaufwärts läuft, um in einem großen Kegelüber der rechten Brust zu enden. Im Som-mer 1990 wird das Publikum in Berlin indie Wagen einer Geisterbahn gesetzt undan einer Reihe vonTableaux vivants vorbei-gefahren, in denen ein zum Rock mutier-ter Fellmantel zu sehen ist, aus dessenÄrmel auf Hüfthöhe ein weiteres paarHände wächst. Ein Model trägt einen sil-bergrauen Body mit Kordel-Applikationenzur Faustfeuerwaffe, eines zum knallrotenUnterteil und Straußenfedern nichts alstierisches Tarnfleck auf der Haut. MitGold und Glitzer, mit Engelsflügeln, Pelzund Plüsch holt Lisa D. ein Strahlen insHalbdunkel der Geisterbahn, das voneinem Model jäh gebrochen wird, das sichlasziv auf einer Kloschüssel räkelt. Mankönnte die Fotos dieser Show mit Ausfüh-
rungen über camp und queer garnieren.„Klääsch“ erzählt stattdessen von ManniMattschke, dem Besitzer der Geisterbahn,der sich um sein Geld sorgt und sich nurmühsam beruhigen lässt.
Was diese Mode aus den Frauen macht?Nichts! Weil es umgekehrt Frauen sind,die etwas aus dieser Mode machen, wennsie die nicht straßentauglichen Entwürfefür die Schauen mit Leben füllen, undsogar alle, die Kleider der Modeschöpferintragen: Selbstbewusstsein gehört dazu,Humor, ein Gefühl für die ganz eigeneSchönheit, die niemand sonst ausstellen,angaffen oder bewerten darf. Eine Artweiblicher Komplizenschaft ist dieserMode eigen, ein Schmäh, der Grenzenzeigt, indem er mit ihnen spielt.
Was diese Mode aus den Männernmacht, zeigt die letzte Schau, von der„Klääsch“ erzählt: In „Siegfrieds Lust –Tarnung und Täuschung“ lässt Lisa D. imNovember 1994 Männer ihre Entwürfe inder Berliner Bar jeder Vernunft vorführen.Otto Sander, Wolfgang Flatz, Rolf Zacherund Wotan Wilke Möhring sind unterden Models. „Ich finde“, lässt Lisa D. ihreErzählerin Alice schreiben, „all diese zer-knautschten Helden und abenteuerlichenSpinner, diese durchschaubaren Angeberund liebenswerten Gossenprinzen, kurz-um, all diese flauschig-beknackten männ-lichen Geschöpfe, die sonst nur in derLiteratur oder im Kopf mancher Frauenexistieren, sie alle sind in dieser Show tat-sächlich für einen magischen Momentlang Wirklichkeit geworden.“
FRAU LISAS GESPÜR FÜR SCHMÄH
Oben: Rolf Zacher (Mitte), Ralph Meiling (rechts) auf dem Laufsteg; unten: Lisa D. in Lisa D.
MOOD/MUT68MOOD
087
Bedeutende Dinge,Menschen, Ideen,Orte und weitereKuriositäten,
zusammengestellt vonJennifer Wiebking
MUT
In asiatischen Megastädten kam man zuerst auf die Idee mit Läufen, die einer Pokémon Go Challenge gleichen – nur schwitzt man mehr. Jetztkönnten District Races auch bei uns eine Chance haben. FO
TOS
DA
VID
BÖ
LL,V
ICK
YLE
HM
AN
N,H
ER
ST
ELL
ER
(8)
Der Name des gerade in Berlin eröffneten Student Hotel klingt konkret, ist aber weit gefasst.Man muss weder an der Uni eingeschrieben sein, um hier zu nächtigen, noch ein Zimmer mitBett buchen. Für Co-Living wie Co-Working ist genug Platz.
Je größer die Auswahl, desto trefflicher kanndie Mittagspause gestaltet werden. Mit der AppLunch Now geht es organisiert in die freieDreiviertelstunde.
Gegen Ende des Sommers stand einer derHampley-Gründer, Marvin Herbert, nach derMittagspause vor unserer Redaktion undquatschte eine Kollegin an. Hampley fertigeRucksäcke aus Hanf! Statt aus Polyester!In Frankfurt! Geben wir gerne weiter.
Auch Menschen,die in Wellness-trends eineErsatzreligionerkennen,könnten dieentsprechendeHalskettegebrauchen– natürlich mitRosenquarz.(Nallik)
Nichtausgeschlossssen,dass Fragennn wiediese auf deeenGesprächskkkarten(Elma van VVVliet:„Herzensfragen“,Droemer KKKnaur)auch Zündstofffür einen heftigenStreit seinkönnen. Abbberselbst das kkkannman dann jjjaAufarbeitungnennen.
WIE ZWEIMAL AM TAG DREI MINUTENZÄHNEPUTZEN
So lange beschäftigen sich die Deutschen auchetwa im Durchschnitt mit der Pflege des Gesichts.Nach einer Umfrage des Kosmetikverbands VKEbraucht die Mehrheit, nämlich 35 Prozent, fünfbis zehn Minuten. Schminken und Rasur inklusive.
Es ist Oktober! Erkältungszeit! Ein Fall für Lagubos-Pastillen mit alpinem Latschenkiefer.
Wenn Bruder und Schwester ein Zimmer teilen,ist meist klar, wem welche Seite gehört. DieBettwäsche verrät es. Katha Covers setzt demKlischee genderneutrale Bezüge entgegen.
Jetzt, da Grünkohl als Trendfood genugAufruhr im Gemüsebeet hervorgerufen hat,könnte auch mal der Brokkoli dran sein.(„Herbivore“)
Diese vergoldete Farfalle (Trine Tuxen)hält, was sie verspricht: Der Knoten fälltnicht auseinander.
MACHT MEHRAUS DEM MOMENT.
Entdecken Sie die Platinum Card aus Metall und profitieren Sie vonVorteilen wie Zugang zu über 1.200 Airport Lounges sowie von einemFahrtguthaben für den Chauffeur- und Limousinenser
70 AMERIKA
ann ist eine Kuh fertig? Es gibt immer noch einBüschel Haare am Schweif, die nicht formvoll-endet fallen. Eine Ader am Euter, die man stärkerherausarbeiten könnte. Sarah Pratt beugt sichleicht vor. Ihr Atem formt ein Wölkchen vor dem
linken Ohr der Kuh, als würde die Schöpferin ihremGeschöpf etwas zuflüstern. Die enge Galerie ist auf fünfGrad heruntergekühlt. Sonst würde das lebensgroße Jersey-Rind zerfließen, das Pratt in den vergangenen Tagen aus300 Kilo Butter erschaffen hat, die sie Klecks für Klecksum ein Skelett aus Holz und Draht schmierte. Ihr Blickbleibt zwischen den Nasenlöchern der blassgelben Kuhhängen. Den kleinen Holzspachtel packt sie weg. Mit demZeigefinger streicht sie über das Flotzmaul, mit dem Nagelzieht sie eine Furche nach.
Auf der anderen Seite des Schaufensters sind solcheFeinheiten kaum zu erkennen. Seit dem frühen Morgenschiebt sich hier ein Strom von Jahrmarktbesuchern mitschussbereiten Fotohandys vorbei. Die einen ärgern sich,dass da eine Frau im Kapuzenpulli neben der „ButterCow“ steht, der Ikone der Iowa State Fair seit 1911. Dieanderen freuen sich, die Künstlerin mit aufs Bild zu be-kommen. Die wenigsten machen sich bewusst, wie es aufPratts Seite der Scheibe riecht.
Nach 15 Jahren Ausbildung hat sie 2006 die Aufgabeübernommen, jedes Jahr die Kuh und etliche andere Figurenzu modellieren. Seit 13 Jahren benutzt sie dafür dieselbeButter. Je ranziger der Rohstoff, desto weniger Wasser ent-hält er, desto formbarer ist er. „Riecht wie Blauschimmel-käse, oder?“ Sarah Pratt hat ein sonniges Gemüt.
Eigentlich ist das Butter-Recycling Verrat an der Idee.Vor 100 Jahren war die Verschwendung Programm. Mitseiner Butterkuh demonstrierte Iowa den Städtern an derOstküste, dass es Essen im Überfluss besaß. „Es war einMarketing-Gag, um mehr Menschen in den MittlerenWesten zu locken“, erklärt Pratt. Heute leiden AmerikasMilchbauern unter Überkapazitäten und Preisverfall.Gerade deshalb, sagt Pratt, sei die Butterkuh so beliebt.„Wir würdigen die harte Arbeit unserer Farmer.“ Die Kuhhabe Kultstatus. „Alle wollen sie sehen.“
Übertrieben ist das kaum. Nicht nur Familien stehenSchlange. Auch tätowierte Muskelprotze wollen ein Selfie
Rummelplatz, Viehschau,Talentwettbewerb und politischeBühne: Auf der Iowa State Fair
feiert sich seit 1854das ländliche Amerika.
Von Andreas Ross
Amerikas berühmtester Jahrmarkt: Die Iowa State Fair will die Zuneigung unter den Menschen fördern. Dieses Jahr kamen fast 1,2 Millionen Besucher.
mit der Butterkuh. Schon anno 1881 schwärmte ein Zeit-genosse über die „Verbrüderung“, die sich so nur auf derIowa State Fair zutrage: „Niemand mischt sich unter20.000 Männer, Frauen und Kinder auf dem Jahrmarkt,ohne dass seine Zuneigung zu den Mitmenschen wüchse.“
Inzwischen besuchen mehr als eine Million Leute dieanderthalbwöchige Kreuzung aus Viehschau, Rummelund Talentwettbewerb in dem 3,1-Millionen-Einwohner-Staat – und die Veranstalter haben dem überliefertenVerbrüderungszitat in ihrer Broschüre eine Mahnunghinzugefügt: „Das ist fraglos noch wichtiger geworden inunserer schnelllebigen Zeit, in der die Einzelnen immerisolierter von ihren Nächsten leben.“
Dass die Butterkuh tatsächlich Personen mit ver-schiedensten Prioritäten in ihren Bann zieht, kann manvielen Besuchern von der Brust lesen. „Farm Strong“, stehtauf etlichen T-Shirts – bauernstark. Alle sieben Mitgliedereiner Familie tragen hellblaue T-Shirts mit dem Appell:„Wir sollten uns öfter herzen!“ Das Muskelshirt einesMannes versichert ungefragt: „Niemals werde ich michfür Amerika entschuldigen.“ Und ein anderer Butterkuh-bewunderer gibt sich spaßeshalber als Folterlehrer aus:„Waterboarding Instructor“. Ein Grundschüler verbreitetauf seinem Rücken die Durchhalteparole: „Schwäche isteine Entscheidung“.
Immer mal wieder gibt sich jemand mit der Kappen-aufschrift „Make America Great Again“ als AnhängerDonald Trumps zu erkennen. Eine Frau hält auf ihremXXL-Shirt mit „Make America Read Again“ dagegen.Jedes Mal, wenn ihr ein Fan des Präsidenten den Daumenentgegenreckt, fühlt sie sich belustigt und bestätigt: Sollendie Amerikaner eben wieder lesen lernen! Ein Mann trägteinen Slogan von Iowas Senatorin Joni Ernst auf seinemLeib spazieren: „Make ’em squeal“. Die Republikanerinerzählt nämlich gern, wie sie in ihrer Jugend Schweinekastriert habe, und sie versprach ihren Wählern, nun diePolitiker in Washington „zum Quietschen zu bringen“.
Die erste Iowa State Fair fand 1854 statt. „Ihre Ent-wicklung von einer einfachen Viehschau in ein extra-vagantes Landwirtschafts- und Entertainmentfest“, sodie Veranstalter in ortsüblicher Breitbeinigkeit, „spiegeltIowas Entwicklung von unkultivierter Prärie zum Zentrum FO
TOS
AN
DR
EA
SR
OS
S(4
),IO
WA
STA
TEFA
IR,A
FP,A
P,R
EU
TER
S
HEARTLAND
W
71AMERIKA
der Nahrungsmittelproduktion unserer Nation.“ Bis heutewerden die schönsten, schnellsten oder stärksten Nutztiereauf der State Fair ebenso prämiert wie die höchsten Mais-stauden, dicksten Kürbisse und köstlichsten Blaubeertorten.Ein Preis für das „gesündeste Baby“ wird seit 1952 nichtmehr ausgelobt, aber dafür konkurrieren krabbelndeSäuglinge an einem Morgen um die Auszeichnung derdekorativsten Windel. Wer sich „farm strong“ fühlt, kannes beim Armdrücken oder Hotdog-Wettessen beweisen.Mehr Kreativität verlangt der traditionelle Grunzwett-bewerb zum „Schweinerufen“, inzwischen um die popu-läre Disziplin des „Ehemännerrufens“ ergänzt. HundertePreisrichter mit Klemmbrettern versehen ihre Aufgabemit gravitätischem Ernst.
Das Washington, in das die Senatorin Ernst mit ihremKastrationsbesteck zog, liegt tausendMeilen von den Arenenund Achterbahnen, Bühnen und Buden des Festgeländesin Iowas Hauptstadt Des Moines entfernt. Aber die politi-sche Prominenz lässt sich hier so zuverlässig blicken wienirgends sonst in den Weiten der Nation. Allein in diesemAugust sind zwei Dutzend Politiker zur Iowa State Fairgereist, um sich als besten aller erdenklichen NachfolgerTrumps anzupreisen. Denn erstens sprechen die rundzwei Millionen Wahlberechtigten des Staates seit fasteinem halben Jahrhundert das gewichtige erste Wort,wenn die beiden Parteien in Vorwahlen ihre Präsident-schaftskandidaten küren. Hier war 2008 einem dunkel-häutigen Juniorsenator aus dem benachbarten Illinois mitdem sperrigen Namen Barack Hussein Obama ein Über-raschungserfolg gelungen, von dem sich die Partei-FavoritinHillary Clinton nie mehr erholen sollte.
Zweitens zählt Iowa zu den sogenannten Schlachtfeld-staaten: Theoretisch haben beide Parteien eine Chance aufden Sieg. Obama bezwang hier zweimal die republikanischeKonkurrenz. 2016 aber verbuchte Trump fast zehn Prozent-punkte mehr als Clinton. Mehr als 100.000 Wähler vomLande, die zweimal auf Obama gesetzt hatten, suchten ihrHeil bei dem New Yorker Milliardär. Dessen Handelskriegkommt viele Farmer teuer zu stehen. Trotzdem halten dieallermeisten Landwirte Trump die Treue.
Auch deshalb herrscht in den linksliberalen Hoch-burgen an der Ost- und der Westküste des Landes Unmut
Erlösung und Ermutigung: Therapierte Suchtpatienten ziehen bei der Parade über die Grand Street in Iowas Hauptstadt Des Moines.
Butterliebe: Sarah Pratt formt die traditionelle „Butter Cow“.
darüber, dass die Bevölkerung von Iowa, die zu mehr als90 Prozent weiß ist, alle vier Jahre eine wichtige Weicheder amerikanischen Politik stellen darf. Ziemlich erfolglosversuchen führende Demokraten des Bundesstaats, diesenDiskurs einzudämmen. „Nichts schadet uns mehr“, sagtein erfahrener Politiker, „als Trumps Wähler pauschal zuRassisten zu stempeln.“ Beileibe nicht nur Hardcore-Fansdes Präsidenten klagen in Iowa, dass „an den Küsten“ ihreLebensart nicht verstanden, ja verächtlich gemacht werde.
Ihren Rang als Amerikas berühmteste State Fair, alseinziger Jahrmarkt im populären Reiseführer „TausendOrte, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt“,verdankt die Iowa State Fair auch einem Roman von1932. Der Schriftsteller Phil Stong erzählte in „State Fair“von einer Schweinezüchterfamilie, die eine Woche aufdem Jahrmarkt zeltet. Vater Abel Frake bringt es dort zugroßem Ruhm, weil sein „Blue Boy“ zum prächtigstenEber des Staates, gefühlt sogar der ganzen Welt gekürtwird. Mutter Melissa sticht die Konkurrenz mit ihrenraffinierten Gurken aus. Vor lauter Eifer und Eitelkeitübersehen die Eltern, wie ihre beiden jugendlichen Kinderauf amouröse Abwege geraten. Tochter Margy verliert ihreJungfräulichkeit mit einem Reporter, Sohn Wayne mitder ungezügelten Tochter eines Pferderennenveranstalters,die dessen Insiderwissen bei den Buchmachern versilbert.Die Pointe des Romans: Beide Romanzen enden damit,dass die jungen Frakes am Ende des Jahrmarkts ihren
Geliebten Adieu sagen und sich wie geläutert auf dasihnen vorbestimmte ehrliche bäuerliche Leben vorbereiten.
Schließlich war der Autor in Iowa aufgewachsen undwusste, was sich gehört. Seine Nichte Norma sollte knappdrei Jahrzehnte nach Erscheinen des Bestsellers zur Butter-kuhbildnerin der State Fair avancieren und es 40 Jahrelang bleiben – sie war es, die Anfang der neunziger Jahrebegann, ein Mädchen namens Sarah anzulernen und aufihre Nachfolge vorzubereiten. Phil Stongs Entwicklungs-roman wurde viermal verfilmt, zweimal als Musical.Doch keiner der Produzenten in Hollywood oder NewYork, und das ist die eigentliche Pointe, wollte sich mitdem ehrbaren Ende nach Iowa-Art abfinden. Immer neueHappy Ends wurden erfunden, in denen die Liebe dieKluft zwischen Land- und Lotterleben überbrückt.
Mit ihrer agrofeministischen „FarmHer“-Kappe inPink sieht die 29 Jahre alte Carly Cummings wahrlichnicht aus, als wäre sie einemMusikfilm von 1945 entstiegen.Auf den Preis, der ihrer Familie dieses Jahr auf der StateFair überreicht wurde, ist sie aber mindestens so stolz wiedie Familie Frake auf ihren Eber „Blue Boy“. Die Cummingshaben die Preisrichter nicht mit einem prächtigen Masttierüberzeugt, sondern mit ihrer Lebensart. Der „The WayWe Live Award“ geht seit zehn Jahren an Familien, „dieihre Hingabe für die Landwirtschaft und für Iowas starkeFarm-Werte bewiesen haben“.
Carly Cummings’ Großvater, ein Luftwaffensoldat,hatte seine Familie nach seiner Rückkehr aus Korea 1955nach Iowa verpfllf anzt und sich in Pleasantville eine Existenzals Schweinezüchter und Milchbauer aufgebaut. SeineSöhne, Carlys Vater und Onkel, haben sich auf Getreideund Rinderzucht verlegt. Carlys Bruder ist auch dabei, sieselbst betreibt mit ihrem Mann eine weitere kleine Farmund eine Tierarztpraxis. Sie war es, die ihre Familie fürdie Auszeichnung vorschlug, „nur als kleine Geste derWertschätzung für die harte Arbeit meines Vaters, Onkelsund Bruders“. Die Agrarwirtin mit Master-Abschlussbeklagt, „dass heute 98 Prozent der Bevölkerung fastkeine Verbindung mehr zu den zwei Prozent haben, diefür ihr Essen sorgen“. In der Bewerbung erzählte sie, dassihr Vater seit kurzem ein Smartphone habe und Fotosvon der Feldarbeit auf Facebook poste. „Unser Pastor hat
72 AMERIKA
Wichtiger Politik-Schauplatz: Bernie Sanders auf der State Fair
schon darüber gepredigt, wie hilfreich es ist, auf dieseWeise mehr über die Landwirtschaft zu lernen.“ Außer-dem heißen die Cummings oft Schulklassen auf ihremHof willkommen. Denn selbst im ländlichen Iowa seienheute mehr Leute in der Versicherungsbranche als aufBauernhöfen beschäftigt.
In der Woche, in der Familie Cummings auf der StateFair gewürdigt wird und ein Preisgeld von 250 Dollarentgegennimmt, hat der Washingtoner Polit-NewsletterAxios unter dem Titel „Todesspirale im ländlichen Amerika“eine Liste von „Pathologien“ verbreitet, die Trumps Erfolgauf dem Lande mit erklären sollen. Die Rede war vonBildungs- und Ärztewüsten, von Brain-Drain und Fett-leibigkeit, Selbstmorden und Opioid-Abhängigkeiten sowieeiner überproportional großen Wahrscheinlichkeit instrukturschwachen Gegenden, dass Künstliche Intelligenzden eigenen Job überf lüssig machen werde. CarlyCummings rümpft die Nase, als sie die Liste überfliegt.
Sie bestätigt zwar, dass die Selbstmordrate unter Farmernsogar höher liege als unter Kriegsveteranen, und dass teureInvestitionen und niedrige Marktpreise vielen Landwirtendie Luft abschnürten. Dennoch schüttelt sie energisch denKopf darüber, wie in Washington das Leben von ihr undihresgleichen dargestellt werde. „Es gibt nichts Besseres,als auf einer Farm aufzuwachsen“, versichert sie. „Manlernt, hart zu arbeiten – mich schreckt keine Aufgabe, diemir das Leben stellen könnte. Und man vergisst niemals,wie wichtig Familienbande sind.“ Carly Cummings hältkurz inne. „Wenn ein Blitz in dein Kalb einschlägt, hastdu ein Lebewesen verloren, aber auch einen Vermögens-wert. Damit musst du umgehen können. Deshalb umgebenwir uns mit Familie.“
Wer sich vor Augen führen will, was das Leben inIowa ausmacht, bekommt einmal im Jahr eine bequemeGelegenheit: einfach am Abend vor der Eröffnung derState Fair einen Campingstuhl an der Grand Street in DesMoines aufklappen und das ländliche Amerika winkendvorbeidefilieren lassen. Gekrönte Pork Queens und uni-formierte Kriegsveteranen; Rodeo-Reiterinnen und High-School-Musiker; Turbanträger, die hinter einem Banner„Amerikanische Sikhs und stolz darauf“ herlaufen, damitdie Leute endlich kapieren, dass sie keine Muslime sind;eine beleibte Frau im gelben Butterkuhkostüm mit ange-klebtem Gummieuter vor dem Unterleib; Monstertrucks,Betonmischer und Sattelschlepper mit patriotischenBemalungen; Iowas „Mutter des Jahres“ in einem Oldtimer-
Cabrio und eine Pappfigur des Papstes auf der Ladeflächedes Pick-ups eines katholischen Radiosenders; grünehistorische Traktoren von John Deere und rote historischeTraktoren von McCormick; therapierte Suchtpatientenim Kleinbus einer evangelikalen Kirchengemeinde undein Cabrio mit einer Pappfigur von Donald Trump aufdem Rücksitz; vom Leben gezeichnete Eltern und Groß-eltern in klapprigen Familienkutschen, die auf drastischenSchildern mitteilen, dass Gerichte ihnen Kinder oderEnkel entrissen hätten; Harley-Rocker mit Rauschebärtenund Cheerleaderinnen eines Footballteams.
Der pensionierte Biologielehrer Don Staker hat seitJahrzehnten keine State Fair verpasst, aber zur Paradekonnte er auch diesmal nicht gehen, denn wie jedes Jahrarbeitet er als Einweiser auf dem Campingplatz des Jahr-markts. An die 3000 Wohnmobile müssen auf einemhügeligen Gelände zwischen alten Bäumen Platz finden.
Keine zwei Wochen dauert die State Fair, aber fürviele Familien markiert sie den Höhepunkt des Jahres.Die Camping-Genehmigungen werden auf Lebenszeitvergeben und dürfen, ja sollen innerhalb der Familienvererbt werden. Immer wieder gibt es Streit darüber. Beikomplizierten Scheidungen müssen Gerichte befinden, werden Stellplatz auf dem Jahrmarkt bekommt. Don Stakerhat kürzlich erst wieder mitbekommen, wie sich in seiner
Heimatstadt Ames die beiden erwachsenen Töchter einerVerstorbenen monatelang um das „Camping Permit“zankten. In seiner Familie erwartet Staker keinen Unfrieden.Mit seiner Frau Karen hat er zwei Söhne, sechs Enkel undbisher einen Urenkel. Sie alle verbringen auch dieses Jahrdie eine oder andere Nacht imWohnmobil der Stakers.
Als Don vor 73 Jahren zum ersten Mal auf der IowaState Fair zeltete, war er fünf Jahre alt, und die Erlaubniswar noch auf den Namen seines Großvaters ausgestellt.Nur in den sechziger Jahren hat er den Jahrmarkt zweioder drei Mal verpasst, weil er als Soldat in der Türkeistationiert war. „Früher brachten viele Familien Hühneroder Kaninchen mit“, erzählt er. „Die haben sie dann vorihren Zelten geschlachtet und gegrillt.“ Die Stakers aßenvor allem Eier, „die haben sich ohne Kühlung gehalten,wenn man sie in genug Hafer bettete“. Strom gab es inden vierziger und fünfziger Jahren noch nicht auf demPlatz – „aber auf ihrer Farm hatten meine Großelterndamals auch keinen Strom, also waren wir alle darangewöhnt“. Karen Staker ergänzt: „Alle waren damals arm.Also merkten wir Kinder das nicht.“
Don Staker kann lange darüber reden, wie sich derCampingplatz verändert hat, wie die schlichten Zelteimmer schickeren, üppigeren Wohnmobilen wichen. Erselbst kam jahrelang mit einem ausgemusterten Schulbus,in den er selbst Betten eingebaut hatte; erst nach derPensionierung kauften sich die Stakers ein zwölf Meterlanges Wohnmobil, „damit wir im Winter für ein paarMonate in den Süden fahren können“. Auf die Frage,wie sich die State Fair, ja das Leben in Iowa, veränderthabe, fällt den Stakers nicht viel ein. „Iowa bleibt einStaat, der sich an Familienwerten orientiert, das spiegeltder Jahrmarkt.“ Der Hufeisen-Zielwurf, bei dem KarenStakers Vater vor Jahr und Tag als Iowa-Meister vom Platzging, zieht bis heute viele Zuschauer an. Neu ist, dassKinder in einem „Learning Center“ zusehen können, wieKühe kalben oder Ziegen gemolken werden. „Das brauchteman früher nicht“, sagt Don Staker. „Das kannten diemeisten von zu Hause.“
Schon als der kleine Don 1946 seine erste State Fairerlebte, waren die Zeiten vorbei, als man dort vor aus-verkaufter Tribüne zwei Dampfzüge aufeinander zurasenließ, auf dass sich Zehntausende Leute an einer Explosionergötzen konnten. Zum dritten und letzten Mal fand diesesSpektakel 1932 statt, mitten in der Great Depression, undum der Sache einen zusätzlichen Kick zu geben, standen
Familienbande: Die Cummings Family – ganz rechts Carly Cummings – wurde auf der State Fair mit dem „The Way We Live Award“ ausgezeichnet, weil sie an alten Werten festhält.
HEARTLAND
73AMERIKA
John Olsen Sean Bagniewski
die Namen der beiden Präsidentschaftskandidaten auf denWaggons: von links kam Roosevelt, von rechts Hoover.„Hier gibt es keinen Sieger“, sagte der Kommentator, alsbeide Loks in einem großen Feuerball verschwanden, „aberim November wird das anders sein.“
Nicht nur wegen Sicherheitsbedenken wäre das heuteundenkbar. Sondern auch, weil die meisten Menschen dasThema Politik tunlichst meiden. Im Roman „State Fair“verbringt Abel Frake seine Abende auf dem Zeltplatz nochdamit, lustvoll mit den Nachbarn über politische Kandi-daten zu streiten. Für Don und Karen Staker kommt dasnicht in Frage. Sie lassen zwar irgendwann durchblicken,dass sie von der Trump-Show wenig halten. „Aber wirsprechen mit niemandem darüber, von dem wir nichtsicher wissen, dass sie das genauso sehen. Die Politik istso giftig geworden.“
Davon ist wenig zu ahnen, wenn morgens überall aufdem Festgelände die Lautsprecher zu plärren beginnenund eine Sängerin die Nationalhymne intoniert. Ein jedernimmt seine Kappe ab, sucht in seiner Umgebung eineamerikanische Fahne, fixiert den Blick darauf und legtdie rechte Hand aufs Herz. Auch Sarah Pratt tut das,wenn sie in ihrer Butterkuhvitrine die Hymne hört. Be-trachtet sie ihre Kunst, ihren Nebenjob, ihre alljährlicheHommage an die Milchwirtschaft und an das Machen-wir-einfach-Ethos des Mittleren Westens als etwas typischAmerikanisches? Pratt antwortet verblüffend vorsichtigund spricht zunächst von den tibetischen Mönchen, dieschon in der Ming-Dynastie Opfergaben aus Yak-Butterformten. Eine Baumwollfarmerin aus Arkansas namensCaroline Shawk Brooks machte 1876 als erste Amerikanerin
mit Butterkunst Furore. Mit einer filigranen Skulptur derblinden Jolanthe aus Tschaikowskis Oper begeisterte sieKritiker auf der Weltausstellung in Philadelphia. „Sie kamauch nachDesMoines und hat auf der Bühne eines TheatersButterfiguren modelliert, während ein Orchester spielte“,erzählt Sarah Pratt.
Von alledem hatte die Tochter eines Kleinstadt-Apothekers nichts geahnt, als sie mit 14 Jahren die Elternihrer Freundin Cary überredete, sie mit auf die State Fairzu nehmen. Carys Familie stellte Rinder aus, und dieMädchen durften auf Heuballen im Stall schlafen. Sarahmusste versprechen, tatkräftig zu helfen. „Aber ich erwiesmich als ziemlich unnütz.“ Erst sollte sie eine Kuh waschen,benutzte aber so viel Seife, dass es eine Stunde dauerte,das Fell vom Schaum zu befreien. Dann sollte sie ein Rindzur Arena führen, aber das Tier störte sich am Jahrmarkt-trubel, und Sarah bekam es nicht in den Griff. Schließlichwurde sie Norma „Duffy“ Lyon zugeteilt, der schon legen-dären Butterkuhbildnerin.
„Im ersten Jahr habe ich vor allem Eimer ausgewaschen“,sagt Pratt. Im nächsten Jahr kam die Aufgabe hinzu, „dieButter vorzubereiten“ – sie stückchenweise mit den Händenvorzukneten und an die Künstlerin weiterzugeben, aufdass ein Ohr oder eine Zitze daraus werde. „Als ich einpaar Jahre später die Highschool abgeschlossen hatte,kannte ich mich schon recht gut mit den einzelnen Kuh-rassen aus.“ Pratt studierte Sonderpädagogik, gründeteeine Familie in einem Vorort von Des Moines, blieb LyonsAssistentin – und hatte, erzählt sie, kein Wort mitzureden,als diese sie zur Nachfolgerin ausrief.
Auch Sarah Pratt hat ihre Nachfolge schon geregelt.Seit vielen Jahren sind ihre Zwillingstöchter von früh bisspät dabei, hocken im kleinen Vorraum und knetenButter, entwerfen auch schon kleinere Figuren. An dasJahr, in dem die Pratts zusätzlich zur Kuh einen HarryPotter aus Butter modellierten, wird die Familie nochlange zurückdenken. Dieses Jahr umrahmen Bibo unddas Krümelmonster die Butterkuh, während Ernie undBert noch in der Mache sind – weil Sarah Pratt schon vorzehn Jahren die Mondlandung aus Butter nachgebauthatte, feiert sie diesmal den 50. Geburtstag der Sesam-straße. Aus dem Alter sind ihre Töchter zwar raus. Dochdafür sind sie inzwischen offiziell als Butterkuh-Lehrlingebei der State Fair tätig. „Sie sind 14 Jahre alt, wie ichdamals. Und sie können es kaum abwarten, eines Tageszu übernehmen.“
ean Bagniewski, 36, ist erfolgreicher Anwalt in DesMoines. John Olsen, 50, arbeitet als Vertretungslehrer
im Vorort Ankeny. Beide werden in den kommendenMonaten ihre Berufe und Familien vernachlässigenund jeden Tag Stunden darauf verwenden, DonaldTrump aus demWeißen Haus zu verjagen.
Bagniewski ist Parteichef der Demokraten im PolkCounty, dem bevölkerungsreichsten Landkreis vonIowa. Auf Twitter stellt er sich als „Trailer Park Kid“vor: Seine Mutter zog ihn in einer Wohnwagensiedlunggroß. Er war in der fünften Klasse, als 1994 Bill Clintonin seinen Ort kam. Sean bat um ein Autogramm, aberder Präsident ließ es nicht dabei bewenden. Er redeteauf den Jungen ein, sich politisch zu engagieren. Seanwar angefixt. 2017 übernahm er die Führung derDemokraten rund um Des Moines.
Die hatten sich nach Hillary Clintons Niederlagegegen Trump im Streit zwischen Bernie-Sanders-Anhängern und dem „Establishment“ entzweit. Jetztwird Bagniewski täglich von Präsidentschaftskandidatenoder deren Kampagnenchefs um Rat gebeten, orga-nisiert Fundraiser – und gibt sich hoffnungsvoll. DasEntsetzen über Trump schweiße die Demokratenzusammen und verschaffe ihnen Zulauf. „Du kannstdir nicht vorstellen, wie langweilig unsere regulärenSitzungen sind“, sagt Bagniewski, „aber jetzt kommenjedes Mal mehr als 120 Leute!“
John Olsen hat kein vergleichbares Amt – aber einenAnzug, der Aufmerksamkeit garantiert. Zum Beispieleine Hose und Weste von 1972, die in den amerikani-schen Nationalfarben zum Wählen auffordern: Vote!An der Weste hat Olsen unzählige Buttons befestigt,Originalware aus lang vergangenen Wahlkämpfen.Olsen ist nahe Washington aufgewachsen, hat seinStudium der Sozialarbeit zugunsten der Politologieaufgegeben und in einem politischen Vintage-Ge-schäft gejobbt, wie es das nur in Amerikas Hauptstadtgeben kann. Doch sein ältester Sohn ist Autist, undweil es ihm mit seiner Großmutter am besten geht,zogen die Olsens zu ihr nach Iowa. Der Umzug fieldem politikversessenen Vater zunächst schwer. Dochbald merkte er, dass er der großen Politik in Iowa vielnäher kommt als in Washington.
Schon 2008 warb er für Joe Biden, der aber BarackObama und Hillary Clinton unterlag. Umso mehrfreut er sich, dass Biden nun gute Chancen hat.Schwärmerisch verweist Olsen auf die tragischenEreignisse in Bidens Leben, seine erste Ehefrau undeine Tochter kamen bei einem Autounfall ums Leben,sein Sohn starb an Krebs. „Biden ist mitfühlend unddemütig, trotz seines Selbstbewusstseins.“ Ein Polit-Trainer hat Olsen gelehrt, seine Haustürgesprächezugunsten eines Kandidaten nicht als „Transaktion“,sondern als Akt des Beziehungsaufbbf aus zu betrachten.„Manchmal plaudere ich eine halbe Stunde mit denLeuten über ihr Leben und erwähne Biden gar nicht“,sagt er. „Aber irgendwann komme ich wieder.“
Sean Bagniewski will keinen Favoriten nennen.„Sollte noch einer von ihnen auf die Straße hechten,um meinen kleinen Sohn davor zu bewahren, voneinem Laster überfahren zu werden, ändere ich meineMeinung vielleicht, sonst bleibe ich neutral wie dieSchweiz.“ Diesmal wollen die Demokraten in Iowa aneinem Strang ziehen. „Jeder wirbt für seinen Kandi-daten“, sagt Bagniewski. „Aber alle sagen, dass sie amEnde denjenigen unterstützen werden, der die bestenChancen gegen Trump hat. Denn diesmal fühlt essich an, als wäre das Ende der Welt nahe.“
Dauergast: Don Staker hat vor 73 Jahren zum ersten Mal auf der State Fair gezeltet. Heute hat er mit seiner Frau Karen einen Camper.
ZWEI GEGEN TRUMPWie Sean Bagniewski und John Olsengegen das Ende der Welt kämpfen
74 NACHTLEBEN
FOTO
SY
BIL
LS
CH
NE
IDE
R
osa Tapeten, schwarze Flamingos und Porno-VHS-Kassetten aus den Siebzigern zierenden Innenraum der Porno-Karaoke-Bar vonOlivia Jones. „Graf Faculla“, „Tirol wie es
bumst und kracht“ und „Lesbische Liebe im Lustschloß“bestimmen den Abend. Über der Tanzfllf äche hängen vierBildschirme mit einer digitalisierten Auswahl an Schmuddel-filmen. Am hinteren Ende des kleinen Raums bestellenverunsicherte Gäste ihre Getränke. Während es in norma-len Karaoke-Bars darum geht, einen Song auszusuchen,ihn mit Freunden und Unbekannten zu singen, auch mitetwas Scham und Lampenfieber, stöhnt man sich beimPorno-Karaoke das Herz aus der Hose.
Dafür sucht sich der Gastgeber „Lex Dildo“ jede halbeStunde seine Opfer aus. Einheimische, Touristen undMitglieder von Junggesellenabschieden jeder Altersklasseverirren sich in die Bar in Hamburg. Die Besucher freuensich über Fotos mit Olivia Jones, die immer mal wieder anTischen und Sitzplätzen vorbeizieht und turnusmäßig mitden Gästen Kontakt sucht.
Hier ist alles dabei: von halbwegs nüchtern bis sturz-betrunken. Und mitten unter den Partygästen bemühtsich „Lex Dildo“ mit seiner roten Phallusmütze, anfangsunter den Blicken der peinlich berührten Besucher, einenKandidaten oder eine Kandidatin herauszusuchen.
Die Mission des „Kapitäns der Liebe“: „Spread Love“.Auch politisch: Sein aktueller Wahlslogan ist „Mehr Lexitstatt Brexit“ – und da der Kapitän für mehr Stimmungsorgen will, pickt er David heraus, einen Bräutigam, derseinen Junggesellenabschied an diesem Abend auf derGroßen Freiheit feiert. Er wirkt peinlich berührt. Schütteltden Kopf. Sein Hemd ist durchgeschwitzt.
Die Idee, die erste Porno-Karaoke-Bar der Welt zugründen, kam Olivia Jones und ihremTeam bei einer ihrerParty-Hafenrundfahrten. Dort testeten sie auch erstmalsdas Konzept am Publikum – mit Erfolg. Auf St. Pauli gabes früher die höchste Porno-Kino-Dichte, durch die vielenSexshops auch die größte Heimkino-Auswahl, und dort,wo jetzt die Porno-Karaoke-Bar ist, war in den Sechzigernein Kino, in dem die Gäste zu Schmuddelfilmen 3D-Brillenaus Pappe und bunter Folie bekamen. Heute ist das Erleb-nis in der Bar gleichzeitig realer und humoristischer. Sowie bei David.
Unter dem Druck der Freunde gibt er sich schlussend-lich geschlagen und wird von „Lex Dildo“ auf die Bühne
Olivia Jones hat in Hamburgeine Porno-Karaoke-Bar eröffnet.
Nach dem, was man siehtund hört und versteht, scheintes der letzte Schrei zu sein.
Von Artur Weigandt
Stöhnen und stöhnen lassen: Olivia Jones bringt in ihrer Porno-Karaoke-Bar in Hamburg manchen Gast ins Schwitzen.
gezerrt. Schlager wie „Traum von Amsterdam“ und„Atemlos“ von Helene Fischer sowie die deutsche National-hymne müssen in der ersten Übungsrunde von Davidnachgestöhnt werden. Das Publikum grölt, lacht undapplaudiert. Die Freunde feuern ihn an. Allerdings ist dasnoch nicht das Ende.
Aus etwa 30 kurzen, knackigen Porno-Clips sucht sich„Lex Dildo“ einen Film zum Nachstöhnen aus. Der Gast-geber hat viele kuriose Ereignisse seit der Eröffnung derBar erlebt. „An einem Abend trat eine junge Braut mitihrer 70 Jahre alten Schwiegermutter an. KllK asse Perfor-mance. Oder: Zwei Mädels versuchten sich an einemLesben-Porno und fingen plötzlich an, sich gegenseitig zubefummeln. Ich habe gesagt: Mädels, ihr sollt das Videonachstöhnen, nicht nachspielen. Aber die beiden habendann erst richtig losgelegt.“ Der Gastgeber hat schon oftbeobachtet, dass Männer schüchterner sind als Frauen.David bekommt jetzt zehn Minuten Pause.
Im Außenbereich der Porno-Bar tummeln sich Drag-Künstler, die sich unter das Publikum mischen. AllA le machenFotos, trinken Alkohol. 2008 eröffnete Olivia Jones die„Olivia Jones Bar“, 2010 kam „Olivias Wilde Jungs“hinzu, die erste Tabledance-Bar auf St. Pauli, zu der nurFrauen Zutritt haben. 2012 eröffnete sie „Olivias ShowClub“, ihr drittes Geschäft. Seit 2014 besitzen OliviaJones und ihre Familie fast eine ganze Insel der Travestie-Kunst mitten auf der Reeperbahn.
Während im Innenhof das bunte Treiben weitergeht,sitzen einige an den Tischen der Porno-Karaoke-Bar, an-dere tanzen zu Schlager, EDM und Chartmusik. Bis „LexDildo“ das Mikrofon ergreift und David wieder auf dieBühne bittet. Er schaltet sich durch das Porno-Programm.In der Auswahl erscheinen Filme, die in der Gynäkologie,der Landwirtschaft, beim Pizza-Lieferdienst spielen. Dies-mal ist es eine Büroszene, in der ein Angestellter seinerSekretärin nachstellt und auf sie einredet. Das Filmchensieht eher nach Comedy als nach Porno aus.
Doch David stottert, ist nervös. Er fängt sich wiederund macht dann fünf Minuten lang den Text und dieGeräuschkulisse nach wie ein echter Pornostar. Für ihngibt’s Applaus und einen Kurzen. Jetzt sind die nächstendran: Ein anderer Bräutigam und seine Schwiegermutterstehen auf der Bühne. Ihr Film ist ein Gynäkologen-Schmuddelfilm. Die Botschaft der Hobby-Pornostars:Kritik am Krankenkassensystem.
HERZAUSDERHOSERKenia und Tansania 20 Tage ab 4.299 €Südafrika mit eSwatini 21 Tage ab 2.999 €Island 15 Tage ab 2.999 €Georgien 15 Tage ab 1.599 €Marokko 16 Tage ab 1.399 €Vie
76 REISE
FOTO
SH
UB
ER
IMA
GE
S(3
),F
UN
DA
CIÓ
NC
ÉS
AR
MA
NR
IQU
E
ie ein schlechter Witzmutet es an, dass schräggegenüber von CésarManriques letztem Wohn-
haus in der Lanzarote-Gemeinde Haríaeine jener aufgegebenen Baustellen liegt,mit einem verfallenden Rohbau, die erzeitlebens bekämpft hat. Und gegen dieseine Stiftung nach wie vor protestiert undprozessiert. Das Jahr 2019 steht auf derKanaren-Insel ganz im Zeichen des vor100 Jahren geborenen Künstlers, Architek-ten und Umweltaktivisten, dessen Worteauch mehr als zweieinhalb Jahrzehntenach seinem Unfalltod im September1992 aktuell sind. „Wann endlich wirdsich der Mensch seiner selbstmörderi-schen, rentablen, aber tödlichen Plump-heit bewusst werden?“, schrieb Manriquein den achtziger Jahren. „In seinem maß-losen Stolz hat er ein System hinfälligerWerte geschaffen, das einzig dazu gedienthat, sein eigenes System zu zerstören.“
Ein Schwarzweißfoto aus jener Zeitzeigt ihn, fast 70 Jahre alt, mit Megafon inder Hand an einem Strand, den er gegenBoden- und Bauspekulation verteidigt.„Tod Lanzarotes“, „Beton-Barbarei“ oder„Mörder der Insel“ – solche Schlagzeilenhat er provoziert, um aufzurütteln. Sehrviel später, nach seinem Tod, hat die Stif-tung ein „Manifest der Nachhaltigkeit“verfasst. Sostenibilidad, also Nachhaltig-keit, war sicher kein Wort aus ManriquesWortschatz, er formulierte nie bürokra-tisch, sondern immer mitreißend empa-thisch. „Wir, die wir hier geboren sind,kennen deine magischen Kräfte, deineWeisheit, deine Vulkanologie, deine revo-lutionäre Ästhetik; wir, die wir gekämpfthaben, um dich aus deiner geschichtlichenVergessenheit und der dich immer kenn-zeichnenden Armut zu retten, zitternheute ob der Feststellung, wie sie dich zer-stören und vermassen; und wir begreifen,wie wichtig unsere Proteste und Hilferufesind, angesichts der Raffgier der Spekulan-ten und der Tatenlosigkeit der Behörden,die zulassen, dass die Insel, die eine derberühmtesten und schönsten der Erde seinkönnte, unwiderrufllf ich zerstört wird.“
Die Wahrheit ist, dass Manriques „ver-bissener Kampf““f , so sah er ihn selbst, nichtvergeblich war. Seit 1974 schon ist dasTimanfaya-Gebiet, das Zentrum der Vul-kanausbrüche von 1730 bis 1736, ein ge-schützter Nationalpark. 1993 wurde ganzLanzarote zum Biosphärenreservat erklärt.Was mit dem bis heute wirksamen Einsatzdes Künstlers gegen große Werbetafeln inder Landschaft begann und was sich mitseinen Geboten für „intelligenten Touris-mus“ fortsetzte, ermöglicht im 21. Jahrhun-dert ein Insel-Erlebnis fast ohne Hotel-
Hochhäuser (Ausnahme: das Grand-Hotelin Arrecife) und andere Schreckensbilderdes globalen Reisens. Die Insel ist erstaun-lich sauber, wenngleich der sorglose Um-gang mit Plastik und die Verschwendungvon Wasser verstörend wirken. Hier hatdie Stiftung noch gut zu tun.
An Manriques Vermächtnis kommtman nicht vorbei. Wahrzeichen wie dasMonumento del Campesino sind unüber-sehbar. Und sein erstes Haus bei Tahiche,jetzt Sitz der 1982 von ihm gegründetenStiftung, ist allein wegen seiner Architek-tur, die auf spektakuläre Weise fünf Lava-blasen einbezogen hat, eine Attraktion.Viele Politiker und Prominente waren hierzu Gast – also auch Boulevard-Fotografen,die Höhlen, Pool, Tanzfllf äche und Sitz-ecken so inszenierten, wie man sich in densiebziger Jahren ein Jet-Set-Leben vorstell-te. So trug Manrique zum Interesse derTouristen an Lanzarote bei. Wie er dieHeimat in seinen ersten künstlerischenJahren sah, kann man nun wiederent-
decken: In Tahiche ist eine über Jahremühevoll restaurierte Wandmalerei zusehen, die Manrique im Herbst 1953 fürden ersten Flughafen geschaffen hatte.
Näher als im stark umgebauten AnnA wesenbei Tahiche kommt man seiner Persönlich-keit in seinemWohnhaus und seinemAtelierin Haría, die nach seinem Tod kaum ver-ändert wurden. Seine Sammlungen voneigenen und fremden Bildern, von Skulp-turen, Masken, KllK eidung, Alltagsgegen-ständen, sein Architekturkonzept, seineLebenseinstellung – all das führen dieRäume im Palmental in Haría vor Augen.Trotz des Studiums in Madrid und erfolg-reicher Künstlerjahre in New York blieb erimmer ein Kind Lanzarotes, „einer Inselfür Meditation und Beschaulichkeit“, wieer schrieb. „Der direkte Kontakt mit demverbrannten Magma von Timanfaya er-zeugt eine Unruhe der vollkommenenFreiheit. Man verspürt die seltsame Emp-findung einer Vorahnung von Zeit undRaum.“ Manrique zog seine Lebensenergie
Optimist und Utopist: Lanzarotefeiert den 100. Geburtstag des Künstlersund Umweltaktivisten César Manrique.
Von Jörg Hahn
Im Atelier: César Manrique (1919–1992) Vor der Tür: Haus der Stiftung bei Tahiche
aus dieser kargen Insel, in deren dunklerAsche es jedes Leben schwer hat.
Malla erei, Bildhauerei, ArrA chitektur, Musik,Gartenkunst, Ökologie und Ökonomie –all das hat Manrique beschäftigt. Nochbis zum Jahresende zeigen Ausstellungen,Tagungen und Konzerte diese Vielfalt.Eine Ausstellung in der Casa Amarilla inder Inselhauptstadt Arrecife schlägt einenBogen von Manrique zu Greta Thunberg,der Umwelt-Ikone von heute. „Wir sindZeugen eines historischen Augenblicks,und die riesige Gefahr der Zerstörung derUmwelt ist heute so offensichtlich, dasswir im Hinblick auf die Zukunft eine neueVerantwortung zu übernehmen haben.“Ein Satz, der auch von Greta stammenkönnte. Wie andere auch: „Bis heute hatder Mensch die Natur in plumper Weisebeherrscht und vergewaltigt; aber die Fol-gen dieses irrationalen Missbrauchs kön-nen nicht mehr weiter fortgesetzt werden,weil das Überleben der Menschen auf demSpiel steht.“
Das Erinnerungsjahr hat viele Aspekteseines Werks offengelegt. Kaum jemandbleibt an den Orten, die der Künstler undBaumeister erschaffen hat, unbeeindruckt– am Mirador del Rio, einem großartigenAusguck auf die nördliche NachbarinselLa Graciosa, im Kakteengarten oder imKulturzentrum El Almacén in Arrecife.Kubische Bauten, weiß gekalkte Mauern,grün gestrichenes Holz prägen die Dörfer,deren Seitenstraßen oft noch unbefestigtund staubig sind wie eh und je. Trotzdem:Bei rund 140.000 Einwohnern stehenetwa 100.000 Gästebetten bereit. Immer-hin rund drei Millionen Urlauber kom-men im Jahr auf die Insel.
César Manrique hat von sich gesagt, erhabe Schönheit auch dort erkannt, woandere Menschen nichts gesehen odergespürt hätten. „Die Natur hat mir groß-zügig gegeben, was andere weder sahennoch verstanden.“ Also musste er den an-deren die Augen öffnen. Daraus hat sichetwas entwickelt, was er vielleicht ohneIronie als Corporate Identity Lanzarotesbezeichnet hätte: Sein Markenzeichen fürdie Insel, eine Sonne mit einem schwarzenKern, findet sich längst auch auf Miet-autos. Er war, neben allen anderen Betäti-gungen, auch ein PR-Experte, in eigenerSache und im Interesse der Insel.
Wie es die Insel von der Heimat armerFischer und Bauern zum festen Teil desglobalen Tourismus geschafft und den-noch als Naturereignis überlebt hat, das istdie spannende Geschichte, die im Jahr deshundertsten Geburtstags des Optimistenund Utopisten nun neu erzählt wird. AlsLehrstück, das weit über Lanzarote hin-ausreicht.
Meer im Blick: Vor dem Aussichtspunkt Mirador del Rio liegt die Nachbarinsel La Graciosa. Erinnerungswürdig: Das Monumento del Campesino schuf Manrique zu Ehren der Inselbauern.
ZEIT FURDIE INSEL
W
danish design by . made by
ESSEN78
ach dem langen Sommer mitleichten Salaten und gegrill-tem Fisch ist endlich wiederZeit für opulente Herbst-
küche. Dabei ist dieses Gericht auch inökologischer Hinsicht verlockend: DerServiettenknödel, der Star des Mahls, istResteküche, das Wildschwein wuchs art-gerecht und frei von Antibiotika im nahe-gelegenen Odenwald auf, und der Wirsingstammt von hiesigen Feldern. Der Knödelpasst zu jedem Gericht mit reichlich Saucesowie zu Gulasch und Ragouts. Vegetariersollten ihn zu Rahmpilzen, beispielsweiseKräutersaitlingen, versuchen. Seit Jahrenwird er bei uns zu Hause vehement alsWeihnachtsessen eingefordert.
Für den Servvr iettenknnk ödel altbackene Bröt-chen verwenden, gerne auch eine Laugen-brezel oder ein Stück Baguette. Die Brot-reste gewürfelt oder in feine Scheibengeschnitten mit warmer Milch, in der dieButter geschmolzen wurde, und den ver-quirlten Eiern übergießen. Gold-gelb ge-schmorte Zwiebelwürfel, gehackte Peter-silie und Salz, Pfeffer und Muskat hinzu-fügen. Den Teig mit den Händen sorg-fältig verkneten. Eine gut ausgewascheneStoffserviette oder ein feuchtes Geschirr-handtuch ausbreiten, mit Butter einstreichenund mehlieren. Darauf den zu einer Wurstgeformten Knödelteig setzen, ihn in dasTuch einrollen und die Enden bonbonartigverschnüren. In einem großen Topf mitgesalzenem Wasser 40 Minuten lang sim-mern, nicht kochen lassen.
Für sechs Personen:8 altbackene Brötchen in feinen Scheibenoder Würfeln
200 ml Milch erwärmen200 g Butter darin zerlassen4 Eier verquirlen2 Zwiebeln fein würfeln und gold-gelbschmoren
6–8 Stängel glatte Petersilie, gehacktPfeffer, Salz, MuskatButter und Mehl für die ServietteKüchengarn zum Zubinden
FOTO
SC
LA
US
EC
KE
RT
Der Braten stammt aus der ausgebeintenKeule eines Wildschweins (etwa 1,8 Kilo-gramm). Aus den zerhackten Knochen amVortag einen Fond kochen. Die Keuleinnen mit einer Wildgewürzmischung auszermahlenem Wacholder, Pfeffer, Piment,Zimt und Lorbeer einreiben, Speckstreifendarüberlegen und zu einem Braten schnü-ren. Das Fleisch von allen Seiten kräftiganbraten, danach ebenso das Suppengemüsemit Tomatenmark. Mit einer halbenFlasche Rotwein und 500 Milliliter Wild-fond auffüllen, Lorbeerblätter und zersto-ßene Wacholderbeeren dazugeben und imgeschlossenen Bräter bei 150 Grad in denOfen schieben. Der Braten muss nicht vonder Flüssigkeit bedeckt sein. Nach einerStunde die Hitze auf 120 Grad reduzieren,den Braten wenden, gegebenenfalls Flüssig-keit auffüllen. Nach weiteren 90 Minutensollte er mit einer Kerntemperatur vonknapp 80 Grad durch sein. Herausnehmenund in Alufolie und mäßiger Wärmeruhen lassen.
Für die Sauce reichlich getrocknete Wald-pilze oder Steinpilze mit kochendemWasserüberbrühen und quellen lassen. Die Braten-sauce mit dem Gemüse je nach Geschmackgröber oder feiner passieren. Mit Salz,Pfeffer, etwas Orangenschale, Johannis-beermarmelade und ein paar StückchenBitterschokolade abschmecken, Pilze undetwas von dem Pilzwasser hinzugeben unddie Sauce sämig köcheln. Ein paar LöffelCrème fraîche hinzufügen.
Die Blätter eines Wirsingkopfs waschen,den harten Strunk entfernen, in etwasFlüssigkeit etwa 20 Minuten blanchieren.Ausdrücken, hacken und mit 50 GrammButter und 150 Milliliter Sahne vermengenund kurz köcheln lassen. Nach Bedarfabschmecken.
Es ist wieder Zeit für kräftige Küche: Ein Rezeptfür Serviettenknödel mit Wildschweinbraten,Waldpilzen und Rahmwirsing. Von Claus Eckert
ENDLICHHERBST
NWARUMAUSG
Fürst VON METTERNICH. FÜRSTLICH GENIESSEN.
Letzteres gelingt mit dem Riesling allerdings ausgezeichnet. Zuge-geben, er ist ein echter Klassiker mit Charakter, edel und welt-berühmt. Aber vielleicht ist das genau der Grund, weshalb sich der König der weißen Rebsorten so eigensinnig und anspruchsvoll gibt.
Denn um gut zu gedeihen, nimmt er sich gerne Zeit. Am liebsten in exklusiver Lage, so wie man sie im Rheingau, in Rheinhessen und der Pfalz findet. Hier ist das Klima ideal. Denn warme Tage und kühle Nächte hat der Riesling besonders gern.
Auch beim Boden zeigt er sich wählerisch. Erst wenn dieser tief-gründig, mineralstoffreich und durchlässig beschaffen ist und Wärme speichern kann, entfalten die Riesling-Reben ihre volle Klasse.Begegnet man diesem hochwertigen
Fürst VON METTERNICH. FÜRSTLICH GENIESSEN.
AUSGERECHNET
GESUNDHEIT80
FO
TOJU
LIA
ZIM
ME
RM
AN
N
Herr Michalsen, was machen wir bei der Ernährung falsch?Das meiste. Wir essen zu fett, zu süß, zu salzig – und zuviel. Ob am Bahnhof oder in der Stadt, überall wird unsverarbeitete Nahrung angeboten, die wir gerne konsumie-ren. Und zwar bis zu zehnmal am Tag. Dabei ist unserKörper auf Phasen ohne Kalorienzufuhr ausgelegt. Manstelle sich vor: 70 Prozent aller chronischen Erkrankun-gen haben ihre Ursache auch in falscher Ernährung.Wenn unsere Essgewohnheiten anhalten, werden Leidenwie Diabetes und Bluthochdruck weiter zunehmen.
Sie haben ein Buch über gesunde Ernährung und dieHeilkraft des Fastens geschrieben. Dabei ist der Marktgerade regelrecht übersättigt.Zum einen leite ich in meinem Buch Empfehlungenaus aktuellen Forschungsergebnissen her. Zum anderenkonnte ich am eigenen Leib erfahren, was eine Ernäh-rungsumstellung bewirken kann. Ich habe in meinerZeit als Assistenzarzt viel Süßes und Fast Food gegessen.Das Ergebnis waren ein erhöhter Blutdruck und zu hoheBlutfette. Daraufhin habe ich angefangen, mich medi-terran zu ernähren, und ein halbes Jahr später warenmeine Werte wieder normal. Diesen Effekt beobachteich auch täglich bei meinen Patienten. Entscheidend ist,wann, wie oft und was wir essen. Es gibt ja regelrechteSuperfoods, die einen ausgewiesenen Wirkstoff in hoherKonzentration enthalten und im Idealfall den Effekteines Medikaments haben.
Zum Beispiel?Rote-Bete-Saft etwa schlägt an wie ein Blutdrucksenker.Dazu reicht ein halber Liter täglich. Wer 30 GrammNüsse verzehrt, beugt Schlaganfall, Diabetes undHerzinfarkt vor. Am besten ist die Walnuss, weil sie dankOmega-3-Fettsäuren und Antioxidantien vor Gefäß-und Herzerkrankungen schützt. Leinsamen enthaltenAlpha-Linolensäure und reichlich Ballaststoffe. Ingeschroteter Form sind sie ein wirksames Superfoodgegen Bluthochdruck und zu hohes Cholesterin. Siehaben sich als hervorragende Ergänzung bei einermedikamentösen Rheuma-Therapie erwiesen. Sogardie Krebsprävention liefert vielversprechende Befunde.
Heidelbeeren haben auch einen ausgezeichneten Ruf.Es gibt kein gesünderes Obst als Beeren. Heidelbeerensind sehr zu empfehlen bei Krebs, Darmerkrankungenund Bluthochdruck. Zudem enthalten Beeren insgesamtweniger Fruktose als anderes Obst. Wer ein zuckerreichesGericht zu sich nimmt und zusätzlich viele Beeren isst,bremst den Blutzucker- und Insulinanstieg damitein wenig aus. Darüber hinaus verbessern Beeren dieSehkraft bei der Arbeit am Bildschirm.
Es gibt ständig verblüffende neue Erkenntnisse über unserEssen. Was hat Sie zuletzt am meisten überrascht?Dass das Thema Ernährung generell so ein Gewichtbekommen hat. Trotzdem hinken wir hinterher; dieZusatzbezeichnung „Ernährungsmedizin“ ist zumBeispiel erst beim letzten Ärztetag bundesweit etabliertworden. Eine besondere Freude ist es für mich, dassdas Fasten inzwischen den Durchbruch geschafft hat.
Wie meinen Sie das?Unter Kritikern galt das Fasten vor 25 Jahren noch alsesoterische Scharlatanerie. Damals benutzte man nochBegriffe, die heute zu Recht nicht mehr in Umlauf sind,etwa „entschlacken“ oder „entgiften“. Inzwischen sind diepositiven Effekte belegt. Fasten senkt den Blutdruck, hilftbei Diabetes und gilt als effektives Mittel gegen rheumati-sche Beschwerden. Und es scheint die einzige Interventi-on zu sein, die lebensverlängernd auf Organismen wirktund altersbedingte Erkrankungen wie Demenz verzögert.
Warum genau ist das Fasten so gesund?Wann immer wir essen, schmeißen wir den gesamtenMechanismus der Verdauung und des Energiestoff-wechsels an, was unser System ständig übersteuert. BeimFasten dagegen holt sich der Körper die Energie ausden eigenen Fettreserven, der Darm entspannt sich, undseine Bakterien können neu starten. Hinzu kommt dieErholung: Wenn die Zellen nicht mehr mit der Verdau-ung beschäftigt sind, räumen sie auf und pflanzen sichfort. Am Ende dieser Kaskade sinkt der Blutdruck,schmilzt die Fettleber weg, reguliert sich der Zuckerhaus-halt. Durch Fasten und eine Ernährungsumstellung istnicht selten ein insulinpflichtiger Diabetes heilbar. Fürmeine Patienten ist das der Wahnsinn. Sie fasten zehnTage und brauchen auf einmal keine Medikamente mehr.
Auf welche Arten kann man überhaupt fasten?Das Fastenuniversum hat sich diversifiziert. Amwichtigstensind das Heilfasten, das über einen längeren Zeitraumläuft, und das Intervallfasten, bei dem sich Phasen derNahrungszufuhr und -abstinenz regelmäßig abwechseln.Früher galten starre Fastenregeln: maximal 300 Kalorienam Tag, mindestens eine Woche. Heute wissen wir, dasses auch anders geht. Bei der Fasting Mimicking Dietdürfen bis zu 800 Kalorien zugeführt werden, solangeman sich vegan und zuckerfrei ernährt.
Sobald es um Veganismus geht, verhärten sich die Fronten.Es gibt einen Zusammenhang zwischen der günstigenWirkung des Fastens und einer pflanzenbasiertenErnährung. Kalorienrestriktion befördert die Erneuerungder Zellen. Vor allem tierische Eiweiße und Zuckerbeschleunigen ihren Alterungsprozess. Deswegen sollteman beim Fasten keine süßen Fruchtsäfte zu sichnehmen. Oder nehmen Sie die Haut: Sie ist bei Fleisch-essern schlechter vor schädlicher Sonnenstrahlunggeschützt als bei Veganern. Grundsätzlich gilt: Die idealeErnährung sollte überwiegend pflanzlich, abwechslungs-reich und vollwertig sein. Gemüse ist um den Faktor dreigesünder als Obst. Am besten sind zwei große Mahlzeitenam Tag, von denen die üppigere zur Mittagszeit einge-nommen wird. Immer gut sind antientzündliche Gewürzewie Ingwer, Koriander, Kurkuma und Kreuzkümmel.
Auch an Grünkohl und Hafer kann man sich gewöhnen,denn wir essen nicht, was uns schmeckt, sondern unsschmeckt, was wir essen.
Was sind außer tierischem Eiweiß und Zucker weitereIrrwege unserer Ernährung?Man hat zum Beispiel Proteine zu hoch bewertet. Zwarhat ein Proteinmangel gravierende Auswirkungen, aberes gibt keine Studie, die nachweisen konnte, dass eineproteinreiche Ernährung langfristige Vorteile für dieGesundheit mit sich bringt. In den Blue Zones, also denGebieten auf der Welt, wo Menschen deutlich längerleben als der Durchschnitt, spielen Proteine keine großeRolle. Tatsächlich erhöht zu viel tierisches Protein dasRisiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Außer-dem wird von Ernährungsberatern zu wenig differenziert.Die Label „Low Carb“ und „Low Fat“ suggerieren, alleKohlenhydrate oder Fette seien gleich. Es ist aber einUnterschied, ob wir Kohlenhydrate in Form von Zuckeroder Vollkornbrot zu uns nehmen, ob das Fett ausLeinsamen oder Bauchspeck kommt.
Das liegt doch auf der Hand.Es gibt auch Zusammenhänge, die weniger bekannt sind.Brokkoli ist beispielsweise ein tolles Superfood. Er istantidiabetisch, stärkt das Immunsystem und scheintkrebspräventiv zu sein. Das gilt aber nur, wenn erzerschnitten und zerkaut wird. Dann nämlich spaltet dasEnzymMyrosinase die im Kohl enthaltenen Glucosinolateund setzt den gesunden Wirkstoff Sulforaphan frei.Jedoch ist die Myrosinase sehr empfindlich, was dazuführt, dass Brokkoli bei längerer Kochzeit kein Sulfora-phan bildet. Ein Trick: Zerkleinern Sie den Kohl undwarten Sie eine Viertelstunde, bevor Sie ihn kochen. Soentsteht das Sulforaphan früh genug und bleibt beimKochen erhalten. Es kommt immer auf den Kontext an.
Und auf den Rhythmus: Mahlzeiten zivilisieren uns, weilsie uns Regeln und einen Takt geben. Nun bekommen wiraber an jeder Ecke etwas zu essen. Führt das neben sozialenVeränderungen auch zu biologischen?Ja. Wenn ich eine Woche lang um neun Uhr, um 13 Uhrund um 19 Uhr esse, gewöhnen sich die Zellen daran.Sie stellen um 18 Uhr erste Enzyme bereit, weil sie wissen:In einer Stunde geht’s los. Verlässt man diesen Rhythmusund zieht sich um 21 Uhr eine Portion Pommes rein,führt das zu einem metabolischen Jetlag. Auf molekularerEbene ist die Verdauung dann sofort durcheinander.Auch wer ständig Gemüse ist, tut sich keinen Gefallen.Natürlich sind viele kleine Rohkost-Bowls am Tag besserals lauter Currywürste, aber es ist nicht wirklich gesund.Früher hieß es, mehrere kleine Mahlzeiten am Tag seienbesonders gut. Das stimmt aber gar nicht. Im Zweifel istes immer besser, nichts zu essen und die Darmbakterienmal in Ruhe zu lassen.
Auf welche Prozesse im Körper hat das Mikrobiom desDarms Einfluss?Wahrscheinlich auf alle. Es spielt auch bei immunologi-schen Erkrankungen eine maßgebliche Rolle – vonAllergien bis zu Multipler Sklerose. Das Mikrobiom istsehr wandelbar: Wenn Sie mit jemandem zusammenwoh-nen, dann gleichen sich die Mikrobiome über die Zeit an,weil Ökosysteme immer miteinander im Austausch sind.Das, was wir essen, bestimmt, welche Bakterien sichin unserem Darm wohlfühlen und vermehren. Deshalbhaben Bauchspeck-Esser ein anderes Mikrobiom alsSpinat-Esser. Stellt man die Ernährung um, gibt esschnell neue Mitbewohner im Darm. Über dieses Organgibt es noch viel zu lernen.
Die Fragen stellten Melanie Mühl und Kai Spanke.
Der Mediziner Andreas Michalsen über Fehler bei der Ernährung, die Heilkraftdes Fastens, Rote Bete als Blutdrucksenker und Alterung durch Zucker
Hat selbst mal zu süß gegessen: Andreas Michalsen ist Chefarztder Abteilung Naturheilkunde im Immanuel-Krankenhaus Berlinund Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkundeam Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheits-ökonomie der Charité. Gerade ist sein Buch „Mit Ernährungheilen. Besser essen. Einfach fasten. Länger leben“ erschienen.
„Auch an Grünkohl und Haferkann man sich gewöhnen“ „Das beste Fotolabor
Hinter Acrylglas, gerahmt oder als großer Foto-Abzug. Made in Germany – von Menschen,die Fotografie lieben. Wir sind stolz auf mehr als 100 Testsiege und Empfehlungen! EinfachFoto hochladen und Ihr Wunschformat festlegen, sogar vom Smartphone.
Ihre schönstenMomente ineinzigartiger Galerie-Qualität.
WhiteWall.deStores in Berlin / Düsseldorf / Frankfurt / Hamburg / Köln / München
Alle
Rech
te, Ä
nder
unge
n und
Irrtü
mer
vorb
ehalt
en. W
hite
Wall
Med
ia Gm
bHEu
ropa
allee
59, 5
0226
Frec
hen,
Deut
schl
and ©
Phot
o by G
eo D
ays
82
Grüßßü eaussu
REISE
Wer an Brookkllyyn ddenkt, dem fällt zunächstWilliamsburg ein. Aber auch Brooklyn
Heights und Cobble Hill haben viel zu bieten.Von Jennifer Wiebking
DDDiese Promenadeisttt ein New YorkerKlllK assiker – undlieeegt in Brooklyn.Ennndlich hat manauuuch die fünf Piersammm Brooklyn BridgePaaark auf Vordermanngeeebracht. Im Sommer200018 wurde zuletztPiiier 3 fertig, einPaaark auf Stelzen imWWWasser zwischenPiiier 2 (Sportplätze)unnnd Pier 4 (Strand).
Wenn man alleinunterwegs ist undbei „Watty & Meggin Cobble Hill zuMittag isst, brauchtman nicht einmaldas Smartphone zurUnterhaltung. DieGespräche an denTischen, die draußeneng beieinanderstehen, sind vielspannender.
Shen Beauty, einer der bestenSchönheitsläden der Stadt, liegtin Brooklyn, und das ist eineÜberraschung. Die manikürteund zurechtgeföhnte KllK ientelverlässt Manhattan schließ-lich noch immer ungern. FürZauberstaub von Goop, alsoGwyyw neth Paltrows Lifestyle-marke, ist hier auch gesorgt.
KllK eine Erinnerung daran,in welcher Stadt man ist:Bei Perelandra NaturalFood in Brooklyn Heightsgibt es keine schlichteGuacamole, sondernChimichurri, ChashewQueso und Tofu Ricotta.
KllK ingt seltsam:„Malai“ in CobbleHill mischt dem Eiindische Gewürzebei. Die Sorten„Sea Salt Vanilla“und „Rose withCinnamon RoastedAlmond“ schmeckenzwar kein bisschenwie Tikka Masala.Aber trotzdemrichtig gut.
Brooklyn Heights, New Yorksältester Vorort, ist bekannt fürseine Brownstones. TrumanCapote hat auch in einemgelebt. Seinen Essay darüberbegann er 1959 mit dem Satz:„I live in Brooklyn. By choice.
In der Brooklyn Historical Society erinnert die BildhauerinMeredith Bergmann mit „Pinky“ (2010) an den Kampfdes Predigers Henry Ward Beecher gegen die Sklaverei. Er„kaufte“ Pinky 1860 auf einem Sklavenmarkt zum Preis von900 Dollar, um den Horror der Sklaverei zu zeigen. Späternahm Pinky ein Studium auf.
gggg“
tttt
rrrr
n
s
nnnn
r
:.“
SSSSSSSSiiiiÜÜÜ
Gäbe es so etwas wie ein königliches Gütesiegel, der Landschaft dernordspanischen Provinz Asturien wäre es sprichwörtlich sicher:Bereits König Alfons II. von Asturien durchquerte sie zu Beginn desneunten Jahrhunderts auf dem Weg in das heutige Santiago deCompostela, um das gerade erst entdeckte Grab des Apostels Jakobuszu besuchen – quasi als erster Pilger. Abertausende Gläubige taten es
ihm im Laufe der Jahrhunderte gleich, aus demschlichten Grabtempel, den der König bauenließ, ist längst eine Kathedrale geworden, derWeg dorthin freilich ist derselbe geblieben: DerCamino Primitivo, einer der vielen Jakobswege,die sich heute durch Spanien ziehen, ist mitmehr als tausend Jahren der älteste und mit340 Kilometern der kürzeste der Wege. Eineeinfache Übung also? Der Blick auf die Kartezeigt enge Höhenlinien und verspricht vieleGipfel. Kein Sonntagsspaziergang also. Diesportliche Herausforderung ist jedoch nureiner der Aspekte.
Die innere Einkehr kommt von selbstSchon am Start des Camino Primitivo imnordspanischen Oviedo, der Hauptstadt vonAsturien, locken am Horizont die Berge. Nochein wenig Sightseeing, zum Beispiel die maleri-sche Altstadt oder die präromanischen Kirchenaus dem neunten Jahrhundert, noch ein Glas
Sidre – Apfelwein, wie er typisch ist für die Region –, dann geht es losan der Kathedrale von San Salvador mitten im Ort.
Üppiges Grün säumt den Weg, der über einige typische Kleinstädteund Dörfer führt. In Salas beispielweise, das mit seiner perfekten Alt-stadt samt Burg auf mehr als tausend Jahre Geschichte zurückblickt.Wer in Obona einige hundert Meter vom Weg abweicht, darf sich vonder geheimnisvollen Stimmung des verlassenen Klosters Santa Maríala Real de Obona überraschen lassen, das bereits im Jahr 780 ge-gründet wurde. Auch Pola de Allande, wenige Kilometer weiter, ist einhistorisches Highlight. Auch w 730 Ei h ähl l kes doch gleich mit mehreren KirPalast, dem Palacio de Cienfue
Zwischendrin geht es berwunschene Wälder, über Berg
Puerto de Palo mit seinem sagenhaften Weitblick – entlang groberSteinmauern, gedrungener Bauernhöfe, die Dächer mit Steinschindelngedeckt, und durch einsame Weiler wie Montefurado.
Naturerlebnis mit NachweisZwölf Tage brauchen diemeistenWanderer. Gläubigmussman übrigensnicht sein, um mit dem Jakobsweg zu liebäugeln. Der eine oder anderemetaphysische Gedanke stellt sich ob der weiten Landschaften undspektakulären Aussichten ganz von selbst ein – und die geistige Er-holung sowieso.
Ein gewisser Minimalismus ist Pflicht: Wie schon die ersten Pilgerträgt man schließlich alles auf dem Rücken. Da fällt es nicht schwer,sich in die frühen Pilger des Mittelalters hineinzuversetzen. Einenkleinen, aber bedeutenden Unterschied gibt es allerdings schon:Am Abend wartet heute nach jeder Etappe eine warme Dusche inder Herberge, eine üppige Mahlzeit der herzhaften, asturischenKüche – und oft auch noch der Spaziergang durch besagte lauschigeStädtchen.
Wichtig sind diese Orte übrigens nicht nur der Idylle und Historiewegen: Vielesmag unterwegs auch heute noch an Bedeutung verlieren –nicht jedoch der Pilger-ausweis „Compostela“, derin jeder Herberge undDorfkneipe abgestempeltwird. Er bescheinigt demWanderer, dass er denWeg wirklich zu Fuß zu-rückgelegt hat. Manch-mal reicht es aber auch,die Wanderer einfach nuranzuschauen. Wer soentspannt ist, der musswohl über den CaminoPrimitivo gekommen sein.
W i I f R i fi d Si i i d
Alles Strand, Sonne und Meer? Spanien kann auch anders. Zum Beispielin den rauen Landschaften am Camino Primitivo im Norden des Landes.
wenn es nur 730 Einwohner zählt, locktrchen und sogar einem veritablenegos de Peñalba.gauf, bergab, durch ver-gwiesen, vorbei am Pass
Weitere Infos zur Region finden Sie unterwww.asturientourismus.de
ASTUR IEN
Santiagode Compostela
Camino Primitivo
OviedoGrau/Grado
Salas
Tinéu/Tineo
Pola deAllande
Berducedo
Bourres/Borres
Grandasde Salime
Puerto del Acebo
V.i.S.d.P. SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓÓNY PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DELPRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. –Laboral Ciudad de la Cultura,Calle Luis Moya Blanco, 261 –33203 Gijón, Asturias, Spanien
84 WERKSTATT
FOTO
SF
RA
NK
RÖ
TH
,HE
RS
TE
LLE
R
a sage noch einer, Journalistenkönnten nichts bewegen. Ohneden amerikanischen Motorjour-
nalisten Bob Hall jedenfalls gäbe es denMazda MX-5 wohl bis heute nicht. Hallwar es, der im Jahr 1979 den damaligenEntwicklungsleiter von Mazda, KenichiYamamoto, von der Idee überzeugte, einenkleinen Sportwagen in der Tradition derenglischen Roadster wie Lotus Elan oderMG B zu bauen. Es dauerte dann nochfünf Jahre, bis das Projekt tatsächlich an-gegangen wurde, und weitere fünf Jahrevergingen, bis der Roadster fertig war undauf einer eher unbedeutenden Automessein Chicago Premiere hatte.
Bob Hall war da schon Angestelltervon Mazda geworden und hatte das Kon-zept durchgesetzt, an dem noch heute fest-gehalten wird: Motor vorne und Antriebhinten, ein enges Cockpit für zwei, manu-elles Stoffvvf erdeck, kleiner Kofferraum.Alles andere wäre auch Verrat an der Sachegewesen. Tatsächlich hatte es bereits Plänefür Frontantrieb oder Mittelmotor gege-ben, das Projekt mit dem internen Code729 LWS aber setzte sich durch.
In den ersten Berichten überschlugsich die amerikanische Presse vor Begeiste-rung. Die Zustimmung wuchs noch nachden ersten Probefahrten, zu denen auchdeutsche Journalisten eingeladen waren.Das Magazin „Auto, Motor und Sport“ließ sich gar dazu hinreißen, den kleinenMazda mit einem Porsche 911 Cabrio zu
vergleichen. Und das, obwohl der MX-5gerade mal 115 PS hatte – und der 911erzu dieser Zeit satte 231.
Zur IAAAA im Jahr 1989 schaltete MazdaDeutschland Anzeigen mit der Schlagzeile:„Der Roadster lebt!“ Auf der Messe stachder Zweisitzer alle anderen Neuheiten aus.Als der MX-5 im Frühjahr 1990 bei dendeutschen Händlern bestellt werden konnte,war er im Nu ausverkauft, bei einem Basis-preis von 35.500 Mark. Mehr als 10.000Bestellungen gingen ein. Obwohl dasKontingent für Deutschland schon von2000 auf fast 5000 aufgestockt wordenwar, gingen viele Fans leer aus.
Kaufvvf erträge wurden gehandelt wiesonst bei Mercedes, manche versuchten inden Vereinigten Staaten an ein Fahrzeugzu kommen, und es war wohl auch der
eine oder andere Interessent dabei, dernicht kaufte, weil er sich für das Autobegeisterte, sondern für das Geld, das erdamit zu verdienen hoffte.
Der MX-5 bewährte sich später auchin allen Dauertests. Er war eben ein solidesjapanisches Auto, zuverlässig bis zurSelbstverleugnung. Dabei machte er Spaßwie kein anderes. Er wurde geliebt, weil erdas Fahren wieder zum elementaren Erleb-nis machte und Kurven zum großen Ver-gnügen wurden. Nur mit der Heckscheibeaus Plastik gab es hin und wieder Ärger.
Die Konkurrenz verfolgte den Erfolgmit Interesse. BMW und Mercedes-Benzarbeiteten bald mit Nachdruck am Z3 be-ziehungsweise am SLK, wobei der mit sei-nem klappbaren Stahldach streng genom-men gar nicht in die Roadster-Kategorie
Vor 30 Jahren begeisterte Mazda mit dem MX-5 die Autowelt – und begründetedamit die Rückkehr der Roadster. Von Boris Schmidt
OFFEN FÜR ALLA LE
Guter Weg: Der MazdaMX-5 wird 30 Jahre alt.Das Jubiläums-Sondermodellträgt Racing-Orange.
Liebe auf den ersten Blick: Auf der IAA 1989 war der MX-5 so begehrt wie keine andere Neuheit.
D
fiel. Der Z3 startete schließlich 1995, derSLK 1996. KllK appscheinwerfer wie dererste MX-5 hatten sie beide nicht, undein Hardtop mit Glasfenster für die kaltenTage gab es für den MX-5 schon seit 1991.
Nach fünf Jahren folgte die erste inten-sive Überarbeitung. Aus 115 PS wurden131. Damit hatte der 1,9-Liter-Vierzylin-der-Motor mit den 990 Kilogramm nochleichteres Spiel, und die 200-km/h-Markefiel, sobald es leicht bergab ging. ABS undAirbags waren nun ebenfalls zu haben.Dem neuen SLK und dem Z3 setzteMazda 1997 die zweite Generation desMX-5 entgegen. Die KllK appscheinwerferwaren passé, das Verdeck bekam ein Glas-fenster, Innenraum und Karosserie wur-den überarbeitet. Der 1,9er-Motor hattenun 140 PS und übertraf so die 200-km/h-Marke nicht nur bergab. Eine Sensationwar der Einführungspreis in Deutschlandim Frühjahr 1998: 35.500 Mark – genauwie acht Jahre zuvor. Und das Schaltgetriebehatte jetzt sechs Gänge.
Im Mai 2000 stellte der MX-5 mit531.890 bis dahin gebauten Einheiteneinen Produktionsrekord für zweisitzigeoffene Sportwagen auf. 2003 wurden inJapan 200 MX-5 als Coupé vermarktet,heute sind es gesuchte Einzelstücke. Als2005 die dritte Generation auf dem Gen-fer Automobilsalon an den Start ging, lagdie Produktionszahl schon bei 800.000Einheiten. Seither wird der MX-5 auch ineiner Version mit Stahl-KllK appdach offe-riert. Immerhin 40 Prozent der Kundenbevorzugen dieses Modell. Das 900.000.Auto ging im Februar 2011 an einen Kun-den in Deutschland.
Heute ist Mazda stolz auf mehr als1,1 Millionen verkaufte Roadster. Das isteinzigartig. Die vierte Generation, seit2015 auf dem Markt, schreibt die Ge-schichte fort: Der Fahrspaß ist der gleichewie 1989. Enger Kontakt zur Fahrbahnund zum Auto, Kurven sind eine Lust undkeine Last, dank geringem Gewicht sindkeine extremen Motorleistungen für or-dentlichen Vortrieb nötig, und sobald dieAußentemperaturanzeige zweistellig wird,bleibt das Verdeck unten.
Mit 1000 Kilo Leergewicht ist dervierte MX-5 kaum schwerer als der erste.Wie bisher sind Motorhaube und Koffer-raumdeckel aus Aluminium, jetzt sind eszudem auch die vorderen Kotfllf ügel. DerAnteil des Leichtmetalls bei der Karosserie-struktur steigt von praktisch nicht vorhan-den auf immerhin neun Prozent. 3,91Meterist das Cabriolet 2019 kurz, 1989 waren esacht Zentimeter mehr. Das Dach wird wieimmer mit einem Handgriff nach hintengeworfen oder hervorgeholt, wenn dernächste Schauer droht.
Neu bei der vierten Generation: DerMX-5 hat einen italienischen Verwandten.Fiat war so schlau und hat sich mit Mazdaauf eine Kooperation geeinigt. Der Fiatoder Abarth Spider ist mehr oder wenigertechnisch identisch, nur benutzt Fiat eigeneMotoren.
Im Jubiläumsjahr beginnen die Preisefür den MX-5 mit 132 PS aus 1,5 LiternHubraum bei 23.950 Euro. Das Sonder-modell zum 30. Geburtstag, in Racing-Orange, mit 184 PS und 2,0-Liter-Motor,ist so gut wie vergriffen. 34.190 Euro ste-hen dafür zu Buche. Damit ist man fastwieder am Startpreis von 1989 angekom-men. Nur eben in Euro.
86 FRAGEBOGEN
Was essen Sie zum Frühstück?Frische Früchte mit Schweizer Joghurt.
Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?Ich kaufe Kleidung, sofern ich Kleidung brauche,immer nur in der Freizeit, das heißt entweder auf Caprioder im Engadin. Bestimmte Marken bevorzuge ichnicht, nur die Unterwäsche ist von Zimmerli.
Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?Ein ungefähr 40 Jahre alter Pullover von Hermès. Derist so fein gestrickt, dass ich ihn immer bei mir habe,auch im Rucksack. Darum ist er so zerknittert, dass mangar nicht merkt, dass er zerknittert ist.
Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?Heute früh. An einen Geschäftspartner und an meineKinder. Ich habe mehrere Füllfederhalter und – ohne zuübertreiben – an allen meinen Arbeitsplätzen mindestens100 Buntstifte. Und die benutze ich permanent, fürmeine tägliche Arbeit und auch zum Briefeschreiben.Ich bin der einzige von meinen 90 Mitarbeitern, derkeinen Computer hat oder auch benutzt, weil ich mir daszeitlich gar nicht leisten kann. Ich bin bei der Gestaltungviel schneller mit der Hand.
Welches Buch hat Sie im Leben am meisten beeindruckt?Ich glaube Italo Calvino: „Sechs Vorschläge für dasnächste Jahrtausend“. Das lese ich mindestens zwei Malim Jahr.
Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?Ich lese ausschließlich auf Papier und jeden Morgen dieF.A.Z., gefolgt von einigen wenigen Minuten „Corrieredella Sera“. Darin lese ich nur – wie wohl die meistenitalienischen Männer – alles über meine Lieblingsfuß-ballmannschaft, Inter Mailand. Das dauert zwei bisfünf Minuten.
Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?Smalltalk kenne ich nicht. Ich bin Südtiroler undverhalte mich wie ein Bergbauer: Ich sage immer, wasich denke. Das heißt, es gibt keinen Smalltalk.
Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?Bei dem Bergsteigerfilm „Free Solo“. Er handelt von derBesteigung des El Capitan im Yosemite-Nationalparkohne Seil und ist einfach Wahnsinn.
Sind Sie abergläubisch?Nein.
Worüber können Sie lachen?Über alles, was komisch ist. Ich schätze den neapolitanischenHumor. Der Neapolitaner hat eine Lebenseinstellungund -auffassung, die diametral zu der der Deutschen ist.Demzufolge fühle ich mich der Idee sehr nahe, dass dasLeben ein Spiel ist und aus Leichtigkeit besteht.
Ihre Lieblingsvornamen?Konstantin und Leopold – die Namen meiner Söhne.
Machen Sie eine Mittagspause?Ja. Wir haben eine Studioküche, die frei ist für alleMitarbeiter, damit sie sich zumindest einmal am Tag
austauschen können. Ich ziehe mich aber lieberzurück und esse eine halbe Stunde allein in meinemBüro, um wieder zu mir selbst zu finden.
In welchem Land würden Sie gerne leben?Italien.
Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?Frische Früchte und Gelbe Rüben.
Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?Ich besitze kein Auto. Ich habe ein Klappfahrrad, mitdem mache ich alles. In meiner Jugend aber war ichRennfahrer. Mit 14 habe ich mich heimlich an einerRennfahrerschule zuerst am Salzburgring, dann inZeltweg und schließlich in Watkins Glen eingeschrieben.Ich liebe nach wie vor die Geschwindigkeit, finde esaber absolut inakzeptabel, im Individualverkehr heutenoch eine Blechkiste zu besitzen.
Was ist Ihr größtes Talent?Das müssen andere entscheiden.
Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?Mit dem Mountainbike schnell bergab fahren.
Welcher historischen Person würden Sie gerne begegnen?Leonardo da Vinci. Ein Universalgenie, wie es zurRenaissancezeit noch möglich war, in unsererdemokratischen Epoche aber, die ich natürlich sehrschätze, offenbar nicht mehr. Es ist einfach nicht mehrmöglich, Probleme holistisch kreativ zu lösen, wie esLeonardo gelungen ist. Was war er? Maler, Bildhauer,Techniker – es lässt sich nicht sagen. Das letzteUniversalgenie war mein Lehrmeister Ettore Sottsass.Er war Fotograf, Schriftsteller, Architekt, Designer,hat mit Glas gearbeitet, mit Keramik, und das immerauf allerhöchstem Niveau.
Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?Schmuck nicht und eine Uhr nur während der Arbeits-zeit. Abends ziehe ich sie sofort aus.
Haben Sie einen Lieblingsduft?Vétiver von Guerlain.
Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?Ein Urlaub an der Skelettküste in Namibia, einerder ältesten Landschaftsformationen der Erde an derGrenze zu Angola. Dort liegen Hunderte vonSchiffswracks. Die Schiffbbf rüchigen verdursteten,weil dahinter die Wüste Namib beginnt.
Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?In der Oper „Aschenputtel, oder Der Triumph desGuten“ von Gioachino Rossini in der Mailänder Scala.
Was fehlt Ihnen zum Glück?Nichts.
Was trinken Sie zum Abendessen?Hagebuttentee. Und manchmal ein Glas Nero d’Avolavom Ätna.
Aufgezeichnet von Peter-Philipp Schmitt.
Sein Name ist untrennbar mit derDesigngruppe Memphis verbunden.Matteo Thun, der einem öster-reichischen Adelsgeschlecht ent-stammt und eigentlich MatthäusAntonius Maria Graf von Thunund Hohenstein heißt, traf alsStudent in Los Angeles den italieni-schen Designer Ettore Sottsass.Sie wurden Freunde und gründeten1980 in Mailand die GruppeMemphis mit, die mit den Regelndes Funktionalismus brach. Thun,der 1952 in Bozen geboren wurde,zählt zu den bedeutendsten Designernund Architekten der Welt. Alleindreimal wurden seine Arbeiten mitdem Design-Oscar „Compassod’Oro“ ausgezeichnet.
„EINENCOMPUTERKAAK NNICHMIR NICHT
LEISTEN“ZEITLICH
FOTO
NA
CH
OA
LEG
RE
Freiheitbeginnt mit
Seit 70 Jahren s