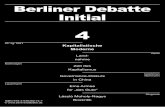“É bom porque é ruim!”: Considerações sobre produção e consumo de cultura trash no Brasil
Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]
Transcript of Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]
1
Unser tägliches Brot: Speisegebote, Luxuskonsum & Essstörungen
Bibelwissenschaften, klassische Archäo-logie, Psychologie und Umweltwissen-schaften präsentieren in dieser Ausstel-lung gemeinsam Einblicke in Teilbereiche der aktuellen Forschung. Die Ausstellung im Museumskabinett bietet sechs thema-tische Schwerpunkte. Neben der „Herstel-lung und Aufbewahrung der Nahrung im Al-ten Orient“ und dem „Stillen im Altertum“ werden auch folgende Inhalte vorgestellt: „Nahrung – Speise der Götter & göttliche Gabe“, „Festfeier und Fasten“ sowie „Ess-störungen (Beeinflussung des Selbstbildes junger Frauen)“. Aber auch Zeugnisse zur sagenumwobenen Totenspeisung sind Teil der Ausstellung. Antike und moderne Ob-jekte laden zu einer Reise durch die Zeit ein. Alltägliche Fragen aus Kultur und Ge-sellschaft kommen genauso in den Blick.
EinBlick in vergangene Zeiten
Versorgung, Feinschmeckertum und Ge-nuss von Speisen spielen nicht nur in un-serem Alltag eine grosse Rolle – schon vor Tausenden von Jahren waren sie von be-sonderer Bedeutung. Die Hochkulturen der Antike (die Ägypter, Hethiter, Assyrer, Babylonier) – und auch die Israeliten in-mitten dieser Völker – kannten die Sorge um das „tägliche Brot“, verstanden Reich-tum von Speise als göttlichen Segen und übten zu speziellen Zeiten im Jahr Enthalt-samkeit von Nahrung (Fasten).
Die Präsentationsvitrine
Besonders eindrückliche Exponate wer-den im Foyer gezeigt. Im unteren Register ist eine 3000 Jahre alte Reibstein-Installa-tion ausgestellt. In Wirklichkeit handelt es sich dabei aber um ein antikes Multifunk-tionsgerät (vgl. unten). Im mittleren Tablar ist die aktive Verwendung des Reibsteins eingefangen: Eine kornmahlende Ägypte-rin bei ihrer dynamischen Arbeit (Abb. 1), bei der die Anstrengung gross, aber der Er-trag nicht gerade üppig ausfiel. An höchs-ter Stelle in der Vitrine thronen Göttinnen-figuren. Sie sind durch ganz unmoderne Schönheitsideale gekennzeichnet. Die brei-
Begleitbroschüre zur temporären Ausstellung
„Ernährung in biblischer Zeit......und heute“
Abb. 1: Eine kornmahlende Ägypterin
2
ten, vollen Formen der kleinen Figur verge-genwärtigen den „Segen der Beleibtheit“: Wer viel zu essen hatte, konnte sich Reser-ven (eben auch am eigenen Körper) zule-gen (Abb. 2). Die grosse Figur, wahrschein-lich eine schwangere Göttin, trägt auf dem Kopf ein eigentümliches Rüttelgefäss für die antike Butterherstellung (Abb. 3).
Vitrine 1: Herstellung und Aufbewahrung der Nahrung im Alten Orient
Der obere Teil der Vitrine verdeutlicht ei-nige wichtige Grundkoordinaten zum The-ma der Ausstellung. Ein Relieffragment aus der Amarnazeit (1350-1336 v.Chr.) zeigt eine Alltagszene: Vater und Sohn (einen Erntesack tragend), die sich vielleicht auf dem Weg zum Feld befinden. Rollsiegel il-lustrieren die Bedeutung der agrarischen Themen: Pflug-, Aussaat- und Ernteszenen
Abb. 2: Eine beleibte Sitzfigur (Schaar Ha-Golan-Typ)
Abb. 3: Die schwangere Göttin von Gilat (Israel)
3
(inkl. der wichtigen Sternkonstellatio-nen) sind ebenso vertreten wie Darstel-lungen von Dattelpalmen und einem Mann, der einen Schaduff (al-tes Bewässerungsgerät) zum Wasserschöpfen einsetzt. Ein Siegel ist mit einer Vielzahl von Herdentie-ren komplett ausgefüllt, ein anderes Stempelsie-gelamulett zeigt eines der wichtigsten antiken Trans-portmittel: den Esel. Er kann grosse Lasten transportieren. Zugleich wurde er aber auch als antikes „Taxi“ eingesetzt – für den, der es sich leis-ten konnte. Würdenträger in Palästina/Israel (so auch Jesus am Palmsonntag) reiten auf dem Esel – er ist ein Presti-geobjekt. Viel häufiger sind aber die Esel schwer bepackt mit Säcken und Taschen dargestellt (Abb. 4). Auch dieses Bild ist Ausdruck des Segens. Man wünscht sich den Segen des umtriebigen Handels in Form von stets befüllten Speichern und voll beladenen Lasttieren zum Transport:
„Unsere Speicher sei-en gefüllt, sie mögen Nahrung spenden von jeglicher Art!“ (…) „Unser Lastvieh ist allezeit beladen“ (Ps 144,13f).
Neben zwei Terrakotta-Plaketten, die Schlachtung und Jagd als zentrale Ele-
mente der Fleischbeschaffung dar-stellen, ist auch ein Rollsiegel mit
einer umfangreichen Jagdszene ausgestellt. Besonders inhalts-reich ist die Darstellung der beiden Traubenträger auf einer byzantinischen Öllampe (Abb. 5, Mitte des ersten Jt. n. Chr.).
Es liegt ein direkter Bezug zu ei-ner Erzählung im 13. und 14. Kapi-
Abb. 4: Gravierte Platte: Eselstreiber und
beladener Esel
EnergieFood Waste
Hunger ErdölMassenproduktion
KonsumMonokulturen
TierhaltungAbfall
UmweltverschmutzungGlobalisierung
WasserGesundheit
ErosionCO2
EnergiePlastik
Stichwortsammlung zum Thema„Umwelt damals und heute“
Abb. 5: Byzantinische Öllampe mit atl. Motiv
4
tel des Buchs Numeri (4. Mose) vor: Josua und Kaleb brachten von ihrer Kundschaf-terreise eine grosse Traube auf einer Stan-ge mit. Sie ist Sinnbild für die Fruchtbarkeit des verheissenen Landes (Ka-naan), dem Land, in dem auch „Milch und Ho-nig“ fliessen. Ein klei-ner Spitzmaussar ko-phag am Rand der Vitrine soll auf die Problematik der Insek-ten als Lebensmittelkon-sumenten und Schäd-linge verweisen. Die Spitz maus, war wegen ihres Appetits auf Insekten hochgeschätzt in den antiken Kul-turen und darum auch teilweise verehrt. Im unteren Vitrinenteil wurde von der Ko-ordinationsgruppe Umweltwissenschaf-ten (Prof. H. Völkle und Chr. Rothenberger) ein kleines Modell bereitgestellt, welches zum Nachdenken anregen soll: „Ernährung ist wesentlich“ – so beginnt der Kommen-tartext und fährt fort: „Die menschliche Ernährung besteht aus Wasser und Nah-rungsmitteln. Sie ist nötig für den Aufbau des Körpers und um seine Lebensfunktio-nen aufrecht zu erhalten.“ Dies gilt nicht erst seit gestern sondern auch für die Men-schen im Altertum. Versorgung mit Eiweis-sen, Kohlenhydraten, Fetten und mit Was-ser – vor allem aber deren Beschaffung – machen einen ganz erheblichen Teil der Lebenszeit unserer Vorfahren aus. Aber ein Vergleich von antikem und heutigem Leben ist nicht einfach: Während einige
Herausforderungen sich ähnlich gestalten, haben sich trotzdem einige Grundlagen ra-
dikal verändert. Die alten Kulturen stan-den auch vor Problemen wie der
Versalzung der Böden oder sie hatten z.T. mit den
schlimmen Folgen der intensiven Ro-dung zu kämpfen.
Hin gegen sind CO2-Emissionen, Überpro-
duktion oder Plastikmüll eindeutig als moderne Zivi-
lisationsprobleme einzuord-nen. Die Grafik (Seite 3) nennt
einige der spannenden Vergleichspunk-te zum Thema „Umwelt damals & heute“. Jeder Begriff kann untersucht und dis-kutiert werden: Gilt er nur für die Ge-genwart oder hatte er vielleicht auch für das Altertum eine besondere Relevanz? In der Vitrine ist zudem eine Publikati-on zur Umweltethik eingestellt. Es stellt sich nämlich die Frage, wie die heutige Gesellschaft mit der Umwelt umgeht: Sie muss sich zwischen Bewahren oder Zer-stören entscheiden. Gerade in dieser Fra-ge hat die Bibel mit ihrer langen Tradition einige sehr wichtige Positionen anzubie-ten, die selbst nach Tausenden von Jah-ren für den Diskurs von Bedeutung sind. Im Hintergrund des unteren Vitrinenteils sind wiederum zwei antike Stücke zu be-wundern: Ein Vorratsgefäss und ein ge-stempelter Krughenkel (Abb. 6). Auf ihm ist nicht nur eine Flügelsonne (königliches Symbol in alttestamentlicher Zeit) sondern
Abb. 6: Siegelung auf einem Henkel: „lmlk“ (für den König)
5
auch eine Inschrift zu erkennen. Wenn man diese nun entziffert, lautet die hebräische Buchstabenfolge: lmlk – für den König. Es handelt sich also um ein vom König fest-gesetztes Hohlmass, in welches Güter (Ge-treide, Früchte) eingefüllt wurden. Diese wurden dann an den König und seine Ver-waltungsstandorte weitergeleitet. Solche Stempelungen auf Henkeln kennt man sehr gut aus dem Hügelland südwestlich von Je-rusalem (aus der sogenannten Schephela). Es stellt sich nur die Frage: Wer ist dieser König, für den die Güter bestimmt sind? Ist es der judäische König, der in Jerusalem re-sidierte, oder ein König der Philister (der in Gad oder Gaza einen Hofstaat unterhielt)? Oder sind die gefüllten Behältnisse als Tri-butabgaben zu verstehen, die dem assyri-schen Grosskönig zustanden? Dann wäre er der auf den Stempeln genannte König. Das Rätsel ist bis heute nicht vollständig gelöst.
Vitrine 2: Stillen im Altertum
Diese Vitrine erzählt eine Geschichte „zwi-schen Muttermilch und Brei“, namentlich mit der Frage, wann die Milchflasche ihren Siegeszug in der Kinderstube antrat. Die Gestaltung wurde vom Institut für Klassi-sche Archäologie (Prof.in V. Dasen, SNF-As-sistentin S. Jaeggi in Zusammenarbeit mit Céline Dubois und Lucinne Rossier) über-nommen. Zunächst deutete man die aus-gestellten Behälter (aus dem 1. Jt. v. Chr.) als Einfüllhilfe für Öllampen; es konnten in-zwischen aber einige Indizien beigebracht
werden, dass es sich um Babyflaschen und antike Milchpumpen handelt (Abb. 7). Nicht alle müssen auch wirklich verwendet worden sein – denkbar sind auch Szenari-en symbolischer Verwendung, die aktuell untersucht werden. Das interdisziplinäre Projekt beschäftigt sich auch mit der Typo-
logie solcher Gefässe und mit der Analy-se der Rückstände in den antiken Fundstü-cken: Ist vor vielen Jahrhunderten wirklich Milch durch die Tülle geflossen oder war es doch eine ganz andere Flüssigkeit, die da-mit umgefüllt wurde? Gerade wenn solche Objekte in Gräbern gefunden wurden, sind Untersuchungen zu den Bestatteten selbst sehr aufschlussreich. Die Entwöhnung, die manchmal früher oder später, abrupt-brutal oder langsam-behutsam verlaufen konnte, war ein entscheidender Schritt für das heranwachsende Kind. Die späte-re Nahrung, meist Getreide(brei), konn-te aber verunreinigt sein und sich in frü-
Abb. 7: Römische Tüllenflasche (eine antike Nuckelflasche?)
6
hen Lebensstadien (in bestimmten Fällen) schädlich oder tödlich auswirken. Damit ist der Bereich der antiken Krankheitskunde (Paläopathologie) berührt – Kindersterb-lichkeit war in der Antike sehr hoch. Im oberen Teil der Vitrine sind zudem Grab-beigaben aus einem Kindergrab zu sehen:
Vielleicht handelt es sich hierbei um Baby-
geschirr, wie es heu-te auch noch verkauft wird. In der rechten oberen Ecke ist die ak-tuelle HighTech-Stu-
fe der Milchzubereitung ausgestellt: Ein Milch-bereitungsautomat, der – ähnlich wie es
bei der Kaffeezube-reitung der Fall ist – mit Hil-fe von Kapseln bestückt wird. Aber auch die
religiösen Kom-po nenten dieses Themas finden Berücksichti-gung (vgl. die stil len den Göt-tinnenfiguren).
Vitrine 3: Nahrung für die Götter und als göttliche Gabe
Schon in der vorherigen Vitrine konnte man das Thema der göttlichen Segensgabe kennenler-nen: Muttergottheiten, die kleine Kinder (häu-fig Götter, Halbgötter oder Könige) mit Mut-termilch versorgen. In der dritten Vitrine ist nun ein Prototyp dieser stillenden Muttergöt-tin zu sehen: Die ägypti-sche Göttin Isis, die den Horusknaben stillt (eine sogenannte Isis lactans, Abb. 8). Als Ikone der fürsorglichen, ver-sorgenden Mutter hat sich diese Konstel-lation bis ins Christentum durchgehalten und tritt dort in der Figur der Gottesmutter Maria dem Betrachter entgegen. Sie stillt den kleinen Jesusknaben an ihrer Brust, wie schon Isis ihren „Sohn“ tausend Jah-re zuvor. In der aktuellen Installation sind nun vor dieser Bronzestatuette zwei weite-re Metallfiguren zu sehen. Es handelt sich um Opferbrotbringer (Abb. 9), die sich der Gottheit nähern. Auch Götter mussten nach antiker Vorstellung mit Lebensmitteln ver-sorgt werden. Hierzu gehört auch das täg-liche Brot für die Götter, das in Opferlisten gut bezeugt ist. Im vorliegenden Fall wer-den die Brote auf einem Tablett serviert.Diese Vorstellung hat sich auch bis in die
Abb. 8: Die Göttin Isis stillt den Horusknaben an ihrer Brust
Abb. 9: Ein Priester mit Opferbroten auf
einer Platte
7
alttestamentlichen Bü-cher Exodus und Leviti-kus hindurch gehalten. Denn dort finden näm-lich die so genannten „Brote des Angesichts“ oder „Schaubrote“ Er-wähnung. Auch die spe-ziellen Riten für diese elementare Opfermate-rie werden dargelegt. Im Weiteren wird der Segen der Brüste, wie er schon mehrmals the-matisiert wurde, beim folgenden Objekt mit anderen Segensbildern zusammengedacht .
Eine Göttin (Abb. 10), die ihre Scham öff-net (als Zeichen des Geburtssegens) wird mit Kleinkindern verbunden, die an ih-ren Brüsten gestillt wer-den. Diese beiden Aspekte verkörpern in gleicher Wei-se Segen, wie die gerade noch erkennbaren zie-genartigen Tiere, wel che auf ihren Oberschenkeln abgebildet sind: Diese fressen an grünen Baumsträu-chern. Auch die-se Ikone, die Cap-riden am Baum, steht für den Se-gen, den die Göt-
tin den Menschen zu Teil werden lässt: Frucht barkeit, Nachkommenschaft und Fül le in Flora und Fauna. Ein Doppelbild zweier Göttinnen ist ebenso in der Vitrine zu finden. Es handelt sich um die beiden griechischen Göttinnen, die aufs Engste mit Vegetation (Getreide) und Jahreslauf verbunden sind: Demeter und Persephone. Im oberen Bereich der Vitrine werden ei-nerseits Gefässe mit einem kultischen Be-zug, andererseits dezidiert Stücke mit Stiersymbolik präsentiert. Die beiden Ob-jekte am rechten Rand sind innen hohl und dienten als Libationsgefässe. Mit ih-nen konnten wertvolle Flüssigkeiten, die zum Opfern bestimmt waren, ausgegossen werden. Sie funktionieren wie eine heilige, antike Giesskanne, mit der punktgenau vor einem Götterbild ein Flüssigkeitsopfer dar-gebracht werden konnte. Dabei verstärkt die Form des Gefässes die Kraft des Opfers: Mit der Stärke des Tieres wird die einge-
setzte Flüssigkeit aufgeladen. Hier sind je ein Stier- und
ein Kamel-Libations-gefäss (Abb. 11) aus-gestellt. Die Verstär-
kung der Opfergabe gilt auch für andere Gefäs-
se, wie beispielsweise die Stier-schale am anderen Ende der Vit-
rine. Zwischen diesen Objekten sind zwei Darstellungen des göttlichen
Stiers zu erkennen. Es handelt sich um den ägyptischen Gott Apis, der zum ei-nen einmal springend als Stier auf ei-
nem Sarkophagfragment aufgemalt wurde, Abb. 11: Libationsgefäss in Form eines beladenen Kamels
Abb. 10: Die Segens-göttin aus Palästina (mit Attributen & Symbolen)
8
zum anderen um das Bruchstück einer Ste-le, die ägyptische Beter bei der Verehrung des göttlichen Apis-Stieres zeigt (Abb. 12). Es ist gut möglich, dass der Apis-Stier das Vorbild für die Wüstenerzählung vom Gol-denen Kalb im Buch Exodus (2. Mose) ist. Sicherlich war er den Israeliten in Ägypten von den dortigen kultischen Bräuchen wohl bekannt. Neben der Tatsache, dass Stie-re auch geopfert werden konnten (Fleisch- und Fettopfer), ist die Symbolik des Tieres folglich nicht nur auf die Verstärkung der Opfermaterie begrenzt. Auch als göttliche Kraft konnte er Hochschätzung erfahren.
Vitrine 4: Festfeier und Fasten
Diese Einsicht leitet direkt zur nächsten Vi-trine über: Den Tieren werden in unter-schiedlichen Situationen sehr verschiede-ne Rollen zu Teil. Einerseits können sie als „rein“ gelten und sind so auch für den Men-
schen verzehrbar. Oder aber sie können unrein sein und sind damit dem Nahrungs-kontext entzogen. Auf eine andere Wei-se sind diese Tiere unverzehrbar, wenn sie als göttliche Symboltiere gelten: Niemand würde die heilige Kuh in Indien verzehren! Alle diese Facetten – auch mit Vergleich der biblischen Passagen über Reinheit und Unreinheit – lassen sich bei den ausgestell-ten Tieren erläutern. Für Falke, Nilbarsch (Abb. 13), Ibis, Strauss und Hahn gibt es Be-gründungen, warum sie einer der o.g. Ka-tegorien zugeordnet werden. Im unteren Teil der Vitrine sind unterschiedliche Ga-benbringer mit Opfer (vgl. z.B. Abb. 14) ab-gebildet. Zudem kommt ein ganz zentrales Thema genauer in den Blick: Das Schwei-nefleisch-Verbot. Es hat sich in Judentum und Islam bis zum heutigen Tag erhalten und ist eines der bekanntesten Speiseta-bus. Möglicherweise hatte es seine Wur-zeln in den unterschiedlichen Essgewohn-heiten und Produktionsmöglichkeiten. Die Israeliten haben daraus zu einer bestimm-
Abb. 13: Der in Ägypten heilige Nilbarsch darf in Is-rael, da er Flossen und Schuppen hat, als reines Tier
verspeist werden.
Abb. 12: Fragment einer ägyptischen Stele, welche die Verehrung des Gottes Apis zeigt
9
ten Zeit diesen Kulturmarker in eine religi-öse Sphäre überführt – kein seltenes Phä-nomen in der antiken Welt. Insgesamt können an der Vitrine noch die Festtraditi-onen erläutert werden: Über das Jahr hin-weg fanden Feste mit oder ohne Einbezug des Tempels statt, die den Alltag rhythmi-sierten und einen Ausbruch aus den fest-gefügten Routinen boten. Häufig waren sie mit besonderen Speisetraditionen verbun-den (Sukkot-, Passa-, Purim- und auch das Neujahrsfest). Zugleich gab es bestimmte Zeiten, in denen die Distanz zur Nahrung gemeinsam erfahren wurde: Das Zom-Fas-ten wäre für das alte Israel ein treffendes Beispiel. In unserer heutigen Gesellschaft haben sich die Fastenzeiten (vor Ostern, aber eigentlich auch vor Weihnachten!)
erhalten. Die Muslime fasten einen Mo-nat pro Jahr (Ramadan). Im Anschluss dar-an wird die Nähe zur Nahrung mit genüss-lichen Festen wieder intensiv zelebriert.
Vitrine 5: Essstörungen. Beeinflussung des Selbstbildes junger Frauen
Nähe und Distanz zur Nahrung spielen auch in der fünften Vitrine eine besonde-re Rolle. Allerdings ist hier nicht der kul-tische Bereich betroffen, sondern die sä-kularen Bereiche unserer Gegenwart. Die vom Lehrstuhl für Klinische Psycho-logie und Psychotherapie (Prof. Simone Munsch, Dr. Andrea Wyssen) eingerich-tete Vitrine vermittelt zentrale Einsichten zu diesem Thema: Zunächst stellt sich die Frage nach Schönheitsidealen. Wie Haut-farbe und Körpergrösse, so sind auch die Körperformen unterschiedlichen Moden unterworfen. Eine schmale, sportliche Kör-perlinie, wie sie durch eine Vielzahl von Kinderspielzeug suggeriert wird, gilt mit-unter als Traumziel in der westlichen Welt. In Pakistan würde die Diskussion um schö-ne Körperlinien gänzlich anders ausfallen. In der westlichen Welt versucht man dem Ideal mit der Hilfe von harten Diäten, in-tensivem Sporttreiben und Medikamenten nahezukommen. Pillen und Tabletten sol-len die gewünschte Figur herbeizaubern. Diese Präparate werden stark und aggres-siv beworben. Auf der anderen Seite wer-den die ungesunden Lebensmittel (Süssig-keiten, Chips, Modegetränke) mindestens
Abb. 14 : Ein Opfergabenbringer,der ein Tier auf den Armen trägt
10
in gleichem Mass den Konsumenten ange-priesen. Es zeigen sich zwei Gesichter un-serer heutigen Konsumgesellschaft. Sol-che widersprüchliche Botschaften können auch in Krankheiten münden, die aktuell erforscht werden. Publikationen wie „Das Leben verschlingen“ oder Abhandlungen zum „Binge-Eating“ sind ebenso ausge-stellt, wie Mode- und Lifestyle-Zeitschriften und ein Sortiment ungesunder Nahrung. Unbalancierte Nähe und Ferne zu Speisen kann, wie gesehen, krank machen. Häufig spielt auch Unzufriedenheit mit dem eige-
nen Körper eine grosse Rolle. Ein theolo-gischer Anknüpfungspunkt in dieser Frage wäre die Bedeutung des Menschen in der biblischen Überlieferung. Jeder Mensch ist Gottesgeschöpf – in seiner Form, mit sei-nem Aussehen und ohne Vorbedingung ge liebt. Dies ist unabhängig von Körperge-fühl und Körperlinie der Fall. Die biblische
Botschaft betont dies und bietet so einen Startpunkt zur Annahme der eigenen Kör-perlichkeit und zur Selbstwertschätzung.
Vitrine 6: Die Totenspeisung
Zurück in die Vergangenheit: Nicht nur die Götter und die lebenden Menschen muss-ten mit Nahrung versorgt werden. Auch Verstorbene benötigten für eine Fortexis-tenz nach dem Tod eine besondere Art von Verpflegung. In diesem Rahmen spielt der erste männliche Nachkomme eine ganz be-sondere Rolle: Er ist für den Totenkult ver-antwortlich und hat festgelegte Aufgaben zu übernehmen, die dem Andenken und der Fortexistenz der verstorbenen Ahnen dienen. Die letzte Ausstellungsvitrine zeigt zu einem Grossteil ägyptische Objekte, weil die Vorstellung vom Jenseits in Ägyp-ten sehr stark ausgeprägt und überliefert
11
wurde. Die Ägypter hatten Tausende von Jahren vor dem Aufkommen des Christen-tums eine sehr konkrete Vorstellung vom Leben nach dem Tod, aber auch von der „Auferstehung“ der Toten am Gerichtstag. In der linken Ecke der Vitrine sind vor al-lem Vorratsgefässe aus feinem Alabaster zusammengestellt. In ihnen wurden unter-schiedliche Vorräte, aber auch feine Salben und Parfüms gelagert. Ein Fragment einer Grabwand (Abb. 15) zeigt einen Grabher-ren (neben ihm ist noch seine Frau zu er-kennen). Häufig ist der Verstorbene mit Segenswünschen in Hieroglyphenschrift umgeben: „Es sollen dir gegeben werden 1000 Ochsen, 1000 Hühnchen, 1000 Brote und auch 1000 Weinportionen.“ Aber auch für Erledigung der körperlichen Arbeit gibt es Lösungen. In der Vitrine erkennt man
eine kleine Helferfigur. Von diesen wur-den sehr viele den Verstorbenen beigege-ben. Sie heissen „Uschabti-Figuren“. Der Name leitet sich vom ägyptischen Wort für „Antwort geben“ (wescheb) ab. Die Figu-ren geben Antwort, wenn der Verstorbe-ne fragt: „Wer wird mein Feld bestellen?“ oder „Wer wird die Ernte einbringen?“ In diesem Moment treten die Uschabti-Fi-guren auf den Plan und erledigen die Ar-beit. Prominent ist auch ein Kornosiris auf-gestellt (Abb. 16). In dieser und ähnlicher Form wurden Pflanzensamen (Kresse u.a.) ins Grab gestellt und bewässert. Am drit-ten Tag sprosste neues, frisches (grünes) Leben hervor – am Ort des Todes und der Verlassenheit. Es handelt sich um ein schönes Sinn-bild für die Auferstehung. Die Vorstellung vom Wie-deraufleben nach dem Tod gehört damals wie heu-te noch in vielen Religio-nen zu den Kernaussagen.Auch der Esel begegnet uns im Grab wieder: Seine Sat-telkrüge wurden mit Korn oder anderen Materialien gefüllt. Die Botschaft ist auch hier deutlich: Reiche Ver-sorgung mit Gü-tern hat vor und nach dem Tod grosse Bedeutung.
Abb. 15: Grabrelief mit dem Verstorbenen und seiner Frau (am linken Rand),
vermutlich vor einem Opfertisch voller Gaben
Abb.16: Holzfigur eines ägypt. Totengottes
12
Zwei weitere Exponate ausserhalb der Vitrinen
Im Ausstellungskabinett sind noch zwei weitere Objekte zu entdecken: Einerseits eine weitere Reibsteininstallation (Abb. 17), andererseits ein Altar für Deposit-opfer mit gut erkennbaren Gesichtszügen. Die Reibsteininstallation mit Läufer (unte-rer Teil) und Stössel stellt in der Antike ein vielseitiges Arbeitsinstrument dar. Man kann nicht nur Reiben/Mahlen (Korn), son-dern auch die Verarbeitung anderer Güter wurde praktiziert: Das Ausquetschen von Früchten aber auch das Öffnen/Teilen von harten Gegenständen ist gut möglich. In gewisser Weise handelt es sich um ein All-zweckgerät, das wegen seiner Einsatzmög-lichkeiten Jahrtausende in Gebrauch blieb. Der Opferaltar (Abb. 18) stammt aus der Zeit um 5000 v. Chr. Im Golan wurden sol-che Stücke in grosser Stückzahl gefun-
den und sind heute in vielen Museen aus-gestellt (z.B. in Israel). Auf der Kopfplatte wurden Speiseopfer niedergelegt und so einer Gottheit geweiht. Vielleicht kann man in dem ausgearbeiteten Gesicht die verehr te Gottheit erkennen. Der Altar mit Gesichts darstellung knüpft wiederum
an die Aussagen zur Versorgung der Göt-ter an, die offensichtlich schon 7000 Jah-re alt ist. Nahrung und Versorgung (von Göttern, Tieren, Lebenden und Verstor-benen) haben offensichtlich eine lan-ge Tradition, die auch in biblischen Epo-chen und darüber hinaus bedeutsam war. Noch immer gibt es solche Traditionen in unserem Alltag – einige wenige zu erklä-ren, ist Ziel dieser Ausstellung. Aber je-der ist eingeladen, sich selbst als Forscher zu betätigen und die langen Traditionen von Nahrung und Verarbeitung im Alltag zu suchen. Die Phänomene sind zahlreich und begegnen auf Schritt und Tritt. Auch hier gilt das biblische Wort: „Wer suchet – der findet“ (Matthäusevangelium 7,7).
Bibel+Orient Museum Freiburg CH | [email protected]://www.bible-orient-museum.ch/Text und Umsetzung: Fl. Lippke | [email protected]
vers 1.9 (ind)
Abb. 17: Reibsteininstallation mit Läufer und Stössel
Abb. 18: Opferaltar aus dem Golan
![Page 1: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Lippke (2014.3a*), Ernährung in biblischer Zeit [BOM]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022214/6320809ba3cd9cf896067c01/html5/thumbnails/12.jpg)