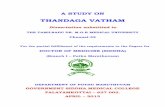Wald und Waldnutzung am Kaiserstuhl in alamannischer Zeit
-
Upload
uni-heidelberg -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Wald und Waldnutzung am Kaiserstuhl in alamannischer Zeit
LANDESDENKMALAMT BADEN-WÜRTTEMBERG
BAREARA SASSE
Ein frühmittelalterliches Reihengräberfeld bei Eichstetten am Kaiserstuhl
Mit Beiträgen von KURT W. ALT, BARBARA HOLLACK,
HANS-JÜRGEN HUNDT, MANFRED KUNTER, ELISABETH NUBER, MANFRED RÖSCH,
WERNERVACH und GARY WHITE
2001
KOMMISSIONSVERLAG · KONRAD THEISS VERLAG · STUTTGART
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4
2. 2.1 2.2
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.1.1 3.7.1.2 3.7.1.3 3.7.1.4 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.2 3.7.2.3 3.7.2.4 3.7.3 3.7.4 3.8 3.8.1 3.8.2
Inhalt
Einleitung ................................................... . Methodische Vorbemerkungen .................................. . Zur Fundgeschichte und Topographie ............................ . Friedhofsgrenzen, Störungen, Nachbestattungen und Überschneidungen .. Zur Struktur der Belegung ..................................... . Zur Verteilung von Männer-, Frauen- und Kindergräbern ........... . Übersicht über den Belegungsablauf ............................. .
Zum Bestattungsbrauch ....................................... . Grabanlagen ................................................. . Kreisgräben ................................................. .
Die Funde .................................................. . Perlen ...................................................... . Das Material ................................................. . Die Farben .................................................. . Die Formen ................................................. . Die Techniken .... . ............... . .......................... . Die Verzierungsmuster ........................................ . Chronologisch aussagefähige Perlentypen ........................ . Nadeln ..................................................... . Ohrringe .................................................... . Fibeln ...................................................... . Bügelfibeln .................................................. . Die Vogelfibel ............................................... . DieS-Fibel .................................................. . Scheibenfibeln ............................................... . Preßblechfibeln .............................................. . Die ,.Ringfibel" .............................................. . Der Armring ................................................ . Fingerringe .................................................. . Riemenschnallen und -beschläge ................................ . Frauengürtel ................................................ . Eisenschnallen ............................................... . Bronzeschnallen ............................................. . Schnallen mit Lasche oder Beschlag ............................. . Riemenzungen vom Gürtel oder Gürtelgehänge ................... . Männergürtel ................................................ . Eisenschnallen ............................................... . Schnallen aus Bunt- und Edelmetall ............................. . Saxgürtelgarnituren ........................................... . Spathagarnituren ............................................. . Die Wadenbindengarnitur ..................................... . Schuhgarnituren ............................................. . Waffen ..................................................... . Spathen ..................................................... . Saxe ........................................................ .
11 11 11 13 15 16 16
17 17 20
22 22 24 27 31 37 38 41 46 47 48 49 51 51 51 53 56 57 57 57 57 59 60 60 61 61 63 64 66 73 75 76 79 79 82
7
8
3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.9 3.10 3.10.1 3.10.2 3.11 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4 3.11.5 3.11.6 3.12
3.13 3.13.1 3.13.2 3.13.3 3.13.4 3.13.5 3.13.6 3.14 3.15
4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3
Äxte ............. -~ ........................................ . Lanzen .. .. ................... ... ........... . ...... . ... .. .. . . Pfeile ...................................... · · ·. · · · · · · · · · · · · · · Schilde ...................................................... . Reitzubehör ................................................. . Taschen und Gehänge ... . ..................................... . Taschen in Männergräbern ..................................... . Gürtelgehänge der Frauen ........................ . ............ . Geräte .. ... .................... .. ........... ·· .... ··········· Messer ...................................................... . Feuerstähle und -steine ........................................ . Pfrieme, Ahlen und Nägel ..................................... . Kämme .......... .. ...... .. ..... . ..... ... ................... . Tonwirtel ....... .. ................... . .. . ................... . Sonstige Geräte .............................................. . Gegenstände von Amulett- und Symbolcharakter, Antiquitäten, Münzen (mit einer Tabelle von Elisabeth Nuber) .... . ............. . Gefäße ..................................................... . Reduzierend gebrannte, scheibengedrehte Knickwandgefäße ........... . Rauhwandige, doppelkonische Gefäße ........................... . Beutelartige Gefäße ... ...... ......................... ..... .... . Grobe Wölbtöpfe ............................................ . Kugelige Töpfe .. ...... ... .. ................................. . Gläser ............................................. ....... .. . Tierbeigaben ................................................ . Holzreste (nach einer Untersuchung von M. Schneider) ............ .
Ergebnisse ..................... .. .................. ...... ... . Verteilung der Ausstattungsstücke auf das Sterbealter .............. . Ausstattungsstücke der Frauengräber ............................ . Ausstattungsstücke der Männergräber ................... .... .. .. . Ausstattungsstücke ausMänner-und Frauengräbern ............... . Chronologische Gliederung der Funde und Belegungsablauf ........ . Belegungschronologische Ergebnisse ............................ . Seriation der Perlen ........................................... . Seriation des Saxensembles .............. ....... ........... .. ... . Stratigraphien ................................................ . Überlegungen zum Belegungsablauf .... .. .... ............. ..... . . Die Chronologie von Eichstetten im regionalen und überregionalen Rahmen .................................................... .
88 89 90 91 92 92 92 95 98 98 99
100 100 101 102
102 106 108 109 109 110 111 111 111 112
113 113 113 115 120 120 122 126 129 130 132
133 4.4 Demographische Beobachtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 4.5 Sozialgeschichtliche Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4.6 Handel und Kulturkontakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4.7 Zum Beitrag des Friedhofs zur Vorstellungswelt der
Merowingerzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5. Listen ....................................... . ............... 148 5.1 Liste 1: die Typen der Perlengruppen
(kursiv neue Typen, fett Leittypen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 5.2 Liste 2: Leitformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5.3 Liste 3: datierte Gräber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6. Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7. Katalog . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 7.1 Einführung...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 7.2 Katalog der Grabfunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 7.3 Streufunde und nicht zuweisbare Funde .......................... 231 7.4 Anhang zum Katalog .......................................... 231
Tafeln .............................................................. 241
Farbtafeln 381
Karten ............................................................. 389
Beiträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Die menschlichen Skelettreste aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld von Eichstetten am Kaiserstuhl Von Barbara Hollack und Manfred Kunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Untersuchungen zur Verwandtschaftsstruktur der merowingerzeitlichen Bevölkerung von Eichstetten am Kaiserstuhl Von Kurt W. Alt und WernerVach ............................... 475
Die Tierknochen Von Gary White
Wald und Waldnutzung am Kaiserstuhl in alamannischer Zeit
643
Von Manfred Rösch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Die Textilreste Von Hans-Jürgen Hundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
9
Wald und Waldnutzung am Kaiserstuhl in alamannischer Zeie
Manfred Rösch
Einleitung
An Holzresten aus dem alamannischen Gräberfeld vom Wannenberg bei Eichstetten, Kreis BreisgauHochschwarzwald, wurden holzanatomische Artbestimmungen vorgenommen (Ausführung: M. Schneider). Es handelte sich durchweg um bearbeitete Holzteile (Griffe von Waffen, Reste von Spathascheiden u.ä.), die durch die Einwirkung von Metallsalzen erhalten geblieben waren. Dies und vor allem die Tatsache, daß die Funde zum Zeitpunkt der Bestimmung bereits konserviert waren, erschwerte die Untersuchung und ermöglichte trotz Einsatz eines Auflichtmikroskops in vielen Fällen kein sicheres Bestimmungsergebnis (vgl. auch B. Sasse-Kunst S. 112 in diesem Band). Holzbestimmungen aus archäologischem Kontext erlauben nur eingeschränkt Aussagen über frühere Bewaldungsverhältnisse, da man, besonders bei Nutzhölzern, von einer geziehen Selektion ausgehen muß. Sie sind eigentlich nur in Zusammenschau mit Pollenanalysen sinnvoll interpretierbar. Im Fall Eichstetten kommt als zusätzliche Einschränkung die geringe Stückzahl der untersuchten Funde (36 Stück) und der große Anteil nicht bestimmbarer Hölzer (36,1 %) hinzu. Seitens der Pollenanalyse ist der Kenntnisstand für die südliche Oberrheinebene außerdem als ausgesprochen schlecht zu bezeichnen. Die vorliegenden Untersuchungen stammen durchweg aus den dreißiger Jahren (Sleumer 1934, Oberdorfer 1937a u. b, Hatt 1937). Der darauf fußende Kenntnisstand wurde von Firbas (1952, 43 ff.) zusammengefaßt. Dort ist auch die einzige holzanalytische Untersuchung aus dem Gebiet (Breisach, Müller-Stoll1937) eingearbeitet. Pollenanalysen in der Oberrheinebene selbst werden durch die Seltenheit geeigneter Ablagerungen erschwert. Wie jedoch Kalis (1978), Hölzer (1987) und insbesondere Grosse-Brauckmann (1978) zeigen konnten, spiegelt sich die Vegetation der Rheinebene auch als Pollenfernflug in den Kammlagen von Schwarzwald und Vogesen wider. Deshalb liefert uns das etwa 15km in ostsüdöstlicher Richtung von Eichstetten entfernte, in fast 1 OOOm Höhe gelegene Pollenprofil von Breitnau-Neuhof (Rösch 1989) zusätzliche Informationen zur Waldgeschichte der Breisgauer Bucht. Der Vergleich der dort radiometrisch auf 1590±40 BP (d.h. 380-560 n.Chr.) datierten Pollenzone mit den Ergebnissen von
Schloss (1979, Anhang Pollenprofile SI-3 und SIV-3) zeigt, daß die Verhältnisse in der Breisgauer Bucht wohl für weite Teile der südlichen Oberrheinebene zutreffen.
Zum Naturraum
Eichstetten liegt am Ostrand des Kaiserstuhls, der hier zur Freiburger Bucht abfällt. Die Fundstelle Wannenberg befindet sich etwa 1 km nördlich der Ortslage im Bereich der lößbedeckten Plattenlandschaft, die von Wasenweiler bis Bahlingen reicht (Schrepper 1933). Die geologischen Verhältnisse sind der Geologischen Karte von Freiburg i.Br. und Umgebung (Groschopf u.a. 1981) zu entnehmen: Die Hänge des Kaiserstuhls bedecken hier mächtige Lößauflagen. Daran schließen holozäne Talfüllungen der Dreisam- und Glotterrinne an, zwischen denen sich südlich von Nimburg eine lößbedeckte Scholle erstreckt. Diese Rinnen sind in würmzeitliche Niederterrassenschotter eingetieft, die weiter östlich und südlich großflächig anstehen. Es handelt sich in diesem Gebiet um Schwarzwaldschotter. Die südliche Oberrheinebene gehört, bedingt durch die geringe Höhe und die relativ südliche geographische Lage, zu den wärmsten und trockensten Landschaften Mitteleuropas. Die Temperaturen liegen im Mittel über das ganze Jahr bei 10 Grad, im Januar über 0 Grad, im Juli bei 20 Grad und darüber. Bedingt durch den Regenschatten der Vogesen und den Schwarzwaldstau steigen die Niederschläge von weniger als 500mm im Jahr bei Colmar auf rund 900mm in Freiburg. Eichstetten selbst hat etwa 800mm Jahresniederschlag (0. Wilmanns, schriftliche Mitteilung). Die Vegetation und Geomorphologie dieser seit der Bandkeramik besiedelten Landschaft ist in starkem Maße vom Menschen geprägt. Diese Tatsache und der oben erwähnte Forschungsstand erschwerten die Rekonstruktion der potentiellen natürlichen und der ursprünglichen Vegetation, und entsprechend konträr sind daher auch die Meinungen dazu. Insbesondere ist man sich nicht einig, welche Rolle die Buche auf den Lößhügeln und auf der Niederterrasse spielte.
* Das Manuskript wurde am 20.7.1989 eingereicht.
645
Die Holzbestimmungen
Die Holzreste stammen von verschiedenen Bestandteilen der Waffen aus den Gräbern (zur Ansprache der Waffenteile vgl. Sasse-Kunst S. 79ff. in diesem Band). Ohne Differenzierung nach einzelnen Werkstücken sieht das Ergebnis der Bestimmung folgendermaßen aus:
Taxon Stück
J uglans regia 12 Ainus sp. 3 Fagus sylvatica 3 Acer sp. 2 Fraxinus excelsior 2 cf. Abies alba Pomoideae
Quercus sp. Salix sp. Tiliasp. indet. 15
%
44,4 11,1 11,1 7,4 7,4 3,7 3,7
3,7 3,7 3,7 35,7
Holzart
Walnuß Erle Rotbuche Ahorn Esche Weißtanne Kernobst-gewächs Eiche Weide Linde unbestimmbar
Wie bereits angedeutet, ist der hohe Anteil unbestimmbarer Holzreste vor allem auf die Tatsache zurückzuführen, daß die Holzreste bereits in konserviertem Zustand zur Bestimmung übergeben wurden. Wegen der anzunehmenden geziehen Auswahl der Holzarten für die Werkstücke und wegen der geringen bestimmten Stückzahl gibt uns diese Statistik keine Auskunft über das Waldbild der Umgebung von Eichstetten in merowingischer Zeit. Deshalb soll versucht werden, das Waldbild aus den pollenanalytischen Untersuchungen zu erschließen und dann zu fragen, welche Holzarten vor Ort zur Verfügung standen, und welche aus größerer Entfernung und woher beschafft werden mußten.
Das Waldbild aufgrund von Pollenanalysen
Die großen frühmittelalterlichen Rodungen im Gebiet fallen ins 5. Jahrhundert. Sie stellen einen ganz entscheidenden landschaftsgeschichtlichen Einschnitt dar. Zuvor kann man von relativ geschlossener Bewaldung nicht nur im Schwarzwald, sondern auch im östlichen Teil der Rheinebene ausgehen. In welchem Umfang in der Vorhügelzone nach dem Abzug der Römer Besiedlungskontinuität bestand und die Landschaft offen gehalten wurde, ist noch ungeklärt. Die Waldvegetation im 5. Jahrhundert kann man in ganz groben Zügen etwa folgendermaßen beschreiben: Die Westabdachung des Schwarzwaldes war mit Buchen-Tannen-Wäldern bestockt, die überwiegend lößbedeckte Vorbergzone und die Hänge des Kaiserstuhls wohl mit Buchenmischwäldern, die einen mehr oder weniger hohen An-
646
teil an Eichen und anderen Laubhölzern hatten. Auch auf der Niederterrasse spielte die Buche sicherlich eine nicht unbedeutende Rolle, wenngleich hier zusammen mit anderen Holzarten, vor allem der Stieleiche. Zumindest außerhalb des hohen Schwarzwaldes dürften die Wälder überwiegend nicht mehr ursprünglich gewesen sein, sondern es dürfte sich vor allem um durchgewachsene Nieder- oder Mittelwälder oder gar um Sekundärwälder auf ehemals offenen Flächen gehandelt haben. Die syntaxonomische Zuordnung dieser Wälder (Fagion sylvaticae, Carpinion betuli oder gar Quereion robori-petraeae) scheint uns in diesem Zusammenhang mehr von akademischem Interesse zu sein. Mit Sicherheit weitgehend buchenfrei waren lediglich die in die Niederterrasse eingetieften, hochwassergefährdeten Rinnen, wo neben Weichholz-Auenwäldern vor allem Hartholz-Auenwälder mit Eschen, Ulmen, Schwarzerlen und Stieleichen stockten. Im Zuge der frühmittelalterlichen Rodungen wurden nun alle diese Wälder in beträchtlichemUmfangdurch Rodungen dezimiert oder, soweit sie erhalten blieben, in ihrem Bestand und der Artenzusammensetzung stark verändert. In der Rheinebene und in der Vorbergzone stand dabei die Ausstockung zum Gewinn landwirtschaftlicher Flächen im Vordergrund, wovon zunächst nur die hochwassergefährdete Weichholzund tiefergelegene Hartholzaue halbwegs verschont blieben. Im Mittelgebirge machte sich ein durch die Umwandlung von sehr naturnahen in wirtschaftlich genutzte Wälder bedingter Bestandsumbau stärker als Ausstockungen bemerkbar. Dabei wurde durch plenternde Nutzung und andererseits bevorzugte Entnahme von Buchenholz, das als Grundstoff zur Holzkohlegewinnung zum wichtigsten Energieträger des Mittelalters wurde, die Tanne stark auf Kosten der Buche gefördert (Schloss 1979, Pollenprofile SI-3 und SIV-3, Beginn von Zone X nach Firbas). Die Holzfunde von Eichstetten sind auch ein Dokument dieser frühmittelalterlichen Rodungen und Waldnutzung. Die am häufigsten nachgewiesene Holzart, die Walnuß Quglans regia), wurde nun aber in dieser Beschreibung der Wälder gar nicht erwähnt, und dies mit gutem Grund, weil nämlich die Walnuß in den hiesigen Wäldern nicht heimisch ist, sondern vermutlich erst von den Römern als Kulturpflanze in unser Land eingeführt wurde. Dabei wurde die Kultur des Nußbaumes nicht unbedingt sofort von den Alamannen übernommen und nahtlos fortgesetzt, sondern der Nußbaum kann sich auch in der Hartholzaue oder in anderen feuchten, nährstoffreichen Waldgesellschaften als verwilderte Nebenboizart behauptet haben, wo er dann durch Sammler genutzt wurde. Für diese Deutung spricht auch die allgemeine Beobachtung, daß offenbar
die gesamte hochentwickelte römische Obstbauktiltur von den Germanen zunächst nicht übernommen wurde. Das harte, feinfaserige und schön gezeichnete Holz des Nußbaumes gilt heute als das wertvollste aller einheimischen Holzarten (Hegi 1981). Mit jeweils drei Nachweisen liegen Rotbuche und Erle an zweiter Stelle der Häufigkeit. Sie konnten wohl in der unmittelbaren Umgebung gewonnen werden, sind jedoch andererseits als qualitativ minderwertig einzustufen. Erlenholz ist weich, wenig haltbar und springt leicht beim Trocknen, gilt aber als sehr dauerhaft in beständiger Feuchtigkeit. Buchenholz ist zwar hart, aber besonders bei Witterungseinflüssen wenig haltbar. Laut Hegi ist es wegen des starken Schwundes und dem Hang zum Reißen für Gebrauchsgegenstände, bei denen die Qualität des Holzes eine Rolle spielt, nur bedingt verwendbar. Mit jeweils zwei Nachweisen folgen Esche und Ahorn. Während die Herkunft des Eschenholzes aus den nahegelegenen Hartholzauen vorausgesetzt werden darf, ist die Herkunft des Ahornholzes schwieriger zu rekonstruieren, da mindestens drei Arten in Frage kommen: Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus). Feldahorn könnte aus der Hartholzaue oder auch aus den Laubmischwäldern auf Löß stammen, auch wenn diese bereits stark anthropogen verändert waren, denn der raschwüchsige und leicht ausschlagende Feldahorn kann sich auch in Niederwäldern oder Feldgehölzen behaupten. Spitzahorn wäre ebenfalls in der Bartholzaue zu suchen. Bergahorn hätte man wohl eher über größere Entfernungen aus den Bergmischwäldern des Schwarzwaldes antransportieren müssen. Das Holz der Ahornarten ist hart, elastisch, feinporig und gut polierbar, jedoch wenig widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Es eignet sich besonders für hölzerne Gefäße . Eschenholz ist hart und schwer, langfaserig und elastisch, für vielerlei Werkstücke und Geräte geeignet und ein entsprechend wertvolles Nutzholz. Von den jeweils einmal nachgewiesenen Holzarten war Weidenholz wohl in der nahen Aue verfügbar. Weidenholz ist weich, wenig dauerhaft und kein gutes Werkholz. Ähnliche Eigenschaften hat Lindenholz, das allerdings als besonders geeignet für die Holzschnitzerei gilt. Die Winterlinde gehört in die EichenHainbuchenwälder des Kaiserstuhls, besonders auf schuttreichen Stellhängen (Wilmanns, schriftl. Mitt.).
Sie war aber nach Ausweis der Pollenanalyse nicht mehr allzu häufig. Hartes und durchaus für Gerätschaften geeignetes Holz bieten dagegen die Kernobstgewächse. Hier kommen neben Apfel, Birne, Quitte und anderen vor allem Arten der Gattung Sorbus (u.a. Eberesche) in Frage. Über den möglichen Standort läßt sich bei dieser Vielfalt nichts aussagen, nicht einmal darüber, ob das Holz von einem wildwachsenden oder von einem kultivierten Obstbaum stammt. Das Holz der Eichen ist besonders hart, schwer und dauerhaft, wird aber normalerweise mehr für größere Bauteile als für Kleingeräte verwendet. Stiel- und Traubeneiche (Quercus robur und Q. petraea) waren damals in der Rheinebene sowohl in der Hartholzaue, als auch auf der Niederterrasse, auf Löß und in der Vorbergzone neben der Buche die wichtigsten Holzarten. Auf klimatisch besonders begünstigten Standorten in der Vorbergzone ist darüber hinaus mit dem Vorkommen der Flaumeiche (Quercus pubescens) zu rechnen, die holzanatomisch nicht unterschieden werden kann. Tannenholz ist weich, leicht, glatt und leicht zu spalten. Außer zu Bauzwecken wurde und wird es häufig für Schindeln, Faßdauben (Behre 1983, 109) und ähnliches verwendet. Die Tanne fehlte wohl in der Rheinebene und war in der Vorbergzone selten, dagegen im Schwarzwald sehr häufig. Bezieht man die Untersuchungen von Müller-Stoll aus Breisach mit in die Auswertung ein, so kann man festhalten, daß die alamannische Bevölkerung am Kaiserstuhl für die hölzernen Teile ihrer Waffen Material aus der näheren und weiteren Umgebung verwendete, und zwar lassen sich folgende Standorte feststellen:
Obstbäume (auch wild oder verwildert) Weichholzaue Hartholzaue Niederterrasse, Löß, Vorbergzone Schwarzwald
13,2% 0,5%
23,7% 33,2% 29,5%
Bei dieser Statistik wurden Birke, Erle, Esche " Linde, Hartriegel, sowie Eiche und Ahorn zur Hälfte zur Hartholzaue gerechnet, Buche, sowie Eiche und Ahorn zur Hälfte zu Niederterrasse/LößNorbergzone. Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß ausschließlich die lokalen und regionalen Holzressourcen genutzt wurden, und daß Hinweise auf Verwendung importierter Hölzer fehlen.
647
Behre 1983
Firbas 1949/52
Groschopf u.a. 1977
Grosse-Brauckmann 1978
Hatt 1937
Hegi 1937ff
Hölzer/Hölzer 1987
Kalis 1979
Müller-Stoll1936
Oberdorfer 1937a
Oberdorfer 1937b
Rösch 1989
Schloss 1979
Sleumer 1933
648
Literatur
K.-E. Behre, Ernährung und Umwelt der wikingerzeitlichen Siedlung Haithabu. Ausgr. Haithabu 8 (Neumünster 1983).
F. Firbas, Waldgeschichte Mitteleuropas. 2 Bde. Oena 1949/52).
R. Groschopf u.a., Erläuterungen zur Geologischen Karte Freiburg im Breisgau und Umgebung 1:50000. Geol. Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.) (Stuttgart 1977).
G. Grosse-Brauckmann, Absolute jährliche Pollenniederschlagsmengen an verschiedenen Beobachtungsorten in der Bundesrepublik Deutschland. Flora 167,1978,209-247.
J.-P. Hatt, Contribution a l'analyse pollinique des tourbieres du Nord de Ia France. Bull. Sercive Carte Geol. Alsace et Lorraine 4, 1937, 1-79.
G. Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 7 Bde.2 (München 1937).
A. Hölzer/A. Hölzer, Paläoökologische Moor-Untersuchungen an der Hornisgrinde im Nordschwarzwald. Carolinea 45, 1987, 43-50.
A. J. Kalis, Ergebnisse pollenanalytischer und vegetationskundlieber Untersuchungen zur holozänen Waldgeschichte derwestlichen Hochvogesen (Frankreich). Ber. Int. Symp. Int. Ver. Vegetationskde. 1978,263-268.
W. R. Müller-Stoll, Untersuchungen urgeschichtlicher Holzreste nebst Anleitung zu ihrer Bestimmung. Prähist. Zeitschr. 27, 1936, 3-57.
E. Oberdorfer, Zur spät- und nacheiszeitlichen Vegetationsgeschichte des Oberelsasses und der Vogesen. Zeitschr. Botanik 30, 1937,513-572.
E. Oberdorfer, Vegetationskarte von Baden. Badischer Heimatatlas (1937).
M. Rösch, Pollenprofil Breitnau-Neuhof: Zum zeitlichen Verlauf der holozänen Vegetationsentwicklung im südlichen Schwarzwald. Carolinea 47 (im Druck).
S. Schloss, Pollenanalytische und stratigraphische Untersuchungen im Sewensee. Diss. Bot. 52 (1979).
H. Sleumer: Die Pflanzenwelt des Kaiserstuhls. In: Der Kaiserstuhl. (Freiburg 1933) 158-268.