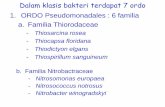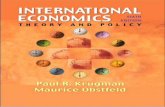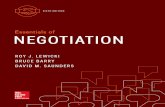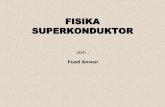„Laßt uns pflügen, laßt uns bauen“: Brigadebilder und Typenporträts in der DDR-Fotografie...
-
Upload
hgb-leipzig -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of „Laßt uns pflügen, laßt uns bauen“: Brigadebilder und Typenporträts in der DDR-Fotografie...
Agneta Maria Jilek
„Laßt uns pflügen, laßt uns bauen“
Brigadebilder und Typenporträts in der DDR-Fotografi e der frühen Fünfzigerjahre
Die sechs Riesaer Stahlarbeiter besprechen in ihrer Pause lieber die aktu-elle Politik der DDR, als sich auszuruhen. Daran lässt die Bildunter-schrift (Abb. 1) keinen Zweifel: „Arbeiter des Stahlwerkes Riesa disku-tieren in der Mittagspause die wichtigsten politischen Ereignisse.“1 Den Gesprächsstoff liefert ihnen die Tageszeitung „Neues Deutschland“, seit 1946 zentrales Sprachrohr der SED. Einer der Arbeiter hält das Titelblatt der Zeitung demonstrativ in die Kamera. Die programmatische Mittags-pause der Arbeitsbrigade erschien 1951 in der Zeitschrift „Die Deutsche Demokratische Republik im Aufb au“. Versehen mit viersprachigen Tex-ten auf Englisch, Polnisch, Russisch und Deutsch, produzierte die DDR-Führung sie speziell für eine Leserschaft im Ausland. Mithilfe der „DDR im Aufb au“ wurden über die Grenzen des neu gegründeten Staates hinaus vermeintliche Dokumente des Arbeitseifers und des freiwilligen Einsatzes der „Neuen Menschen“ für die optimale Planerfüllung im werdenden Sozialismus in Umlauf gebracht. Gegenüber den eher knapp gehaltenen Textbeiträgen dominieren Fotografi en, wobei das Bild der Arbeitswelt im „ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden“ deutlich präsenter ist.2
1 Die Deutsche Demokratische Republik im Aufb au 1 (1952) 2, o. S.2 Vgl. Ludger Derenthal, Bilder der Trümmer- und Aufb aujahre, Marburg/München
1999, S. 186.
146 Agneta Maria Jilek
Programmatische Mittagspause einer Arbeitsbrigade im Stahlwerk Riesa: Statt sich auszuruhen, diskutieren die Arbeiter die aktuelle Politik.Die Deutsche Demokratische Republik im Aufb au 1 (1951) 2, o. S.
Arbeit im Bild – die Funktionalisierung der Pressefotografie
Den Weg zur Etablierung des Sozialismus und zum wirtschaft lichen Auf-schwung in der DDR sollte auch die fotografi sche Bilderwelt ebnen. Dabei kam dem massenmedial verbreiteten Sujet Arbeit ein zentraler Stellenwert zu. Die hohe Bedeutung des Arbeits- und Arbeiterbildes sowohl im Bild-
147„Laßt uns pfl ügen, laßt uns bauen“
journalismus als auch in den Künsten der DDR ergab sich aus der „führen-den Rolle“ der Arbeiterklasse, die ab 1968 sogar Verfassungsrang erhielt. In der zweiten Verfassung der DDR hieß es: „Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von den Werktätigen ausgeübt. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Bemühungen der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates.“3 Mit der neuen Staats- und Regierungs-form wurde das Wunschbild vom „Neuen Menschen“ geschaff en, das sich am sowjetischen Modell orientierte und hauptsächlich auf den Th eorien von Karl Marx beruhte. Das Idealbild dieses Menschentypus wurde vom Arbeiter verkörpert, der sich nicht als Individuum, sondern als Teil eines Kollektivs begreift . Zum Zweck der einheitlichen Darstellung des sozialis-tischen Menschen- und Weltbildes wurde sowohl für die bildende Kunst als auch für die angewandte Fotografi e die Doktrin des „sozialistischen Realismus“ proklamiert.4 Die Fotografen in der DDR hatten sich seit den Formalismus-Debatten vor allem an der sowjetischen Reportagefotografi e, der Arbeiterfotografi e der Weimarer Republik und an der volkstümlichen deutschen Heimatfotografi e zu orientieren. In der Sowjetunion hatte sich bereits in den Dreißigerjahren eine realistische, reportagehaft e Fotografi e entwickelt, in der Arbeiter und Bauern die neuen Helden waren. Fotografen wie Arkadij Schaichet , Max Alpert und Semjon Fridland repräsentierten diese ideologische Richtung, bei der die neuen „Helden der Arbeit“ im Vor-dergrund der Berichterstattung standen.
Auch in der DDR kam der Fotografi e bei der Visualisierung politischer Inhalte eine wichtige Rolle zu. Die „agitatorische Regiefotografi e“5 sollte zur Erziehung des sozialistischen Menschen beitragen und ein positives Bild des neuen Systems transportieren. Anfang der Fünfzigerjahre wurde der Fotografi e im theoretischen Diskurs übereinstimmend eine objektive Beweiskraft hinsichtlich der Bebilderung des gesellschaft lich „Neuen“
3 Verfassung der DDR vom 6. April 1968, Artikel 2, Absatz 1, www.documentarchiv.de/ddr.html (zuletzt eingesehen am 19. 3. 2012).
4 Der sozialistische Realismus wurde nach sowjetischem Vorbild in der DDR auf der 5. Tagung des Zentralkomitees der SED am 17. März 1951 offi ziell durchgesetzt und im „Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur für eine fortschrittliche deutsche Kultur“ als „Neuer Kurs“ beschlossen.
5 Vgl. Karin Th omas, Kunst in Deutschland seit 1945, Köln 2002, S. 121.
148 Agneta Maria Jilek
zugeschrieben. So weist zum Beispiel der Fototheoretiker Ernst Nitsche in seinem Artikel in der DDR-Zeitschrift „Die Fotografi e“ auf deren Wirk-lichkeitsbezug hin: Die „kämpferische Diskussion um das Neue“ könne in der Fotografi e nicht auf der gleichen Ebene geführt werden wie in den bil-denden Künsten, denn jede fotografi sche Wiedergabe sei „etwas Wirklich-keitsnahes im Sinne des Wortes“.6 Nitsche spricht sich für die realistische Gestaltung der Fotografi e aus und verwehrt sich gegen jedweden Formalis-mus, denn in diesem Fall sei die „Vermittlung der objektiven Wirklichkeit“ nicht mehr möglich.7 Der 1953 erschienene Artikel leitete die Politisierung der Fotografi e und Fototheorie in der DDR ein, in deren Folge Bilder mit dem Sujet Arbeit in der Zeitschrift „Die Fotografi e“ deutlich zunahmen.8 Das Bild der Arbeit tauchte in der DDR-Pressefotografi e der frühen Fünf-zigerjahre entweder als Kollektivsujet in Form von Brigadebildern oder als „Typenporträt“ auf. Im Folgenden soll anhand dieser beiden Bildtypen ein Schlaglicht auf die Visualisierung von Arbeitswelten in der DDR-Fotografi e der frühen Fünfzigerjahre geworfen werden.
„Unsere Frauen stehen ihren Mann!“: Typenporträts in den
Fünfzigerjahren
Zu den prominentesten Arbeitern der DDR gehörte Adolf Hennecke . Der Bergarbeiter soll im Jahr 1948 seine Tagesschicht im Steinkohlebergbau in Oelsnitz mit einer Arbeitsleistung von 387 Prozent übererfüllt haben. Das fotografi sche „Dokument“ dieser Leistung zeigt den schwer arbeitenden „Aktivisten“ mit dem Bohrhammer vor der Kulisse des Kohleschachtes und fehlte später in kaum einem Schulbuch der DDR. Das Kompositions-prinzip dieses ikonischen Bildes beruht auf der Diagonalen: Alles strebt
6 Ernst Nitsche, Realismus und Formalismus in der Fotografi e, in: Die Fotografi e (1953) 7, S. 112.
7 Ebenda, S. 113.8 Die Debatte um den sozialistischen Realismus in der Fotografi e fand bis Mitte der
Fünfzigerjahre fast ausschließlich fotografi eintern statt. Die Zeitschrift „Die Foto-grafi e“ war zu diesem Zeitpunkt das einzige massenwirksame Medium, in dem darüber diskutiert wurde.
149„Laßt uns pfl ügen, laßt uns bauen“
von links unten nach rechts oben aus dem Bildrand hinaus: Hennecke s Oberkörper, sein Blick und der mächtige Bohrhammer.9 Damit wird der positive, zukunft sweisende Aspekt seiner vorbildhaft en Arbeitsleistung suggeriert. Das Bild ließ sich bestens in verschiedenste Publikationskon-texte einfügen und gehörte zu den meist gedruckten Fotografi en der DDR. Es war kein Zufall, dass im Jahr der Rekordschicht Hennecke s auch die Aktivistenbewegung nach sowjetischem Vorbild initiiert wurde. Hen-necke s Ausnahmeleistung wurde sorgsam geplant und inszeniert, um als Motor für die Aktivistenbewegung zu dienen, mit deren Hilfe die Beleg-schaft en in den Fabriken und Betrieben fl ächendeckend zur Mehrarbeit motiviert werden sollten. Diese Mehrarbeit ergab sich aus den Jahresplä-nen der Fünfzigerjahre, in denen die SED-Spitze eine erhebliche Produk-tionssteigerung festgelegt hatte, um die Volkswirtschaft der DDR aufzu-bauen und zu stabilisieren.
Neben den namentlich bekannten „Helden der Arbeit“ wurden zahl-reiche weitere, anonyme Aktivisten medial erschaff en, um die Wirtschaft in der DDR anzukurbeln. Für deren Visualisierung eignete sich am besten das sogenannte Typenporträt. Bei dieser Porträtform bleibt die dargestellte Person zugunsten des verallgemeinernden Klassifi zierens in der Regel ano-nym. Der oder die Porträtierte wird zum Beispiel durch Attribute, Klei-dungsstücke oder Bildunterschrift en einer bestimmten gesellschaft lichen Gruppe zugeordnet. Die Typenporträts in der DDR-Fotografi e wurden häufi g mit längeren Textpassagen versehen, um eine unmissverständliche Aussage zu treff en. So heißt es etwa in einem Text unter dem ganzseitigen Typenporträt einer Dreherin, abgebildet in „Die Fotografi e“ von 1952: „Unsere Frauen stehen ihren Mann! Dreherinnen sind bei uns keine Selten-heit mehr. Aber noch mehr sollten unsere Frauen solche, ihnen in früheren Zeiten verwehrten Berufe ergreifen.“10 Auf dem Bild ist eine Dreherin bei einem typischen Arbeitsgang zu sehen. Als Zeichen ihrer zuvor verrich-teten Arbeit fallen im Vordergrund Späne von der Maschinenkurbel. Der Text dient bei diesem Bild als erzieherischer Appell: Frauen sind dazu auf-gerufen, auch männlich dominierte Berufe zu ergreifen.
9 Vgl. Christoph Hamann, Bilderwelten und Weltbilder. Fotos, die Geschichte(n) mach(ten), Berlin 2002, S. 70.
10 Vgl. Die Fotografi e (1952) 12, S. 375.
150 Agneta Maria Jilek
Eine weitere Variante der Synthese von Bild und Text war die bloße Angabe der Berufsbezeichnung. Auf dem als „Schweißer-Porträt“ beti-telten Bild, das 1953 in der gleichen Zeitschrift abgedruckt wurde, wird der Idealtypus eines Schweißers inszeniert (Abb. 2). Der Porträtierte ist seinem Lebens- und Arbeitsumfeld entrückt; der Bildhintergrund ist ein-farbig und dadurch unbestimmbar. Das Brustbild ist nicht frontal und auf Augenhöhe, sondern seitlich leicht gedreht und in minimaler Untersicht
Der Zukunft zugewandt und optimistisch: Der Idealtypus eines Schweißers in der frühen DDR-Fotografi e. Die Fotografi e (1953) 8, S. 241.
151„Laßt uns pfl ügen, laßt uns bauen“
aufgenommen. Der Schweißer blickt aus dem linken Bildrand hinaus; im rechten unteren Bildrand sind seine Arbeitswerkzeuge zu erkennen. Sein zerfurchtes Gesicht und die Mimik lassen ihn als einfachen Mann erschei-nen, sein Lächeln und der Blick aus dem Bild hinaus suggerieren ähnlich wie das Hennecke -Porträt Zukunft sgewandtheit und Optimismus. Das „Schweißer-Porträt“ steht exemplarisch für die stilistische Nähe der frü-hen DDR-Fotografi e zur völkischen Fotografi e des Nationalsozialismus. Porträtaufnahmen bestimmter Berufs- oder Bevölkerungsgruppen stan-den im Zentrum der völkischen Fotografi e, bei der die Nahaufnahme in Untersicht, mit geringer Schärfentiefe und einem monochromen Bildhin-tergrund häufi ges Gestaltungsprinzip war. Auch in der Fotografi e des Nationalsozialismus ging es um das Klassifi zieren und die Bildung von „Idealtypen“. Diese waren in der Regel im ländlichen Bereich verortet, ver-richteten körperliche Arbeit und entsprachen optisch der damaligen Vor-stellung vom „Deutschen Volk“.
Zeigen, Erklären und Diskutieren: Das Brigadebild in den
Fünfzigerjahren
Zusätzlich zur Aktivistenbewegung rief der Freie Deutsche Gewerkschaft s-bund (FDGB) 1950 die sogenannte Brigadebewegung ins Leben. Auch diese Initiative wurde medial mithilfe von fotografi sch inszenierten Bil-dern angeschoben. In der bereits erwähnten Ausgabe der „DDR im Auf-bau“ ist den Arbeitsbrigaden eine ausschließlich fotografi sch bebilderte Doppelseite gewidmet. Durch die Abbildungen zieht sich als roter Faden das Muster, bei dem ein erfahrener Arbeiter seinen um ihn herum grup-pierten Kollegen etwas erklärt. Der Vortragende weist dabei meist mit einem markanten Zeigegestus auf den zu besprechenden Gegenstand, etwa den Teil einer Maschine. Auch solch deskriptiven Bildunterschrift en wie „Kurt Bichler , früher Oberschmelzer, jetzt stellvertretender Betriebsleiter, bespricht mit Stahlwerkern einen Ofenriß“ lassen sich bei den meisten Aufnahmen der Doppelseite ausmachen. Diese Darstellungsweise betonte die Echtheit und den reportagehaft en Charakter der Fotografi en mit der Absicht, ein möglichst authentisches Bild der „schönen neuen Welt“ zu
152 Agneta Maria Jilek
vermitteln. Das „Pausenbild“ aus der „DDR im Aufb au“ steht exemplarisch für diese Funktionalisierung der Fotografi e. Bereits die Aufnahmeperspek-tive in Untersicht vermittelt dem Betrachter die gesellschaft liche Bedeu-tung der Arbeiterbrigade: Durch ihren erhöhten Standpunkt erscheint sie dem Betrachter überlegen, wenn nicht sogar heroisch. Nicht nebensäch-lich ist auch die Wahl des Aufnahmeortes. Im Hintergrund schiebt sich ein Förderkran wie ein Riegel über die Köpfe der Arbeiter. Im Vordergrund verdeckt ein großes Rad aus Metall deren Unterkörper. Auf diese Weise zwischen Kran und Rad geschoben, manifestiert sich die körperliche Nähe der Arbeiter zu ihrem Arbeitsplatz und den „Produktionsmitteln“. Diese enge Verbindung zwischen den Arbeitern und den Arbeitsgegenständen inszeniert programmatisch einen zentralen Aspekt der marxistisch-leninis-tischen Weltanschauung. Im „Wörterbuch zur marxistisch-leninistischen Philosophie“ wird diese Verbindung hervorgehoben: „Die Produktion setzt immer eine bestimmte Form der Vereinigung der menschlichen Arbeits-kraft mit den P[roduktionsmitteln] voraus.“11 Erst durch die mensch-liche Aneignung und die Aufh ebung von deren Privatisierung würden die Arbeitsgegenstände zu Produktionsmitteln. Auch die vermeintlich spontan eingefangene Diskussionsbereitschaft der Gruppe entspricht den Zielen der Volkswirtschaft : Wer in den Fünfzigerjahren Mitglied in einer Arbeitsbri-gade wurde, verpfl ichtete sich, „sozialistisch zu arbeiten“ und mit ganzer Kraft am Aufb au des neuen Staates mitzuwirken.
Die in der Pressefotografi e der DDR propagierten Arbeitshelden stan-den paradigmatisch für den wirtschaft lichen Aufb au und die Umstruktu-rierungen, die Anfang der Fünfzigerjahre stattfanden. Mit ihrer Gründung führte die DDR die Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild ein. Inner-halb dieser Wirtschaft sordnung steuerte die Partei zentral die Güter und Dienstleistungen der Republik zugunsten eines Gesamtplanes. Die ersten Wirtschaft spläne – der Zweijahresplan (1949–51) und der Fünfj ahresplan (1951–55) – hatten eine kontinuierliche Leistungs- und damit Produkti-onssteigerung zum Ziel. Deshalb waren die Betriebe innerhalb des jeweils zu erfüllenden Planjahres stets zur höchstmöglichen Leistung angehalten.12
11 Alfred Kosing, Wörterbuch der marxistisch-leninistischen Philosophie, 3. Aufl ., Berlin 1987, S. 427.
12 Vgl. Jörg Roesler, Die Wirtschaft der DDR, Erfurt 2002, S. 54.
153„Laßt uns pfl ügen, laßt uns bauen“
In diesem Rahmen hatten die Aktivisten- und die Brigadebewegung ihre Funktion: Die Wirtschaft sleistung der DDR sollte durch die Gründung der Aktivisten- und später der Brigadebewegung und deren Vorbildfunk-tion wirkungsvoll angekurbelt werden. Als die Betriebe 1947 die ersten Arbeitsbrigaden in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) gründeten,13 wollten sie damit die Produktion beständig steigern: Die „Arbeitskollek-tive“ sollten durch die eff ektive Zusammenarbeit als Gruppe ihr Arbeits-soll möglichst schon vor der angesetzten Frist erfüllen. Von den einzelnen „Helden der Arbeit“ erhofft e man sich zudem eine Vorbildwirkung für die Mitglieder der ganzen Brigade. Ab Mitte der Fünfzigerjahre war bereits knapp die Hälft e aller Arbeiter in Brigaden organisiert.14
Auf einer anderen 1952 in der „Fotografi e“ veröff entlichten Abbil-dung einer Arbeitsbrigade verweist die Bildunterschrift auf die forcierte Leistungserhöhung: „Produktionsbesprechungen in den Betrieben tragen dazu bei, Schwierigkeiten zu beseitigen und die Leistungen zu steigern. Auch ein Zeichen des neuen Geistes in unseren volkseigenen Betrieben.“15 Auf der Fotografi e ist eine „Funktionsbesprechung“ dargestellt. Im Bild-zentrum steht eine große Maschine, die etwa zwei Drittel des Bildhinter-grundes ausfüllt. Die Maschine wird von einer Arbeitsbrigade fl ankiert. Der Blick der zwölf Arbeiter ist auf den Sprecher gerichtet, der etwas erhöht mit angewinkeltem Bein auf der großen Maschine steht. Er zeigt demonstrativ auf den Kolben der Maschine und erklärt off enbar deren Funktionsweise. Den Gesichtern der Zuhörenden ist anzusehen, dass sie am Gesprächs-inhalt interessiert sind, bei einigen ist sogar der Anfl ug eines Lächelns zu erkennen. Statt Arbeitsfrust herrscht in der Fabrik scheinbar eine große Vorfreude auf die bevorstehende Arbeit. Der Optimismus der Gruppe wird durch das dichte Drängen der Männer um die Maschine noch verstärkt. Auch auf diesem Bild wird die enge Verbindung der Arbeiter zu den Pro-duktionsmitteln deutlich.
13 Vgl. Jörg Roesler, Inszenierung oder Selbstgestaltungswille? Zur Geschichte der Bri-gadebewegung in der DDR während der 50er Jahre, Berlin 1994, S. 5.
14 Vgl. Roesler, Die Wirtschaft der DDR, S. 56. Ab 1960 wurden die Arbeitsbriga-den als „Kollektive der sozialistischen Arbeit“ bezeichnet. Ende der Achtzigerjahre waren 84 Prozent der Beschäft igten im Brigadesystem organisiert.
154 Agneta Maria Jilek
Ausblick: Der Wandel im fotografischen Bild der Arbeit
In die Pressefotografi e der Fünfzigerjahre sollte das politische Bewusstsein der „Neuen Menschen“ einfl ießen. Das Ergebnis waren lächelnde, opti-mistisch in die Zukunft blickende Arbeiter, die in Verbindung mit Sinn-sprüchen und Losungen abgebildet wurden.16 Die Bilder waren jedoch off ensichtlich inszeniert und wenig überzeugend. Dies sollte sich in den folgenden Jahren ändern. Schon ab 1953 wurden infolge des Arbeiterauf-standes vom 17. Juni authentischere Darstellungen gefordert. Ab Ende der Fünfzigerjahre diskutierten Kunstwissenschaft ler der DDR ästhetische und gestalterische Fragen zur Fotografi e erstmals nicht mehr nur intern, sondern auch für ein breites Publikum. Berthold Beiler , der von 1961 bis 1975 die Abteilung Fotografi e der Leipziger Hochschule für Grafi k und Buchkunst (HGB) leitete, avancierte mit seinen fotografi etheoretischen Büchern „Die Parteilichkeit im Foto“ (1959) und „Die Gewalt des Augenblicks“ (1967) zum Vorreiter einer eigenständigen Fototheorie der DDR. Im neuen Dis-kurs um die Fotografi e untersuchte er als erster Kunstwissenschaft ler der DDR die Eigengesetzlichkeiten des fotografi schen Mediums hinsichtlich seiner Ästhetik. Er erreichte schließlich, dass die Fotografi e nicht mehr aus-schließlich in den Kategorien der Malerei behandelt wurde, sondern sich als eigenständiges künstlerisches Medium entwickeln und etablieren konnte. Infolge des Übergangs von der Ulbricht- zur Honeckerära entwickelte sich in den Siebzigerjahren der Kanon des sozialistischen Realismus hin zu einer größeren Alltagsnähe. Daraufh in wurde die künstlerische Fotografi e zum Teil „entideologisiert“. Ab Mitte der Siebzigerjahre wurden auch in den offi -ziellen Ausstellungen der DDR Fotografi en von müden und abgekämpft en Arbeitern in großer Distanz zu den Produktionsmitteln präsentiert. Daran zeigt sich zum einen, wie sich die Bedeutung von „Arbeit“ wandelte. Zum anderen verdeutlichen sich darin auch real- und kulturpolitische Wand-lungsprozesse. Bis zum Ende der DDR gab das fotografi sche Bild der Arbeit nahezu seismografi sch genau wieder, auf welchem politischen Kurs sich die Regierung jeweils befand.
15 Die Fotografi e (1952) 11, S. 353.16 Vgl. Derenthal, Bilder der Trümmer- und Aufb aujahre, S. 206.