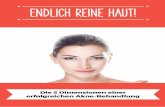Konzeptuelle Fokussierung: Bemerkungen zur Behandlung der Polysemie in der Zwei-Ebenen-Semantik
Transcript of Konzeptuelle Fokussierung: Bemerkungen zur Behandlung der Polysemie in der Zwei-Ebenen-Semantik
Konzeptuelle FokussierungBemerkungen zur Behandlung der Polysemie in der Zwei-Ebenen-Semantik
Gergely Pethő*
1. EinleitungIn diesem Aufsatz werde ich versuchen, den Status der Polysemie inder sogenannten Zwei-Ebenen-Semantik zu analysieren und zurevidieren. Um diese Zielsetzung überhaupt interpretieren zu können,soll zuerst (im Abschnitt 2.) die Terminologie im Zusammenhang mitPolysemie erläutert werden. Es folgt (im Abschnitt 3.) eineDarstellung der Behandlung der Polysemie in der Zwei-Ebenen-Semantik, die auf der klassischen und wohl bekannten ArbeitBierwisch (1983a) beruht. Diese Darstellung setzt sich zum Ziel,bestimmte Punkte, die in den klassischen Arbeiten zur Zwei-Ebenen-Semantik nicht ganz klar ausgeführt, aber aus unserem Gesichtspunktwichtig sind, explizit zu machen und dient eher als eineInterpretation als eine einführende Vorstellung der Theorie. ImAbschnitt 4 soll auf problematische Stellen des Ansatzes aufmerksamgemacht werden und schließlich sollen alternative Analysenvorgeschlagen werden. Die Analysen werden mit neueren Ansätzen, diesich mit Polysemie befassen, verglichen, besonders mit derGenerative Lexicon-Theorie von Pustejovsky. Es werden ausschließlichProbleme im Zusammenhang mit der Polysemie von Substantivenbehandelt, auf die Semantik von Verben und Adjektiven wird ausPlatzgründen nicht eingegangen.Der hier formulierte Standpunkt weicht an vielen Punkten von dem ab,den ich in Pethő (1999) zusammengefasst habe, da jener Aufsatz schonvor mehr als zwei Jahren geschrieben wurde und sich meine Meinungseitdem zu vielen einschlägigen Fragen verändert hat. Wo sich diebeiden Standpunkte widersprechen, soll das hier Gesagte alsRevidierung des in Pethő (1999) Formulierten verstanden werden.
2. Was ist Polysemie und was wird Polysemie genannt?Diese beiden Fragen zu Anfang mögen zugegebenermaßen etwas seltsam,da tautologisch klingen, doch es wird sich herausstellen, dass ihreBeantwortung keineswegs trivial, jedoch außerordentlich wichtig ist.Polysemie ist seit mehr als einem Jahrzehnt eines der amintensivsten untersuchten Gebiete der lexikalischen Semantik –* Ich bedanke mich beim Láthatatlan Kollégium für die Bereitstellung der Voraussetzungen, die erst meine Arbeit an dem hier behandelten Thema ermöglicht haben, sowie bei meinem Betreuer beim Láthatatlan Kollégium, Prof. Ferenc Kiefer, dessen fachkundige Leitung mich zu zahlreichen Ideen im Zusammenhang mit dem Thema Polysemie verholfen hat, von denen ich viele auch hier verwendet habe und ohne dessen Hilfe und Ratschläge diese Arbeit nicht geschrieben worden wäre. Ich danke ferner der Fachstiftung „Diákok a Tudományért” der Stiftung Pro Renovanda Cultura Hungariae, die meinen Studienaufenthalt an der Universität Tübingen im Juli 1998 unterstützt hat, sowie allen, mit denen ich über die Themen dieser Arbeit diskutiert habe, besonders Prof. András Kertész und Prof. James Pustejovsky.
1
vielleicht sogar das am intensivsten untersuchte. VerschiedeneAspekte dieses schon seit den Anfängen der Beschäftigung mit derSprache wohl bekannten Phänomenbereichs werden von Anhängernverschiedener Theorien aus ihrem Gesichtspunkt, für den Aufbau derjeweiligen Sprachtheorie als besonders wichtig angesehen.Die Bezeichnung „Polysemie” wird, das muss gleich zu Beginn betontwerden, in der Fachliteratur nicht durchweg einheitlich verwendet.Worüber allgemein Konsens herrscht, ist allerdings die Definitionder Polysemie: so wird nämlich die Erscheinung genannt, wenn einWort (genauer: ein Lexem) über mehrere Bedeutungen verfügt. Daweiter auch allgemein angenommen wird, dass mehrere Bedeutungen nurdann einem Lexem zugeordnet werden können, wenn sie einanderausreichend ähnlich sind (sonst müsste man nämlich von mehrerenverschiedenen Lexemen sprechen), kann man diese Definition mit der(also eigentlich redundanten) Bedingung ergänzen, dass dasbetreffende Wort (das Lexem) über mehrere einander ähnliche /miteinander verwandte Bedeutungen verfügen muss. Polysemie wird indiesem Kontext gewöhnlich der Homonymie gegenübergestellt1, also derErscheinung, dass ein Wort (genauer: eine Wortform) potentiell übermehrere miteinander nicht verwandte Bedeutungen verfügen kann, wassich daraus ergibt, dass potentiell verschiedene Lexeme durch dieseWortform realisiert werden können2.Dass die Verwendung des Terminus „Polysemie” trotz der allgemeinenAkzeptiertheit dieser Definition nicht einheitlich ist, rührt zumTeil von der Tatsache her, dass sich mindestens zwei verschiedeneArten von Polysemie unterscheiden lassen3.
1 Ich gehe hier auf weitere Distinktionen, die gegenüber Polysemie gemacht werden, wie „Vagheit” und „Allgemeinheit der Referenz” nicht ein und verweise stattdessen auf die Einführung Cruse (1986) oder auf meine kürzere Vorstellung dieser Begriffe in Pethő (1999).2 Dass diese Gegenüberstellung schon rein konzeptuell sehr problematisch ist (von dem Problem der Zuordnung einzelner Fälle ganz zu schweigen), habe ich in Pethő (1999) kurz behandelt.3 Allerdings steht auch fest, dass nicht nur die Kompliziertheit des Phänomens, sondern auch die Vagheit der Definition selbst zu dieser Uneinheitlichkeit beiträgt. Es ist etwa unklar, was es heißt, dass zwei Bedeutungen einander ähnlich sind, wie verschieden die Interpretationen von zwei Vorkommen eines Wortes sein müssen, damit sie als zwei verschiedene Bedeutungen gelten, und wie verschieden siesein dürfen, damit sie immer noch als einander ähnlich bezeichnet werden können.
2
Einerseits gibt es Fälle, wo die Lesarten4, die bei einem bestimmtenLexem auftauchen können, nicht auf dieses eine Lexem beschränktsind: parallele Lesarten gibt es auch bei anderen Lexemen, derenBedeutung mit der Bedeutung dieses Lexems (in irgendeinem, näher zubestimmenden Sinne) verwandt ist, und parallele Lesarten könnensogar produktiv, bei neu geschöpften Wörtern desselben „semantischenFeldes” erzeugt werden. Ein bekanntes Beispiel für diese Art vonPolysemie wäre etwa das sog. „animal grinding”5, wo ein Lexem sowohlein Tier als auch das Fleisch dieses Tieres bezeichnen kann:
(1) In Afrika leben viele Strauße.(2) Ich habe gestern im Restaurant Strauß gegessen.
Eine (bei Substantiven) extrem verbreitete und produktive Instanzdieser Art von Polysemie ist auch die sog. „type-token-Ambiguität”,also das Vorhandensein einer spezifischen und einer generischen6
Lesart desselben Lexems. (1) wäre ein Beispiel für eine spezifischeLesart, (3) hingegen enthält die generische Lesart desselben Lexems(sowie des Ausdrucks ein Vogel):
(3) Der Strauß stammt von einem Vogel ab, der noch fliegen konnte.Diese Art der Polysemie, wo also bestimmte Lesarten parallel beivielen verschiedenen Lexemen vorkommen und dieses Muster auchproduktiv (etwa bei neu gebildeten oder typischerweise nicht in der
4 Ich verwende hier und im Folgenden die synonymen Ausdrücke Lesart, Interpretation und Bedeutungsvariante in der Weise, wie es in der Fachliteratur üblich ist: nämlich als Pendant zu Bedeutung, wobei erstere schwächere, unspezifischere Bezeichnungen sind als letzteres. Eine Bedeutung kann sich demnach in Form von mehreren Lesarten/Interpretationen manifestieren. Diese Bezeichnungen sind in dem Sinne unspezifischer als Bedeutung, dass wir mit ihnen jeden spürbaren semantischen Unterschied bezeichnen können ohne automatisch behaupten zu müssen, dass dieser semantische Unterschied zugleich auf zwei sich deutlich verschiedene Einheiten (zwei Bedeutungen) zurückzuführen sind. Diese Unterscheidung wird im Zusammenhang mit Polysemie interessant, da es konzeptuell problematisch sein kann, anzunehmen, dass ein Lexem mehrere verschiedene Bedeutungen haben darf, und es sich daher in diesem Zusammenhang anbietet, von zwei verschiedenen Lesarten zu sprechen, die jedoch möglicherweise auf eine gemeinsame Bedeutung zurückgehen. Die oben angegebene Definition der Polysemie lässt sich in diesem Sinne in der Weise modifizieren, dass wir von Polysemie sprechen, wenn ein Lexem mehrere Lesarten hat,was eine terminologisch gesehen relevante Modifizierung ist, konzeptuell jedoch dasselbe aussagt, wie die ursprüngliche Definition.5 S. z. B. Copestake/Briscoe (1996).6 Der Ausdruck „generisch” wird in der Semantik in zweierlei Weise verwendet, die miteinander nicht verwechselt werden sollten. Einerseits werden verallgemeinernde Äußerungen generisch genannt, die eine Art von Quantifikation enthalten, die der universalen Quantifikation ähnlich, jedoch schwächer ist (vgl. dazu Carlson/Pelletier, Hrsg. 1995). Andererseits wird (neben der ebenfalls typischen Bezeichnung „Type-Lesart”) eine bestimmte Lesart von lexikalischen Einheiten (genauer gesagt von Substantiven) so genannt, bei der die lexikalische Einheit sichnicht auf individuelle Objekte oder Lebewesen bezieht, die zur Extension des jeweiligen Wortes gehören, sondern auf die Gattung oder den Typ dieser Objekte oderLebewesen, also auf eine Abstraktion, die auf diesen Individuen basiert. Im Folgenden wird „generisch” stets in dieser Weise verstanden.
3
betreffenden Lesart gebrauchten Lexemen) erzeugt werden kann, könnenwir als „regelmäßige”7 oder „systematische Polysemie” bezeichnen.Die andere Art der Polysemie, die wir von der erstgenanntenunterscheiden müssen, lässt sich in Opposition zu dieser als „nicht-systematische Polysemie” bezeichnen. Sie umfasst alle Fälle, woverschiedene Lesarten eines Wortes nicht auch bei anderen Lexemenparallel vorhanden sind, sich jedoch offensichtlich ähnlich sind.Die typischen Beispiele für Polysemie, die in eher traditionellenWerken zur Semantik gewöhnlich genannt werden, gehören zu dieserGruppe. So sind etwa die beiden Lesarten von Birne ‘Frucht’ und‘Glühbirne’ Fälle nicht-systematischer Polysemie8.Obwohl das entscheidende Kriterium der Zuordnung zu diesen beidenGruppen eindeutig die Systematizität ist, kann als eine ergänzendeFaustregel auch zu Hilfe gezogen werden, dass Lesarten, die einesystematische Polysemie darstellen, eine metonymische Beziehungverbindet (also etwa eine Teil-Ganzes- oder eine Ursache-Wirkung-Beziehung), Lesarten hingegen, die eine nicht-systematischePolysemie darstellen, eine metaphorische Beziehung.Nun gibt es verschiedene Auffassungen bezüglich des Status dieserbeiden Gruppen von Polysemie und es gibt dementsprechend auchUnterschiede bei ihrer Bezeichnung.
1. Es gibt Werke (etwa Apresjan 1973 und wohl die Mehrzahl derholistischen kognitiven Linguisten, z. B. Taylor 1995), die diewohl mit der semantischen Tradition übereinstimmende Meinungvertreten, dass beide Gruppen in der Tat Fälle von Polysemieenthalten, dass also in beiden Fällen einzelne Lexeme mehrereBedeutungen besitzen.Deane (1987 passim, besonders jedoch 36–42) vertritt ebenfallsdiese weitere Auffassung von Polysemie und unterscheidetinnerhalb dessen zwei Typen: Allosemie und lexikalische
7 Diese Bezeichnung, „regular polysemy” (und dessen Gegenstück „irregular polysemy”)wurde in Apresjan (1973) eingeführt, und meines Wissens ist das auch das erste Werkin der Fachliteratur, das auf die Notwendigkeit der Unterscheidung von systematischer und nicht-systematischer Polysemie aufmerksam macht. Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass Apresjan den Begriff „regular polysemy” weniger streng verwendet, als er hier definiert wird, so dass viele der von ihm alsBeispiele der „regular polysemy” genannten Polysemieklassen nach den hier vorgestellten Kriterien zur nicht-systematischen Polysemie gezählt werden müssen.8 Es kann nun natürlich auch vorkommen, dass ein bestimmtes Wort z. B. die (einanderähnlichen) Lesarten s1, s2 und s3 hat, wobei Lesarten, die parallel zu s1 und s2 sind,auch bei anderen Lexemen auftreten, so dass dies als ein Fall der systematischen Polysemie angesehen werden muss; andererseits gibt es jedoch keine Lesart bei anderen Lexemen, die zu s3 parallel wäre, was wiederum als nicht-systematische Polysemie angesehen werden muss. Einen solchen Fall sehen wir etwa beim Wort Birne, wenn wir s1=’Birnenfrucht’, s2=’Birnbaum’ und s3=’Glühbirne’ nehmen (wobei Birne natürlich auch noch weitere Lesarten hat). Um Widersprüchen vorzubeugen empfiehlt es sich daher, systematische und nicht-systematische Polysemie nicht als Attribute von Lexemen (oder, vorsichtiger formuliert, von Wörtern) anzusehen, sondern als Relationen zwischen verschiedenen Lesarten eines Wortes.
4
Polysemie, die grundsätzlich jeweils mit systematischer bzw.nicht-systematischer Polysemie identisch sind.
2. Die meisten Vertreter der heutigen lexikalischen Semantik, dienicht der holistischen kognitiven Richtung angehören, nehmeneine weit restriktivere Haltung gegenüber Polysemie ein. Siemeinen, dass von diesen beiden Gruppen nur Fälle dersystematischen Polysemie als „Polysemie” bezeichnet werdenkönnen und es nur bei ihnen der Fall ist, dass einem Lexemmehrere miteinander eng zusammenhängende Bedeutungsvariantenzugeordnet werden. Nicht-systematische Polysemie ist gar keinePolysemie, sondern vielmehr (lexikalische) Homonymie, daangenommen wird, dass es sich hier um verschiedene Bedeutungenhandelt, die zu jeweils anderen Lexemen gehören, welche sichallerdings morphologisch, phonologisch und weitgehend auchsyntaktisch gleichen. Nach diesem Standpunkt wird derÄhnlichkeit zwischen solchen Bedeutungen (etwa der Ähnlichkeitder beiden genannten Bedeutungen von Birne) nicht Rechnunggetragen.Zu dieser Gruppe gehören z. B. Cruse (1986: 80) und dieVertreter der Generative Lexicon-Theorie um Pustejovsky (s. dazuvor allem Pustejovsky 1995 und Pustejovsky/Boguraev Hrsg.,1996).
3. Obwohl das in der neueren Diskussion zum Thema Polysemie keinebesonders bedeutende Rolle mehr spielt, sollte auch erwähntwerden, dass die semantische Fachliteratur vor dem Beginn derneueren Polysemieforschung entweder keine Kenntnis vonsystematischer Polysemie nahm oder sie zumindest nicht vonnicht-systematischer Polysemie unterschied. Nach dieser älteren,vor den 80er Jahren vorherrschenden Terminologie wurde also vorallem nicht-systematische Polysemie als Polysemie bezeichnet.
Neben der Dichotomie „systematisch – nicht systematisch”, die in derFachliteratur verhältnismäßig verbreitet ist, muss noch eine dritteGruppe erwähnt werden, die in den meisten der genannten Ansätzeunter Polysemie fällt. Es handelt sich um Lexeme, die in einzelnenKontexten verschiedene Interpretationen besitzen können, die zwarnicht parallel bei anderen Lexemen vorkommen (also nichtsystematisch sind), die aber teilweise offensichtlich, teilweisenach einer näheren Untersuchung auf dieselbe „Kernbedeutung” desLexems zurückzuführen sind. Die meisten Verben haben z. B. einegroße Zahl von voneinander leichter oder stärker abweichendenInterpretationen in verschiedenen Kontexten, die zwar nichtsystematisch bei anderen Verben anzutreffen sind, die wir aberdennoch nicht verschiedene Bedeutungen nennen wollen (d. h. nichtverschiedenen Lexemen zuordnen wollen), da sie sich offensichtlichsehr ähnlich sind. Diese Interpretationen ergeben sich nach Ansichtvieler Semantiker aus der Unterspezifiziertheit der Bedeutung dieser
5
Lexeme in Hinsicht auf die fraglichen Interpretationen9. Der mentaleZustand, der durch das Verb mögen etwa in den folgenden Fällenbezeichnet wird, ist zwar natürlich verschieden, wir wollen aber dieeinzelnen Beispiele nicht als Instanzen von verschiedenen Verben(mögen1, mögen2 etc.) mit verschiedenen Bedeutungen auffassen:
(4) Ich mag unseren Postboten.(5) Ich mag Rembrandt.(6) Ich mag Mathematik.(7) Ich mag Kekse.(8) Mir schmecken zwar keine Fische, aber ich mag Hecht immer
noch mehr als Karpfen.Neben diesen Fällen gibt es auch zahlreiche Beispiele, wo es sicheindeutig nicht um systematische Polysemie handelt, aber um etwas,was ihr zumindest auf den ersten Blick sehr ähnlich ist. Sie sindder systematischen Polysemie sogar dahingehend ähnlich, dass sieebenfalls metonymisch motiviert sind, z. B.:
(9) Die ganze Schule hat sehr gute Noten erzielt.Dieser Satz kann dem folgenden gegenübergestellt werden:
(10) Die ganze Schule hat an dem Ausflug teilgenommen.(10) stellt einen Fall systematischer Polysemie dar: mit denBezeichnungen von Institutionen können wir uns in der Regel auf dieGesamtheit von Menschen beziehen, die dieser Institution angehören.Dies ist nicht nur bei Schulen, sondern auch bei anderenInstitutionen möglich:
(11) Die ganze Firma hat an dem Ausflug teilgenommen.(9) ist dieser Art von Polysemie intuitiv sehr ähnlich (es handeltsich z. B. ebenfalls um eine Art Metonymie, die auf der Teil-Ganzes-Beziehung basiert), es gibt aber einen wichtigen Unterschied: die9 Dass die Bedeutung eines Lexems in Hinsicht auf seine Interpretationen unterspezifiziert ist meint, dass die Interpretationen des Lexems in gegebenen Kontexten nicht allein durch die Bedeutung des Lexems determiniert sind, d. h. es sind nicht alle Informationen in der Semantik des Lexems spezifiziert, die zu seiner Interpretation in einzelnen Kontexten notwendig sind. Daraus folgt, dass sich die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks nicht einfach durch die Addierung der Bedeutungen seiner Teile ergibt. Es muss hinzugefügt werden, dass Unterspezifiziertheit dementsprechend zwei Aspekte hat. Einerseits kann man sie, imSinne der Gesagten von der Semantik der lexikalischen Einheit her betrachten, d. h.feststellen, dass bestimmte Informationen, die beim Gebrauch der lexikalischen Einheit erscheinen, nicht in seiner Semantik spezifiziert sind. Andererseits kann man sie von der Bedeutung komplexer Ausdrücke her betrachten und sich darauf beziehen, dass ihre Bedeutung nicht durch die Semantik ihrer Teile spezifiziert ist. Diese beiden Aspekte spiegeln sich auch darin, dass die Verwendung des Terminus Unterspezifiziertheit in der Fachliteratur nicht durchweg einheitlich ist,sondern sich eben in der Wahl zwischen diesen beiden Sichtweisen untescheidet.Näheres zum Begriff der Unterspezifiziertheit insbesondere im Zusammenhang mit der Zwei-Ebenen-Semantik s. unten, besonders Abschnitt 3.Es sollte auch erwähnt werden, dass der Begriff der Unterspezifiziertheit in der aktuellen Diskussion in der Semantik ziemlich im Mittelpunkt steht, vgl. etwa die beiden thematischen Ausgaben des Journal of Semantics (Jahrgang 1998, Band 15 Heft 1 und 2), herausgegeben von Blutner und van der Sandt.
6
ganze Schule bezieht sich hier nicht auf die Gesamtheit der Menschen,die der Schule angehören, sondern nur auf die Schüler. DieseBedeutungsvariante ist offensichtlich nicht systematisch: Es gibtkeine andere Institutionsbezeichnung (abgesehen von den Hyponymenvon Schule, die wir aber außer Acht lassen sollten), die eine Lesart‘alle Schüler, die dieser Institution angehören’ besitzt.Innerhalb des Phänomenbereichs Polysemie können wir also dreiverschiedene Gruppen unterscheiden, die auch in sich selbst weitergegliedert werden könnten: 1. systematische, in der Regelmetonymisch motivierte Polysemie; 2. nicht-systematische, in derRegel metaphorisch motivierte Polysemie; 3. nicht-systematische,durch Unterspezifiziertheit oder durch Metonymie motiviertePolysemie.Da bei den Gruppen 1. und 3. als Kriterium genannt wurde, dass essich bei der Polysemie in diesen Fällen um Bedeutungsvariationhandeln muss, die auf eine gemeinsame Bedeutung eines Lexemszurückgeht und nicht um mehrere einander ähnliche, aber dennochverschiedene Bedeutungen, sollten wir diese beiden Gruppenzusammenfassen und als „harte Polysemie” bezeichnen10. Bei der Gruppe2. handelt es sich um Fälle, wo die betreffenden Wörter wie schongesagt mehrere unterschiedliche, aber einander ähnliche Bedeutungenhaben. Nennen wir diese Art von Polysemie (die, wie schon erwähnt,von vielen Forschern gar nicht als Polysemie sondern als Homonymieinterpretiert wird) zur Unterscheidung von der vorigen Gruppe„weiche Polysemie”.Nun stellt sich natürlich die Frage, a) welche Terminologie dieZwei-Ebenen-Semantik verwendet und b) welche Terminologie in dieserArbeit verwendet werden soll, was also eigentlich mit der im Titelerwähnten „Behandlung der Polysemie” gemeint ist.In einem der bekanntesten Werke der Zwei-Ebenen-Semantik, Bierwisch(1983a), vertritt Bierwisch den Standpunkt, dass die von ihmbeschriebenen Fälle (die nach der oben vorgestellten TerminologieInstanzen der harten Polysemie sind) keine Ambiguität darstellen(darauf soll bei der Vorstellung der Zwei-Ebenen-Semantik weiter
10 Es sollte bemerkt werden, dass harte Polysemie in bestimmten Fällen, und besonders in der Verbalsemantik, nur schwer von genereller Bedeutung eines Lexems auseinanderzuhalten ist. Generelle Bedeutung ist für alle Inhaltswörter einer Sprache außer Eigennamen charakteristisch und ergibt sich aus der Tatsache, dass Lexeme der Klassifizierung dienen. Dass das Wort Tisch etwa sehr verschiedene Objektebezeichnen kann (Schreibtische, Rauchtische, Tischtennistische etc.) ergibt sich daraus, dass Tisch eine generelle Bedeutung hat und nicht daraus, dass es polysem ist. Es kann nun zuweilen recht schwierig sein, zwischen diesen beiden Alternativenzu entscheiden. Sind die Vorkommen von stehen etwa in den beiden Sätzen Peter steht neben Susanne. und Die Kirche steht am Hauptplatz. Instanzen derselben generellen Bedeutung von stehen oder von zwei verschiedenen Bedeutungsvarianten (d. h. Polysemie)?Obwohl diese Entscheidungen praktisch nur schwer zu fällen sind, sollte betont werden, dass harte Polysemie Phänomene im Zusammenhang mit genereller Bedeutung nicht umfasst.
7
unten näher eingegangen werden). Da Polysemie jedoch nach dertraditionelleren Auffassung (wo wie gesagt unter Polysemie vor allemdie nicht-systematische Variante verstanden wurde) eine Art derAmbiguität bezeichnet, hat Bierwisch daher aus einem guten Grundnicht diesen Terminus zur Charakterisierung der beschriebenenErscheinungen verwendet11, sondern sich stattdessen auf sounspezifische Bezeichnungen beschränkt, wie verschiedene„Interpretationen” oder „Varianten” einer lexikalischen Einheit.In Bierwisch (1983a) wurde also die Art von systematischerBedeutungsvariation, die die neuere Fachliteratur „systematischePolysemie” nennt, nicht als Polysemie bezeichnet, und dasselbe giltauch für die wohl wichtigsten, klassischen Arbeiten zur Zwei-Ebenen-Semantik, die Beiträge in Bierwisch/Lang (Hrsg., 1987). In mehrerenneueren einschlägigen Aufsätzen im Rahmen der Zwei-Ebenen-Semantik12
wurde der Ausdruck „Polysemie” allerdings in der Regel eben fürdiese Phänomene verwendet13, was als eine Annäherung an die heuteakzeptierte Terminologie zu verstehen ist und wohl kaum als eineFolge einer Veränderung der theoretischen Einschätzung der Phänomeneinnerhalb der Zwei-Ebenen-Semantik.In dieser Arbeit schließlich werde ich den Ausdruck „Polysemie” alsBezeichnung für sowohl systematische als auch nicht-systematischeharte Polysemie verwenden, also in Einklang mit mehreren neuerenArbeiten in diesem Ansatz und also ebenfalls abweichend von derTerminologie von Bierwisch (1983a). Ich möchte innerhalb diesesPhänomenbereichs vorerst keine weiteren Differenzierungen anstellenund alles, was auf den ersten Blick harte Polysemie zu sein scheint,als Polysemie akzeptieren. Wichtige und teils in der bisherigenFachliteratur noch nicht in Betracht gezogene Differenzierungensollen aber später vorgestellt werden.
3. Die Interpretation der Polysemie in der Zwei-Ebenen-SemantikDie folgende Darstellung der Behandlung der Polysemie in der Zwei-Ebenen-Semantik beruht grundsätzlich auf dem Aufsatz Bierwisch(1983a), die die sozusagen „klassische” Ausprägung der Zwei-Ebenen-Semantik vorstellt. Im Prinzip dasselbe System wird auch inBierwisch (1983b), in Bierwisch/Lang (Hrsg., 1987), sowie in11 Ein anderer Grund, der die Entscheidung motiviert, diese Bedeutungsvariationen nicht „Polysemie” zu nennen dürfte natürlich auch jener sein, dass Bierwisch zwei Arten von Variation vorstellt, die jeweils durch konzeptuelle Verschiebung und konzeptuelle Differenzierung erzeugt werden (s. weiter unten) und eine gemeinsame Bezeichnung hätte die bedeutenden Unterschiede unter diesen beiden Arten von Variation verwischt.12 Z. B. Dölling (1992, 1994), Gerstl (1992), Egg (1994), Pause/Botz/Egg (1995), Schwarze/Schepping (1995).13 Es muss hinzugefügt werden, dass in manchen dieser Arbeiten auch Fälle von nicht-systematischer harter Polysemie behandelt und als „Polysemie” bezeichnet werden. Diese werden aber zumeist nicht eindeutig von systematischer harter Polysemie unterschieden.
8
weiteren Werken von Bierwisch und Lang vorgestellt und angewendet.Die Bezeichnung „Zwei-Ebenen-Semantik” für diesen Ansatz wurde inArbeiten von Lang (s. z. B. 1994) eingeführt und wurde seitdem zurallgemein verwendeten Bezeichnung der Theorie.Um die Motivation der Ideen der Zwei-Ebenen-Semantik zu verstehen,muss noch hinzugefügt werden, dass sie von einem strengmodularistischen Kognitionsmodell ausgeht, also annimmt, dass a) dieKognition des Menschen aus verschiedenen relativ unabhängigenModulen mit speziellen Funktionen besteht, z. B. aus den ModulenSprache, Perzeption, begriffliches System etc.14; sowie b) dieseModule sich ebenfalls in verschiedene Teilmodule mit speziellenAufgaben gliedern, die Sprache etwa in die Teilmodule syntaktisches,semantisches, phonologisches System, Lexikon etc.
3.1. Semantische und konzeptuelle InformationDie Zwei-Ebenen-Semantik nimmt an, dass sich die Interpretation vonsprachlichen Ausdrücken in zwei Schritten vollzieht. Dielexikalischen Einheiten, die in den jeweiligen Ausdrücken enthaltensind, steuern eine bestimmte, für sie charakteristische (und in dersemantischen Repräsentation der lexikalischen Einheit enthaltene)semantische Information zur Interpretation bei. Diese semantischenInformationen reichen jedoch nicht aus, um einen Ausdruck zuinterpretieren, da sie im Hinblick auf die Bedeutung des gesamtenAusdrucks unterspezifiziert15 sind. Das heißt: wenn wir diesemantischen Informationen addieren, die zu allen lexikalischenEinheiten gehören, die in einem Ausdruck enthalten sind (wobei wirnatürlich auch die Struktur des Ausdrucks beachten), ergibt dasnicht die tatsächliche Bedeutung des Ausdrucks, sondern etwas, wasnoch ergänzt (spezifiziert) werden muss, um diese zu erhalten. DieZwei-Ebenen-Semantik nimmt nun an, dass diese Spezifizierung imGegensatz zur vorhin genannten semantischen Information nicht mehrsprachlicher Art ist, sondern konzeptuell. Das heißt, dass dasbegriffliche (konzeptuelle) System des Menschen ebenfalls an derInterpretation teilnimmt, indem es nämlich anhand der vorgegebenensemantischen Informationen weitere Informationen hinzufügt.Die Interpretation eines sprachlichen Ausdrucks A können wir alsofolgendermaßen darstellen:
LE1 LE2 ... LEn CS(11) (SEM1 + SEM2 + ... + SEMn)SEMA M(A)
Die n lexikalischen Einheiten LE, aus denen A besteht, tragenjeweils mit der semantischen Information SEM, die ihnen (neben
14 Dazu s. Bierwisch (o. J.).15 Zum Terminus unterspezifiziert vgl. Fußnote 9.
9
phonologischen und morphosyntaktischen Informationen) im Lexikonzugeordnet ist, zur Interpretation bei und ergeben die komplexesemantische Repräsentation SEMA des Ausdrucks A. Dieseunterspezifizierte semantische Information wird vom konzeptuellenSystem CS analysiert und es werden sowohl an die jeweiligensemantischen Einheiten SEM1, SEM2 etc. als auch an dieGesamtrepräsentation SEMA weitere Informationen hinzugefügt (wobeiauch der sprachliche Kontext berücksichtigt wird), die einesinnvolle Interpretation des Ausdrucks, M(A) ermöglichen.Diese beiden Schritte der Interpretation, also die Bestimmung dersemantischen Repräsentationen und deren konzeptuelle Modifizierung,stellen die beiden Ebenen dar, auf die sich die Bezeichnung „Zwei-Ebenen-Semantik” bezieht. Wenn A als eine Äußerung erscheint, kommtaußer diesen beiden noch eine dritte Ebene hinzu, eine sozusagenpragmatische Interpretation16. Diese operiert auf sog.kontextinterpretierten Äußerungen, d. h. sie folgt auf derenkonzeptuelle Interpretation. Der Äußerung wird von dem System vonInteraktionsstrukturen (einem weiteren kognitiven Modul) unterBerücksichtigung eines Interaktionsrahmens ein „kommunikativer Sinn”zugewiesen. Da dieser Aufsatz lediglich semantische Themenuntersucht, werde ich diese Ebene der Interpretation im Folgendennicht weiter verfolgen. Es zeigt jedoch, dass pragmatische Phänomenein dieser Theorie von semantischer und konzeptueller Interpretationunterschieden werden und hilft daher einzuengen, was diekonzeptuelle Interpretation leisten bzw. nicht leisten soll.
3.2. Die Funktion der beiden Ebenen in der Ableitung von Bedeutungsvarianten: Ein BeispielDie wohl wichtigste Motivation für die Annahme einer Zwei-Ebenen-Architektur sind Phänomene der harten Polysemie. Sie sind nämlichnach der Ansicht der meisten Vertreter dieses Ansatzes nicht in densemantischen Repräsentationen SEM der jeweiligen lexikalischenEinheiten kodiert, sondern ergeben sich erst durch derenkonzeptuelle Interpretation in den einzelnen Kontexten.Dass diese Fälle etwa von Bierwisch nicht als „Polysemie” bezeichnetwerden, wurde schon erwähnt und nachdem wir die Annahmen der Theorienäher untersucht haben, lässt sich auch der wohl wichtigste Grundfür diese terminologische Entscheidung finden: Die Verwendung derBezeichnung „Polysemie” wäre rein konzeptuell falsch (dairreführend), da es sich nach der Zwei-Ebenen-Semantik im Gegensatzzur Etymologie des Wortes Polysemie nicht um mehrere semantischeInformationen handelt, die einer lexikalischen Einheit (also einemLexem) zugeordnet sind, sondern lediglich um verschiedenekontextuell bedingte Varianten (Realisierungen) eines monosemenLexems.
16 Allerdings meidet Bierwisch bewusst die Bezeichnung dieser Ebene als pragmatischeEbene.
10
Nehmen wir das klassische und wohl bekannte Beispiel derlexikalischen Einheit Schule, um das bisher Gesagte zu illustrieren17:
(12) Die Schule hat ein Flachdach. ‘Gebäude’(13) Die Schule spendete einen größeren Betrag.
‘Institution’(14) Die Schule macht ihm großen Spaß. ‘Ensemble von
Prozessen’(15) Die Schule ist eine der Grundlagen der Zivilisation.
‘Institution als Prinzip’Schule erscheint in diesen Sätzen in jeweils verschiedenen Lesarten.Die Zwei-Ebenen-Semantik nimmt nun an, dass Schule im Lexikon einesdeutschen Sprechers als eine lexikalische Einheit erscheint, dereine mentale semantische Repräsentation SEM zugeordnet ist. DieseRepräsentation enthält alle semantischen Informationen, die derlexikalischen Einheit zugeordnet sind und wird von Bierwischfolgendermaßen grafisch dargestellt:
(16) x [ZIEL x w] | w = LEHR- UND LERNPROZESSE.
Diese Repräsentation ist im Hinblick auf den tatsächlichen Beitragvon Schule zur Interpretation der Sätze (12)–(15) offensichtlichunterspezifiziert, da sie eben die Informationen nicht angibt, diediese einzelnen Lesarten voneinander unterscheiden. Sie stelltvielmehr die Invariante dar, die in allen vier Fällen (und auch insämtlichen sonstigen relevanten Vorkommen von Schule) gleich ist. DieSpezifizierung der aktuellen Bedeutungsvariante geschieht währendder kontextuellen Interpretation, d. h. nachdem das Lexem in einengegebenen Kontext (z. B. einen Satz) eingefügt wurde.Die Spezifizierung wird vom konzeptuellen System durchgeführt, wasso zu verstehen ist, dass nicht die Wortbedeutung vorschreibt, wasfür Interpretationsmöglichkeiten das Lexem Schule hat, sondern unserkonzeptuelles System, das auch die Kenntnisse enthält, die wir überSchulen haben, d. h. dass die Schule eine Institution ist, zu der inder Regel ein oder mehrere Gebäuden gehören, wo eine Tätigkeitausgeübt wird, die für diese Institution charakteristisch ist usw.Das können wir z. B. anhand der unterschiedlichen Interpretationender Beispiele (9) vs. (10) leicht einsehen: die in (9) gegebeneLesart von Schule, ‘Gesamtheit von Schülern, die zu dieser Institutiongehören’, ließe sich nur kompliziert durch eine semantischeSpezifizierung dieser möglichen Lesart in der lexikalischensemantischen Repräsentation dieses Lexems festlegen. Diese Lösungwürde ferner auch schon der observationellen Adäquatheit nichtgenügen, da sie nicht der kreativen Verwendung von lexikalischenEinheiten Rechnung tragen würde (dass wir also lexikalischeEinheiten prinzipiell in sehr vielen Bedeutungsvarianten verwenden
17 Bierwisch (1983a: 81).
11
können; man denke an die Beispiele und Argumente in Nunberg 1980).Die Spezifizierung von (16), die also vom konzeptuellen Systemgesteuert wird, geschieht genauer durch Operationen, die weiterePrädikate in (16) einführen. (17) etwa leitet aus (16) dieInterpretation in (12) her:
(17)SEMx [GEBÄUDE x UND SEM x]Wenn wir die Funktion (17) auf (16) anwenden, erhalten wir (18):
(18) x [GEBÄUDE x UND ZIEL x w] | w = LEHR- UNDLERNPROZESSE.
Das heißt, wir erhalten, dass jenes etwas, dessen Ziel die Lehr- undLernprozesse sind, ein Gebäude ist. Die weiteren Varianten (13)–(15)erhalten wir durch die Anwendung von Operationen, die zu (17) analogsind, auf (16).Das konzeptuelle System wählt diejenige Operation, die im jeweiligenFall angewendet werden soll, aus der Menge seiner Alternativenanhand des Kontexts aus. Wenn im Kontext etwa eine Eigenschaft einesGebäudes wie in (12) oder eine lokale Angabe im Zusammenhang mitSchule vorkommt, wird die Bedeutung dieses Wortvorkommens durch (17)als ‘Gebäude’ spezifiziert und nicht etwa als ‘Institution’ durcheine zu (17) analoge Funktion.Es muss außerdem bemerkt werden, dass die Informationen, die diekonzeptuell gesteuerten Operationen wie (17) enthalten, der Formnach offensichtlich identisch mit den Informationen sind, die dielexikalischen semantischen Repräsentationen enthalten. Beideenthalten Dekompositionsstrukturen, die aus Prädikaten, Variablen,Junktoren und Operatoren bestehen und sind sogar miteinanderkombinierbar. Das ist aber, wie Taylor (1994) feststellt, nichtunproblematisch, da sie ja jeweils zu verschiedenenRepräsentationsebenen bzw. Modulen der Sprache gehören, zur Semantikbzw. zum konzeptuellen System nämlich. Dies ist jedoch nur auf denersten Blick inkohärent und stellt tatsächlich keinen Widerspruchdar, da die Prädikate, die die semantischen Repräsentationenenthalten, wie GEBÄUDE, ZIEL, INSTITUTION etc. Konzepte bezeichnen, dieTeile des konzeptuellen Systems sind und nicht des semantischen. DieAufgabe des semantischen Moduls besteht demnach im Falle vonlexikalischen Einheiten darin, der lexikalischen Einheit jenekonzeptuellen Einheiten zuzuordnen, die die unterspezifiziertesemantische Repräsentation dieser lexikalischen Einheit ergeben, dieVariablen, die in diesen konzeptuellen Einheiten enthalten sind, zubinden, sowie die kompositionalen Beziehungen zwischen diesen zuspezifizieren18.18 Des Weiteren können wir annehmen, dass die Semantik auch andere Aufgaben besitzt,wie etwa die Interpretation von Quantoren und die kompositionale Zusammensetzung von komplexen Ausdrücken. Der Status des semantischen Systems in der Zwei-Ebenen-Semantik ist jedoch m. E. nicht ganz eindeutig. Die Literatur der Zwei-Ebenen-Semantik behauptet nämlich, dass die Phänomene, die von mir als harte Polysemie bezeichnet werden, dafür sprechen, das semantische System vom konzeptuellen zu
12
3.3. Das technische Instrumentarium der Zwei-Ebenen-SemantikDie Zwei-Ebenen-Semantik unterscheidet zwei Arten von Operationen,die die Bedeutungsvarianten (also die verschiedenen Lesartenpolysemer Lexeme) von den unterspezifizierten lexikalischenRepräsentationen ableiten:a) Konzeptuelle Verschiebung „verschiebt” eine bestimmte semantischeRepräsentation unter einen Begriff, d. h. sie führt eine odermehrere Komponenten in die Repräsentation ein. Die oben, unter (12–15) angegebenen Bedeutungsvarianten von Schule sind z. B. durchkonzeptuelle Verschiebung entstanden. Die Operation (17), die weiteroben näher besprochen wurde, ist eine Operation der konzeptuellenVerschiebung.b) Konzeptuelle Differenzierung hingegen führt keine völlig neuenElemente in die semantische Repräsentation ein, sondern siepräzisiert deren Inhalt in einer bestimmten, oft nur schwergreifbaren Weise. Die Differenzierung bedeutet die Ausfüllung einesParameters in der semantischen Repräsentation (technisch wird einerin ihr stehenden existenzquantifizierten Variablen ein bestimmterWert zugewiesen)19.Das Attribut „konzeptuell” bezieht sich darauf, dass diese beidenOperationen erst auf der konzeptuellen Ebene in der Interpretationerscheinen und Teile des konzeptuellen Moduls, also keine Teile desSprachsystems sind.Diese Operationen enthalten jedoch keine Informationen darüber, wann
trennen. Das trifft aber in dieser Form kaum zu. Vielmehr sprechen diese Beispiele dafür, Weltwissen von Wortbedeutung zu trennen, d. h. in der Interpretation von sprachlichen Ausdrücken lexikalisch kodierte und lexikalisch nicht kodierte, sondern kontextuell eingeführte Informationen zu unterscheiden, mit anderen Worten also ein separates lexikalisches System und ein konzeptuelles anzunehmen. Da jedochinfolge der Interpretation alle Informationen, die in der semantischen Repräsentation enthalten sind, in die konzeptuelle Ebene übertragen werden, und es also anscheinend keine Repräsentationen gibt, die nur im semantischen System existieren, scheint nichts dagegen zu sprechen, das semantische System unter das konzeptuelle zu subsumieren.Taylor (1994) gelangt, zwar aufgrund grundsätzlich verschiedener Prämissen, aber ebenfalls zum gleichen Schluss (s. auch Pethő 1999; vgl. außerdem auch Meyer 1994).Ich möchte im Folgenden diesen zugegebenermaßen recht ketzerischen Gedanken nicht weiter verfolgen. Die grundsätzliche Frage im Zusammenhang mit Polysemie ist nämlich nicht, ob es ein autonomes semantisches System gibt, sondern was im Lexikonvon der Bedeutung der lexikalischen Einheiten spezifiziert ist und wie diese Information gegebenenfalls ergänzt wird.19 Die Bedeutung des Verbs aufwecken enthält z. B. die Information, dass die durchseine Subjektergänzung bezeichnete Entität etwas tut, demzufolge die durch seineObjektergänzung bezeichnete Entität erwacht. In dem folgenden Kontext zum Beispiel:
(F1) Der Wecker hat Petra aufgeweckt.wird der Inhalt des Verbs aufwecken durch eine konzeptuelle Differenzierungpräzisiert, die angibt, wie der Wecker Petra aufgeweckt hat (im Normalfall alsodurch Klingeln). Das Ergebnis der konzeptuellen Differenzierung entspricht imWesentlichen der Erscheinung, die Cruse kontextuelle Modulation nennt (1986: 52–3).
13
sie angewendet werden sollen oder dürfen (sie sind also an sichweder reguliert noch irgendwie restringiert). Sie sind deshalb aufeine externe Instanz angewiesen, die ihre Anwendung steuert. DieseInstanz ist die sogenannte konzeptuelle Selektion:c) Konzeptuelle Selektion wählt anhand des Kontextes aus, welche vonden möglichen Lesarten der einzelnen Wortvorkommen in dembetreffenden Kontext realisiert wird und stimmt dadurch dieBedeutungen der zusammen auftretenden Wörter aufeinander ab. Im Fallvon (14) entscheidet z. B. die konzeptuelle Selektion anhand vonmacht ihm Spaß, dass Schule von seinen oben aufgezähltenInterpretationsmöglichkeiten in diesem Kontext die Lesart ‘Ensemblevon Prozessen’ erhält. Es werden aber nicht nur sprachlicheInformationen bei der Interpretation der einzelnen Wortvorkommenberücksichtigt, sondern auch allgemeines Weltwissen. Das Wissendarüber, was Schulen sind (also Institutionen, die ihren Sitz inGebäuden haben etc.), stellt uns z. B. erst die Liste der möglichenLesarten in (12)–(15) bei der Interpretation zur Verfügung.Obwohl sowohl die konzeptuelle Selektion als auch die beidenkonzeptuellen Operationen nicht sprachliche, sondern wie gesagtkonzeptuelle Entitäten darstellen und ihre Erforschung daher nichtprimär die Aufgabe der Sprachwissenschaft ist20, untersucht die Zwei-Ebenen-Semantik doch gerade diese. Es ist nämlich auch für dieSprachwissenschaft, und innerhalb deren für die Semantikinteressant, wie die Interaktion zwischen dem Sprachsystem und demkonzeptuellen System beschaffen ist. Allerdings hat sich die Zwei-Ebenen-Semantik vor allem mit den beiden Operationenauseinandergesetzt, mit der Selektion jedoch kaum21. So ist bei derheutigen Forschungslage m. E. nicht geklärt, ob aus der Perspektiveder Linguistik überhaupt etwas positiv über die konzeptuelleSelektion gesagt werden kann.Es sollten dieser skizzenhaften Charakterisierung desInstrumentariums der Zwei-Ebenen-Semantik einige Anmerkungenhinzugefügt werden, die aus der Perspektive der in diesem Aufsatzdarzulegenden Vorschläge interessant sind. Einerseits isthervorzuheben, dass Bierwisch anscheinend für alle Vorkommen vonlexikalischen Einheiten in einem Ausdruck jeweils nur eine einzigekonzeptuelle Verschiebung bzw. Differenzierung vorsieht. Er nimmtan, dass Lesarten generell nicht in der Weise entstehen, dass einegegebene Lesart (z. B. ‘Institution’ bei Schule) in eine andere (z.
20 Dies wird auch von Bierwisch erwähnt, s. (1983a: 81).21 Als eine Ausnahme ist Dölling (1992, 1994) zu erwähnen, der sortale Selektionsbeschränkungen vorschlägt, die als Restriktionen für die Anwendung der konzeptuellen Verschiebung fungieren. Trotz der Beschränkungen, die Dölling vorschlägt, scheint sein System dennoch derart überzugenerieren, dass seine Lösung kaum als eine befriedigende Charakterisierung der konzeptuellen Selektion angesehenwerden kann.
14
B. ‘Lokalität’, d. h. ‘Gebäude’) überführt wird22. SolcheZusammenhänge zwischen den Lesarten eines Wortes, wie sie von demsogenannten radial set-Modell in der kognitiven Semantik angenommenwerden23, sind (ganz abgesehen von dem prototypentheoretischenHintergrund dieser Analysen) in der Zwei-Ebenen-Semantik nichtvorgesehen (an ihrer Stelle stehen ja die Unterspezifiziertheit unddie beiden erwähnten konzeptuellen Operationen).Um das mit einem kurzen Beispiel zu illustrieren, betrachten wir dieVerwendung des Wortes Tür in den folgenden Kontexten:
(19) Veronika ist durch die Tür gegangen.‘Öffnung’(20) Der Tischler hat die Tür aus ihren Angeln gehoben und auf
den Boden gelegt.‘Gegenstand’
(21) Sandra steht gerade in der Tür.‘Öffnung als Behälter’
Intuitiv sind ‘Öffnung’ und ‘Gegenstand’ die beiden primärenLesarten des Wortes, die dritte Lesart in (21) scheint wiederum ausder Lesart ‘Öffnung’ abgeleitet zu sein. Ein ähnliches Beispiel wäre‘Institution als Prinzip’ als eine Interpretationsvariante von Schulein (15), die intuitiv auf die Lesart ‘Institution’ (vgl. 13)zurückführbar zu sein scheint. Das Instrumentarium der Zwei-Ebenen-Semantik würde in solchen Fällen keine Ableitung erlauben, die ausmehreren Schritten besteht, sondern die gewünschten Interpretationendurch eine einzige konzeptuelle Verschiebung ableiten, die dieunterspezifizierte semantische Repräsentation der jeweiligenlexikalischen Einheit unmittelbar in sie überführt. Der ziemlichstarken (aber dennoch natürlich nicht unbedingt richtigen)Intuition, nach der in solchen Fällen mehrere Phasen der Ableitungerwünscht wären, wird also von der Zwei-Ebenen-Semantik nach demVorschlag von Bierwisch (1983a) nicht Rechnung getragen.Dass mehrere konzeptuelle Verschiebungen nicht sukzessiv angewendetwerden können, erkennt man auch am Schema der konzeptuellenVerschiebung:
(22)SEMx [P x UND SEM x]Als Eingabe dieser Operation dient nämlich eine semantischeRepräsentation SEM, und da wir uns nach der Durchführung einerkonzeptuellen Verschiebungsoperation schon auf der konzeptuellenEbene befinden und der Output dieser Operation dementsprechend keinesemantische Repräsentation ist, sondern eine konzeptuelle, kannlogischerweise keine Verschiebung mehr angewendet werden.Eine weitere Anmerkung betrifft die Interpretation der Polysemie bei
22 S. dazu die Argumentation in Bierwisch (1983a) und besonders die Beispiele Schule (82) und Oper (84).23 Zu den verschiedenen Repräsentationsarten in den (holistischen) kognitiven Semantiken vgl. die kurze Zusammenfassung bei Geeraerts (1995).
15
Lang (1995). Wie gesagt wurde Polysemie in den beiden bekanntestenWerken der Zwei-Ebenen-Semantik, Bierwisch (1983a) undBierwisch/Lang (Hrsg., 1987) nicht definiert. Allerdings enthält einneuerer Aufsatz, Lang (1995) die folgende Definition:„Polysemie: Mehrdeutigkeit eines Lexems L in der Weise, daß einerphonetischen Form /L/ bei partiell gleichen kategorialen Merkmalen[L] aufgrund grammatisch gerechtfertigter und in [GF] und AS zuvermerkender Differenzen mehrere semantische Formen SF(L)1,SF(L)2, ..., zugeordnet werden müssen.”24
[GF] sind die grammatischen Features der lexikalischen Einheit, etwakategoriale Merkmale wie [+N] oder morphosyntaktische Merkmale wie[+Finit] und [+direktional]. AS ist die Argumentstruktur, die nachLang nicht als ein Inventar an thematischen Rollen wie Agens, Themaoder Source konzipiert ist, sondern „als eine spezifische Verbindungzwischen PF, GF und SF gemäß der Annahme, dass das Theta-Grid eineSchnittstelle zwischen Morpho-Syntax und konzeptueller Strukturbildet”25.Nachdem wir uns ein Bild von der Behandlung der uns interessierendenharten Polysemie in der Zwei-Ebenen-Semantik gemacht haben, könnenwir versuchen, anhand dieser sehr knappen Definition zu beurteilen,was Lang unter Polysemie versteht. Dies ist zwar für uns nichtunbedingt notwendig, doch es könnte in Hinsicht auf diePolysemieauffassung der Zwei-Ebenen-Semantik dennoch aufschlussreichsein.Offensichtlich ist in dieser Definition keine Rede von konzeptuellerVerschiebung oder Differenzierung, vielmehr wird explizit genannt,dass es sich um mehrere semantische Formen handelt, also nicht umkonzeptuell hergeleitete Varianten. Daraus ergibt sich, dass LangBeispiele wie Schule nicht als Instanzen von Polysemie bezeichnenwürde. Obwohl nicht eindeutig ist, was für lexikalische Einheitennach dieser Definition dann polysem sein sollten, legt dieBezugnahme auf „grammatisch gerechtfertigte und in [GF] und AS zuvermerkende Differenzen” nahe, dass es sich um Lexeme handelt, diezwei Lesarten haben, die semantisch eng verwandt sind und lediglichdarin voneinander abweichen, dass sie sich grammatischunterschiedlich verhalten. Es gibt eine Gruppe von Wörtern, auf diediese Kriterien zutreffen, und das sind Verben, die syntaktisch-semantische Alternationen aufweisen26. Solche Alternationen sind etwadie oft zitierte Kausativ-Unakkusativ-Alternation, z. B.
(23) Michaela kocht Tee.(24) Der Tee kocht in der Kanne.
24 Lang (1995: 42)25 Lang (1995: 40)26 Die Typen von verbalen Alternationen wurden am ausführlichsten in dem berühmten Werk Levin (1993) vorgestellt. Dieses Buch fasst die Alternationsklassen des Englischen zusammen, aber viele von ihnen kommen auch in anderen Sprachen wie im Deutschen vor.
16
oder die sogenannte load/spray-Alternation, z. B.(25) Steven loaded hay onto the truck.(26) Steven loaded the truck with hay.
Da zumindest manche dieser Alternationen eindeutig systematischsind, müssen sie nach der oben vorgeschlagenen Terminologie alssystematische harte Polysemie charakterisiert werden27. Die Extensiondes Polysemiebegriffs von Lang ist also nicht völlig verschieden vondem in diesem Aufsatz vertretenen, er ist jedoch restriktiver.Dieses Beispiel zeigt außerdem, dass bestimmte Arten vonsystematischer Polysemie nach der Auffassung der Zwei-Ebenen-Semantik nicht erst auf der konzeptuellen Ebene erfasst werden,sondern schon lexikalisch vermerkt sind.Problematisch ist dabei, dass die Systematizität der Alternationenund sogar ihre sprachübergreifende (also quasi-universale) Naturnach dieser Definition nicht erfasst wird. Sie erscheinen, falls wirdem Vorschlag von Lang folgen, als Idiosynkratismen der einzelnenlexikalischen Einheiten.
3.4. Ergänzungen zur Interpretation der Polysemie bei Schwarze/Schepping (1995)In ihrer frühen Version, die bei Bierwisch (1983a und b)zusammengefasst wurde, schien die Zwei-Ebenen-Semantik anzunehmen,dass systematische Bedeutungsvariation stets durch konzeptuelleOperationen gesteuert wird (obwohl das allerdings nicht expliziterwähnt wird)28. Die Architektur der Zwei-Ebenen-Semantik stellteinen Weg bereit, diese Hypothese empirisch zu prüfen undgegebenenfalls zu widerlegen.Diesen Weg gehen die Autoren in Schwarze/Schepping (1995). Sieuntersuchen Belege für die Zwei-Ebenen-Semantik durch dasVergleichen von französischen und deutschen Beispielen. Wie Lang(1995) nehmen auch sie an, dass bestimmte Arten von (harter)Polysemie in der semantischen Repräsentation der betreffendenlexikalischen Einheit wurzeln und nicht konzeptueller Natur sind.Sie meinen, dass sich durch den Sprachvergleich entscheiden lässt,ob eine lexikalische Einheit sozusagen semantisch oder konzeptuellpolysem ist. Falls nämlich die Polysemie einer lexikalischen Einheitauf konzeptuelle Operationen zurückzuführen ist (also aufkonzeptuelle Verschiebung oder Differenzierung), kann man annehmen,dass dieselben Lesarten der lexikalischen Einheit in allen Sprachenverfügbar sein müssen, deren Sprecher über prinzipiell das gleiche
27 Es ist also wahrscheinlich, dass es durchaus Alternationstypen gibt, die durch eine konzeptuelle Verschiebung erfasst werden können. Diese Annahme ist besonders dann berechtigt, wenn ein Alternationstyp in mehreren verschiedenen Sprachen nachzuweisen ist und eine natürliche semantische Klasse von Verben möglichst ohne Ausnahmen involviert. Es gibt jedoch Forscher, von denen besonders Pustejovsky hervorzuheben ist, die syntaktische Verbalalternationen allgemein als harte Polysemie behandeln.28 S. dazu Schwarze/Schepping (1995: 287–8).
17
Konzept verfügen29. Wenn etwa das Lexem Schule im Deutschen (unteranderem) die genannten Lesarten besitzt und diese durch konzeptuelleVerschiebung entstehen, muss das dem entsprechende Lexem in allenanderen Sprachen unseres Kulturkreises (also z. B. school imEnglischen, iskola im Ungarischen oder škola im Russischen) dieselbenLesarten aufweisen.Wenn jedoch Kontraste zwischen den Lesarten einander entsprechenderLexeme in verschiedenen Sprachen erkennbar sind, müssen diese(lexikalisch) semantischer und nicht konzeptueller Natur sein, essei denn, die Sprecher der jeweiligen Sprachen konzeptualisieren dasdurch das betreffende Lexem benannte Objekt aufgrund eineskulturellen Unterschieds unterschiedlich. Dies ist leichteinzusehen, da die konzeptuellen Operationen ja ausschließlich vomkonzeptuellen System gesteuert werden und (an den relevantenStellen) gleiche konzeptuelle Systeme logischerweise dieselbenOperationen bei den semantisch gleichen lexikalischen Einheitenerlauben. Wenn solche Kontraste also gegeben sind, muss manannehmen, dass man die Abweichungen zwischen den Lesarten in derWeise erklären kann, dass die semantische Repräsentationen dieserlexikalischen Einheiten in den jeweiligen Sprachen verschieden sind.Als Beispiele für Polysemie, von der wir anhand der Kontrasteannehmen können, dass sie aus der semantischen Repräsentation derlexikalischen Einheit folgt, erwähnen sie etwa Fälle des „contrastof modification of valence”. Das entspricht den verbalenAlternationen, auf die sich wahrscheinlich auch Lang beruft. Sienennen als Beispiel die folgenden beiden Varianten (transitiv bzw.intransitiv) des Verbs schießen im Deutschen:
(27) Wilhelm schoss auf den Apfel.(28) Lava schoss aus dem Boden.
Der Kontrast besteht zwischen schießen und seiner Entsprechung im Französischen, tirer:
(29) Guillaume tira sur la pomme.(30) *La lave tira du sol30.
Dieser Kontrast legt nach Schwarze und Schepping nahe, dass diebeiden Verben sich in ihrer semantischen Repräsentationunterscheiden. Es gibt theoretisch zwei Möglichkeiten, dasdarzustellen, wobei die Entscheidung unter ihnen letztlich aufgrundempirischer Evidenzen gefällt werden muss: Entweder muss in dersemantischen Repräsentation des französischen Verbs vermerkt sein,
29 Da das konzeptuelle System nach Ansicht der Zwei-Ebenen-Semantik ja relativ autonom vom sprachlichen Modul ist, ist es demnach möglich, dass Sprecher verschiedener Sprachen über gleiche Konzepte verfügen, die sie jeweils durch verschiedene lexikalische Einheiten benennen. In holistischen kognitiven Sprachtheorien wäre eine solche Annahme nicht interpretierbar, da diese davon ausgehen, dass unsere Konzepte prinzipiell lexikalischer Natur und daher streng sprachabhängig sind.30 Schwarze/Schepping (1995: 287).
18
dass die konzeptuelle Verschiebung, die (28) aus (27) ableitet, inFranzösischen blockiert ist (diese Meinung vertreten Schwarze undSchepping) oder alternativ können wir (im Sinne von Lang 1995)annehmen, dass im Deutschen zwei Repräsentationen für schießen gegebensind, im Französischen für tirer hingegen nur eine.Ein anderer Typ von Kontrast, der ebenfalls darauf hinweist, dasseinzelne Lesarten eines polysemen Lexems in manchen Fällensemantisch zur Auswahl gestellt bzw. blockiert sein müssen, ist dersog. „contrast of polysemy”31. Als Beispiel nennen die Autoren jeneVerwendung des Verbs kommen, wo das Ziel der Bewegung nicht mit demOrt des Sprechers identisch ist:
(31) Hänsel und Gretel kamen an ein kleines Häuschen.Das französische Verb venir verfügt aber nicht über diese Lesart, anseiner Stelle wird in solchen Fällen arriver verwendet:
(32) Jeannot et Margot *vinrent / arrivärent ä une petitemaison32.Wenn wir annehmen, dass eine konzeptuelle Verschiebung die Lesart in(31) aus der einfachen Bewegungsverbvariante von kommen (die ja imWesentlichen identisch mit venir ist) herleitet, muss postuliertwerden, dass entweder dieselbe konzeptuelle Verschiebung bei venirsemantisch unterbunden ist oder dass sie vielleicht im Deutschendurch eine „latente” (d. h. sich bei der primären Variante vonkommen nicht äußernde) semantische Komponente ermöglicht wird.Schwarze und Schepping haben also die Aufmerksamkeit auf eineUnzulänglichkeit der klassischen Zwei-Ebenen-Semantik gelenkt: aufdie Tatsache, dass nachweisbar nicht alle systematischenBedeutungsvariationen konzeptuell motiviert sind, semantischbegründete Variation jedoch vollkommen außer Acht gelassen wurde.Leider stellen sie kein vollständiges System vor, mit dem dieseBefunde erfasst werden könnten, sie unterbreiten lediglich kurzeVorschläge, wie man mit ihnen in einer Zwei-Ebenen-Semantik umgehenkönnte. Ob und wie diese Vorschläge jedoch in die Zwei-Ebenen-Semantik in ihrer gegebenen Form integriert werden können, ist nichtoffensichtlich.
4. Konzeptuelle Fokussierung und andere Vorschläge zur Modifizierungder Zwei-Ebenen-SemantikNachdem wir das Problem, ob Variation in gegebenen Fällenlexikalisch-semantisch oder konzeptuell erklärt werden soll, kurzberührt haben, möchte ich im folgenden Abschnitt weitere Problemeder Zwei-Ebenen-Semantik hervorheben und für sie unter31 Diese Bezeichnung ist natürlich in der Hinsicht nicht besonders gelungen, dass sie in der Gegenüberstellung mit dem „contrast of modification of valence” suggeriert, dass es sich im letzteren Fall (also bei den verbalen Alternationen) nicht um Polysemie handelt. Das ist aber eindeutig das Gegenteil davon, was die Autoren sagen wollen.32 Schwarze/Schepping (1995: 286–7).
19
Berücksichtigung der aktuellen Polysemiediskussion Lösungswegevorschlagen.
4.1. Das Problem der gleichzeitig zugänglichen LesartenEin bedeutendes Problem, das im Zusammenhang mit der Zwei-Ebenen-Semantik erscheint, ergibt sich aus dem Phänomen, dass wir beimanchen Vorkommen von lexikalischen Einheiten gleich auf mehrereLesarten der lexikalischen Einheit zugreifen müssen, um sie richtiginterpretieren zu können.Ein Beispiel dafür wären etwa die folgenden Fälle:
(33) Der Einbrecher ist durch das Fenster ins Haus gestiegen, das er zerbrochen hatte.
(34) Christinas sinnlicher Mund ist von innen mit Wunden bedeckt.Das Lexem Fenster verhält sich parallel zu Tür (s. 19–21), d. h. esbesitzt die beiden primären Lesarten ‘Öffnung’ und ‘Objekt’. Wennwir im Sinne der Zwei-Ebenen-Semantik annehmen, dass seinesemantische Repräsentation in Hinsicht auf diese beiden Lesartenunterspezifiziert ist und sie jeweils durch eine konzeptuelleVerschiebung zu Stande kommen, müssen diese Lesarten demnach völligdistinkt sein, d. h. wenn die eine Lesart gegeben ist, sollte dieandere nicht zugänglich sein. Wenn etwa die eine Lesart durch einekonzeptuelle Verschiebung erzeugt wird, die eine Komponente ÖFFNUNGzur unterspezifizierten semantischen Repräsentation hinzufügt, istdiese Komponente in der resultierenden Repräsentation enthalten, dieKomponente OBJEKT, die durch die zur anderen Lesart gehörendekonzeptuelle Verschiebung eingeführt würde, fehlt jedoch natürlich.Wenn das allerdings der Fall ist, sagt das über (33) voraus, dass essemantisch nicht wohlgeformt sein sollte. Im Hauptsatz wird nämlichdie Lesart ‘Öffnung’ aktiviert, und die Komponente OBJEKT fehltdemnach in der entsprechenden Repräsentation. Zerbrechen kann manjedoch keine Öffnung, und so sollte der Relativsatz und damit dergesamte Satz semantisch abweichend (nämlich ein Zeugma) sein; vgl.Satz (35)33:
(35) ?Die Sonate, die auf dem Klavier lag, dauerte zehn Minutenzu lange.Sätze wie (33) und (34) sind jedoch für die meisten Sprecherakzeptabel (obwohl es vereinzelt individuelle Unterschiede gebenkann).Ähnliches lässt sich über (34) sagen. Der Ausdruck sinnlicher Mundaktiviert die Lesart ‘Lippen’ der lexikalischen Einheit Mund, von innenbezieht sich jedoch nicht auf das Innere der Lippen, sondernvielmehr auf die Lesart ‘Mundhöhle’ von Mund. Dass (34) für diemeisten Sprecher akzeptabel ist, zeigt, dass die Komponenten, die
33 Bierwisch (1983a: 93–4).
20
für die Lesart ‘Mundhöhle’ konstitutiv sind, auch bei Aktivierungder Lesart ‘Lippen’ zugänglich sind.Allerdings steht fest, dass diese beiden Beispiele der Zwei-Ebenen-Semantik selbst in ihrer klassischen Form nicht unbedingtwidersprechen. Bei (34) ist es z. B. nicht offensichtlich, ob dieBedeutungsvarianten von Mund (also ‘Lippen’, ‘Mundöffnung’ und‘Mundhöhle’34) in der klassischen Zwei-Ebenen-Semantik durchkonzeptuelle Verschiebungen aus einer unterspezifiziertenRepräsentation abgeleitet würden. Dagegen spricht, dass sich zu ihridentisch verhaltende lexikalische Einheiten kaum vorhanden sind;die beiden ersteren Bedeutungsvarianten sind allerdings zu denerwähnten beiden Lesarten von Lexemen des Typs Tür ausreichendparallel. Andererseits stellt die Tatsache, dass sich dieentsprechenden Lexeme in verschiedenen Sprachen hinsichtlich dieserBedeutungsvarianten weitgehend identisch verhalten (also Fälle des„contrast of polysemy” ä Schwarze/Schepping (1995) nicht gegebensind), einen Beleg dafür dar, dass diese Variation auf konzeptuellerEbene erfasst werden muss; dann dürfte allerdings kaum eine andereOperation als die konzeptuelle Verschiebung in Frage kommen. Dass essich bei diesen Lesarten von Mund um harte Polysemie handelt, solltekaum anzuzweifeln sein.Bei (33) wäre es noch schwieriger dagegen zu argumentieren, dassFenster seine besagten beiden Lesarten durch konzeptuelle Verschiebungerhalten sollte. Diese Lesarten sind nämlich für eine ganze Klassevon semantisch verwandten lexikalischen Einheiten charakteristisch(also systematischer Natur) und sind in den meisten Fällen auchsprachübergreifend. Was die Erklärung dieser Variation durchVerschiebung andererseits erschweren würde ist die Tatsache, dasssich kaum eine Invariante ausmachen lässt, die alsunterspezifizierte semantische Repräsentation in Frage kommen würde(s. dazu auch die Analyse zu Tür weiter unten).Dass die beiden genannten Fälle nicht unbedingt als Instanzenkonzeptueller Verschiebung in der klassischen Zwei-Ebenen-Semantikgewertet würden, könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die Kritik,die sich auf dem Problem der gleichzeitig zugänglichen Lesartengründet, die Theorie gar nicht trifft. Allerdings erscheint dasProblem auch in Fällen, wo die Zwei-Ebenen-Semantik eindeutigVerschiebung annimmt, z. B. auch beim Lexem Schule. Wie schon erwähntwird der Bedeutungsvarianten ‘Gebäude’ nach Bierwisch folgendekonzeptuelle Repräsentation zugewiesen:
(18) x [GEBÄUDE x UND ZIEL x w] | w = LEHR- UNDLERNPROZESSE.
34 Mit der Bedeutung der ungarischen Entsprechung von Mund, száj und verwandten lexikalischen Einheiten befasst sich mein Aufsatz Pethő (1998), worauf teilweise diese Feststellungen basieren.
21
Taylor (1994) hat diese Repräsentation bemängelt, da w (also Lehr-und Lernprozesse) eigentlich nicht das Ziel von Gebäude x ist,sondern von der Institution, deren Sitz das Gebäude x ist und sokönnten wir die Komponente ZIEL in (18) und in dem nachfolgendenBeispiel (36) nicht in derselben Weise interpretieren; folglich seidie Beschreibung von Bierwisch nicht konsequent35.
(36) x [INSTITUTION x UND ZIEL x w] | w = LEHR- UND LERNPROZESSEEs geht hier darum, dass die Komponente INSTITUTION, die ja für dieLesart ‘Institution’ konstitutiv ist und nur dort durch einekonzeptuelle Verschiebung eingeführt wird, auch bei der Lesart‘Gebäude’ zugänglich sein sollte, um die Beschreibung konsequent zuhalten.Verschiedene Lesarten können auch bei Schule (und auch in anderenBeispielen für konzeptuelle Verschiebung) in der Weise gleichzeitigzugänglich sein wie in (33, 34):
(37) Die Schule, die neben dem Sportplatz liegt, hat einen größeren Betrag gestiftet36.Andererseits ist dies nicht bei allen Varianten der Fall:
(38) ??Die Schule ist aus der Geschichte Europas nicht wegzudenken und (sie) liegt neben dem Sportplatz37.
Beobachten wir auch den seltsamen Kontrast zwischen (39) und (40)!In beiden Fällen geht es anscheinend um die gleichzeitige Verwendungder Lesarten ‘Gebäude’ und ‘Institution’, wobei jedoch (39) beinaheunproblematisch, (40) jedoch recht eindeutig ein Zeugma ist:
(39) (?) Die Schule, die neben dem Sportplatz liegt, hat einen Ausflug nach Holland gemacht.
(40) ?? Die dreistöckige Schule die neben dem Sportplatz liegt,hat einen Ausflug nach Holland gemacht.
Bierwisch selbst weist darauf hin, dass Sätze wie (37) semantischrichtig sind und nimmt deswegen an, dass verschiedene konzeptuelleVerschiebungen kombinierbar/kontaminierbar sind. Das Problem dergleichzeitig zugänglichen Lesarten kann tatsächlich dadurchteilweise gelöst werden, dass wir annehmen, es könnten auch mehrerekonzeptuelle Verschiebungen gleichzeitig erfolgen, wenn Elemente imKontext vorhanden sind, die das erfordern. Jedenfalls schlägtBierwisch keine Erklärung dafür vor, welche Verschiebungenkombinierbar sind und welche nicht, da das Thema zu der Zeit nochunzulänglich untersucht sei.Durch die von Bierwisch angenommene Lösung kann jedoch nur dieeigentlich unerwartete semantische Akzeptabilität der erwähntenVorkommen der betreffenden lexikalischen Einheiten erklärt werden,
35 Taylor (1994: 13). Eine ähnliche Bemerkung macht auch Meyer (1994: 37).36 Bierwisch (1983a: 93).37 Bierwisch (1983a: 93).
22
das von Taylor aufgeworfene Problem ist jedoch in dieser Weise nichtaus der Welt zu schaffen.
4.2. Die konzeptuelle FokussierungUm unter anderem das Problem der gleichzeitig zugänglichen Lesartenzu lösen, schlage ich in diesem Aufsatz eine Modifizierung der Zwei-Ebenen-Semantik vor. Danach würde die sprachtheoretische Architekturder Theorie in ihren Grundsätzen weiterhin beibehalten. SemantischeRepräsentationen sollen nach diesem Vorschlag weiterhinunterspezifiziert sein, allerdings gleichzeitig viel reicher als die„minimalen” semantischen Repräsentationen, die z. B. in Bierwisch(1983a) angenommen werden. Auf der Grundlage solcherRepräsentationen entstehen die einzelnen Lesarten dann nicht wie beider konzeptuellen Verschiebung in der Weise, dass die semantischeRepräsentation durch eine völlig neue Komponente ergänzt wird,sondern in der Weise, dass eine Komponente, die schon von vornhereinin der semantischen Repräsentation vorhanden war, fokussiert wird(indem ihr Argument durch einen Lambda-Operator gebunden wird).Dieser Operationstyp erschient in keiner der mir bekannten Aus-führungen der Zwei-Ebenen-Semantik, stellt jedoch m. E. daseffektivste Instrument zur Beschreibung bestimmter Daten dar.Ein interessantes Beispiel ist das oben schon erwähnte Lexem Tür.Gegeben seien die Lesarten (19, 20); die Lesart (21) behandle ichweiter unten in Abschnitt 4.3. und 4.4. Nehmen wir an, dass für Türin (19) charakteristisch ist, dass es sich um eine Öffnung handeltund für Tür in (20), dass das Objekt ein Hindernis ist, das dasDurchdringen dieser Öffnung unterbindet. Diese Lesarten müssendemnach jeweils eine Komponente wie ÖFFNUNG bzw. HINDERNIS enthalten.Das grundsätzliche Problem bei der Repräsentierung dieserBedeutungsvariation mittels konzeptueller Verschiebung ist, dasskeine dieser beiden Lesarten repräsentiert werden kann, ohne dassauf die andere Bezug genommen wird:HINDERNIS muss entweder selbst ein relationales Prädikat sein oder miteiner anderen relationalen Komponente verbunden sein, aber auf jedenFall muss festgelegt werden, wofür das Objekt ein Hindernis ist; indiesem Fall ist es speziell ein Hindernis, das das Durchdringen derÖffnung unmöglich macht, also die Öffnung schließt. EineBeschreibung, die das außer Acht lässt, wäre m. E. konzeptuellfalsch.Eine Repräsentation, die allein die Komponente ÖFFNUNG enthält undsich nicht auf den Gegenstand Tür durch eine Komponente wie HINDERNISbezieht, ist andererseits deskriptiv falsch. Eine Öffnung in derWand eines Raumes, durch die man etwa von einem Flur in diesen Raumeintreten kann, wobei diese Öffnung jedoch nicht durch eine Tür (seies eine normale Tür, eine Glastür oder eine Falltür, sei es etwas,was auch nur entfernt an eine Tür erinnert wie etwa ein Vorhang;
23
aber auf jeden Fall etwas, was als Hindernis fungiert) verschlossenwerden kann, kann nicht Tür genannt werden38, obwohl die erwähnteRepräsentation genau das vorhersagt.Die Repräsentationen, die letztendlich am besten geeignet sind, umall diesen Rechnung zu tragen, wären jeweils die folgenden:
(41) λx Tür’(x) : λx y z [ÖFFNUNG (x,y) & BEHÄLTER (y) & HINDERNIS (z) &FUNK(z, MACHT_UNPENETRIERBAR (z,x)) & ...] ‘Öffnung’
(42) λz Tür’(z) : λz x y [ÖFFNUNG (x,y) & BEHÄLTER (y) & HINDERNIS (z) & FUNK(z, MACHT_UNPENETRIERBAR (z,x)) & ...]
‘Hindernis’Das Prädikat FUNK (‘Funktion’) ist ein intensionales Prädikat (obwohldas in der Formel nicht explizit angezeigt ist), das denrelationalen Charakter von HINDERNIS erfassen soll. Sie besagt, dassdie Funktion von Hindernis z darin besteht, die Öffnung x zu schließen(d. h. „unpenetrierbar” zu machen). Die Komponente BEHÄLTER erscheintin der Repräsentation aus zwei Gründen. Einerseits sind Öffnungennie Öffnungen an sich, sondern immer Öffnungen von etwas, nämlichwahrscheinlich immer von Behältern oder von als Behälteraufgefassten Entitäten. Anders formuliert ist der Begriff ÖFFNUNGTeil des konzeptuellen Schemas BEHÄLTER und daher solltewahrscheinlich ÖFFNUNG immer zusammen mit BEHÄLTER in einerRepräsentation erscheinen. Da nur die Öffnungen von bestimmtenObjekten (z. B. Zimmer, Fahrzeuge, Schränke) Tür genannt werdenkönnen, muss andererseits ohnehin angegeben werden, wofür eine Türdie Öffnung darstellt. Möglicherweise ist festzulegen, dass derBehälter feste Begrenzungen haben muss, welche Größe er hat usw.Ähnliches ist wahrscheinlich zum Hindernis und zur Öffnungsweise desHindernisses zu spezifizieren (z. B. dass etwas, was wie einSchraubverschluss einer Flasche durch Drehen geöffnet wird, nichtTür genannt werden kann). Da diese Komponenten jedoch im Gegensatzzu den in (41, 42) genannten keine notwendigen Bedingungendarstellen sondern eher durch eine prototypentheoretischeBeschreibung erfasst werden können, habe ich sie in dieRepräsentationen oben nicht einbezogen, sondern nur vermerkt, dassnoch weitere Komponenten erforderlich sind, damit eine hinreichendeCharakterisierung gegeben ist.Wesentlich ist nun aus unserem Gesichtspunkt, dass die Komponentenvon (41, 42) identisch sind und die beiden konzeptuellenRepräsentationen lediglich dahingehend voneinander abweichen, dassdie als Argumente dieser Komponenten erscheinenden Variablenverschiedenerweise gebunden sind. In (41) ist das Argument des38 Es sei denn, man nennt eine solche Öffnung Tür, weil man sie in irgendeiner Situation irgendwie benennen muss, aber sich keine bessere Bezeichnung anbietet (dies ist aber nur eine Notlösung und daher irrelevant). Hier finden wir nämlich sowohl im Deutschen als auch im Ungarischen eine lexikalische Lücke, die im Englischen hingegen durch das Lexem doorway gefüllt ist.
24
Prädikats Öffnung durch einen Lambda-Operator gebunden und das vonHindernis durch einen Existenzquantor. (41) besagt demnach, dassetwas, das eine Tür ist, eine Öffnung ist und es gibt einenHindernis, das diese Öffnung schließen soll. In (42) sind diesebeiden Variablen gerade umgekehrt gebunden und die Formel besagtdementsprechend, dass etwas, das eine Tür ist, ein Hindernis ist,das eine Öffnung schließen soll.Dass diese beiden Repräsentationen in dieser Form nicht durchjeweils eine konzeptuelle Verschiebung aus einer unterspezifiziertensemantischen Repräsentation abgeleitet werden können, istoffensichtlich. Wie schon erwähnt wäre überhaupt problematisch, wieeine solche Repräsentation beschaffen sein sollte, da eigentlichnichts aus (41, 42) übrig bleibt, wenn wir ÖFFNUNG und HINDERNIS sowiedie weiteren Komponenten, die jeweils die eine von ihnen weiterspezifizieren, entfernen39.Wegen des minimalen Unterschieds zwischen den beidenRepräsentationen bietet sich jedoch ein anderer Weg an. Nehmen wiran, dass (43) die unterspezifizierte semantische Repräsentation zu(41, 42) ist:
(43) Tür’(a) : y [ÖFFNUNG (x,y) & BEHÄLTER (y) & HINDERNIS (z) &FUNK(z, MACHT_UNPENETRIERBAR (z,x)) & ...]
In (43) sind die beiden Variablen x und z frei. Die Festlegung deraktuell erforderlichen Lesart erfolgt dann in der Weise, dass dieentsprechende dieser beiden Variablen durch einen Lambda-Operatorgebunden und die andere Variable existenzquantifiziert wird.Nennen wir diese neue Operation konzeptuelle Fokussierung:
Def: Konzeptuelle Fokussierung ist jene konzeptuelle Operation imRahmen einer modifizierten Zwei-Ebenen-Semantik, in deren Folgeeine der freien Variablen in einer semantischen Repräsentationmit einem Lambda-Operator und jede andere freie Variable miteinem Existenzquantor gebunden wird40. Die Variable, die durchden Lambda-Operator gebunden wird und die Komponente(n), derenArgument sie ist, werden fokussiert. Die Operation derkonzeptuellen Fokussierung (wie auch die konzeptuelleVerschiebung und die konzeptuelle Differenzierung) wird von der
39 Lediglich die funktionale Komponente kommt in Frage, aber diese sollte dann grundsätzlich anders repräsentiert werden als hier und es ist überhaupt fragwürdig,ob dies befriedigend gelöst werden kann.40 Letzterer Schritt wird in der semantischen Fachliteratur existential closure genannt. Sie wird in der Regel angewendet, wenn bestimmte Argumente eines Prädikats syntaktisch nicht realisiert werden (darum handelt es sich aus formalsemantischer Sicht betrachtet auch bei Tür). So wird etwa die Intransitivierung lexikalisch transitiver Verben gewöhnlich in dieser Weise dargestellt. Es wird etwa angenommen,dass das in (F3) im Gegensatz zu (F2) nicht realisierte Thema-argument von essen dortdurch einen Existenzquantor gebunden wird:(F2) Petra isst gern Lachs.(F3) Petra isst gern.
25
konzeptuellen Selektion gesteuert41.Die konzeptuelle Fokussierung weicht technisch von der konzeptuellenVerschiebung ab, in ihrem Resultat jedoch nicht: eineunterspezifizierte semantische Repräsentation wird einem Begriffzugeordnet.Sehen wir uns, um auch einen anderen Beispiel zu nehmen, dasVerhalten des Lexems Mund an42. Wie oben erwähnt hat das neben denbeiden Lesarten ‘Öffnung’ (‘Mundöffnung’) und ‘Hindernis’ (‘Lippen’)auch die Interpretation ‘Behälter’ (‘Mundhöhle’). Dies kann in derWeise erfasst werden, dass wir die folgende, (43) sehr ähnlichesemantische Repräsentation annehmen:
(44) Mund’(a) : [ÖFFNUNG (x,y) & BEHÄLTER (y) & HINDERNIS (z) &FUNK(z, MACHT_UNPENETRIERBAR (z,x)) & ...]
Der Unterschied zwischen (43) und (44) besteht darin, dass in (44)auch die Variable y frei ist und also fokussiert werden kann. Dadurchgewinnen wir die weitere Lesart ‘Mundhöhle’.
4.3. Das Beispiel Schule und das Problem der SystematizitätMittels konzeptueller Fokussierung lassen sich nun m. E. auch dieklassischen Beispiele der Zwei-Ebenen-Semantik wie Schule adäquaterbehandeln als durch konzeptuelle Verschiebungen. Taylorsberechtigter Einwand etwa gegen die Behandlung von Wörtern des TypsInstitution (Schule, Universität etc.) durch Bierwisch gilt in dem Fallnicht, wenn wir auch für solche Lexeme eine weitaus reicheresemantische Repräsentation annehmen, als es bislang der Fall war.Schule lässt sich z. B. folgendermaßen charakterisieren:
(45) Schule’(a) : GEBÄUDE (x) & INSTITUTION (y) & SITZ (y,x) &ZIEL (y,w) & LEHR-_UND_LERNPROZESSE (w) (& ...)
Diese Repräsentation umfasst die drei Interpretationen ‘Gebäude’(12), ‘Institution’ (13) und ‘Ensemble von Prozessen’ (14). Sieergeben sich durch die Fokussierung von jeweils x, y bzw. w. DieseFormel gibt die Intuition, die auch Taylor (1994) vertritt, richtigwieder, dass „Lehr- und Lernprozesse” nicht das Ziel des Gebäudessind, sondern der Institution, zu der das Gebäude gehört. Alleähnlichen Fälle des Problems gleichzeitig zugänglicher Lesarten,über die die klassische Zwei-Ebenen-Semantik ebenfalls falsche41 Natürlich wird sich dadurch, dass demzufolge eine neue Operation unter die Operationen aufgenommen wird, die von der konzeptuellen Selektion gesteuert werden,wahrscheinlich auch der Charakter der konzeptuellen Selektion (d. h. das Regelsystem, das diese Operation konstituiert) verändern. Da die Zwei-Ebenen-Semantik jedoch bisher kaum positive Hypothesen über das Funktionieren der konzeptuellen Selektion an sich formuliert hat (sondern in erster Linie nur festgelegt hat, dass es eine solche Operation gibt und ihre Funktion bestimmt hat),können wir das nicht überprüfen.42 Die ausführliche und mit sprachlichen Daten belegte Begründung für die folgende Analyse findet sich in Pethő (1998).
26
Vorhersagen formulieren würde, können in dieser Weise natürlichgelöst werden.
(12) Die Schule hat ein Flachdach.(13) Die Schule spendete einen größeren Betrag.(14) Die Schule macht ihm großen Spaß.(15) Die Schule ist eine der Grundlagen der Zivilisation.
Ich nehme an, dass die generische Lesart ‘Institution als Prinzip’(15) wie alle Lesarten dieser Art in einer grundsätzlich anderenWeise zu erklären ist. Im Grunde genommen basiert diese Entscheidungauf der Tatsache, dass Bedeutungsvariation von zweierlei Art seinkann:Einerseits gibt es eine semantisch-konzeptuell streng restringierteVariation wie bei den klassischen Beispielen Schule, Oper, Sonate etc. Nureine nach semantischen Kriterien recht eindeutig umgrenzbare, wennauch beliebig erweiterbare, Klasse von Wörtern weist die jeweilsgeltenden parallelen Lesarten auf (ist also nach Bierwisch einer„Begriffsfamilie” zugeordnet).Andererseits gibt es auch weitgehend unrestringierte Typen vonVariation, die nicht nur für eine engere semantische Klasse gelten,sondern für mehrere solcher Klassen. Die Komponenten, die für dieseLesarten charakteristisch sind, sind dementsprechend nicht jeweilsin der semantischen Repräsentation festzulegen, sondern werden durchVerschiebungsregeln eingeführt. Ich begründe und erläutere diesesalternative Verfahren näher in Abschnitt 4.5. weiter unten.Wenn wir von (15) demnach auch annehmen, dass es nicht durchkonzeptuelle Fokussierung erfasst werden muss, stellt sich immernoch die Frage, ob nicht andere Komponenten in (45) einzubeziehensind. Die Bedeutungsvariante (10) könnte z. B. ein Kandidat für dieErweiterung von (45) sein.
(10) Die ganze Schule hat an dem Ausflug teilgenommen.Es ist nun eine empirisch zu entscheidende Frage, ob die Lesart, diein (10) erscheint (‘Gesamtheit von Personen, die zu der Institutiongehören’), in der lexikalischen Repräsentation vermerkt werden soll(was keine größeren Probleme bereiten würde) oder ob sie ähnlich wiedie generische Lesart als eine produktive, übergreifendeRegelmäßigkeit aufzufassen ist. Ich möchte hier in dieser Fragekeine Stellung nehmen, da eine größere Menge von Daten vorgelegtwerden müsste, um eine Entscheidung hinreichend zu motivieren.Obwohl diese Behandlung der Polysemie von Schule und ähnlichen Lexemen(wie gezeigt wurde) in gewisser Hinsicht offenbar adäquater ist alsdie klassische Version, scheint sie andererseits weniger adäquat zusein, was die Erfassung der Systematizität dieser Polysemieanbelangt: sie erfasst in der oben dargelegten Form die Tatsachenicht, dass die entsprechenden Lesarten nicht nur für Schule gelten,sondern für eben eine ganze Klasse von Lexemen. Das ist schon aus
27
dem Grund ein schwerwiegendes Desiderat, weil dies gerade dasHauptanliegen der Zwei-Ebenen-Semantik ist.Dieses Problem lässt sich in trivialer Weise lösen, wir sindallerdings darauf angewiesen, ein System konzeptuellerRedundanzregeln zu stipulieren. Eine solche Redundanzregel wäre etwadie folgende:
(46) INSTITUTIONS-SCHEMA : GEBÄUDE (x) & INSTITUTION (y) & SITZ (y,x) &ZIEL (y,w)
Die Komponente INSTITUTIONS-SCHEMA lässt sich nach dieser Regel in einerRepräsentation durch die nachfolgenden weniger komplexen Komponentenersetzen. Die redundanzfreie lexikalische semantische Repräsentationvon Schule lautet dann folgendermaßen (vgl. dazu 45):
(47) Schule’(a) : INSTITUTIONS-SCHEMA & LEHR-_UND_LERNPROZESSE (w) (& ...)Um der Systematizität der Bedeutungsvariation Rechnung zu tragen,muss angenommen werden, dass dieselbe Komponente INSTITUTIONS-SCHEMA inder semantischen Repräsentation aller Lexeme verzeichnet sein muss,die eine zu Schule identische Bedeutungsvariation aufweisen.Redundanzregeln wie (46) lassen sich am besten als vereinfachteDarstellungen von Aktivierungsmustern in konzeptuellen Netzwerkenauffassen. Die Funktionsweise solcher Redundanzregeln können wirdann etwa folgendermaßen stark vereinfachend grafisch darstellen(Pfeile kennzeichnen die Richtung der Aktivierung, einfache Liniendie gegenseitige Verbundenheit der Komponenten miteinander, die inder formalen Repräsentation durch Variablen angezeigt wird):
(48)CS SITZ INSTITUTION
GEBÄUDE ZIEL
… INSTITUTIONS-SCHEMA …
SSS Schule
Im sprachtheoretischen Rahmen der Zwei-Ebenen-Semantik müssen solcheRedundanzregeln als Entitäten des konzeptuellen Systems CS angesehenwerden. Die Zuordnung der Komponenten zu Schule (von denen ichlediglich das hier relevante INSTITUTIONS-SCHEMA dargestellt habe; alleanderen Komponenten einschließlich LEHR-_UND_LERNPROZESSE sindwahrscheinlich ähnlich zu behandeln) erfolgt andererseits im
28
semantischen Teilsystem des grammatischen Systems SSS43. DieKomponenten selbst sind im Wesentlichen Elemente sowohl dessemantischen als auch des konzeptuellen Systems44, in Einklang mitder Forderung Bierwisch’, dass aus heuristischen Gründen „in Bezugauf Einzelannahmen über (Klassen von) Repräsentationen [davonausgegangen werden soll], dass [bei Äußerungsbedeutung m und Kontextct, also bei Einheiten des CS] Unterscheidungen gegenüber sem immer undnur dann gemacht werden, wenn sie empirisch begründet sind”45 (d. h.dass konzeptuelle und semantische Repräsentationen einander soähnlich sein sollen wie nur möglich). Sie stehen deshalb im Schnittvon CS und SSS.Mit dieser Ergänzung ist die modifizierte Zwei-Ebenen-Semantik wiegesagt in der Lage, die Systematizität der Bedeutungsvariationen zuerfassen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die klassischeVersion der Zwei-Ebenen-Semantik dieser nicht überlegen ist, da wirja gezwungen waren, gesondert Regeln zu stipulieren, um diesystematische Polysemie als solche darstellen zu können (und daherdiese Lösung möglicherweise komplizierter ist und bestimmteVerallgemeinerungen verfehlt). Die Antwort auf diese Frage lauteteindeutig „nein”: die Zwei-Ebenen-Semantik bei Bierwisch (1983a) istebenso auf ein weiteres Regelsystem angewiesen, um dieBedeutungsvariation beschreiben zu können, das System wird nur nichtausführlich von Bierwisch beschrieben. Ich werde das am obenbehandelten Beispiel nachweisen (obwohl es eigentlich trivial istund daher kaum eines Beweises bedarf).Wenn wir (wie Bierwisch 1983a) davon ausgehen, dass (16) diesemantische Repräsentation von Schule ist, können wir daran gleicherkennen, dass sie keine Information darüber enthält, welchekonzeptuellen Verschiebungen an ihr durchgeführt werden können. Diesist auch nicht erwünscht, da nicht die Semantik der lexikalischenEinheit bestimmen soll, welche Interpretationen erlaubt sind,sondern die „Alltagstheorie”, die der lexikalischen Einheitzugeordnet ist, z. B. die von einer Schule. Alltagstheorien gehörennach Bierwisch offenbar zum konzeptuellen System. Ein konzeptuelles
43 Ich nehme hier Bierwisch folgend an, dass semantisches und konzeptuelles System getrennt werden müssen. Dieses Schema wäre allerdings einfacher, wenn wir kein separates semantisches System postulieren würden (s. Fußnote 18), sondern annähmen,dass (48) die Interaktion zwischen dem Lexikon und dem konzeptuellen System darstellt. So könnten wir uns z. B. solche sehr unangenehmen, da außerordentlich spekulativen, jedoch angesichts (48) sich logischerweise stellenden Fragen ersparen, ob die Komponenten, die durch (46) eingeführt wurden, auch wieder dem semantischen System direkt zugänglich werden, etwa um LEHR-_UND_LERNPROZESSE mit ZIEL durch Zuteilung einer identischen Variablen zu verbinden, oder ob das vom konzeptuellen System geleistet wird.44 Obwohl es wahrscheinlich richtiger wäre zu sagen, die Elemente des SSS verweisen eindeutig auf entsprechende Elemente des CS (s. auch Pethő 1999); das spielt in deneigentlichen Analysen allerdings keine Rolle.45 Bierwisch (1983a: 78).
29
Schema wie (48) ist wahrscheinlich nicht sehr weit von dem entfernt,was nach Bierwisch eine Alltagstheorie von Institution sein könnte.Wenn wir das akzeptieren, bleibt in dem klassischen Modellletztendlich nur zu klären, woher wir wissen, welche Alltagstheoriezu welcher lexikalischen Einheit gehören soll. Entweder muss dasunmittelbar spezifiziert werden (also etwa wie in 48) oder dieZuordnung der Alltagstheorie ergibt sich mittelbar aus denKomponenten, die in der unterspezifizierten Repräsentation enthaltensind (z. B. sollte das CS demnach „wissen”, dass etwas, dessen Ziel„Lehr- und Lernprozesse” sind, eine Schule ist und dementsprechendwie eine Institution beschaffen ist).Auf jeden Fall steht fest, dass das klassische Zwei-Ebenen-Modellein ähnliches konzeptuelles System stipulieren müsste, umsystematische Polysemie erklären zu können, wie die hiervorgeschlagene modifizierte Fassung. Es ist ihr folglich auch indieser Hinsicht nicht überlegen46.
4.4. Behandlung des „contrast of polysemy”Im modifizierten Modell kann der „contrast of polysemy” in einersehr ähnlichen Weise erfasst werden, wie Bierwisch Wörter wieRegierung behandelt (die sozusagen einen innersprachlichenPolysemiekontrast darstellen). Bierwisch (1983a: 83) bemerkt, dasssich auch semantisch verwandte Wörter hinsichtlich ihrerBedeutungsvariation unterschiedlich verhalten können, und nennt diefolgenden beiden Beispiele:
(49) Das Parlament hat die Frage bereits entschieden.(50) Das Parlament liegt am Stadtrand.(51) Die Regierung hat die Frage bereits entschieden.(52) ?Die Regierung liegt am Stadtrand.
Bierwisch erklärt diese Fakten, indem er feststellt, dass nicht alleInstitutionen auf die gleiche Weise lexikalisiert werden (1983a: 82)und eventuelle Abweichungen wie im Fall von Regierung gehandhabtwerden können, wenn wir annehmen, dass die besondere Eigenschaft,die eine abweichende lexikalische Einheit von den „normalen”unterscheidet, in der semantischen Repräsentation der jeweiligenlexikalischen Einheit festgelegt ist. Während die semantischeRepräsentation von Parlament derjenigen von Schule (16) ähnlich ist(abgesehen von der Spezifizierung des Ziels, die natürlich bei den
46 Vielmehr ist auch hier gerade das Gegenteil der Fall: Während bei Bierwisch (1983a) die Zuordnung der Alltagstheorien/Begriffsfamilien völlig ungeklärt bleibt,wurde hier explizit eine Hypothese darüber formuliert, wie systematische Polysemie zugleich lexikalisch kodiert und konzeptuell motiviert sein kann.
30
beiden lexikalischen Einheiten verschieden sein muss)47, wirdRegierung folgendermaßen charakterisiert:
(53) x [INSTITUTION x UND ZWECK x w’’]Die Komponente INSTITUTION ist also von Anfang an in der Semantik vonRegierung festgelegt und daher kann das Wort nur diese Lesartaufnehmen, nicht jedoch ‘Gebäude’ (die entsprechende konzeptuelleVerschiebung ist durch die Anwesenheit der Komponente INSTITUTIONblockiert).Wenn wir eine Operation der konzeptuellen Fokussierung wie die obenvorgestellte annehmen, fällt die Behandlung der betreffenden Lexemenatürlich etwas anders aus. Der Unterschied kann selbstverständlichnicht dadurch festgehalten werden, dass wir die für die einzigzugängliche Lesart charakteristische Komponente schon in dersemantischen Repräsentation einführen, da wir ja angenommen haben,dass alle solche Komponenten ohnehin dort schon anwesend sind(sowohl bei Wörtern vom Typ Schule / Parlament als auch bei solchen vomTyp Regierung). Er lässt sich vielmehr durch die unterschiedlicheGebundenheit der Variablen erfassen. Während bei Wörtern wie Schuleoder Parlament die Argumentvariable von GEBÄUDE frei ist (vgl. 45), istsie bei Regierung von Anfang an durch einen Existenzquantor gebundenund deshalb der Fokussierung nicht zugänglich (da gemäß derDefinition von Fokussierung weiter oben nur freie Variablenfokussiert werden können)48.Es ergibt sich dabei ein Problem im Zusammenhang mit Redundanzregelnwie (46). Aufgrund des bisher Gesagten sollte die redundanzfreiesemantische Repräsentation von Regierung etwa folgendermaßen aussehen(P steht hier für das Prädikat, welches das Ziel — d. h. den Zweck,s. o. — einer Regierung angibt):
(54) Regierung’(a) : x [GEBÄUDE (x) & INSTITUTIONS-SCHEMA & P(w) (& ...)]Nun führt die Anwendung der Redundanzregel (46) erneut eineKomponente GEBÄUDE (x) in die Repräsentation ein, mit einerungebundenen Variablen x. Wir können das daraus resultierende Problemallerdings trivial dadurch lösen, dass wir annehmen, dass beiAnwendung von Redundanzregeln solche „überflüssigen” Komponentenautomatisch gelöscht werden.
47 Es findet sich auch ein eigenartiger Unterschied zu (16) in der Repräsentation, die Bierwisch (1983a: 88) für Parlament gibt. Er verwendet dort nämlich eine Komponente ZWECK und nicht ZIEL wie bei Schule. Es ist kaum wahrscheinlich, dass es sich hier um eine absichtliche Unterscheidung handelt (sondern vielmehr um eine kleinere Inkonsequenz vonseiten des Autors).48 Die Frage, ob nicht auch die Variable w’’ gebunden sein sollte (die, falls ungebunden, eine Lesart erlauben würde, die der Prozesslesart von Schule entspricht) möchte ich hier nicht untersuchen (s. dazu jedoch Fußnote 50) und auch jene Frage nicht, ob die Analyse von Bierwisch, dass Regierung zum Typ Institution gehört, überhaupt adäquat ist.
31
Es stellt sich die Frage, ob sich zeigen lässt, dass die Lösung mitdem hier vorgeschlagenen alternativen Instrumentarium etwas erfassenkann, was der klassische Ansatz nicht erfasst.Zuerst muss betont werden, dass die Art und Weise, wie Bierwisch dieabweichenden Beispiele behandelt, dass er also behauptet, dass insolchen Fällen eine bestimmte Lesart (nämlich ‘Institution’) vonAnfang an festgelegt und die Bedeutung der lexikalische Einheitdaher nicht in der Weise unterspezifiziert ist, wie z. B. die vonSchule, keineswegs zwingend aus dem klassischen Modell folgt. Das in(54) dargestellte Verfahren, eine Komponente mit einerexistenzquantifizierten Variablen einzuführen, die eine unerwünschtekonzeptuelle Verschiebung sozusagen blockiert, ist mit dem Modellvon Bierwisch (1983a) ebenso verträglich. Es ist eine empirisch zuentscheidende Frage, ob wir in solchen Fällen (wie Bierwisch 1983a)einzelne Lesarten als einzig zugängliche oder (wie hiervorgeschlagen wurde) vielmehr einzelne Lesarten als blockierteausweisen sollten49.Um diese Frage zu entscheiden, können wir verschiedene Wörter ausdem Wortfeld ‘Institution’ untersuchen. In der folgenden kleinenTabelle seien die möglichen Lesarten einzelner lexikalischerEinheiten zusammengefasst:
(55) Institution Gebäude ProzessSchule + + +Regierung + – –50
Polizei + – –rendőrség (ung. für Polizei)
+ + –
Die Fälle Schule, Regierung und Polizei sind für den klassischen Ansatzunproblematisch. Schule ist in Hinsicht auf diese drei Lesartenunterspezifiziert, Regierung und Polizei sind als ‘Institution’spezifiziert. Rendőrség, das ungarische Wort für Polizei bereitet jedochProbleme, wenn wir vom Muster Schule abweichende Lexeme generell alsauf eine Interpretation spezifiziert ansehen. Da es nämlich zwei
49 Letztere Lösung, nämlich in der semantischen Repräsentation eine bestimmte Variable schon mit einem Lambda-Operator zu binden, wäre auch in dem hier vorgestellten Ansatz möglich; diese empirische Frage stellt sich also für beide Varianten der Zwei-Ebenen-Semantik.50 Ich nehme an, dass Regierung keine Prozesslesart hat, obwohl dem Beispiele zu widerprechen scheinen wie Während seiner Regierung herrschte Frieden. Ich nehme an, dass es sich in solchen Kontexten nicht um dieselbe lexikalische Einheit handelt, sondern um ein Deverbativum, das unmittelbar mit dem Verb regieren verbunden ist und nicht mitder Bezeichnung des Gremiums Regierung. Es ließe sich allerdings dafür argumentieren, dass Regierung in Fällen wie Die Regierung der Sozialisten zwischen 1973 und 1977 war sehr erfolgreich. gleichzeitig als Institution und Prozess spezifiziert ist.
32
verschiedene Lesarten erlaubt, kann keine Lesart spezifiziert sein51.Andererseits ergeben sich keine solchen Probleme, wenn die nichterlaubten Lesarten blockiert werden.Beispiele wie (56), wo Regierung die Menschen bezeichnet, aus denendie Regierung besteht, deuten ebenfalls darauf hin, dass eineRepräsentation wie (53) nicht richtig sein kann, wenn wir unsansonsten auf das Instrumentarium beschränken, das der Vorschlag vonBierwisch bereitstellt.
(56) Die Regierung hat dem Kinderkrankenhaus einen Besuchabgestattet.Ähnliche Beispiele lassen sich zu Hunderten finden. Die empirischenDaten sprechen also dafür, dass auch bei der Behandlung von Lexemenwie Regierung die Unterspezifiziertheit der Bedeutung bei Blockierungeinzelner Lesarten der semantischen Spezifiziertheit bestimmterLesarten vorzuziehen ist.Wie gesagt können allerdings auch im Rahmen der klassischen Zwei-Ebenen-Semantik ohne weiteres semantische Repräsentationen angegebenwerden, wo eine Lesart in der oben vorgestellten Weise blockiertwird, das bisher Gesagte betrifft also nicht den Ansatz vonBierwisch an sich, sondern lediglich seine Repräsentation (53).Eine Kritik, die jedoch den Ansatz selbst trifft, bezieht sichwiederum auf die Explizitheit der Repräsentationen. Aus kognitivsemantischer Perspektive scheint es besonders interessant anzugeben,wie die aufgrund ihrer polysemen Lesarten sich ergebenden Klassenvon Lexemen beschaffen sind, also welche lexikalischen Einheiten zuden Klassen gehören. Bei Bierwisch ist z. B. nicht eindeutig, ob ermeint, dass Regierung sich konzeptuell zu Schule analog verhält und die‘Gebäude’-Lesart lediglich lexikalisch (semantisch) blockiert ist,oder ob Wörter wie Regierung eine Klasse für sich bilden, diekonzeptuell nicht mit der Klasse Schule identisch ist. Es ist z. B.aus kognitiver Sicht nicht gleichgültig, ob Regierung wie in (54)repräsentiert wird (wo wir mit Bierwisch annehmen, dass dieAbweichung von Regierung von der Klasse Schule lediglich einelexikalisch bedingte Idiosynkrasie ist) oder wie in (57) (wo wirannehmen, dass Regierung nicht mit dem Institutions-Schema verbundenist und dass Regierungen demnach nach unserer entsprechenden„Alltagstheorie” im Gegensatz zu normalen Institutionen generellnichts mit Gebäuden zu tun haben):
(57) Regierung’(a) : INSTITUTION (x) & ZIEL (x,w) & P (w) (& ...)52
Es könnte sich beispielsweise herausstellen, dass das Verhalten vonWörtern wie Regierung besser erfasst werden kann, wenn wir annehmen,51 Es sei denn, wir nehmen an, dass es zwei lexikalische Einheiten gibt, rendőrség1 ‘Institution’ und rendőrség2 ‘Gebäude’, was den Intuitionen jedoch eindeutig widersprechen würde und nebenbei auch redundant wäre.52 Wie bei (54) soll weiterhin offen gelassen werden, ob w in der semantischen Repräsentation vielleicht schon existenzquantifiziert sein sollte.
33
dass sie an Stelle des Institutions-Schemas mit einem Gremien-Schemain ihrer semantischen Repräsentation verbunden sind. Solche Differenzierungen lassen sich m. E. im Rahmen der klassischenZwei-Ebenen-Semantik kaum ausdrücken und falls sie doch machbarwären, wären sie verhältnismäßig kompliziert auszuführen. Da dieZwei-Ebenen-Semantik gerade die Frage stellt, ob die Bildung vonBedeutungsvarianten semantisch oder konzeptuell bestimmt ist, lassensich die oben formulierten Fragen allerdings nicht als unwesentlichvom Tisch fegen.
4.5. Die konzeptuelle VerschiebungIch habe oben unter 4.3. dafür argumentiert, in Fällen, in denen dieklassische Zwei-Ebenen-Semantik radikal unterspezifiziertesemantische Repräsentationen annimmt und aus diesen durch eine sehrmächtige konzeptuelle Verschiebungsoperation die gewünschtenLesarten ableitet (also z. B. Schule), diese Hypothese zu verwerfenund von weitaus reicheren, aber immer noch unterspezifiziertensemantischen Repräsentationen auszugehen und die Lesarten durchkonzeptuelle Fokussierung herzuleiten. Das legt nahe, dass wirkonzeptuelle Verschiebung generell nicht mehr brauchen und daher ausdem modifizierten System herauslassen können. Ich möchte allerdingsim Folgenden dafür Stellung nehmen, dass konzeptuelle Verschiebungenweiterhin gebraucht werden, wenn auch ihr Geltungsbereich gegenüberder klassischen Fassung radikal eingeschränkt wird.Wie oben angedeutet, sollen nur solche Bedeutungsvarianten durchkonzeptuelle Verschiebung hergeleitet werden, die a) jeweils imVerhältnis zu einer anderen Lesart sekundär und außerdem b) nichtauf eine semantisch gut umrissene Klasse von Wörtern beschränktsind. Letzteres ergibt sich aus der Tatsache, dass jene Komponenten,die für die „verschobenen” Lesarten charakteristisch sind, nichtwesentliche Komponenten der Bedeutung der jeweiligen lexikalischenEinheiten, sondern sozusagen akzidentell sind.Was damit gemeint ist, lässt sich am besten durch ein Beispielillustrieren. Das sog. Grinding, das weiter oben schon erwähntwurde, ist eine der produktivsten Arten der Bildung vonBedeutungsvarianten. Sie umfasst Fälle, wo sich zur „normalen”primären Lesart eines count nouns eine zweite Lesart gesellt, nachdem das Substantiv eine Substanz bezeichnet und sich als ein massnoun verhält. Der bekannteste Subtyp des Grinding ist das sog.animal grinding, das bei Tiernamen erscheint und auf diesem Gebietseinerseits extrem produktiv ist:
(1) In Afrika leben viele Strauße.(2) Ich habe gestern im Restaurant Strauß gegessen.
Nun gehört die Tatsache, dass sie essbar sind und neben ihrereigentlichen Form auch als eine essbare, unbelebte Substanzerscheinen können, natürlich nicht zu den bestimmenden Eigenschaften
34
von Straußen. Es wäre dementsprechend seltsam (und falsch), dieseInformation in die semantische Repräsentation des Lexems Straußaufzunehmen. Wenn wir annehmen, dass eine konzeptuelleVerschiebungsoperation gegeben ist, die die fragliche Lesartherleitet, lässt sich dieses Problem für unsere Repräsentationlösen. Die entsprechende semantische Repräsentation und diekonzeptuelle Verschiebung lauten demnach folgendermaßen:
(58) Strauß’ (a) : TIER (x) & STRAUSS (x) (& ...)(59)Animal grinding : Py x [SUBSTANZ (y, x) & ESSBAR (y) &
P (x)]53
Die Idee, dass es Bedeutungskomponenten gibt, die nicht zursemantischen Repräsentation einer lexikalischen Einheit gehören,wird in der Fachliteratur seit langem vertreten. Es sei an dieserStelle an die aus unserer Sicht besonders interessante Idee vonWeinreich (1966) erinnert, dass zwei Arten von semantischenKomponenten unterschieden werden müssen: einerseits besitzt dasjeweilige Wort eigene Features, andererseits gibt es jedoch auchsog. „transfer features”, die ein Wort auf ein anderes(typischerweise ein Verb auf sein Argument) überträgt. Das Verb sail‘segeln’ besitzt z. B. Komponenten, die angeben, welche Tätigkeitenmit dem Verb bezeichnet werden können und außerdem hat das Verb auchein transfer feature <Water Vehicle>. Dies wird auf das Objekt desjeweiligen Satzes übertragen, falls es nicht schon an sich über einesolche Komponente verfügt (wie z. B. das Wort ship), wodurch Sätzewie (60) disambiguiert und Sätze wie (61) als semantisch wohlgeformtausgewiesen werden können:
(60) John sails that tub skillfully.(61) John sails that bookshelf skillfully.
Das Verb eat würde nach Weinreich die Komponente <Food> auf seinObjekt übertragen, was aus der Sicht des Objekts einer semantischenVerschiebung wie (59) gleichkommt.Die Zwei-Ebenen-Semantik nimmt natürlich nicht an, dass dieKomponenten, die in (59) enthalten sind, zuerst in der semantischenRepräsentation des Verbs sitzen, vielmehr sind sie anfangs überhauptnicht da und werden in Folge der konzeptuellen Selektion durch eineVerschiebung erst eingeführt. Interessant ist die Idee Weinreichsjedoch in zweierlei Hinsicht: einerseits zeigt sie, dass die Ideesolcher „Verschiebungen” schon seit langem existiert, wenn sie auchfrüher als semantische Operationen aufgefasst wurden, undandererseits verdeutlicht sie, dass Verschiebungen in der Regelstark kontextuell bestimmt sind.Wir können also festhalten, dass Lesarten, die durch konzeptuelleVerschiebung hergeleitet werden, in der Regel zwar konzeptuell
53 Wie Copestake/Briscoe (1996) feststellen, gibt es mehrere Typen von Grinding. Vondiesen führen nicht alle die Komponente ESSBAR ein, die Komponente SUSTANZ gilt aber allgemein. In (59) gebe ich die Regel für den Typ „animal grinding” an.
35
motiviert, jedoch primär kontextuell bestimmt sind, Lesartenandererseits, zu denen wir durch konzeptuelle Fokussierung gelangen,primär konzeptuell motiviert sind (d. h. entscheidend bei derAuswahl an Lesarten ist, wie die durch die lexikalische Einheitbezeichnete Entität beschaffen ist), wobei sekundär auch lexikalischsemantische Blockierungen diese beeinflussen können.Als eine ganz eindeutig kontextuell hervorgerufene konzeptuelleVerschiebung können wir die Einführung der Komponente BEHÄLTERerwähnen. Wie (21) oben zeigt können z. B. Öffnungen als Behälterfungieren, aber besonders wenn es um die Struktur oder eineunmittelbar nicht beobachtbare Eigenschaft einer Entität geht, kannso gut wie alles als Behälter konzeptualisiert werden. Als ein(vollkommen willkürlich herausgegriffenes) Beispiel kann man (62)nehmen:
(62) Bananen enthalten viele Vitamine.Bananen sind an sich bestimmt keine typischen Behälter, dennocherscheinen Vitamine in diesem Beispiel als Objekte in dem BehälterBanane (wobei der Kontext und näher das Verb enthalten dieseVerschiebung induziert).Ein weiterer Unterschied, der zur Identifizierung von konzeptuellverschobenen gegenüber konzeptuell fokussierten Lesarten genanntwerden kann, besteht darin, dass letztere anscheinend viel eher alserstere dazu neigen, lexikalisch blockiert zu werden.Konzeptuelle Verschiebungen sind in der Regel extrem produktiv. Dasgilt für alle bisher erwähnten Verschiebungstypen wie Grinding, diegenerische Lesart oder die sekundäre Behälterlesart. Es können kaumBeispiele genannt werden, wo sie lexikalisch blockiert würden(besonders dadurch, dass schon eine lexikalische Einheit gegebenist, die die verschobene Lesart als primäre Lesart hat). Paralleldazu sind sie auch weitgehend universal, d. h. wahrscheinlich inallen natürlichen Sprachen gleichermaßen möglich. Als eine möglicheAusnahme kann die Bezeichnung von Fleischsorten im Englischengenannt werden. Copestake/Briscoe (1996: 38) erwähnen, dass dasGrinding im Fall von pig ‘Schwein’ oder cow ‘Kuh’ durch pork‘Schweinefleisch’ bzw. beef ‘Rindfleisch’ blockiert wird, so dassSätze wie (63) seltsam sind:
(63) ?Sam ate pig.Allerdings weisen sie selber darauf hin, dass diese Blockierung wohleher konventionell als semantisch (oder konzeptuell) ist, da sie inbestimmten Kontexten aufgehoben wird. Davon abgesehen ist dieseBlockierung weit weniger stark und zwingend als bei derkonzeptuellen Fokussierung. (63) ist etwa eindeutig viel besser als(64), wo die Blockierung der Prozesslesart im Fall von Polizei verletztwird, wodurch der Satz nicht nur seltsam, sondern unverständlichwird.
36
(64) ??Die Polizei macht ihm großen Spaß. (beabsichtigte Lesart: ‘die Arbeit bei der Polizei’)Wir können also weiterhin bei der Annahme bleiben, dass konzeptuelleVerschiebungen generell nicht blockiert werden können. DieBlockierung von konzeptueller Fokussierung kann andererseitsentweder, wie wahrscheinlich bei der Prozesslesart von Polizei, reinidiosynkratisch sein, oder sie kann durch eine entsprechendevorhandene lexikalische Einheit verursacht werden. Im Deutschen istz. B. beim Lexem Spiel die Lesart ‘Gegenstand, der zum Spielenverwendet wird’ generell blockiert, im Ungarischen hingegen ist sieerlaubt. Wir können annehmen, dass im Deutschen die Lesart durch dasVorhandensein des Lexems Spielzeug blockiert wird, was im Ungarischennicht der Fall ist, weil ein entsprechendes Lexem fehlt54.Dass weiter oben behauptet wurde, die Lesarten, die durchkonzeptuelle Verschiebung hergeleitet wurden, seien sekundär,verdient eine nähere Erläuterung. Ein wesentlicher Unterschiedzwischen der konzeptuellen Verschiebung im klassischen Modell und indem hier vorgestellten ist, dass sie hier auf konzeptuellenRepräsentationen operiert, während sie bei Bierwisch (1983a) aufsemantischen Repräsentationen operierte.Wie früher schon erwähnt wurde, können wir die gegebene Lesart desLexems Tür in (21) z. B. nur dann glaubwürdig herleiten, wenn wirannehmen, dass zuerst die Lesart ‘Öffnung’ spezifiziert wird, wasdann durch eine konzeptuelle Verschiebung modifiziert wird, indemeine Komponente BEHÄLTER in die Repräsentation eingeführt wird.
(21) Sandra steht gerade in der Tür. ‘Öffnung als Behälter’Dass diese Lesart von den beiden primären Interpretationen von Tür‘Öffnung’ und ‘Hindernis’ mit ersterem verwandt ist, bedarf keinesKommentars. Wir könnten sie zwar in einem Schritt herleiten (wie wirdas wohl im Sinne von Bierwisch 1983a tun sollten), nämlich durcheine konzeptuelle Verschiebung wie (65), eine solche elementareVerschiebungsoperation wäre jedoch rein intuitiv (da sie denoffensichtlich sekundären Charakter der Lesart nicht als solcheerfasst) ebenso bedenklich wie aus ökonomischen Gründen55.
54 Das Lexem játékszer, das die genaue Entsprechung zu Spielzeug sein sollte, wird nur in übertragenem Sinne verwendet, d. h. ‘etwas, was (besonders einem starken psychischen Zwang oder einer Naturgewalt) hilflos ausgeliefert ist’. Dass die Lesart ‘Gegenstand’ eigentlich natürlich und im Deutschen lexikalisch blockiert ist, wird durch die Tatsache bestätigt, dass diese Lesart auch im Deutschen im Zusammenhang mit einer bestimmten Gruppe von Spielen, nämlich Gesellschaftsspielen (Brettspielen), idiosynkratisch trotz der allgemeinen Blockierung erlaubt ist.55 Da sich nämlich wie gesagt so gut wie alles als Behälter konzeptualisieren lässt,müssten wir die Zahl der konzeptuellen Verschiebungen verdoppeln (neben die Verschiebungen ‘Öffnung’, ‘Institution’ usw. treten dann ‘Öffnung als Behälter’, ‘Institution als Behälter’ usw.). Für jede weitere extrem produktive Verschiebungsoperation käme dann wieder eine Reihe von Verschiebungsoperationen hinzu (also z. B. ‘Öffnung als Prinzip’, ‘Institution als Prinzip’ usw. für die
37
(65)SEMx [ÖFFNUNG x UND BEHÄLTER x UND SEM x]Es empfiehlt sich daher eher, zu erlauben, dass konzeptuelleOperationen nacheinander angewendet werden können.Demnach würde in jedem Fall zuerst eine Fokussierung erfolgen undauf die sich dadurch ergebende konzeptuelle Repräsentation würdeeine konzeptuelle Verschiebung angewendet. Diese Annahme würdevorhersagen, dass konzeptuelle Verschiebungen generell auf allemöglichen fokussierten Bedeutungsvarianten angewendet werden können,dass also im Fall von Schule eine generische Lesart nicht nur auf derLesart ‘Institution’ (wie in 15), sondern auch auf den anderenLesarten basieren kann. Dies scheint intuitiv auch richtig zu sein,obwohl sich entsprechende Belege schwer finden lassen. Eine Lesart‘Gebäude als Prinzip’ käme etwa in einem Text in Frage, wo dieArchitektur von Schulgebäuden diskutiert wird, ‘Prozess als Prinzip’etwa im folgenden Satz:
(66) Die Schule gehört nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Jugendlichen.Verschiedene konzeptuelle Verschiebungen lassen sich sukzessivanwenden. Wir können z. B. davon ausgehen, dass die Lesart‘Personen, die zur Institution gehören’ durch eine Verschiebunghergeleitet wird56. Ein Satz wie (67) könnte dann als Beispiel fürdie Lesart ‘Personen als Prinzip’ genannt werden.
(67) Die Schule ist besonders wichtig, da sie eine Gemeinschaftist, die die Sozialisation von Kindern entscheidend beeinflusst.
4.6. Fokussierung, Verschiebung und gleichzeitig zugängliche LesartenEin weiteres Argument für die Trennung von Lesarten, die durchkonzeptuelle Fokussierung bzw. konzeptuelle Verschiebung hergeleitetwerden, stellen Daten im Zusammenhang mit der gegenseitigenKompatibilität von verschiedenen Lesarten dar.Bei Betrachtung der Daten von Bierwisch (1983a: 93) zeigt sich, dassdie Lesarten, die durch konzeptuelle Fokussierung hergeleitetwurden, miteinander weitaus verträglicher sind als eine verschobeneLesart mit einer fokussierten:
generische Lesart etc.). Da die kombinatorischen Möglichkeiten der verschiedenen produktiven Verschiebungen sehr groß sind, hätten wir am Ende ein riesiges Inventaran Verschiebungoperationen, das größtenteils aus sehr exotischen „komplexen” Verschiebungen bestehen würde.56 Diese Annahme ist allerdings nicht unproblematisch, da sich die ‘Personen’-Lesartnur bei lexikalischen Einheiten zu ergeben scheint, die in weitem Sinne Institutionen bezeichnen (wobei Kaufhaus und Tankstelle ebenso als Institution gelten würden wie Parlament oder Schule). Bei solchen lexikalischen Einheiten ist sie allerdings extrem produktiv (mir sind keine Blockierungen in diesem Kreis bekannt) und sie ist zur Lesart ‘Institution’ ziemlich eindeutig sekundär, was für den Status als Verschiebung spricht. Die Frage müsste allerdings näher untersucht werden, um eine definitive Charakterisierung der Operation geben zu können.
38
(37) Die Schule, die neben dem Sportplatz liegt, hat einen größeren Betrag gestiftet.
(38) ??Die Schule, ist aus der Geschichte Europas nicht wegzudenken und (sie) liegt neben dem Sportplatz.
(68) ?Die Schule liegt neben dem Sportplatz und (sie) hat einengrößeren Betrag gestiftet57.
(69) ??Die Schule ist aus der Geschichte Europas nicht wegzudenken und (sie) hat einen größeren Betrag gestiftet.
Bierwisch formuliert die Verallgemeinerung, dass „die generischeoder Prinzip-Variante Kontaminationen mir anderen Varianten amdeutlichsten ausschließt”. Dass sich die Beschränkung allerdingsvielmehr auf die Kontamination von verschobenen Lesarten mit anderen(fokussierten oder ebenfalls verschobenen) Lesarten bezieht, zeigendie Beispiele (70)58 und (71), ferner auch (40):
(70) ??Sam fed and enjoyed the lamb. Grinding und ‘Tier’
(71) ??Die Schule, die ihm Spaß macht, hat einen Ausflug nach Holland gemacht.
‘Prozess’ und ‘Personen’Dass allerdings weiterhin angenommen werden muss, dass auch andereFaktoren dabei eine Rolle spielen, zeigt (39) oder das folgendeBeispiel, das zwar etwas seltsam, aber deutlich weniger schlecht alsdie genannten Beispiele ist:
(72) ?Das Schwein, das die kalorienreichste Fleischsorte ist, hat ihm sehr geschmeckt.
Grinding und generische Lesart sekundär zum GrindingFür die Akzeptabilität scheint ausschlaggebend zu sein, ob einesekundäre Lesart mit der Lesart „kontaminiert” wird, von der sieabgeleitet wurde, oder mit einer anderen Lesart derselbenlexikalischen Einheit. Im Fall von (39) gegenüber (40) könnten wirannehmen, dass (39) aus dem Grund akzeptabler ist, weil in (39)trotz der Nennung der Lokalität trotzdem die Institutionslesartanwesend ist und diese mit der ‘Personen’-Lesart „kontaminiert”wird.Schließlich sollte auch untersucht werden, wie diese gleichzeitigzugänglichen Lesarten im Rahmen des modifizierten Modellsdargestellt werden können. Die Vorgehensweise, die auf der Handliegt ist mutatis mutandis mit der von Bierwisch vorgeschlagenenidentisch. An Stelle von der Variablen einer Komponente werden die
57 Obwohl Bierwisch dieses Beispiel als seltsam einstuft, scheint sie mir keineswegsunakzeptabel zu sein.58 Aus Copestake/Briscoe (1996: 38).
39
Variablen mehrerer Komponenten durch denselben Lambda-Operatorgebunden und dadurch fokussiert59.
(73) x Schule’(x) : x w [GEBÄUDE (x) & INSTITUTION (x) & SITZ (x,x) & ZIEL (x,w) & LEHR-_UND_LERNPROZESSE (w) (& ...)]
Eine Repräsentation wie (73) ist rein wahrheitskonditional gesehenvöllig unsinnig. Ontologisch kann eine Entität nicht ein Gebäude undeine Institution zugleich sein. Allerdings scheint dieseRepräsentation aus einer kognitiven Perspektive die richtige zusein. Bei der Kontaminierung von Lesarten scheint nämlich gerade dieUnterscheidung von zwei Aspekten einer Entität, im gegebenen Fallvom Gebäudeaspekt und vom Institutionsaspekt, aufgehoben oderverwischt zu werden.Die Art und Weise, wie Verschiebungen repräsentiert werden, sagt ansich voraus, dass (70) und (71) nicht wohlgeformt sein können, d. h.dass eine verschobene Lesart nicht mit einer Lesart des Worteskontaminiert werden kann, wenn diese Lesart nicht der Ausgangspunktder Verschiebung ist (d. h. die im Vergleich zur verschobenen Lesartprimäre). So brauchen keine weiteren Regeln stipuliert zu werden,die solche Beispiele ausschließen. Die beiden Lesarten von lamb, diein (70) verlangt werden, können folgendermaßen charakterisiertwerden:
(74) x lamb’ (x) : x [TIER (x) & LAMM (x) (& ...)]‘Tier’
(75)y x [SUBSTANZ (y, x) & ESSBAR (y) & TIER (x) & LAMM (x)(& ...)]
‘zerkleinertes Tier’Nun ist die Variable, die das Argument von TIER und LAMM ist, in (74)durch einen Lambda-Operator gebunden, in (75) andererseits durcheinen Existenzquantor. Da eine Variable nicht gleichzeitig durchdiese beiden Operatoren gebunden werden kann, sind (74) und (75)nicht miteinander vereinbar, so dass (70) richtig als semantischabweichend ausgewiesen wird.Wenn wir annehmen, dass die ‘Personen’-Lesart durch eineVerschiebung wie (76) hergeleitet wird und daher als (77)repräsentiert werden kann, können wir die einschlägigen Datenebenfalls unmittelbar erklären:
(76)Personen : Px [GESAMTHEIT_VON_PERSONEN (x) &KONSTITUIERT (x,x) & P
59 Möglicherweise muss eine Beschränkung stipuliert werden, dass höchstens zwei fokussierbare Variablen in einer semantischen Repräsentation durch einen gemeinsamen Lambda-Operator gebunden werden, d. h. höchstens zwei primäre Lesarten miteinander kontaminiert werden können; im Fall von Schule scheinen zumindest alle drei Variablen nicht zugleich fokussierbar zu sein (und mir ist auch sonst kein solches Beispiel bekannt).
40
(x)]60
(77)x Schule’(x) : x y w [GESAMTHEIT_VON_PERSONEN (x) &KONSTITUIERT (x,x) & GEBÄUDE (y) & INSTITUTION (x) & SITZ
(y,x) &ZIEL (x,w) & LEHR-_UND_LERNPROZESSE (w)]
Die Repräsentation (77) ist mit der von der Lesart ‘Institution’ (woalso ebenfalls die Argumentvariable von INSTITUTION fokussiert und dieanderen existenzquantifiziert sind) kombinierbar, was richtigvorhersagt, dass (78) akzeptabel sein muss:
(78) Die Schule, die einen größeren Betrag gespendet hat, hateinen Ausflug gemacht.Andererseits wird über (40) richtig vorhergesagt, dass er nichtakzeptabel ist, da bei der ‘Gebäude’-Lesart die Variable fokussiertwird, die das Argument von GEBÄUDE ist, und die entsprechendeRepräsentation ist dann mit (77) nicht kompatibel. (39) ist indiesem Zusammenhang interessant. Wir können hier annehmen, dass die‘Personen’-Lesart mit der (73) entsprechenden ‘Institution-Gebäude’-Lesart zusammen vorkommt. (73) und (77) sind zwar nicht direktmiteinander vereinbar, da die Argumentvariable von GEBÄUDE jeweilsunterschiedlich gebunden ist, aber zumindest ist die von Institutionin beiden Fällen durch einen Lambda-Operator gebunden. DieAbweichung zwischen den beiden Repräsentationen führt anscheinenddazu, dass (39) etwas seltsam ist, aber er ist wegen ihrerteilweisen Übereinstimmung dennoch relativ akzeptabel.
4.7. Der Standpunkt der Generative Lexicon-TheorieEs lässt sich als eine recht überzeugende unabhängige Evidenz (nebenden genannten theorieinternen Motiven und den genannten empirischenDaten) für die oben vorgestellte Revidierung der Zwei-Ebenen-Semantik auffassen, dass ein anderer Ansatz, der in der heutigenlexikalischen Semantik sehr prominent ist, nämlich die GenerativeLexicon-Theorie von Pustejovsky (ausführlich vorgestellt inPustejovsky 1995) sehr ähnliche Repräsentationen und teilweiseähnliche Regeln, die über den Repräsentationen operieren, annimmt.Die Unterschiede zwischen der Generative Lexicon-Theorie und derZwei-Ebenen-Semantik (sowohl der klassischen als auch der hiervorgestellten modifizierten Fassung) lassen sich größtenteils vondem unterschiedlichen Hintergrund her erklären. Während die Zwei-Ebenen-Semantik in der Tradition der rein theoretischen Linguistikwurzelt (wobei besonders die lexikalische Dekomposition und das Erbeder Katz-Fodor-Theorie offensichtlich sind), wurde die Generative60 Eigentlich würde hier natürlich auf den ersten Blick eine Repräsentation naheliegen, bei der KONSTITUIERT (x,y) und P (y) an Stelle der entsprechenden Komponenten steht. Allerdings könnte dann kaum erklärt werden, warum die verschiedenen Lesarten von Schule genau in der Weise kombinierbar sind, wie die Beispiele zeigen. Daher halte ich diese Repräsentation zwar für sehr verdächtig aber dennoch für die richtige.
41
Lexicon-Theorie im Rahmen der computerlinguistischen Forschungentwickelt. Aus letzterem folgt, dass sie mit Konzepten operiert,die zwar in der Computerlinguistik geläufig und weitgehendakzeptiert sind (z. B. ontologische Typensysteme, die etwa bei derWissensrepräsentation verwendet werden), für einen theoretischenLinguisten jedoch, der nicht aus diesem Umkreis kommt, sehr exotischund suspekt erscheinen.Dass sich die Repräsentationen von Pustejovsky nicht unmittelbar mitdenen der Zwei-Ebenen-Semanik vergleichen lassen, folgt schon ausder Tatsache, dass sich die lexikalische Semantik in der GenerativeLexicon-Theorie in mehrere Ebenen gliedert, wobei die Ebene, auf derim Wesentlichen die lexikalische Dekompositionsstruktur lokalisiertwerden kann, nämlich die sog. Qualia-Struktur, selbst vierfachgegliedert ist. Die Komponenten, die in den oben formuliertenRepräsentationen nebeneinander stehen können in einer GenerativeLexicon-Repräsentation demnach auf verschiedene Ebenen und Qualiaverteilt sein (v. a. auf die Argumentstruktur, auf das formale undauf das konstitutive Quale).Ich habe hier nicht die Möglichkeit, näher auf den Aufbau und dasInstrumentarium der Generative Lexicon-Theorie einzugehen undbeschränke mich deshalb nur auf zwei kurze Illustrationen.Einerseits bietet sich die lexikalische Einheit Tür zum Vergleich an.Die Repräsentation, die ich dafür vorgeschlagen habe, ist (43). IhreRepräsentation im Sinne der Generative Lexicon-Theorie wäre etwa diefolgende (ich stelle die Qualia-Struktur nicht näher dar sondernbeschränke mich nur auf den unmittelbar interessierenden Teil):
(79)
Dass das Lexem door sowohl eine Öffnung als auch ein Objektbezeichnen kann, wird nicht in der Weise dargestellt, dassentsprechende Komponenten in der Repräsentation enthalten wären,sondern indem festgelegt wird, dass bestimmte Variablen, die in derQualia-Struktur bestimmten Prädikaten zugeordnet sind, bestimmtenontologischen Typen angehören. Die beiden Typen aperture undphys_obj sowie der aus ihnen gebildete komplexe Typaperture·phys_obj werden gemeinsam als aperture·phys_obj_lcpzusammengefasst (lcp ist der sog. type constructor, der die komplexenTypen aus den einfachen konstruiert). Wichtig ist dabei nun, dassdiese Repräsentation im Wesentlichen behauptet, dass etwas, was doorgenannt werden kann, entweder eine Öffnung ist oder ein Objekt oder
42
zu einem komplexen Typ gehört, der sich aus dem Schnitt dieserbeiden Typen ergibt. Die semantische Unterspezifiziertheit derlexikalischen Einheit ergibt sich also im Prinzip in derselbenWeise, wie bei (43). Wir haben zwei Variablen. Wenn die eine imVordergrund steht (also fokussiert wird), bezeichnet door eineÖffnung, wenn die andere, ein Objekt und wenn schließlich beidefokussiert werden, ergibt sich eine hybride Lesart wie in (80)61:
(80) Der Einbrecher trat die Tür ein und ging hindurch.Produktive Bedeutungsvariationen werden andererseits nicht in denjeweiligen lexikalischen Einheiten kodiert, sondern durchlexikalische Regeln eingeführt, was wiederum mit der konzeptuellenVerschiebung verglichen werden kann. Die lexikalische Regel desGrinding könnte als ein Beispiel erwähnt werden, dieCopestake/Briscoe (1996: 40) erwähnen.Zusammengefasst lässt sich also feststellen, dass die Art und Weise,wie die Generative Lexicon-Theorie Bedeutungsvariation behandelt,eng mit dem hier vorgestellten Vorschlag verwandt ist und derUnterschied zwischen ihnen zumindest im Zusammenhang mit dem hierillustrierten Aspekt der Theorie eher oberflächlich ist und sichnicht aus einer wesentlich verschiedenen Bewertung der Daten,sondern vielmehr aus der unterschiedlichen Zielsetzung der beidenAnsätze ergibt62.
5. ZusammenfassungIch habe in diesem Aufsatz versucht, bestimmte Annahmen der Zwei-Ebenen-Semantik über die Repräsentation von Polysemie zu überprüfenund falls notwendig zu revidieren.
61 Allerdings muss hinzugefügt werden, dass die beiden möglichen Lesarten in diesem Beispiel zwar tatsächlich gleichzeitig zugänglich sind, Pustejovsky m. E. jedoch oft auch in Fällen kontaminierte Lesarten annimmt, wo das nicht ganz nachvollziehbar ist. Das Lexem construction (s. Pustejovsky 1995: 94) hat etwa die zwei einfachen Lesarten ‘Prozess’ und ‘Resultat des Prozesses’, wie in (F4) und (F5):(F4) The construction was arduous and tedious.(F5) The construction is standing on the next street.Nach Pustejovsky sollte auch bei construction eine kontaminierte Lesart möglich sein, die in (F6) erscheint:(F6) The house’s construction was finished in two months.Dieses Beispiel halte ich jedoch nicht für überzeugend (intuitiv scheint es ein Beispiel für die ‘Prozess’-Lesart zu sein und nichts mit F4 zu tun zu haben) und das gilt auch für viele andere Fälle, wo kontaminierte Lesarten illustriert werden sollen.62 Es ist allerding hinzuzufügen, dass die Generative Lexicon-Theorie sich an anderen Punkten stark von der Zwei-Ebenen-Semantik unterscheidet. So behandelt Pustejovsky etwa Fälle, die in der Zwei-Ebenen-Semantik als konzeptuelle Differenzierung gelten und bei denen teilweise fraglich ist, ob es sich überhaupt um Polysemie oder vielmehr um eine einzige Lesart handelt, von Pustejovsky sehr ähnlich behandelt wie die Instanzen systematischer Polysemie (vgl. Beispiele wie ein Buch anfangen/beenden in Pustejovsky 1995).
43
Dabei habe ich versucht zu zeigen, dass wir eine empirischadäquatere, systematischere, explizitere und einfachere Behandlungder Polysemie erreichen, wenn wir im Gegensatz zur klassischenFassung der Zwei-Ebenen-Semantik, zusammengefasst in Bierwisch1983a, zwei Arten der Herleitung von Bedeutungsvarianten beiSubstantiven unterscheiden, wo nur eine Operation der konzeptuellenVerschiebung angenommen wurde.Als die Operation, durch die für die jeweilige lexikalische Einheitcharakteristische Lesarten hergeleitet werden, wurde diekonzeptuelle Fokussierung ausgewiesen. Als Grundlage für diekonzeptuelle Fokussierung werden gegenüber den in der klassischenTheorie postulierten reichere, jedoch weiterhin unterspezifizierteRepräsentationen angenommen. Die Operation der konzeptuellenVerschiebung bleibt erhalten, wird jedoch funktional starkeingeschränkt und dient nunmehr der Herleitung von Lesarten, dienicht für die jeweilige lexikalische Einheit charakteristisch sind,sondern die für eine Vielzahl von semantisch nicht eng verwandtenWörtern gebildet werden können.Als empirische Daten, die für die Trennung der beiden Operationensprechen, wurden vor allem Beispiele zitiert, wo mehrere Lesarteneiner lexikalischen Einheit gleichzeitig aktiviert werden.Nicht behandelt wurde der Status der konzeptuellen Differenzierung,weil ich annehme, dass diese Operation wohl erhalten bleiben muss,um die Bedeutungsvariation bei Verben zu erfassen und andererseitsweil m. E. aufgrund der bekannten Daten kaum wertvolle linguistischeGeneralisierungen im Zusammenhang mit der konzeptuellenDifferenzierung formuliert werden können und daher ihre Untersuchungverhältnismäßig uninteressant, da weniger ertragreich ist.Ebenfalls nicht behandelt wurde die oben „weiche Polysemie” genannteSpielart der Bedeutungsvariation. Obwohl dieser Standpunkt von denVertretern der holistischen kognitiven Semantik nicht akzeptiertwird, sehe ich keine Möglichkeit, weich polyseme Wörter als Lexemezu behandeln, deren verschiedene (in der Regel miteinandermetaphorisch zusammenhängende) Lesarten aus je einer gemeinsamensemantischen Repräsentation abgeleitet würden. Vielmehr steht insolchen Fällen nur der Weg offen, die Lesarten jeweils verschiedenensemantischen Repräsentationen zuzuordnen und d. h. vonverschiedenen, lexikalisch homonymen Lexemen auszugehen.Die in diesem Aufsatz vorgeschlagenen Lösungen für die Behandlungder Polysemie sind insofern mit der Zwei-Ebenen-Semantik kompatibel,als sie den sprachtheoretischen Hintergrund der Zwei-Ebenen-Semantikbehalten. Die einzelnen Analysen widersprechen jedoch denen, die inden klassischen Werken vorgeschlagen wurden und vertreten sogar imFall von prominenten Beispielen der Zwei-Ebenen-Semantik eine ihrgrundsätzlich entgegengesetzte Meinung. Da die hier vorgeschlagenenWerkzeuge anscheinend all das leisten, was das klassische Modell der
44
Zwei-Ebenen-Semantik konnte und außerdem den Anspruch haben, auchweitere Generalisierungen zu erfassen, stellt sich die Frage, obsich jenes auf das hier vorgestellte modifizierte Modell vollständigreduzieren lässt.Die Entscheidung darüber, inwieweit meine Analysen letztendlich nochZwei-Ebenen-Semantik genannt werden können oder sollten, sei demLeser überlassen.
Literatur
APRESJAN, J. D. (1973), Regular polysemy. Linguistics 142, 5–32.BIERWISCH, M. 1983a. Semantische und konzeptuelle Repräsentation
lexikalischer Einheiten. In RŮŽIČKA, R./MOTSCH, W. (Hrsg.),Untersuchungen zur Semantik. (studia grammatica XXII). Berlin: Akademie-Verlag, 61–99.
BIERWISCH, M. 1983b. Major aspects of the psychology of language. Inders., Essays in the psychology of language. (Linguistische Studien, Reihe AArbeitsberichte 114). Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR,Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, 1–38.
BIERWISCH, M. o. J. Die Integration autonomer Systeme — Überlegungenzur kognitiven Linguistik. Manuskript (Dissertation B).
BIERWISCH, M./E. LANG (Hrsg.) 1987. Grammatische und konzeptuelle Aspekte vonDimensionsadjektiven. (studia grammatica XXVI + XXVII). Berlin: Akademie-Verlag.
BOSCH, P./P. GERSTL (Hrsg.), 1992. Discourse and lexical meaning. (Arbeitspapieredes Sonderforschungsbereichs 340, Bericht Nr. 30).
CARLSON, G./F. PELLETIER (Hrsg.) 1995. The generic book. Chicago: Universityof Chicago Press.
COPESTAKE, A./T. BRISCOE 1996. Semi-productive polysemy and senseextension. In PUSTEJOVSKY/BOGURAEV (Hrsg.), 15–67.
CRUSE, D. A. 1986. Lexical semantics. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
DEANE, P. D. 1987. Semantic theory and the problem of polysemy. Manuskript(Ph.D. Dissertation). University of Chicago.
DÖLLING, J. 1992. Polysemy and sort coercion in semanticrepresentations. In BOSCH/GERSTL (Hrsg.), 61–78.
DÖLLING, J. 1994. Sortale Selektionsbeschränkungen und systematischeBedeutungsvariationen. In SCHWARZ (Hrsg.), 41–59.
EGG, M. 1994. Zur Repräsentation extrem polysemer Lexeme. In SCHWARZ(Hrsg.), 163–177.
EGLI, U. et al. (Hrsg.) 1995, Lexical knowledge in the organization of language.(Current issues in linguistic theory 114). Amsterdam/Philadelphia, Benjamins.
GEERAERTS, D. 1995. Representational formats in cognitive semantics.Folia Linguistica 29/1–2, 21–41.
45
GERSTL, P. 1992. Polysemy – list of readings or core meaning? „left”:a case study. In BOSCH/GERSTL (Hrsg.), 91–105.
LANG, E. 1994. Semantische vs. konzeptuelle Struktur: Unterscheidungund Überschneidung. In SCHWARZ (Hrsg.), 25–40.
LANG, E. 1995. Das Spektrum der Antonymie. Semantische undkonzeptuelle Strukturen im Lexikon und ihre Darstellung imWörterbuch. In HARRAS, G. (Hrsg.), Die Ordnung der Wörter. Berlin: deGruyter, 30–98.
MEYER, R. 1994. Probleme von Zwei-Ebenen-Semantiken.Kognitionswissenschaft 4, 32–46.
NUNBERG, G. 1980. The non-uniqueness of semantic solutions —polysemy. Linguistics and Philosophy 3, 143–84.
PAUSE, P./A. BOTZ/M. EGG 1995. Partir c’est quitter un peu. A two-levelapproach to polysemy. In EGLI et al. (Hrsg.), 245–82.
PETHŐ, G. 1998. A száj szó jelentésének kognitív szemantikai leírása.[Die Beschreibung der Bedeutung des Wortes száj (= ‘Mund’) in derkognitiven Semantik.] Folia Uralica Debreceniensia 5, 133–202.
PETHŐ, G. 1999. Die Behandlung der Polysemie in der Zwei-Ebenen-Semantik und den prototypentheoretischen Semantiken. Sprachtheorieund Germanistische Linguistik 9.1., 19–57.
PUSTEJOVSKY, J. 1995. The generative lexicon. Cambridge/London: MIT Press.PUSTEJOVSKY, J./B. BOGURAEV (Hrsg.) 1996. Lexical semantics. The problem of
polysemy. Oxford: Clarendon.SCHWARZ, M. (Hrsg.) 1994. Kognitive Semantik/Cognitive Semantics. Ergebnisse,
Probleme, Perspektiven. Tübingen: Narr.SCHWARZE, CH./M.-T. SCHEPPING 1995. Polysemy in a two-level-semantics.
In EGLI et al. (Hrsg.), 283–300.TAYLOR, J. R. 1994. The two-level approach to polysemy. Linguistische
Berichte 149, 3–26.TAYLOR, J. R. 1995. Linguistic categorization. Prototypes in linguistic theory. 2.
Aufl. Oxford: Oxford University Press.WEINREICH, U. 1966. Explorations in semantic theory. In T. A. SEBEOK
(Hrsg.) Current trends in linguistics 3. The Hague: Mouton, 395–477.
46