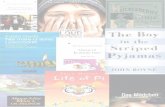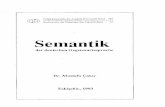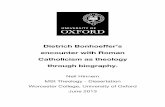Dietrich, Wolf & Ulrich Hoinkes & Bàrbara Roviró & Matthias Warnecke (Hg.). 2006. Lexikalische...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Dietrich, Wolf & Ulrich Hoinkes & Bàrbara Roviró & Matthias Warnecke (Hg.). 2006. Lexikalische...
Wolf Dietrich u. a. (Hgg.). Lexikalische Semantik und Korpuslinguistik 25
Wimmer, Rainer. 2003. Sprachkritik in der Diskussion. In: Sprachreport,
2/2003, 26-29.
Wolf Dietrich & Ulrich Hoinkes & Bàrbara Roviró & Matthias War-
necke (Hg.). 2006. Lexikalische Semantik und Korpuslinguistik. Tübingen:
Narr. 498 S.
Jörg Kilian Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Germanistisches Seminar
Leibnizstraße 8
D-24118 Kiel
Der Band, zugleich eine Gedenkschrift für den 2002 verstorbenen Roma-
nisten und strukturellen Semantiker Horst Geckeler, setzt als dritter Teil
eine Reihe von Publikationen fort, die Beiträge Münsteraner Fach-
tagungen zur lexikalischen Semantik versammeln. Nachdem eine erste
Fachtagung im Jahr 1995 Ansätze der lexikalischen Semantik erkundet
hatte und im Rahmen einer zweiten Fachtagung im Jahr 2000 Ansätze der
strukturellen Semantik gemeinsam mit „konkurrierenden Richtungen der
kognitiven Semantik und Pragmatik“ (aus dem Vorwort zum vorliegenden
Band) in den Blick genommen worden waren,1 widmete sich die in diesem
Band dokumentierte dritte Fachtagung im Jahr 2004 der im Titel benann-
ten Erweiterung dieses Blickes auf die Korpuslinguistik.
Die Herausgeber versammeln insgesamt 22 Beiträge aus der romanis-
tischen, germanistischen und allgemeinen Sprachwissenschaft in deut-
scher, französischer, spanischer und italienischer Sprache in den vier Ka-
piteln: „I. Zur Theorie der lexikalischen Semantik und ihrer Anwendung“
(acht Beiträge), „II. Syntaktische und syntagmatische Bezüge“ (drei Bei-
träge), „III. Zur Theorie der Korpuslinguistik“ (drei Beiträge) und „IV.
Korpuslinguistische Untersuchungen“ (acht Beiträge). Im Folgenden soll
(und kann aus Raumgründen) nicht jeder einzelne Beitrag ausführlich
abstrahiert und wissenschaftlich kritisch gewogen werden. Vielmehr sollen
in der Folge und im jeweiligen Fokus der Kapitel die Untersuchungsergeb-
_____________ 1 Vgl. Ulrich Hoinkes & Wolf Dietrich (Hg.). 1997. Kaleidoskop der lexikalischen Semantik.
Tübingen: Narr. Der Tagungsband „Funktionelle und kognitive Linguistik in der Diskussi-
on“ ist in Vorbereitung.
ZRS, Band 1, Heft 1 © Walter de Gruyter 2009 DOI 10.15/zrs.2009.007
- 10.1515/zrs.2009.007Downloaded from PubFactory at 09/03/2016 10:58:09AM
via free access
Jörg Kilian 26
nisse vor dem Hintergrund des Rahmenthemas zur Geltung kommen.
Wenn dabei einzelne Beiträge näher in den Blick rücken, während andere
nur eine kursorische Erwähnung erfahren, so ist dies nicht wertend auf die
Einzelbeiträge zu beziehen, sondern der an den Erkenntnisinteressen des
Bandes orientierten Perspektive geschuldet.
„Ziel [der in diesem Band dokumentierten Fachtagung, J. K.] war es,
die bisher erreichten theoretischen Erkenntnisse und Erfahrungen zu
verbinden, die aus dem Umgang mit großen Corpora im Bereich der lexi-
kalischen Semantik bereits gewonnen wurden“, notieren die Herausgeber
in ihrem Vorwort (S. 7), und sie fügen offen hinzu, dass diese „Verbin-
dung“ von den Beiträgerinnen und Beiträgern mit unterschiedlicher Inten-
sität durchgeführt wurde. Zum einen näherten sie sich überhaupt in unter-
schiedlichem Maße „der Korpuslinguistik als eigenständigem
Forschungsbereich“, zum anderen legten sie zum Teil eher „theoretische
Arbeiten“ und zu einem anderen Teil eher „praktische Untersuchungen“
vor (S. 8). Blickt man nach der Lektüre der im Einzelfall und insgesamt
anregenden nachdenkenswerten Beiträge zurück auf dieses Vorwort, so
kommt man nicht umhin, der Herausgeberin und den drei Herausgebern
Respekt zu zollen für diese in wissenschaftlichen Sammelbänden nicht
eben selbstverständliche Offenheit, und man vermeint zu spüren, dass es
nicht einfach war, die mitunter thematisch doch recht disparaten und
eigentlich doch weniger durch den Bezug zum Thema der Fachtagung
(und des Bandes) als vielmehr durch den Bezug zu Horst Geckelers For-
schungen zur lexikalischen Semantik verbundenen Beiträge in vier Kapi-
teln zu ordnen und diesen zuzuweisen.
Kapitel I versammelt Beiträge, die eher der semantischen Theorie ge-
widmet sind und Blicke werfen auf mögliche Anschlussstellen zur Kor-
puslinguistik; die Beiträge in Kapitel II bilden gleichsam eine Untergruppe
dazu insofern, als hier der Ausgang von syntaktischen bzw. syntag-
matischen „Aspekten“ der lexikalischen Semantik genommen wird. Im
III. Kapitel, das in einem engeren Sinne die theoretischen der „verbinden-
den“ Beiträge bietet, wird aus unterschiedlichen Perspektiven der Frage
nachgegangen, ob und inwiefern aus dem Bereich der Semantik heraus
eine Theorie der Korpuslinguistik zum Zweck der „semantische[n] Analy-
se von Textcorpora geschriebener und gesprochener Sprache“ (S. 8) zu
entwickeln sei, während im IV. Kapitel Arbeiten vorgelegt werden, die
eher aus der Praxis der lexikalischen Semantikforschung heraus den Ge-
winn korpuslinguistischer Fundierungen für lexikalisch-semantische Un-
tersuchungen aufzeigen. „Insgesamt“, so schließen die Herausgeberin und
ihre drei Mitherausgeber das Vorwort, „bietet dieser Sammelband einen
repräsentativen Überblick über den Forschungsstand, der sowohl das
schon Erreichte als auch die Desiderata zu erkennen gibt.“ (S. 9) Das und
- 10.1515/zrs.2009.007Downloaded from PubFactory at 09/03/2016 10:58:09AM
via free access
Wolf Dietrich u. a. (Hgg.). Lexikalische Semantik und Korpuslinguistik 27
im Titel, so darf man nach der Lektüre dieser Feststellung bestätigend hin-
zufügen, scheint denn auch noch eher ein additives denn ein integratives.
Im Folgenden wird gleichsam der Semantik dieses und nachgespürt.
Die Beiträge des ersten Kapitels sind, wie es der Titel des Kapitels
(„Zur Theorie der lexikalischen Semantik und ihrer Anwendung“) auch
nicht anders verspricht, eingängige semantiktheoretische Studien, die im
Großen und Ganzen ohne Korpuslinguistik auskommen. So geht Migue l
Casas Gómez der Frage nach dem Verhältnis von lexikalischer Seman-
tik und Terminologielehre nach und sucht letztere als Teilgebiet der lexi-
kalischen Semantik genauer zu bestimmen, ohne dass Korpuslinguistik in
diesem Zusammenhang eine bemerkenswerte Rolle spielte. Desgleichen
bleibt auch der Beitrag Georges Kle ibers dem zweiten Teil des Sam-
melbandtitels relativ fern. Ein Phänomen (vermeintlich) der Polysemie,
auf das Cruse aufmerksam gemacht und es als „sub-sense“ (frz. „micro-
sens“) benannt hat, wird von Kleiber der Untersuchung zugeführt. Es
geht um die Frage, ob und inwieweit es ein Fall von Polysemie sei, wenn
ein Wort sowohl hyponymische („La boîte contenait une collection de
conteaux de plusieurs sortes“) wie auch hyperonymische („As-tu un con-
teau?“) Lesarten zeige. Dies sei, so schließt Kleiber nach ausgiebiger Kritik
der Interpretation Cruses, nicht Polysemie, sondern eher Unterdetermi-
niertheit, die kontextuell eingefangen werde. Zwischen diesen beiden eher
korpusfernen Beiträgen eröffnet Hara ld Thun Blicke auf die Reich-
weite von Korpora und Erhebungsmethoden. Ausgehend von Coserius
Ansatz der „funktionellen Sprache“, also gleichsam eines in sich homoge-
nen (Sub-) Systems, und der Erörterung von Problemen, die dieser Ansatz
bereitet (wie u. a. die Abgrenzung dieser [Sub-]Systeme voneinander, so-
dann die Abgrenzung der „Gesamtheit der Äußerungen eines Sprechers“
als „Parole“ von der „Norm“ und gar dem „System“), stellt Thun fest,
dass die strukturelle Semantik die Entscheidung darüber, ob das Wortma-
terial, mit dem sie arbeitet, a) überhaupt repräsentativ ist und b) für welche
Ebene („Parole“, „Norm“, „System“), im Grunde delegiert habe an die
Lexikographie und die Sprachgeographie. Am Beispiel moderner Ansätze
der Sprachgeographie, insbesondere der „pluridimensionalen Dialektogra-
phie“, wird aufgezeigt, wie dieselbe als „Hilfswissenschaft“ der struktu-
rellen Semantik „sprachliche Grenzen“ zu markieren vermag. Bedauer-
licherweise ist die Karte, die den Ausführungen zugrunde liegt, nicht mit
abgedruckt; dennoch erhält man einen Eindruck davon, auf welche Weise
der strukturellen Semantik mit Hilfe der Sprachgeographie das korpus-
linguistische Bett aufgeschüttelt werden könnte.
Die folgenden Beiträge dieses ersten Kapitels sowie die drei Beiträge
des zweiten Kapitels sind wiederum keine korpuslinguistischen Studien im
engeren Sinne. Sie sind, wie die Kapiteltitel es auch verheißen, eher se-
- 10.1515/zrs.2009.007Downloaded from PubFactory at 09/03/2016 10:58:09AM
via free access
Jörg Kilian 28
mantiktheoretische Arbeiten, die gleichwohl auch Blicke auf die Arbeit mit
Korpora werfen – und dies sind keineswegs unkritische Blicke. So widmet
sich Gerd Wot j ak in seinem Beitrag im Wesentlichen der Frage nach
einer theoretischen Fassung für Spezifikationen der semantischen Analyse
lexikalischer Einheiten auf den Ebenen von „System“, „Norm“ und „Re-
de“ im Sinne Coserius. Auf besonderes Interesse stoßen dabei die
„Redebedeutungen“, die Wotjak zu Recht als mentale Größen – und
keinesfalls als materialisierte oder auch nur materialisierbare – identifiziert.
In diesem Zusammenhang wird dann in gewisser Hinsicht der Gewinn
der Nutzung von Korpora für die semantische Analyse eingeschränkt: In
Bezug auf die Analyse der Redebedeutung seien Korpora bereits zu weit
entfernt von den Äußerungskontexten, als dass sämtliche kotextuellen,
konzeptuellen, kommunikativ-pragmatischen u. a. Aspekte ohne Rekurs
auf eine Normbedeutung rekonstruiert werden könnten; die Norm- sowie
gar erst die Systembedeutungen seien indes gar nicht allein aus Korpora
zu gewinnen, sondern „letztlich nur über eine Introspektions- bzw.
Intuitionsanalyse“ zugänglich (S. 82). Von sich aus teilen Korpora eben
gar nichts mit, sondern allein aufgrund hypothesengeleiteter Anfrage. Der
darauf folgende Beitrag S i lke J ansens blickt im Grunde in dieselbe
Richtung. Sie stellt eine hypothesengeleitete Anfrage an ein Textkorpus
französischsprachiger Zeitungen, um zu ermitteln, ob und wann im
Sprachkontakt ein Lexem a) wörtlich übersetzt, b) als Lehnwort über-
nommen oder c) durch eine neue Eigenbildung ersetzt wird. Statt der
lesenswerten historisch-lexikologischen Einzelergebnisse und deren
sprachwandeltheoretischer Verortung sei hier nur das – eigentlich kaum
überraschende – korpuslinguistische Ergebnis erwähnt: Der besondere
Nutzen von Korpora wird darin gesehen, dass sie „über die Betrachtung
von Einzelphänomenen hinaus eine Zusammenschau der großen Ent-
wicklungstendenzen ermöglichen“ (S. 115).
Dieses Ergebnis fasst gleichsam den Zweck des Zugriffs auf Korpora
auch der drei noch verbleibenden Beiträge dieses ersten Kapitels sowie
der drei Beiträge des zweiten Kapitels zusammen – womit wiederum über
die in jedem Einzelfall lesenswerten Untersuchungen und deren lexika-
lisch-semantische Einzelergebnisse keine Aussage verbunden sei: Sei es,
dass Gi l l es Roques die Wortbedeutungsentwicklungen von bruire und
seinem Partizip bruyant nachzeichnet; sei es, dass Me ike Mel i s s sich mit
einer „modular-integrativen Wortfeldstudie“ zu deutschen „Geräusch-
Verben“ befasst; oder sei es, dass Hara ld Weydt die scheinbar mäan-
dernde Semantik von über im Konzept einer einheitlichen Bedeutung mit
zwei Merkmalen erfasst; sei es – im zweiten Kapitel „Syntaktische und
syntagmatische Bezüge“ –, dass Mar i a I l i e scu auf der Grundlage von
Beispielen „aus der Fachliteratur“ (S. 189) der Differenzierung von kon-
- 10.1515/zrs.2009.007Downloaded from PubFactory at 09/03/2016 10:58:09AM
via free access
Wolf Dietrich u. a. (Hgg.). Lexikalische Semantik und Korpuslinguistik 29
vergierenden und divergierenden Kollokationen nachspürt, dass Franz
Hundsnurscher an zwei Textbeispielen Wortbedeutung (und vor allem
den Wortartenstatus) „als den Beitrag eines Wortes zur Satzbedeutung“
(S. 209) erweist, oder dass Georgia Veldre sich auf der Grundlage des
Online-Korpus FRANTEXT der systematischen Erschließung der Kate-
gorie der assoziativen Anapher widmet – die Verfasserinnen und Ver-
fasser kommen entweder ohne Korpus im engeren Sinne zu ihren Ergeb-
nissen (Weydt, Hundsnurscher) oder aber belegen, dass und inwiefern die
Arbeit mit Korpora und Wörterbüchern die erwähnte „Zusammenschau“
ermöglicht, die auch zu Korrekturen der hypothesengeleiteten Anfragen
führen können (Roques, Meliss, Iliescu, Veldre). Das ist nicht wenig, indes
auch, wie erwähnt, nicht überraschend. Die je konkreten Erkenntnisinte-
ressen und Ergebnisse sind es, die die Beiträge zur anregenden Lektüre
machen.
„Zur Theorie der Korpuslinguistik“ ist das dritte Kapitel überschrie-
ben. Es schließt mit seinen drei Beiträgen inhaltlich folgerichtig an die
vorangehenden Arbeiten insofern an , als nun der durch die Nutzung von
Korpora im Rahmen lexikalisch-semantischer Analysen erzielte Gewinn
der „Zusammenschau“ vertiefend – und kritisch – in den Blick genom-
men wird. François Rastier belegt eindrucksvoll, dass große Korpora er-
lauben, semantische Strukturen nicht allein „in den Wörtern“, sondern
„zwischen den Wörtern“, mehr noch: in übergreifenden diskursiven Zu-
sammenhängen zu entdecken und sucht dieselben zwischen Langue und
Parole zu verorten. Johannes Kabatek zeichnet an Beispielen aus der
Geschichte romanischer Sprachen den „Bedeutungsausbau“ im Sinne der
inneren Entlehnung nach und kommt in Bezug auf eine korpuslinguisti-
sche Theoriebildung zu dem Schluss, dass Korpora zunächst nur aus-
drucksseitige Zugriffe zulassen. Es müsse semantisch annotierte Korpora
geben, zumindest eine Systematik semantisch kodierter Abfragemodi bei
der Nutzung gängiger Korpora, wenn man den „Bedeutungsausbau“ einer
Sprache untersuchen wolle – doch sei es gar fraglich, „ob es hier über-
haupt sinnvoll ist, die Corpuslinguistik zu bemühen.“ (S. 294f.) Fast noch
kritischer fällt das Urteil Chr i s toph Schwarzes aus, der als unhinter-
gehbare Voraussetzung semantischer Studien kulturelles, philologisches
und soziolinguistisches Wissen anführt und hinzufügt: „Il est évident que
cela vaut aussi pour la ,linguistique de Corpus‘.“ (S. 311) Die Korpus-
linguistik erscheint hier, wie mittelbar schon bei Wotjak und anderen
Beiträgerinnen und Beiträgern dieses Sammelbandes, als bedeutsame
Hilfswissenschaft der Semantik, deren Nutzung indes stets hermeneutisch
flankiert sein muss.
Die acht „Korpuslinguistischen Untersuchungen“ des den Band be-
schließenden vierten Kapitels veranschaulichen diese Nutzung aus unter-
- 10.1515/zrs.2009.007Downloaded from PubFactory at 09/03/2016 10:58:09AM
via free access
Jörg Kilian 30
schiedlichen Richtungen. Mar i a Grossmann prüft im Anschluss an
Arbeiten Geckelers zu Adjektiven aus dem Sinnbezirk des „Alters“, dass
und inwiefern die Untersuchungen durch Heranziehung von CD-ROM-
und Online-Korpora optimiert werden können. Hi l t raud Dupuy-
Enge lhard t erörtert am Beispiel einer „korpusgestützte[n] lexemati-
sche[n] Analyse des deutschen Wortfeldes des Hörbaren“ Probleme der
Korpora-Nutzung insbesondere in Bezug darauf, aus „Rede“-
Bedeutungen des Korpus „System“-Bedeutungen zu erschließen. Die
„monosemierende Funktion des Kontextes“ (S. 363), wie sie in Korpora
immer wieder deutlich wird, erlaubten eine Präzisierung, doch scheinen
Korpora nur bis zu einer „distributionsbestimmten Normbedeutung“ zu
führen (S. 363). Dieses Ergebnis bestätigt grosso modo die Einschätzung
Wotjaks. C laud ia Glanemann sucht in ihrem Beitrag das Problem der
semantischen Analyse primärer Farbwörter, die sich den Ansätzen der
systembezogenen strukturellen Semantik im Sinne Coserius und Geckelers
verschließen, in den Griff zu bekommen, indem sie in (Zeitungs-)Text-
korpora am Beispiel des Farbwortes weiß (bzw. frz. blanc und ital. bianco)
deren Norm- und Redebedeutungen nachspürt. Der korpuslinguistische
Zugriff wird jedoch nicht näher erörtert, verbleibt auch eher im Hinter-
grund, weshalb dieser Beitrag ebenso gut auch im ersten Kapitel seinen
Platz hätte finden können. Dieselbe Feststellung ist mutatis mutandis auch
für E lmar Egger t s Untersuchungen zu „semantischen Prozessen bei
der Ableitung von Ortsnamen zu treffen, denen „Wörterbucheinträge
einiger ausführlicher Ortsnamenableitungen“ (S. 404) zugrunde liegen.
Eggert schließt jedoch seinen Beitrag mit einem „Ausblick und Bezug zur
Korpuslinguistik“, das in die korpuslinguistische Grundmelodie zahlrei-
cher Beiträge dieses Sammelbandes insofern einstimmt, als auch Eggert
der Korpuslinguistik eine bedeutsame hilfswissenschaftliche Rolle im
Rahmen der lexikalischen Semantik zuspricht, wenn denn vor der jeweili-
gen Analyse und bezogen auf dieselbe „Kriterien für die Erstellung des
Korpus erarbeitet worden sind“ (S. 415). Er ic Sonntag führt diesen
Gedanken gleichsam fort, wenn er Kriterien für eine korpusgestützte Un-
tersuchung zur Gebräuchlichkeit und zur Lexikalisierung von Diminutiva
diskutiert. Während in Wörterbüchern grundsätzlich nur lexikalisierte
Diminutiva gebucht werden, könne mit Hilfe von Korpora die Gebräuch-
lichkeit diminutivischer Ausdrücke im Allgemeinen statistisch erhoben,
mithin ihre „Üblichkeit“ erfasst werden. Die Lexikalisierung erscheine
somit „als Herausforderung für die Korpuslinguistik“ (S. 420). In dieselbe
Richtung führt auch der Beitrag Bruno St a ibs : Während Elativbildun-
gen auf -issime im Französischen lexikologisch und lexikographisch als
marginal und unproduktiv gelten, kann Staib mit Hilfe des historischen
Textkorpus FRANTEXT zeigen, dass dieser Bildungstyp zwar im großen
- 10.1515/zrs.2009.007Downloaded from PubFactory at 09/03/2016 10:58:09AM
via free access
Wolf Dietrich u. a. (Hgg.). Lexikalische Semantik und Korpuslinguistik 31
Ganzen in der Tat nicht sehr produktiv ist, gleichwohl für einzelne Basis-
lexeme im Laufe der französischen Sprachgeschichte unterschiedlich hohe
Vorkommen festzustellen sind. Auch Staib betont und belegt indes, dass
das Korpus vor der Analyse qualitativ zu bearbeiten, insbesondere durch
systematische Kriterien zu reduzieren ist, da eine rein „mechanische Aus-
wertung“ (S. 442) lediglich ausdrucksseitig verfährt und zu falschen Resul-
taten führt (u. a. -issime in Eigennamen oder lat. Zitaten). Nad iane
Kre ip l s Beitrag über eine Frequenzanalyse zur Untersuchung polysemer
Strukturen von Konnektoren, die sie onomasiologisch als „Ausdrucks-
arten von Sinnrelationen“ fasst, wird explizit als „Bericht aus der Praxis
der Korpuslinguistik“ eingeführt (S. 455). Untersucht werden Konnekto-
ren in einem Korpus wirtschaftssprachlicher Fachtexte, dem ein Korpus
literatursprachlicher Texte vergleichend gegenübergestellt wird. Der Kor-
puslinguistik, so darf man zusammenfassen, wird hier dieselbe Rolle für
lexikalisch-semantische Analysen zugesprochen wie in anderen Beiträgen
auch: Sie ergänze und erweitere „den häufig allzu sehr verkürzten Aus-
schnitt aus der sprachlichen Realität“ (S. 459), bedürfe allerdings einer
zuvor erstellten genauen Beschreibung des Gesuchten, um Fehler zu ver-
meiden und eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Ein „Plä-
doyer für einen intelligenten Umgang mit Korpusmaterialien“ (S. 479) aus
der Feder Wul f Oeste r re i chers beschließt dieses vierte Kapitel und
den Sammelband und bringt dessen korpuslinguistische Grundmelodie
noch einmal zum Erklingen: Korpuslinguistik sei „ein fundamental herme-
neutisch zu verstehendes Geschäft“ und dürfe sich nicht mit der bloßen
„Multiplikation der Datenmengen“ zufrieden geben. Zu der mittlerweile
bekannten Unterscheidung von (authentischen) A-Daten, (modifizierten)
M-Daten und (introspektiven) I-Daten müsse eine Differenzierung nach
variations- und diskurslinguistischen Kriterien treten, auch in Form geziel-
ter Manipulationen. Probleme, die sich daraus für die Korpuslinguistik ins-
besondere im Rahmen der historischen Lexikologie ergeben, werden so-
dann an Beispielen aus dem amerikanischen Spanisch des 16. Jahrhunderts
diskutiert. Blickt man am Ende der Lektüre zurück auf den gesamten
Band, so ist eine Lesereise zurückgelegt, die an verschiedenen Orten und
Stationen Halt gemacht und den Reisenden auf den neuesten Stand ge-
bracht hat darüber, welche Leistungen die moderne strukturelle Semantik
zu erbringen im Stande ist und auf welche Weise sie sich neuen Heraus-
forderungen stellt. Zunächst eher zögerlich kommt dabei die Korpuslingu-
istik in den Blick, nimmt sodann zunehmend mehr Raum ein; der erste
und der letzte Beitrag des Bandes sind gleichsam komplementäre Pole auf
einer Skala des Zusammenwirkens von „Lexikalischer Semantik und Kor-
puslinguistik“. Als wohl wichtigstes Ergebnis ist festzuhalten, dass die
lexikalische Semantik, insofern sie Systembedeutungen nachspürt, ohne
- 10.1515/zrs.2009.007Downloaded from PubFactory at 09/03/2016 10:58:09AM
via free access
Elisabeth Berner 32
Korpuslinguistik im engeren Sinne auskommt; dass sie aber, sobald sie
Normbedeutungen und gar Redebedeutungen zu ermitteln sucht, Korpora
heranziehen kann, gar sollte oder müsste. Diese Korpora indes müssen
mit kritisch-philologischem Sachverstand vorstrukturiert werden, sollen
sie nicht rein quantitative Datenmengen sein und sollen sie einer semanti-
schen Analyse gute Dienste leisten können. Eine Schwierigkeit ist nach
wie vor – und auch dies macht dieser Band wieder bewusst –, dass eine
semantische Vorstrukturierung (ganz anders als etwa eine bloß ausdrucks-
seitig alphabetische) bereits den erkenntnis- und interessegeleiteten struk-
turellen Semantiker ins Spiel bringt, bevor das Korpus zusammengestellt
ist. Aber vielleicht finden lexikalische Semantik und Korpuslinguistik eben
dort zusammen, wo sie beide „fundamental hermeneutisch“ zu verstehende
Geschäfte sind.
Dana Janetta Dogaru. 2006. Rezipientenbezug und -wirksamkeit in der Syntax
der Predigten des siebenbürgisch-sächsischen Pfarrers Damasus Dürr (ca. 1535-1585)
(Documenta Linguistica Studienreihe 7). Hildesheim, Zürich, New York:
Georg Olms Verlag. xvi, 434 S.
Elisabeth Berner Universität Potsdam
Institut für Germanistik
PF 601553
D-14415 Potsdam
Mit dem insgesamt 1.108 Seiten umfassenden Manuskript der Predigten
des siebenbürgisch-sächsischen Pfarrers Damasus Dürr liegt der Arbeit
ein Text zugrunde, der zu den eher seltenen Überlieferungen der gebilde-
ten Siebenbürger Sachsen gehört und auch vom Umfang her ein Glücks-
fall für die Erforschung der Entwicklung des Schriftdeutschen jener Zeit
im Allgemeinen sowie der syntaktisch-strukturellen Ausdrucksweise im
Besonderen ist. Da Predigten aufgrund ihrer Textsortenzugehörigkeit für
den mündlichen Vortrag konzipiert sind, bietet sich die Möglichkeit, in
der Ausformung der einzelnen Satzbauelemente zugleich „deutlich er-
kennbare Kennzeichen der Hörerzugewandtheit“ (S. 1) zu ermitteln. Ob-
gleich nur in schriftlicher Form vorliegend und insofern Ausdruck des
Schriftdeutschen jener Zeit, wird in ihnen zugleich der predigende Autor
ZRS, Band 1, Heft 1 © Walter de Gruyter 2009 DOI 10.15/zrs.2009.008
- 10.1515/zrs.2009.007Downloaded from PubFactory at 09/03/2016 10:58:09AM
via free access