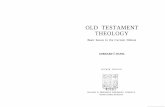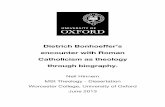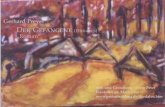Sprachplanung, Sprachlenkung und institutionalisierte Sprachpflege: Rumänisch, în Gerhard Ernst/...
Transcript of Sprachplanung, Sprachlenkung und institutionalisierte Sprachpflege: Rumänisch, în Gerhard Ernst/...
RomanischeSprachgeschichteHistoire linguistique de la RomaniaEin internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen Manuel internaţional d’histoire linguistique de la Romania
Herausgegeben von / Edite par Gerhard Emst • Martin-Dietrich GleBgen Christian Schmitt • Wolfgang Schweickard
2. Teilband / Tome 2
Sonderdruck / Tirage ă part
Walter de Gruyter • Berlin • New York
XI. Sprachnormierung und Sprachverwendungskritik Creation de normes linguistiques et critique de l’utilisation des langues
125. Sprachplanung, Sprachlenkung und institutionalisierte Sprachpflege: RumânischAmenagement linguistique, interventions sur la langue et defense institutionnalisee de la langue: roumain
1. Anfânge schriftlicher Uberlieferung. Auf der Suche nach einer Identitât. Einige Reformversuche
2. Herausbildung einer lateinisch-romanischen und pro-westlichen Identitât. Die Şcoala Ardeleană
3. Militante Romantik. Die Reformtâtigkeit Rădulescus
4. Institutioneller Rahmen: die Academia Română. Latinisierender Purismus vs. ‘vdlkisch-nationale Stromung’. Die Kritik Maiorescus
5. GroB-Rumănien und die neuen Prioritâten der Sprachpolitik
6. Die Zeit des Kommunismus. Sprachprobleme zwischen proletarischem Internationalismus und national-kommunistischer Ideologie
7. Die post-kommunistische Periode: Schwăchung institutioneller Autoritât in Fragen der Sprachpflege und -normierung
8. Literatur
1. A nfânge schriftlicherU berlieferung. A uf der Suche nach einer Iden titâ t. Einige Reformversuche
Die allmahliche Durchsetzung der rumăni- schen Sprache im offentlichen Leben, in der Literatur und schlieBlich im kirchlichen Be- reich wird von rumănischen Historikern und Philologen als Emanzipation aus der Domi- nanz der slavo-byzantinischen Kultur ange- sehen. Die ăltesten rumănischen Texte schrift- sprachlichen Charakters, Handschriften aus dem 16. Jh. (Codicele Voroneţean, Psaltirea Scheiană), sind Ubersetzungen grundlegen- der christlicher Texte. Die Iniţiative hierzu
wurde deshalb bald dem propagandistischen Wirken der Hussitenbewegung (Nicolae Ior- ga, Sextil Puşcariu), des lutheranischen oder des calvinistischen Protestantismus (Ovidiu Densusianu, Ion Bălan, Alexandru Rosetti, Nicolae Drăganu sowie in jungerer Zeit Şer- ban Papacostea) zugeschrieben, bald einer im Kreis rumănischer Monche des Klosters Peri (Maramureş) im Rahmen der Bestre- bungen nach Emanzipation von der Autoritâ t des ukrainischen Bischofs von Muncaci (Petre P. Panaitescu, Gheorghe Ivănescu) entstandenen Iniţiative. Die durch die Be- muhungen ungarischer calvinistischer Herr- scher entstandenen calvinistischen Gemein- schaften in den Gegenden um Hunedoara, Haţeg und im Banat haben fur etwa ein Jahrhundert eine Literatur bescheidenen Umfangs in rumănischer Sprache hervorge- bracht. Einige dieser Texte wurden mit latei- nischem Alphabet und in ungarisch geprăg- ter Orthographie geschrieben. Unstrittig ist auch die Tatsache, dass der Diakon Coresi von etwa 1559 bis 1581 in Braşov und ande- ren Stâdten Siebenburgens sowohl Biicher lutherischer oder calvinistischer Prâgung als auch rein orthodoxe Texte gedruckt hat. Nachdem zunâchst das Argument der leich- teren Verstehbarkeit durch die Ubersetzung in die Muttersprache nur in siebenburgi- schen Drucken erschien, die von Protes- tanten in Auftrag gegeben und finanziert wurden, wurde dieses Argument spâter von hohen Gelehrten und Wurdentrâgern der orthodoxen Kirche wie den Metropoliten der Moldau, Varlaam und Dosoftei, uber- nommen, die auf dogmatischem Gebiet den lutherischen und calvinistischen Protestan-
tismus bekămpften und sich dennoch die Ubersetzung und den Druck der kirchlichen Texte zur Aufgabe machten. Die Einfuhrung des Rumănischen in der orthodoxen Kirche, ein Vorgang, der etwa um 1715 abgeschlos- sen war, eine Folge v. a. der reichen Uberset- zer- und Druckertâtigkeit des Metropoliten Antim Ivireanul, zeigt Zuge einer echten Re- form und hat weit reichende Folgen fur die Entwicklung der Kultursprache.
Vereinzelt und unsystematisch finden sich in den Texten explizite Hinweise auf sprach- pflegerische Bemuhungen um die geschriebe- ne Sprache, so etwa bei Coresi, der im Epilog zum slavo-rumănischen Psalter (.Psaltirea slavo-română) von 1577 sich an die Gramma- tiker, die Schreibkundigen, wendet, denen dieser Text als Studien- und Ubungsmaterial dienen konne. Der ălteste rumânische Text mit Ansătzen zu einer bewussten Sprach- pflege ist die Bucoavna (‘ABC-FibeP) von Bălgrad / Alba Iulia (1699). Die wichtigsten unter diesen ABC-Fibeln (bucoavne, bucva- re) sind in der Folgezeit diejenigen von Cluj (1744), Iaşi (1755), Wien (1771, 1777) und Blaj (1777). Dimitrie Eustatievici Braşoveanul, Autor der ersten vollstăndigen rumănischen Grammatik (Braşov, 1757), weist dem systematischen Studium der Grammatik aufklărerische Funktionen zu: «scoatere a norodului românesc din ceaţa întunericului întru lumina adevărului» (ib., 3r).
Die rumânische Schriftsprache der âlte- ren Zeit war nicht einheitlich, sondern kann- te mehrere literarische Skriptae (dialecte literare) (Ivănescu 1949; 1972b) bzw. ‘regionale schriftsprachliche Varietâten’ (Gheţie 1975), regionale Normen ohne restriktiv-verbindli- chen Charakter und ohne Kodifizierung durch eine anerkannte Institution oder aka- demische Instanz. Diese lokalen Schreibtra- ditionen entsprachen im Wesentlichen den dialektalen Normen der Gegenden, in wel- chen die Texte entstanden waren, und damit den wichtigsten Mundarten des Dakorumă- nischen (nach Ivănescu sind das diejenigen von Crişana-Maramureş, des Banat, Munte- niens, der Moldau sowie - weniger ausge- prăgt - Siebenburgens; nach Gheţie handelt es sich um Muntenien und Sud-Siebenbur- gen, um die nordliche Moldau und das Banat mit dem Gebiet von Hunedoara und N ord-Siebenbiirgen).
Hinsichtlich der ‘dialektalen Basis’ der rumănischen Schriftsprache ist Gheorghe Ivănescu (1949; 1956) der Meinung, die in der Maramureş entstandenen Ubersetzun-
1430
gen religioser Texte hătten die Mundart des Adels aus der Maramureş durchgesetzt, eine Mundart nordlichen Typs, die v.a. durch lautliche Phănomene wie das Fehlen einer Palatalisierung von Labialen und Labioden- talen ( b ,p , f v) charakterisiert war. Mitglie- der der Bukarester sprachwissenschaftlichen Schule (Coteanu 1961; Rosetti / Cazacu / Onu 1971) behaupten dagegen, die Mundart Munteniens habe bereits seit dem 16. Jh., d.h. seit den ersten von Coresi gedruckten Texten, die Basis der Schriftsprache gebil- det. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass weder die Drucke Coresis noch die Bukarester Bibel (Biblia de la Bucureşti, 1688) die vereinheitlichende Rolle gespielt haben, die ihnen zugeschrieben wurde (Gheţie 1972; 1974). Die regionalen Schrifttraditionen haben sich jedenfalls noch zwei Jahrhunderte erhalten, so dass «erst im 18. Jh. in Sieben- biirgen und in der Moldau eine teilweise lautliche Muntenisierung der Schriftsprache erfolgt» (Ivănescu 1972a). Die Vereinheitli- chung der ălteren rumănischen Schriftsprache vollzog sich im Rahmen der kirchlichen Kultur, die fur die Mehrheit der Rumănen in der Moldau, in der Walachei und in Sie- benburgen einheitlich war. Zeitpunkt dieser Vereinheitlichung war die zweite Hălfte des 18. Jh., als die alte muntenische schriftsprachliche Norm allmăhlich auch in Dru- cken aus der Moldau und aus Siebenburgen verwendet wurde und sich so im Bereich ge- druckter Texte als einzige Schriftsprache durchsetzte (Gheţie 1975, 428).
Fur die entgegengesetzte Tendenz, auf all- zu stark regional geprâgte Besonderheiten zu Gunsten des Prinzips allgemeiner Ver- stăndlichkeit gedruckter Texte fur alle Rumănen zu verzichten, sind die Erklărungen beispielhaft, die Simion Ştefan, Metropolit Siebenburgens, in der «predoslovia cătră cetitori» (“Vorwort an den Leser”) des Noul Testament de la Bălgrad (1648) gegeben hat. Er konstatiert dort dialektale Unterschiede zwischen den Rumănen verschiedener Gegenden und stellt die Notwendigkeit fest, eine allen Rumănen gemeinsame und zu- găngliche Sprache zu schaffen. Im selben Vorwort findet sich die ălteste rumânische Formulierung des neologischen Prinzips, d.h. im vorliegenden Fall, der Ubernahme lexikalischer Einheiten aus dem Griechi- schen zur Bezeichnung exotischer Realităten und Objekte, nach dem Vorbild lateinischer und kirchenslavischer Ubersetzungen. Sehr klar und deutlich wird durchgehend die Vor-
XI. Sprachnormierung und Sprachverwendungskritik
stellung formuliert, dass die Rumânen der verschiedenen Gegenden ein und dieselbe Sprache sprechen. Dazu kommt das Be- wusstsein, dass die ‘NutznieBer’ der Uber- setzungen und Drucke die Rumânen von iiberall sind, denen bis dahin Texte in ihrer Sprache fehlten. Diese ‘patriotische’ Recht- fertigung des kulturellen Schreibaktes in der Volkssprache geht meistens mit einer utilitaristischen Rechtfertigung einher: Man verweist auf den Verfall der Bildung in kir- chenslavischer Sprache und auf die man- gelnde Kenntnis der klassischen Sprachen, Umstănde, welche die Ausweitung geschrie- bener Kultur in der Volkssprache (pe înţeles) erforderlich machten. Der allmăhliche Verfall des Kirchenslavischen als Sprache der Gebildeten und als Sakralsprache sowie seine Vernachlăssigung durch die Rumânen werden u. a. von Udrişte Năsturel und An- tim Ivireanul beklagt. Parallel hierzu ist oft die Rede von «strimtarea limbii româneşti» (“die Enge der rumânischen Sprache”, Biblia de la Bucureşti, 1688) und «brudia noastră limbă» (“unsere schwache Sprache”, Cantemir, Istoria ieroglifică, 1704, IV).
Gelehrte wie Dosoftei, Antim Ivireanul oder im 18. Jh. Chesarie de Rîmnic haben sich als wahrhafte Reformer der Schriftspra- che erwiesen. In seinen elf zwischen 1673 und 1683 gedruckten Bănden sowie in wei- teren Werken, die zu seinen Lebzeiten Manuskript geblieben sind, versuchte der Metropolit Dosoftei, eine auf allen Ebenen erneuerte Variante des moldauischen schrift- sprachlichen Dialekts durchzusetzen; Or- thographie und Aussprache, Morphologie, Syntax und Lexikon. Aus der Werkstatt ei- nes bei Zeitgenossen angesehenen polyglot- ten Gelehrten hervorgegangen, sind Dosof- teis Texte von lexikalischen Neologismen verschiedenen Ursprungs (Griechisch, Kir- chenslavisch, Latein) durchsetzt.
Eine entscheidende Wende in der Ge- schichte der Reflexion auf eine rumânische Schriftsprache bedeutete die Entdeckung und die von patriotischem Stolz begleitete Bestâ- tigung des romischen Ursprungs des rumă- nischen Volkes und der engen Verwandt- schaft seiner Sprache mit der lateinischen. Nach einigen Vorlâufern wie den grofien Chronik-Autoren von Adel, Gregore Ureche und Miron Costin, die in Polen eine jesuitische Bildung genossen hatten (—> Art. 18), verfîcht Fiirst Dimitrie Cantemir (bes. in Hronicul vechimii a romano-moldo- vlahilor) die Idee einer reinen Latinităt des
125. Sprachplanung und -pflege: Rumănisch
Rumânischen, verbunden mit der Vorstel- lung von der Kontinuitât der Rumânen als alleinige direkte Nachfolger der Romanitât in Dakien seit der Zeit Trajans, eine Idee, welche in der Folgezeit die zentrale Stiitze des modernen rumânischen Identitâtsbe- wusstseins werden solite, mit umfassenden und entscheidenden Folgen fur die Gestal- tung des Profils der modernen rumânischen Schriftsprache. In der Uberzeugung vom Adel’ der ethnischen Urspriinge seines Volkes und von des sen nationaler Einheit uber die existierenden politischen Grenzen hi- naus, macht sich der gelehrte Herrscher selbst an eine Reform des Schreibens in der Nationalsprache, eine Reform, welche die Schriftsprache aus den Kanons kirchlicher Texte herausfuhren und ihr Ausdrucksmog- lichkeiten verleihen solite, die denjenigen der klassischen Kultursprachen (Latein und Griechisch) vergleichbar waren. Cantemir hatte als einziger ein detailliertes Konzept in sprachlichen Fragen, das er in den letzten beiden Kapiteln der Descriptio Moldaviae darlegte, wo sich ausfuhrliche Verweise auf den lateinischen Ursprung des Rumânischen und auf die Kontinuitât der Rumânen seit dem Dakien Trajans sowie auf die lexikalischen Entlehnungen aus den Kontaktspra- chen (Griechisch, Tiirkisch, Ungarisch, Ta- tarisch, Polnisch) flnden. Er konstatiert die Existenz diastratischer Differenzierun- gen im Sprachgebrauch und dementspre- chend einer hdfischen Sprache, der gepfleg- testen Varietât in der Sprache der Moldauer, die in der Gegend von Iaşi entstanden sei, da die Bewohner aus der Umgebung der Hauptstadt in stândiger unmittelbarer Năhe zum H of des Herrschers sich selbst und ihre Sprache weitergebildet hătten. Cantemir be- merkt femer einen diastratischen Unter- schied zwischen Frauensprache und Mân- nersprache auf der Basis einer Opposition zwischen ‘korrekt’ (und ‘erwiinscht’) vs. ‘un- korrekt’ (und ‘unerwiinscht’), die dazu fiihr- te, dass mânnliche Sprecher, welche die Aussprache ke, k i statt pe, pi nicht ablegen konnten, als ‘ficior de babă’ (“Muttersdhn- chen”) verspottet wurden.
Cantemir diskutiert ferner die offensicht- liche Ubereinstimmung zwischen der Sprache der Moldauer und derjenigen der Bewohner Siebenbiirgens und Munteniens. Er ist der Meinung, die Aussprache jur und Dumnezeu statt moldauisch giur und Dum- nedzeu zeige, dass die Muntenier im Ver- gleich mit den anderen, eine ‘pronunciatio
1431
rudior’ hâtten. Mit moldauischem Lokal- patriotismus meint Cantemir anschlieBend, die Sprache der Moldauer sei reiner und - zusammen mit der Orthographie - werde sie von den Munteniem nachgeahmt, auch wenn diese das nicht eingestehen wollten. Cantemir war der erste rumănische ‘Slavo- phob’ und erwies sich damit auch in dieser Hinsicht als Vorlâufer und Inspirator der Aufklărung in Siebenbiirgen. Die Bezeich- nung der kirchenslavischen kulturellen Do- minanz in Rumânien als eine Periode der Barbarei findet sich gegen Ende desselben Kapitels, im Abschnitt, wo Cantemir den Herrscher Vasile Lupu dafiir lobt, dass er die Moldau schrittweise der Finstemis ent- riss, in die sie die Barbarei der Dominanz des Kirchenslavischen gesturzt hatte.
2. Herausbildung einerlateinisch-romanischen und pro-westlichen Identitât. Die Şcoala Ardeleană
Die Gruppe gelehrter Intellektueller (groB- tenteils Mitglieder der Unierten Kirche), wel- che die Şcoala Ardeleană bildeten (insbes. Samuil Micu-Klein, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu), vertrat aufklâ- rerisch-reformerische Uberzeugungen, die sich in einem grenzenlosen Vertrauen in die Fâhigkeiten von Kultur und Bildung als Faktoren des Fortschritts âuBerten, in einem militanten Nationalismus, Anti-Balka- nismus sowie in der Gegnerschaft zu einer auf dem Kirchenslavischen begrundeten Kultur. Die siebenburgischen Gelehrten, die im Westen (Rom, Wien, Budapest) studiert hatten und uber perfekte Kenntnisse des La- teinischen und moderner Sprachen verfug- ten, die ihre Schriften auf Lateinisch ebenso wie auf Rumânisch (seltener auf Deutsch oder Ungarisch) verfassten, machten - in der Nachfolge der Chronisten des 16. Jh. und v. a. Cantemirs - die Idee des ‘edlen’ Ur- sprungs ihres Volkes zum Grundpfeiler ihrer kâmpferischen Aktivitât, die ihren Nieder- schlag fand in der Abfassung und Veroffent- lichung von historischen Abhandlungen, Handbuchern jeder Art, Grammatiken, Wor- terbuchern, Ubersetzungen von Werken aus Philosophie, Logik, Theologie (-» Art. 118), populărwissenschaftlichen Werken etc. Die Gebildeten dieser Generation waren sich der Dringlichkeit einer Modernisierung der Schriftsprache bewusst, welche eine Voraus-
1432
setzung fur die kulturelle Emanzipierung des rumănischen Volkes bildete. Auf ihren Schultern ruhte die enthusiastisch ubemom- mene Aufgabe, mit legalen Mitteln im Be- reich von Kultur und Schulwesen auf die Be- freiung der Rumănen aus dem Zustand politischer und sozialer Unterlegenheit hin- zuwirken, in dem sie sich als ‘tolerierte Nation’ seit Jahrhunderten in Siebenburgen • befanden. Erklartes Ziel der militanten Gelehrten der Şcoala Ardeleană war es, fur ihr Volk in Siebenburgen den gesetzlichen Sta- tus einer ‘konstitutiven Nation’ neben den anderen drei ‘Nationen’ (Ungarn, Sieben- biirger Sachsen, Szekler) zu erreichen. Mit der Durchsetzung der latinistischen Idee und des Prinzips der Okzidentalisierung als Basis einer Modernisierung der Kulturspra- che, ein Prinzip, das fast einmutig von den nachfolgenden Generationen ubernommen wurde, spielten die Vertreter der Şcoala Ardeleană nicht nur auf kulturellem Gebiet, sondern auch in der Politik eine âuBerst be- deutsame historische Rolle.
Hartnâckig proklamiert, hâufig mit Nu- ancen und Interpretationen, die fur die modeme Geschichts- und Sprachwissenschaft inakzeptabel sind, wird die These des latei- nischen Charakters der rumănischen Sprache, die von den «posteri Romanorum» im Dakien Traians gesprochen wurde, als selbstverstândlich angesehen (Micu / Şincai 1780, 3). Die Idee des autochthonen Charakters der Rumănen in Dakien und ihrer ununterbrochenen Kontinuităt in den heute von ihnen bewohnten Gebieten wird als Axiom dargestellt, zumal gerade in dieser Periode die Kontinuităt der Rumănen in Siebenburgen allmâhlich, v.a. aus politischen Grunden, von deutschen Autoren wie Franz J. Sulzer (f 1791), Joseph Cari Eder (1760- 1811) und Johann Christian von Engel (1770-1814) in Frage gestellt wurde. Aus diesem Grund wird der polemische Tonfall zu einer Konstante des historischen Diskur- ses der siebenburgischen Gelehrten; er fuhrt des Ofteren zu ubertriebenen theoretischen Positionen (Purismus, exzessiver Etymolo- gismus) bei Problemen der Schriftsprache.
Die siebenburgischen Gelehrten verzich- teten auf das Ethnonym valah (—> Art. 13), das von den Gebildeten im Ausland mit Be- zug auf die Rumănen verwendet wurde, und gebrauchten ausschlieBlich den Terminus român, mit dem sie hâufig in einer Art halb beabsichtigter Zweideutigkeit nicht nur die Rumănen, sondem auch die Romer bezeich-
XI. Sprachn ormierung und Sprachverwendungskritik
125. Sprachplanung und -pflege: Rumănisch 1433
neten. Die Idee des romischen Ursprungs wurde einstimmig von den folgenden Gene- rationen ubernommen, nicht nur in Sieben- burgen, sondern auch in der Moldau und in Muntenien; sie wurde so zu einer zentralen Komponente im politischen Diskurs der 48er-Bewegung und der Einigungstenden- zen, mit weit reichender Ausstrahlung in den offentlichen Diskurs der Epoche rascher Modernisierung Rumăniens in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh. Einige Jahrzehnte spâter nahm diese Idee hăufig, v.a. in der Moldau und in Muntenien, geradezu grotes- ke Formen an, so dass kritische Reaktionen nicht lange auf sich warten lieBen. Der mol- dauische Historiker und Politiker Mihail Kogălniceanu, der prinzipiell die Idee der Romanitât teilt, ist sich zwar der Gefahren latinisierender Ubertreibung bewusst und gebraucht den Terminus romanomanie zur Bezeichnung der pathologischen (und letzt- lich schâdlichen) Formen des von seinen Landsleuten gezeigten ‘patriotischen Stol- zes’. Das hindert ihn nicht, in seinen franzo- sischen und deutschen Schriften (Histoire de la Valachie, Berlin, 1827; Moldau und Walla- chei. Romănische oder wallachische Sprache, Berlin, 1837) die etymologisierende Schrei- bung mit o fur das Ethnonym rumănisch zu verwenden: la langue romaine, Ies mots ro- mains; romănische Sprache (statt frz. rou- main, dt. rumănisch). Micu / Şincai (1780, 117) erklăren, eines der ausdrucklichen Zie- le ihrer Forschungen sei es, stândig deutlich zu machen, dass die rumănische Sprache durch Sprachverfall aus der lateinischen entstanden ist: «conati sumus corruptionem linguae Daco-Romanae ex Latina quoquo modo comprobare». Die elaborierteste Vor- stellung zum Ubergang des Lateinischen in die romanischen Sprachen (und damit in das Rumănische) findet sich bei Petru Maior. In der Istoria pentru începutul românilor în Da- chia (Buda, 1812) entwickelt er eine Theorie der Ursprunge des Rumănischen; deren zen- trale Ideen sind: die Kontinuităt der Rumâ- nen im traianischen Dakien, der ausschliefi- lich lateinische Charakter des Rumănischen, die Herkunft des Rumănischen aus dem klassischen Latein, wie es von den romi- schen Kolonisten nach Dakien mitgebracht wurde, die sich hier nach den dakischen Kriegen Traians in groBer Zahl niederlie- Ben. Die erste der zwei im Anhang zur Istorie veroffentlichten Abhandlungen (Pentru începutul limbei româneşti) beginnt so mit der folgenden programmatischen Aussage
zum Lateinischen als Basis der rumănischen Sprache: «Fiindcă limba cea românească e latinească, celui ce va să cerce începutul limbei româneşti îi iaste de lipsă mai nainte să aibă cunoscute întîmplările limbei lătineşti» (Maior 1976, voi. 1, 302). Die pro-westliche Ausrichtung und der Latinitâtswahn (und dazu die pro-katholische Tendenz einer Mehrheit der siebenbiirgischen Gelehrten) fuhrten zu einer allgemeinen Verachtung der kirchenslavischen kulturellen Tradition bei den Rumânen. So berufen sich etwa Micu und Şincai auf Cantemir, von dem sie den Terminus barbarie ubernehmen, um damit den Zustand zu bezeichnen, in den die Ru- mănen nach der Einfuhrung der «literal[is] slavinorum lingua», in der Zeit des Konzils von Florenz geraten waren, die zum Ziel ge- habt habe, «hoc modo praecludere nostris omnem aditum ad s. unionem cum Eccl. Romana» (Micu / Şincai 1780,4).
Das Verfassen und die Publikation von Grammatiken wurde von der Generation der Aufklârung als patriotische Pflicht so- wie als zentraler Bestandteil der gesell- schaftlichen und nationalen Volkserziehung angesehen, der sie sich verschrieben hatten. Diese Idee, die von Micu / Şincai (1780, 8) nur gestreift wird («maternam linguam per- ficiamus»), wird von Ienăchiţă Văcărescu ausdriicklich formuliert. Fur ihn sind «die Liebe zum Vaterland, zu den Nachbarn und zu den Rumănen, welche diese Sprache spre- chen» gewichtige Griinde, um an einer Grammatik zu arbeiten, die «dem Wohl, der Ehre und dem Nutzen der Landsleute und des Vaterlandes» (1787,12) dienen solie. Bu- dai-Deleanu weist seine Leser darauf hin, es sei nicht seine Absicht, durch die in seinem Worterbuch enthaltenen Optionen und im- plizit normativen Empfehlungen die Spre- cher zu einer Ânderung ihrer naturlichen, fur sich legitimen Sprechweise zu veranlas- sen, sondern Auswahlkriterien fur die «limba de obşte la învăţături» (“allgemeine Schriftsprache”, 1970, 132) anzubieten, die gereinigt, in Regeln gefasst und modemi- siert werden musse.
In den Fragen der nationalen Sprachpolitik bestanden unter den Gebildeten Rumăniens kaum Unterschiede auf konfessioneller Basis. Jenseits der beinahe stăndig andauern- den Reibungen und Animosităten zwischen der griechisch-katholischen Kirche Sieben- burgens und der orthodoxen Kirche der Moldau und Munteniens gab es in den gro- Ben Fragen der einheitlichen und alleinigen
1434 XI. Sprachnormierung und Sprachverwendungskritik
rumănischen Kultursprache immer einen stillschweigenden Konsens. So lăsst sich etwa feststellen. dass einerseits die Gelehr- ten und Kleriker der Unierten Kirche nie den Wunsch hatten, einen eigenen kirch- lichen Sprachstil zu entwickeln, sondern denjenigen ubemahmen, der sich um die Mitte des 18. Jh. in den religidsen Drucken Munteniens herausgebildet und stabilisiert hatte. Aufgrund vemunftiger Entscheidun- gen einiger hoher kirchlicher Wurdentrâger wie Chesarie de Rîmnic und Veniamin Cos- tachi, folgte andererseits die kirchliche Hie- rarchie Munteniens und der Moldau der allgemeinen Tendenz der pro-westlichen und latinisierenden Reform, wie sie von den Siebenbiirgern vorangetrieben wurde, und ubernahm schlieBlich sogar in kirchlichen Texten die lateinische Graphie. Auch einige unter den Autoren der ersten rumănischen Grammatiken, die in ihrer Tendenz und im Inhalt deutlich vom Latinismus der Sieben- burger Aufklârer geprăgt waren (Ienăchiţă Văcărescu aus Muntenien, Radu Tempea aus Siebenbiirgen sowie Paul Iorgovici und Constantin Diaconovici-Loga), gehorten der orthodoxen Kirche an und hatte wichtige of- fentliche Funktionen inne. Die streitbare Aktivitât der Siebenburger Latinisten auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft und der Philologie hat das Verdienst, das rumă- nische Kollektivbewusstsein geweckt und den Prozess der «bruscă orientare spre Apus» ausgeldst zu haben, der schlieBlich zur Rero- manisierung des Rumănischen (Puşcariu 21976, 374 s.) fuhren solite.
3. M ilitante Romantik.Die Reformtătigkeit Rădulescus
Ion Heliade Rădulescu (1802-72), einer der ersten Journalisten Rumăniens, Professor am Gymnasium Sfintul Sava, origineller Dichter und Prosaschriftsteller, Ubersetzer und poli- tischer Denker, mit Recht von Hasdeu und Eminescu als «Vater der rumănischen Litera- tur» bzw. als «erster moderner Schriftsteller der Rumănen und Vater jener Schriftsprache, die wir heute gebrauchen», bezeichnet, war sich als Erster in Rumănien bewusst, dass eine modeme Kultur nur von der Regulie- rung der Sprache ihren Ausgang nehmen kann, d.h. von der Konstruktion einer ein- zigen und einheitlichen Schriftsprache, die liber ein Maximum an stilistischer Differen- zierung ebenso verfugt wie uber hochentwi- ckelte und nuancierte Fachterminologien.
Im Bereich der Orthographie geht Heliade von der zu seiner Zeit gângigen kyrilli- schen Graphie aus und beabsichtigt eine Vereinfachung unter Betonung des phoneti- schen Prinzips (1 Lăut = 1 Buchstabe). Er schlâgt deshalb den Verzicht auf die graphi- sche Verdoppelung von i, o, u vor, die Besei- tigung von Graphemen, die traditionell eine Verbindung von zwei Lauten bezeichnen, den Verzicht auf Grapheme, die in der kyril- lischen Schreibung des Rumănischen nur aus Grunden der Uberlieferung beibehalten wurden, aber durch keine phonetisch dis- tinktive Notwendigkeit gerechtfertigt waren, sowie die gănzliche Aufgabe aller Akzente und Spiritus, die iiber die kirchenslavisch- kyrillische Graphie aus der griechischen Orthographie ererbt waren, wo sie einen phonetisch distinktiven Wert besaBen. Von den 33 Graphemen der traditionellen Graphie blieben so schlieBlich nur 29.
Im Bewusstsein von der Bedeutung seiner Grammatik (Sibiu, 1828) in Kultur und Er- ziehungswesen verfolgt Heliade in seinen Empfehlungen zur Orthographie und zur Bereicherung des Lexikons konsequent ein Prinzip der Einfachheit und Funktionalităt; die weitere Entwicklung der Schriftsprache hat seine Losungen in den meisten Făllen bestătigt. Das implizit phonetische Prinzip bei Heliades Vorschlăgen zur Orthographie wurde bereits durch den phonetischen Cha- rakter der traditionellen rumănischen Orthographie im kyrillischen Alphabet nahe gelegt. Als Gegner der kulturellen Domi- nanz des Kirchenslavischen - in der Nach- folge der siebenbiirgischen Aufklârer - teilt Heliade allerdings die Uberzeugung (gera- dezu ein ideologischer Topos!), die Epoche der kirchenslavischen kulturellen Dominanz sei fur die Rumănen eine historische Katas- trophe gewesen und die kulturelle Wiederge- burt des rumănischen Volkes erfordere die Tilgung aller Spuren des kirchenslavischen Einflusses.
Bei seinen Reformen bezieht sich Heliade bestăndig auf das Beispiel kulturell und in- tellektuell entwickelter Nationen («naţiilor celor înţelepte şi gînditoare», 1828, IX): Griechen und Romer in der Antike, Fran- zosen, Deutsche und v.a. Italiener in der Moderne. Als passendstes Vorbild fur die Regelung der modernen rumănischen Orthographie erschien ihm damals, 1828, das Italienische. Im Gedanken an die spâtere Einfuhrung des lateinischen Alphabets fur die Schreibung des Rumănischen hălt er es
fur wiinschenswert, so zu schreiben wie man spricht - entsprechend dem italienischen Vorbild - und das franzosische und engli- sche Modell einer etymologischen Graphie zu meiden (ib., XVI). Als guter Kenner der literarischen Produktion seiner Zeit be- merkt Heliade in der Praxis der gângigen ky- rillischen Schreibung grofie Unordnung und mangelnde Konsequenz, sowohl in hand- schriftlichen Texten wie auch in gedruckten Buchern. In der Uberzeugung, dass die Pfle- ge der gemeinsamen Nationalsprache nur in der Schule effektiv umgesetzt werden kann, ruhmt Heliade die Bemuhungen patrioti- scher Adeliger, die rumânischsprachige Schu- len gegrundet haben, an denen auch die hoheren wissenschaftlichen Fâcher (Recht, Mathematik, Geographie, Geschichte) in der Nationalsprache gelehrt werden. Er wieder- holt dabei mehrmals die aus der Aufklârung herruhrende Vorstellung, der Fortschritt einer Nation sei aufîerhalb eines offentlichen Erziehungswesens nicht vorstellbar; dieses setze aber notwendigerweise die bestăndi- ge Pflege der Nationalsprache voraus. Die Sprachpflege erfordere aber die Schaffung einer Fachterminologie fur jede Wis- senschaft, einschlieBlich der Grammatik, Rădulescus patriotischer Elan kommt auch darin zum Ausdruck, dass er, in der Er- kenntnis von der Notwendigkeit gelehrter Entlehnungen aus den Kultursprachen, der Meinung ist, die rumânische Nation besitze eine besondere historische Berechtigung, sich das, was ihr fehle, aus dem Lateinischen und aus den romanischen Sprachen zu holen. Dabei ist der legitime Wunsch zu erkennen, unter den terminologischen Neologismen vorzugsweise solche lateinisch-romanischen Ursprungs zu ubernehmen, die leichter an das rumânische phonetische und morpholo- gische System zu adaptieren sind. Indem er so die Entlehnungen akzeptiert, macht Heliade darauf aufmerksam, dass «trebuie să luăm numai acelea ce ne trebuie şi de acolo de unde trebuie» (ib., XXVII). Mit ande- ren Worten, es gibt Termini, deren Import durch die Notwendigkeit der Bezeichnung neuer Konzepte gerechtfertigt ist, aber auch solche, die ohne zureichende Begriindung entlehnt wurden. Heliade spricht sich ge- gen diejenigen aus, die fremde Termini in der Form der Ursprungssprache einfuhrten (patriotismos, enthusiasmos aus dem Grie- chischen; nation, ocazion aus dem Franzo- sischen; privilegium, centrum, punctum aus dem Lateinischen; soţieta, cvalita aus dem
125. Sprachplanung und -pflege: Rumânisch
Italienischen). Er kritisiert aber auch die Position derjenigen, die Entlehnungen kate- gorisch ablehnen und die Prâgung von Fach- termini mittels Lehniibersetzung bevorzu- gen, was zu lexikalischen Kuriositâten fiihrt wie cuvintelnic “Worterbuch”, ascuţitapăsat “oxyton”, neîmpărţit “Atom; Individuum”, amiazăziesc “Meridian”, etc.
Gegen Ende seines Vorwurfs formuliert Heliade den Wunsch nach einer Akademie, einer Institution, in welcher die qualifîzier- testen Fachleute ihre Bemuhungen um die Pflege des Rumănischen koordinieren soll- ten, insbes. durch die Erarbeitung von Pu- blikationen mit normativem Charakter, in erster Linie eines vollstândigen Worter- buchs. Dieser Wunsch solite erst nach mehr als 40 Jahren in Erfiillung gehen. Nach 1848 tendierte Heliade in seinem linguistischen Denken zu etymologisierenden und italiani- sierenden Formen. Unter der Bezeichnung heliadism entwickelte sich ein fur sich ge- nommen interessantes System einer Schrift- sprache, die in Orthographie, Lexikon und sogar Grammatik stark von massiven Entlehnungen aus dem Italienischen geprăgt war. Sie fand in der rumănischen Presse je- ner Zeit einige Anhănger und hinterliefi Spuren im zeitgenossischen Normenreper- toire des Rumănischen.
4. Institu tioneller Rahm en: dieA cadem ia R om ână. Latinisierender Purism us vs. ‘volkisch-nationale S trom ung’. D ie K ritik M aiorescus
Die offentliche Diskussion liber die kiinftige Gestalt der nationalen Kultursprache fuhrte in der zweiten Hălfte des 19. Jh. zur Schaffung eines geeigneten institutionellen Rah- mens, der Societatea Academică Română (1866), die 1879 zur Academia Română um- gewandelt wurde. Unter der Dominanz von Philologen und Schriftstellern stellte sich diese akademische Institution schon bei ih- rer Griindung vorrangig drei Aufgaben mit normativem Charakter: die Festlegung einer einheitlichen rumănischen Orthographie auf der Basis der lateinischen Graphie, die Erarbeitung einer rumănischen Grammatik und die Erstellung eines groBen Worterbuchs der rumănischen Sprache. Die Arbeit an der Verwirklichung dieser Ziele wurde im ersten Jahrzehnt von der latinisierend-etymolo- gisierenden Konzeption bestimmt, da die Siebenburger Latinisten und ihre Anhănger
1435
in der Akademie die Mehrheit hatten. Auf- grund einer Art Synthese der zahlreichen Vorschlâge zur Orthographie gelang es der Akademie, in der Schule, an den beiden kurz zuvor gegriindeten Universităten in Iaşi und Bukarest, in der offentlichen Verwaltung sowie in einem Teii der Presse ein maximal puristisch-etymologisches Orthographiesys- tem durchzusetzen, das die fast identische Beibehaltung der lateinischen Form bei Wortern lateinischen Ursprungs vorsah, sowie daruber hinaus die Ausweitung dieses Verfahrens auf andere Worter durch Analogie. Dieses Orthographiesystem trat neben die nicht weniger als 43 Systeme, die fur das Jahrhundert zwischen 1780 und 1881 ver- zeichnet wurden (Macrea 1969, 292) und erhielt 1871 durch einen Erlass des Un- terrichtsministeriums offiziellen Charakter. Trotz der Unterstutzung durch die Politik traf diese Iniţiative auf erbitterten Wider- stand in der Mehrzahl der Stellungnahmen, in denen die Schriftsteller dem System seine Schwerfălligkeit vorwarfen, die einer mog- lichst breiten Verwendung beim Volk im Wege stehe.
Auch in der Lexikographie dominierte zu- năchst der etymologisierende Latinismus der Akademie. Zwischen 1873 und 1877 wurden die drei Bande des Dicţionar al limbii române veroffentlicht, verfasst von A. T. Laurian (1810-81) und I. C. Massim (1825- 77) unter gelegentlicher Mitwirkung anderer Philologen wie Timotei Cipariu (1805t-87) und Gheorghe Bariţiu (1821-93). Das Wor- terbuch von Massim / Laurian, das heute als Gipfel- und Schlusspunkt der latinistischen Ubertreibungen (Macrea 1969, 294) angese- hen wird, hat einen ausgeprăgt normativen Charakter bereits durch die Art seines Auf- baus, mit dem eine latinisierende Tendenz beim Gebrauch des Wortschatzes durch- gesetzt werden solite. Die ersten beiden Băn- de enthalten den rumănischen Wortschatz lateinischen Ursprungs, wobei die lexikali- schen Einheiten in einer extrem latinisieren- den Graphie prăsentiert werden. Die Auto- ren ergânzten die Liste existierender Worter durch eine Reihe eigener Wortschopfungen, die sie direkt aus dem Lateinischen ubemah- men, in der Hoffnung, sie wurden in den allgemeinen Gebrauch iibergehen und die ‘allogenen’ Worter verdrângen: amare fur a iubi, agru fur ogor, audacia fur îndrăzneală. Der dritte Bând (mit dem Titel Glossariu care coprinde vorbele din limba romana străine prin originea sau forma loru, cumu şi celle
1436
de origine induiosa) enthălt die Worter nicht- lateinischen Ursprungs (darunter auch sol- che, deren lateinischer Ursprung von den Autoren nicht erkannt worden war), mit dem ausdrucklichen Hinweis, sie beim Spre- chen zu vermeiden und allmăhlich aufzuge- ben. Weit entfernt, den erwunschten gesetz- geberisch-normativen Einfluss auszuuben, wurde das Worterbuch von Massim / Laurian von den potentiellen Benutzern nicht akzeptiert, es wurde im Gegenteil zur Ziel- scheibe der vereinten Angriffe von Schrift- stellern und Philologen. Selbst innerhalb der Akademie griff ein renommierter Schriftsteller wie Alexandru Odobescu das Worterbuch gerade in seinen normativen Intentio- nen an und lehnte das von den Lexikogra- phen durchgesetzte latinisierende Prinzip zu Gunsten des Prinzips der Bewahrung und Verallgemeinerung des gelâuflgen volkstum- lichen Wortschatzes ab.
Nachdem die Sache zur Staatsangelegen- heit geworden war, die unter dem Patronat von Kdnig Carol I. stand, wurde die Aufga- be der Erarbeitung des Akademieworter- buchs im Jahr 1884 an Bogdan Petriceicu Hasdeu iibertragen, einen vielseitig gebilde- ten Gelehrten (Linguist, Volkskundler, His- toriker etc.). Dieser initiierte ein Mammut- Projekt und veroffentlichte schlieBlich das Etymologicum Magnum Romaniae (4 voi., Bucureşti, 1887-98), ein in seiner Art ein- zigartiges monumentales Werk, das Arti- kel enzyklopadischen Inhalts zu den mit dem Buchstaben A (bis bărbat) beginnenden Wortern des Rumănischen enthielt. Zwischen 1898 und 1906 wurden die Arbeiten am Worterbuch der Akademie von Alexandru Philippide, Professor in Iaşi, geleitet. Als Sprachwissenschaftler mit einer rationa- len lexikographischen Konzeption, gelang es ihm, eine ungeheure Menge an dokumen- tarischem Material zusammenzutragen und die Artikel zu den Buchstaben A-C zu redi- gieren, bis die Akademie mit Sextil Puşcariu einen neuen Verantwortlichen ernannte, der an der Spitze einer Forschergruppe bis 1949 eine Reihe von Bânden veroffentlichte (Buchstaben A-L), die hinsichtlich Umset- zung und Vollstândigkeit von unterschiedli- cher Qualitât sind.
Bei der Erstellung einer Grammatik stieB die Durchsetzung eines allgemein akzeptier- ten theoretischen Prinzips auf betrâchtliche Schwierigkeiten, wobei in der ersten Zeit auch hier infolge Timotei Ciparius Gramatica limbii române (2 voi., Blaj, 1869/77) das
XI. Sprachnormierung und Sprachverwendungskritik
Prestige der Şcoala Ardeleană eine bedeu- tende Rolle spielte. Die Grammatik dieses Wissenschaftlers aus Blaj, gelehrt und mit zahlreichen Kommentaren und Exkursen in die allgemeine Geschichte, aber auch mit zahlreichen zutreffenden Erklărungen, konn- te keine Methode oder Richtung der Gram- matikographie durchsetzen, da die Struktur der Volkssprache, wie sie sich in der Litera- tur der 48er-Generation manifestierte, die Basis fur deskriptiv-normative Grammati- ken bildete, die von Privatleuten auBerhalb der Akademie verfasst wurden. Unter denje- nigen, die wesentlich zur Herausbildung ei- ner Grammatik der modemen rumănischen Schriftsprache beitrugen, sind die Gramatica română (2 voi., Iaşi, 1891/21895/31945) von Hariton Tiktin und die Gramatica elementară a limbii române (Iaşi, 1897) von Alexandru Philippide zu nennen. Beide Wer- ke folgen den theoretischen Prinzipien der neogrammatischen Schule (—> Art. 6), die der gesprochenen Sprache Priorităt ein- răumten. Sie sind relativ reich an Beispiel- material, das der hohen wie auch der volks- tiimlichen Literatur entnommen ist. Ihre Normvorschriften leiten sie aus den dar- gestellten Fakten aufgrund objektiver Be- obachtung sprachlicher Dynamik bei der Mehrzahl der Autoren und Sprecher ab.
In der offentlichen Diskussion gewann in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh. die Posi- tion der gesprochenen Volkssprache die Oberhand liber diejenige des latinisierenden etymologischen Prinzips. Titu Maiorescu (1840-1917), Literaturkritiker und Profes- sor der Philosophie an der Universitât Iaşi, ein Intellektueller mit westlicher Bildung, erwies sich als entschlossener und konse- quenter Vertreter einer radikalen und kon- struktiven Sozial- und Kulturkritik. Fragen der Schriftsprache hatten einen zentralen Platz in den kritischen Reflexionen des Mentors der Junimea. Auch wenn Maiorescu sich wiederholt als Anhânger einer orga- nischen Entwicklung der rumănischen Kul- tur und damit auch der Schriftsprache erklărte, einer Entwicklung, die nicht durch Eingriffe der Philologen behindert werden solite, so zeigt doch die Praxis seiner kritischen Tătigkeit die betrăchtliche Bedeutung der offentlichen Diskussion bei der Kon- sensfindung in Fragen der schriftsprachli- chen Norm. Maiorescus Positionen losten heftige Reaktionen im Lager seiner Gegner aus, sie erwiesen sich aber in historischer Perspektive als siegreich und wurden durch
125. Sprachplanung und -pflege: Rumănisch
die Richtung legitimiert, welche die rumă- nische Schriftsprache im 20. Jh. einschlug. Maiorescu lehnte einerseits die Ubertrei- bungen ab, in welche der patriotische Dis- kurs der Latinisten und der 48er-Generation abgeglitten war, und rief dazu auf, den Sinn fur die Proportionen zu wahren. Er akzep- tierte jedoch andererseits die Idee der Lati- nităt als legitime Basis einer jeden theoretischen Diskussion zur Schriftsprache, unter der Bedingung, dass sie frei von Irrtumem und sophistischen Uberlegungen sei. Aus der Leitidee des modemen rumănischen Selbst- verstăndnisses, dem Bewusstsein der Roma- nităt, ergibt sich fur Maiorescu die Legiti- mation jeglicher Initiativen zur Reform der rumănischen Gesellschaft und implizit ihrer Kultursprache.
Maiorescu war sich schon zu Beginn seiner Tătigkeit als Kritiker der Schwierigkei- ten bewusst, auf die eine kritische Nuancie- rung der zeitgenossischen Probleme und der Versuch, die herrschenden, vom militanten Latinismus der Vorgânger geprăgten Menta- lităten zu ăndem, stoBen wurden. Er postu- liert deshalb das Prinzip der Legitimităt einer in kulturellen Fragen kritischen und aktiven Minderheit. Aus derselben rationa- listisch-historischen Position heraus kriti- siert er wichtige Schriften der latinistischen Schule, wie die Istoria (Buda, 1812) von Petru Maior, das Lexiconul de la Buda (Buda, 1825) oder das gelehrte Werk Tenta- men criticum (Wien, 1840) von August Tre- boniu Laurian; er spricht schlieBlich von einer ‘Verfalschung der Geschichte’, einer ‘Verfalschung der Etymologie’ bzw. einer ‘Verfalschung der Philologie’ durch derar- tige Schriften. Ebenso erscheint die in der Akademie herrschende latinisierende Ten- denz dem jungen Kritiker als Verfalschung der Idee der Akademie selbst.
Maiorescu hielt es fur inakzeptabel, kon- troverse Positionen orthographischer bzw. sprachlicher Art in Schule und offentlicher Verwaltung auf administrativem Weg vor- zuschreiben. In seinem Aufsatz Direcţia nouă în cultura românească (1867) bemerkt er sarkastisch, dass unter den Mitgliedem des Ministerrats, der den oben genann- ten Erlass diskutiert und verabschiedet hatte, sich kein Philologe oder Sprach- wissenschaftler befunden habe. Als heraus- ragendes Mitglied der konservativen Par- tei, die 1871 an der Regierung ist, sieht sich Maiorescu Verleumdungskampagnen in den Zeitungen der liberalen Opposition
1437
1438 XI. Sprachnormierung und Sprachverwendungskritik
{Românul, Telegraful, Trompeta, Uniunea liberală etc.) ausgesetzt, in denen er des Elitis- mus, Kosmopolitismus, Verrats der natio- nalen Interessen und der Missachtung der Nation beschuldigt wird.
Der Kritiker aus Iaşi anerkennt zwar die grofien Verdienste der ‘Briider von jenseits der Karpaten’ (d.h. der Şcoala Ardeleană) am Beginn der modernen rumănischen Kul- tur (Schule, Presse, Philologie etc.), er stellt jedoch fest, nun sei die Zeit gekommen, zwi- schen Enthusiasmus und guten Absichten auf der einen und Pedanterie, fehlerhaftem, schwerfâlligem und unpassendem Stil auf der anderen Seite zu unterscheiden, wobei letztere Eigenschaften als negative Charak- teristika der Siebenbiirger etymologisti- schen Richtung zugeschrieben werden, die um jeden Preis bekămpft werden mussten. Er zielt damit direkt auf das System Cipari- us, ein moglichst etymologisches Orthogra- phiesystem, das sich auf die Uberzeugung stiitzt, die Norm der Schriftsprache konne nur auf den kunstlichen Konstruktionen von Sprachwissenschaften beruhen, den Einzigen, welche die Korrektheit der jeweili- gen Formen beurteilen kdnnten. Gerade die- ses Prinzip wird in seinem zentralen Punkt von Maiorescu angegriffen. Im Namen des gesunden Menschenverstandes und des ‘In- stinkts’, aber unter Verwendung von vagen Begriffen wie ‘Mitteilung des Denkens’, ‘eu- phonische Variation der Worter’, ‘Geist der Volkssprache’, ‘intellektuelles und ăs- thetisches Element’ etc. lehnt Maiorescu die leeren Formalismen ab, die gelehrten Schop- fungen der Philologen. AII seine Empfeh- lungen, die auf volkstumliche Formeln im ‘allgemeinen Gebrauch’ zielen, werden durch die organizistische Konzeption von Sprache legitimiert, welche dem Eingreifen durch Gelehrte oder Schriftsteller nur gerin- gen Raum lăsst. Im Namen der rational- organizistischen Prinzipien mit Bezug auf Sprache wird nicht nur der Etymologismus der Siebenbiirger abgelehnt, sondern auch Heliades Italianismus oder das auf dem Analogieprinzip beruhende System eines Aron Pumnul.
Indem er die Einfuhrung des lateinischen Alphabets statt des kyrillischen fur selbst- verstăndlich ansieht, vertritt Maiorescu in der dffentlichen Diskussion um etymologi- sche vs. phonetische Schreibung ein rationa- les Vorgehen: «O metodă, înainte de a fi fonetică sau etimologică sau fonetico-etimo- logică, trebuie să fie simplu logică» (Maio
rescu 1967, voi. 2, 12). Am Ende einer um- fassenden und minutiosen Analyse, in deren Rahmen die Lăute des Rumănischen im Ver- gleich mit denen des Lateinischen systema- tisch untersucht werden, entscheidet sich Maiorescu in der Orthographiefrage fur eine objektive Position: Er vertritt einen gemă- fiigten Phonetismus, der phonetische und morphologische Elemente enthâlt, und den er als ‘principiu intelectual’ des Schreibens bezeichnet. Die von Maiorescu dargelegten und ausfuhrlich begrundeten Vorschlăge zur Orthographie setzen sich im Lauf des 20. Jh. im Grofien und Ganzen allgemein durch. Es handelt sich um eindeutige Entsprechungen auf der Basis ‘ 1 Lăut = 1 Buchstabe’ fur die Mehrzahl der Phoneme des Rumănischen. Zur Wiedergabe der fur das Rumânische spezifischen Lăute, die im Lateinischen und in den romanischen Sprachen nicht existie- ren, t , + , (X), ui und U, in kyrillischer Schreibung, werden Buchstaben mit diakri- tischen Zeichen vorgeschlagen: ă, î bzw. â, ş und /. Trotz des heftigen Widerstands der Etymologisten fanden Maiorescus Vorschlăge weite Beachtung, der Sieg seiner Position wurde durch seine beiden in der Akademie vorgestellten Berichte von 1880 und 1904 bestătigt.
Hinsichtlich der Neologismen lehnt Maiorescu den von den Siebenbiirger Auf- klârern empfohlenen und begonnenen Aus- schluss nicht-lateinischer (slavischer, tiirki- scher, griechischer) Worter ab. Zwar waren latei nische, franzosische, italienische Worter (hăufig mit nur minimaler lautlicher und morphologischer Anpassung) in vielen Făl- len durch Bezeichnungslucken im rumănischen Intellektualwortschatz gerechtfertigt; sie waren in die Schriftsprache aber auch dann eingefugt worden, wenn im Grund- wortschatz alte, allgemein akzeptierte und bekannte Worter vorhanden waren. Die Til- gung aller Worter slavischen Ursprungs aus dem schriftsprachlichen Gebrauch ist nach Maiorescu nicht nur eine Utopie, sondern auch mit Gefahren fur die naţionale Kultur verbunden, da sie das Volk von der eben erst begonnenen literarischen Bewegung der ge- bildeten Klassen entfremde. In Ubereinstim- mung mit der weiteren Entwicklung des rumănischen Bildungswortschatzes anerkennt Maiorescu jedoch den Nutzen und die Legi- timităt der Entlehnungen im technischen und intellektuellen Bereich. Auch liber Phraseo- logismen als calques nach dem Franzosi- schen macht sich Maiorescu lustig. Ein an-
derer Bereich, in welchem sich Maiorescus kritischer Geist mit heftiger Polemik âuBer- te, ist der Stil. Der Artikel Beţia de cuvinte (1873; Untertitel Studiu de patologie literară) ist - aus der Perspektive einer klassischen und ausgewogenen stilistischen Entschei- dung - eine genaue Diagnose der sprachli- chen Unsitten der noch jungen literarischen Presse jener Zeit; der Titel verweist dabei auf den bombastischen Stil einiger Zeitgenos- sen, der charakterisiert war durch exzessive Anhăufung von Neologismen, durch pleo- nastische Aneinanderreihung von Synony- men, durch den starken Kontrast zwischen der âuBerst bescheidenen Qualitât einiger li- terarischer Erzeugnisse und dem enkomias- tischen Tonfall der hierzu erscheinenden Kommentare.
AbschlieBend ist festzustellen, dass die militante Kritik Maiorescus in Fragen der Schriftsprache und der Sprachpolitik we- sentlich dazu beigetragen hat, die Tendenz der offentlichen Meinung auf eine Vermei- dung der Diglossie festzulegen, eine Situati- on, die sich in jener Zeit in Bezug auf das Neugriechische abzeichnete.
5. GroB-Rum ânien und die neuen P rio ritâ ten der Sprachpolitik
Nach der Eingliederung Siebenbiirgens, fur die Rumănen ein legitimer Akt der Herstel- lung nationaler Einheit, wurde Rumănisch offizielle Sprache eines Staates, dessen Flă- che auf das Doppelte angewachsen war, in dem nun aber zwei groBe Minderheiten leb- ten, Ungarn und Deutsche in Siebenbiirgen. Die Problematik sprachlicher Identitât wurde offentlich diskutiert, und Geschichts- schreibung und rumănische Sprachwissen- schaft wurden halboffiziell dazu aufgefordert, in ihrem wissenschaftlichen Diskurs vorran- gig die ‘historischen Rechte’ der Rumănen auf die Gebiete zu rechtfertigen, die den mo- dernen rumănischen Staat bilden. Die poli- tischen Konsequenzen wissenschaftlicher Theorien waren damals direkt und unmittel- bar und trugen zur Gestaltung bedeutender politischer und diplomatischer Entscheidun- gen bei. So verwendete man etwa im Rah- men der Verhandlungen von Trianon (1920) die Karten von Gustav Weigands rumăni- schem Sprachatlas bei der Grenzziehung zwischen Ungarn und Rumănien.
Die Thematik der Romanităt der Rumâ- nen, ihrer Autochthonie und Kontinuităt nordlich der Donau wurde zur Staatsange-
125. Sprachplanung und -pflege: Rumănisch
legenheit. Im Gegensatz zu Meinungen und Theorien deutscher, ungarischer und bulga- rischer Gelehrter (die ebenfalls auf politi- schen Motiven beruhten!), welche die Konti- nuitât der Rumănen in Siebenbiirgen bzw. in der Dobrudscha bestritten, verzichteten ru- mânische Historiker, Sprachwissenschaftler und schlieBlich auch Archâologen auf diffe- renziertere Positionen hinsichtlich des Ge- bietes, in dem sich das rumănische Volk und seine Sprache entwickelt hatten, wie sie zu- nâchst von Linguisten wie Philippide oder Ovidiu Densusianu formuliert worden waren (beide verwiesen in erster Linie auf das Gebiet siidlich der Donau). Man folgte nun vielmehr der These, derzufolge die ursprung- liche Heimat der Rumănen nur das alte Territorium des traianischen Dakien sein konne. Hauptakteur in diesem wissenschaft- lich-ideologischen Streit war der Sprachwissenschaftler Sextil Puşcariu, erster Rektor der neu gegriindeten Universităt Cluj. In den Statuten des von ihm in Cluj gegriin- deten Muzeul Limbii Române, des ersten rumănischen Forschungsinstituts zur Sprach- geschichte, waren ausdriicklich MaBnah- men zur Sprachpolitik festgelegt: die Samm- lung lexikalischen Materials aus allen Gebie- ten, in denen Rumănen lebten, die Erarbei- tung von Vorschriften und Empfehlungen, die zur endgultigen Vereinheitlichung der rumănischen Schriftsprache fiihren sollten, die Weckung des Interesses breiter Volks- schichten fur Probleme der nationalen Schriftsprache und die Ausbildung rumâni- scher Spezialisten in allen Bereichen philo- logischer und linguistischer Forschung. In diesem Rahmen und um die Zeitschrift mit dem symbolisch-programmatischen Titel Dacoromania versammelte Puşcariu eine ge- wichtige Gruppe kompetenter Forscher, mit deren Hilfe er in Forschungsgebieten, fur die politische Prioritâten bestanden, bedeuten- de Kollektivarbeiten in Angriff nahm und (teilweise) abschloss: der rumănische Sprachatlas, rumănische Toponymie und Etymolo- gie des Rumănischen. Er ubemahm ferner die Aufgabe einer definitiven Festlegung der Orthographie. Zunâchst in einem Projekt, das 1929 der Rumănischen Akademie vorge- stellt und offentlich diskutiert wurde, dann in einem îndreptar şi vocabular ortografic, das er 1932 zusammen mit dem klassischen Philologen Theodor Naum verfasste (Bucureşti, 51946), setzt Puşcariu endgiiltig das phonetische Prinzip zusammen mit den wichtigsten Zugestăndnissen an das etymo-
1439
1440 XI. Sprachnormierung und Sprachverwendungskritik
logisch-latinisierende Prinzip (die Formen sunt, suntem, sunteţi und die Verallgemeine- rung von â im Wortinneren) durch. Puşcari- us Theorie zu dem Gebiet, in dem das rumă- nische Volk und seine Sprache entstanden, wurde von den sprachwissenschaftlichen Schulen von Bukarest und Iaşi ubemommen und erlangte offiziellen Charakter. Sie wurde von der Schule verbreitet, auch in der Zeit des Kommunismus, und wird heute von den Rumânen beinahe einstimmig als Axiom anerkannt.
6. D ie Zeit des Kommunismus. Sprachproblem e zwischen proletarischem Internationalism us und national-kom m unistischer Ideologie
V.a. seit 1948, gleichzeitig mit der totalen Machtergreifung, machte das kommunisti- sche Regime, z.T. nach dem Vorbild der Sowjetunion, die sprachlichen Probleme zur Sache politischer Staatspropaganda. Die Re- form des Unterrichtswesens von 1948, ver- bunden mit einer massiven Ideologisierung, bedeutete einen betrăchtlichen kulturellen Ruckschritt. GemâB der in der Sowjetunion verbreiteten wissenschaftlichen Lehrmei- nung (N. I. Marr) musste die Sprache, eine zentrale Komponente der ‘Suprastruktur’, uberwacht und den ‘groBen Idealen des So- zialismus und Kommunismus’ entsprechend gestaltet werden. In der Zeitschrift Cum vorbim, 1949 mit dem ausdriicklichen Ziel ge- grundet, das Bewusstsein der Offentlichkeit in Problemen der Sprache zu lenken, kămpf- te man fur die ‘Kontrolle der Massen’ uber die wissenschaftliche Tătigkeit der Linguis- ten, die in corpore beschuldigt wurden, sie seien im ‘kosmopolitischen und formalisti- schen Morast der burgerlichen Wissenschaft versunken’ und ‘ohne Verbundenheit mit der Sache der Arbeiterklasse’. Es sei dringend notwendig, die Sprache von der Prăgung durch die ‘Ausbeuterklasse’ zu befreien und ‘zum Besitz des ganzen Volkes’ zu machen. Man versuchte sogar eine Sowjetisierung des Wortschatzes (Worter wie colhoz, pionier, raion, partid erhielten eine starke posi- tive Konnotierung), jedoch ohne groBen Erfolg, da mit der Aufgabe der Marr-Dokt- rin durch Stalin (1950) auf die Vorstellung vom Klassencharakter der Sprache verzich- tet wurde. Die kommunistischen staatlichen Autoritâten befassten sich jedoch weiterhin
mit sprachlichen Problemen, v. a. denjenigen der Schriftsprache. Die Akademie, 1948 nach kommunistischen Prinzipien umorganisiert und in den Dienst der Arbeiterklasse ge- stellt, wendet sich den fruheren Aufgaben zu, jetzt systematisch in neuem institutionel- lem Rahmen, infolge der Griindung dreier linguistischer Forschungsinstitute in Bukarest, Iaşi und Cluj. Mit Diplomaţie und um den Preis groBer politischer und ideologi- scher Kompromisse gelingt es bedeutenden Sprachwissenschaftlern (Iorgu Iordan, Alexandru Graur, Alexandru Rosetti), die kommunistischen Autoritâten von der Notwen- digkeit der Durchfiihrung weit reichender Kollektivprojekte unter Aufsicht und mit Unterstiitzung des Staates zu uberzeugen; dazu gehoren die Realisierung des Thesau- rus-Worterbuchs, die Verdffentlichung des rumănischen Sprachatlas und der Regional- Atlanten, eines groBen Toponymenworter- buchs, einer von der Akademie herausgege- benen rumănischen Sprachgeschichte etc. Derartige Projekte wurden von Kollektiven junger Forscher unter Leitung erfahrener ăl- terer Sprachwissenschaftler durchgefuhrt.
Das normative Prinzip beherrschte die wissenschaftlichen Debatten, die betrăchtli- ches Echo in der Offentlichkeit fanden (Radio, Tagespresse, Zeitschriften). Unter der Bezeichnung cultivarea limbii wurden die Bemuhungen um die Korrektheit des schrift- lichen und mundlichen Ausdrucks zu einem wahren Staatsproblem, v.a. seit 1958, als Iorgu Iordan eine umfassende und systema- tische offentliche Kampagne mit dem Ziel der Bewusstmachung, der Erklărung und schlieBlich der Beseitigung hâuflger sprach- licher Fehler begann; seit 1971 existierte in der Akademie sogar eine Kommission fur Sprachpflege. Die Kriterien hierfur waren meist rein sprachlicher Art, der Faktor ‘Po- litik’ spielte allmăhlich eine immer geringere Rolle, mit einigen Ausnahmen, so etwa im Fall des Worts tovarăş “Genosse”, das von einigen opportunistischen Sprachwissenschaftlern als Zeichen der neuen sozialen Beziehungen angesehen wurde, im Gegen- satz zu domn “Herr”, als Zeichen der alten Ordnung (cf. Iancu 1977, 123). Im Rund- funk (spâter im Fernsehen), in den Fachzeit- schriften (Limba română) in literarischen Zeitschriften (Contemporanul, Gazeta literară, România literară, Luceafărul) und in der Tagespresse (Scînteia, România liberă) so- wie in zahlreichen monographischen und populârwissenschaftlichen Publikationen er-
scheint eine Flut publizistischer Beitrăge, Artikel und Studien, an denen fast alle ru- mânischen Sprachwissenschaftler jener Zeit beteiligt sind, von denen einige sogar den grdBten Teii ihrer wissenschaftlichen Tâtig- keit theoretischen oder praktischen Proble- men der Sprachpflege widmen.
Die Frage der Orthographie wurde 1951 durch eine von Graur und Petrovici initiierte Debatte wiederaufgenommen, welche fur die Notwendigkeit einer Vereinfachung der Or- thographie plădierten. Im Micul dicţionar ortografic von 1953 (mit mehreren Neudru- cken und mehrmals geândertem Ţiţei, bis zur Standardform - seit 1960 îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie) konsoli- dierte sich das phonetische Prinzip, die be- deutendsten Uberbleibsel des etymologi- schen Prinzips wurden getilgt. Das neue Orthographiesystem wurde durch einen Be- schluss des Ministerrats in Gesetzesform ge- bracht und rasch fur alle Bereiche des of- fentlichen Lebens vorgeschrieben (Schule, Presse, Verlage, offentliche Verwaltung). Diese Orthographiereform wurde von ihren Initiatoren und Anhângern als Sieg des Neuen dargestellt, von vielen Intellektuellen und von einem Teii der Bevolkerung wurde sie jedoch als ein Angriff auf die naţionale Besonderheit und als Versuch der Russifizie- rung bzw. Slavisierung der rumănischen Sprache (eigentlich: Graphie) empfunden. V. a. die Beseitigung des Buchstabens â, der in allen Positionen durch î ersetzt wurde, empfand (und beabsichtigte!) man als Reve- renz an die alte kyrillische Schreibung (auf- grund der Âhnlichkeit mit den kyrillischen Zeichen * und *) und als Versuch, den sym- bolischen Verweis auf die Latinitât des Rumănischen und implizit die Romanitât der Rumânen zu beseitigen (das Ethnonym român und seine Ableitungen wurden nun mit f geschrieben, was fur die Mehrheit der erwachsenen rumănischen Bevolkerung, die friiher zur Schule gegangen war, einer Blas- phemie gleich kam). Auf dieser Grundlage beginnt Nicolae Ceauşescu 1965, eben erst an die Macht gekommen, seine lange national- kommunistische Herrschaft mit der gesetz- lichen Wiedereinfuhrung des Buchstabens â in român, was ihm viele Sympathien eintrug.
Als wichtige und dringliche offentliche Aufgabe wurde die Erarbeitung und Verof- fentlichung der Gramatica Academiei ange- sehen, an der eine umfangreiche Gruppe junger Wissenschaftler beteiligt war (Bucureşti, 11959, unter der Leitung von Alexan
125. Sprachplanung und -pflege: Rumănisch
dru Graur, Jacques Byck, Dimitrie Macrea; 21963 unter der Leitung von Alexandru Graur, Mioara Avram, Laura Vasiliu). Bei- de Ausgaben beziehen sich auf die zeitge- nossische Synchronie des Rumănischen und vereinbaren die objektiv-wissenschaftliche Beschreibung mit prăskriptiv-normativen An- gaben und Empfehlungen stilistischer Art. Die ideologischen Bezuge und die Zitate aus Stalin, Engels und Gheorghiu-Dej aus dem Vorwort der ersten Ausgabe fehlen in der zweiten Ausgabe, die gegeniiber der ersten umfangreicher, detaillierter und reicher an Beispielen und normativen Vorschriften ist. Auch wenn diese zweite Ausgabe nicht die Weihen eines Gesetzgebungsaktes erhielt, und obwohl sie in Detailfragen von Fachleu- ten hâufig kritisiert wurde, so wurde sie doch ein obligatorischer Bezugspunkt fur die traditionelle Grammatik und (halb-)of- fiziell fur die Schulbucher, ein Regelwerk fur Fragen der Korrektheit in Syntax und Morphologie, ein Referenzwerk fur die Forschung. In den darauf folgenden Jahr- zehnten hat das systematische Grammatik- studium eine groBe Schar von Fachleuten an Universitâten und Forschungsinstitu- ten hervorgebracht, die mehr oder weniger personlich gefărbte Grammatiken veroffent- lichten, von denen viele mit Bezeichnungen wie pentru toţi, de bază, elementară versehen waren. Eine Besonderheit des rumănischen Unter richtswesens aus kommunistischer Zeit, die bis heute (2003) beibehalten wurde, ist die Einfuhrung des Unterrichts in rumâni scher Grammatik als Hauptfach in der Grundschule und an Gymnasien sowie als obligatorisches Fach beim Abitur. In den letzten 50 bis 60 Jahren wurde der Markt mit einer Unmenge von Buchern mit Erklârungen und unterschiedlichen Ubungstypen zur Grammatik fur die ver- schiedenen Unterrichtsstufen uberschwemmt. Im Vergleich mit anderen Lândern ist so in Rumânien die theoretische Kenntnis der Grammatik weit verbreitet, auch wenn die konkrete Praxis des Schreibens auf allen Ebenen des Schulwesens nicht geniigend ge- iibt wird.
Vom Interes se des kommunistischen Re- gimes, sich auf dem Gebiet der Forschung zur Nationalsprache zu legitimieren, hat auch die Lexikographie profitiert. Von mehreren Kollektiven von Lexikographen in Bu- karest, Iaşi und Cluj (etwa 30 Wissenschaftler), die sich ausschliefilich diesem Projekt widmeten, wurden 1965 die Arbeiten am
1441
1442 XI. Sprachnormierung und Sprachverwendungskritik
‘Thesaurus’ der rumânischen Sprache (DLR) wieder aufgenommen. In der Absicht, die Reihe zum Abschluss zu bringen, beschloss man die Weiterfuhrung ab dem Buchstaben M, wo das Werk von der Equipe um Puşcariu 1949 aufgegeben werden musste, obwohl die neue redaktionelle Konzeption einige Neue- rungen vorsah: ein weit groBerer Umfang der Artikel pro Wort auf der Basis einer sehr viei umfangreicheren Materialdokumentation, die Beibehaltung der historischen Dimension, jedoch mit Betonung der zeitgenossischen Sprache, die Festigung der normativen Komponente durch die Einbeziehung von Hinweisen zur richtigen Aussprache und zur Morphologie. Nach knapp 40 Jahren wur- den bis heute die Bande mit den Anfangs- buchstaben M, N, O, P, R, S, Ş, T, Ţ, U und ein Teii von V veroffentlicht; die anderen Bande befinden sich in einem fortgeschritte- nen Redaktionsstadium. Bereits vorher wur- den aus ideologischen Griinden, die mit der Pflege des zeitgenossischen Rumânisch zu tun hatten, ein Dicţionar al limbii române literare contemporane (4 voi., Bucureşti, 1955-57) veroffentlicht sowie ein Dicţionar al limbii române moderne (Bucureşti, 1959), Vorlâufer des DEX {Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1915121996), des populărsten rumânischen Worterbuchs.
Ceauşescus Nationalkommunismus, ver- bunden mit dem Personenkult des Dikta- tors, zeigt sich im Bereich der Sprachwissen- schaft beim Versuch, die Wissenschaftler zu Aktivisten der Partei’ zu machen, zu einer Art Propagandisten, die in ihren wissen- schaftlichen Veroffentlichungen die ideologischen Abartigkeiten des Diktators zu be- weisen hatten, so etwa dessen Uberzeugung, die Rumănen seien ‘das zahlreichste, tap- ferste und tuchtigste’ aller Volker. In pro- grammatischen Schriften forderte Ceauşes- cu die Wissenschaftler auf, um jeden Preis Beweise und Argumente fur seine fixen Ide- en zu liefern: das Dakertum, die Kontinui- tâ t und Autochthonie der Rumănen und deren Existenz nordlich der Donau vor anderen Volkerun sowie ihren qualitativen und chronologischen kulturellen Vorrang (protocronismul). Er selbst gab hierfiir Bei- spiele, indem er den Namen zweier groBer Stădte ihren alten dakisch-romischen Namen hinzufugte (Cluj-Napoca und Drobeta- Turnu Severin) sowie StraBen und neuen Wohnvierteln Namen gab, die eine glorrei- che Vergangenheit evozieren sollten, wie etwa Dacia, Sarmizegetuza, Decebal, Apulum,
Potaisa, Columna. Im Unterschied zu vielen Kollegen aus der Geschichtswissenschaft oder der Archăologie, die eilends ‘Beweise’ zur II- lustration der ofliziellen Thesen fabrizier- ten, uberschritten die meisten Sprachwissen- schaftler glucklicherweise nicht die Grenzen des gesunden Menschenverstandes und wis- senschaftlicher Objektivităt und niitzten den ideologischen Trend lediglich, um wis- senschaftlich bedeutsame Vorhaben wie die regionalen Sprachatlanten (Muntenien und Dobrudscha, Oltenien, Banat, Siebenbiir- gen, Maramureş, Moldau und Bukowina) durchzufuhren. Erfolglos blieb auch Ceauşescus Versuch, in die Dynamik der Sprach- norm einzugreifen, wie sein beriihmter Erlass vom Anfang der 80er Jahre, in dem die Verwendung der Anredeform domnule (“Herr”) verboten und tovarăş (“Genosse”) als Zeichen des ‘sozialistischen Triumphs’ allgemein vorgeschrieben wurde.
Im Nachkriegs-Bessarabien, das 1944 dem Sowjetreich eingegliedert wurde, hatte die heftige Unterdruckung, der die rumâni- sche Bevolkerungsmehrheit ausgesetzt war (Enteignungen, Vertreibung, Massendepor- tationen), auch eine bedeutende sprachliche Komponente. Bei der Anwendung des stali- nistischen Prinzips der Entnationalisierung der Volker mit der Absicht ein ‘einheitliches Sowjetvolk’ zu schaffen, griff man zu massi- ven und systematischen MaBnahmen, um den speziflschen Charakter der rumânischen Sprache kunstlich zu verăndem und regionale und lokale Charakteristika um jeden Preis zu fordern. Von ihren Landsleuten jen- seits des Prut trotz der ‘rumănisch-sow- jetischen Bruderschaft’ durch eine undurch- lăssige Grenze abgeschnitten, wurden die Moldauer zu einem eigenen Volk erklărt, und ihre Sprache, die nunmehr limba moldovenească (“moldauische Sprache”) hieB, wurde systematisch an den Rând gedrăngt, indem sie nur mehr als limba de conversaţie (“Sprache der Konversation”) verwendet wurde, bes. von Personen geringerer Bil- dung. Die massive Verwendung des Russi- schen in Schule, Kultur und offentlichem Leben bewirkte allmăhlich, dass die rumăni- sche Schriftsprache durch ein kunstliches Idiom ersetzt wurde, eine Mischung von Volksmundart (man empfahl Aussprachen wie die SchlieBung der Auslautvokale und die Palatalisierung der Labiale) und einem stark russifizierten Wortschatz, in dem schon seit langer Zeit gebrăuchliche latei- nisch-romanische Neologismen durch russi-
sche Entsprechungen ersetzt wurden (zavod fur uzină, tetrad fur caiet, cardaş fur creion, aptecă fur farmacie). Die Durchsetzung des russischen Alphabets diente ebenfalls dem Zweck, die romanische Identităt der ‘mol- dauischen Sprache’ auszuloschen. Diese aggressive Sprachpolitik beeinflusste auch die Spracheinstellung eines Teils der mol- dauischen Bevolkerung. Diese Leute - mit dem Schimpfwort mancurt bedacht - verste- hen sich zwar als Moldauer, sprechen jedoch Russisch und verhalten sich strikt ablehnend gegenuber einer Annăherung an Rumănien.
7. D ie post-kom m unistische Periode: Schwâchung institutioneller A uto rită t in Fragen der Sprachpflege und -norm ierung
Der Zusammenbruch des kommunistischen Systems 1989 fiihrte in Rumănien zu einer Autoritătskrise auch auf dem so streng iiberwachten Gebiet der Sprachplanung der kommunistischen Âra. Da die Rumănische Akademie nicht mehr von der absoluten Au- toritât des totalităren Staates unterstiitzt wurde, verlor sie ihre Rolle als unumstritte- ner ‘Gesetzgeber’ in Fragen der ublichen Ver- wendung der Nationalsprache, und selbst Begriffe wie ‘gepflegtes Sprechen’ und ‘Be- achtung der schriftsprachlichen Norm’ ver- loren die Nuance von Verpflichtung und Pres- tige. Die Rumănische Akademie, deren Mit- glieder - als Erbe des vorigen Regimes - in der Mehrheit aus dem Techniker- und Inge- nieurbereich stammten und eine konservati- ve und opportunistische Mentalităt mitbrach- ten, versuchte, Prestige und symbolische Autorităt in Fragen der Sprache durch eine anachronistische, kontraproduktive und kostspielige Iniţiative wieder zu gewinnen. Auf Iniţiative des Prăsidenten der Akademie, ehemals Stutze des kommunistischen Regimes, Technokrat mit philosophischen Ambitionen, der in der ‘scientific communi- ty’ fast einmutig abgelehnt wurde, verab- schiedeten die Mitglieder der Akademie 1991 eine Resolution zur Einfuhrung von zwei neuen orthographischen Regeln: die Schreibung mit ă fur den Vokal, der seit 1953 f geschrieben wurde, und die Einfuhrung der Form sunt statt sînt (1. Pers. Sg. und 3. Pers. PI. des Verbs a f i “sein”). Beide orthographischen Neuerungen entbehrten einer wirklichen historischen Begriindung, sie wurden sogar gegen die Meinung der
125. Sprachplanung und -pflege: Rumănisch
Sprachwissenschaftler verabschiedet, die eine breite offentliche Diskussion auslosten und versuchten, diese - wie sie sagten - ‘Pseudoreform’ bzw. «diversiune demagogică patriotardă» (Mioara Avram) zu verhin- dem. Den neuen Regeln wurde von ihren Initiatoren in zweifacher Hinsicht eine gro- Be symbolische Bedeutung verliehen: Sie sollten einerseits graphisch zusătzlich auf die Latinitât des Rumănischen verweisen, andererseits die ‘Ruckkehr der rumănischen Sprache zur Normalităt’ nach der kommunistischen ‘Parenthese’ markieren. Denn, so argumentierten die Initiatoren, die Regelun- gen von 1963 waren von den russischen Be- satzern aufgezwungen worden und hatten die Ausloschung der rumănischen Identităt durch ‘Sowjetisierung’ und ‘Russifizierung’ der Sprache (bzw. besser: der Orthographie) zum Ziel. Aus Mangel an gutem Willen und sprachlichem Sachverstand oder auch aus politischem Opportunismus ubergingen die Mitglieder der Akademie die Argumente des gesunden Menschenverstands der Sprachwissenschaftler in der Akademie, die zeig- ten, dass die knapp 40 Jahre seit der Reform von 1953 die einzige Periode der Stabilităt in der neueren Geschichte der rumănischen Orthographie waren, was eine sehr positive Wirkung auf die normale und effiziente Ent- wicklung der Schriftkultur zur Folge hatte. Tatsache ist, dass - ausgehend von einer Institution mit angeschlagenem Ruf - in breiten Kreisen der Intellektuellen, v.a. im Bereich der Universitât, und ohne gesetzge- berische Unterstiitzung (das rumănische Parlament vermied die Beschlussfassung liber ein entsprechendes Gesetz) die beiden neuen Orthographieregeln inkonsequent und chao- tisch nur von einigen wenigen Verlagen an- gewandt wurden, bis es der Rumănischen Akademie gelang, sie in ihren eigenen Insti- tutionen (Forschungszentren, Veroffentli- chungen, Verlage), in der Schule (mit der Hilfe des Unterrichtsministeriums), in Kir- che und Armee (aufgrund der in beiden Institutionen herrschenden nationalkonser- vativen Mentalităt) und in den meisten staat- lichen kulturellen Institutionen (offentliche Verwaltung, Museen, staatliches Fernsehen) durchzusetzen. Diese relativ chaotische Si- tuation der Orthographie wird voraussicht- lich durch die Herausbildung eines Konsen- ses und die Ubemahme der neuen Regeln auf allen Ebenen, in allen Berufen und so- zialen Schichten beendet werden.
Die uneingeschrănkte Meinungsfreiheit,
1443
die AbschafFung jeglicher Form von Zensur und Autozensur, eine noch nie da gewesene Explosion der Zahl von Presseorganen und audiovisuellen Medien (Dutzende neuer Radio- und Fernsehsender), all das fuhrte zur Schwăchung und gelegentlich sogar zur Auflosung des Normempfindens beim Ge- brauch der rumănischen Schriftsprache. Nicht nur in der Umgangssprache bzw. im ‘ungepflegten’ Stil, sondern auch in der Of- fentlichkeit (Parlament, Fernsehen, Radio, Zeitungen) erscheinen verbreitet einerseits Elemente aus Argot und Jargon, anderer- seits zahlreiche spontane Entlehnungen aus anderen Sprachen, bes. aus dem Englischen, hăufig in unadaptierter Form. Es ist eine Art gesellschaftlicher Mimetismus zu spuren, der die Mitglieder der neuen politischen Klas- se und der neuen Bourgeoisie dazu bringt, modische Termini und Ausdrucke (implementare, brifîng, talk-show) zu ubernehmen, die instinktiv als Anzeichen von Prestige und Zugehorigkeit zur oberen Gesellschafts- schicht empfunden werden. In dieser Situa- tion lieBen konservative Reaktionen nicht auf sich warten. Einen symptomatischen Fall populistischer Manipulation mit der Absicht, daraus symbolisches und politi- sches Kapital zu schlagen, stellt die Einzel- aktion des Literaturkritikers G. Pruteanu dar, der sich in den 90er Jahren durch eine lange Reihe von Sendungen zur Sprachpfle- ge im nationalen Fernsehen eine gewisse Popularitât verschafft hatte. Dieser Politiker ergriff 2002 im Parlament die Iniţiative zur ‘lege Pruteanu’, welche die rumanische Spra- che vor dem Angriff fremder Sprachen, v. a. des Englischen ‘schiitzen’ solite. Diese Ge- setzesinitiative, eine anachronistische Form des Sprachpurismus mit ultranationalisti- schen Nuancen, von der Bevolkerung mit Ironie und Zuruckhaltung aufgenommen, von den Fachleuten aber abgelehnt, sieht u.a. die Ubersetzung fremder Namen (Pro- dukte, Firmen, Organisationen) sowie der kommerziellen Werbung ins Rumanische vor; fur VerstoBe gegen das Gesetz sind GeldbuBen vorgesehen.
Eine besondere Situation existiert in der ehemaligen Moldauischen SSR. Die Erstar- kung des Nationalgefuhls und die Wiederge- burt eines rumănischen Identitâtsbewusst- seins im groBten Teii der rumânisch spre- chenden Bevolkerung dieser Provinz (heute ein unabhângiger Staat) zeichnete sich ab in der sog. ‘bătălie pentru limbă şi grafie’ (cf. Dumeniuc / Mătcaş 1990). Der Prozess, der
1444
mit der Ubernahme des Glottonyms limba română und dem Ersatz des alfabet ruso- moldovenesc (das in den Jahren der sowjeti- schen Herrschaft in propagandistischer Absicht erfunden wurde, um die Identitât von sog. limbă moldovenească und Rumănisch unkenntlich zu machen) durch das in Rumă- nien ubliche lateinische Alphabet begann, kam mit der Erklârung des Rumănischen zur Staatsprache der Republik Moldau zu einem Abschluss. Auf diesen ‘Sieg’ der na- tionalrumănischen Richtung folgte ein Ruck- schritt seit 2001, als die nostalgisch-kommu- nistischen Krăfte die Herrschaft ubemah- men. Gestutzt auf die russophone Minder- heit (die jedoch in wirtschaftlicher Hinsicht dominiert), versucht die neue Regierung in Chişinău, trotz der Proteste in der Bevolke- rung, die russische Sprache neben dem Ru- mânischen wieder als offizielle Staatsspra- che einzufuhren. Das Sprachproblem ist zu einem Thema der politischen Konfrontation geworden, in der pro-rumânische und pro- europăische Krăfte, geschart um die Idee der Identităt von Rumănisch und sog. limbă moldovenească, pro-russischen und anti- rumănischen Krăften gegeniiberstehen, die These von der historischen Notwendigkeit eines moldauischen staatlichen und sprach- lichen Partikularismus durchzusetzen. Aus politischen Motiven (in kommunistischer Zeit die Furcht vor einer Verărgerung des ‘groBen Bruders’ in Moskau, nach dem Fall des Kommunismus Notwendigkeiten der ‘Integration nach Europa’) haben die Regie- rungen Rumâniens beim ‘Kampf um die Sprache’, der in der Republik Moldova ge- fuhrt wird, sich um Zuruckhaltung und Nicht-Einmischung bemiiht.
8. L iteratur
Avram, Mioara, Probleme ale exprimării corecte, Bucureşti, 1987.Bahner, Winfried, Das Sprach- und Geschichtsbe- wufitsein in der rumănischen Literatur von 1780— 1870, Berlin, 1967.Bochmann, Klaus, Rumănisch: Sprachnormierung und Standardsprache, in: LRL 1/2 (2001), 239-251.Budai-Deleanu, Ion, Scrieri lingvistice, eds. Mire- la Teodorescu / Ion Gheţie, Bucureşti, 1970.Cantemir, Dimitrie, Hronicul Vechimei a Romano- Moldo-Vlahilor, ed. Gr. G. Tocilescu, Bucureşti, 1901.-, Descriptio Moldaviae I Descrierea Moldovei, ed. Dionis M. Pippidi, Bucureşti, 1973.
XI. Sprachnormierung und Sprachverwendungskritik
126a. Norm alizzazione, pianificazione e tu tela istituzionalizzata della lingua: friulano 1445
Istoria ieroglifică, eds. Stela Toma / Virgil Cân- dea, Bucureşti, 1973 [1704].Cipariu, Timotei, Principie de limbă şi scriptură, ed. Carmen-Gabriela Pamfil, Bucureşti, 1987 [Blaj, 1864].Coteanu, Ion, Româna literară şi problemele ei principale, Bucureşti, 1961.Dahmen, Wolfgang, Rumănisch, in: Janich, Nina / Greule, Albrecht (eds.), Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch, Tubingen, 2002.Diaconovici-Loga, Constantin, Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor, eds. Olimpia Şerban / Eugen Dorcescu, Timişoara, 1973 [Buda, 1822],Dumeniuc, Ion / Mătcaş, Nicolae, Coloana infinită a graiului matern. File din marea bătălie pentru limbă, Chişinau, 1990.Eustatievici Braşoveanul, Dimitrie, Gramatică ru- mânească, ed. Nicolae A. Ursu, Bucureşti, 1969 [Braşov, 1757].Gheţie, Ion, Biblia de la Bucureşti şi procesul de unificare a limbii române literare, SLLF 2 (1972), 53-66.
Rolul textelor coresiene în procesul de unificare a limbii române literare, SLLF 3 (1974), 105-139.—, Baza dialectală a limbii române literare, Bucureşti, 1975.Golescu, Iordache, Băgări de seamă asupra canoanelor grămăticeşti, Bucureşti, 1840.Heliade Rădulescu, Ion, Gramatică românească de D. I. Eliad, ed. Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, 1980 [Sibiu, 1828].Iancu, Victor, Limbaj cotidian şi rostire literară, Timişoara, 1977.Iordan, Iorgu, Limba literară. Studii şi articole, Craiova, 1977.Iorgovici, Paul, Observaţii de limbă rumănească, eds. Doina Bogdan-Dascălu / Crişu Dascălu, Timişoara, 1979 [Buda, 1799],
Ivănescu, Gheorghe, Problemele capitale ale vechii române literare, Iaşi, 1949.-ţ, Elemente maramureşene (şi ardelene) în limba tipăriturilor lui Coresi [1956], in: Ivănescu 1989, 43-52.—, Bazele dialectale ale limbii literare române (1972), in: Ivănescu 1989, 8-11 (= 1972a).- , Existenţa dialectelor literare (1972), in: Ivănes- cu 1989, 12-14 (= 1972b).- , Studii de istoria limbii române literare, ed. Alexandru Andriescu, Iaşi, 1989.Macrea, Dimitrie, Discuţiile referitoare la dezvoltarea limbii române literare în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, SLLF 1 (1969), 291-309.Maior, Petru, Istoria pentru începutul românilor în Dachia, Buda, 1812.- , Scrieri, ed. Florea Fugariu, 2 voi., Bucureşti, 1976.Maiorescu, Titu, Critice, ed. Domnica Filimon- Stoicescu, 2 voi., Bucureşti, 1967.Micu, Samuil / Şincai, Gheorghe, Elementa lin- guae daco-romane sive valachicae, ed. Mircea Zdrenghea, Cluj-Napoca, 1980 [Viena, 1780; Buda, 21805].Puşcariu, Sextil, Limba română, I. Privire generală, Bucureşti,21976.Rosetti, Alexandru / Cazacu, Boris / Onu, Liviu, Istoria limbii române literare, Bucureşti, 1971.Tempea, Radu, Gramatică românească, Sibiu, 1797.Văcărescu, Ienăchiţă, Observaţii sau băgări de seamă asupra regulelor şi orînduielelor gramaticii româneşti, Rîmnicu-Vîlcea, 1787.Weigand, Gustav (ed.), Linguistischer Atlas des dacorumănischen Sprachgebiets, Leipzig, 1909.
Eugen Munteanu, Iaşi / Flora Şuleu, Bukarest
126a. Normalizzazione, pianificazione e tutela istituzionalizzata della lingua: friulanoSprachplanung, Sprachlenkung und institutionalisierte Sprachpflege: Friaulisch
1. Introduzione 1. In tro d u z io n e2. Premessa sociolinguistica3. Pianificazione 1.1. N ell’elenco degli ‘argom enti’ degli in 4. N ormalizzazione dici delle pubblicazioni della Societâ F ilo lo5. Standardizzazione gica Friu lana (di seguito S.F.F.), ricco orm ai6. Conclusione di circa quindicim ila tito li (Peressi 1974-7. Bibliografia 98), neppure fra i contributi p iu recenţi figu-
rano voci quali normalizzazione, standardiz- zazione, ne tantom ento pianificazione, politica linguistica o simili. Eppure la S.F.F., fondata nel 1919, rappresenta la piu importante delle istituzioni che fra i compiti primari si prefiggono la tutela della lingua friulana.
1.2. La assenza di queste voci negii indici delle pubblicazioni della S.F.F. b motivata non soltanto dalia loro introduzione relati- vamente recente nel lessico comune anche italiano, ma soprattutto dalia effettiva man- canza in Friuli per tutti questi anni di una vera, coordinata azione rivolta ad una politica linguistica. A sua volta cio e dovuto, ol- tre che ad una inadeguata coscientizzazione dei parlanti nei confronti del problema, soprattutto allo ‘status’ del friulano, lingua che dovette aspettare (insieme alle altre lin- gue minoritarie) fino al 1999 per ottenere il riconoscimento giuridico da parte della Au- toritâ nazionale (Repubblica Italiana, legge n. 482, 15 dicembre 1999: Norme in materia delle minoranze linguistiche storiche). Solo tre anni prim a la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva promulgato una legge organica in favore del friulano (Legge Regionale 22 marzo 1996, n. 15 «Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lin- gue regionali e minoritarie»), integrativa e sostitutiva di precedenţi, parziali interventi legislativi.
2. P rem essa socio lingu istica
2.1. Come e noto, la affermazione a livello scientifico deU’autonomia linguistica del friulano in seno alia România risale agii ultimi decenni del secolo scorso (Ascoli 1873). M a la coscienza del parlante (ancora oggi molto viva sia a livello popolare, che nei ceti sociali piu elevaţi) di usare una lingua ben differenziata rispetto agii idiomi del resto della Penisola, e documentata giâ da secoli: basterebbe citare il sonetto In laude de len- ghe furlane (“In lode della lingua friulana”) di Girolamo Sini (vissuto fra il 1529 ed il 1602), il quale rivendicava il diritto di scrive- re nella sua lingua, piuttosto che in «lom- bart» “lombardo” o in «toscan» “toscano”, cioâ in italiano (Chiurlo / Ciceri 1975, 140 s.).2.2. La Regione amministrativa a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia sulla base dei daţi del 1997, annovera una popolazione
1446
complessiva di 1.200.000 abitanti circa, dei quali poco meno di 950.000 residenti nel Friuli storico (con esclusione, cioe, della Provincia di Trieste).
II quadro generale dei parlanti risulta va- riamente distribuito, ow ero non presenta una fisionomia omogena: piâ forte b la tenu- ta del friulano nella Provincia di Udine e in generale nelle aree collinari e montane della intera regione, mentre i territori delle Pro- vince di Pordenone e di Gorizia, insieme con le tre citta capoluogo e gli altri centri urbani maggiori, mostrano vistosi cedimenti nei confronti dell’italiano (fino al qualche de- cennio fa anche del veneto), che b la lingua ufficiale della Regione, oltre che da sempre l’idioma di indiscusso maggior prestigio sociale.
2.3. Non disponiamo sino ad oggi di daţi uffîciali sul numero complessivo dcgli abi- tanti della regione che parlano il friulano (ma cf. 2.5.).
Esistono tuttavia alcune inchieste parziali, la prima delle quali compiuta nel 1977 per incarico della Regione Friuli-Venezia G iulia, i cui risultati pero furono resi noti soltanto ufficiosamente.
Un’altra indagine piu complessa, arti- colata con impostazione scientifica, ma lim itata alia sola Provincia di Udine (circa 530.000 abitanti), fu svolta nel 1986. D a quest’ultima emergeva, fra i daţi complessi- vi, che circa il 75% della sua popolazione parlava regolarmente il friulano, un altro 10% lo adoperava occasionalmente, quasi tu tti ne avevano almeno competenza passi- va. Quanto alia tutela del friulano, oltre il 90% degli intervistati di allora (con percen- tuali maggiori fra gli insegnanti e gli ammi- nistratori pubblici), se ne era dichiarato favorevole (Strassoldo 1986). E notevole ri- levare che a distanza di meno di dieci anni fra le due inchieste la maggioranza dei daţi corrispondevano quasi perfettamente: in particolare pure nella indagine regionale del 1977 quasi il 75% della popolazione aveva indicato il friulano quale ‘lingua preferită’.
2.4. D a almeno due decenni perd si assiste ad una preoccupante, progressiva perdita del friulano, soprattutto fra i giovani: l’anti- ca lingua materna non viene piu tram andata ai figli, in quanto ritenuta non piu funziona- le a corrispondere alle esigenze imposte dai continui mutamenti in tu tti i settori della vita sociale, che sempre pih si esprimono quasi esclusivamente nella lingua nazionale
XI. Sprachnormierung und Sprachverwendungskritik