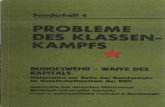Zeitschrift für Australienstudien - German Association for ...
Kontingente Konnektionen. Walter Benjamins Kritik der Schuld (Deutsche Zeitschrift für Philosophie...
Transcript of Kontingente Konnektionen. Walter Benjamins Kritik der Schuld (Deutsche Zeitschrift für Philosophie...
DZPhil, Akademie Verlag, 60 (2012) 5, 725–742
Kontingente Konnektionen
Walter Benjamins Kritik der Schuld
Von Daniel loick (Frankfurt/M.)
Dass unsere Handlungen Folgen haben, veranschaulicht besonders prägnant Annette von Droste-Hülshoffs Ballade Die Vergeltung. Der Passagier eines kenternden Schiffes rettet sein Leben, indem er einen Kranken mit Gewalt von einem Holzbalken trennt, an dem dieser sich festgeklammert hatte. Der unmoralische Passagier ergattert den Balken für sich selbst und wird von einem Schiff aufgenommen, das sich aber später als Piratenschiff entpuppt. Nach-dem das Schiff am Strand angekommen ist, wird auch der Gerettete für einen Piraten gehalten und hingerichtet, da niemand zu seinen Gunsten aussagen will. Die letzte Zeile der Ballade offenbart die Moral der Geschichte: An seinem Galgen entdeckt der Passagier eine Inschrift, die zuvor schon Erwähnung fand – als Inschrift auf genau dem Balken, den er dem Kranken entrissen hatte. Sie lautet: „Batavia. Fünfhundert Zehn“. Während Batavia der Name des Schiffes ist (und die Ballade damit zugleich auf einen realen Vorfall referiert, den Untergang des niederländischen Segelschiffes Batavia im 17. Jahrhundert vor der Küste Australiens), lässt sich die Zahl als Hinweis auf das fünfte der zehn Gebote verstehen: Du sollst nicht töten.1 Dieses Gedicht kann in mehrerlei Hinsicht als paradigmatisch für eine Gerechtigkeitskon-zeption gelten, die Jan Assmann als „konnektive Gerechtigkeit“ bezeichnet hat.2 Die biblische Vorstellung konnektiver Gerechtigkeit, deren Ursprung Assmann bereits im alten Ägypten erkennt3, beruht auf der Konstruktion eines Zusammenhangs von Tun und Ergehen (oder: Tat
1 FüreineAnalysederBalladeimZusammenhangspezifischmodernerpoetischerGerechtigkeitvgl.S. Kaul, Poetik der Gerechtigkeit. Shakespeare – Kleist, München 2008, 11 f.
2 Für eine kondensierte Fassung seines Arguments vgl. J. Assmann, Vertikaler Sozialismus. Solida-rität und Gerechtigkeit im altägyptischen Staat, in: R. Faber (Hg.), Sozialismus in Geschichte und Gegenwart, Würzburg 1994.
3 Um die Frage des biblischen oder altägyptischen Ursprungs der konnektiven Gerechtigkeit und des Tun-Ergehen-Zusammenhangs haben Jan Assmann, Bernhard Janowski und Klaus Koch eine spannende Debatte geführt, die hier im Einzelnen nicht referiert werden kann; vgl. J. Assmann, Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im alten Ägypten, München 1995; ders. u. a., Richten und Retten. Zur Aktualität der altorientalischen und biblischen Gerechtigkeitskonzeption, in: dies. (Hg.), Gerechtigkeit. Richten und Retten in der abendländischen Tradition und ihren altorientali-schen Ursprüngen, München 1998; B. Janowski, Die Tat kehrt zum Täter zurück. Offene Fragen im Umkreis des ‚Tun-Ergehen-Zusammenhangs‘, in: ders., Die rettende Gerechtigkeit. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn 1999; K. Koch, Gibt es ein Vergeltungsdogma
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
726 Daniel Loick, Kontingente Konnektionen
und Folge): Gerecht ist, dass sich Verbrechen nicht lohnt und der Bösewicht bestraft wird. Diese Konnektivität fungiert dabei sinnstiftend; indem einzelne Geschehnisse kausal aufein-ander bezogen werden, erhält die ansonsten kontingente und chaotische Ereignisabfolge eine logische und moralische Bedeutung. Durch den plakativen Rückbezug am Ende der Ballade auf die Inschrift vom Anfang wird eine Verbindung zwischen den Situationen vor und nach der unmoralischen Tat hergestellt, sodass ein in sich geschlossenes sinnhaftes Ganzes ent-steht, wo ansonsten nur die zufällige Sequenz voneinander isolierter Einzelepisoden entdeckt werden könnte. Die gerechte Strafe bemisst sich dabei nach dem Äquivalenzprinzip, es wird Gleiches mit Gleichem vergolten. Es ist nun genau dieses konnektive Gerechtigkeitsverständnis, das auch dem Recht als der menschlichen Form dieses kosmischen Prinzips zu Grunde liegt. Da eben der Kosmos selbst manchmal versagt, das persönliche Ergehen mit dem individuellen Tun zu verknüpfen, müssen die rechtlichen Prozeduren den Tun-Ergehen-Zusammenhang auf künstliche Weise garantieren. Auch diese Verbindung erfolgt nach dem Äquivalenzprinzip: Gemäß des abend-ländischen ius talionis soll zwischen dem Schaden, den das Opfer erlitten hat, und dem Scha-den, der dem Täter zugefügt werden soll, eine Gleichwertigkeit bestehen. Die Grundlage dieser Vorstellung, man könne durch die konnektive Gleichwertigkeit der Schadenszufügung die Tat des Verbrechers gewissermaßen gegen ihn selbst kehren, beruht schließlich juristisch auf der Kategorie der Schuld – die Vergeltung ist gerecht, wenn sie der Schuld des Täters angemessen ist.4 In einigen vor allem zwischen 1919 und 1921 entstandenen Texten und Textfragmenten macht Walter Benjamin die Rechtskategorie der Schuld mehrfach zum Gegenstand einer polemischen Kritik. Die Auseinandersetzung mit dem Schuldbegriff ist ein Element seines umfassenderen Programms der radikalen Kritik des positiven Rechts insgesamt, wie er es sich in seinem Aufsatz Zur Kritik der Gewalt explizit zur Aufgabe getellt hat.5 Wie das ganze philosophische Projekt Walter Benjamins, so ist auch seine Kritik der Schuld vor allem von zwei geistesgeschichtlichen Traditionen geprägt: den sozialen Kämpfen des Proletariats und dem Judentum. Neben Benjamins bekannten Sympathien für die kommunistischen und anar-chistischen Staatskritiken seiner Zeit beschäftigten ihn dabei vor allem die Diskussionen um Möglichkeit und Gestalt eines jüdischen Staates, wie sie im Umfeld des Zionismus geführt wurden; in seiner Korrespondenz mit Gershom Scholem verhandeln die beiden Freunde unter anderem die Frage, wie eine der jüdischen Tradition angemessene postkonventionelle poli-tische Form aussehen könnte. Benjamins Texte sind also auch Interventionen in diese durch den Kampf verschiedener und entgegengesetzter Programme und Ideologien geprägte Situa-
im Alten Testament?, in: ders., Spuren des hebräischen Denkens. Beiträge zur alttestamentarischen Theologie, Neukirchen-Vluyn 1991; ders., Sädaq und Ma’at. Konnektive Gerechtigkeit in Israel und Ägypten?, in: J. Assmann u. a. (Hg.), Gerechtigkeit, a. a. O.
4 DasdeutscheRechtdefiniertSchuldnichtalseinfacheRechtswidrigkeit,sondernalsVorwerfbarkeit.Der Grundsatz nulla poena sine culpa bezieht damit die Subjektivität des Täters bei der Strafzumes-sung mit ein. Das Schuldstrafrecht ist festgelegt in Art. 103 Abs. 2 GG und im Strafrecht verankert in § 46 Abs. 1 Satz 1 StGB. – Für eine ausführliche Darstellung der Entwicklung des Schuldbegriffs in der Strafrechtshistorie vgl. S. Stübinger, Schuld, Strafrecht und Geschichte. Die Entstehung der Schuldzurechnung in der deutschen Strafrechtshistorie, Köln 2000; für eine ausführliche geschicht-liche Abhandlung zum Zusammenhang von Vergeltung und Kausalität vgl. H. Kelsen, Vergeltung und Kausalität. Eine soziologische Untersuchung, Wien 1982.
5 Zur Aktualität von Benjamins Kritik der Gewalt vgl. D. Loick, Kritik der Souveränität, Frankfurt/M. 2012.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
727DZPhil 60 (2012) 5
tion; und obwohl Benjamins Kritik radikal, ja messianisch ist, ist es wichtig, ihre konkrete politisch-institutionelle Sprengkraft ernst zu nehmen. Für das politische Projekt der „Entsetzung des Rechts“ (II.1, 202)6 ist Schuld als integrale juristische Kategorie grundsätzlich negativ besetzt. Benjamin beschreibt sie regelmäßig als Instrument eines umfassenden Kolonisierungsprozesses, als Verschuldung, und sucht, in dieser Zeit im ständigen Dialog mit Scholem und der von ihm repräsentierten jüdischen Religions-philosophie, nach einer Alternative zur Okkupation des menschlichen Lebens durch das Recht. Er widmet sich dieser Aufgabe nicht auf dem Weg einer systematischen Abhandlung, son-dern in seinem typischen idiosynkratischen, kryptischen und apodiktischen Stil, wobei er die jüdische Tradition in Bezug auf die Motive der Gerechtigkeit und des Rechts, der Rache und der Strafe erforscht und neu interpretiert. Dabei experimentiert Benjamin insbesondere mit einem notorisch unklaren Begriff, nämlich dem Begriff der Entsühnung. Ich möchte im Folgen den den Vorschlag unterbreiten, diese Idee vor allem als Opposition zum bis heute hegemonialen konnektiven Gerechtigkeitsverständnis zu verstehen. Dabei gehe ich in zwei Schritten vor. Zunächst möchte ich skizzieren, was genau Benjamin am Schuldbegriff problematisiert, indem ich wiederum auf zwei voneinander zu unterscheidende Dimensionen seiner Kritik eingehe, eine politisch-moralische und eine ethisch-sozialpsychologische Dimension (I). Nachdem ich auf diese Weise die Facetten von Benjamins Schuldkritik zumindest angedeutet habe, will ich mit ihm nach einer möglichen Alternative zum konnektiven Gerechtigkeitsverständnis fragen, welche wiederum den beiden Kritikdimensionen Rechnung tragen muss (II).
I. Dimensionen der Schuldkritik
1. Die moralisch-politische Dimension: Schuld als Schicksal. Der rechtlich garantierte Tun-Ergehen-Zusammenhang setzt an die Stelle einer jeweils genuin kontingenten Reaktion auf eine Unrechtstat eine automatische Rechtsfolge. Dies ist gerade die Pointe des Begriffs der Rechtssicherheit. Zwar trifft das moderne Recht prozedurale Vorkehrungen, um nicht recht-lich antizipierbaren außergewöhnlichen Fällen in Form von Ausnahmeregelungen auf legale Weise Rechnung tragen zu können; das Rechtsinstitut wäre jedoch als solches ad absurdum geführt, wenn immer wieder aufs Neue entschieden werden müsste, ob die Rechtsgemein-schaft auf Rechtsbruch überhaupt rechtlich antworten soll. Rechtssicherheit schützt vor staat-licher Willkür. Die Rechtsfolge einer Handlung muss daher zumindest relativ vorhersehbar und damit auch relativ determiniert sein (dies heißt auch, dass das Recht das einzige Medi-um sein darf, das die Verbindung von Tun und Ergehen produziert, eine private Herstellung von Konnektivität etwa in Form der Selbstjustiz ist ausgeschlossen). Der Schuldbegriff ist in der Moderne darüber hinaus nicht nur ein integrales Moment von Rechtsstaatlichkeit, sondern auch von Demokratie, denn nur wenn sich die Bürger/innen für die Einhaltung der von ihnen gemeinsam beschlossenen Gesetze auch individuell verantwortlich halten, ist die Relevanz der demokratischen Beschlussfassungskanäle auch garantiert; die juristisch durch den Schuldbegriff prozessierte persönliche Zurechenbarkeit strafbaren Verhaltens wird so zur Voraussetzung demokratischer Partizipation.7
6 Quellenangaben in Klammern verweisen auf Band und Seitenzahl der von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser herausgegebenen Gesammelten Schriften Walter Benjamins.
7 Dies hat Klaus Günther in seiner Habilitationsschrift gezeigt: ders., Schuld und kommunikative Freiheit. Studien zur personalen Zurechnung strafbaren Unrechts im demokratischen Rechtsstaat, Frankfurt/M. 2000.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
728 Daniel Loick, Kontingente Konnektionen
In genau diesem rechtlichen Schuldbegriff sieht Benjamin nun eben nicht den Kern demokratischer Freiheit, sondern den Nukleus juridisch zementierter Unfreiheit. Sein zen-trales Argument gegen den Schicksalszusammenhang, wie er ihn im Recht eingerichtet sieht, funktioniert durch eine Umkehrung des traditionellen Verhältnisses von Tun und Ergehen. Normalerweise wird dem Verbrecher die aktive Rolle zugewiesen: Er begeht eine unrechte Tat und macht sich so schuldig – er ist für sein Ergehen „selbst verantwortlich“, insofern ihm sein Handeln vorwerfbar ist. Benjamin will nun dieses „Dogma von der natürlichen Schuld des Menschenlebens“ (II.1, 178) hinterfragen. Er übernimmt ein paulinisches Argu-ment (vgl. Röm 7,7), wenn er argumentiert, der Mensch sei nicht in seiner Praxis zunächst schuldig, sondern werde erst schuldig gemacht. Hier wird das Recht zum aktiven Part der Relation: Es determiniert das Ergehen des Menschen und schiebt ihm metaleptisch die Schuld erst retroaktiv zu. Dies ist der Einsatz von Benjamins Text Schicksal und Charakter. „Das Schicksal“, schreibt Benjamin hier, „zeigt sich also in der Betrachtung eines Lebens als eines verurteilten, im Grunde als eines, das erst verurteilt und darauf schuldig wurde […] Das Recht verurteilt nicht zur Strafe, sondern zur Schuld. Schicksal ist der Schuldzusammen-hang des Lebendigen.“8 (II.1, 175) Nicht weil es Leben, sondern weil es Recht gibt, gibt es Schuld–dennerstdasRechtdefiniert,identifiziertundfixiert,wasSchuldundwerschuldigist. „Der Richter“, so Benjamin weiter, „kann Schicksal erblicken, wo immer er will; in jeder Strafe muss er blindlings Schicksal mitdiktieren.“ (II.1, 175) Das Schicksal eines Menschen ist damit eben nicht Ergebnis seines Charakters, wie es das von Benjamin als „idealistisch“ etikettierte traditionelle Rechtsbewusstsein will, vielmehr schließt das Recht als künstlich errichteter Kausalnexus jedes eminent eigenständige Wirken des menschlichen Charakters und damit jede wirkliche Freiheit aus. Für diese schicksalhafte Unfreiheit steht paradigmatisch die mythische Figur der Niobe, die Benjamin in der Kritik der Gewalt erwähnt.9 Die griechische Sage erzählt, dass Niobe, die stolz auf ihre Fruchtbarkeit war, die Titane Leto verspottet und so deren Unmut auf sich zieht. Letos einzige Nachkommen, Apollon und Artemis, töten sämtliche von Niobes vierzehn Kin-dern, Niobe selbst erstarrt zu Stein, hört aber noch als Stein nicht auf, Tränen zu vergießen. Für Benjamin ist die Besonderheit hier, dass Niobe gerade nicht vernichtet wird, sondern als Symbol der Macht des Rechts über das Leben zu fungieren hat. Durch die Verschuldung wird Niobe gelähmt, sie wird der ganzen Bandbreite ihrer Handlungsmöglichkeiten beraubt und zur passiven Klage verdammt. Auch hier ist die Kausalität wieder durch das Recht, nicht durch die Verbrecherin in Gang gesetzt worden. Letos Polizei, Apollon und Artemis, benutzen Niobe, um das Recht und damit ihre eigene Macht aufzurichten und zu etablieren: „Zwar könnte es scheinen, die Handlung Apollons und der Artemis sei nur eine Strafe. Aber ihre Gewalt richtet vielmehr ein Recht auf, als für Übertretung eines bestehenden zu strafen. Niobes Hochmut beschwört das Verhängnis über sich herauf, nicht weil er das Recht verletzt, sondern weil er das Schicksal herausfordert.“ (II.1, 197) An diesem Punkt sollte allerdings nicht das Missverständnis unterlaufen, Benjamin machte einen Mangel an Berechenbarkeit und Voraussehbarkeit der Rechtsfolgen, also eine fehlende Rechtssicherheit, für Niobes Ver-hängnis verantwortlich. Es ist vielmehr gerade die performative Herstellung von Recht und
8 DieserletzteSatzfindetsichwörtlichauchinBenjaminsTextGoethes Wahlverwandtschaften (I.1, 138).
9 Vgl. für die bislang ausführlichste Analyse des Niobe-Motivs in Benjamins Text J. Butler, Kri-tik, Zwang und das heilige Leben in Walter Benjamins ‚Zur Kritik der Gewalt‘, in: S. Krasmann u. J. Martschukat (Hg.), Rationalitäten der Gewalt. Staatliche Neuordnungen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, Bielefeld 2007.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
729DZPhil 60 (2012) 5
somit von Rechtssicherheit, die sich an Niobe demonstriert. Das menschliche Leben ist für Benjamin dem Recht verfallen, schon allein, aber nicht nur, weil Unkenntnis vor Strafe nicht schützt (vgl. II.1, 199), es wird gewissermaßen seine Beute, ohne es selbst heraufbeschworen zu haben (denn dies würde ja selbst schon einen rechtlichen Maßstab voraussetzen). In die-sem Sinne ist auch eine Passage aus Benjamins Aufsatz über Goethes Wahlverwandtschaften zu verstehen, wo davon die Rede ist, die Menschen würden schuldig nicht durch Entschluss und Handlung, sondern durch Säumen und Feiern: „Mit dem Schwinden des übernatürlichen Lebens im Menschen wird das natürliche Schuld, ohne dass es im Handeln gegen die Sitt-lichkeit fehle. Dem Unglück, das sie über ihn heraufbeschwört, entgeht er nicht. Denn nun steht es im Verband des bloßen Lebens, der am Menschen als Schuld sich bekundet. Wie jede Regung in ihm neue Schuld, wird jede seiner Taten Unheil auf ihn ziehen.“ (I.1, 139) War Letos Reaktion für Niobe am Anfang vielleicht auch eine Überraschung, so wird es von nun an keine Überraschungen mehr geben: Wer das Schicksal herausfordert, hat mit dem Recht zu rechnen, dafür steht die versteinerte Niobe so emblematisch wie der Schlagstock im Halfter des Polizisten. Die Verschuldung des Lebens durch das Recht lähmt aber nicht nur die, welche schuldig geworden ist, sondern auch alle anderen Mitglieder der Rechtsgemeinschaft und damit immer auch die Opfer. Auch sie werden ihrer Handlungsmöglichkeiten beraubt, denn auch sie sind fortan zur passiven Untätigkeit verurteilt. Indem das Recht im Verbot der Selbstjustiz den Verbrecher zwar auch schützt, schließt es zugleich auch alle möglichen anderen Reaktionen auf eine Unrechtstat aus. Das individuelle Verzeihen, aber auch Diskussion und Streit, ja alles Politische darf es in einem Rechtsstaat nur in dem Maße geben, wie es das rechtliche Urteil gestattet. Das Gericht eliminiert jeden Abstand zwischen der Untat und der Vergeltung, der wesentlich andere Verbindungen vom Nachher zum Vorher eröffnen könnte. Die symbolträch-tige Hinrichtung des schuldbeladenen Passagiers am Ende von von Droste-Hülshoffs Ballade macht ja den Toten nicht wieder lebendig, und Niobes Martyrium macht ihren Spott nicht ungesagt. Das Recht schreibt das Ergehen der Täter in einen künstlichen Kausalzusammen-hang mit ihrem Tun ein und verlängert so die Unfreiheit, die in der Unwiederbringlichkeit der vergangenen Zeit liegt, anstatt sie zu verlassen. In dieser rechtlich etablierten Kausalität kann man ein ironisches Umschlagen der rechtsstaatlich-demokratischen Institutionen, eine Dialek-tik der Aufklärung gewissermaßen, entdecken, denn indem das Recht die Menschen von der Heteronomie der Blutrache befreit, installiert es selbst einen Schicksalszusammenhang, in dem die wesentlichen Handlungsabfolgen der Gesellschaft im Vorhinein festgelegt sind. Es bedarf nun wenig gesellschaftstheoretischer Phantasie, um zu überblicken, wie zentral das philoso-phisch-theologische Konstrukt der Schuld zur politischen Legitimation und psychologischen Verinnerlichung eines gesamtgesellschaftlichen Disziplinierungsregimes ist.
2. Die ethisch-sozialpsychologische Dimension: Schuld als Unglück. Mit diesem politisch-moralischen Aspekt hängt ein ethisch-sozialpsychologischer Aspekt eng zusammen, den Ben-jamin anhand der Kategorie des Glücks beziehungsweise des Unglücks verdeutlicht. Glück istkeineKategoriedesRechts.DasRechtversprichtdieRegelungvonKonfliktenundsodie Verminderung des gesellschaftlichen Gewaltaufkommens, nicht aber die Ermöglichung menschlichen Glücks. Dies ist im Begriff des Rechts selbst begründet; das Recht ist überhaupt nichts anderes als die von den staatlichen Exekutivorganen wahrgenommene wechselseitige Zwangsbefugnis, darum ist es folgerichtig, dass, wie Kant festgestellt hat, das Recht „eine Gesetzgebung, welche nötigend, nicht eine Anlockung, die einladend ist, sein soll“.10 Wenn
10 I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, in: ders., Werke, Bd. IV, Darmstadt 1998, 324.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
730 Daniel Loick, Kontingente Konnektionen
aber das Recht keine Perspektive auf das Glück bietet, so wird Glück für die Menschen nur erreichbar in einer Sphäre, die sich von den Diktionen des Rechts zumindest ein Stück weit befreit hat. Während für den Liberalismus die rechtsstaatliche Verfasstheit der politischen Welt die Voraussetzung und Bedingung des individuellen pursuit of happiness darstellt, gerät sie für Benjamin mit ihm in eine irreduzible Spannung. Da das Recht für sich reklamiert, in schlechterdings allen sozialen Fragen die letztinstanzliche Entscheidungskompetenz zu haben, zwingt es allen anderen gesellschaftlichen Subsystemen seine Prädestinationen auf und diktiert jedem anderen Lebensbereich seine wesentlichen Handlungsobligationen. Hierdurch formalisiertesdieKonfliktedesLebensnachabstraktenRechtssätzen,subsumiertallesin-gulärenBesonderheitenunterdieihmspezifischeAllgemeinheit,suspendiertdieindividuelleVerantwortung für moralisch virulente Situationen, uniformiert die Pluralität der Sozialbezie-hungen und normativen Perspektiven und garantiert im Allgemeinen die weltgeschichtliche „Einsinnigkeit des Geschehens“ (VI, 92).11 Diese Verrechtlichung des Lebens, bei welcher der Schuldbegriff eine zentrale Rolle spielt, verdichtet sich für Benjamin soweit, dass es ihm angezeigt erscheint, vom Recht als einer Schicksals- oder Verhängnismacht, gar von einer „mythische[n] Verknechtung der Person im Schuldzusammenhang“ (II.1, 178) zu sprechen. Der objektive Freiheitsverlust schlägt sich in der Subjektivität der Menschen nieder. Der Grund der von Benjamin konstatierten Verknechtung liegt darin, dass die Menschen ihre Unfreiheit zugleich als Unglück erfahren. Dieser Begriff ist doppeldeutig, er bezeichnet zum einen ein negativ verlaufendes Schicksal, etwas, das einem zustößt, zum anderen aber auch einen emotionalen und affektiven Zustand. Beide Bedeutungsebenen lassen sich nicht von-einander trennen: Spielball fremder Mächte zu sein, das eigene Leben nicht in der Hand zu haben, bereitet Kummer. Dieser Befund scheint sich empirisch leicht bestätigen zu lassen: Wenn Menschen einüben, deviantes Verhalten vor allem aus Erwartung negativer Sanktio-nen zu vermeiden, wenn Sozialisation und Erziehung jede Form der Dissidenz mit Angst besetzen, dann lässt sich das Unglück, welches die Schulddrohung dem Menschen aufgibt, oft bis ins Habituelle hinein nachvollziehen. Glück, argumentiert Benjamin in Schicksal und Charakter, ist daher Schicksallosigkeit, die Herauslösung des eigenen Ergehens aus der Kette der Kausalitäten (vgl. II.1, 174). Dies entspricht auch dem Begriff des Charakters selbst: Wo das Schicksal herrscht, dort kann kein Charakter sein (vgl. II.1, 173), denn ein wirklicher Charakter kann nur dort existieren, wo nicht alle Handlungen durch vorher festgelegte Prä-dispositionen bestimmt sind.12 Die Idee des Charakters ist untrennbar mit Freiheit und damit auch der Freiheit von Schuld verbunden. In diesem Zusammenhang bekommt der Begriff desLebendigenbesondereBedeutung:SchicksallosistdasSchuldlose,wiePflanzen,Tiereund das Lebendige am Menschen (vgl. I.1., 138), während der soziale und politische Teil der menschlichen Subjektivität an der Schuld- und damit der Schicksalsproblematik Anteil hat.13 Die dementsprechende Antwort auf den Verschuldungszusammenhang ist für Benjamin darum auch „die Vision von der natürlichen Unschuld des Menschen“ (II.1, 178).
11 In der Kritik der Gewalt führt Benjamin diese Kritik noch weiter aus; in einem im Nachhinein an Hannah Arendt erinnernden Gedankengang beklagt Benjamin, das Recht sei so eingerichtet, „dass es nur ein einziges Schicksal gibt“ (II.1, 187).
12 Die biologistische Idee, der Charakter selbst könne als Einschränkung von Freiheit verstanden wer-den, weil er bestimmte Handlungsabfolgen im Vorhinein determinierte, ist Benjamin, der seinem Begriff von Charakter hier eine kantische Idee von Autonomie zu Grunde legt, freilich ganz fremd.
13 Benjamin opponiert gegen die Degradierung des Lebendigen zum Objekt rechtlicher Verschuldung. Die Sphäre der Renitenz gegen Schuld und Schicksal ist diejenige des Lebens selbst, die Sphäre einer menschlichen Praxis, die vor und somit diesseits des Rechts gelegen ist. Das Leben, in des-sen Namen Benjamin gegen die Verrechtlichung protestiert, ist allerdings wohlgemerkt nicht das
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
731DZPhil 60 (2012) 5
Benjamin vertritt also eine Kolonisierungsthese: Das ursprünglich unschuldige Leben, das Lebendige des Lebens selbst, wird durch das Recht einer Schuld unterworfen und so gelähmt und gefesselt, ein Freiheitsverlust, der vom Subjekt als Schicksal und somit als Unglück erfahren wird. Diese Betrachtung verdankt viel der Genealogie des schlechten Gewissens, wie sie Friedrich Nietzsche in der zweiten Abhandlung seiner Genealogie der Moral vorge-legt hat.14 Nietzsche stellt das schlechte Gewissen in den Zusammenhang der Zurichtung des Menschen als „Tier, das versprechen darf“: Alle politischen Institutionen, ja die Institutionali-tät der politischen Welt selbst sind auf der Tatsache gegründet, dass Menschen anderen Men-schen etwas versprechen und dieses Versprechen halten. Für diese Fähigkeit, gar die Erlaub-nis, zu versprechen, ist jedoch ein Preis zu bezahlen: Mithilfe der „socialen Zwangsjacke“ muss der Mensch berechenbar und verantwortlich gemacht werden, um gegen die natürliche Vergesslichkeit anzugehen, die dem Menschen eigen ist. Diese affektiv-habituelle Umwand-lung ist für Nietzsche historisch ebenso bedeutsam wie die Verwandlung vom Wassertier zum Landtier und ebenso schmerzhaft, denn sie vollzieht sich durch eine im Kern gewaltförmige Transformation der gesamten psychischen Ökonomie des Menschen. Das Gewissen als Kon-trollinstanz der Seele, ja die Seele selbst als ein innerlicher Raum des Subjekts, entsteht erst durch eine Internalisierung externer Forderungen. Die Instinkte des freien Menschen richten sich gegen ihn selbst. Nietzsche schreibt in einer oft zitierten Passage: „Die Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung – alles das gegen die Inhaber solcher Instinkte sich wendend: das ist der Ursprung des ‚schlech-ten Gewissens‘.“15 Was Benjamin anhand des Beispiels der Niobe demonstriert, veranschau-licht Nietzsche anhand militärischer Eroberungen: Unter den Hammerschlägen der Eroberer wird die Freiheit aus der Welt geschaffen und durch Organisation und Formung in einen psychischen Innenraum eingekerkert. Das schlechte Gewissen, so Nietzsche, ist der auf diese grausame Weise latent gemachte Instinkt der Freiheit.16 Er bezeichnet das schlechte Gewissen folgerichtig als „tiefe Krankheit“, die von Elendsgefühl und Missbehagen bestimmt ist. EineganzähnlicheDiagnosedesschlechtenGewissenunddesSchuldgefühlsfindetsichauchbeiSigmundFreud,derebenfallsvonNietzschesSchriftbeeinflusstist.DenProzess,den Nietzsche historisch beschreibt, beschreibt Freud biographisch. Weil der Mensch Triebe hat, muss er zunächst psychisch zugerichtet werden, um Teil einer Zivilisation werden zu kön-nen. Nicht jeden Trieb unmittelbar zu befriedigen, lernt der Mensch sozialisatorisch nur durch
organische oder biologische, ist nicht das ‚nackte Leben‘, sondern, wie Benjamin in Die Aufgabe des Übersetzers klar macht, das geschichtliche: „Denn von der Geschichte, nicht von der Natur aus, geschweigevonsoschwankenderwieEmpfindungundSeele,istzuletztderUmkreisdesLebenszubestimmen. Daher entsteht dem Philosophen die Aufgabe, alles natürliche Leben aus dem umfassen-deren der Geschichte zu verstehen.“ (IV.1, 11) Dies entspricht auch den Ausführungen aus der Kritik der Gewalt, in denen Benjamin sich dagegen verwehrt, dass ausgerechnet das bloße (animalische oder vegetabile) Leben heilig gesprochen wird – das „dem alten mythischen Denken nach der ge-zeichnete Träger der Verschuldung ist“ (II.1, 201). Deshalb ist es ihm der Hinweis so wichtig, dass die mythische Gewalt blutig sei, die göttliche aber „auf unblutige Weise letal“ (II.1, 199): „Denn Blut ist das Symbol des bloßen Lebens.“ (II.1, 199)
14 Benjamins eigener Bezug zu Nietzsche (und Freud) ist freilich durchgehend kritisch (etwa in: Schicksal und Charakter, II.1, 173; und in: Kapitalismus als Religion, VI, 101 f.), gewisse „Schul-den“ ihm gegenüber sind aber nicht zu übersehen.
15 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, in: ders., Kritische Studienausgabe, Bd. 5, München 2002, 323.
16 Für eine ausführliche Reflexion über die damit zusammenhängenden politischen und ethischenProb leme vgl. J. Butler, Zirkel des Schlechten Gewissens. Nietzsche und Freud, in: dies., Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt/M. 2001.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
732 Daniel Loick, Kontingente Konnektionen
eine äußere Autorität. Was zunächst einfach die Angst vor äußeren Sanktionen als Reaktion auf eine verbotene Tat ist, wird durch die Errichtung eines inneren Richters und Bestrafers introjiziert und verstetigt. Da sich vor diesem inneren Auge kein verbotener Wunsch ver-bergen lässt, lässt sich die Schuld nicht mehr durch Triebverzicht sühnen, die Folge ist ein Schuldbewusstsein als permanente Grundkonstante der kulturell formierten menschlichen Subjektivität. Freud resümiert diesen Prozess wie folgt:
„[F]ür ein drohendes äußeres Unglück – Liebesverlust und Strafe von seiten der äußeren Autorität – hat man ein andauerndes inneres Unglück, die Spannung des Schuldbewußt-seins, eingetauscht. […] Die zeitliche Reihenfolge wäre also die: zunächst Triebverzicht infolge der Angst vor der Aggression der äußeren Autorität […], dann Aufrichtung der inneren Autorität, Triebverzicht infolge der Angst vor ihr, Gewissensangst. Im zweiten Falle Gleichwertung von böser Tat und böser Absicht, daher Schuldbewußtsein, Strafbe-dürfnis. Die Aggression des Gewissens konserviert die Aggression der Autorität.“17
Für beide, Nietzsche und Freud, ist Schuldbewusstsein also das Ergebnis einer Verinnerlichung von Aggression. Die Aggressivität der Schuld ist ja auch im alltäglichen Sprachgebrauch doku-mentiert, sie wird mit negativ besetzten Begriffen wie dem des Gewissensbisses beschrieben, der „drängt“ oder „nagt“. Benjamin übernimmt von Nietzsche und Freud die Einsicht von der inhärenten Aggressivität der verschuldeten Subjektivität, doch ist er eben nicht der Meinung, Schuld und schlechtes Gewissen seien unverzichtbare Voraussetzungen für Präskriptionen oder Normativität. Ganz im Gegenteil, insofern sie Freiheit unterdrücken, verhindern sie gerade, für eine Handlung echte Verantwortung zu übernehmen. Benjamin ist der Meinung, die Schuld und das von ihr erzeugte Unglück seien nur Ausdruck einer ganz bestimmten, nämlich recht-lich prozessierten Weise, mit unmoralischen Handlungen umzugehen.
II. Andere Verbindungen. Leben ohne Schuld?
Dies wirft die Frage nach der Möglichkeit einer Alternative auf, nach der Möglichkeit einer Welt ohne juristische Schuld und die damit korrespondierende verschuldete Subjektivität. Als Chiffre für die Beendigung der Verschuldung des Lebens durch das Recht verwendet Benjamin den ungewöhnlichen Ausdruck der Entsühnung. Eingegangen sind in Benjamins Idee der Entsühnung zunächst einmal verschiedene religiöse Motive, wie etwa der Versöh-nungstag Yom Kippur, an dem die Sünden vergeben werden, oder die Idee des immer nach 49SabbatjahrenstattfindendenJubeljahrs, indemalleSchuldenerlassenundalleSklavenund Gefangenen frei gelassen werden sollen (gemäß 3 Mos 25,10).18 Allerdings, und hier geht Benjamin durchaus über die traditionelle theologische Deutung hinaus, ist die Entsüh-nung für ihn nicht an die Bedingung einer Vorleistung durch den Schuldigen, wie etwa ein bestimmtes Verhalten, eine reuevolle Einstellung oder Abbitte, gebunden. Entsühnung ist bei Benjamin nicht Sühnung19, nicht Retribution, Retaliation oder Restitution, nicht das Abtra-
17 S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. XIV, London 1955, 487.18 Vgl. zum Zusammenhang der rechtlichen und ökonomischen Schuldstrukturen B. Lindner, Der
11.9.2001 oder Kapitalismus als Religion, in: N. Müller-Schöll (Hg.), Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterfahrung. Anspruch und Aporien, Bielefeld 2003.
19 Auf der Verwechslung dieser beiden Kategorien beruht aber Jacques Derridas fatale Interpretation, wonach sich die Gaskammern der Shoah als Entsühnung im Sinne Benjamins verstehen ließen (vgl.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
733DZPhil 60 (2012) 5
gen der Schuld durch eine Ausgleichsleistung oder ein Opfer, sondern der rigorose Abbruch der juridisch hergestellten Verkettung von Kausalitäten und Tauschhandlungen. Sie ist auch kein Zurück zur ursprünglichen oder natürlich Schuldlosigkeit, sondern eine selbst geschicht-lich generierte „zweite“ Unschuld.20 Damit ist freilich eine radikale und beinahe undenkbare Umwälzung der Ordnung der Gerechtigkeit und des in ihr befangenen Subjekts projektiert, denn nichts weniger ist Benjamins politisches Ziel als die Überwindung des konnektiven Gerechtigkeitsverständnisses, wie es das Abendland seit seiner Entstehung geprägt hat. Von der Länge dieses Zeitraums unbeeindruckt, insistiert Benjamin auf dem historischen und eben nicht natürlichen, logischen oder metaphysischen Ursprung dieser Konnektivität: Die Her-stellung von Schuld ist eine geschichtliche Leistung, also kann sie geschichtlich auch über-wunden werden.21 Um zu verstehen, was für eine Art von normativer Ordnung Benjamin mit dem Begriff der Entsühnung praktisch anstrebt, muss man sich zunächst klar machen, dass die Suspension der Schuld nicht die Suspension des Gesetzes bedeutet. Die Entsühnung nimmt dem Gebot nichts von seiner absoluten Unbedingtheit. In der Kritik der Gewalt stellt Benjamin unmiss-verständlich fest, dass der Wegfall der juristischen Kategorie der Schuld nicht den Wegfall moralischer Verbindlichkeit bedeutet: „auf die Frage ‚Darf ich töten?‘ ergeht als unverrück-bare Antwort das Gebot ‚Du sollst nicht töten‘“ (II.1, 200). Es ist, Benjamin könnte klarer nicht sein, moralisch falsch, einem Schwächeren in den Fluten den lebensrettenden Balken mit Gewalt zu entreißen und ihn so in den Tod zu stoßen. Wird aber aus einer Übertretung des Tötungsverbots die Konsequenz einer Strafbefugnis geschlossen, liegt eine temporale Verwechslung vor. Das Gebot bezieht sich auf das Davor der Tat, während die Strafe sich auf das Danach bezieht, das mit dem Davor in keinem mechanischen Kausalverhältnis steht.
J. Derrida, Gesetzeskraft. Der ‚mystische Grund der Autorität‘, Frankfurt/M. 1991, 123 ff). Bettine Menke hat außerdem gezeigt, dass Derridas Missverständnis sich zum Teil auf einen Übersetzungs-fehler zurückführen lässt. Derrida stützt sich auf die englische Übersetzung von „entsühnend“ als „expiatory“ – was nichts anderes heißt als sühnend (vgl. B. Menke, Benjamin vor dem Gesetz. Die Kritik der Gewalt in der Lektüre Derridas, in: Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida – Benjamin, hg. v. A. Haverkamp, Frankfurt/M. 1994, 255).
20 Dieser Begriff stammt von Nietzsche, der ihn für einen Effekt einer konsequenten Säkularisierung hält: „Atheismus und eine Art zweiter Unschuld gehören zu einander.“ (F. Nietzsche, Genealogie, a. a. O., 330)
21 Benjamin scheint eine ungefähre Vorstellung von der historischen Entstehung des heute hegemo-nialen Schuldbegriffs gehabt zu haben, er hat sie in seinem Fragment Kapitalismus als Religion angedeutet. Dieses lässt sich so verstehen, dass er in der Schuld eine zunächst mythische Kategorie sieht,dieerstmitdemKapitalismusaufdemWegeihrerAffinitätzumökonomischenBegriffderSchulden ihre eigentliche geschichtliche Durchschlagskraft erhalten hat. Den Kapitalismus zeichnet gegenüber allen anderen Kulten aus, keine Perspektive auf Entsühnung mehr anzubieten, sondern universell verschuldend zu sein: „Ein ungeheures Schuldbewusstsein, das sich nicht zu entsühnen weiß, greift zum Kultus, um in ihm diese Schuld nicht zu sühnen, sondern universal zu machen, dem Bewusstsein sie einzuhämmern und endlich und vor allem den Gott selbst in diese Schuld einzube-greifen, um endlich ihn selbst an der Entsühnung zu interessieren.“ (VI, 100 f.) Auch hier ergänzt Benjamin seine Kritik an der vom Kapitalismus produzierten Unfreiheit um eine sozialpsycholo-gische Komponente. Die dem Kapitalismus eigene Subjektivitätsform ist die Sorge: „Die ‚Sorgen‘ sind der Index dieses Schuldbewusstseins von Auswegslosigkeit.“ (VI, 102) Benjamin ersetzt an dieser keineswegs die Dominanz der Rechtssphäre durch die Dominanz der ökonomischen Sphäre. Schuld und Schulden haben ihre gemeinsame Wurzel als Rechtsbegriffe: Der heidnische Charakter des Rechts und hierin vor allem der mythische Eigentumsbegriff ist die Voraussetzung dafür, dass auch das Geld eine verschuldende Dynamik annehmen kann (vgl. auch B. Lindner, Der 11.9.2001, a. a. O., 206).
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
734 Daniel Loick, Kontingente Konnektionen
Benjamin argumentiert hier transzendental, rein mit Bezug auf die temporale Struktur von Vergeltung und Vergebung, und ohne jedes Kalkül möglicher empirischer Nutzen. Benjamin, der hierin ganz in der Tradition der absoluten Straftheorie Kants und Hegels steht, hält Prä-vention oder Resozialisation grundsätzlich nicht für legitime Strafzwecke. Doch anders als für Kant und Hegel zerreißt diese Erkenntnis für Benjamin die rechtliche Konnektivität von Tun und Ergehen insgesamt.22 Es kann, aus apriorischen Gründen, für Benjamin überhaupt keinen legitimen Strafzweck und darum auch keine legitime rechtliche Schuld geben:
„Aber es [das Gebot] bleibt freilich, so wahr es nicht Furcht vor der Strafe sein darf, die zu einer Befolgung anhält, unanwendbar, inkommensurabel gegenüber der vollbrachten Tat. Aus ihm folgt über diese kein Urteil. (…) [Das Gebot] steht nicht als Maßstab des Urteils, sondern als Richtschnur des Handelns für die handelnde Person oder Gemeinschaft, die mit ihm in ihrer Einsamkeit sich auseinanderzusetzen und in ungeheuren Fällen die Ver-antwortung, von ihm abzusehen, auf sich zu nehmen haben.“ (II.1, 200 f.)23
Für Benjamin ist die Zeitlichkeit des Rechts wesentlich noch immer die der Rache, er nennt sie darum auch „mythisch“ oder gar „heidnisch“. Gegen die bisherigen Formen des Rechts und der Rechtsgewalt verteidigt er eine alternative nicht-etatistische Form des Gebots und der Gebothaftigkeit, die sich in der jüdisch-messianischen und auch anarchistischen Tradition in Distanz oder Opposition zum Staat verstehen lässt. Die Forderung nicht nach Abschaf-fung des Rechts, aber nach einem anderen Umgang mit Unrecht lässt ein politisch-soziales Gemeinwesen vorscheinen, in dem die zwischenmenschlichen Handlungsobligationen nicht immer schon im Vorhinein determiniert sind, sondern andere Formen von Verbindung und Verbindlichkeit möglich werden. Diese alternative Form der Gebothaftigkeit ist also nicht weniger kategorisch, aber sie trägt der Zeitlichkeit und also der Vergänglichkeit des Daseins Rechnung, sie berücksichtigt also die Tatsache, dass das Gebot als Richtschnur des Umgangs mit der einmal vollbrachten Tat unanwendbar geworden ist. Für Benjamin realisiert sich diese Art und Weise, der Kon-tingenz der Konnektivität von Tun und Ergehen gerecht zu werden, als Aufschub. Um andere als rechtliche Verbindungen zulassen zu könne, bedarf es gegenüber dem Geschehenen einer gewissen Distanz, eines Abstands zwischen der Untat und der Reaktion auf sie. Die Entsüh-nungbesitztdahereinespezifischeZeitlichkeit,welchesievonderZeitlichkeitdesRechtsunterscheidet; genauer gesagt, die Entsühnung wird der Zeitlichkeit des Daseins, der Zeitlich-keit der Zeit selbst, gerecht, während das Recht nur „ganz uneigentlich zeitlich“ (II.1, 176)
22 Für Kant ist das Strafgesetz ein kategorischer Imperativ. Niemand kann mit Verweis auf einen prak-tischen Nutzen seiner gerechten Strafe entgehen, und sei es beim Preis des Untergangs der Mensch-heit: „denn, wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden leben“ (I. Kant, Metaphysik, a. a. O., 453). Dies gilt freilich auch umgekehrt: Es darf nie nur um der Programmierung gesellschaftlicher Verhältnisse Willen gestraft werden. Ist das Band zwischen Tun und Ergehen einmal zerrissen, so steht die Strafbefugnis insgesamt ohne apriorische Legitimation da. – Genauso verhält es sich bei Hegel, für den in der Strafe „der Verbrecher als Vernünftiges ge-ehrt“ wird (G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt/M. 1986, 191); auch er schließt bedingungslos alle Strafen aus, die ihren Maßstab nicht aus der verbrecherischen Tat selbst nehmen. Ist aber die Anwendbarkeit des Gebots als Maßstab des Urteils ruiniert, so verliert die Restitution der Rechtsordnung, die Hegel angesichts der verbrecherischen Tat für notwendig hält, im Verbrecher ihr Objekt.
23 Ähnlich lässt sich auch eine knappe Bemerkung verstehen, mit der sich Benjamin in Goethes Wahl-verwandtschaften gegen die Vorstellung eines göttlichen Mandats an den Dichter wendet: „Von Gott aber kommen dem Menschen nicht Aufgaben sondern einzig Forderungen.“ (I.1, 159)
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
735DZPhil 60 (2012) 5
ist.24 Diesen Gedanken, dass der rechtlich stabilisierte Tun-Ergehen-Zusammenhang die Zeit-lichkeit leugnet, führt Benjamin in dem Fragment Die Bedeutung der Zeit in der moralischen Welt ein wenig näher aus. Das Recht ist dem Verstreichen der Zeit gegenüber indifferent: Es maßt sich an, Urteile über vergangene Zeiten zu fällen und sie so gegenwärtig zu machen, wobei es ganz gleichgültig ist, ob die zu beurteilende Tat gestern oder vor zehn Jahren statt-gefunden hat. Im quid pro quo der rechtlichen Vergeltung sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zwangsweise synchronisiert.25 Während das moderne Recht durch das Prinzip der Verjährung dieser Vernichtung von Zeitlichkeit eine Grenze gesetzt hat, ist die Konnektivität des Tun-Ergehen-Zusammenhangs allerdings prinzipiell unendlich, sie kann sich über ein ganzes Leben oder mehrere Generationen spannen und ist sogar in der Lage, eine Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits herzustellen: In vielen Religionen wird die endgültige Rech-nung erst nach dem Tod präsentiert. Dem entspricht eine Vorstellung des Jüngsten Gerichts, die Benjamin heidnisch nennt (und worunter bei ihm auch die christliche Konzeption fällt). Dieser heidnischen Vorstellung zufolge ist das Jüngste Gericht „der Termin, an welchem allem Aufschub Einhalt, aller Vergeltung Einbruch geboten wird“ (VI, 98). Jeden Verzug kann diese heidnisch-mythische Rechtsvorstellung folglich nur als „leere[s] Säumen“ (VI, 98) begreifen, er hat keine eigene zeitliche Qualität. Der zeitlosen Zeit der rechtlichen Welt setzt Benjamin die Zeitlichkeit einer anderen Sphäre entgegen, die er als „moralische Welt“ bezeichnet: Dies ist die Zeit nicht mehr der Vergeltung, sondern der Vergebung. So heißt es in einer enigmatischen Passage:
„Denn die Zeit, in welcher Ate dem Verbrecher folgt, ist nicht die einsame Windstille der Angst, sondern der vorm immer nahenden Gericht daherbrausende laute Sturm der Vergebung, gegen den sie nicht ankann. Dieser Sturm ist nicht nur die Stimme, in der der Angstschrei des Verbrechers untergeht, er ist auch die Hand, welche die Spuren sei-ner ‚Untat‘ vertilgt, auch wenn sie die Erde darum verwüsten müßte. Wie der reinigende Orkan vor dem Gewitter dahinzieht, so braust Gottes Zorn im Sturm der Vergebung durch die Geschichte, um alles dahinzufegen, was in den Blitzen des göttlichen Wetters auf immer verzehrt werden müßte.“ (VI, 98)
Ate, die Tochter des Zeus, ist in der griechischen Mythologie die Göttin der Schuld, der Strafe und des Unheils und wird als Schaden bringende Rächerin dargestellt. Zwischen der Untat des Verbrechers und der von Ate erstrebten Sühne gibt es einen zeitlichen Abstand. DieserAbstanderöffnetdenSchauplatzeinesKonfliktszwischenRechtundMoral,zwischenVergeltung und Vergebung. Die Zeit selbst ist in diesem Streit parteiisch, denn während die
24 „Sie ist eine unselbständige Zeit“, heißt es dort weiter, „die auf die Zeit eines höheren, weniger natur haften Lebens parasitär angewiesen ist. Sie hat keine Gegenwart, denn schicksalhafte Momente gibt es nur in schlechten Romanen, und auch Vergangenheit und Zukunft kennt sie nur in eigentüm-lichen Abwandlungen.“ (II.1, 176)
25 Diese „magische“ Eigenschaft der Schuld hat auch eine materielle, eine leibliche Komponente. Sie findetsichimMal.InseinemmedienästhetischenFragmentÜber die Malerei oder Zeichen und Mal führt Benjamin aus: „Insofern der Zusammenhang von Schuld und Sühne ein zeitlich magischer ist, erscheint vorzüglich diese zeitliche Magie im Mal in dem Sinne, dass der Widerstand der Gegenwart zwischen Vergangenheit und Zukunft ausgeschaltet wird und diese auf magische Weise vereint über den Sünder hereinbrechen. Doch hat das Medium des Mals nicht allein diese zeitliche Bedeutung, sondern zugleich auch, wie es besonders im Erröten ganz erschütternd hervortritt, eine die Persön-lichkeitingewissemUrelementeauflösende.“(II.2,605;vgl.denKommentarvonJ.Butler,BeyondSeduction and Morality: Benjamin’s Early Aesthetics, in: The Life and Death of Images. Ethics and Aesthetics, hg. v. D. Costello u. D. Willsdon, Ithaca 2008)
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
736 Daniel Loick, Kontingente Konnektionen
Vergeltung ihr gegenüber gleichgültig ist, ist die Zeit das genuine Medium der Vergebung (oder, wie Werner Hamacher pointiert: „Zeit verzeiht“26). Wenn man der Zeit gegenüber nicht gleichgültig ist, kann es keine Rache mehr geben, sondern nur noch Vergebung, denn Rache ist nichts anderes als die Indifferenz gegen die Zeit, während Vergebung der Name für die Kontingenz der Konnektivität ist: Sie macht andere Verbindungen möglich. Dies ist wohlge-merkt nicht so zu verstehen, dass die Zeit der Vergebung deshalb wohlgesonnen ist, weil die Untaten mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Vergebung ist nicht Vergessen, sondern Erin-nern der Untat, das stellt Benjamin im nächsten Satz unmissverständlich klar: Die Zeit ver-hilft zur Vergebung der Untat „auf ganz geheimnisvolle Weise“ gerade „auch in ihrer Dauer“ (VI, 98). Die „einsame Windstille der Angst“ ist darum für Benjamin eine falsche Metapher, um den Aufschub zu bezeichnen, denn der Abstand zwischen Untat und Urteil ist nicht das Erlebnis einer unheilvollen Erwartung, des reuevollen Gewahrwerdens der eigenen Schuld in Antizipation des Richterspruchs, sondern, als göttliche, die Zeit der Entsühnung. Der Rhyth-mus des (mythischen) Rechts ist also Ungeduld und Gewalt, der Rhythmus der (göttlichen) Gerechtigkeit ist Geduld und Gewaltlosigkeit.27
Dem Gericht und der Strafe zieht also ein Sturm voraus (ein Motiv, das Benjamin 20 Jahre später in der berühmten neunten Geschichtsphilosophischen These, allerdings mit anderem Bedeutungskontext, wieder aufgreifen wird). Rhetorisch gesehen ist der Ausdruck eines „lau-ten Sturms der Vergebung“ eine Katachrese, denn während man Vergebung gemeinhin mit einem höchstpersönlichen, intimen und zaghaften Prozess assoziiert, ist ein Sturm allum-fassend, gewaltig und entschieden. Vergebung ist für Benjamin keine emotive Haltung einer Einzelnen zur Anderen, sondern eine universelle und universalisierende Zäsur.28 Dieser Sturm der Vergebung ist auch keine Gnade, denn er ist nicht individuell abwägend, sondern entsühnt ohne Ansehen der Person. Ebenfalls ist er keine Amnestie, keine staatlich-souveräne Ausnahme, die die Regel bestätigt, vielmehr entstammt er einer Ordnung, welche allen rechtlichen und staatlichen Gewalten gegenüber radikal heterogen ist. Dass dieser Sturm zugleich eine Hand sei, welche die Spuren der verbrecherischen Tat vertilgt, „auch wenn sie die Erde darum verwüsten müsste“, erinnert an den deontologischen Grundsatz fiat iustitia, pereat mundus. Er kann als dessen konsequenteste Verwirklichung angesehen werden, steht mit ihm aber auch in einer gewissen Spannung; denn ganz gemäß des kantianischen Programms, das die FolgenabwägungausdermoralischenReflexionganzverbannenwill,entsühntdieserSturmkategorisch und bedingungslos, ohne auf mögliche nachteilige Konsequenzen Rücksicht zu nehmen,dochenthälterandererseitskeinenImperativundversperrtsichseinerKodifizierungin Maximen und Rechtssatzungen.29
26 W. Hamacher, Schuldgeschichte. Benjamins Skizze ‚Kapitalismus als Religion‘, in: D. Baecker (Hg.), Kapitalismus als Religion, Berlin 2003, 119.
27 Vgl. als einen der wenigen ausführlichen Kommentare zu diesem Themenkomplex bei Benja-min A. Noor, Walter Benjamin: Time and Justice, in: Naharaim. Zeitschrift für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte, 1 (2007), hier insbes. 49.
28 Darin sprengt die Entsühnung auch das Äquivalenzprinzip, denn in der Vergebung steht die Rechts-folge in keinem Verhältnis mehr zur Tat. Viele Philosophen vor und nach Benjamin haben mit über-zeugenden Argumenten die Vorstellung von der geschichtlichen Invarianz des schuldrechtlichen Äquivalenzprinzips zurückgewiesen; vgl. etwa F. Nietzsche, Genealogie, a. a. O., 298 ff.; E. Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, Frankfurt/M. 1980, 276 ff.; M. Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M. 1976.
29 Exkurs: Eine besondere Herausforderung für jede Schuldkritik muss die historische Erfahrung der Shoah darstellen. Ist die Forderung nach kategorischer und bedingungsloser Entsühnung im Kontext des gigantischen Verbrechens gegen die Menschheit nicht genau die falsche, weil sie die
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
737DZPhil 60 (2012) 5
Benjamin wirft der „heidnischen“ Vorstellung vom Jüngsten Gericht vor, es verschließe sich ihr, „welche unermessliche Bedeutung jener ständig zurückgedrängte, von der Stunde jederUntatsounablässiginsZukünftigeflüchtend[e],derGerichtstaghat“(VI,98).DerTagdes Gerichts kommt nie, oder besser gesagt, er kommt nie an. Wie ist aber dann dieser „Auf-schub“ zu verstehen? Gibt es für diesen Aufschub ein Zeitlimit, ist er eine Frist, die ablaufen kann, eine buchstäbliche Galgenfrist? Ist die Tatsache, dass der Gerichtstag nie aufhört, ins Zukünftigezuflüchten,gleichbedeutenddamit,dassesihngarnichtgibt?WennalleTatenvor Eintreffen des Gerichts entsühnt werden, wozu ist es dann überhaupt noch nötig? Offen-bar ist die Entsühnung kein rechtlicher Akt, sondern einer, der dem Recht entgegengesetzt ist, sie entstammt einer ganz anderen Ordnung, die Benjamin die der Gerechtigkeit, der Moral oder Gottes nennt. Mit der Metapher des Sturms des Vergebung macht Benjamin zweierlei deutlich: Erstens ist die Kraft der Vergebung bereits wirksam, auch wenn die Macht des Gerichts noch intakt ist. Da Untat und Urteil niemals instantan sind, ist der Aufschub irre-duzibel und die Virulenz der Vergebung dem Rechtssatz immer schon eingeschrieben. Das Recht bleibt schon auf Grund der Zeitlichkeit des Daseins der Möglichkeit seiner eigenen Suspension ausgesetzt.30 Doch zweitens sind aus Benjamins Interventionen auch Schlussfolgerungen für das Ver-ständnis gebothafter Präskriptionen selbst zu ziehen und für die Art der rechtlichen und poli-tischen Institutionen, welche der Verknechtung der Menschen in Schuld und Schicksal entrin-nen wollen. In diesem Kontext sind zum genaueren Verständnis der Kategorie des Aufschubs auch einige Notizen hilfreich, die Gershom Scholem über die biblische Figur des Jona ange-fertigt hat, welche er Benjamin bereits 1918 vorgelesen hatte und die in vielerlei Hinsicht gro-
Schuldigen aus der Schuld entlässt, noch bevor diese sie überhaupt übernommen haben? Entschul-digt sie nicht die Täter und verhöhnt damit die Opfer? Vladimir Jankélévitch hat im Zuge der Debatte in Frankreich um die juristische Verjährung der Nazi-Verbrechen entschieden die Posi-tion von der nicht nur Unverjährbarkeit, sondern auch der Unverzeihbarkeit der Shoah vertreten: „Heute, wo die Sophisten uns das Vergessen empfehlen, werden wir nachdrücklich unser stummes und ohnmächtiges Entsetzen vor den Hunden des Hasses zum Ausdruck bringen; wir werden nach-drücklich an die Agonie der Deportierten ohne Bestattung und an die kleinen Kinder denken, die nicht zurückgekehrt sind. Denn diese Agonie wird dauern bis ans Ende aller Tage.“ (V. Jankélé-vitch, Verzeihen?, in: ders., Das Verzeihen. Essays zur Moral und Kulturphilosophie, Frankfurt/M. 2003, 282) Diese Position steht jedoch nicht in Opposition zu Benjamins Schuldkritik. Denn für Benjamin ist „Vergebung“ in diesem Zusammenhang keine Haltung der Absolution und der Par-donnierung, sondern nur der gewissermaßen formale Begriff für die Dissoziation des durch das abstrakte Recht prädisponierten Zusammenhangs von Tun und Ergehen. Erst durch diese Zäsur wird tatsächliche Erinnerung möglich, für die Benjamin in den Geschichtsphilosophischen Thesen den Begriff des Eingedenkens verwendet. Denn obwohl es freilich unerträglich gewesen wäre, die faschistischen Täter straffrei ausgehen zu lassen, befördert die in der künstlichen Konnektivität liegende Uniformierung und Formalisierung von Rechtsfolgen immer auch die Verdrängung und Delegation; die industrielle Vernichtung von Millionen Menschenleben unter einen justiziablen Begriff fassen zu wollen, bagatellisiert immer auch die Ausmaße des Verbrechens. Insofern war Auschwitz die negative Aufhebung der Schuld, denn die Shoah stellt ein Verbrechen dar, für das „niemand im Ernst die Verantwortung […] übernehmen kann“ (H. Arendt, Elemente und Ursprün-ge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus, München 2008, 135). Zur In-adäquatheit des Schuldbegriffs in Bezug auf die Shoah vgl. auch G. Agamben, Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge, Frankfurt/M. 2003; zur Kritik des Strafrechts in Bezug auf die Ahndung schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen vgl. D. Loick, Strafe muss nicht sein. Zur Kritik des Strafrechts auf nationaler und internationaler Ebene, in: Zeitschrift für Menschenrechte, 6 (2012), 30–43.
30 Vgl. W. Hamacher, Schuldgeschichte, a. a. O., 116 ff.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
738 Daniel Loick, Kontingente Konnektionen
ße Parallelen zu Benjamins Überlegungen aufweisen.31 Die Geschichte von Jona hat beson-dere Bedeutung für den jüdischen Versöhnungstag Yom Kippur, sie wird als Teil der Haftara im Mincha Gebet vorgelesen. Jona wird von Gott ausgesandt, um dem Sündenpfuhl Ninive die Vernichtung als göttliche Strafe zu verkünden. Nachdem Ninive daraufhin umkehrt und den Sünden entsagt, verzichtet Gott auf die Vollstreckung seines Urteils. Jona überkommt daraufhin eine tiefe Enttäuschung, seiner Ansicht nach macht sich Gott der Lüge schuldig, wenn er das einmal verkündete Urteil nicht vollzieht. Jona, so demonstriert Scholem, spricht hier vom Standpunkt des Rechts aus, das Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft synchroni-sierenwill:„DertiefeKonfliktdesBuchesJonaberuhtdarauf,dassJonadieProphetie,dasistempirisch gesehen Weissagung über die Zukunft, mit der Geschichtsschreibung, das ist Weis-sagungüberdieVergangenheit, identifiziert sehenwill.“32 Jona insistiert auf der Relevanz von Rechtssicherheit: Handlungen müssen Folgen haben, und zwar genau die Folgen, die vom Recht zuvor angekündigt worden waren. Gott hingegen spricht von einem Standpunkt aus, der den rechtlichen transzendiert: vom Standpunkt der Gerechtigkeit. Scholem nennt auch dieses Aussetzen der Vollstreckung einer Rechtsfolge einen Aufschub. Als „tiefste[n] Sinn alles Aufschubs“ bezeichnet er die Suspension der Exekutive: „In der Bekehrung wird das Recht überwunden und das Urteil nicht vollstreckt. […] Denn dies und nichts anderes bedeutet Gerechtigkeit im tiefsten Sinne: Dass zwar geurteilt werden darf, aber die Exekutive davon völlig unterschieden bleibt. Die eigentliche Beziehung des richterlichen Urteils auf die Exekutive, auf die eigentliche Rechtsordnung wird aufgehoben im Aufschub der Exeku-tive. Das tut Gott mit Ninive.“33 Diese „Vollstreckung einer Nichtvollstreckung“34 dient auch für Scholem zur Dissoziation von Tun und Ergehen. Scholem veranschaulicht die Pluralität der Handlungsoptionen in Anbetracht einer vollbrachten Unrechtstat am Beispiel der Armen: Über die Armen soll genauso geurteilt werden wie über die Reichen, aber das Urteil wird nicht vollstrecktundsozurWohltat(dashebräischeWortהקדצ,Zedaka,bedeutetsowohlGerech-tigkeit als auch Almosen).35 Das ist etwas anderes als das einfache Geltendmachen mildernder Umstände und darf auch nicht als Gnade oder souveräne Ausnahme missverstanden werden. Die Möglichkeit der Suspension der Exekutive unterminiert die Rechtssicherheit und expo-niert die Grundlosigkeit der in ihr konstruierten Kausalität. Dies hat eminente Auswirkungen auf die Form des Gebots selbst. Die Zeit, für Benjamin und Scholem die mächtige Verbündete der moralischen Welt, der Gerechtigkeit und Gottes, ist Kontingenzproduktion und damit
31 Die Idee des Aufschubs, schreibt Scholem in seinen Erinnerungen, hat Benjamin beeindruckt und seine eigenen Überlegungen zum Konzept der Gerechtigkeit inspiriert; vgl. G. Scholem, Walter Benjamin – Die Geschichte einer Freundschaft, Frankfurt/M. 1975, 180; zum Vergleich von Scho-lem und Benjamin und dem Zusammenhang von Zeit, Schuld und Rechtsordnung vgl. W. Hama-cher, Schuldgeschichte, a. a. O., 113 ff.
32 G. Scholem, Tagebücher nebst Aufsätzen und Entwürfen bis 1923, 2. Halbband: 1917–1923, Frankfurt/M. 2000, 526.
33 Ebd. – Die Bekehrung ist auch hier nicht die Voraussetzung für die Entsühnung. Gott belohnt nicht Ninive einfach für Reue oder Rechtschaffenheit. Nach Scholem dient die Umkehrung lediglich der besseren Isolierung des prophetischen Problems in der Darstellung: „Gerade diese mediumistische Klarheit macht es zur kristallenen Darstellung des prophetischen Problems. Die Bösen sind in die-sem Buch gleichsam eliminiert, Ninive bekehrt sich. Die autochthone Schwierigkeit ihres Problems ist ausgeschaltet, die Problemketten verwirren sich nicht.“ (Ebd., 525)
34 G. Scholem, Tagebücher, a. a. O., 341.35 Den Bezug zum Armen stellt auch Benjamin in Schicksal und Charakter her, indem er Goethe
(ebenso wie implizit wieder Paulus) gegen die metaleptische Verschuldungslogik des mythischen Rechts anführt: „Ihr lasst den Armen schuldig werden.“ (II.1, 175)
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
739DZPhil 60 (2012) 5
schon grammatikalisch gegen die Rechtsordnung und die in ihr repräsentierte Gewalt gerich-tet: „Wo das Gericht einen Spruch fällt“, schreibt Scholem, „erhebt die Gerechtigkeit eine Frage.“36 Und an anderer Stelle heißt es ebenso sloganhaft: „Die Gerechtigkeit eliminiert das Schicksal.“37 Dass sich Scholem (und Benjamin) jeder Antwort, das heißt jedem Spruch, jeder Setzung und jeder Satzung, verweigert, demarkiert seine (und Benjamins) Position von jeder polizeilichen Umsetzung des Rechts und noch mehr von der dezisionistischen Ausnahme vom Recht. Gerechtigkeit als Frage ruiniert die Gewissheit von der schicksalhaften Konnek-tivität von Tun und Ergehen insgesamt und revolutioniert somit die Struktur des rechtlichen Gebots und die seiner Umsetzung. Rechtssätze sind abschließend, determinierend, Schicksal diktierend, Fragen sind offen, unabgeschlossen – und sie ermöglichen Charakter. Sie erstatten den Menschen ihre Urteilskompetenz zurück. Dieser befreiende Aspekt der Entsühnung schlägt sich so wiederum in der Subjektivität nieder, besser gesagt: Die Befreiung erlöst die Menschen von ihrer rechtlichen Subjektivität. Wenn, wie Benjamin im gleichnamigen Text ausgeführt hatte, das Verhältnis von Schick-sal und Charakter dasjenige einer Opposition ist, dann liegt in der Unterbrechung der fata-len Dynamik des Rechts eine Chance für die Entstehung von Freiheit und somit von Glück. Benjamin sieht dies in Kulturerscheinungen wie dem literarischen Genre der Komödie und der Lehre der Physiognomie aufscheinen; beiden ist gemeinsam, dass sie Personen nicht in Hinblick auf ihr Wirken in einem übergeordneten Kausalzusammenhang, sondern allein in Hinblick auf den Charakter selbst beschreiben. Anders als im Recht interessieren das Publi-kum in der Komödie die Eigenschaften der Protagonisten nicht in einem moralischen Sinne, sondern nur in Hinblick auf die Erzeugung von Heiterkeit. Aus dem Gewebe der konventio-nellen Handlungsobligationen ist der komische Charakter damit in gewisser Weise heraus-gelöst; alles ist allein ausgerichtet auf die künstlerische Exposition einer charakteristischen Besonderheit der individuellen Figur. Benjamin sieht in dieser Ausstellung der Erhabenheit von Individualität und Besonderheit einen geschichtlichen Kontrapunkt zur Einwebung der Personen in das Netz von Schicksal und Schuld.38 Im puren Gefallen der Charaktereigen-
36 G. Scholem, Tagebücher, a. a. O., 526.37 Ebd., 529.38 Indem die Konnektivität von Tun und Ergehen einen künstlichen Sinnzusammenhang zwischen ge-
schichtlichen Ereignisabfolgen konstruiert, etabliert sie zugleich eine Kontinuität personaler Iden-titäten. Der Täter muss mit sich selbst gleich bleiben, um noch nach der Tat belangt zu werden, er muss sich die Schuld als seine Schuld zurechnen lassen (dies ist das Problem, das David Lynchs Film Lost Highway behandelt, in dem sich ein Gefangener in der Gefängniszelle über Nacht in einen anderen verwandelt). Diese „naive“ Vorstellung personaler Identität wurde von der poststruktura-listischen Subjektkritik mehrfach zurückgewiesen: Ich kann von mir nie vollständig Rechenschaft ablegen, da ich Teil einer diskursiven, sozialen, kulturellen und politischen Geschichte bin, deren Vergangenheit und Gegenwart mir nicht transparent sind (vgl. exemplarisch J. Butler, Kritik der ethischen Gewalt. Adorno-Vorlesungen 2002, Frankfurt/M. 2007). Dass das Recht den Subjekten abverlangt, Verantwortung für etwas zu übernehmen, das sie nicht zu verantworten haben, ist aller-dings nicht Benjamins Kritik. Insofern das Gebot als Maßstab des Urteils inkommensurabel ist, ent-sühnt der Sturm der Vergebung auch die Verantwortlichen. Würde Benjamin also einen Film drehen, so sähe er anders aus als der von Lynch – er wäre eine Komödie: „In ihrer Mitte steht, als Hauptper-son der Charakterkomödie, oft genug ein Mensch, wenn wir im Leben seinen Handlungen statt auf der Bühne ihm selber gegenüber stehen müssten, einen Schurken nennen würden. Auf der Bühne der Komödie aber gewinnen seine Handlungen nur dasjenige Interesse, das mit dem Lichte des Charakters auf sie fällt, und dieser ist in den klassischen Fällen der Gegenstand nicht moralischer Verurteilung sondern hoher Heiterkeit. Niemals an sich, niemals moralisch betreffen die Handlun-gen des komischen Helden sein Publikum; nur soweit sie das Licht des Charakters zurückwerfen, interessieren seine Taten.“ (II.1, 177) – Damit unterscheidet sich Benjamins Schuldkritik auch von
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
740 Daniel Loick, Kontingente Konnektionen
schaften, die keine neuen Kausalitätsbeziehungen mehr initiieren, liegt Freiheit: „Während das Schicksal die ungeheure Komplikation der verschuldeten Person, die Komplikation und Bindung ihrer Schuld aufrollt, gibt auf jene mythische Verknechtung der Person im Schuld-zusammenhang der Charakter die Antwort des Genius. Die Komplikation wird Einfachheit, das Fatum Freiheit. Denn der Charakter der komischen Person ist nicht der Popanz der Deter-ministen, er ist der Leuchter, unter dessen Strahl die Freiheit ihrer Taten sichtbar wird.“ (II.1, 178) Und weiter heißt es, noch immer in der Metaphorik des Lichts und der Helligkeit: „Die Vision des Charakters ist befreiend unter allen Formen […] Der Charakterzug ist also nicht der Knoten im Netz. Er ist die Sonne des Individuums am farblosen (anonymen) Himmel des Menschen, welche den Schatten der komischen Handlung wirft.“ (II.1, 178) Damit ist die Komödie der Tragödie entgegengesetzt. Obwohl die Tragödie zwar durch die Erkenntnis von der Überlegenheit der Menschen über die Götter zum historisch ersten Mal „das dämonische Schicksal durchbrochen“ (II.1, 174 f.)39 hat, bleibt ihr Held unmündig und stumm, an der Herauslösung des Charakters aus Schicksal und Verhängnis muss er darum noch scheitern. In der Komödie hingegen sind Schicksal und Charakter – mithin: Ergehen und Tun – streng voneinander getrennt. Sie vollendet so, was die Tragödie begonnen hat: die Emanzipation des Genius, des Charakters von seinem Schicksal. Eine ähnliche Gegen-überstellung lässt sich mit den Konzepten von Chiromantie und Physiognomie vornehmen40: Während die abergläubische Handlesekunst aus leiblichen Zügen den Charakter erkennen und somit das Schicksal vorhersagen zu können glaubt, so ist laut Benjamin in der nüchternen Phänomenologie der alten und mittelalterlichen Temperamentenlehre noch jedes moralische Werturteil über die Charaktereigenschaften getilgt. Benjamins Interventionen zur Kritik des abendländischen Schuldbegriffs lassen sich in einem bündigen Satz Gershom Scholems pointieren: „Die bedeutungslose Tat“, notiert Scho-lem, „ist die gerechte Tat.“41 Die philosophischen Konsequenzen dieser Schlussfolgerung las-sen sich kaum ermessen. Rechtstheoretisch bedeutet sie ein nicht von der Hand zu weisendes Wagnis: Indem das Prinzip der Rechtssicherheit aufgegeben und die individuelle Zurechnung strafbaren Verhaltens überwunden wird, entsteht die Gefahr nicht nur des Bedeutungsverlu-stes des Rechts, sondern und vielleicht noch schwerwiegender die der Wiederkehr der per-
im Kern deterministischen Positionen, seien sie soziologisch (vgl. exemplarisch G. Dux, Der Täter hinter dem Tun. Zur soziologischen Kritik der Schuld, Frankfurt/M. 1988) oder biologistisch (vgl. exemplarisch W. Singer, Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung, Frankfurt/M. 2003, hier insbesondere 34).
39 Die Passage heißt vollständig: „Nicht das Recht, sondern die Tragödie war es, in der das Haupt des Genius aus dem Nebel der Schuld sich zum ersten Male erhob, denn in der Tragödie wird das dämonische Schicksal durchbrochen. Nicht aber, indem die heidnisch unabsehbare Verkettung von Schuld und Sühne durch die Reinheit des entsühnten und mit dem reinen Gott versöhnten Menschen abgelöst würde. Sondern in der Tragödie besinnt sich der heidnische Mensch, dass er besser ist als seine Götter, aber diese Erkenntnis verschlägt ihm die Sprache, sie bleibt dumpf. Ohne sich zu bekennen sucht sie heimlich ihre Gewalt zu sammeln […] Es ist gar keine Rede davon, das die ,sitt-liche Weltordnung‘ wieder hergestellt werde, sondern es will der moralische Mensch noch stumm, noch unmündig – als solcher heißt er der Held – im Erbeben jener qualvollen Welt sich aufrichten. Das Paradoxon der Geburt des Genius in moralischer Sprachlosigkeit, moralischer Infantilität ist das Erhabene der Tragödie.“ (II.1, 174 f.) Benjamin zitiert diese Überlegungen noch einmal in seinem Trauerspielbuch (vgl. I.1., 288 f.).
40 Diese beiden philosophisch einigermaßen exzentrischen Motive Chiromantik und Physiognomie erwähnt Scholem auch in seinen Aufzeichnungen zu Jona, was als weiterer Beleg für die enge Kor-respondenz zwischen den beiden Freunden gelten muss; vgl. G. Scholem, Tagebücher, a. a. O., 336.
41 Ders., Tagebücher, a. a. O., 529
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
741DZPhil 60 (2012) 5
sönlichen Vergeltung in Form der Rache oder Selbstjustiz. Dies ist freilich die Problematik einer jeden anarchistischen oder messianischen Staatskritik. Denn die Entsühnung, welche den Verhängniszusammenhang von Schuld und Sühne zerreißt, darf nicht ihrerseits die Reak-tionen auf eine Unrechtstat prädisponieren, formalisieren oder uniformieren, darf die Band-breite der Konnektionsoptionen nicht im Vorhinein gewaltsam einschränken. Indem sie den Verschuldungsprozess sistiert und dadurch eine Form juridischer Gewalt überwindet, über-windet sie noch nicht jede Gewalt; rechtliche Vergebung ist noch nicht soziale Versöhnung.42 Alles was ihr bleibt, ist die Hoffnung, eine von der Aggressivität der Verschuldung befreite Gesellschaft könnte sukzessive auf andere Möglichkeiten der „gewaltlosen Übereinkunft“ (II.1, 197) zurückgreifen, der dem Leben inhärente Sachgehalt könnte alternative Mittel zur BewältigungvonKonfliktenfinden,sobaldernichtmehrvomrechtlichenZwangzurSchuld-zuweisung und Schuldabtragung irritiert wird. Dieser Gefahr des Rückfalls in individuelle Willkür entspricht auf der psychischen Ebene das Risiko, dass an die Stelle einer schuldba-sierten Subjektivität eine schambasierte treten könnte. Im Gegensatz zur Schuld ist die Scham durch eine unklare Verantwortlichkeit und das Fehlen einer individualisierten Zurechnung gekennzeichnet, was zu einer permanenten Angst vor dem Verlust öffentlicher Wertschätzung bei der Verletzung der äußeren Normenordnung oder der sozialen Harmonie führen kann. Auch was den Bereich der Subjektivität angeht, bedarf es also der Ausbildung rechtsjensei-tiger sittlicher Sphären und Anerkennungsmilieus, in welchen die Gesellschaftsmitglieder, um mit Adorno zu sprechen, „ohne Angst verschieden“43 sein können. Für diese Vision einer „solidarischen Menschheit“44 scheint die von Benjamin avisierte Entsühnung allerdings eine notwendige Voraussetzung zu sein, denn erst die Überwindung der durch ‚schlechtes Gewis-sen‘ und Strafbedürfnis geprägten strukturell paranoiden und autoritären Selbst-Verhältnisse werden neue und weniger gewaltbasierte Formen der intersubjektiven Bezugnahme denkbar und lebbar. Und schließlich berührt die Idee kontingenter Konnektionen die Geschichtsphilosophie insgesamt. Dem rechtlich instituierten und als Schicksal naturalisierten Zusammenhang von Tun und Ergehen entsprach die kosmologische Vorstellung einer sinnhaften und auch nor-mativ sinnvollen Kausalbeziehung von Ursache und Wirkung. Menschliche Freiheit liegt dieser Vorstellung zufolge darin, zur wirkenden Ursache einer Kausalität zu werden, in der Möglichkeit also, Effekte in der Welt zu zeitigen. Für Benjamin und Scholem ist nicht nur jede rechtliche, sondern auch jede geschichtsphilosophische Vorstellung eines mechanischen Zusammenhangs von Ursache und Wirkung Illusion.45 Dies ist auch der tiefere Sinn von Ben-jamins Polemik gegen die Historiker, die sich „die Abfolge von Begebenheiten durch die Finger laufen […] lassen wie einen Rosenkranz“ (I.1, 704). Was er in den Geschichtsphiloso-phischen Thesen als Jetztzeit bezeichnet, „in welcher Splitter der messianischen eingesprengt
42 So könnte man auch Benjamin verstehen, wenn er schreibt: „Was in diesem Bilde gesagt ist, muss sich klar und deutlich in Begriffen fassen lassen: die Bedeutung der Zeit in der moralischen Welt, in welcher sie nicht allein die Spuren der Untat auslöscht, sondern auch in ihrer Dauer – jenseits allen Gedenkens oder Vergessens – auf ganz geheimnisvolle Art zur Vergebung hilft, wenn auch nie zur Versöhnung.“ (VI, 98)
43 Th.W.Adorno,MinimaMoralia.ReflexionenausdembeschädigtenLeben,in:ders.,GesammelteSchriften, Bd. 4, Frankfurt/M. 1991, 66.
44 Ders., Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 14, Frankfurt/M. 1991, 73.
45 DieseFormdesMaterialismuslässtsich,instrukturellerAffinitätzumgleichnamigenProjektLouisAlthussers, vielleicht am besten als „aleatorischer Materialismus“ bezeichnen; vgl. L. Althusser, Materialismus der Begegnung, Berlin 2010.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49
742 Daniel Loick, Kontingente Konnektionen
sind“ (I.1, 704), impliziert keinen solchen mechanischen Kausalnexus mehr. Freiheit ist für ihn nicht mehr einfach nur, selbst von keiner Kausalität determiniert zu sein, sondern auch keine mehr anzustoßen. Hierin liegt der Unterschied zum Marxismus und auch zu allen ande-ren konventionellem Emanzipationsbewegungen: Hatten diese den Grund der Heteronomie darin gesehen, dass die unterdrückten Gruppen daran gehindert werden, ihren Willen gleich-berechtigt in Form von Handlungen zu aktualisieren, letztlich also in ihrer Unfähigkeit, ihre eigene Geschichte zu machen, so werden wir mit Benjamin die überraschende Möglichkeit in Betracht zu ziehen haben, dass Freiheit gerade darin besteht, dass unsere Handlungen endlich folgenlos werden.
Dr. Daniel Loick, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut für Philosophie, Grüneburg-platz 1, 60629 Frankfurt/M.
Abstract
This essay explores Walter Benjamin’s critique of the concept of guilt as it underlies the occidental notion of “connective justice”. It describes both the political-moral and the psychological-ethical effects of guilt and reconstructs Benjamin’s idea of ‘Entsühnung’, understood as a rigorous termination of the circle between act and consequence. Finally, possible political, ethical and historical alternatives are discussed.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/MainAngemeldet
Heruntergeladen am | 13.03.15 13:49