Knusper, Knusper, Knäuschen, Wer hat das schönste Häuschen? Die Hexe im Zauberspiegel...
Transcript of Knusper, Knusper, Knäuschen, Wer hat das schönste Häuschen? Die Hexe im Zauberspiegel...
1
W er hat das schönste Häuschen?
Knusper, Knusper, Knäuschen,
Die Hexe im Zauberspiegel fränkischer Kulturgeschichte
Schriftenreihe des Städtischen Museums Kitzingen Band 8
Herausgegeben von Stephanie Nomayo
Begleitband zur Sonderausstellung 2010 - 2011 im:Städtischen Museum Kitzingen, Fastnachtmuseum Kitzingen, Conditorei Museum Kitzingen, Vogelkundlichen Museum im Deusterturm, Museum Barockscheune Volkach.
2
Grußwort des Kitzinger Oberbürgermeisters Siegfried Müller 5Grußwort Christine Bender 7Vorwort der Herausgeberin 11
Es war einmal ein Hexenhaus ...
Stephanie Nomayo Von Wurtzkrämern und WaldhäuschenWie kommt das Hexenhaus unter den Weihnachtsbaum? 17
Walter Poganietz Wer die Holzmodel geschnitzt hat... 28
Lisa-Marie SchneiderDie Etymologie des Lebkuchens 31
Lisa-Marie SchneiderDie Geschichte des Lebkuchens 34
Helga KelberZur Geschichte des Papiertheaters und zur Entstehung der Märchenoper Hänsel und Gretel 39
Magie, Aberglaube und Hexenspuk
Stephanie NomayoSchwarze Seelenvögel in Franken 49
Robert EndresVon magischen Vögeln, Weisheitsboten und Unglücksbringern 53
Reinhard FeiselEin besonderes Nachtschattengewächs –das Bilsenkraut 59
Daniela SandnerVon den Hexen der Fastnacht 64
Hintergründe des Hexenwahns
Hans DrieselDu musst verstehn, aus eins mach´zehn… Hexen, kein Thema von vorgestern 75
Volker von Hoyningen-HueneHexenglauben im römischen Altertum und frühen Mittelalter 81
Volker von Hoyningen-HueneHexenglauben und Hexenverfolgung vom Mittelalter bis in die Neuzeit 83
Stephanie NomayoIn Kitzingen ging´s den Hexen gut 87
Stephanie NomayoDas Strafschwert Ehrenbergs: Güterkonfiskation 95
Inhaltsverzeichnis
3
Stephanie NomayoJohann Caspar Barthel – hätte er die Hinrichtung Maria Renatas verhindern können? 97
Hilarius TriftigMaria Renata Singer von Mossau – Auszüge aus dem Passionsspiel 99
Rainer WerthmannDas Mahnmal von Vardö 103
Naturenergien und Kräuterheilkunst Modernes Hexenwesen
Thomas SchneiderDas Hexeneinmaleins aus Goethes Faust 108
Thomas SchneiderHexentum heute 111
Thomas SchneiderDie Jahreskreisfeste der Hexen 123
Gabriela BrunschVier Hexen treffen sich in einer düsteren Höhle 131
Mark BrooksKünstlerportrait eines modernen Schamanen in Franken 135
Hexenjagd in der Gegenwart
Manfred RuppertWenn Gerüchte töten, Ausgrenzung und Vernichtung von Sündenböcken gestern und heute 139
Stefanie GlaschkeIst Cybermobbing eine moderne Form der Hexenverfolgung? 143
Stefanie GlaschkeDie Hexe in der Psychologie 147
Stefanie GlaschkeDie Angst vor dem Weibe 149
Stephanie NomayoNachbetrachtung 151
Mitmachen….
Stefan SchneidmadelStefans Hexenhäuschen – Backen oder Basteln 158
Bastelbogen 164Abbildungsnachweise 166Publikationen in der Schriftenreihe des Städtischen Museums Kitzingen 169Auflösung Hexeneinmaleins 170Das Städtische Museum Kitzingen 171
4
Abb.1 Hexenhäuschen der fränkischen Lebküchnerei Will, Kitzingen, anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender.
5
Grußwort des Oberbürgermeisters Siegfried Müller
Sehr geehrte Damen und Herren,
Turmhexen rütteln am Hexenhaus, Knusper Knusper Knäuschen, Wer hat das schönste Häuschen..., zurück in Kitzingen! So hieß es Anfang Februar 2011, als die erfolg-reiche Sonderausstellung an ihren Entstehungsort in die fastnachtsfröhliche Weinhandelsstadt Kitzingen, passend zur 5. Jahreszeit, zurückkehrte.
Die vom Städtischen Museum Kitzingen unter muse-umspädagogischen Aspekten entwickelte und kindgerecht aufbereitete Ausstellung war erstmals vom 27. Novem-ber 2010 bis 6. Januar 2011 im Museum Barockscheune Volkach gezeigt worden.
Im Februar 2011 kam es daraufhin in der Stadt Kitzingen, im Rahmen dieses Themas zu einer erstmaligen, Genera-tionen- und Museen übergreifenden Kooperation von vier Kitzinger Museen. Das Deutsche Fastnachtmuseum, das private Conditorei-Museum am Marktplatz und das Vo-gelkundliche Museum im Deusterturm schlossen sich zur Realisierung der Sonderausstellung mit dem Städtischen Museum Kitzingen zusammen. Unterstützt wurde das Pro-jekt zudem durch die Miniaturkunstbühne Papiertheater in der Kitzinger Grabkirchgasse. Das Hexenhaus und die Märchen, welche sich darum ranken, die in diesem Zu-sammenhang tradierten Vorstellungen im Volksaberglau-ben, die zugehörige Sitten und Bräuche, aber auch kul-turhistorische, sozialgeschichtliche und geschichtliche Hintergründe waren das Thema dieses museumspädago-gisch ausgerichteten Sonderausstellungsprojektes.
Die Idee zu diesem Ausstellungsthema stammte von der damaligen Bezirks- und heutigen stellvertretenden Lan-drätin, Christine Bender, der ich an dieser Stelle meine besondere Anerkennung und meinen Dank aussprechen möchte. Ausstellungskonzept und Realisierung wurden vom Arbeitskreis für Volkskunde und Brauchtumspflege des Städtischen Museums Kitzingen erarbeitet und um-gesetzt. Hierfür geht mein Dank an die Mitglieder der Gruppe: Lisa-Marie Schneider, Agnes Schneider, Thomas Schneider, Dr. Volker von Hoynigen-Huene, Helen von Hoyningen-Huene, Stefan Schneidmadel, Inge Sinn und Sylvia Gaiser, sowie an die damalige Praktikantin Marina Polikarpova.
Weiterhin danke ich den Leiterinnen und Leitern des Kit-zinger Fastnachtmuseums, Hans Driesel und der neuen
6
Leitung Daniela Sandner, sowie dem Leiter des Condi-torei-Museums Walter Poganietz und dem Leiter des Vo-gelkundlichen Museums, Robert Endres, für Ihre Koope-rationsbereitschaft und Ihre hervorragenden Beiträge zu diesem Gemeinschaftsprojekt.
Ein besonderer Dank geht auch an Helga Kelber und Gab-riele Brunsch, die mit dem Papiertheater einen weiteren wichtigen Beitrag zum Gelingen des Projektes beitrugen. Weiterer Dank geht auch an das Team der Märchenoper mit der rührigen Vorleserin Karin Böhm und ihrem beg-nadeten Pianisten Burkard Lutz. Weitere Höhepunkte wa-ren die Märchenstunde mit Anna Mebs, mehrere Hexen- und Kräuterseminare mit der Hexe Nenne alias Stefanie Glaschke und die szenische Lesung zum letzten fränki-schen Hexenprozess Maria Renata von und mit dem Autor Hilarius Triftig sowie das Hexenliteraturprojekt von und mit Hans Driesel und seinem Team. Nicht zuletzt danke ich der Leiterin des Städtischen Museums Kitzingen un-ter deren Federführung das Gesamtprojekt konzipiert und umgesetzt wurde.
Mein besonderer Dank aber geht an alle jene fleißigen klei-nen und großen Hobbybäcker, aber auch an die Backprofis und Meisterinnen für Dekoration und Tischschmuck, die diese Idee durch Ihren tatkräftigen Einsatz mit Leben füll-ten.
Als Oberbürgermeister der Stadt Kitzingen bin ich stolz darauf, dass es unseren vier Museen innerhalb eines Ge-meinschaftsprojektes gelungen ist, eine der dunkelsten Episoden unserer Landesgeschichte auf kindgerechte Wei-se, Generationen- und Kulturen übergreifend, aufzuberei-ten. Ich wünsche der hierbei entstandenen Dokumentation, dass sie als künftige Wanderausstellung noch an vielen Or-ten des Kitzinger Landes gezeigt werden kann. Der Kul-turstiftung des Bezirk Unterfranken aber danke ich für die Förderung des Projektes.
Abb.2 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender.
7
Grußwort Christine Bender – Initiatorin der Ausstellung
Sehr geehrte Damen und Herren,
war es unser Weihnachtsfest bei unserer Tochter in Norwe-gen, die vielen verschneiten und verstreut liegenden alten Holzhäuser, die mich inspirierten, oder die Erinnerung an die Vorweihnachtszeit mit meinen Kindern, als wir jedes Jahr zusammen ein Hexenhaus gebacken haben?
Ich weiß es nicht mehr so genau, mir war aber bewusst, Hexenhäuser, Brauchtum zum Backen, wäre ein spannen-des Thema für eine Ausstellung.
Jene Zeiten sind längst vorüber, wo es in den Häusern im-mer stiller wurde und nach Wachskerzen und Plätzchen
roch schrieb Dr. Reinhard Worschech, ehemaliger Be-zirksheimatpfleger, in seinem Buch über Fränkische Bräu-che zur Weihnachtszeit.
Damit sich diese Feststellung nicht fortsetzt, ist es mir ein Anliegen, fränkische Bräuche zur Weihnachtszeit und die Tradition des Backens in der Vorweihnachtszeit, wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Da liegt ja mehr als nur der Backduft in der Luft.
Mir ging es darum, öffentliche Räume mit einer Sonder-ausstellung zu beleben
Es bot sich auch an, die „Adventsstraße“ in Volkach mit dieser Ausstellung als weiterem Kulturangebot zu berei-chern.
Mit der Ausschreibung eines Wettbewerbs war es mir auch wichtig, Kindergärten, Schulen, Gemeinschaftseinrichtun-gen wie Altenheime und Privatpersonen zu motivieren und zum Mitmachen einzuladen.
Es ist gelungen, und darüber freue ich mich.
Mit dem Ausstellungsentwurf und dem Hexenhauswettbe-werb konnte ich zunächst Herrn Meyer und auch Herrn Bürgermeister Kornell überzeugen und begeistern.
Wobei, Herr Meyer war schon auch skeptisch und frag-te: Was machen Sie denn, wenn kein Hexenhaus kommt? Oder: Was machen wir, wenn hundert Häuschen kommen?
Lassen wir uns überraschen, war mein Leitspruch.
Bei einer Ausstellungseröffnung im Städtischen Museum in Kitzingen habe ich die Museumsleiterin, Frau Stepha-nie Nomayo, kennengelernt. Ihr habe ich von der geplan-ten Hexenhausausstellung erzählt. Frau Nomayo sagte zu, eine Ausstellung zu konzipieren und die Geschichte sowie Geschichten rund um das Hexenhaus, Hexen, Märchen und Wald aufzuarbeiten.
Unter der Leitung von Frau Nomayo gibt es im Museum in Kitzingen eine volkskundliche Arbeitsgruppe. Gemein-sam wurde in vielen Stunden die Entstehung der Ausstel-
8
Sylvia Gaiser, AK Volkskunde Städtisches Mu-seum Kitzingen
Dr. Volker von Hoynigen-Huene, AK Volkskun-de Städtisches Museum Kitzingen
Walter Poganietz, Leiter des Conditorei Muse-ums Kitzingen
Marina Polikarpova, Praktikantin Städtisches Museum Kitzingen
Agnes Schneider, AK Volkskunde Städtisches Museum Kitzingen
Lisa-Marie Schneider, AK Volkskunde Städti-sches Museum Kitzingen
Thomas Schneider, AK Volkskunde Städtisches Museum Kitzingen
Stefan Schneidmadel, AK Volkskunde Städti-sches Museum Kitzingen
Inge Sinn, AK Volkskunde Städtisches Museum Kitzingen
- der Presse für das Interesse an diesem Thema und der Berichterstattung in der Vorbereitungs-zeit.
Ein Angebot für Museumspädagogik war für uns selbst-verständlich. Christine Löffler, Kleinrheinfeld, Meisterin der Hauswirtschaft und Ernährungsfachfrau, hat mit den Kindern und Jugendlichen in der Grund- und Mädchenre-alschule gebacken.
Ob im Advent oder an Weihnachten, die richtige Stim-mung bringt der dekorierte Tisch, Henriette Dornberger, Wetzhausen, Deutschen Meisterin der Tafelideen, hat den Weihnachtstisch gestaltet.
Ganz besonders danke ich allen, die sich an der Ausstel-lung durch die Abgabe von Exponaten oder durch das Ba-cken eines Hexenhauses beteiligt haben. Ein großer Dank
lung begleitet, unterstützt und aufgebaut. Vom traditio-nellen Pfefferkuchenhaus über das moderne Hexenhaus, Schnittbögen, Bastelanleitungen, Backformen, Gewürze, Rezepte, Bräuche und Symbole wurden untersucht und vorbereitet. Auch den Ausstellungstitel Knusper, knusper, Knäuschen, wer hat das schönste Häuschen, verdanken wir der Arbeitsgruppe.
Die Realisierung der Ausstellung ist ein großes Gemein-schaftsprojekt. Viele waren beteiligt und haben mitgehol-fen, diese Idee zu verwirklichen.
Ich will dafür ganz herzlich Dank sagen:
- der Stadt Volkach, Herrn Bürgermeister Kor-nell, für die Bereitschaft und Unterstützung, Herrn Maiberger mit seinem Team in der Tou-ristinfo und auch dem Hausmeister und Mitar-beiter des Volkacher Bauhof waren beteiligt
- dem Vorsitzenden des Kulturvereins, Herrn Meyer, für die unermüdliche Hilfe und Betreu-ung der Ausstellung während der nächsten Wo-chen.
- dem Bezirk Unterfranken, insbesondere Herrn Professor Reder, für die Unterstützung und die Förderung der Ausstellung durch die Kulturstiftung. Wir freuen uns, wenn der Bezirk diese Ausstellung in die Reihe der Wanderaus-stellungen aufnimmt.
- der volkskundlichen Arbeitsgruppe des Städ-tischen Museums in Kitzingen, die in vielen Stunden sich auch selbst an diesem Thema be-geistert hat. Beteiligt waren:
Mark Brooks, Kunstfotograf Euerfeld
Hans Driesel, ehem. Leiter des Fastnachtsmuse-ums Kitzingen
Robert Endres, Leiter des Vogelkundlichen Mu-seums Kitzingen, im Deusterturm.
9
an die Leiterin des Städtischen Museums in Kitzingen, Stephanie Nomayo, für das Gesamtkonzept.
In sehr vielen Ländern gehören Pfefferkuchen-, Lebku-chen-, Knusper- oder Hexenhäuser zur weihnachtlichen Tradition. Die meisten deutschen Häuschen sind als He-xenhäuser mit Hänsel und Gretel bekannt, gebacken aus Honigkuchenteig und verziert mit Plätzchen und Na-schwerk. Lebkuchen, Pfefferkuchen, Gewürzkuchen oder Honigkuchen, auf fränkisch Labkuchen, sind ein Gebäck, das in Variationen vor allem in der Advents- und Weih-nachtszeit zubereitet wird. Labkuchen, Leckkuchen oder Lebenskuchen werden sie in süd- und westdeutschen Re-gionen genannt, in Teilen Bayerns auch Magenbrot; im östlichen Deutschland ist die Bezeichnung Pfefferkuchen zu hören.
Der Name Pfefferkuchen geht auf das Mittelalter zurück, als die exotischen Gewürze, die ein wesentlicher Bestand-teil des Gebäcks sind, ganz allgemein als Pfeffer bezeich-net wurden.
Allein schon bei dem Wort Lebkuchen steigen in der Nase die verschiedensten Wohlgerüche auf. Orientalische Ge-würze, wie Zimt, Nelken, Anis, Kardamom, Koriander, Ingwer, Muskat und Honig als Süßungsmittel, sind einige der Zutaten.
Verfeinert werden die Teige mit Mandeln, Nüssen, Oran-geat, Zitronat und Schokolade. Mehl wird nicht in allen Rezepten verwendet. Feine Lebkuchen werden ohne Mehl, nur mit Nüssen, Mandeln oder Ölsamen, gebacken. Potta-sche und Hirschhornsalz sind die Triebmittel für die Pfef-
Abb. 3 Eröffnung der Ausstellung in Volkach: Stellvertretende Landrätin Christine Bender, Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Klaus Reder, Leiterin des Städtischen Museums Kitzingen, Stephanie Nomayo. Foto: Rudi Bender.
10
ferkuchenteige, dadurch hat der rohe, noch ungebackene Teig einen bitteren Geschmack. Da für die Herstellung sel-tene Gewürze aus fernen Ländern benötigt wurden, haben vor allem Städte an bedeutenden Handelsknotenpunkten eine lange Lebkuchentradition Während in München die Lebkuchen mit Formen ausgestochen und mit buntem Zu-cker verziert wurden, dekorierte man die Nürnberger Leb-kuchen mit Mandeln und Zitronat. In Klosterbäckereien, wo man schon Hostien anfertigte, wurden die Lebkuchen auf Oblaten gebacken. Erste schriftliche Zeugnisse von kleinen gewürzten Honigkuchen entstanden um 350 v. Chr. Doch bereits die alten Ägypter haben honiggesüßte Kuchen gekannt, wie man aus Grabbeigaben weiß.
Bei den Römern wurde der Honig auf den Kuchen gestri-chen und mit gebacken. Anders als heute wurde der Leb-kuchen nicht nur zur Weihnachtszeit verzehrt, sondern zu Ostern oder starkem Bier serviert.
Na, das wäre doch auch einmal etwas.
Ein alter fränkischer Brauch sind Pfeffernüsse und Wein.Lassen Sie uns die Tradition der Lebkuchen und des He-xenhausbackens neu beleben und fortführen.
Diese Ausstellung Geschichte und Geschichten rund ums Hexenhaus soll dazu beitragen.
Herzlichen Dank.
Christine BenderStellvertretende Landrätin Landkreis Schweinfurt
Bezirksrätin des Bezirks Unterfranken 2008-2013
Abb. 4 Das Team um Christine Bender bei der Eröffnungsveranstaltung in Kitzingen 2011, Foto: Rudi Bender.
11
Vorwort von Stephanie Nomayo
Mit der Wahl des Projekttitels Knusper, knusper, Knäu-schen, wer hat das schönste Häuschen? werden ambiva-lente Assoziationen wachgerufen.
Im ersten Teil des Zitates werden Kindheitserinnerungen an das alte Märchen Hänsel und Gretel geweckt, mit wel-chem seit dem 19. Jahrhundert viele Generationen aufge-wachsen sind. Der im Originalzitat lautende Fragesatz Wer knuspert an meinem Häuschen?, der sich nun erwartungs-gemäß anschließen würde, ahndet sowohl eine verbotene Tat und zitiert im gleichen Moment das schmerzliche er-tappt werden. Assoziationen von Schuld und Betroffenheit lassen verdrängte Erlebnisse wach werden von unerlaub-ten Griffen in Zuckerdosen und Bonbongläser. Das sind Erfahrungen, die keinem Kind an der Schwelle des Erken-nens von mein und dein erspart bleiben!
Die Verfremdung des Spruches aber durch die Wendung Wer hat das schönste Häuschen? hebt den bösen Zauber auf. Nun wird nicht die unerlaubte Aneignung, sondern im Gegenteil der Besitz eines Knusperhäuschens vorausge-setzt! Der Aufruf zum fröhlichen Wettstreit lässt aufatmen und regt zum Mitmachen an.
Der kindgerechte Ausstellungsansatz des Projektes bietet den Vorteil, dass zunächst, quasi durchs Schlüsselloch des Hexenhauses, die märchenhaften Züge des Phänomens Hexe, so wie sie während der romantischen Verklärung im 19. Jahrhundert geprägt wurden, in den Vordergrund der Betrachtung gerückt werden. Während jene eng mit der Geschichte der Hexe verknüpften Schattenseiten zwar the-matisiert, aber dennoch pädagogisch behutsam aufbereitet werden können. Der damit verbundene Aspekt allgemein
ethischer Betrachtungen und Wertvorstellungen wie die Frage nach dem Umgang der Gesellschaft mit Fremden und Außenseitern, lassen sich dem Thema dadurch spiele-risch und zwanglos anschließen. Das Projekt selbst besteht hierbei aus vier wesentlichen Bausteinen:
1. Eine Dokumentation in Form von Textbahnen (1m x 2m) zu den Themenbereichen:
- Das Märchen Hänsel und Gretel und seine Verankerung im volkstümlichen Bewusst-sein.
- Die Geschichte des Lebkuchens.
- Die Hexe und die historischen Hintergrün-de ihrer Verfolgung.
- Die moderne Rezeption des Hexenwesens vor naturreligiösem und gesellschaftlichem Hintergrund.
2. Ausstellungsexponate, die exemplarisch die Inhalte der Dokumentation belegen. In diesem Zusammenhang wurden von der volkskundli-chen Arbeitsgruppe des Städtischen Museums entsprechende Realien, die vom traditionellen Pfefferkuchenhaus, über das moderne Hexen-haus, Bilderbücher mit Hexendarstellungen, Rezeptbücher, aber auch Hexenhäuschen in al-len Spielarten aus Keramik, Holz, in Form von Lebkuchendosen, Schnittbögen und Bastelan-leitungen bis hin zu Lebkuchenhäuschen-Au-tomaten eingeworben. Auch Backformen, Gewürze und Rezepte, Bräuche und Symbole wurden untersucht und innerhalb entsprechen-der Sequenz- und Objekttexte präsentiert.
12
3. Einem museumspädagogisch ausgerichteten Wettbewerb, bei welchem unter fachkundiger Anleitung in Schulen, Altenheimen und Kin-derbetreuungseinrichtungen Hexen- und Leb-kuchenhäuschen, Hexenmasken und volks-tümliche, bzw. märchenhafte Herbst- bzw. Winterdekorationen entstanden. Diese wurden im Rahmen der Ausstellung präsentiert und durch eine Jury prämiert.
4. Dem Projektprogramm, das aus einem kreati-ven Mitmachprogramm, aber auch aus einem klassischen Rahmenprogramm besteht. So blieb es auch in Kitzingen nicht aus, dass sich ein bunter Reigen an vielfältigen Workshops, Vorträgen, Theaterstücken, einer kleinen Oper und Themenführungen um das Hexenhäuschen gruppierten.
Der Programmverlauf in Kitzingen
Nach dem Start des Ausstellungsprojektes im Museum Barockscheune Volkach im November 2010, kehrte die Ausstellung im Februar 2011 an ihren Entstehungsort, nach Kitzingen, zurück. Mit im Gepäck waren neben den klassischen Ausstellungsexponaten auch unzählige He-xenhäuschen des in Volkach unter Regie von Frau Ben-der und Christine Löffler durchgeführten Lebkuchenhäus-chen-Backwettbewerbs.
In Kitzingen kam das Thema passend zur 5. Jahreszeit an. Es lag nahe, dass man versuchte mit dem Fastnachtmu-seum in Kooperation zu treten, gab es dort doch wunder-bare alemannische Masken, die man sich bereits für die Ausstellung in Volkach ausgeliehen hatte. Aber auch das Conditoreimuseum mit seinem Schatz an außergewöhn-lich schönen Lebkuchenmodeln und das Vogelkundliche Museum im Deusterturm mit seinen Hexenbegleitern, den Raben, Krähen Fledermäusen, Kröten und Salamandern waren geeignete Partner.
An dieser Stelle danke ich meinen Kitzinger Museumskol-legen Hans Driesel, Manfred Ruppert, Walter Poganietz, Robert Endres und seit Kurzem auch Daniela Sandner für die hervorragende Kooperation! Im Fasching war es natür-lich richtig, neben dem Hexenhaus die Hexe selbst noch etwas mehr in Erscheinung treten zu lassen. Unheilsdro-hende Rezitative skandierend, trieb daher ein Hexenchor um Karin Böhm in der Stadt sein Unwesen. Plötzlich war nichts mehr sicher vor dem Spuk der Kitzinger Hexen!
Am 12. Februar 2011 kam es zu einer Eröffnungssoirée im Städtischen Museum Kitzingen. Nach dem Einführungs-vortrag der Verf. entführte Frau Dr. Christiane Löffler ca. 120 Anwesende in die Welt der Hexen- und Zauberpflan-zen des Mittelalters. Im Anschluss konnte die Märchen-oper Hänsel und Gretel in der Miniatur-Kunst-Bühne in der Kitzinger Grabkirchgasse besucht werden. Helga Kel-
Abb. 5 Volkacher Hexenhäuschen auf dem Weg nach Kitzingen.
13
ber und Gabriele Brunsch boten hier Papiertheater vom Feinsten, frei nach der berühmten deutschen Kinderoper von Engelbert Humperdinck - als Singspiel für kleine und große Menschen. Im weiteren Rahmen des Mitmachpro-gramms bestand die Möglichkeit zur Teilnahme am schau-rig schönen Singspiel Hänsel und Gretel, Märchenträu-me mit Kinder- und Wiegenliedern im Theaterkeller des Deutschen Fastnachtmuseums, unter Mitwirkung des Pianisten Burkard Lutz und seinem Team hervorragender Kitzinger Sänger und Sängerinnen sowie einem Geschwa-der auf Besen reitender und böse Verse skandierender He-xen.
Einen weiteren Höhepunkt gab es im Rahmen einer The-menführung im Vogelkundlichen Museum im Deus-terturm, unter dem Motto Magische Vögel - Weisheits-boten und Unheilsbringer erzählte der Museumsleiter Robert Endres mythische und magische Geschichten von Vögeln, aber auch Fledermäusen, Kröten, Salamandern und anderem Getier. Nebenbei konnten die Besucher und Besucherinnen, darunter zweifelhafte Gestalten mit gro-ßen, krummen Nasen und riesigen schwarzen Hüten, den herrlichen nächtlichen Blick auf die Stadt Kitzingen ge-nießen.
Die Grundlagen im Umgang mit Naturenergien standen im Seminar der Hexe Nenne, alias Stefanie Glaschke, auf dem Programm. Die Teilnehmerinnen erfuhren im Rahmen dieses Workshops welcher Rituale sich moder-ne Hexen bedienen. In einer Autorinnenlesung referierte Stefanie Glaschke zu einem späteren Zeitpunkt über das Heilwissen, das Seelenwissen und das Liebeswissen der weisen Frauen.
Um die Entwicklung des Hexenbildes - Hintergrund, Ety-mologie, Aberglaube ging es im Vortrag, den Dr. Volker von Hoyningen-Huene am 20. Februar 2011 im Städti-schen Museum Kitzingen hielt. Hierbei erfuhren die An-wesenden, dass die europäische Kirche und Gesellschaft
nicht immer so begierig gewesen waren, Hexen zu jagen und diese für schlechte Ereignisse verantwortlich zu ma-chen. Der hl. Bonifatius erklärte im 8. Jahrhundert, dass der Glaube an Hexen unchristlich sei. Kaiser Karl der Gro-ße dekretierte, dass das Verbrennen vermuteter Hexen ein heidnischer Brauch sei und mit dem Tod bestraft werde. Im Jahre 820 wiesen der Bischof von Lyon und andere den Glauben zurück, dass Hexen schlechtes Wetter machen, bei Nacht fliegen und ihre Gestalt ändern könnten. Dieser Glaube wurde in das kanonische Recht aufgenommen und erst Jahrhunderte später aufgegeben, als die Hexenverfol-gungen zunahmen. In der Tat waren die Autoren des Mal-leus Maleficarum (Hexenhammer) gezwungen, eine Rein-terpretation des kanonischen Rechts zu fordern, um ihren Glauben, Hexerei sei real und finde statt, mit dem Kanon in Übereinstimmung zu bringen.
Unter dem Titel: Kitzinger Lebküchnerei - eine alte Tra-dition, führte der Museumsleiter Walter Poganietz durch sein privates Conditoreimuseum. Seine Zuhörer erfuhren Wissenswertes über die seit Generationen im Besitz sei-ner Familie befindliche Kitzinger Lebküchnerei (heutige Konditorei am Markt) aus dem Jahr 1722, sowie über die Geschichte der Herstellung und Kultur des Lebkuchens. Ein Höhepunkt war die Vorstellung historischer Kitzinger Lebkuchenformen, die in diesem traditionsreichen Gebäu-de vor einigen Jahren auf dem Dachboden entdeckt wor-den waren. Im Anschluss bestand Gelegenheit zum Ge-dankenaustausch mit dem Museumsleiter in den Räumen des im Hause sich befindenden Cafe Rösner.
Zum großen Vorleseabend am 19. März hatten sich ein zahlreiche Kinder und Erwachsene im Foyer des Museums eingefunden um am Vorleseseminar von Anna Mebs, Die dunkle Tochter, die helle Tochter, die goldene Spindel und der wundersame Brunnen, teilzunehmen. Phanta-sievoll gekleidet, auf einem mit Rosen gemustertem Tuch drapierten Sessel las Anna Mebs das altbekannte Märchen
14
von der Frau Holle in einer frauenverwandelten Version Die Königin, die goldene Spindel und der wundersame Brunnen von Angela Lorent. Da war dann zu hören, wie beide Töchter der Königin von ihrer Mutter eine Prüfung auferlegt bekamen. Welche von den beiden würde im Be-sitz der goldenen Spindel von dem wundersamen Brunnen heimkehren und sich dadurch als die geeignete Nachfolge-rin ihrer Mutter auf dem Königinnenthron erweisen?
Spannend wurde es für die ZuhörerInnen, wie dann eine jede von ihnen auf eine ihr gemäße, eigene Art, dieselben Aufgaben meisterte. Bei Frau Holle erfüllten beide ein ar-beitsreiches und doch lustvolles Jahr lang die ihnen ge-stellten bekannten Aufgaben. So wurden denn die beiden treuen Schwestern, die Sonnentochter und die Mondin-tochter, nach ihrer frohen Heimkehr von ihrer Mutter in die Königinnenwürde eingesetzt und sie lebten in großer Zufriedenheit und das Land gedieh wie niemals zuvor und niemals seitdem. Fragen zu der veränderten Version runde-ten die märchenhafte halbe Stunde ab und wurde ergänzt durch den Besuch der Ausstellung.
Samstag, 12. März 2011 spielten, tanzten und rezitierten Hans Driesel, Ingrid Klier, Claudia Müller und Wolfgang Klopf (Hans Sachs Gruppe Schweinfurt - Kleinkunstbüh-ne Schrotturmkeller) im Theaterkeller des Deutschen Fast-nachtsmuseums zum Thema Hexen-Litera-Tour. Es wurde ein nicht immer ernster Abend zu einem ernsten Thema.
Unter dem Motto: MARIA RENATA zuhören, nachdenken, mitfühlen, einsehen wurde am 25. März 2011 eine szeni-sche Lesung aus dem Passionsspiel Maria Renata von und mit dem Autor Hilarius Triftig im Historischen Theater-keller des Fastnachtmuseums geboten. Die Abschlussver-anstaltung am darauffolgenden Tag im Kitzinger Stadt-museum mit Vortrag und Nachbetrachtung zum Thema Hexenwahn in Franken bot allen Teilnehmern noch einmal im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Möglichkeit mit einander in Dialog zu treten.
All dies hatte für den Besucher den Vorteil, dass er erst-mals mit einem Kombiticket alle vier Kitzinger Museen inklusive der Eröffnungsdarbietung des Papiertheaters für nur 3.- € besuchen konnte. Das war eine gute Gelegenheit die vier Kitzinger Museen kennenzulernen!
Abb. 6 Das Kombiticket der Kitzinger Museen für das Hexenhäuschenprojekt Februar 2011.
16
Abb.7 Hexenhäuschen der russischen Hexe Baba Yaga auf Hühnerfüßen, gebacken von Stefan Schneidmadel anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender.
17
Von Wurtzkrämern und Waldhäuschen. Wie kommt das Hexenhaus unter den Weihnachts-baum?
von Stephanie Nomayo
Lebküchnerei in Kitzingen
Nürnberg wurde bereits im 14. Jahrhundert für seine Lebkuchen bekannt. Neben Ulm, Basel, Köln und
Augsburg entwickelte sich diese fränkische Stadt zu einer der bedeutendsten Produktionsstätten des Honigbäcker-handwerks. Begünstigt wurde die Entwicklung zum einen durch die Bienenzucht, die sogenannte Zeidlerei, welche in den Bienenstöcken des Nürnberger Reichswaldes von den umliegenden Klöstern betrieben wurde, andererseits durch die Gewürzstraße, die sogenannte Goldene Stra-ße, die einer vorgeschichtlichen Verbindung folgend1, im 14. Jahrhundert durch Kaiser Karl IV. ausgebaut, neben Zinn und Kupfer auch jene unzähligen, zunächst namen-losen und mit dem Sammelbegriff Pfeffer bezeichneten aromatischen Ingredienzien und Kräutlein von Prag über Nürnberg nach Frankfurt führte. Die ältesten Steinbrücken
Mitteleuropas, darunter die Würzburger, Frankfurter und Kitzinger Mainbrücke, bezeugen die historische Bedeu-tung dieser Fernverbindung als mitteleuropäische Haupt-handelsroute. Die Beziehungen zwischen Nürnberg und Kitzingen waren, abgesehen von der gemeinsamen güns-tigen Verkehrslage, im 15. Jahrhundert auf politischer Sei-te sehr eng. Zumal jene, seit der Verpfändung Kitzingens im Jahr 1443 als neue Kitzinger Stadtherren agierenden Markgrafen von Brandenburg gleichzeitig auch Burggra-fen von Nürnberg waren2. Es steht zu erwarten, dass sich unter diesem nachhaltigen Nürnberger Einfluss auch ent-sprechende Handwerkszweige in Kitzingen entwickelten. Und tatsächlich etabliert sich zu dieser Zeit, wohl geför-dert durch den Handel mit Zinn und im gegenseitigen Aus-tausch der Gesellen, das hohen Handwerk der Zinn-, oder Kandelgießer, zunächst in Etwashausen und dann in der Stadt Kitzingen. Inwieweit allerdings die Kitzinger Leb-küchnerei in diese Zeit zurückreicht, kann, wie bei vielen Phänomenen der Sozialgeschichte, nur vermutet werden. Die Tatsache, dass der erste in Kitzingen archivarisch er-wähnte Lebküchner, jener 1628 in der Topographia Kit-zingae Codomanni3 auf dem Kitzinger Marktplatz Haus Nr. 11 bezeugte Paul Gleßner, zusätzlich den Beruf eines Wurtzkrämers ausübte, zeigt, dass spätestens im ausgehen-den Mittelalter ein Kitzinger Zugriff auf jene begehrten Gewürze und seltenen Spezereien wie Anis, Kardamom, Muskat, Ingwer, Zimt, Nelken etc., die auf der aus Nürn-berg führenden Straße der Pfeffersäcke durch Kitzingen über die Mainbrücke befördert wurden, bestanden haben muss. Und, neben der Versorgung mit Gewürzen dürfte in Kitzingen noch eine weitere, notwendige Voraussetzung der Pfefferkuchen-Herstellung erfüllt worden sein - die Zeidlerei, d. h. die Gewinnung von Honig! Honig ist in gewisser Hinsicht ein Abfallprodukt! Und Honig fällt nur
18
da ab, wo Kirchen und vor allem Klöster Bienenstöcke be-treiben, um an die wertvolle Substanz Bienenwachs zu ge-langen. Es wird zur Herstellung von Kerzen für kirchliche Festivitäten permanent, und das bis heute, benötigt. Das traf mit Sicherheit auch auf das, seit Mitte des 8. Jahrhun-derts bezeugte und bis 1544 bestehende Kitzinger Bene-diktinerinnen Kloster zu. Seit 1722 wird die Handwerk-stradition der Kitzinger Lebküchnerei, auch Lebzelterei,
ein paar Häuser weiter, Richtung Marktturm, am Kitzinger Marktplatz 26 fortgesetzt. Gemäß einem Eintrag im Kit-zinger Steuerbuch4 ist in dieser Zeit Kilian Weißbeckh, ein Lebküchner, Eigentümer des bereits 1579 errichteten Hau-ses. Die Details der bewegten Geschichte dieser Kitzinger Lebküchnerei, Wachszieherei und bis heute bestehenden Konditorei erfährt man in den Obergeschoßen des dort von der Kitzinger Familie Poganietz untergebrachten Condito-rei Museums, in deren Besitz sich diese traditionsreiche Zuckerbäckerstätte seit 1893 befindet. Als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die beginnende industrielle Gewinnung von Zucker aus der heimischen Zuckerrübe zu einer dramatischen Verbilligung des ehedem sündteu-
Abb. 8 Der Kitzinger Marktplatz nach einer Zeichnung Georg Martins in der Topograph-ia Kitzingae Codomani3.
5 6 7 8 9 10 115 Georg Holzmann, Krämer6 Hans Machmet, Schuster7 dessen ander Haus 8 Philipp Pengel, Krämer 9 Wirthshaus zum Goldenen Hirschen Lorenz Zorn10 Konrad Botthof 11 Paul Gleßner, Wurtzkrämer und Lebküchner
19
eren Süßstoffes führt, begann der unaufhaltsame Abstieg der Honigbäcker. Es war die Geburtsstunde der modernen Konditorei. Traditionellen Honiggebäcken sagte man plötzlich nach, sie seien der Gesundheit abträglich und für den Magen schlecht. Dagegen standen die nun erschwing-lichen Zuckergebäcke in der Gunst der Bürger ganz oben.
Abb. 9 Conditorei Georg Friedrich Gebhard. Teilansicht auf einer Schützenscheibe von Andreas Schmiedel vom Mai 1865 der Kgl. Pri-vil. Schützengesellschaft von 1408 Kitzingen. Älteste bekannte Ansicht der ehemaligen Lebküchnerei/Conditorei im Haus Marktstr. 26, Firmenschild: „Fr. Gebhard“.
Viele Lebküchner passten sich den veränderten Verbrau-cherwünschen an, indem sie zusätzlich Zuckerbäckereien in ihr Sortiment aufnahmen. Die Söhne der alten Lebküch-ner aber erlernten meist das Konditorhandwerk. Diese Entwicklung vollzog sich auch im Hause Marktstrasse 26 in Kitzingen5.
20
Als Beispiele für die Hungerjahre 1813 und 1816/1818 in der Stadt Kitzingen finden sich in der permanenten Ausstellung des Städtischen Museum Kitzingen beschrifteter Ziegel aus dem Jahr 1818 und zwei sogenannte Hungerthaler:
Dachziegel aus einer Kitzinger Ziegelhütte, 1818
„Gott zu lib will ich alles leiten und wann es noch so bös gehen dudt / mein Schicksal das glach ich kein darum dhud mir keins helfen/
1818 Paulus Ki. zie h n“
Der Ziegel wurde beim Abbruch einer Scheune der Unteren Mühle in Repperndorf gefunden. Er dürfte in einer Kitzinger Ziegelhütte gebrannt worden sein und zeugt von der Enttäuschung der 1814 endgültig an Bayern gefallenen Kitzinger Bevölkerung. Sie hatte sich von der bayerischen Verfassung, die ihnen erst-mals Mitbestimmung bei der Gesetzgebung, Besteue-rung und Finanzverwaltung zusicherte, mehr erwar-tet. 1813 setzte in der Region bereits eine Hungersnot ein, die im August 1818 ihren Höhepunkt erreichte. Der Kitzinger Chronist Kleinschroth kommentiert die Situation mit folgenden Worten: Man lebt von der Freiheit. Und gerade dies macht, dass man mehr Geld braucht. Dieses Geld fehlte den Handwerkern, Gesel-len, Meistern, Tagelöhnern und Weinbauern, die seit 1813 mit Beginn der Hungerjahre oft mehrere Jahre
keine Einnahmen mehr hatten.
Abb. 10 Dachziegel aus einer Kitzinger Ziegelhütte bei Repperndorf, Bestand des Städtischen Museums Kitzingen. Foto: Michael Herbert.
21
Zwei so genannte Hungerthaler
Medaillen zum Andenken an die Teuerung 1818
Silber, Thomas Stettner, Münzgraveur
Nürnberg, Kitzingen, 1817
Diese Erinnerungsstücke sollten das Gedenken an die Hungersnot 1816/17 wach halten. Das Museum ver-fügte gemäß den Einträgen in den alten Inventarlisten wohl ursprünglich auch über drei Brötchen aus dem Hungerjahr 1818, die aber wohl aufgrund der konser-vatorischen Bedingungen im alten Museumsgebäude den Weg alles Zeitlichen gehen mussten. Es wird be-richtet, dass die Menschen in Kitzingen zu Zeiten der Hungerjahre versuchten, selbst aus Holzmehl noch
Brot zu backen.
Abb. 11 Zwei Hungerthaler 1818, Bestand des Städtischen Museums Kitzingen. Foto: Michael Herbert.
22
Theuerung und Not
Das Hexenhaus als Gegenent-wurf der Hungerjahre
Zelto ist der germanische Begriff für Fladen. Und damit jene, als Lebzelten bezeichneten Fladen nicht auseinander-laufen, hat man sie mit sogenannten Modeln, das sind aus Holz geschnittene Formen, in Form gebracht. Das Pfeffer-kuchenhaus ist solch eine aus gemodelten Fladen konst-ruierte Spielform der Lebzelterkunst9. Auch als Knusper-, oder Hexenhaus bekannt, dringt es erstmals nach dem Erscheinen des Märchens Hänsel und Gretel in der Mär-chensammlung der Gebrüder Grimm als Bildthema und Erzähltopos in das deutsche volkstümliche Bewusstsein. Die beiden Sprachwissenschaftler Wilhelm und Jacob Grimm veröffentlichen 1819 eine enzyklopädische Samm-lung von Märchen und Erzählungen. Unter fortschrittli-chem Ansatz suchen sie nach jenen ursprünglichen, gerne als „naiv“ bezeichneten Ausdrucksformen, die von den gesellschaftlichen Konventionen einer Zeit unmittelbar nach der Aufklärung möglichst unberührt geblieben zu sein scheinen. Die Themen und Formen dieses volkstümli-chen Vermächtnisses vermuten sie als universell und in al-len menschlichen Gesellschaften vorhanden. Speziell die durchaus vergleichbaren Eigenschaften und das Wirken von Hexen im weltweiten Überlieferungsschatz scheinen diesen Ansatz zu bestätigen.
Das Hexenhaus aber passt nicht in dieses Bild! Denn ent-weder hat es keinen Vorläufer in unserem volkstümlichen Vermächtnis, oder aber das Bild des Grimmschen Knus-perhäuschens war dermaßen beeindruckend, dass es eine
eventuelle, vormalige mündliche oder bildliche Tradition so wirkungsvoll überdeckte, dass sie sich bis heute nicht fassen lässt! Dabei kennt man durchaus Hexenhäuser in al-ler Welt, bis in die Südsee! Allerdings mit dem Unterschied, dass diese, erinnert sei nur an das russische Hexenhaus der Baba Yaga, furchterregende und wenig verlockende Be-hausungen darstellen, während das romantische, deutsche Knusperhäuschen einem Schlaraffenlandidyll entsprungen zu sein scheint. Als rettende Zuflucht im tiefen Wald, aber auch als wohlige Behausung, die Sicherheit und Wärme
Abb. 12 Ein charakteristisches Hexenhäuschen gebacken von Stefan Schneidmadel anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender.
23
spendet, avanciert es im Märchen Hänsel und Gretel zum prominentesten Motiv des Grimmschen Märchenschatzes.
Vergleicht man die sozialen Hintergründe der Entste-hungszeit der Märchensammlung mit jenen nachweislich älteren, der Geschichte von Hänsel und Gretel zugrunde liegenden Erzählmotiven wie der zitierten Hungersnot, der mehrfachen Kindesaussetzung durch das Einwirken einer bösen Stiefmutter und die letztlich erfolgende Hexenver-brennung als Befreiung der tapferen, aber schwachen Op-fer6, so werden zwei Eigenheiten des Märchens und damit auch des merkwürdigen Waldhäuschens, deutlich: Zum einen scheint das Lebkuchenhaus ungeachtet des Fehlens jeglicher greifbaren Überlieferung, eine vermeintlich „alte Tradition“ zu beschwören. Es wird als „typisch deutsch“ etabliert und entwickelt sich in seiner Ausprägung als Lebkuchenhaus zu einem Anknüpfungspunkt für eine Wiederbelebung ältester Relikte des Aberglaubens, aber auch für erneuertes Brauchtum bis heute. Andererseits aber verrät sich in der Abfassung der oben genannten, be-sonders grausamen Erzählmotive, die einer Überlieferung spätestens des 17. Jahrhunderts und damit einer tatsächlich alten Erzählschicht entstammen7, die historische fassba-re Katastrophe, vor deren Hintergrund sich das Märchen zwischen 1812 und 1843 in verschiedenen Auflagen ent-wickelt. Es liegt die Vermutung nahe, dass das Hexenhäus-chen seinen Siegeszug in die deutschen Stuben und damit in unser volkstümliches Bewusstsein einer allgemeinen Geistesströmung verdankt, die für diese, von Restauration und Nachkriegszeit geprägte Zeit charakterisierend wer-den sollte, dem Biedermeier.
Das Lebkuchenhaus ist geradezu Sinnbild einer Kultivie-rung des Häuslichen und vor allem bietet es die Möglich-
keit zu wohltuender, romantischer Realitätsflucht vor der Kälte der Industrialisierung und den zunehmenden sozi-alen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Arbeitslo-sigkeit und Inflation. Einen Hinweis auf die sozialen Hin-tergründe der Zeit in der sich das Märchen zwischen der ersten und 5. Auflage entwickelt, gibt folgende Passage:
Vor einem Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern [...] er hatte so wenig zu beißen und zu brechen, und einmal als gro-ße Theuerung ins Land kam, konnte er auch das täg-lich Brot nicht mehr schaffen8 .
In späteren Ausgaben, so in einer Reihe der Göttinger Bü-cher Grimms Märchen, 1950, heißt es sogar im Fall der zweiten Kindesaussetzung:
Nicht lange danach kam abermals eine große Theu-erung.
Nimmt man diese Hinweise wörtlich, so kann das nur be-deuten, dass hier auf die Hungerjahre angespielt wird, die um 1812 und zwischen 1815/1818 im ganzen deutschspra-chigen Raum, bis in die Schweiz nachweisbar sind. Auch in der Stadt Kitzingen, die wir hier als naheliegendes Bei-spiel anführen, gibt es entsprechende Nachweise. Hunger-katastrophen in Zusammenhang mit Krankheiten betrafen die Kitzinger Bevölkerung besonders zu Kriegszeiten durch die damit zusammenhängenden Truppendurchzüge und Einquartierungen. So geschehen im Dreißigjährigen Krieg, dann wieder zur Zeit der Napoleonischen Kriege, besonders hart ab 1813, als zu diesen Belastungen noch mehre aufeinander folgende Regenjahre die Ernte vernich-teten.
24
Wie kommt das Hexenhaus unter den Weihnachtsbaum?
Das Märchen spielt weder zu Weihnachten noch im Win-ter. Lebkuchen wurden und werden auch aufgrund ihrer Haltbarkeit zwar gerne als Wintergebäck hergestellt, aber das kann nicht die einzige Erklärung sein, warum das zu-ckersüße Waldhäuschen im Volksbrauchtum neben den ebenfalls im Verlaufe des 19. Jahrhunderts in die weih-nachtliche Stube verbrachten Weihnachts- oder Christ-baum versetzt wird.
Die Schlüsselszene des Märchens, Hänsel und Gretel, als sie von der Hexe beim Naschen am Lebkuchenhaus er-tappt werden, wird von Wilhelm Grimm in einem seiner wenigen Kommentare selbst vorgegeben. Sie etabliert sich als festes Darstellungsmodell. Weiterhin wurde von den Illustratoren auch ein Hexenstereotyp in der Physiog-nomie beachtet, selbst wenn die Hexen unterschiedlichen Ständen angehören können, unter der einfachen Prämis-se: Hässliches Äußeres lässt auf innere Bosheit schlie-ßen. Allerdings waren für die Illustratoren der Grimm-schen Märchen althergebrachte Darstellungstraditionen des Volksaberglaubens, wie Hexenflug, die Hexe als Verführerin, Hexensabbat, und sei es nur in der Form eines an die Hauswand gelehnten Reisigbesens, nicht verwendbar.
Heute tritt uns das Hexenhaus in vielgestaltigen Formen und in jüngster Zeit versehen mit immer außergewöhnli-cherer Ausstattung entgegen. Der Phantasie werden keine Grenzen mehr gesetzt – Besen, Raben, Kröten, Fleder-mäuse, Katzen – die Grimmsche Vorlage ist längst zuver-lässig überholt. Vielleicht aber liegt hierin die Ursache zur
Dass aber der wörtliche Hinweis auf die Theuerung erst 1843 und damit sehr spät in die Fassung der Grimm-schen Märchen aufgenommen wird, ist nicht weiter verwunderlich! Vermutlich wird der Begriff erst im Rückblick verwendet, vor dem Hintergrund eines ab 1840 erneut, aufgrund von Wirtschaftskrisen, Importproblemen und auch aufgrund von Auswanderung beginnenden Pauperismus, der bis in die Zeit um 1860 andauern sollte. In der Entstehungszeit des Märchens aber, zwischen 1812 und 1819 hatte man wohl zunächst keinen Begriff für die neue, durch den Verfall des Geldwertes geprägte Situation – Heute würden wir es Inflation nennen.
Wie dankbar wird man vor dem Hintergrund solch kata-strophaler Umstände den eigenen Eltern sein, wenn sie nicht zum letzten Mittel der Kindesaussetzung greifen, um sich des bettelnden Nachwuchses zu entledigen! Wenn sie darauf achten, dass die eigenen Kinder, sobald sie den Schutzraum des elterlichen Hauses verlassen, die vorge-gebenen Pfade einhalten, damit sie sich nicht einem absei-tig drohenden, manchmal sogar verlockend unberechen-baren Schicksal und damit Menschenfressern und Hexen ausgeliefert finden! Und was für ein Traum ist das, wenn dann ein Haus aus Brot, mit Fenstern aus Zucker – und, das ist der Gipfel – gedeckt mit Kuchen, damit sind teuer gewürzte Lebkuchen gemeint, vor das geistige Auge tre-ten! Eine für Kinder sicher halluzinogen wirkende Vor-stellung, zumal wenn es in der eigenen Wirklichkeit nicht einmal genug Brot gegen den schlimmsten Hunger gibt! Die Erfindung des Lebkuchenhauses als Gegenentwurf und Schlaraffenlandidyll zu den im 19. Jahrhundert aktu-ellen Hungerjahren war wohl die eigentliche Leistung der Grimms in Bezug auf das Märchen Hänsel und Gretel, das zu einem der populärsten Märchen im deutschsprachigen Raum überhaupt werden sollte.
25
alljährlichen Wiederkehr des Hexenhäuschens an Weih-nachten?
Denn es stellt sich die Frage, ob nicht das Thema Hexen-haus in der Volkskunst seit dem 19. Jahrhundert gerade deswegen so gerne adaptiert wird, weil sich daran die viel-schichtigen Ebenen eines latent vorhandenen, teils alther-gebrachten Aberglaubens noch einmal, wenn auch unter geänderten Vorzeichen durchspielen lassen. Vielleicht so-gar, weil es immer weiteren Gesellschaftskreisen mit zu-nehmendem Wohlstand möglich wurde, sich genau diesen Gegenentwurf zum Hunger, als kindlichen Traum in die gute Stube zu holen. Garniert mit dem wohligen Schauer, der sich hinter der Gestalt der Hexe, die man mit einset-zender Aufklärung überwunden glaubt, von selbst ergibt?
Zu dieser Koketterie gehört auch, dass man hierbei mit Relikten des Aberglaubens spielt, vergessend, dass diese eigentlich zu den tieferen Wurzeln einer sehr alten Traditi-on gehören. Mit diesem Grimmschen Märchen wurde eine Erzähltradition etabliert, die aus zwei bedenklichen und grausamen Überlieferungen des 17. Jahrhunderts, nämlich den Charles Perraultschen Kunstmärchen Brüderchen und Schwesterchen als auch dem Däumling extrapoliert wur-de. Das Motiv der Hexenverbrennung als verdiente Strafe überdauert diese Politur, genauso wie das Motiv der Kin-derfresserei, das vermeintlichen Hexen, aber auch anderen gesellschaftlichen Randgruppen immer wieder unterstellt wurde!
Anmerkungen:
1. Es handelt sich um die 839 erstmals erwähnte via publica, die spätere Poststraße, die von Brüs-sel über Frankfurt nach Nürnberg und weiter von dort nach Prag führte. Diese alte Straße, wohl eine fränkische Reichsstraße, mündete aus Würzburg ankommend, gemäß Codomans Topographie 1628 beim Spazerthor in Kitzingen. Da das Spazerthor bereits im 15. Jh. erbaut und dort auch das Geleit an Würzburg übergeben wurde, dürfte auch der Straßenverlauf im 15. Jh. dort bestanden haben. In älteren Zeiten aber mündete diese alte Fernverbin-dung offenbar als „Alte Poststraße“ nach einem längeren Hohlweg über dem Spital in Kitzingen! Das ergibt sich aus einem Hinweis bei Codoman (s. Anm. 3): „Der Narrenturm, so sehr alten und gleichen Baues mit dem Spacerturm, hat das Tor gehabt, dadurch man nach Würzburg über den Eselsberg gefahren, so man zugemauert, und das Narrenhaus der Enden gemacht.“ Heute ist die Bundesstraße 8 weitestgehend identisch mit dem Verlauf dieser alten Fernverbindung. s. dazu auch: W. Frobenius, Altkitzingens Straßen, Am fränki-schen Herd, Kitzingen 8. und 15. November 1931; Wilhelm Funk, Zur Entwicklungsgeschichte der Stadt Kitzingen am Main, Hissiger, Kitzingen am Main 1951.
2. Belege dieser historischen Verbindung finden sich im Kitzinger Stadtarchiv bereits für das Jahr 1408 in einem Schiedsspruch Friedrichs II., Burggraf von Nürnberg, der zur Zeiten der Kitzinger Äb-tissin Sophia Freiherrin von Hohenberg die beste-henden Streitpunkte zwischen Stadt und Kloster – darunter den Neubau des klösterlichen Kaufhau-ses an jener Stelle, wo heute das alte Rathaus steht
26
– regelt. (Stadtarchiv Kitzingen U 105, 1408, Alte Urkundennummer 23, gebunden in Band I 322, Nr. 13). Weitere Urkunden, so z. B. die Beurkun-dung des Leibgedings der Pfalzgräfin Margaretha bei Rhein und Herzogin von Bayern belegen die direkte Verbindung zu Nürnberg durch die neuen Stadtherren, der „Markgrafen von Brandenburg und Burggrafen von Nürnberg“ (Stadtarchiv Kit-zingen U 53 1449 Alte Urkundennummer 113a, gebunden in Band I 320, Nr. 2); Einen interessan-ten Hinweis zum Status der Untertanen der Nürn-berger Burggrafen findet sich weiterhin in einer Urkunde aus dem Jahr 1521. Hier bestätigt Kaiser Karl der V. den beiden Markgrafen von Branden-burg Casimir und Georg in ihrer Eigenschaft als Burggrafen von Nürnberg den Freiheitsbrief von Kaiser Karl IV. aus dem Jahre 1363, wonach kein weltlicher oder geistlicher Untertan der Burggra-fen von Nürnberg vor ein fremdes Gericht geladen werden darf. (Stadtarchiv Kitzingen, U 29 1521 Alte Urkundennummer 207, gebunden in Band I 315, Nr. 48);
3. Gemeint ist jene in mehreren Manuskripten erhal-tene Lagebeschreibung Kitzingens, die sogenann-te Topographia Kitzingae de anno 1628, angefer-tigt vom damaligen evangelischen Stadtpfarrer Salomon Codoman. Sie beinhaltet ein Verzeichnis „der Stöck und Gebauen“ Kitzingens. Zur Ergän-zung wurde von Dekan Codoman der Maler Ge-org Martin beauftragt mit der Anfertigung einer detailgetreuen Ansicht der „Fürstlich Branden-burgischen Hauptstatt Kitzingen am Mainstrom Im Land der Franken“, deren Kopie aus dem 18. Jahrhundert noch heute im Städtischen Museum Kitzingen zu sehen ist. Für den Hinweis auf den Lebküchner Paul Gleßner dankt die Verfasserin Herrn Heinz Vetter, Kitzingen.
4. Stadtarchiv Kitzingen ST 56 (1722 – 25) fol 2;
5. Die Ausführungen zur Entwicklung des Lebküch-ner- und Konditorenhandwerks in der Marktstra-ße 26 verdanke ich Herrn Walter Poganietz. Seit 1893 ist das Gebäude im Besitz seiner Familie. Das Kitzinger Conditorei Museum wurde von ihm persönlich in den Obergeschoßen eingerichtet und trägt erheblich zur Attraktivität des Kitzinger Marktplatzes bei.
6. Folgenden Hinweis verdankt die Verfasserin den Recherchen von Herrn Dr. Volker von Hoynin-gen-Huene: Das Märchen ist als AaTh 327a im Aarne-Thompson-Index verzeichnet. Es hat eine klare Parallele in Charles Perraults Märchen „Der kleine Däumling“, das zahlreiche Einzelheiten der Erzählung enthält (arme Eltern, Hungernot, Aus-setzen im Wald), jedoch als Bösewicht einen Oger (später im Deutschen auch Riese oder Menschen-fresser) enthält. Die Forschung scheint sich einig zu sein, dass „Hänsel und Gretel“ aus dem „Klei-nen Däumling“ als Vorläufer hervorgegangen ist, da Perraults Märchen seit dem ersten Erscheinen 1697 weite Verbreitung fanden. Bei dem Däum-lingsmotiv deutet die ethnografische Forschung darauf hin, dass es sich um einen sehr alten, auf allen drei Kontinenten der alten Welt verbreiteten Märchentyp handelt. Variationen sind von West-afrika über Nubien und den Nahen Osten, Persien und Indien bis hin nach Japan dokumentiert. Der Aspekt einer Hexe in einem Brothaus im Wald tritt hingegen nur bei den Gebrüdern Grimm auf. Wie es zu einer Vermischung des Däumlingsmärchens mit einer Hexengeschichte kommen konnte, ist nicht eruierbar. Es wird in der Literatur diskutiert, dass die deutschen Zuhörer dieser Geschichten mit einem Oger nicht viel anfangen konnten.
27
7. Die Gebrüder Grimm haben die 1697 von Charles Perrault herausgegeben Märchen gekannt und zum Teil adaptiert. Auf den kleinen Däumling aber sollen Sie verzichtet haben, so die gängige Märchenforschung, weil die Parallelen zu Hänsel und Gretel zu deutlich waren. (s. auch: J. Bolte und G. Polivka: Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Bd. 1, Leipzig 1913, S. 115).
8. Kinder und Haus-Märchen der Brüder Grimm, 5. Auflage 1843.
9. Für Hinweise zur Geschichte und Etymologie des Lebkuchens danke ich Lisa-Marie Schneider aus Willanzheim, Mitglied der Volkskundlichen Ar-beitsgruppe des Kitzinger Stadtmuseums.
Tipp für Museumsbe-sucher und Liebha-
ber des Themas: Ein Glanzlicht der Ausstellung des Kitzinger Conditorei Museums auf dem Marktplatz 26 (Ein-gang durch das Café Rösner) ist ein Konvolut großformatiger geschnitzter Lebkuchenmodel aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert, das sich 1981 auf dem Dachboden des Gebäudes fand. Es belegt anschaulich, dass Lebkuchen- aber auch die Mo-
delherstellung in Kitzingen Tradition hatte.
Weitere Lebkuchenmodel, sowie eine als Wander-ausstellung verfügbare Dokumentation zum The-ma Hexenhäuschen bietet das Städtische Museum
Kitzingen, Landwehrstraße 23.
Hexenmasken, darunter Alemannische Sonder-formen wie die, von Daniela Sandner (S. 64) vorgestellten Flecklas-, Pfannenschlecker-, oder Lauinger Hexen, können im Kitzinger Fastnacht-
museum, Luitpoldstraße 4, besichtigt werden.
Die magischen Vögel wie Eule, Kauz und Krähe, aber auch Kröten, Fledermäuse und Reptilien als Hexenbegleiter können im Kitzinger Vogelkund-lichen Museum im Deusterturm, am Hindenbur-
gring Nord, ins Visier genommen werden.
28
Wer die Holzmodel geschnitzt hat …
von Walter Poganietz
Unser Museumsbestand umfasst eine große Anzahl Holzmodel, unter denen sich wahre Spitzenstücke von hohem künstlerischem Rang befinden. Bis auf die Wachsmodel in Vitrine 2 stammen alle aus dem Hause selbst. Ich habe sie 1981 zusammen mit den anderen Beständen oben auf dem Dachboden unseres Hauses (Marktstrasse 26 in Kitzingen) entdeckt. Die Holztafeln standen aufrecht in mehreren Kisten, dick überzogen mit Holzmehl und Staub. Sie wurden seinerzeit am Bayerischen Nationalmuseum in München fachgerecht gereinigt und wo nötig gefestigt.
Bei Führungen werde ich immer wieder gefragt, wer diese Formen wohl geschaffen hat. War es der Konditor selbst, oder gab es andere Spezialisten bzw. Künstler, die sich mit der Herstellung solcher Model befassten, oder waren alle Genannten daran beteiligt. Für Letzeres spricht, dass zwischen den einzelnen Model jedenfalls große qualitative Unterschiede festzustellen sind. Hauptsächlich waren es fahrende Modelstecher, die mit ihrem Handwerksgerät von Ort zu Ort zogen und im Hause des Meisters für einige Zeit wohnten und auf Bestellung arbeiteten. Ihre Vorlagen waren Mode-Journale, Kupferstiche, Fürstenporträts, Genrebilder u.ä. Sie standen bei ihren Auftraggebern, den Konditoren und Lebküchnern im hohen Ansehen. So war es Ihnen erlaubt, am Tische traditionell zur Rechten des Meisters zu sitzen. Oft hatten diese berufsmäßigen Modelstecher auch fertige Ware im Gepäck. Wir haben z.B. einen prächtigen Reitermodel aus dem Jahre 1797, bei dem in der linken oberen Ecke der Preis, nämlich f 4
Abb. 13 Großer Lebkuchen-Model, 18.Jh. 42 x 27 cm. Motiv: Zwei Doppelköpfige Reichsadler im Blätterkranz. Großer Lebkuchen für offizielle Anlässe und Feiertage (Kaiser’s Geburtstag). Herkunft: Kitzingen aus der ehemaligen Lebkuchen=Backherey Haus Nr. 2 (heute Marktstr. 26) Slg. Po-ganietz Inv.Nr. A.05.067.
29
= 4 Gulden, eingraviert ist. Übrigens für damalige Zeiten ein horrend hoher Betrag! Der eingekerbte Preis könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass der Modelstecher seine Ware auf einer Verkaufsveranstaltung, z.B. der Frankfurter Messe, angeboten hatte.Oft fertigten die Modelstecher von einem einzigen Motiv eine ganze Serie in verschiedenen Größen. In Kitzingen hat der Schreiner Jonaß Gulden um 1600 Holzmodel hergestellt. Sein Verlassenschaftsinventar von 1612 enthält neben Schneidwerkzeug auch vier alte Gerbmödel, drei Streichmödel und neun Mödel, da man daß Pappier darauff truckht. Im späten 18. Jahrhundert ist in Kitzingen der berufsmäßige Formschneider und Knopfmacher Johann Ignatz Schlecht nachgewiesen (Julius Schwarz).Auch die Lebküchner und Konditoren selbst versuchten sich im Modelstechen, schon allein deshalb, weil früher die Fertigung eines Model als Gesellenstück vorgeschrieben war. Einzelne erlangten dabei hohe Meisterschaft, wie der Regensburger Lebzelter Timotheus Prunner, dessen prächtige Rundmodel aus dem 17. Jahrhundert sich im Bestand des Germanischen Museums in Nürnberg befinden. Andere Handwerker brachten kaum Durchschnittliches zustande. Welcher Lebküchner oder Konditor in unserem Hause selbst Model hergestellt hat, ist unbekannt. Allerdings habe ich auf dem Dachboden auch Schnitzwerkzeuge, Malvorlagen, unbearbeitete Holztafeln, sowie Tafeln mit unvollendeten Schnitzereien gefunden. Das sind genug Beweise dafür, dass in diesem Hause Model gestochen wurden.Unsere Holzmodel stammen hauptsächlich aus der 2. Hälfte des 18. und den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Es ist ganz auffallend, dass gerade in dieser Zeit besonders schöne und prächtige Exemplare entstanden sind. Es gibt dafür viele Gründe. Einer erscheint mir sehr naheliegend: In dieser Epoche vollzogen sich als Auswirkung der Französischen Revolution auch in Franken große Abb. 14 Großer Lebkuchen-Model, um 1810, 58 x 22 cm, Motiv:
Dame mit Täschchen und Federhut.Herkunft: Kitzingen aus der ehemaligen Lebkuchen=Backherey Haus Nr. 2 (heute Marktstr. 26), Slg. Poganietz Inv.Nr. A.05.008.
30
Je nach dem künftigen Verwendungszweck wurden sie tief oder flach geschnitten. Die tiefgeschnittenen Lebkuchenmodel sind auch noch mit ca 0,5 cm hohen Rändern ausgestattet, um den zähen Honigteig in die richtige Form zu bringen. Unsere Modeltafeln sind alle längs zur Faser geschnitten.
Literatur:
Julius Schwarz, Bäcker, Lebküchner und Konditoren – Zur Kulturgeschichte des Backgewerbes. Erschienen in der Reihe Land und Leute, Veröffentlichungen zur Volks-kunde. Hg Wolfgang Brückner. Echter Würzburg 1988.
soziale Veränderungen. Als Folge davon wurden viele begabte Kunsthandwerker, die vormals ihr Brot bei den Feudalherren verdienten, arbeitslos, zumindest aber gingen die Einkünfte zurück. Sie waren deshalb gezwungen, ihre Kunst auch anderweitig anzubieten, um sich so ein Zubrot zu verdienen. Es liegt nahe, dass einige dieser begabten Künstler sich u. a. auch mit der Herstellung von Holzmodeln befassten. Es waren hauptsächlich Holzschnitzer, aber auch Goldschmiede, Medailleure und Kupferstecher. Aus diesem Kreis stammen offensichtlich die Spitzen-stücke. Leider sind nur wenige unserer Model mit den Initialen des Modelstechers ausgestattet. Folgende Initialen sind auf unseren Model zu finden: IFL, IA, GK, JA, ILS, FS, M. Bis heute ist es mir nicht gelungen, die dazu gehörigen Namen ausfindig zu machen. Lediglich die Initiale IFL habe ich auch auf einen Model des Historischen Museums Wertheim entdeckt. Beide Model sind von ähnlicher Qualität und könnten vom selben Künstler stammen. Übrigens hat nicht selten der Konditor seine eigenen Initialen quasi als Handelsmarke in die Figur einar-beiten lassen, oder mittels einer solchen Kartusche außerhalb des Bildes sein Eigentum gekennzeichnet. Viele unserer Model tragen die Kartusche GK. Es könnte sich um die Initialen des Konditors Georg Kühnert handeln, der von 1863-1876 im Hause tätig war. Die Model sind aber viel älter.
Die Modelstecher verwendeten hauptsächlich Birnen- und Apfelholz für Ihre Arbeiten. Diese weichen Obst-hölzer waren hervorragend für die Herausarbeitung der feinen und feinsten Strukturen geeignet. Trotz-dem waren sie robust genug, den beruflichen Bean-spruchungen, wie Druck, Schlag und Feuchtigkeit, standzuhalten. Allerdings sind diese Hölzer besonders anfällig für Holzwurmbefall. Abb. 15 Hexenhäuschen von Philippe Gala für den Backwettbewerb
anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender.
31
Die Etymologie des Lebkuchensvon Lisa-Marie Schneider
Warum heißt der Lebkuchen eigentlich Lebkuchen? Generationen haben diese Frage bereits gestellt und ebenso viele wussten keine Antwort darauf. Auch heu-te gibt es auf diese Frage keine eindeutige und zufrie-denstellende Antwort, zu groß und zu vielfältig sind
die Möglichkeiten.
Lebkuchen als Kuchen des Lebens
Dass der Namensteil Leb von Leben kommt, wird heu-te noch immer, vor allem auf Kinderfragen, geantwortet. Diese These gilt mittlerweile jedoch, trotz ihrer vermeint-lichen Nähe, als überholt. Weder sind diese Kuchen leben-dig, noch verlängern oder verbessern sie es auf irgendeine Art und Weise.
In der rotwelschen Diebessprache bezeichnet man Brot übrigens unter anderem als Lehem, Leem1 Legum oder Le-chum2. Vielleicht sah man ja in Aussehen und Struktur der Honigkuchen Parallelen.
Der Kuchen in Laibform
Bei dieser Theorie geht man, dass sich der Name Lebku-chen von dessen Form ableitet, also ursprünglich ein laib-förmiges Gebäck gewesen sei. Aus dem Laib wurde im Laufe der Zeit Leb und auch die Formvielfalt der Lebku-chen nahm zu.3
Das süße Gebäck
Eine weitere Theorie besagt einen Zusammenhang mit dem mitteldeutschen Begriff lebbe, der übersetzt so viel wie süß bedeutet (siehe auch den Abschnitt zu Leb-Ho-nig). Das lebbe soll sich hierbei auf den süßen Geschmack und den Honig als solchen, der eine der Hauptzutaten bil-det, beziehen.4 Zudem werden Lebkuchen vor dem Backen gerne mit Rosinen und süßen Mandeln verziert und nach dem Erkalten mit Zuckerguss oder Kuvertüre glasiert.
Die Honigsorte als Namensgeber
Diesen Ansatzpunkt findet man in einer der wichtigsten wissenschaftlichen Quellen im deutschsprachigen Raum. Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft5 nannte J.G. Krünitz sein zwischen 1773 und 1858 in 242 Bänden er-schienenes Werk. In ihm findet sich in Band 25 ein soge-nannter Leb-Honig. Besagter Honig soll demnach für die aus ihm gebackenen Kuchen namensgebend gewesen sein. Woher der Honig selbst seinen Namen hat, ist Krünitz selbst unsicher. Er gibt als mögliche Ursprünge laben für dick und fett machen bzw. werden, was sich auf den Nähr-wertgehalt beziehen dürfte, leb bzw. lebbe als mundartli-che Bezeichnungen für süß oder Laib, da Leb-Honig einen im Vergleich zu anderen Sorten dickeren, festeren Honig mit gröberen Strukturen sei.6
Abb. 16 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender.
32
Der Autor verweist zudem auf eine weitere Quelle namens Frisch hin. Dieser leitet die Bezeichnung von laben ab, sofern es mit dem lateinischen reficere im Sinne von wie-derherstellen, reparieren gleichzusetzen ist.
Eine weitere Quelle leitet den Namen des Leb-Honigs vom altnordischen lyf ab, einer Bezeichnung für belebende Arznei und laben, aber auch Zaubermittel und Heilmittel.7
In Anbetracht dessen, dass Vorformen des Lebkuchens Göttern geopfert wurden8 und Honig seit jeher als Heil-mittel Verwendung findet, erscheint dieser Ursprung zu-mindest plausibel.
Außer diesen vier Herleitungen gibt es noch weitere The-orien, darunter Ansätze wie lipa, die slawische Bezeich-nung für Linde oder lipiec für feinsten Honig9, doch bis heute konnte noch keine eindeutige Herkunft des Lebku-chenbegriffs gefunden werden.
Anmerkungen:
1. Vgl.: Girtler, Roland: Rotwelsch. Die alte Sprache der Gauner, Dirnen und Vagabunden. Wien/Köln/Weimar 1998, S. 174.
2. Vgl.: Wolf, Siegmund A.: Wörterbuch des Rotwel-schen. Deutsche Gaunersprache. Mannheim 1956, S. 195.
3. Vgl.: Lerner, Franz: Blüten, Nektar, Bienenfleiß. Die Geschichte des Honigs. München 1984, S. 126.
4. Vgl.: Krünitz-Artikel zu Leb-Honig.
5. Vgl.: Onlineversion der Enzyklopädie [URL: http://www.kruenitz1.uni-trier.de/]
6. Vgl.: Krünitz: Leb-Honig.[URL: http://kruenitz1.uni-trier.de/cgi-bin/getKRSearchText.tcl?sexp=leb-honig+mode=0+start=0+loc=+from=+til=+sa=0]
7. Vgl.: Angret: Dem Kult und der Gesundheit die-nend… Merkwürdiges aus der langen Geschichte des Lebkuchen. In: Der Imkerfreund, Heft 11, 1966. S. 394.
8. Vgl.: Nietsch, Erich: Wer backte die ersten „Printen“ oder „Lebkuchen“ – die Wiener oder die Nürnber-ger? In: Bienenwelt. Das Fachblatt für den zeitgemä-ßen Imker, Nr. 12, Dezember 1999, S. 28.
9. Vgl.: Estermann, Max: Der Lebkuchen hat Tradition. In: Schweizerische Bienen-Zeitung. Monatsschrift des Vereins deutschschweizerischer und rätoromani-scher Bienenfreunde, Nr. 1, Januar 2000, S. 708.
10. Vgl.: Mette, Gretel: Dem Kult und der Gesundheit dienend. Merkwürdiges aus der langen Geschichte der Lebkuchen. In: Nordwestdeutsche Imkerzeitung. Organ der Imker-Landesverbände Hannover und Weser-Ems und des Deutschen Berufsimkerbundes. 17. Jg., Nr. 1, Jan. 1965, S. 209.
Abb. 17 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender.
33
Literaturverzeichnis und Internetquellen
Angret: Dem Kult und der Gesundheit dienend… Merkwürdiges aus der langen Geschichte des Lebkuchen. In: Der Imkerfreund, Heft 11, 1966. S. 393-394.
Estermann, Max: Der Lebkuchen hat Tradition. In: Schweizerische Bienen-Zeitung. Monatsschrift des Vereins deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde, Nr. 1, Januar 2000, S. 708-710.
Girtler, Roland: Rotwelsch. Die alte Sprache der Gauner, Dirnen und Vagabunden. Wien/Köln/Weimar 1998.
Lerner, Franz: Blüten, Nektar, Bienenfleiß. Die Geschichte des Ho-nigs. München 1984.
Krünitz, J.G.: Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines Sys-tem der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft. (Online-Version) [URL: http://www.kruenitz1.uni-trier.de/]
Mette, Gretel: Dem Kult und der Gesundheit dienend. Merkwürdi-ges aus der langen Geschichte der Lebkuchen. In: Nordwestdeut-sche Imkerzeitung. Organ der Imker-Landesverbände Hannover und Weser-Ems und des Deutschen Berufsimkerbundes. 17. Jg., Nr. 1, Jan. 1965, S. 209.
Nietsch, Erich: Wer backte die ersten Printen oder Lebkuchen – die Wiener oder die Nürnberger? In: Bienenwelt. Das Fachblatt für den zeitgemäßen Imker, Nr. 12, Dezember 1999, S. 28-31.
Wolf, Siegmund A.: Wörterbuch des Rotwelschen. Deutsche Gaun-ersprache. Mannheim 1956.
Abb. 18 Prunkhexenhäuschen von Stefan Schneidmadel für die Ausstellung in Kitzingen 2011. Foto: Museum.
34
Geschichte des Leb-kuchens
von Lisa-Marie Schneider
Was ein Lebkuchen ist und wie er aussieht, dürfte, trotz seiner vielen Variationen, jedem Kind geläufig sein. Aber was genau macht einen Lebkuchen aus und wo sind seine Ursprünge? Nicht nur in Lebkuchen
kommen Honig und Gewürze vor.
Was ist zum Beispiel mit einem Gewürzkuchen (Ulmer)? Diese Kuchenart wird ebenfalls mit allerlei weihnachtlich anmutenden Gewürzen (Zimt, Nelken, Pfeffer, Ingwer, Muskat, Anis, Vanille, Kardamom) und bisweilen Mal so-gar mit etwas Honig verfeinert. Nach dem Backen glasiert man ihn mit Zucker- oder Schokoladenguss und schneidet ihn in eckige Stücke. Ist so etwas nicht auch als eine Spiel-art des Lebkuchens zu betrachten?
Bereits im alten Ägypten, etwa um 1500 v. Chr., waren Honigkuchen bekannt, wobei sie dort meist den Pharao-nen und Göttern als Opfer vorenthalten waren. Sogar im Jenseits wollte so mancher Herrscher nicht auf das Gebäck verzichten und lies sie sich mit auf die letzte Reise in die Grabkammer geben. Die Herstellung dieser Kuchen ist uns durch bildliche Wanddarstellungen überliefert, genauso, wie die unterschiedlichen Formen, in die der Teig gebracht wurde. Es wurden nicht nur Laibe gebacken, man findet auch Kuhformen und Spiralen abgebildet. Inwieweit hier-bei schon Gewürze zum Einsatz kamen lässt sich nicht mit
Gewissheit sagen, jedoch sollen bisweilen größere Liefe-rungen Kassia-Zimt zu den Tempeln transportiert worden sein. Es liegt also durchaus im Möglichen dass dieser bei der Honigkuchenproduktion verwendet wurde.
Im antiken Griechenland hingegen, gab es die Honigku-chen auch für das gemeine Volk. Seeleute nahmen sie auf ihre Fahrten mit, Soldaten zogen mit ihnen in den Krieg und sie wurden den Göttern geopfert.12
Auch im heidnischen Deutschland gingen aus einem ur-sprünglich aus Hirse, Milch und Honig zusammengesetz-ten süßen Brei Opferbrote in Gestalt von Gottheiten und göttlichen Symbolen hervor, deren Hauptzutaten Mehl, Honig, Milch und Eier waren.3 Die ursprünglichen Opfer-gebäcke wurden um die Wintersonnenwende herum herge-stellt und waren als ein Abbild des Wintergottes geformt. Heute gibt es solche Gebäcke noch in Form sogenannter Stutenkerle, auch Grittibänz genannt, das sind kleine He-feteiggebilde. Männer mit Bart und einer Pfeife im Mund.Im Zuge der Christianisierung wurde die bärtige Gottheit zu einem Bischof namens Nikolaus, da er sich aufgrund der zeitlichen Nähe seines Gedenktages ein passender Er-satz war.
Später wurden diese Rezepte in mittelalterlichen Klöstern übernommen und verbessert. Man sieht das heute noch gut anhand der süddeutschen bzw. österreichischen Bezeich-nung des Lebkuchens. Dort werden sie nämlich Lebzelten geheißen. Zelte leitet sich von dem germanischen Wort zel-to ab und bedeutet Fladen.4 Die ältesten bekannten Back-modelle eines Lebkuchenähnlichen Gebäcks wurden aller-dings in einem mesopotamischen Königspalast entdeckt. Die über 40 Exemplare mit prachtvollen Darstellungen wie Tieren, Jagdszenen, Göttern und Herrschern stammen aus der Zeit um 2000 v.Chr., also etwa 500 Jahre früher als oben genannte ägyptische Variante.5
35
Allerdings wäre es verfehlt zu behaupten, die Mesopota-mier hätten den Lebkuchen bzw. Honigkuchen erfunden, denn niemand vermag mit Gewissheit zu sagen, wann wer wie und warum er das erste Mal in Erscheinung trat. Man kann zwar sagen, die ersten Darstellungen, schriftlichen Aufzeichnungen oder Formen finden sich da und dort, doch niemand kann mit Bestimmtheit sagen, dass es die-ses Gedankengut nicht schon zuvor irgendwo anders gab. Wer weiß wie lange zuvor solche Rezepte schon gebacken wurden, sich aber nur noch keine Gelegenheit ergab sie schriftlich oder bildlich festzuhalten, vielleicht sah man auch keine Notwendigkeit darin. Jedenfalls dürften die Wurzeln des Honigkuchens irgendwo in dem Zeitraum an-zusiedeln sein, als der Mensch erste Versuche betrieb zer-kleinerte Körner mit Wasser zu einem Teig anzurühren um daraus Fladen zu backen.
Doch zurück ins Mittelalter. Dass Klöster als eine Wie-ge des Lebkuchens, wie wir ihn heute kennen, gesehen werden können hängt mit deren Geschichte zusammen. Viele Klöster der damaligen Zeit hielten sich eigene Bie-nenschwärme um der Wachsproduktion für die im Got-tesdienst benötigten nachzukommen. Als Nebenprodukt fiel Honig an. Da man stets darauf bedacht war, möglichst viel aus einer Sache rauszuholen und ja keine Dinge zu verschwenden, suchte man nach Verwendungszwecken für den Bienenhonig, also sozusagen eine Recyclingmög-lichkeit.6 Eine Lösung war, ihn zum Backen von kleinen Kuchen zu verwenden. Der Honig gab dem Gebäck Ge-schmack und machte ihn haltbar. Besonders häufig wurden Lebkuchen an Wallfahrtsorten bzw. – Routen produziert, da Pilger sie gerne als Wegzehrung mitnahmen. Aufgrund des geringen Feuchtigkeitsgehaltes waren sie ideal für lan-ge Reisen, da sie nicht so leicht verdarben und noch dazu recht nahrhaft waren. Auch dienten sie manch einem auch als Beweis, tatsächlich die Wallfahrt vollendet zu haben. Es gab sogenannte Einsiedlerscheiben, das waren große runde Lebkuchen, die in Modeln gedrückt wurden und da-
nach auf ihrer Oberfläche das Relief der jeweiligen Wall-fahrtskirche zeigten und als beliebtes Mitbringsel dienten.7
Selbst heute noch kaufen sich Besucher von Jahrmärkten Lebkuchenherzen mit Sprüchen darauf, um ein Souvenir für zuhause zu haben.
War der Lebkuchen zunächst an keine bestimmte Jah-resabschnitt gebunden8, so zeigte sich bald eine gewisse Tendenz zur kalten Jahreszeit und heute wird er fast aus-schließlich in der Advents- und Weihnachtszeit genossen, selbst wenn manche Läden meinen, sie müssten uns glau-ben machen, dass die beste Gelegenheit zum Lebkuchen-kauf das Ende der Sommerferien ist.
Die mittelfränkische Großstadt Nürnberg wird seit jeher mit der Produktion weltbekannter Lebkuchen verbunden. Dass Nürnberg zu einer der bedeutendsten Produktions-stäten wurde, war maßgeblich von zwei Dingen bedingt:
Zum einen brachten die nahen Handelsstraßen allerhand exotische Gewürze in die Stadt, zum anderen lieferte der umgebende Reichswald große Mengen an Honig.9 Bereits im 14. Jh. war die fränkische Stadt für ihre Lebküchnerei-en berühmt, doch eine eigene Zunft genehmigte man ihnen erst im Jahre 1643. Damals stellten 14 Lebküchnermeis-ter den Grundstock der Zunft dar. Sie alle mussten sich strengstens an die 1645 erschienene Lebküchner-Ordnung und deren Vorgaben halten.10
Außer Nürnberg gab und gibt es noch andere Städte, die diese Gebäcke produzierten z.B. Ulm, Basel, Köln und Augsburg. Diese Metropolen haben die notwendige Ge-meinsamkeit, dass sie sich in örtlicher Nähe zu Handels-straßen befanden, was für die aromatischen Ingredienzien unverzichtbar war.
Einige Forscher sehen die handwerklichen Lebküchner- und Lebzeltereien als jünger als die häuslichen und klös-terlichen Lebkuchenproduktionen an. In vielen Familien
36
gibt es Lebkuchenrezepte (Geheimrezepte) die seit Gene-rationen von der Mutter auf die Tochter überliefert wurden und jedes Jahr aufs Neue in der gleichen Weise gebacken werden. 11
Im Gegensatz dazu ist es sehr schwer, an die alten Meis-terrezepte zu kommen. Diese wurden nämlich meist so gut gehütet, dass sie von den Lebküchnermeistern mit ins Grab genommen wurden. Einer der Gründe hierfür war, dass viele der Meister der Meinung waren, dass es für die Zubereitung eines schmackhaften Lebkuchens keiner festgelegten mit genauen Mengenangaben versehener Re-zepturen bedarf. Je nach Auftragslage wurden individuelle Rezepte zusammengestellt und zuvor mit Probebacken auf ihre Tauglichkeit hin geprüft. Solche Proben konnten sich über mehrere Tage hinziehen und fanden im Geheimen statt, die Konkurrenz sollte schließlich nicht hinter das Geheimnis des besseren Geschmacks kommen. War man mit den Ergebnissen zufrieden, schritt man zur richtigen Produktion. Deshalb schmeckten auch die Lebkuchen aus derselben Lebzelterei nie gleich.12
Lebkuchen erfreuten sich so großer Beliebtheit, dass man sogar in Kriegszeiten nicht auf sie verzichten wollte. Selbst den Soldaten wurden zur Weihnachtszeit Pfefferkuchen mit der Feldpost geschickt. Leider gab es bisweilen Pro-bleme einzelne Zutaten zu beziehen, weshalb in Kriegsta-gebüchern extra auf solche Zeiten abgestimmte Rezeptu-ren erschienen. So wird statt Honig u.a. Kunsthonig, Sirup oder Marmelade verwendet. Bis Ende des 19. Jh. wur-den die Lebkuchen meist in schlichter rechteckigen oder runden Formen gebacken. Das änderte sich erst, als ein findiger Forscher, ein ehemaliger Student des berühmten Justus Liebig, namens Eben Norton Horsford das Back-pulver erfand13. Ab diesem Punkt konnten neue Varianten des Lebkuchens erprobt werden. Eine dieser Varianten ist der eingangs schon erwähnte Gewürzkuchen. Somit kann man ihn durchaus als eine Spielart des gemeinen Lebku-chens betrachten.
Was man heutzutage immer weniger findet, sind Lebku-chen, die mithilfe von Holzmodeln ein individuelles Aus-sehen bekommen. Die Motive können sehr verschieden sein. Es gibt sowohl religiöse wie phantasievolle Formen, mal gröber, mal feiner ausgearbeitet in unterschiedlichen Größen. Der ausgewalkte Teig (ein spezieller Lebku-chenteig) wurde damals auf die Formen gelegt und ein-gedrückt, das Überstehende weggeschnitten und dann, natürlich ohne Model, wie normal aussehende Lebkuchen in der Ofenröhre gebacken. In der Fachsprache werden ge-modelte Lebkuchen als Doggenware bezeichnet. Das hat nichts mit diesen massigen, sabbernden Molossern zu tun. Dogge, eigentlich docke kommt vom mittelhochdeutschen tocke, das soviel heißt wie Puppe, Mädchen und walzen-förmiges Stück (Holz).14
Die Motive der Modeln reichen von Heiligen- und Herr-scherportraits, über Szenen aus dem alltäglichen Volksle-ben, Liebesmotive bis hin zu mythologischen Abbildun-gen. Eine Spielerei des Lebkuchens, deren Teile früher auch aus Modeln geformt wurden und noch heute in vielen Haushalten zu finden ist, ist das attraktive Hexen-, Knusper-, Lebkuchen- und Hänsel-und-Gretel-Haus, dem wir hier eine Ausstellung gewidmet haben. Es wird zum einen als Meisterstück gefertigt und zum anderen mit Vor-liebe in der Adventszeit mit der ganzen Familie gebastelt. Essbare Häuser wie dieses sind bereits aus dem Schlaraf-fenland bekannt.
37
Anmerkungen
1. Vgl.: Nietsch, Erich: Wer backte die ersten „Printen“ oder „Lebkuchen“ – die Wiener oder die Nürnberger? In: Bienenwelt. Das Fachblatt für den zeitgemäßen Imker. 41. Jg., Nr. 12, Dez. 1999. S. 28.
2. Vgl.: Mette, Gretel: Dem Kult und der Gesundheit dienend. Merkwürdiges aus der langen Geschichte der Lebkuchen. In: Nordwestdeutsche Imkerzeitung. Organ der Imker-Landesverbände Hannover und Weser-Ems und des Deutschen Berufsimkerbundes. 17. Jg., Nr. 1, Jan. 1965, S. 209.
3. Vgl.: Schwarz, Julius: Bäcker, Lebküchner und Kondi-toren. Zur Kulturgeschichte des Backgewerbes. Würz-burg 1988. S. 19.
4. Vgl.: Nietsch, Erich: S. 28.
5. Vgl.: Schleich, Uschi: Das süße Brot der Mönche. In: Wiener Zeitung, Online-Ausgabe, 01.12.2008 [URL: http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_refle-xionen/vermessungen/?em_cnt=250487]
6. Vgl.: Estermann, Max: Der Lebkuchen hat Tradition. In: Schweizerische Bienen-Zeitung. Monatszeitschrift des Vereins deutschschweizerischer und rätoromani-scher Bienenfreunde. 123. Jg., Nr. 1, Jan. 2000. S. 708.
7. Vgl.: Schwarz, Julius: S. 28.
8. Vgl.: Schwarz, Julius: S. 19.
9. Vgl.: Nietsch, Erich: S. 29.
10. Vgl.: Arbeitsgemeinschaft Nürnberger Lebkuchen (Hrsg.): Zünftige Lebküchner [URL: http://www.lebku-chen.nuernberg.de/zuenftig.html]
11. Vgl.: Lerner, Franz: Blüten, Nektar, Bienenfleiß. Die Geschichte des Honigs. München 1984, S. 127-129.
12. Vgl.: Bode, Jochen: Backpulver – Geschichte und Wissen heute.(= Informationen aus dem Wissensforum
Backen, Nr. 9), S. 1-2. [URL: http://www.wissensfo-rum-backwaren.de/files/wfb_broschuere09_d.pdf]
13. Vgl.: Ludikowsky, K.: Die Lebzelterei und Wachszieherei im Laufe des vergangenen Jahrhunderts. In: Der Österrei-chische Imker. 5. Jg., Nr. 1, Jan. 1955. S. 13.
Literatur und Internetquellen
Arbeitsgemeinschaft Nürnberger Lebkuchen (Hrsg.): Zünftige Lebküchner [URL: http://www.lebkuchen.nuernberg.de/zuenftig.html]
Estermann, Max: Der Lebkuchen hat Tradition. In: Schwei-zerische Bienen-Zeitung, 123. Jg., Nr. 1, Jan. 2000, S. 708-710.
Lerner, Franz: Blüten, Nektar, Bienenfleiß. Die Geschichte des Honigs. München 1984.
Ludikowsky, K.: Die Lebzelterei und Wachszieherei im Laufe des vergangenen Jahrhunderts. In: Der Österreichische Imker, 5. Jg., Nr. 1, Jan. 1955, S. 12-15.
Mette, Gretel: Dem Kult und der Gesundheit dienend. Merk-würdiges aus der langen Geschichte des Lebkuchens. In: Nordwestdeutsche Imkerzeitung, 17. Jg., Nr. 1, Jan. 1965.
Nietsch, Erich: Wer backte die ersten Printen oder Lebku-chen – die Wiener oder die Nürnberger. In: Bienenwelt. Das Fachblatt für den zeitgemäßen Imker, 41. Jg., Nr. 12, Dez. 1999, S. 28-30.
Schleich, Uschi: Das süße Brot der Mönche. In: Wiener Zeitung, Online-Ausgabe, 01.12.2008 [URL: http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessun-gen/?em_cnt=250487]
Schwarz, Julius: Bäcker, Lebküchner, Konditoren. Zur Kulturgeschichte des Backgewerbes. Würzburg 1988.
Abb. 19 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender.
39
Zur Geschichte des Papiertheaters und zur Entstehung der
Märchenoper Hänsel und Gretel
von Helga Kelber
Wussten Sie, dass Engelbert Humperdincks zauberhafte Märchenoper ihre Ursprünge auf einer Miniaturbühne hatte?
Die Kunstform des Papiertheaters hatte ihre Blütezeit im 19. Jahrhundert. Sie ent-stand in der Zeit des Biedermeiers, als das Bürgertum erstarkte und man sich zu-nehmend für Kunst, Musik und Theater begeisterte. Auf kleinen Bühnen aus Papier führte man im Familienkreis die Werke der Weltliteratur auf. Dafür druckten die Verlage extra Bilderbögen, auf denen Personen und Kulissen für jedes Werk dar-gestellt waren. Die Lithografien waren anfangs noch schwarz-weiß, wurden spä-ter aber auch schon farbig angeboten. In gemeinsamem Basteln, Ausschneiden und Üben wurden neue Stücke einstudiert, musikalisch untermalt und im kleinen Kreis aufgeführt.
Auch der Komponist Engelbert Humperdinck entstammte solch einer theaterbegeis-terten Familie. Seine Schwester Adelheid Wette gestaltete gern mit ihren Kindern Märchen als Theaterstücke für die Heimbühne. Gelegentlich lieferte der Bruder kleine Musikstücke dazu, und aus dieser Zusammenarbeit erwuchs schließlich die große romantische Märchenoper Hänsel und Gretel. Humperdincks Sohn Wolfram hat uns die Entstehungsgeschichte überliefert:
Abb. 20 Papiertheater, Bühnenbild und Figuren Hänsel und Gretel, entworfen und gefertigt von Helga Kelber, Kitzingen.
40
Adelheid Wette fasste das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm in Ver-se, doch ihr mütterliches Empfinden sträubte sich gegen die Grausamkeit des Märchens. Sie verwandelte die böse Stiefmutter in eine herzensgute, wenn auch etwas jähzornige echte Mutter und erfand noch einige zusätzliche Figuren, die das Geschehen im Wald etwas abmilderten. So erscheint am Abend das Sand-männchen und wünscht den Kindern einen sanften Schlaf, und vom Himmel steigen vierzehn Englein herab, um die Geschwister zu bewachen. Im Morgen-grauen tritt dann das Taumännchen auf und läutet den neuen Tag ein. Die Hexe jedoch bleibt eine böse Figur, wie sie sich die Menschen damals vorstellten. Gierig lockt sie die arglosen Kinder herbei, um sie in ihrem Zauberofen zu bra-ten: Schlicker schlecker - lecker, lecker! Ja, Gretelchen, wirst bald ein Brätel-chen! Doch Frau Wette gibt auch hier dem Märchen eine Wendung zum Guten: die früheren Opfer der Hexe, im Ofen zu Lebkuchen gebacken und als Zaun aufgestellt, werden am Schluss wieder lebendig. Zum Finale schließlich kön-nen die glücklichen Eltern Hänsel und Gretel erleichtert in die Arme schließen.
Engelbert Humperdinck steuerte zunächst zu den Versen seiner Schwester nur einige Liedchen bei. Wolfram Humperdinck erzählt:
Doch es war noch ein anderes, was ihn bezauberte und für das Werk-chen urgründig einnahm: so, wie es die Schwester gedichtet hatte, weh-te ihm aus jedem Wort, aus jeder Wendung und aus der Poesie der neu ge-formten Handlung eine altvertraute, heimische Atmosphäre entgegen, aus einer Zeit, die unter den Ereignissen und Einflüssen seines wechselvollen Lebens verdrängt und fast vergessen worden war. Jetzt, da er die Mitte der Dreißig überschritten hatte, kam das Versunkene unmittelbar wieder em-por, umtönt von den Klängen der mit der Schwester verbrachten Jugend, ih-ren Neigungen und ihrem kindlichen Wirken auf künstlerischen Gebieten.
41Abb. 21 Papiertheater, Bühnenbild und Figuren Hänsel und Gretel, entworfen und gefertigt von Helga Kelber, Kitzingen.
42
Die Dichtung seiner Schwester ließ Engelbert Humperdinck nicht mehr los. Zunächst komponierte er noch weitere Melodien für das anfängliche Singspiel, und nach Jahren schließlich schuf er es zu einer großen Oper um, die am 23. Dezember 1893 in Weimar unter Richard Strauss uraufgeführt wurde. Bald darauf ging die Oper in einem Sieges-zug ohnegleichen durch die Welt. Bis heute hat sich das Werk als Künder des romanti-schen deutschen Wesens einen unverrückbaren Platz im Opernrepertoire erobert.
Wolfram Humperdinck verfasste eine Biografie seines Vaters, die von der Historischen Kom-mission der Stadt Frankfurt als Band XVII der „Frankfurter Lebensbilder“ im Verlag Walde-mar Kramer, Frankfurt 1965, herausgegeben worden ist.
Das Papiertheater Kitzingen
Das Papiertheater Kitzingen befindet sich in Kitzingen in der Grabkirchgasse 4 und bietet Vorstellungen übers ganze Jahr an.
Zwei Frauen haben sich mit Hingabe und Leidenschaft der alten, fast vergessenen Kunstform verschrieben: Gabriele Brunsch mit ihrer Bühne Der blaue Schleier und Helga Kelber mit ihrer Bühne Anderwelt. Jede der beiden Künstlerinnen erschafft die Werke für ihr Miniaturtheater selbst: von der ersten Idee über das Drehbuch, die Gestal-tung des Bühnenbildes, der Figuren und des Soundtracks bis zur Inszenierung ist alles das Werk einer einzigen Frau. Nur beim Spielen braucht man Hilfe, denn die Figuren werden von rechts und von links geführt und so zum Leben erweckt. Deshalb treten die beiden Frauen immer gemeinsam auf und verzaubern schon seit 11 Jahren ihr Publikum.
Infos im Internet unter:
www.papiertheater-kitzingen.de
43Abb. 22 Papiertheater, Bühnenbild und Figuren Hänsel und Gretel, entworfen und gefertigt von Helga Kelber, Kitzingen.
44
Meine Inszenierung der Oper Hänsel und Gretel
Ich habe für mein Papiertheater Humperdincks Werk auf eine Stunde gekürzt und neu bearbeitet, unter Verwendung von Adelheid Wettes Versen, die auch das Libretto der Oper bilden. Meine Figuren sprechen jedoch, gesungen werden nur einige der beliebten Lieder, und natürlich ertönt auch Humperdincks wunderbare Musik. So ist es wieder ein Singspiel geworden, doch der Zauber der Oper wohnt ihm weiter inne und lässt tief in uns modernen Menschen ro-
mantische Sehnsüchte klingen.
Meine Bühne ist 70 auf 50 cm groß und damit deutlich größer als die Papierbühnen der alten Zeit. Die Figuren werden von den Seiten an dünnen Stäben geführt, einige sind drehbar. Alle Bilder habe ich selbst erdacht und mit Wasserfarben auf Aquarellpapier gemalt. Den Erzähltext und die Stimmen habe ich selbst gesprochen, nur die Rolle des Vaters hat mein Bruder übernommen, dazu wurden Musikstücke und Geräusche eingespielt. Der gesam-
te Soundtrack läuft während des Spiels von einer CD ab.
45Abb. 23 Papiertheater, Bühnenbild und Figuren Hänsel und Gretel, entworfen und gefertigt von Helga Kelber, Kitzingen.
48 Abb. 29 Hexennacht im Deusterturm, Februar 2011, Museumsleiter Robert Endres mit Besuchern, Foto: Reinhard Feisel.
49
Schwarze Seelenvögel in Frankenvon Stephanie Nomayo
Tatsächlich kann man, vor allem in strengen Wintern, auf den altehrwürdigen Türmen unserer fränkischen Kirchen tiefschwarze Krähenvögel beobachten. Sie lassen sich reihenweise auf den Kreuzbalken und Wetterhähnen der Kirchturmspitzen nieder. Ihre schwarz glänzenden Kollegen besiedeln dabei in Scharen die kahlen Bäume des meist in unmittelbarer Nähe gelegenen Friedhofes. Mit laut vernehmbarem Krächzen überfliegen sie in kunstvollen Bögen den stillen Ort. An frischen Gräbern finden diese intelligenten Tiere in den abgelegten Blumengebinden Nahrung für den Winter. Im Sommer ist ihr Tisch in der umliegenden Feldflur reich gedeckt. Wie der Name schon sagt, können Saatkrähen gerade weil sie in Scharen einfallen, auch heute noch gewaltigen Schaden an Getreidefeldern anrichten. So versteht man, dass man diesen Vogel im Mittelalter, als Gedeih und Verderb einer ganzen Dorfgemeinschaft vom jährlichen Ernteerfolg abhing, als Kulturschädling erbarmungslos verfolgte.Mit diesem Krähenvogel verbinden sich für einige fränkische Orte, wie Höchberg, Großlangheim oder Goßmannsdorf bei Ochsenfurt ein ungelöstes Rätsel, denn die Bewohner dieser Orte werden seit alter Zeit Kracken, also Krähen genannt.
50
erreichten, konnten sie nur noch mit krächzender Stimme ihre Botschaft ausrichten. Die mitleidigen Menschen gewährten den Vögeln Asyl und verwehrten ihnen nicht die Brosamen auf ihren Feldern. Doch böse Nachbarn hörten den heiseren Schrei der Vögel und verspotteten die Höchberger als Kracken. Die göttlichen Vögel aber kommen seitdem jedes Jahr zu den Menschen in Höchberg. Der Inhalt der Botschaft dieser schwarz gefiederten göttlichen Herolde ist leider nicht überliefert. Doch so freundlich wie dieses Märchen aufgebaut ist, kann es nichts Schlimmes gewesen sein.
Tatsächlich aber gelten die schwarzen Gesellen nicht als Glücks- sondern als Unglücksboten. Sodass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei diesem Märchen um die Grundlage für die Bezeichnung Kracken handelt eher gering ist. Es dürfte sich vielmehr um einen nachträglichen Erklärungsversuch handeln, wobei die Idee der Schicksalsfäden spinnenden Wintergöttin des Nordens auch in Bezug auf die Geschichte um Frau Holle sehr reizvoll ist.
Es wurde noch verschiedenes als des Rätsels Lösung angeboten, doch in einem ist man sich einig, dass es sich um einen Schimpfnamen handeln muss. Zumal auch die Bewohner vieler anderer fränkischer Orte mit gesucht ehrenrührigen Ortsschimpfnamen belegt werden, wie das Beispiel aus dem nahe gelegenen Heidingsfeld zeigt, dessen Bewohner wenig schmeichelhaft als Giemäuler, das heißt Verräter, bezeichnet werden. Die Namenforschung geht davon aus, dass Ortsschimpfnamen erfahrungsgemäß eher auf ein einzelnes Vorkommnis zurückzuführen sind, als auf allgemeine topographische Gegebenheiten oder spezifische Eigenheiten der Bewohner. Und dieses Ereignis herauszufinden, wenn es weit zurückliegt, ist eigentlich unmöglich. Wer möchte sich damit zufrieden geben?
Fragt man die Bewohner dieser Orte woher der Name käme, so gibt es mannigfache Lösungsvorschläge. So wollen die Höchberger beobachtet haben, dass ihr Ort aus der Vogelperspektive einem Krähenvogel, oder vielleicht auch einem Krähennest gleicht. Andere Stimmen meinten, dass die entsprechenden Ortsbewohner wohl besonders laute Zeitgenossen gewesen wären, so hätten die Bewohner von Oberzell die Höchberger schon von weitem gehört wie sie krakeelten, wenn sie auf dem Fabrikerweg im Gemeindewald zwischen Höchberg und Zell ihren Weg bergab zur Arbeit bei König und Bauer liefen. Was dann wohl aufgrund der heiser-lauten Stimmen zur Bezeichnung Kracken geführt haben könnte.Die häufigste Erklärung aber, welche heute noch den Kindern gegeben wird, erklärt den namen Kracken mit dem gehäuften Auftreten des Vogels in den entsprechenden Orten im Winter. So suchen speziell die Saatkrähen im Winter die Nähe des Menschen, um als echter Allesfresser im Ort von den Essensresten und Abfällen zu leben. Außerdem weiß man, dass im Winter zudem noch weitere Krähenarten aus nördlicher gelegenen Gegenden die Frankenstädtchen aufsuchen, um in unserer Region zu überwintern.In Höchberg hat sich eine kleine Geschichte hierzu überliefert:
Im hohen Norden saß die Göttin und spann an den Fäden des Schicksals der Menschen. Ihre Boten waren Vögel, in feierlich schwarz glänzende Federn gehüllt. Sie flogen weit über die Lande und wurden ihrer Aufgabe mit viel Verantwortung gerecht. Eines Tages waren sie wieder unterwegs, da fegten eisige Winterstürme über das Land, doch die Rabenvögel verkrochen sich nicht in ein warmes Plätzchen, sondern erfüllten getreu ihre Aufgabe die göttlichen Anweisungen nach Franken zu bringen. Doch als sie das liebliche Dorf Huohobura (Höchberg)
51
in Höchberg, sicher der Seelenvogel und Aasfresser, die Krähe gemeint.
Höchberg liegt spätestens seit dem frühen 17. Jahrhundert zwischen zwei Hinrichtungsorten. Ein Richtplatz befand sich auf dem Hexenbruch, der zweite soll sich auf dem Nikolausberg befunden haben. So muss es nicht einmal sein, dass Höchberg aus diesem Grund stärker von Krähen frequentiert war als die Nachbarorte. Allein die Tatsache, dass Höchberg selbst, ähnlich den Krähenkolonien um einen Richtplatz, so nahe zwischen zwei Würzburger Richtplätzen lag, dürfte wohl für die herablassende, wahrscheinlich auf ihre Lebensbedingungen anspielende Bezeichnung dieser damals sicher armen Menschen ausschlaggebend gewesen sein. Wie erwähnt, gibt es in Franken noch weitere Orte, so Großlangheim im Landkreis Kitzingen (hier gibt es einmal jährlich den Krackenmarkt) und Goßmannsdorf bei Ochsenfurt, deren Bewohner als Kracken bezeichnet werden Und – wen wundert´s? – auch Ochsenfurt war im 16. und 17. Jahrhundert schwer heimgesucht vom Hexenwahn.
Vielleicht, weil es sich gerade bei der Krähe, dem unterfränkischen Krack, vor allem wegen seiner Intelligenz, aber auch seiner Geselligkeit und seines eleganten Aussehens doch um einen recht sympathischen Gesellen handelt, identifiziert man sich in Franken ganz gerne mit ihm. Wenn der Winter endet ist seine Zeit, die 5. Jahreszeit, gekommen. Mit Helau Krackau feiert Höchberg jedes Jahr seine Fasnet. Da sind dann auch hier und da Hexen dabei.
Literatur:
zitiert nach Peter Stichler, Die schwarzen Seelenvögel von Höchberg, Höchberger Lesebuch, Höchberg 1998 (auf der Grundlage eines Beitrags von Stephanie Nomayo).
Schauen wir noch einmal zurück, was der Krähenvogel eigentlich seit alter Zeit im Volksaberglauben und im Empfinden der Leute bedeutet. Vielleicht sind es sein gehäuftes Erscheinen im Winter, sein spottendes, lautes Krächzen und sein tiefschwarzes glänzendes Gefieder, vielleicht aber auch seine Nahrungsgewohnheiten als Schädlings- und Aasfresser, die hinter diesem Vogel ein Geheimnis zu verbergen scheinen. Sein Ruf, in dem manche Menschen die Worte grab grab oder starb starb gehört haben wollen, bringen das Tier nicht nur in unserem Kulturkreis in Zusammenhang mit der Ankündigung eines nahenden Lebensendes, als dessen Boten sie schon im antiken Mythos galten. In vielen Fällen sollen sie selbst die schwarzen Seelen verstorbener Missetäter verkörpern. Die Beobachtung der Wirklichkeit im Zusammenhang mit den abergläubischen Interpretationen des Volkes findet sich meisterhaft beschrieben in den Novellen von Theodeor Storm. In seinen Geschichten finden wir die schwarzen Krähenvögel an verwaisten Hinrichtungsorten, meist belagern sie einen Hexenrichtplatz. Es sind Galgenvögel, die sich an den menschlichen Überresten, zumeist an den Augen der Gerichteten, gütlich tun. So ist es kein Wunder, dass die Hinrichtungsplätze im fränkischen Städtchen Roßtal, aber auch in Rothenburg Rabenstein heißen und es verwundert auch nicht, dass der Volksaberglaube die Krähen damit als ständige, der Weissagung mächtige Hexenbegleiter überliefert.
In wieweit diese Überlegung auf Höchberg zutrifft, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit beweisen. Aber einen weiteren Hinweis gibt es: In der Leichenrede des Jesuitenpaters P. Gaar heißt es anlässlich der Hinrichtung der letzten fränkischen Hexe, der Subpriorin des Klosters Unterzell, Maria Renata Singer von Mossau, am 20. Juni 1749 auf dem Höchberger Hexenrichtplatz: ...und ein schwarzer Geiersvogel flog auf. Damit war, zumal
52 Abb. 30 Hexennacht im Deusterturm, Februar 2011, Museumsleiter Robert Endres mit Kitzinger Turmhexen, Foto: Reinhard Feisel.
53
Robert Endres führt Kitzinger Hexen durch den Deusterturm, hierbei erzählt er aus seiner Kindheit. Er berichtet, dass der Hexenglauben in Franken bis
in die 1970er Jahre auf dem Land noch selbstverständlich
Von magischen Vögeln, Weisheitsboten und Unglücksbringern....
von und mit Robert Endres
54
war. Er lebte im Ochsenfurther Gau, als einst ein Kalb auf dem Hof seiner Eltern sich losgerissen hatte und im Stall eine beträchtliche Verwüstung anrichtete. Als er mit seinem Vater gerade ans Aufräumen gegangen war, kam der Großvater dazu. Er rügte beide, dass sie alles liegen lassen sollten, denn er müsse erst aus den umgeworfenen Gabeln, Holzstapeln und Ketten herauslesen, um welchen Zauber es sich handelte. Auch weiß er zu berichten, dass es Personen gab, denen man nachsagte, sie könnten anderen Böses anwünschen, traf dann aus Zufall etwas entsprechend Schlimmes ein, so wurde es der Hexe oder dem Hexer zugeschrieben. Auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten wurden zu Hexen stilisiert.
So erzählt Robert Endres, dass im Ochsenfurter Gau Frauen, zu Zeiten ihrer Menstruation, keine Gartenarbeiten erledigen durften, da man befürchtete, dass das Beet keine Früchte tragen, oder Tiere bei ihrer Berührung nicht mehr trächtig werden könnten.Ein Teufelskerl war auch, wer Fledermäuse unter dem eigenen Dach duldete. Ein Acker, der von Raben und Krähen heimgesucht wurde, war verhext.
Verstarb ein Mensch, so hielt man auf dem Land Totenwache, hierbei wurden um das Bett des Verstorbenen Kerzen aufgestellt und bei Nacht angezündet. Durch das Licht wurden
Eulen und Steinkäuze angelockt, vernahm man sodann deren Schrei, so bedeutete dies Unglück. Generell standen Personen, die sich mit Raben, Krähen, Eulen, Steinkäuzen, Salamander oder schwarzen Katzen befassten, im Verdacht mit dem Teufel im Bunde zu sein. Das Ganze änderte sich erst im Laufe der 1970iger Jahre.
56
Pressestimmen: Während des Ausstellungsjahres gab es zum Projektbeitrag des Vogelkundlichen Museums in Kitzingen folgenden Pressebeitrag in der
Kitzinger von Redakteur Ralf Dieter:
Der 64-Jährige ist auch in 17 Metern Höhe, im fünften Stockwerk des Deuster-Turms, geerdet.
An Hexen, die auf Besen herumfliegen und Zauber-tränke mischen, glaubt er nicht. Aber Endres kann sich an seine Jugend erinnern, als der Aberglaube durch-aus noch zum Alltag gehörte. Dank seiner zahlrei-chen Auslandsaufenthalte weiß er, dass der Begriff Hexe nicht überall negativ besetzt ist. „Verfolgung oder Glücksbringer. Diese besonderen Menschen ha-ben schon immer eine Gratwanderung mitgemacht.“ Nach Indien und China haben ihn seine Studienrei-sen geführt, in Tanzania war er sogar drei Mal für drei Monate, hat dort in den 80er Jahren für eine Entbin-dungsstation und ein Krankenhaus Solaranlagen ge-baut. Endres hat damals auch Geschichten von Heilern
Abb. 32 Hexennacht im Deusterturm, Februar 2011, Kitzinger Turmhexen mit Anführerin Karin Böhm, Foto: Reinhard Feisel.
Hexenwerk im DeusterturmAm Wochenende startet eine sechswöchige Veran-staltungsreihe über Hexen in vier Kitzinger Muse-en. Robert Endres vom Vogelschutzbund verbindet bei einer Führung schaurige Anekdoten und nüch-
ternes Wissen
Robert Endres ist bereit: Am Sonntagabend führt er Gäste durch den Deuster-Turm. Thema: Magische Vögel - Weis-heitsboten und Unheilsbringer. Robert Endres sitzt in 17 Metern Höhe im Deuster-Turm. Dichter Nebel steigt drau-ßen an den Fenstern nach oben, umschlingt den Turm wie ein feines Leinentuch. Endres, dessen Gesicht von einem langen, weißen Bart umrahmt wird, erzählt mit seiner sono-ren Stimmen von längst vergessen Zeiten, von Sagen und Mythen. Wenn jetzt eine Hexe auf ihrem Besenstiel um den Turm flöge, das Bild wäre perfekt. Doch selbst wenn End-res über Hexen und ihre Verbindung zu mystischen Vögeln wie kein Anderer im Landkreis Kitzingen berichten kann: An Übernatürliches glaubt der Vorsitzende des Landes-bundes für Vogelschutz (LBV) im Kreis Kitzingen nicht. Am Samstag, 12 Februar, startet die Veranstaltungsreihe über Hexen, die Stephanie Nomayo, Leiterin des Städti-schen Museums Kitzingen, ins Leben gerufen hat. Inner-halb von sechs Wochen wird die Geschichte der Hexen in Ausstellungen, Vorträgen, Workshops und Lesungen vertieft. Vier Museen arbeiten dabei Hand in Hand. „Ich sehe das als Chance für die Kitzinger Museenlandschaft“, sagt Endres. Schon deshalb hat er nicht lange überlegen müssen, als ihn Nomayo fragte, ob er dabei sein wolle.
57
und Heilerinnen gehört, von Menschen mit einer be-sonderen Begabung. „Das ist mir in der Vorbereitung zu dieser Ausstellung alles wieder eingefallen“, sagt er. Sein Thema am Sonntagabend, bei seiner Sonderführung durch die vogelkundliche Ausstellung im Deusterturm,
wird aber ein ganz anderes sein:
„Magische Vögel, Weisheitsboten und Unheilsbringer.“ „Schon als kleiner Junge habe ich mich mit dem Vogelschutz beschäftigt“, sagt Endres und lächelt. Seit mehr als 25 Jah-ren ist er Vorsitzender des LBV im Kreis Kitzingen. Endres hat sich in all den Jahren Wissen angesammelt, das er jetzt in Verbindung mit der magischen Welt der Hexen setzen kann. Wir sind zwei Stockwerke tiefer gegangen. In Vitrinen und Schaukästen stehen die ausgestopften einheimischen Vo-gelexemplare. Eine lebensgroße Stoffhexe steht vor dem
Schaukasten mit den Eulen. Nicht von ungefähr. „Man konnte das Verhalten der Schleiereulen früher nicht erklä-ren und hat es deshalb mit der Welt der Hexen in Verbin-dung gebracht“, sagt er. Die Erklärung für die nachtaktiven Tiere klingt in den Ohren der Menschen des 21. Jahrhun-derts ganz logisch: Ein fantastisches Gehör, das ein zehn Mal besseres Fangergebnis garantiert als bei anderen Greifvögeln lässt die Eulen nur nachts Jagd auf Mäuse machen. „Als Nahrungs-Konkurrenten werden sie bei Tag von Falken und Sperbern angegriffen“, informiert End-res und betont: „Es gibt immer eine logische Erklärung.“ Das trifft auch auf die Fledermäuse zu. Die passten zu den Hexen, weil sich angeblich beide lautlos und schnell
durch die Luft bewegen können.
Wie tief die Angst vor Fledermäusen in den Menschen sitzt, hat Endres gerade bei etlichen US-Soldaten er-lebt, die vor ein paar Jahren noch im Landkreis statio-niert waren. Der 64-Jährige erzählt von einem Solda-ten, der nicht mehr in der Wohnung bleiben wollte, weil sich Fledermäuse im Rollokasten eingenistet hatten. In Bali hat Endres dagegen erlebt, wie Hindus eine Zere-monie in einer riesigen Fledermaushöhle feierten. Als die Sonne unterging sind die Tiere zu tausenden in die Nacht davongesegelt. „In Asien stehen schwarze Vögel auch nicht für den Tod, wie bei uns“, erzählt er. „Dort wird die Farbe weiß mit dem Tod in Verbindung gebracht.“ Robert Endres kann aus einem reichen Fundus an selbst Erlebtem und aus angelesenem Wissen schöpfen. Am Sonntagabend wird er die magische Welt der Hexen mit der nüchternen Welt der Realität in Einklang bringen. Wenn sich die Nacht über den Deusterturm senkt, der Nebel an den Fenstern aufsteigt und Endres das elektrische Licht löscht und mit seiner alten Laterne die Stufen hinansteigt, dann wird so manchem nüchternen Geist aus dem 21. Jahr-
hundert dennoch ein kribbeliges Gefühl beschleichen.
Abb. 32 Hexennacht im Deusterturm, Februar 2011, Kitzinger Turmhexen mit Anführerin Karin Böhm, Foto: Reinhard Feisel.
59
Ein besonderes Nachtschattengewächs - das Bilsenkraut
von Reinhard Feisel
Bilsenkraut gilt als das Hexenkraut schlechthin. Als angebliche Rezeptur für die berüchtigten
Hexensalben wurden neben dem Bilsenkraut auch weitere sog. Nachtschattengewächse erwähnt, wie
Stechapfel, Alraune und Tollkirsche.
Die tatsächlichen und nachgesagten Wirkungen dieser Zubereitungen auf den Menschen waren mannigfaltig. Der Stechapfel wurde allerdings erst im 16. Jh. aus Südamerika nach Europa eingeführt. Allen Pflanzen gleich ist der Gehalt an Alkaloiden, die eine starke und lebensbedrohliche, zumeist berauschende oder betäubende Wirkung auf den Menschen haben. Entsprechend werden diese Pflanzen heute als sehr stark giftig eingestuft.
Das Schwarze Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) und weitere Arten der Gattung sind im Mittelmeerraum heimisch, so dass die Pflanze im Altertum bereits den Griechen und Römern bekannt war und auch als Arznei beschrieben wurde. Dioskurides erwähnt den Saft und Samen als Heilmittel gegen Schmerzen, Entzündungen und Husten. Er warnt jedoch auch vor zu hoher Dosierung, die einen gelinden Wahnsinn bewirkt. Plinius berichtet ebenfalls, dass ein Getränk, aus den Blättern des Bilsenkrautes zubereitet, den Geist verwirrt. Bilsenkraut wurde auch im Mittelalter als Bestandteil schlaffördernder und krampflösender Mittel eingesetzt und insbesondere bei starken Schmerzen und Zahnschmerzen verwendet. Jedoch sind die Nebenwirkungen des Hauptinhaltsstoffes, des Alkaloids Hyoscyamin, lebensbedrohlich, mit
Abb. 26 Bilsenkraut, Fotos: Reinhard Feisel.
61
Symptomen wie Sprechstörungen, Halluzinationen, Pupillenvergrößerung, Herzrasen und zuletzt Koma und Atemlähmung.
Die Berichte und Sagen, die sich zum Bilsenkraut finden, sind zahlreich: Der Name Hyoskyamos = Schweinekraut verweist möglicherweise auf die Zauberin Kirke und die Verwandlung der Gefährten des Odysseus in Schweine. Der althochdeutsche Name bilisa könnte auf den Sonnengott Bel/Belenos hindeuten. In Shakespeares Hamlet fällt
der Dänenkönig einem Mordanschlag mit Bilsenkrautöl zum Opfer. Es finden sich für das Kraut zahlreiche Volksnamen, die jeweils auf die schmerzstillende, betäubende, berauschende oder auch tödliche Wirkung hindeuten. Daneben wurde Bilsenkraut auch dem Bier zugesetzt, um eine besondere Rauschwirkung zu erzielen. Die häufige Verwendung beim Bierbrauen schlägt sich in entsprechenden Verboten nieder, in denen das Bilsenkraut (Bilsensamen, Bilsen) ausdrücklich genannt wird, z.B. die Polizeiordnung von Eichstätt von 1507 und die Bayerische
Abb. 27 Stechapfel, Fotos: Reinhard Feisel.
63
Land- und Polizeiordnung von 1649. Weitere, bereits früh bekannte Anwendungen waren die Bekämpfung von Ratten und der Fischfang mit entsprechend zubereiteten Ködern.
Unter den Giftwirkungen könnte vor allem die halluzi-nogene Wirkung des Bilsenkrautes Anlass gewesen sein für die verschiedenen hexenkundlichen Berichte über Verwandlungen zu Tiergestalten, Hexenflügen und Ortsveränderungen auf wundersame Weise, bis hin zu Teufelsgemeinschaften. Die Pflanze konnte entweder eingenommen, als Salbe aufgetragen oder auch als Räucherwerk inhaliert werden. Erwähnt werden die Samen auch zum Ausstreuen an bestimmten Orten zu Zauberzwecken oder als Bestandteil von Amuletten. Dabei reichte in Verdachtsfällen wohl allein der Fund des Krautes bei den Betroffenen aus, um sie der Hexerei zu überführen. Auch das Aussehen der fünflappigen mattgelben Blüte mit einer dunkel-violetten Äderung wurde als düsteres Symbol der Eule, der nächtlichen Begleiterin der Hexe, gedeutet.
Das heutige Vorkommen des Bilsenkrautes (Hyoscyamus niger) ist eher selten bis zerstreut. In unserem Raum liegt ein Verbreitungsschwerpunkt im südlichen Maindreieck auf sandig-kiesigen Standorten am Main. Hier finden sich ebenfalls lokal gehäufte Vorkommen des Stechapfels (Datura stramonium). Die Tollkirsche (Atropa bella-donna) als Pflanzenart des Waldes fehlt lokal. Die Alraune (Mandragora officinarum) kommt bei uns nicht natürlich vor, sie stammt aus dem Mittelmeergebiet; sie ist im milden Weinbauklima allenfalls winterhart.
Literatur:
Abraham, Hartwig / Thinnes, Inge (1995): Hexenkraut und Zaubertrank. Unsere Heilpflanzen in Sagen, Aberglauben
und Legenden. Urs Freund Verlag. Greiffenberg.
Daxelmüller, Christoph (2005): Zauberpraktiken. Die Ideengeschichte der Magie. Patmos. Düsseldorf.
Reichl, Franz-Xaver (Hrsg.)( 2008): Taschenatlas der Toxikologie. Nikol. Hamburg.
Roth, Lutz (Hrsg.) / Daunderer, Max / Kormann, Kurt (1994): Giftpflanzen Pfanzengifte. Nikol. Hamburg.
Schönfelder, Peter / Bresinsky, Andreas (Hrsg.) (1990): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Eugen Ulmer. Stuttgart.
Steinecke, Hilke (2004): Schwarzes Bilsenkraut. In: Druidenfuss und Hexensessel - Magische Pflanzen. Beiheft zur Sonderausstellung im Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main (Sonderheft 38). Frankfurt am Main.
Wulle, Stefan (1999): Bilsenkraut und Bibergeil. 50 Jahre DFG-Sondersammelgebiet Pharmazie. Begleitheft und Auswahlbibliographie zur Ausstellung vom 30.4. bis 19.6.1999. Braunschweig.
64 Abb. 33 Die Maske der Allersberger Flecklashex ist durch die große Nase und die zahlreichen Warzen entstellt. Foto: Viktor Meshko.
65
Von den Hexen der Fastnachtvon Daniela Sandner
Zur Bedeutung der Teufels- und Hexengestalten der Fastnacht
In der Fastnacht hat der Teufel eine lange Tradition, die bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts und vermut-lich noch länger zurückreicht. Teufelsfiguren traten schon früh in aller Drastik1 auf. Beim Nürnberger Schembartlauf, dem ersten organisierten Fastnachtsumzug, trat in der ers-ten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Teufel in Begleitung eines alten Weibes auf.
Abb. 33 Die Maske der Allersberger Flecklashex ist durch die große Nase und die zahlreichen Warzen entstellt. Foto: Viktor Meshko.
66
Die teuflische Gefolgschaft böser Weiber beschreibt schon ein Nürnberger Fastnachtsspiel des ausgehenden 15. Jahr-hunderts2. Noch heute begegnen uns Teufelsgestalten beispielsweise in Einsiedeln und im schwäbisch-aleman-nischen Raum in Hornberg, Triberg, Offenburg, Saulgau, Kirchzarten, Obernheim, Freiburg und Rottenburg3.
Entgegen der landläufigen Meinung, bei den Schreckge-stalten der Fastnacht handele es sich um Relikte der vor-christlichen Mythologie, ist für die Brauchgestaltung der Fastnacht […] nur die christliche Ausprägung dieses Prin-zips4 von Bedeutung. Dem sogenannten Teufelsfest wurde am Vorabend des Aschermittwochs durch einen gemein-schaftlich vollzogenen Abschlußbrauch ein Ende gesetzt5. Die katholische Kirche beobachtete das rege Treiben zur Fastnachtszeit mit Widerwillen, ging aber nur in wenigen Fällen rigide dagegen vor, solange sich die Ausschreitun-gen im dafür vorhergesehenen (zeitlichen) Rahmen beweg-ten. Anders war dies, wenn die Fastnachter ihre Narrheiten bis in die Fastenzeit hinein ausbreiteten. Dann wurden die kirchlichen Amtsdiener aktiv: Verbote gegen das Masken-tragen zur Fastnacht sind nicht als Generalverbote zu ver-stehen, sondern richten sich meist gegen einen bestimmten Tathergang6. Die protestantische Kirche hingegen wandte sich pauschal gegen sämtliche fastnächtlichen Aktivitäten, sie schloß eine konkrete Teufels- oder Höllendarstellung […] grundsätzlich aus7.
Alte Weiber begleiteten die Teufelsgestalten der Fastnacht also schon vor 1500, doch führt von dort keine direkte Entwicklungslinie zur heutigen Fastnachtshexe8. Wie dem auch sei, [j]edenfalls hat die Hexe, als Gegenstück zum Teufel, in der Fastnachtswelt ihren festen Platz, zumal auch sie nach christlicher Auffassung den Menschen zum Abfall von Gott verführt9.
Die Hexenfiguren der schwäbisch-alemannischen
Fasnet
Die Hexen gehören zu der größten Figurengruppe der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Entgegen der landläu-figen Vermutung, es handele sich dabei um Figuren mit lan-ger historischer Tradition, tauchen die frühesten Hexen als Fastnachtgestalten erst im 19. Jahrhundert auf. Im Schwä-bisch-Alemannischen lief die erste Hexe, das Produkt des Künstlers Karl Vollmer, sogar erst im Jahr 1933 in Offen-burg. Dem Vorbild der Offenburger Hexen folgten bald zahlreiche weitere: die Obernheimer, Gengenbacher, Pful-lendorfer Hexen, die Aulendorfer Eckhexen, die Schrättle aus Bad Waldsee, die Rungunkeln aus Wolfach und viele andere. Sie alle sind an ihren hakennasigen Gesichter[n], […] Kopftücher[n], derben Kittel[n], ausladende[n] Rö-cke[n], altmodische[r] Unterwäsche, farbige[n] Ringel-strümpfe[n], Strohschuhe[n] und […] ein[em] grob[en] Reisigbesen10 zu erkennen. Werner Mezger spricht, auf die große Beliebtheit und das damit verbundene starke Anwachsen der Hexenfiguren rekurrierend, von einem regelrechten Hexen-Boom11. Er sieht diesen vor allem in den freien Gestaltungsmöglichkeiten der Hexengruppen begründet. Nicht selten werden heute Hexenfiguren neu eingeführt mit dem Hinweis auf den letzten Hexenprozess im Ort. Tatsächlich jedoch lassen sich die Fastnachtshexen weniger auf die tragischen Opfer[…] früherer Hexenver-folgungen12, als vielmehr auf die Märchenhexen der deut-schen Romantik zurückführen.
67
Ausgewählte Hexenexponate aus dem Bestand des Deutschen
Fastnachtmuseums
Die Allersberger Flecklashexen
Die Flecklashexen aus dem mittelfränki-schen Allersberg sind schon von weitem an ihren bunten Flickenkleidern zu erken-nen. Die sogenannten Blätzle, Spättle oder Fleckle (Fleckla) finden sich auch bei zahl-reichen weiteren Figuren insbesondere der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Die Stofffetzen können dabei in Form, Größe, Arrangement und Farbigkeit variieren. Das Unterkleid, auf das die Flicken aufgenäht sind, besteht meist aus Leinen, Nessel oder Baumwolle. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Vermutlich sind Kostüme dieser Art deshalb so weit verbreitet und po-pulär, weil sie schon früh und auch in Not-zeiten günstig und einfach aus Stoffresten herzustellen waren13.
Die Geschichte des Kultur- und Verschöne-rungsvereins von Allersberg reicht zurück in das Jahr 1889. Nach dem Zweiten Welt-krieg trieb der Verein zunehmend die Hei-
Abb. 34 Die Allersberger Flecklashex eröffnet den ersten Ausstellungsraum im Deutschen Fastnachtmuseum. Foto: Viktor Meshko.
68
mat- und Brauchpflege voran. Nach und nach übernahm er auch Maßnahmen des Fremdenverkehrs. Im Jahr 1965 er-folgte schließlich die Umbenennung in Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein. Drei Jahre später gründete sich innerhalb dieses Vereins die Abteilung Faschingskomitee. Damit rückte das aktive Wiederbeleben lokaler Faschings-bräuche, insbesondere des Allersberger Hexenlaufens, in den Vordergrund. Die neuen Hexenmasken stammten aus der Werkstatt von Georg Braun. Es wurden zudem wieder Umzüge am Faschingssonntag veranstaltet. In den folgen-den Jahren entwickelten sich die Allersberger Hexen zum Exportartikel und sind heute die älteste Gruppe von Fast-nachtsfiguren bei der Fernsehsitzung Fastnacht in Fran-ken, die jedes Jahr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird14.
Ende der 1980er Jahre vollzog sich schließlich innerhalb der Gruppe ein Wandel hin zur Showtanzgruppe unter Lei-tung professioneller Tanztrainer. Heute sind die bunten Hexen aus diversen Fernsehsitzungen, insbesondere aus Fastnacht in Franken, und aus den regionalen und über-regionalen Faschingsumzügen nicht mehr wegzudenken15. Heischegänge zur Fastnachtszeit sind dabei, so Willy Bitt-ner, bereits im Zweiten Weltkrieg belegt. In Notzeiten er-bettelten sich die jungen Allersberger Männer in Hexen-kostümen kleinere Abgaben16.
Die Hexen der Lauinger Narrenzunft
Am Gumpigen Donnerstag17 treffen sich die Hexen der Narrenzunft Laudonia im schwäbischen Lauingen (Do-nau) zum großen Hexentanz. Der Umzug wird angeführt von der Oberhexe Barbara Schwertgoschin18, den Ab-schluss bildet die Gruppe der Lauinger Hexen. Anschlie-ßend findet das Lauinger Fastnachtsspiel statt, in dem es um die Austreibung des Winters geht. Die Hexen unterlie-gen hierbei als Wintergestalten den Frühlingsfiguren. Eine Puppe der Oberhexe wird schließlich als Symbolfigur des Winters erhängt und verbrannt. Die übrigen Hexen stim-men dabei ein ohrenbetäubendes Wehklagen an.
Die Lauinger Hexenfigur existiert seit 1978 und erhielt im Jahr 1983 ihr heutiges Aussehen. Sie trägt heute ein grünes Kleid mit einem dreieckigen Seitentuch. Unter dem Kleid trägt sie eine weite, weiße Hose. Unverkennbar sind ihre rot-weiß-gestreiften Socken und ihre Strohschuhe. Der missgestaltete Hexenbuckel wird meist anhand eines Kis-sens geformt. Unter dem roten Kopftuch sind zwei lange, blonde Hanfzöpfe zu erkennen. Natürlich trägt die Hexe einen Reisigbesen mit sich.
Die Hexenmaske besteht meist aus Lindenholz, ältere Mas-ken wurden noch aus Kiefernholz geschnitzt. Entworfen und in den Anfangsjahren geschnitzt wurde sie von dem Holzbildhauer Klaus Demeter, in den 1990er Jahren über-nahm der Zunftmeister R. Zobel diese Aufgabe. Eine Be-sonderheit stellt das zweiteilige Gesicht dar: während die eine Hälfte lächelt, blickt die andere recht finster drein19.
69
Abb. 35 Die Maske der Lauinger Hexe zeigt ein zweiteiliges Gesicht: während die eine Hälfte schelmisch lächelt, ist die andere grotesk verzerrt. Foto: Viktor Meshko.
70
Die Hexen der Pfannenschleckerzunft Rheinbischofsheim
Die Hexenzunft der Pfannenschlecker20 wurde im Jahr 1971 in Rheinau im Ortenaukreis gegründet. Seither eröff-nen die Hexen am 11. November jeden Jahres die närrische Session mit ihrem Rathaussturm. Beim Narrenbaumstel-len, das traditionell zwei Wochen vor Fastnacht stattfindet, spielen die Hexen ebenfalls die Hauptrolle. Ansonsten ver-treten sie die Bischemer vor allem bei Fastnachtsveranstal-tungen in der Region. Heute besteht die Hexenzunft aus ca. 120 aktiven Hexen und 60 Junghexen21.
An der hölzernen Maske sind besonders die spitzen Eck-zähne sowie die herausgestreckte Zunge auffällig, die an das Pfannenschlecken erinnert. An der Maske sind ein dunkles, geblümtes Kopftuch und zwei Zöpfe aus Stroh angebracht. Die frühen Masken der Hexenzunft stam-men von Josef Tränkle, einem Elzacher Schnitzer. Dessen Handwerk hat in den 1990er Jahren Rudolf Winter über-nommen.
Über dem fliederfarbenen Rock trägt die Hexe eine Schür-ze aus dunklem, geblümtem Stoff. Die Bluse ist rot und ebenfalls mit Blumen gemustert. Rote Socken, Strohschu-he und ein Reisigbesen komplettieren das Häs22 der Hexe23.
Abb. 35 An ihre Namensgeber erinnert die Maske der Pfannenschlecker-Hexe aus Rheinbischofsheim mit ihrer ausgestreckten Zunge. Foto: Viktor Meshko.
71
Alles Männer?!
In vielen schwäbisch-alemannischen Fastnachtsbräuchen, beispielsweise in Löffingen, Offenburg, Saulgau oder Bad Waldsee, werden die Hexenfiguren von Männern darge-stellt. Zu ihren Aufgaben gehört das sogenannte Mädchen-fangen, bei dem Teufel oder Hexen ihre Opfer auf den ent-blößten Leib stempeln24.
Frauengestalten, die in Wirklichkeit von Männern gespielt werden, haben in der Fastnacht eine lange Tradition: Aus-schließlich männliche Ehepaare finden sich beispielsweise in einigen Fastnachten Tirols, darunter die Laggeroller und Laggescheller des Imster Schemenlaufens. Auch unter den Kostümen der Narrönin in Laufenburg, des Schellenweib-les in Wangen oder des Rankenweibles in Ochsenhausen stecken traditionell Männer25.
Die Buttenträger- oder Menschenreiterfiguren sind eine besondere Art der Scheinreiter26. Sie sind in einigen Fast-nachten Tirols und im schwäbisch-alemannischen Raum verbreitet. Hier trägt eine menschliche Figur die andere: In der heutigen Fastnacht sehen diese Gestalten in der Regel so aus, daß sie den zwingenden Eindruck erwecken, als trüge eine unter der Last tief gebückte Ehefrau ihren tri-umphierenden Mann in einem Korb oder direkt spazieren, wohin dieser sie dirigiert27. In Wirklichkeit aber handelt es sich um nur einen (männlichen) Kostümierten, der eine Attrappe einer weiblichen Figur vor sich herträgt. Diese Scheinpaare sind auf eine geschlechterspezifische Komik in ihrer Rollenverteilung angelegt28, in der die männliche Figur die weibliche erniedrigt. In Wellendingen treibt bei-spielsweise der Hexenreiter eine nach vorn gebeugte He-xengestalt durch Schläge in den Nacken zu größerer Eile29 an.
Heute sind in vielen Hexenzünften die Hexen-Darstellerin-nen auf dem Vormarsch. Sie übernehmen meist nicht nur die Ausbildung der Junghexen und treten als Tanztrainer-innen in Erscheinung. Vielerorts sind nun vermehrt auch tatsächlich Frauen unter den Hexenkostümen zu finden.
1. Moser, Dietz-Rüdiger: Fastnacht-Fasching-Karneval. Das Fest der ‚Verkehrten Welt‘. Edition Kaleidoskop. Styria. Graz [u.a.] 1986, S. 205.
2. Vgl. ebd. S. 215.
3. Vgl. ebd. S. 216.
4. Ebd. S. 205.
5. Ebd. S. 206.
6. Vgl. ebd. S. 210.
7. Ebd. S. 211.
8. Mezger, Werner: Das große Buch der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Ursprünge, Entwicklungen und Erscheinungsformen organisierter Narretei in Südwestdeutschland. Theiss. Stuttgart 1999, S. 53.
9. Moser (1986), S. 220.
10. Mezger (1999), S.53.
11. Ebd.
12. Ebd. S. 54.
13. Vgl. ebd. S. 51.
14. Vgl. http://www.kvv-allersberg.de/html/geschichte.htm [01.05.2014]
15. Vgl. http://www.flecklashexen.de/geschichte.html [24.04.2014]
Anmerkungen
72
16. Vgl. Interview mit Willy Bittner, Allersberg, lang-jähriger Präsident und heute Ehrenpräsident des Faschingskomitees; geführt am 24.04.2014.
17. Anm.: In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht beginnt mit dem Schmotzigen, Gombigen bzw. Gumpigen Donnerstag (= Unsinniger Donners-tag) die Fastnachtszeit. Schmotzig ist hierbei als alemannischer Ausdruck im Sinne von fett zu verstehen. Die Wortbedeutung rekurriert also auf den Umstand, dass zur Fastnacht geschlachtet und gebacken wurde. Fette Speisen waren in der sich anschließenden Fastenzeit streng untersagt. Der Begriff gumpig wiederum stammt aus dem Schwäbischen und bedeutet springen oder hüpfen (vom Verb gumpen), aber auch adjektivisch unru-hig oder nervös. Denkt man an die oft tollkühnen Sprünge und Bewegungen der Fastnachtsgestal-ten, ist die Bezeichnung Gumpiger Donnerstag durchaus nachvollziehbar. Vgl. dazu: Mezger (1999), S. 80ff.
18. Anm. Der Name Schwertgoschin bezieht sich auf das lose Mundwerk (Gosch) der Oberhexe, das so scharf wie ein Schwert sei.
19. Vgl. http://www.laudoniahexen.de/, dort insbe-sondere unter der Rubrik Iber d’Hexa [24.04.2014]
20. Anm.: Die Zunft wählte ihren Namen in Anleh-nung an den Spitznamen der Rheinbischofsheimer Einwohner. Dieser ist auf eine örtliche Sage zu-rückzuführen, nach der der letzte Graf von Rhein-bischofsheim so arm war, dass seine Bediensteten seine Pfannen auslecken mussten, um ihren Hun-ger zu stillen.
21. Vgl. Interview mit Jürgen Zink, Rheinau, Zunft-meister der Pfannenschleckerzunft; geführt am 30.04.2014.
22. Anm.: Unter Häs versteht man im schwäbisch-ale-mannischen Sprachraum schlicht das Narrenkos-tüm.
23. (23) Vgl. http://www.pfannenschlecker-zunft-rheinbischofsheim.de/, dort insbesonde-re unter der Rubrik Geschichte [24.04.2014]
24. Moser (1986), S. 258.
25. Vgl. Moser, Dietz-Rüdiger: Hosenrollen. Zum Kleider- und Geschlechtertausch, besonders im Leben, im Volksbrauch und auf der Bühne. In: Rheinische Vereinigung für Volkskunde (Hg.): Kleidung oder Verkleidung – Brauch oder Tradi-tion? (= Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 36). Verlag Franz Schmitt. Bonn 2006. S. 198f.
26. Anm.: Hierbei handelt es sich um Tier- oder Menschenattrappen mit Scheinreitern; heute finden sich solche unter anderem theriomor-phen Kostüme in Bräunlingen (der Stadtbock), in Briel (das Rößle) und in Rottweil (der Guller, ein Hahn). Vgl. Mezger (1999), S. 55f.
27. Mezger (1999), S. 56.
28. Ebd.
29. Ebd.
75
Du musst verstehn, aus eins mach‘ zehn …Hexen, kein Thema von vorgestern
von Hans Driesel
In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai wurde in alter Zeit ‚Beltane‘, das keltische Fest der Fruchtbarkeit gefeiert. Im Zuge der Christianisierung versuchte die
Kirche, dieses Fest aus dem Kalender zu streichen, weil ihr die sinnenfrohen orgiastischen Festlichkeiten missfielen. Als dies auf Widerstand stieß, ging die Geistlichkeit den Weg der Umdeutung. Man fand eine Heilige namens Walpurgis – die Äbtissin des Klosters Heidenheim – und erfand eine Mär, dass ihre Gebeine an einem 1. Mai nach Eichstätt übergeführt wurden. Damit liegt nun ein Hauch christlicher Festkultur über der Nacht zum 1. Mai, der Walpurgisnacht.
Doch im Volksglauben bleibt sie die Nacht der Sinnenlust, die Nacht des Phantastischen, die Nacht der Hexen. So zieht sich das Hexenthema durch die Menschheitsgeschichte und damit auch durch die Welt der Literatur, des Sprech- und Musiktheaters, der Sagen, Legenden und Märchen. Bis zum heutigen Tag.
Du musst verstehn!Aus Eins mach’ Zehn,und Zwei lass’ gehen,und Drei mach’ gleich,
so bist du reich.
Verlier’ die Vier!Aus Fünf und Sechs,
so sagt die Hex’,mach’ Sieben und Acht,
so ist’s vollbracht;
Und Neun ist Eins,und Zehn ist keins.
Das ist das Hexeneinmaleins.
Beim Hexeneinmaleins (Faust I, Szene Hexenküche) handelt es sich keinesfalls um eine Phantasterei Goethes, sondern um ein auf einem magischen Quadrat basierendes Zahlenrätsel des englischen Mathematikers John Dee (1527-1608). In der besagten Szene wird der alternde Dr. Faust verjüngt, um ihn dem Eros und damit der weiblichen Versuchung wieder zugänglich zu machen. Das ist nur durch Hexerei möglich.
76
Den Begriff Hexerei führen wir noch heute im Munde. Wir kommentieren damit das unerwartet Eingetroffene, und mit Hexe betiteln wir manchmal augenzwinkernd eine außergewöhnliche (schöne) Frau.
Hexenprozesse, noch im 18. Jahrhundert, auch in Franken
Der Hexenglaube ist keine Angelegenheit des finstern Mittelalters, denn aus dieser Zeit sind uns kaum
Hexenprozesse überliefert. Es bedurfte der Erkenntnisse der Neuzeit, der Entwicklung der Naturwissenschaften, um dem Hexenwahn den Boden zu bereiten. Dieser erreichte seinen Höhepunkt im 17. Jahrhundert und fand sein Ende erst hundert Jahre später. Zumindest nach Aktenlage und je nachdem, wie eng oder wie weit man den Begriff ‚Hexenjagd‘ fasst.
Am 21. Juni 1749, im Geburtsjahr Goethes, wird in Würzburg Maria Renata Singer, die Subpriorin des Klosters Unterzell als Hexe verurteilt und auf der Feste Marien-berg enthauptet. Der Körper der ‚Singerin‘ wird verbrannt, ihr Kopf auf eine Stange gesteckt mit Blickrichtung auf das Kloster Unterzell.
Und das noch 1749, im Jahrhundert der Aufklärung. Immanuel Kant hatte den Menschen zugerufen: Bediene Dich deines eigenen Verstandes! Doch dazu schien die Menschheit nicht in der Lage. Fast vierzig Jahre später, 1782, fand noch ein Hexenprozess in der Schweiz statt. Angeblich der Letzte in Europa. Der Fall Anna Göldi.
Abb. 37 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld.
77
Ein Denkmal für die Hexe
Der Dienstmagd Anna Göldi in Glarus war vorgeworfen worden, die Tochter ihres Dienstherrn
verhext zu haben. Anna Göldi gestand auf der Folter. Sie wurde verurteilt und mit dem Schwert hingerichtet. Ein Rehabilitationsverfahren im Jahre 2007 scheiterte zunächst am Einspruch der Kantonsregierung. Ein Jahr später gab die Regierung nach, Prozess und Hinrichtung wurden als Justizirrtum anerkannt. Damit war Anna Göldi nach 226 Jahren rehabilitiert. Heute erinnern in Glarus ein Denkmal und ein Museum an die unglückliche Frau.Anna Göldi kam aus ärmlichen Verhältnissen, war abhängig beschäftigt, hatte ein Verhältnis mit ihrem Dienstherrn(!). Allerdings gerieten auch Frauen aus höheren Kreisen ins Visier der Hexenjäger. Auch Männer und Kinder. Vor allem aber waren heilkundige Frauen, Hebammen und Kräuterfrauen ihrem Umfeld suspekt und schnell wurde aus der Kräuterfrau die Kräuterhexe, die beseitigt werden musste.
Der Hexenbegriff in der Literatur
Bereits im Buch der Bücher, der Bibel, wird von Hexen gesprochen und zur Hexenjagd aufgerufen. Im 2. Buch
Mose, Kapitel 22, Vers 17 lesen wir: Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen! Schon König Saul rief zu Hexenjagd auf, was ihn aber nicht davon abhielt, in auswegloser Situation Rat bei einer Totenbeschwörerin, der Hexe von Endor zu suchen.
Hexen sind in fast allen Religionen ein Thema. Die Grenzen zwischen der Weiblichkeit im Allgemeinen und dem Hexenbegriff im Besonderen sind oft fließend. Buddha riet seinen Jüngern, den Anblick der Frauen zu meiden, er setzte das Weibliche der Sünde, der Verführung und somit dem Unguten gleich. Die christlichen Religionen schlugen in die gleiche Kerbe und arbeiteten den Hexenjägern zu. Selbst ein kritischer Geist wie Martin Luther (1483-1546) hing noch dem Hexenglauben an. In einer seiner Predigtaufzeichnungen aus dem Jahre 1526 lesen wir: Hexen sollten getötet werden, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Sie können Kinder verhexen, Krankheiten anhexen, Liebe und Hass ins Haus bringen, das Land verwüsten. Tötet sie!
So hat Simone de Beauvoir (1908-1986) wohl nicht ganz unrecht, wenn sie über vierhundert Jahre später in ihrem Werk „Das andere Geschlecht“ den Hexenwahn wie folgt auf den Punkt bringt: Frauen wurden nur aufgrund der Macht ihrer Weiblichkeit verfolgt und verbrannt.
Abb. 38 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld.
78
Am Anfang war der Hexenhammer
Vier Jahre nach Luthers Geburt erschien der „Hexenhammer“, eines der folgenschwersten
Bücher der Literaturgeschichte. Das Machwerk, von zwei Dominikanermönchen verfasst, war fortan die Anleitung zur Verfolgung und Aburteilung von Hexen durch Folter und anschließender Verbrennung. Schon die Kapitelüberschriften wie z.B. ‚Über die Art, wie sie das männliche Glied weg zu hexen pflegen‘ liest man nur mit Kopfschütteln. Die Themen sind vielfach im sexuellen Bereich angesiedelt. Nicht selten projizierten die Ankläger ihre unterdrückten oder deformierten sexuellen Bedürfnisse auf die Angeklagten, vor allem auf die Frauen.
Die Unsinnigkeit der Prozesse war sicher manchem wachen Geist bald klargeworden. Doch wer traute sich schon, öffentlich gegen die Hexenjagd Stellung zu beziehen? 1631 wagte es der Jesuitenpater Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635). Er veröffentlichte anonym seine kritische Schrift „Cautio Criminalis – rechtliche Bedenken wegen der Hexenprozesse“. Das Buch bewirkte immerhin, dass in der Folgezeit einige Fürsten ein milderes Vorgehen gegen die vermeintlichen Hexen anordneten.
Die Hexe in der klassischen Literatur
Friedrich Spee von Langenfeld war ein Zeitgenosse des großen Dramatikers William Shakespeare. In dessen
Werk finden sich Hexen als die schicksalswebenden Botschafterinnen des Bösen. Andere große Literaten rückten verführerisch schöne Frauen in die Nähe der Hexen. Und wenn eine Frau gar das Begehren eines Priesters entzündete, war der Weg zum Scheiterhaufen nicht weit. Denken wir an das Schicksal der schönen Esmeralda in dem Weltbestseller „Der Glöckner von Notre Dame“ von Victor Hugo (1802-1885).
Mit Victor Hugo sind wir auch in der Zeit der deutschen Klassiker. Goethe und Schiller spielen mit dem Hexenbegriff, auch Heine und Fontane um zwei weitere Beispiele zu nennen. Freilich, Heine der Frauenfreund benutzte den Begriff mehr in der heiter-ironischen Form, aber immerhin. Wie z.B. in seinem Gedicht von der ‚Hexe
Loreley‘:
Zu Bacharach am Rheine, wohnt eine Zauberin,sie war so schön und feine und riss viel Herzen hin.
Und brachte viel zuschanden, der Männer rings umher,aus ihren Liebesbanden, war keine Rettung mehr.
Die die Männer zuschanden bringende, kopflos machende Loreley hat durch Heines Ballade „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ nicht nur die Romantiker beschäftigt, sondern auch Dichter und Komponisten unserer Zeit. Von Erich Kästner und Rose Ausländer über Karl Valentin bis Helge Schneider. Sogar die „Scorpions“ thematisierten das die Männer behexende Weib auf dem Felsen.
79
Die Schönheit des Weibes, das Ewigweibliche, das uns hinan zieht (Goethe) oder hinab zieht (Nietzsche)? Diese Diskussion wird uns bleiben. Ebenso wie der Begriff der Hexe. Es liegt an uns, welches Gewicht wir ihm verleihen. Vielleicht sollten wir uns die unbefangene Sicht der Kinder- und Jugendliteratur zu eigen machen.
Heia Walpurgisnacht …
Nicht nur im Werk der Brüder Grimm bevölkern Hexen die Kinder- und Jugendliteratur. Sie haben die Zeiten
überdauert und finden sich auch im 21. Jahrhundert in den Kinder- und Jugendbüchern. Die Faszination dieser Phantasiewesen ist offenbar ungebrochen. Denken wir an die Erfolgsgeschichten von Ottfried Preußler (1923-2013) und seine „Kleine Hexe“ oder an Joanne K. Rowlings (*1965) „Harry Potter“.
Leider gehört der nachstehende Artikel nicht in die Welt der Märchen. Am 28. April 2012 war in der Berliner Tageszeitung (TAZ) folgendes zu lesen:
Erst erdrosselt, dann verbranntWalpurgisnacht, die Hexen tanzen?
In Köln tagt ein Ausschuss zur Rehabilitation von Opfern der Hexenverfolgung. Nur der Erzbischof will sich nicht entschuldigen. Eine an Kardinal Meisner geschickte Petition ließ der Erzbischof durch seinen Generalvikar wie folgt beantworten: „Wir als Christen dürfen in dem Glauben an Gott als ewigen Richter darauf vertrauen, dass er selbst einst alle irdischen Ungerechtigkeiten und Unvollkommenheiten heilen
wird.
Eine recht zweifelhafte Vergangenheitsbewältigung. Kein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von Seiten einer Institution, die zu Zeiten einen schrecklichen Wahn beförderte und unterstützte.
Abb. 39 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld.
81
Hexenglauben im römischen Altertum und frühen Mittelalter
von Volker von Hoyningen-Huene
Der Glaube an mit Zauberkraft (gut oder böse) ausgestatteten Frauen ist in vielen Kulturen verbreitet. Deshalb sollen hier nur direkte, kulturelle Wurzeln betrachtet werden, die für unsere mitteleuropäische Kultur bedeutsam sein mögen.Die Vorstellung, dass Hexenkunst eine potentiell schädliche Kraft sei, deren Anwender getötet werden sollten, war keine Erfindung der christlichen Kirche. Diese Vorstellung ist in vorchristlichen Religionen vielfach zu finden, wie z.B. bei den Bacchanalien, von denen der römische Schriftsteller Titus Livius in seinem Werk Ab urbe condita berichtet, im Jahre 186 v. Chr. habe der Senat in einem Beschluss Senatus consultum de Bacchanalibus diesen Ritus verboten, mit der Ausnahme besonderer Umstände, welche die Zustimmung des Senates benötigten. Zuwiderhandelnden drohte der Tod. Der Beschluss kam als Folge einer außerordentlichen Untersuchung (quaestio extra ordine) zustande, während deren die Rechte der Befragten außer Kraft gesetzt waren und Folter angewandt werden konnte, insofern einem frühen Vorläufer der Inquisition.Im frühen Mittelalter ist der Canon Episcopi ein wichtiges Dokument in der Geschichte der Hexerei. Es wird zuerst in den Libri de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, die von Regino von Prüm um 906 verfasst wurden, erwähnt. Aber Regino selbst hielt es für einen früheren Text, worin ihm spätere Autoren folgten und glaubte, es stamme von einem „Konzil von Ankyra“ im Jahre 314. Jedoch fehlt hierfür jeglicher Nachweis. Das Werk wurde später in das Decretum des Burchart von Worms aufgenommen (entstanden ca. 1008 bis 1012), einem frühen Versuch, das gesamte
Abb. 40 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld.
82
kanonische Recht zusammen zu fassen. Später wurde es Teil von Gratians maßgeblichem Werk Corpus juris canonici von 1140 und wurde danach bis ins späte Mittelalter als kanonisches Recht betrachtet.
Der Canon Episcopi hat bei Historikern, die sich mit der Hexenwahnperiode beschäftigen, als frühe Darstellung der theologischen Position der katholischen Kirche zur Frage der Hexenkunst große Aufmerksamkeit gefunden.Auch hat er bei Forschern des Neu-Heidentums Aufmerksamkeit erregt, da die Schrift den Glauben an die Hexenkunst mit der heidnischen Verehrung der römischen Göttin Diana zu verknüpfen scheint. Dieses Bindeglied wurde von manchen Autoren als Begründung für die Vermutung genutzt, dass die europäische Hexenkunst eine Fortsetzung vorchristlicher heidnischer Religionen sei.
Der zentrale Satz im Canon Episcopi lautet:Auch dies darf nicht übergangen werden, dass einige verruchte, wieder zum Satan bekehrte Frauen von den Vorspiegelungen und Hirngespinsten böser Geister verführt sind und glauben und behaupten, sie ritten zu nächtlicher Stunde mit Diana, der Göttin der Heiden, und einer unzähligen Menge von Frauen auf gewissen Tieren und legten in der Stille der tiefen Nacht weite Landstrecken zurück und gehorchten ihren (Dianas) Befehlen wie denen einer Herrin und würden in bestimmten Nächten zu ihrem Dienst herbeigerufen (Hartmann 2004, S. 421)Die europäische Kirche und Gesellschaft waren nicht immer begierig, Hexen zu jagen und diese für schlechte Ereignisse verantwortlich zu machen. So erklärte St. Bonifaz im 8. Jahrhundert, dass der Glaube an Hexen unchristlich sei.785 stellte die Heilige Synode von Paderborn fest: Wer vom Teufel verleitet nach heidnischen Glauben behauptet, dass es Hexen gibt und sie auf dem Scheiterhaufen verbrennt, wird mit dem Tode bestraft.
Dieses Dekret wurde von Kaiser Karl dem Großen bestätigt, der die Anordnung erließ, dass die Bischöfe alle aus der christlichen Gemeinschaft ausschließen sollten, die an teuflische Magie und den nächtlichen Flug der Hexen glaubten.Im Jahre 820 wiesen der Bischof von Lyon und andere den Glauben zurück, dass Hexen schlechtes Wetter machen, bei Nacht fliegen und ihre Gestalt ändern könnten. Dieser Glaube wurde in das kanonische Recht aufgenommen und erst Jahrhunderte später aufgegeben, als die Hexenverfolgungen zunahmen. In der Tat waren die Autoren des späteren Malleus Maleficarum (Hexenhammer, 1486) gezwungen, eine Reinterpretation des kanonischen Rechts zu fordern, um ihren Glauben, Hexerei sei real und finde statt, mit dem Kanon in Übereinstimmung zu bringen.
Quellen:
Das Sendhandbuch des Regino von Prüm. Unter Benutzung der Edition von F.W.H. Wasserschleben, hrsgg. und übersetzt von Wilfried Hartmann, Darmstadt 2004 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 42).
Titus Livius, Ab Urbe Condita, XXXIX.
83
Hexenglauben und Hexenverfolgung vom Mittelalter bis in die Neuzeit
von Volker von Hoyningen-Huene
Erst das Aufkommen und die große Verbreitung von häretischen Sekten in europäischen Ländern in den Jahren 1000-1200 zwingt die Kirche, ihre Haltung gegenüber dem Hexenglauben zu ändern und seine Existenz einzugestehen. Dabei wurden Hexerei und Häresie anfänglich gleich gesetzt.
Thomas von Aquin (1225-1274) bestätigt die Existenz von Hexen und folglich auch von Dämonen. Er erklärt, dass es die Magie gebe und dass sie nicht das Werk der Hexen, sondern der Teufel sei (Superstitionstheorie). Er gilt als bedeutendster Philosoph und Theologe des Mittelalters mit Einfluss auf die katholische Lehre bis heute.
1235 Breve von Papst Gregor IX., die Inquisition wird endgültig eingesetzt. Die Kirche gab das Prinzip der Nichtexistenz von Dämonen und Hexen auf. Gregor IX. überträgt den Dominikanermönchen diese Aufgabe.
1252 Papst Innozenz IV. lässt die Folter zur Wahrheitsfindung zu.
1264 Erste Hexenverurteilung in Deutschland.
Abb. 41 Johann Philipp von Schönborn, Ölgemälde im Städtischen Museum Kitzingen.
84
1484 Apostolische Bulle Summis desiderantes affectibus des Papstes Innozenz VIII. Der Text der Bulle wurde auf Betreiben von Heinrich Institoris (Verfasser des späteren Hexenhammers) durch das Sekretariat des Papstes ausgefertigt und von ihm verkündet.
In seinem Regest von 1901 fasst Hansen den Inhalt der Bulle wie folgt zusammen:
Papst Innozenz VIII. ermächtigt die beiden in Deutschland tätigen Inquisitoren Heinrich Institoris und Jacob Sprenger, gegen die Zauberer und Hexen gerichtlich vorzugehen. Er erklärt den Widerstand, den dieselben seither in Kreisen von Klerikern und Laien bei dieser Tätigkeit gefunden haben, für unberechtigt, da diese Verbrecher tatsächlich unter die Kompetenz der Ketzerrichter gehören, und beauftragt den Bischof von Straßburg, die den Inquisitoren etwa entgegengesetzten Hindernisse durch die Verhängung kirchlicher Zensuren zu beseitigen.
1486 Der Hexenhammer (Malleus Maleficarum) wird von dem Dominikanermönch Heinrich Kramer (Henricus Institoris) als Legitimation und Anleitung der Hexenverfolgung in Speyer veröffentlicht. Bis ins 17. Jahrhundert erschien das Werk in 26 Auflagen.
Unter Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn nehmen die Hexenverfolgungen zu.
1626-1630 Höhepunkt der Hexenverfolgung in Deutschland.
Abb. 42 Malleus maleficarum, Lyon 1669.
85
Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhausen (1617-22), zugleich Fürstbischof von Bamberg, geht als Hexenverfolger in die Geschichte ein. Unter seiner Regierung nahmen die Hexenverfolgungen große Ausmaße an (siehe Hexenprozesse in Würzburg).
1612/1613 und 1617/1618 starben im Hochstift Bamberg 300 Personen in den Flammen der Scheiterhaufen. Allein 1617 wurden 102 Menschen im Hochstift als Hexen hingerichtet.
Die Hexenverfolgungen wurden unter seinem Bamberger Nachfolger Johann Georg II. Fuchs von Dornheim, genannt der Hexenbrenner, noch gesteigert.
Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg setzt die Hexenverfolgung fort. Er betrieb eine harte Rekatholisierungspolitik. Zugleich ist sein Name mit der Hexenverfolgung im Würzburger Territorium verbunden, die zwischen 1626 und 1630 ihren Höhepunkt erreichte.
Im Stift brannten über 900 Hexen, allein in der Stadt Würzburg an die 200. Die Hexenverfolgung erfasste Menschen aller Stände: Adlige, Ratsherren und Bürgermeister wurden neben einfachen Leuten verbrannt. Ein Fünftel der in Würzburg Verbrannten waren Priester und Ordensleute.
Im nahen Gerolzhofen wurden Verbrennungsöfen installiert, um die rund 200 Menschen pro Jahr fristgerecht verbrennen zu können.
Erst das Reichskammergericht und der Tod von Philipp Adolf am 16. Juli 1631 beendeten die Prozesse.
Erst mit Johann Philipp von Schönborn tritt im Würzburger Raum eine Abkehr vom Hexenwahn ein und eine Periode der Toleranz beginnt.
Um 1700 Beginn des Zeitalters der Aufklärung.
1775 Letzte Verurteilung einer Hexe zum Tod durch Verbrennung in Deutschland.
Im Stift Kempten (Allgäu) wird wegen erwiesener Teufelsbuhlschaft Maria Anna Schwegelin zum Tode durch Verbrennen verurteilt. Das Urteil wird aber nicht vollstreckt, Maria Anna Schwegelin stirbt 1781 in einem Zuchthaus in Kempten.
Um 1950: Die moderne Kultur der Hexerei beginnt ihre ersten Zeichen zu setzen.
Quellen:
Joseph Hansen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn 1901, S. 24-27 Nr. 36 (zitierfähige lateinische Ausgabe).
87
In Kitzingen ging´s den Hexen gut
von Stephanie Nomayo
Wir befinden uns im 17. Jahrhundert. In Franken brennen die Scheiterhau-fen. Leben wird darauf geopfert, Frau-en, Männer, Kinder, Edelleute und arme Menschen, sogar Tiere, geköpft, stranguliert, gefoltert, jeder Würde be-raubt, zur Schau gestellt.
Als die Hexenseuch in Franken wütete und ehrgeizige Kir-chenfürsten die Flammen mit jenen Menschen nährten, die von der frühbarocken Gesellschaft zu Sündenböcken erkoren wurden, deren Sterben man inszenierte, deren akribisch verwaltete Folter- und Verköstigungsgebühren man den Angehörigen auferlegte und deren Habe man sich auf der Grundlage sorgfältig geführter Gerichtsverfahren und fürstbischöflicher Instruktionen reinen Gewissens bemächtigte, füllten sich die eisenbeschlagenen Eichen-holztruhen geistlicher und weltlicher Magnaten durch die Schauprozesse quasi von selbst. Jeder Prozess schaffte neue Nahrung. Keine(r) war vor dem Gespenst der Denun-ziation sicher.
Während das Bamberger und Würzburger Hochstift sich zum Glutofen von Hexen, Juden und Protestanten verfol-gender Eiferer auf dem Fürstenthron entwickelte, hat sich ein fränkisches Landstädtchen ohne große Worte heraus gehalten, Kitzingen!
Pragmatisch und nüchtern hat das Kitzinger Stadtregiment in Abstimmung mit dem damaligen Stadtherrn, dem Mark-grafen Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach, durch-aus einige Fälle von Malefizvergehen geprüft. Man ist aber relativ schnell und ohne hochnotpeinliche Befragung zur Einsicht gelangt, dass wohl weder im Fall der gelähmten
Buchbrunner Stiefmutter, die ihre Familie, den Sohn und ihren Mann, den Vater Stahl, beschuldigte, sie krank ge-hext zu haben, als auch im Fall des schwitzenden Och-sen, der von der Buchbrunner Witwe Affra Helbing ver-hext worden sein soll, Hexerei im Spiel gewesen wären. Im letzten Fall hat man auf Anordnung des Markgrafen sich den Denuntianten Holtzmann etwas genauer vorge-nommen. Er hatte im Zusammenhang mit seinem Verhör sowohl die Buchbrunner Witwe Affra Helbing in Verruf gebracht, besagten Ochsen verhext zu haben, als auch die Buchbrunner Witwe Elisabeth Stapf. Sie wurde von ihm beschuldigt seiner Frau, der Holtzmannin, empfohlen zu haben, etwas vom Buchbrunner Bildstock abzuschlagen, um damit das Fieber eines erkrankten Kindes zu heilen. Für Elisabeth Stapf wurde es in diesem Zusammenhang eng, weil auch der junge Georg Stahl zugab, seine Stief-mutter mithilfe eines Zaubers, den er wiederum von der Witwe Elisabeth Stapf gelernt haben wollte, tatsächlich krank gehext zu haben1.
Entsprechende Verfahren wurden auf der Grundlage der sogenannten Brandenburgischen Halsgerichtsordnung eingeleitet. Denn auch das Kitzinger Stadtregiment war 1517 durch markgräfliche Schenkung in den Besitz einer entsprechenden Ausfertigung dieses zu damaliger Zeit wohl fortschrittlichsten Strafgesetzbuches gebracht wor-den. Die ansonsten eher sparsamen Markgrafen hatten ihre Schenkung, wie aus der entsprechenden Vorrede folgt, be-gründet: Nachdem wir verschiedentlich erfahren haben, dass hier an den Halsgerichten unserer Fürstentümer durch Über-sehen und Unwissenheit viel Mißbrauch und schlechte Gewohnheit eingewachsen, die dem Rechte nicht gemäß, haben wir Gott zu Lob mancher zukünftiger unbillicher Beschwernis der leute zuvorkommen wollen, auch die Missetat desto besser un förmlicher gerechtfertiget und gestraft werden vermöge, ist diese unsere nachträgliche Reformation und Ordnung gesetzt und gemacht worden.
Abb. 43 Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach, Kupferstich, Städtisches Museum Kitzingen.
89
Berücksichtigt man, dass diese Strafgerichtsordnung für Vergehen wie Mord, Totschlag, Abtreibung, Diebstahl, Raub etc., darunter aber auch Gotteslästerung und Zau-berey, Strafen vorsah, wie Verbrennen, Köpfen, Hängen, Pfählen, Rädern, Ertränken, Vierteilen und in leichteren Fällen die sogenannten Lebensstrafen wie Auspeitschen, mit glühenden Zangen reißen, Ohren abschneiden, Fin-ger abhauen und ähnliches mehr, so versteht man, dass das Einleiten eines solchen Verfahrens nicht leichtfertig geschehen durfte, wollte man die Betroffenen und deren Angehörige nicht schwerenwiegenden Folgen aussetzen.
Vielleicht war das auch der Grund, warum der Kitzinger Stadtrat in den genannten Verfahren nicht nur vorsichtig agierte, sondern offensichtlich sogar versuchte, eine Aus-weitung der Verfahren auszubremsen.
Im Stadtarchiv Kitzingen ist der Fall der Elisabeth Stapf für den 5. Januar 1606 als die Untersuchung einer Malefizper-son von Buchbrun belegt. Es findet sich folgender Eintrag2:
Stadtarchiv Kitzingen, Rat 13 1602 – 1613, fol. 185, 186
Rhattschlag gehalten Sontags den 5. Januarii Anno 1606
Malefitz Person von Buchbrunn. Item nach dem der Herr Ambtman [Hans Ludwig von Münster] ein Weib [Elisa-beth Stapf] Von Buchbrun, verdechtig Hexerey halben, einziehen lassen, und die Verhör im Ambthaus, Abwesend Castner, Vogts und Bürgermeisters für sich vorgenommen, wo doch solches uffm Rhatthauß geschehen sollen, unnd doch heut dato durch Wendel Schlehenriedten begern lassen, ein bericht schreiben, so Herr Ambtmann in sei-nem namen allein gefertigt, nach Hoff zuordnen, und ein Erb. Rhatt daß Pottenlohn darzulegen, ist Wendel Schle-henriedten in gantzer Rhatsversamblung zur Antwortt Angezeigtt worden, weils von Alterß her khommen, daß dergleichen Verhör uffm Rhathauß vorgenommen, und Alßdann die Bericht nicht Allein in der beampten, son-dern auch in Bürgermeister und Rhats namen abgangen seindt, daß aber in disem fall nicht geschehen: So müsste man daß Bottenlohn auch nicht darzulegen.
Abb. 84 Inhaltsverzeichnis und Einband, Brandenburgische Halsgerichtsordnung, Stadtarchiv Kitzingen MAN 1 1516 (alt: 347).
Abb. 83 Ausschnitt aus dem Ratsprotokoll, Stadtarchiv Kitzingen, Rat 3 1602-1613, fol. 185, 186.
91
Der Stadtrat war demnach nicht bereit, den Botenlohn des Kitzinger Amtmannes Franz Ludwig von Münster – er war der Zehntrichter in Kitzingen – für einen Bericht an den Stadtherren, den Markgrafen Joachim Ernst von Branden-burg-Ansbach zu erstatten, da bei der Durchführung des Verhörs, wie aus dem Vermerk hervorgeht, offenbar ernst-hafte Formfehler begangen wurden. So wurde zum einen versäumt, den Ehrbaren Rat, Erb.Rhatt, bei der Ausstel-lung des Berichtes hinzuzuziehen, andererseits wurde of-fenbar auch das Verhör unter Ausschluss des Rates vorge-nommen, denn es wird weiterhin moniert, dass das Verhör nicht, wie es von Alterß herkhommen üblich war, auf dem Rathaus vorgenommen wurde.
Wir wissen zwar nicht, wie der Bericht ausgesehen hät-te, wenn der Kitzinger Stadtrat hier tatsächlich mitzure-den gehabt hätte, aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass es überhaupt keinen Bericht gegeben hätte. Denn die Verweigerung des Botenlohnes ist wohl eher ein Versuch, die Weiterleitung eines Berichtes an den Markgrafen und damit einen drohenden Prozess durch die fürstlichen Räte oder den Stadtherrn von vorneherein zu verhindern.
Doch die Antwort des Markgrafen ist nüchtern und, wie Helga Walter 19872 schreibt, tatsächlich ein Ruhmesblatt für Vernunft und Weisheit in dieser vom Hexenwahn heim-gesuchten Zeit.
Bereits Anfang Februar 1606 erreichte daher den Amt-mann Franz Ludwig Münster folgendes Schreiben des Stadtherrn und Fürsten3:
Von Gottes Gnaden Joachim Ernst…
[…]
Uns ist ewer fernerer bericht und der zue Kitzingen ver-hafften Georgen Stahls des Eltern unnnd Elisabetz Stapfen von buchbrunn, wie auch Hannsen Holtzmans daselbsten aussagen, sambt anderer darüber verhörter personen an-zeig alles inhalts verleßen worden.
Unns hette gleichwol wie neherals auch angedeutet, strack anfenglichs nottwendige erkundigung der Stapfin Lebens und wandels halben eingezogen, unnd nicht sobalden uff des Jungen Stahls als einen leichtfertigen gesellen bloses angaben, mit gefenglicher einziehung gegen ihr verfahren werden sollen, dann weilen sich die beschuldigte zauberey weder aus ihrer noch aus der verhörten personen aussag befunden, so sehen wir keine Ursachen, warum sie Stap-fin lenger inn der verhafft uffzuhalten, sondern bevelhen hiermit, ihr wollet sie, als die zue Buchbrunn seßhafft, den negsten ohn allen entgelt wider von statten lassen, deß-gleichen den alten Stahlen, weilen er leichtfertige gesell-schaft geherbrigt und seinen ungerahtenen Söhnen, zue ihrem bösen leben nicht wenig anlaß gegeben, uff Bezah-lung sein und der Rastin atzung (die kunfftig seinem ent-wichenen Sohn Georgen einstmals wider abzukürzen) der verhafft erledigen.
Den Holtzmann aber umb seiner gebrauchten verbottenen zauberey und verursachten aberglaubens willen, uffs we-nigst ein paar dag ins Thurm straffen, fürtters nach ernst-lichem verweiß seines begangenen Unrechts, und wann er seine atzung bezahlt, wird fortlassen, mit angehengter be-trohung , so man das geringste mehr uff ihme erfahre, als daß ein ander straff darauf folgen solle,
[…]
darbey es nochmals verbleibens, mit gnaden gewogen.
Datum Onoltzbach 5. February 1606Abb. 85 Foltergeräte, Illustration Vorsatzblatt, Brandenburgische Halsgerichtsordnung, Stadtarchiv Kitzingen MAN 1 1516 (alt: 347).
93
Vor dem Hintergrund des gleichzeiti-gen Wütens der Würzburger Fürsten ist dieses nüchterne Urteil hochinter-essant. Zum einen wird moniert, dass aufgrund der Aussagen eines windigen Gesellen, nämlich des jungen Georg Stahl, die Witwe Elisabeth Stapf über-haupt in Haft genommen worden war, hierbei wird bemerkenswerter Weise vom Markgrafen offenbar sogar die Selbstbezichtigung des Schadenhe-xens des jungen Mannes ignoriert, zum anderen ist der einzige, der für ein paar Tage in Arrest genommen wurde, der Denunziant und Dorfschamane Holtzmann selbst, damit er sich seines Aberglaubens gewahr werde. Er hatte übrigens auch seine Verpflegung (At-zung) im Turm selbst zu tragen und dürfte auf der Grundlage der Drohung, dass ihn noch andere Strafe einholen könnte, vermutlich nicht mehr weiter aufgefallen sein.
Es ist verständlich, dass dieses Urteil in Kitzingen wirkte! Es wurde kein weiterer Fall von Malefizvergehen zur Zeit der Markgrafen mehr bekannt.
Als allerdings 1628 die Stadtherrschaft wechselte, indem die Stadt Kitzingen durch Fürstbischof Philipp Adolph von Ehrenberg wieder eingelöst wurde, kam es auch in Kitzingen zu Vertrei-bungen und Verfolgungen, diese betra-fen die Kitzinger Protestanten.
Die damalige Entscheidung von Kitzinger Stadtrat und Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach im frühen 17. Jahrhundert sollte für Kitzingen und seine Bür-ger heute noch mahnender Auftrag und Verpflichtung sein, auch in kritischen Situationen vernünftig zu bleiben und im Zweifelsfall dem klaren Menschenverstand zu gehor-chen, anstatt Vorurteilen, Gerüchten und Denunziationen das Ohr zu leihen!
In diesem Sinne ist auch dieses Buch der Vernunft gewid-met. Es werden Abbildungen und anschauliche Schilde-rungen brennender Scheiterhaufen und obszöne Abbildun-gen des Grauens bewusst vermieden, auch um den Opfern nicht im Nachhinein noch ihre letzte Würde zu nehmen.
Unter pädagogischem Aspekt hat das hier versammelte Autorenkollektiv versucht, eines der dunkelsten Kapitel fränkischer Landesgeschichte so aufzubereiten, dass es als Lehrstück zum Nachdenken, Vergleichen und Mitfühlen anregt, und so den Weg bereitet, für Verständnis und Ver-nunft im vorurteilsfreien Umgang miteinander.
Anmerkungen:
1. wiedergegeben auf der Grundlage von Helga Walter, He-xen in Buchbrunn, ein Fall aus der Kitzinger Justizge-schichte, Teil III, Am fränkischen Herd, Heimatkundliche Beilage der Kitzinger Zeitung und nvz, 26. Jahrgang - Nr. 4 – Samstag, 13. Juni 1987, sowie Helga Walter, Hexen in Buchbrunn, in Helga Walter, Bilderbogen der Kitzinger Stadtgeschichte erzählt von Helga Walter, vom Siechhaus-meister bis zum Klostermüller, Kitzingen 1987, S. 88 ff.
2. Erneut transkribiert von Doris Badel, Leiterin des Stadtar-chivs Kitzingen, der ich hierfür herzlich danke.
3. zitiert nach Helga Walter, Am Fränkischen Herd (1987), S. 140.
Abb. 86 links: Wappen der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, rechts: Artikel zur „Straff der Zauberey“, Brandenburgische Halsgerichtsordnung, Stadtarchiv Kitzingen MAN 1 1516 (alt: 347).
95
Das Strafschwert Ehrenbergs: Gü-terkonfiskation
von Stephanie Nomayo
Ein Jahr vor der Wiedereinlösung Kitzingens hatte sich die Situation im Hochstift Würzburg dramatisch zugespitzt.
Am 10. Juni 1627 erließ Fürstbischof Philipp Adolph von Ehrenberg ein allgemeines Mandat zur Beschlagnahmung der Hexengüter. Diese sogenannte Instruction bildete die rechtliche Grundlage mit welcher die Einnahmen aus den Hinrichtungen guten Gewissens von den Ämtern des Hochstifts, den Exekutionseinrichtungen und dem Fiskus des Hochstifts eingezogen werden konnten.
Ehrenberg begründete sein rigides Vorgehen mit Gottes Fügung:
Es zeige sich bei seiner ohnehin sehr beschwerlichen und gefahrvollen Regierung das Laster aller Laster, d. i. die Hexerei und Teufelskunst, aus besonderem göttlichen Ver-hängnis dergestalt, dass die Vernachläßigung der gänz-lichen Ausrottung dieses Uebels unverantwortlich und höchst strafbar seyn würde. Auf wunderbare und nach allen Umständen göttliche Eingebung und Handbietung habe er (Ehrenberg) deswegen nicht unterlassen, schon seit geraumer Zeit die Zahl der dem Laster der Hexerei ergebenen Unmenschen, so viel deren durch fleißige Inqui-sition zu entdecken gewesen, mittels leidentlicher Bestra-fung und Hinrichtung zu mindern. Dabei habe sich aber ergeben, daß, je mehr man diesem Laster den Untergang zu bereiten strebe, dessen Anhänger sowohl von Manns= als Weibsgeschlechte nur desto stärker sich vermehren.
Diese Erscheinung müsse als ein offenbares Merkmal an-gesehen werden, daß Gott, wofern die irdische Obrigkeit von dem ihr anvertrauten Strafschwerte Gebrauch zu ma-chen unterlasse, alsdann Feuer und Schwefel vom Himmel herab das Land heimsuchen und wie einst Sodoma und Gomorra vertilgen werde, zumal da bisher weder Krieg, Hungersnoth und Pestilenz noch andere Unfälle eine Bes-serung der Menschen bewirkt hätten. Ja die göttliche Strafe werde hier noch schwerer als damals seyn, weil die Unholden neben dem Laster der Sodomiterei selbst die Majestät Gottes verletzten, Gott und seiner heiligen Reli-gion entsagten und sich dem Teufel zu allen erdenklichen Schandtaten, zu Ehebruch, Mord, Diebstahl etc. ergäben. Diese Verruchtheit verdiene demnach nebst der Strafe an Leib und Leben wohl auch jene der Güterkonfiskation1.
System bekam die Güterkonfiskation in der Form, dass Ehrenberg in allen Ämtern und Orten seines Landes Ver-walter einsetzte, die jene Gelder einnehmen sollten, wel-che aus den Gütern hingerichteter Malefizpersonen erlöst werden konnten.
Sie waren angehalten, die Güter zeitnah zu liquidieren und hatten gemäß der folgenden INSTRUCTION darüber Rechnung abzugeben:
Instruction Vor die jenige, welche so wol in der Stadt Wirt-zburg, als auf dem Land, zu Einnehmung deren Hexerey wegen judizierter Personen verfallener Güter vorordnet seynd.
Demnach der hochwürdig Fürst, Unser gnädiger Fürst und Herr von Wirtzburg, aus sonderbarer göttlicher Schickung und gleichsam wunderbarlichem Anlaß dahin gemüssiget worden, dem Ertzlaster der Hexerei und Teuffelskunst, mit gebührendem Ernst, in Recht verordneter Inquisition nachsetzen, und dann S. Fürstl. Gn. Krafft underschiedli-cher demselben ohnfehlbar mitlauffender unthaten, neben der ordentlichen Verwirkung Leibs und Lebens, auch alle
Abb. 81 Philipp Adolph von Ehrenberg, Kupferstich, Städtisches Museum Kitzingen.
96
derselben Haab und Güter einzuziehen, und deren Fisco zuzueignen befugt werden2…
Innerhalb dieser Instruction wird genau geregelt in welcher Form die verschiedenen Arten von Gütern, seien es liegende (Liegenschaften) oder Realien ein-gezogen, in welcher Form versteigert und zu welchen Anteilen die daraus erlösten Gelder von den Ämtern, in welchen die Hingerichteten lebten, von den Exe-kutionseinrichtungen und dem Hochstift einbehalten werden sollten.
Kurz nach Erlass dieses Mandates, das am 14. Juni 1627 in Kraft trat, brannten die Scheiterhaufen.
Am 17. Juni 1627 wurden 9 Menschen, am 20. Juli 6 Menschen, am 7. August 7, am 18. August 18, am 23. August 7, im September 5, am 26. Oktober 10, das heißt innerhalb von 5 Monaten wurden allein in Würzburg 62 Menschen auf den Scheiterhaufen hin-gerichtet. 1628 und 1629 wurde diese Hinrichtungs-welle fortgesetzt.
Anmerkungen
1. Zitiert nach Carl, Gottfried Scharold, Zur Ge-schichte des Hexenwesens im ehemaligen Fürstbis-thume Würzburg, Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg, Würzburg 1840, S. 128, 129.
2. Ebd. S. 129, 130.
97Abb. 44 Johann Caspar Barthel, Kupferstich, Städtisches Museum Kitzingen. Im Hintergrund die Etwashäuser Kreuzkapelle, an deren Einweihung er 1745 teilnahm und deren Hochalter er stiftete.
Johann Caspar Barthel
Hätte er die Hinrichtung Maria Renatas verhindern können?
von Stephanie Nomayo
Johann Caspar Barthel wurde 1697 in Kitzingen geboren. 1721 wurde er,
nach Abschluss eines Theologiestudiums, in Würzburg zum Priester geweiht. Während seines zweijährigen Studien-aufenthaltes in Rom erlangte er den Grad des Juris Utriusque Doctor (Gelehrtheit im zivilen Recht, Corpus iuris civilis, und im kanonischen Recht, Corpus iuris canonici). 1727 kehrte er nach Würzburg zurück und wurde zum Professor für Kirchenrecht und Regens des Würzburger geistlichen Seminars ernannt, das, 1589 von Julius Echter gegründet, sich zur Zeit der Leitung Johann Caspar Barthels in den Räumen der Alten Universität Würzburg befand.
98
1728 wurde Barthel geistlicher Rat und ein Jahr später Doktor der Theologie. Seit 1738 war er Kanonikus im Stift Haug, 1743 wurde er ins Würzburger Domkapitel aufgenommen.
1745 nahm er gemeinsam mit dem Würzburger Fürstbischof Friedrich Carl von Schönborn an der Einweihung der Kitzinger Kreuzkapelle teil. In seinem Testament im Jahr 1771 stiftete er den Hochaltar für diese, von Balthasar Neumann erbaute Kirche seiner Heimatstadt. Von 1754 bis zu seinem Tod am 8. April 1771 war er Dechant des Stiftes Haug und Vizekanzler der Universität Würzburg.
Im Jahr 1749 gehörte der gebürtige Kitzinger Dr. Johann Caspar Barthel zusammen mit dem geistlichen Rat, Dr. Johann Anton Michael Wenzel, sowie den beiden Jesuitenpatres, Adam Staudinger und Ulrich Munier, jener geistlichen Untersuchungskommission an, die das Verhör der Subpriorin des Klosters Unterzell auf Verdacht der Hexerei durchführte. Das Verhör, das am 19. und am 21. Februar 1749 stattfand, setzte sich aus 211 Hauptfragen zusammen. Gemäß den Richtlinien des 1487 verfassten Hexenhammers, dem Standardwerk der Hexenverfolgungen, wurde das Verhör systematisch aufgebaut. Es bestand aus Fragen zur Person und Biographie der Inquisitin, Fragen nach dem Hexenmal, Teufelsbuhlschaft, Abschwur, Hexenversammlung und Zaubermittel, Schadenzauber und Hexenwissen, Hostienschändung, theologischen Fragen und Reueermahnungen1.
Die Hexerei galt als Sonderverbrechen, als crimen exceptum. Die im Normalfall gültigen Prozessregeln waren daher außer Kraft gesetzt, die Verhaftung konnte bereits auf Verdacht erfolgen. Die Delikte aber, Schadenszauber und Hexenflug, konnten nur durch ein Geständnis
nachgewiesen werden. Die Position der Befragten war aussichtslos, da die gewünschten Antworten durch Folter erzwungen werden konnten.
Am 21. Juni 1749 wurde der Inquisitin im Beisein zweier Hofschultheißen und zweier Stadtgerichtsbeisitzer das von Johann Caspar Barthel verfasste Endurteil vorgelesen. Hierbei zweifelte allerdings der Kommissionsvorsitzende an der Rechtmäßigkeit des Prozesses2. Er ging zwar von der realen Hexenexistenz aus, erachtete aber die Indizien für nicht ausreichend, die Subpriorin hinrichten zu lassen3.
Er bat, die Nonne ohne peinliche Befragung zu vernehmen und von einer Hinrichtung der Angeklagten abzusehen.
Das Gnadengesuch des Kommissionsvorsitzenden war die letzte Möglichkeit, Maria Renata vor einer Hinrichtung zu bewahren. Doch die Übergabe an den weltlichen Richter konnte nicht verhindert werden, da die Vertreter der konservativen Richtung die Stimmenmehrheit hatten4.
Im nachfolgenden Auszug aus dem Schauspiel Die Großin und der Große – Maria Renata, die letzte Hexe von Franken zeichnet der Autor, Hilarius Triftig, das Dilemma in welchem sich die Inquisitin befand noch einmal in eindrucksvoller Inszenierung nach.
Anmerkungen:
1. Sussman-Hanf, Claudia: Maria Renata Singer von Mossau – Die letzte Hexe von Würzburg. In: Frankenland, 47. Jg. 1995, S. 25-36
2. Sussman-Hanf, 1995, S. 28.3. Sussman-Hanf, 1995, S. 32.4. zitiert nach Sussman-Hanf, 1995, S. 32.
99
Maria Renata steht allein für Viele vor ihr. Sie war die letzte Frau aus Franken, die auf dem
Scheiterhaufen stand, 1749 als Hexe denunziert, verurteilt und verbrannt.
Die folgenden Textauszüge waren Grundlage einer szenischen Lesung im Historischen Theaterkeller des Deutschen Fastnachtmuseum Kitzingen von und mit dem Autor Hilarius Triftig aus seinem Buch Maria Renata (erschienen als Passionsspiel zur 1250 Jahrfeier der Marktgemeinde Höchberg, Höchberg 1998, illustriert von
Stephanie Nomayo.)
Maria RenataSinger von
Mossauvon Hilarius Triftig
Abb. 45 Hinrichtung Maria Renatas, die Entwurfsskizze zeigt den Nachrichter von Kitzingen, der gerühmt wurde, dass es ihm gelang, die Nonne mit einem einzigen Schwertstreich zu köpfen, Entwurfsskizze zur Illustration des Passionsspiels von Stephanie Nomayo 1998.
100
Auszug 1:Inquisition, vorgefertigte Fragen
und Antworten
CHRONIST: Der Fürstbischof Karl Philipp von Greiffenclau zu Vollraths wusch seine Hände in Unschuld. Eine geistliche Kommission war schon von seinem Vorgänger eingesetzt worden. Vertreter der geistlichen Kommission, Rene Munier, Johann Kaspar Barthel und Richard Traube, erschienen bei Maria Renata, um sie zu verhören.
Karsamstag 1749: Die geistliche Kommission, bestehend aus Rene Munier, Johann Kaspar Barthel und Richard Traube, kommt in das Kloster Frauenzell. Die Inquisitoren suchen die Inquisitin Maria Renata in ihrer Zelle auf.
MUNIER: Wann also Inquisitin dem bösen Feind mit ihrem Blut unterschrieben?
MARIA RENATA: Ich habe niemals mit meinem Blut dem Teufel eine Unterschrift gegeben. Mit vierzehn Jahren kam ich zu einer besonders vornehmen Frau in München, die mich in ihre Gesellschaft aufnehmen und zu dem Zweck in ein Buch aufschreiben wollte. Nachts kam die Frau an mein Bett und holte mich ab. In ihrer Gegenwart ist aber solches nie geschehen, dass ein anderer oder eine andere unterschrieben hätte.
MUNIER: Auf wieviel Jahre der Pakt mit dem Teufel abgeschlossen wurde?
MARIA RENATA: Von einem Soldaten, der mir den Schädel gegeben, habe ich auch einen Zettel und eine Wurzel bekommen. Der Bund zwischen uns, meinte
er, sollte 60 oder 70 Jahre dauern, wenn er nicht durch geistliche Herren gebrochen würde. Dann käme er, der Soldat, um mich abzuholen, vorausgesetzt, er oder ich leben noch.
TRAUBE: Und die weiteren Bedingungen?
MARIA RENATA: Der Soldat meinte: Wenn ich womöglich in ein Kloster ginge, also wo ich in einem Gefängnis eingesperrt wäre, dann könnte durch die Knechte der Geistlichkeit Abhilfe vom Bund mit dem Bösen verschafft werden.
MUNIER: Was Inquisitin mit dem Zettel und der Wurzel das Bösen angefangen hat.
MARIA RENATA: Den Zettel habe ich mit der Wurzel zusammen verbrannt. Als ich den Zettel aber in das Feuer werfen wollte, sprang er mir zweimal in die Hand zurück. Daraufhin habe ich ihn mit dem Stecken in das Feuer gehalten und verbrannt. Dabei hat es einen Knall gegeben, dass ich meinte, der Ofen würde zerspringen.
BARTHEL: Durch wen und durch was für Mittel sie ins Kloster kommen sei.
MARIA RENATA: Mein Vater hat es gern gesehen, dass sein Kind versorgt sei. Ich habe aber Tag und Nacht geweint, als ich ins Kloster gehen musste.
BARTHEL: Hat sie jederzeit zufrieden im Kloster gelebt?
MARIA RENATA: Nicht gern wohl, weil ich mich mehr in die Welt hinausgedacht habe. Ich habe zwar meine geistlichen Verrichtungen getan, aber ohne Vergnügen daran.
101
BARTHEL: Ob sie gegen ihre Oberinnen Grund zur Klage gehabt habe oder umgekehrt?
MARIA RENATA: Ja, als die Oberen die Spieltage abgeschafft haben und die Leute nicht mehr in die Redestuben gelassen haben, bin ich unzufrieden gewesen.
MUNIER: Und sonst keine Klage seitens der Inquisitin?
MARIA RENATA: Doch, seitdem der Propst die Beichte hörte, entstand viel Verdruß, weil einige bei ihm beichten, andere aber nicht.
BARTHEL: Geriet der Inquisitin die Ablehnung eines Beichtgesprächs beim Propst zum Nachteil?
MUNIER (zu Barthel): Gegen diese Frage wird Einspruch erhoben, sie ist nicht Bestandteil des vorgesehenen Katalogs an Fragen, welche an die Inquisitin zu richten sind.
BARTHEL: Als Vorsitzender steht mir das Recht zu, eigene Fragen zu formulieren und zu stellen.(Zu Maria Renata) Also sind Inquisitin Nachteile daraus entstanden, dass sie die Beichte beim Propst verweigerte?
MARIA RENATA: Ja, ich war deswegen sieben Wochen lang eingesperrt.
BARTHEL: Mit weitgehenden Folgen?
MARIA RENATA: `wurde ein wenig melancholisch.
Auszug 2: Die Kommission der Inquisition tagte oft.
Dabei stand das Ergebnis der Inquisition, der Berfragung in puncto magiae et sortilegii,
von vorneherein fest, noch bevor eine Frage an die Inquisitin, die Hexe, Maria Renata,
gerichtet worden war.
MUNIER (hebt den rechten Arm): Die Hexe, mesdames, messieurs, die Hexe ist eine Unholdin. Welchen Mut aber brachten wir, professores et ministri collegii, nur der Wahrheit verpflichtet, auf, Inquisitin aufzusuchen. Doch niemand von uns ist gegen die Gefahr der Seuche gefeit.
BARTHEL (unterbricht erneut sehr erregt): Aber selbst der Hexenammer (er zieht ein Exemplar aus seinem Talar und schlägt eine bestimmte Seite auf) stellt doch fest, dass die Hexenkünste oft nicht und überhaupt nur in der Phantasie und Einbildung der Besagten existieren. Und zu genau diesem Ergebnis sind auch wir bei der peinlichen Befragung der Inquisitin gelangt.
MUNIER (schlägt ein Kreuzzeichen): Die Hexe, mesdames, messieurs, die Hexe ist eine Unholdin…! Vor der Gefahr ihres unseligen Wirkens kann nicht genug gewarnt werden.
103
Das Mahnmal von Vardöauf einem Hinrichtungsplatz erbaut
Abb. 46 Das Mahnmal von Vardö, Fotos von Rainer Werthmann.
105
Mahnmal von Vardövon Rainer Werthmann
In Vardö, der östlichsten Stadt Norwegens an der Eismeerküste am Ausgang des Varangerfjordes, gibt es ein Mahnmal für die 91 im 17. Jahrhundert in der Provinz Finnmark hingerichteten, meist verbrannten Hexen und Hexer. Für jeden einzelnen Menschen gibt es eine Tafel. Der Mann auf der letzten Tafel soll der größte Sami-Schamane seiner Zeit gewesen sein. Diese 91 Personen sind etwa 30 % der Gesamtzahl der in Norwegen wegen Hexerei in diesem Jahrhundert Hingerichteten. Das Mahnmal wurde 2011 durch die Königin eingeweiht, steht etwas außerhalb des Ortes unterhalb von Kirche und Friedhof mit weitem Blick aufs Meer.
Abb. 47 Das Mahnmal von Vardö, Fotos von Rainer Werthmann.
108
Das Hexeneinmaleins
aus Goethes Faust
von Thomas Schneider
Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe beschäftigte sich mit Magie und Mystik. Seine drei Reisen in den Harz (1777, 1783 und 1784) und der Besuch auf dem Brocken haben ihn beeindruckt. Ausdrucksvolle Spuren davon finden sich in seinem Werk Harzreise im Winter und in der Walpurgisnacht im ersten Teil des Faust. In seinem Werk Faust entdecken wir unter anderem das Hexeneinmaleins. Was sich zuerst wie eine unverständliche Wort- und Zahlenspielerei liest, ist in Wahrheit die Anleitung zum Erstellen eines magischen Zahlen-Quadrats. Die Summen aus den Waagerechten und
den Senkrechten ergeben immer das gleiche Ergebnis.
Nehmen Sie Goethes Werk zur Hand und suchen Sie gemeinsam mit Dr. Faust und seinem teuflischen Berater Mephistopheles nach der Lösung.
Viel Spaß beim Probieren!
109
Du mußt versteh‘n, aus Eins mach Zehn.Die Zwei lass geh‘n.
Die Drei mach gleich,So bist Du reich.Verlier die Vier.
Aus Fünf und Sechs,So spricht die Hex‘,
Mach Sieben und Acht,So ist‘s vollbracht.Die Neun ist Eins
Und Zehn ist keins.Das ist das Hexeneinmaleins
110
Abb. 48 Um 1776/79. Feder in Grau laviert, auf weißem Papier. 29,0 * 47,0 cm. Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-MuseumIn einer nächtlichen Landschaft spielt sich im Mondlicht eine gespenstische Szene ab: Vor einer von phantastischen Wesen bevölkerten Kulisse aus dichten Bäumen und einem alten Gemäuer ist ein magischer Kreis gezogen, in dem Zauberutensilien wie der Totenkopf mit den drei Kerzen angeordnet
sind. Zwei Hexen halten ein kleines Kind über einen Dreifuß, unter dem ein Feuer brennt, eine dritte steht in beschwörender Haltung, einen Zauberstab in der Rechten, vor einem Spiegel, in dem sich undeutlich eine Erscheinung manifestiert. Die Darstellung wurde als Geisterbeschwörung, Hexenküche zum Faust, Walpurgisnacht oder Illustration zum Medea-Mythos interpretiert. Aus: Goethe und die Kunst, Seite 126.
111
Hexentum heutevon Thomas Schneider
Beim Wort Hexentum denken die meisten als Erstes an Märchen, Hexenhaus, Brüder Grimm. Versucht man den Begriff in die heutige Zeit zu tragen,
dann assoziiert man Begriffe wie Aberglaube, Esoterik und Okkultismus.
Gibt man den Begriff Hexe in den Internetsuchmaschinen ein, wird man mit einer schier unendlichen Menge und Vielfalt an Informationen versorgt. Schnell erfährt man, dass Hexen heute präsenter sind, als man denkt. Als moderne Heilerin arbeitet sie mit Edelsteinen und Kräutern, mit Liebestränken hilft sie bei der Partnersuche nach und den Alltag erleichtert sie uns mit dem notwendigen Wissen um Mondphasen. Schaut man genau hin, stellt man fest: Die meisten Hexen sind es aus Überzeugung. Dennoch gilt es schon hier zu differenzieren. Hexe sein wird für verschiedene individuelle Zwecke genutzt. Zur Lebenshaltung der echten Hexen gehörten allerdings die Hingabe, die Wertschätzung und die Achtsamkeit allem Leben gegenüber. Mit Feminismus, Geschlechterkampf oder Okkultismus hatten und haben wirkliche Hexen nichts zu tun.
Hexen von heute orientieren sich an einem modernen Hexentum des 21. Jahrhunderts. Zum einen ist das Wissen, das sie verbreiten zeitlos, zum anderen respektieren sie die Erkenntnisse der Vorfahren, ohne sich die alten Zeiten zurück zu wünschen. Hexen sehen sich als Mitglied in der Gefolgschaft der Weisen. Hier gilt das Prinzip der Gleichheit. Es gibt keine Organisation und keine andere Form von Hierarchie, denn eine solche würde den Naturgesetzen wiedersprechen. Niemand besitzt mehr oder weniger Wert. Eines bedingt das andere nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Das Hexentum von heute beschreitet alte Pfade mit dem Wissen und den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts, auch wenn uns diese okkult, esoterisch und oft schlichtweg unglaublich vorkommen.
113
Naturreligion ist ein religionswissenschaftlich nicht abgesicherter Begriff. Es ist ein Sammelbegriff für Religionen, in welchen die Verehrung der Natur im Mittelpunkt steht. Die Natur selbst ist für ihre Anhänger göttlich, nicht nur Ausdruck göttlicher Schöpfungskraft. Die besonderen Festtage werden meist nach dem Lauf der Sonne und dem Stand von Mond und Sternen berechnet. Der Wechsel der Jahreszeiten wird besonders gefeiert und rituell gestaltet. In vielen neuzeitlichen Hexenbräuchen wird das Göttliche in Form einer Göttin oder Gott verehrt. Diese Sinnbilder sind mannigfaltig im Kreislauf der Natur zu finden, und fast alle früher heidnische Feste wurden ins Christentum integriert. Naturreligionen haben eines gemeinsam: Sie versuchen die Verbindung zwischen der Natur und dem Menschen wieder herzustellen. Hilfsmittel auf diesem Wege sind, neben den bereits erwähnten besondere Ritualen, aber auch Meditation, Trance und Intuition. Sofern bei den Ritualen bestimmte Kleidung getragen wird, dient dies nur dazu, sich für diesen Zweck auch im Äußeren vom Alltag zu lösen.
Fälschlicherweise werden den Opfern, die während der Zeit der Hexenverbrennungen von Kirche und Obrigkeit umgebracht wurden, magische Eigenschaften zugesprochen, die diese in Form von praktizierter Naturreligion oder Ritualen angewandt haben sollen. Mittlerweile weiß man, dass das nur in seltenen Fällen zutraf. Viele der modernen Hexen sehen sich in direkter Linie mit den damals verfolgten. Sie versuchen als Neu-Hexen allerdings an eine Tradition anzuknüpfen, die es aber gar nicht gegeben hat. Sieht man einmal von Unkenntnis der geschichtlichen Tatsachen ab, sind die Gründe dafür recht unterschiedlich. Da ist zum einen sicher eine Art Seelenverwandtschaft mit den damals Getöteten. Zum anderen kommt eine starke Sehnsucht nach spirituellen Inhalten hinzu, typisch für innerlich erlebte Werteverluste und ausgelöst durch den oft beschriebenen Wertewandel der heutigen Zeit.
Wer jedoch glaubt, das heutige Hexentum sei neumodischer Hokuspokus oder ein Produkt des sogenannten New Age, der irrt. Die Wurzeln liegen in der Vorzeit. Die Hexensymbole wie Spirale oder die Beobachtung des Mondes sind uns schon von Höhlenmalereien bekannt. Durch die Sesshaftwerdung der Menschen haben sich die Tätigkeiten der Hexen oft auf weibliche Mitglieder eines Stammes konzentriert. Sie übernahmen die Seelsorge, die Heilung und die Beratung in Lebensfragen.
Eine erste Wiederbelebung ist schon in der Romantik des 19. Jahrhunderts zu finden. Damals war es en Vogue sich mit naturreligiösen Themen zu beschäftigen. Zu den prominenten Vertretern aus dieser Epoche, zählen u.a. der Schriftsteller Novalis, die Philosophen Johann Gottlieb Fichte und August Wilhelm Schlegel, sowie der Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Aber auch mit dem Sammeln von Märchen, z.B. durch die Brüder Grimm, und das Niederschreiben und Zusammentragen von Bräuchen und Gewohnheiten sollte damals das alte Volksbrauchtum vor dem Vergessen bewahrt werden.
Der Begriff Hexe war als Bezeichnung für Männer und Frauen schon immer identisch. Wir finden in der Hexe auch den Schamanen wieder, den Medizinmann, die weise Frau, die Kräuterkundige, die Handauflegerin, den Heiler. Es ist dem aufgeklärten Abendland zu verdanken, dass diese Berufe kaum mehr zu finden sind. Aus dem Alchemisten wurde der Chemiker, aus dem Bader der Arzt. Mit der Kommerzialisierung der Heilkunde, der Seelsorge und der Lebensberatung, wurden die weisen Frauen und Männer aus ihren Ämtern gedrängt. Doch welcher moderne Berufsstand, der die Arbeit der früheren Hexen heute übernimmt, er bedient sich der Regeln und der Vorbilder in der Natur (Pharmazie, Medizin, Religionen etc.). Hexen von heute zeigen uns, dass altes Wissen neben moderner Wissenschaft durchaus existieren kann.
115
Es ist dennoch so, dass das Interesse am Hexentum in den achtziger Jahren, dem Beginn des Esoterikbooms, einen ungeahnten Anschub bekam, vor allem ausgelöst durch Ablehnung einer als spießig und altbacken angesehenen Gesellschaft. Themen, wie das Waldsterben und die durch die Medien erstmals vor Augen geführte Umweltzerstörung sorgte bei vielen für eine auch ökologisch motivierte Rückbesinnung auf die Natur. Die starke Popularisierung durch die neuen Medien sorgte zudem für eine rasche Kommerzialisierung.
Mittlerweile hat sich die Selbstbezeichnung Hexe als Synonym für verschiedene Vorstellungen und Praktiken etabliert. Während man früher aus Bosheit jemanden als Hexe bezeichnete, ist der Begriff heute eine positive Selbstbezeichnung von Frauen. Sich als Hexe zu bezeichnen soll signalisieren: Ich bin als Frau stark, selbstbestimmt und selbstbewusst. Hexe sein ist für diese Frauen keine Freizeitbeschäftigung, sondern eine Lebenseinstellung, eine Demonstration weiblicher Macht. Man verlässt alte, ausgetretene Pfade um einen neuen spirituellen Weg zu gehen. Man glaubt, sich befreien zu müssen, von einer christlich geprägten Bevormundung und sucht sein Heil in einer naturverbundenen Spiritualität. Viele der angebotenen Praktiken und Angebote finden wir seit Mitte der 80er Jahre herausgelöst aus der Hexentradition in vielen anderen Richtungen des spirituellen Marktes wieder.
Modernes Hexentum hat auch nichts mit den Klischees zu tun, welche uns in Filmen wie Harry Potter und Fernsehsendungen wie Sabrina – total verhext, Buffy oder Charmed begegnen. Fast alle Teenager, für welche diese Sendungen produziert werden, durchleben im Laufe der Pubertät irgendwann einmal eine Phase, in welcher sie sich für Okkultes und Magisches begeistern – und somit mit den Hauptfiguren dieser Serien identifizieren.
Wer eine Hexe werden möchte, besucht eine Hexenschule. Hier erhält man den praktischen Einstieg in die Naturreligion und die Anwendung bestimmter Heilmethoden. Im Mittelpunkt steht die Arbeit an einem selbst, die Verbindung zu den Elementen des Lebens und das bewusste Wahrnehmen des Jahresrhythmus.Das Erlernen des Umgangs mit Tarotkarten, Runen und Orakel befähigt zur Beratung. Unterstützung findet die praktizierende Hexe im inneren Dialog mit Naturgeistern. Auch traditionelle Techniken der Schamanen und Druiden müssen gelernt und geübt werden. Fragt man Hexen nach ihren persönlichen Motiven, wird klar, warum sie sich von der neuen Spiritualität angezogen fühlen. Es geht ihnen um eine Relativierung traditioneller religiöser Wahrheitsansprüche, die Suche nach einem undogmatischen, naturnahen Weg und eine stark individualisierte Spiritualität. Wer einmal eine Hexe kennenlernt, wird sie als warmherzige, selbstbewusst Frau erfahren.
Hexenwerkzeuge:Es gibt viele verschiedene Werkzeuge, die die Hexe
benötigt, um ihre Hexenkunst auszuüben.
AltarEin Ort, an dem die Hexenkunst ausgeführt wird. Meist steht der Altar an einer festen Stelle im Haus. Für Rituale im Freien werden speziell für diesen Anlass Altäre aufgebaut. Die Altargestaltung ist sehr persönlich. Hier folgt die Hexe dem Anlass und der Intuition. Zu den üblichen Gegenständen, die auf dem Altar platziert sind, gehören neben den nachfolgend näher beschriebenen Werkzeugen, oft auch Blumenschmuck und zu segnende
Kräuter und Früchte.
116
Hexendolch Dieser wird auch mit Athame oder Ritualdolch bezeichnet und symbolisiert das Element „Luft“. Auf dem Altar sollte er im Osten liegen. Die Schneide symbolisiert die Schärfe des Verstandes, das Metall den kühlenden Lufthauch. Im Ritual hilft der Dolch, die Energien zu lenken und unter Kontrolle zu halten. Er dient der Hexe als verlängerter Arm, der ihr den Umgang mit den magischen Kräften erleichtert, ähnlich dem Zauberstab. Mit dem Dolch werden zudem die Kräuter verarbeitet und die Früchte geteilt. Es gibt den Hexendolch in unterschiedlichen Farben, mit einseitiger oder doppelseitiger Klinge. Er
symbolisiert den männlichen Aspekt des Ritus (Phallussymbol).
HexenkelchDieser repräsentiert auf dem Altar das Element Wasser. Er verkörpert im Ritual den weiblichen Aspekt. Bei dem Kelch handelt es sich um ein mit Wasser, Wein, Met oder einer anderen Flüssigkeit gefülltes Gefäß, meist aus Glas, Silber oder Messing. Er wird verwendet zur Anrufung der Elementarkräfte des Wassers. Auf dem Altar findet er seinen Platz im Westen. Um das Einheitsgefühl aller an der Zeremonie Teilnehmenden zu stärken, trinken alle reihum aus dem Kelch.
Seine Form symbolisiert den weiblichen Aspekt des Ritus (Schoßsymbol).
Kerze Die Kerze steht für das Element Feuer. Kerzenrituale zählen zu den häufigsten Zeremonien. Sie erzeugen bei den Teilnehmern das Gefühl von Licht, Wärme und Geborgenheit. Beim Betrachten der Kerze werden die Gedanken auf einen Punkt gebracht. Meist ist mit dem Abbrennen ein bestimmter Wunsch oder eine bestimmte Erwartung verbunden. Die verwendeten Kerzen werden vor ihrer Verwendung mit bestimmten Ölen eingerieben, um die erhoffte energetische Wirkung zu verstärken. Auch Farbe und Form der Kerze werden gezielt ausgewählt. Hexen unterscheiden zwischen Ritualkerzen und Schutzkerzen. So hilft die Farbe Weiß die innere Antriebskraft zu verstärken, Silber unterstützt das Selbstvertrauen, goldene Kerzen halten Unglück fern und rosafarbene Exemplare verwendet man u.a. um eine Liebesbeziehung wieder aufzufrischen.
Abb. 51 Hexendolch, Leihgabe aus Privatbesitz.
117
RäucherwerkDas Räuchern gehört seit jeher zu den ältesten rituellen Praktiken der Menschheit. Ihm liegt schon immer eine wichtige religiöse Bedeutung zugrunde. Man denke an den Weihrauch in der Kirche. Die Schale und das Räucherwerk symbolisieren das Element Luft. In einem Räuchergefäß (platziert auf dem Altar im Süden) wird auf glühender Kohle das Räucherwerk verbrannt. Durch das Entzünden des Räucherwerks und in Verbindung mit der Luft, werden Rauch und Duft erzeugt. Die Zutaten werden je nach Belieben oder Anlass zusammengestellt.
Hierzu eignen sich Hölzer, Kräuter, Harze, Früchte, Blüten, Blütenblätter, Beeren, Pilze und Gräser. Das Räuchern dient hauptsächlich zur Reinigung von Räumen oder Häusern. Der Duft soll böse Wesenheiten vertreiben bzw. die guten Mächte anlocken und willkommen heißen. Dem aromatisierten Rauch werden auch heilende oder stimulierende Wirkungen zugesprochen. (Rauch: Element
Luft, Kraut: Element Erde)
Abb. 52 Dreifuß mit Räucherwerk, Städtisches Museum Kitzingen.
118
PentagrammEs ist eines der ältesten und am weitesten verbreiteten magischen Symbole. Heutzutage ist das Verständnis für das vielseitige Symbol des Pentagramms in breiten Kreisen der Bevölkerung verloren gegangen. In der Natur finden wir das Pentagramm überall, beispielsweise im Seestern, in Blüten. Der Mensch und alle anderen Landwirbeltiere bilden mit ihrem Körper ein Pentagramm. Die menschliche Hand wird von einigen als Pentagramm gesehen (die Strahlen sind dann die fünf Finger). Viele Kirchenbauten sind zum Pentagramm angeordnet, die Freimaurer nutzen das Pentagramm als Symbol, in vielen Mandalas und Kirchfenstern finden wir Pentagramme,
ebenfalls in der EU-Flagge und so weiter. Das Pentagramm ist das wichtigste Symbol der Hexen. Das bekannteste natürliche Pentagramm findet man, wenn man einen Apfel halbiert. Dieses Pentagramm im Apfel steht symbolisch für Eva und damit für Weiblichkeit, aber auch für Natur, Unvergänglichkeit und auf jeden Fall für etwas Gutes, Nahrhaftes, Gesundes. Im Wort Pentagramm steckt das griechische Wort für fünf (pente). Das Pentagramm lässt
sich mit etwas Übung in einer Linie zeichnen.
Abb. 53 Stechapfel oder Engelstrompete, (Nachtschattengewächse), die Blüte zeigt ein Pentagramm, sie galt als Hexenkraut und wurde als Aphrodisiakum verwendet, hoch giftig! Aufnahme: Elisabeth Porzelt.
119
Schale mit SalzDie Schale mit Salz symbolisiert das Element Erde und. Sie steht neben dem Räuchergefäß und versinnbildlicht
Reinigung.
ZauberstabDer Zauberstab verlängert - wie der Dolch - die Hand der Hexe und transportiert den magischen Willen. Mit dem Zauberstab zieht die Hexe magische Kreise, zeichnet magische Symbole auf den Boden und dirigiert damit, ähnlich wie mit dem Hexendolch, die Energien. Unterschiede macht, aus welchem Holz der Stab geschnitzt ist. Verschiedene Hölzer aus denen der Stab geschnitzt ist, haben unterschiedliche Eigenschaften. Der Zauberstab ist dem Geist zugeordnet (Element Luft). Er liegt auf dem
Altar im Süden.
HexenkesselEr ist ein wichtiges Arbeitsinstrument von Hexen. Darin werden Kräuter verbrannt und Zaubergetränke gebraut. Der Hexenkessel symbolisiert Weiblichkeit, Fruchtbarkeit und das Element Wasser. Hexenkessel stehen meist auf drei Beinen und versinnbildlichen Inspiration und
Unsterblichkeit der Seele.
PendelDas Pendel dient als Entscheidungshilfe und Ratgeber. Die Hexe spürt damit hauptsächlich Störfelder und/oder Schwingungen von Orten auf, und erkennt so schädliche
und heilsame Schwingungen.
Abb. 54 Schale mit Salz, Städtisches Museum Kitzingen.
Abb. 55 Hexenkessel, Leihgabe Stefan Schneidmadel.
120
SchattenbuchDas Schattenbuch ist die ganz persönliche Sammlung des Hexenwissens einer Hexe. Sie stellt vielleicht ihr Schattenbuch selbst her, schreibt nur in Hexenschrift hinein. Das Schattenbuch kann nach dem Tod einer Hexe weitervererbt werden. Das Schattenbuch gehört zur
Grundausstattung jeder Hexe.
BesenWas zeichnet eine Hexe außer ihrem Zauberstab in den alten Geschichten noch aus? Genau, ihr Besen mit dem sie durch die Luft fliegt. Auch wenn Hexen in Wirklichkeit nicht auf ihrem Besen fliegen, so ist er dennoch ein wichtiges Hexenwerkzeug. Mit dem Besen, der dem Element Wasser zugeordnet ist, fegen die Hexen vor einem Ritual den Platz, an dem es stattfinden soll. Er sorgt so symbolhaft für die Reinigung und die Befreiung von negativer Energie. Hexenbesen werden grundsätzlich aus Weiden- und
Birkenzweigen hergestellt.
HexensprücheHexensprüche gehören zur Hexerei. Am besten wirken Hexensprüche, wenn sie selbstgemacht sind. Einen ganz alten Hexenspruch geben wir hier weiter. Das besonders magische ist, dass er in verschiedene Richtungen gelesen werden kann und dabei immer gleich lautet. Die Übersetzung ist nicht ganz geklärt, wahrscheinlich bedeutet er: Der große Sämann hält das Werk in seiner
Hand.
Abb. 56 Schattenbuch, Schenkung.
121
S A T O RA R E P OT E N E TO P E R AR O T A S
Abb. 57 Collage zum Thema Zaubersprüche basierend auf einer Fotografie von Mark Brooks.
123
Die Jahreskreisfeste der Hexen
von Thomas Schneider
Der Lebens- und Arbeitsrhythmus von uns Menschen richtete sich nicht immer nach den heutigen 365 Tagen/12 Monaten aus. Früher orientierte man sich vielmehr am Stand von Sonne und Mond und am Lauf der Gestirne. Es waren im Besonderen die Bauern, welche den Rhythmus der Natur nutzten und sich dabei bei Saat und Ernte nach bestimmten Tagen richteten. Das Bauernjahr dauerte ca. sechs Monate, begann mit dem Fest Beltane, am 5. Vollmond des Jahres (um den 30. April), und endete am 11. Neumond (um den 31. Oktober) mit dem Samhain-Fest. Die von den heutigen modernen Hexen noch immer gefeierten Feste und deren Bezeichnungen kommen aus der keltischen und germanischen Tradition unserer Vorfahren. Viele dieser Feste sind später vom Christentum übernommen worden. So wurde das Julfest durch Weihnachten ersetzt. Maria Lichtmess wurde früher an Imbloc gefeiert. Besonders deutlich ist die namentliche Ähnlichkeit des christlichen Osterfestes mit Ostara, benannt nach einer germanischen Frühlingsgöttin. Die Feiertage der Hexen umfassen acht Jahreskreisfeste. Sie stehen in enger Beziehung zu jahreszeitlichen und kosmischen Rhythmen. Die Hexen feiern
diese Feste zu Ehren der Mutter Erde und der Götter.
124
Im Jahreskreis ist die helle Jahreszeit durch männliche Energien und die dunkle Jahreszeit durch weibliche Energien bestimmt. Das bedeutet, dass die jeweilige Qualität in jedem einzelnen Menschen im Vordergrund wirkt oder wirken sollte. So können Männer und Frauen gemeinsam im Sommer besser Impulse setzen als im Winter. Beide können im Winter mehr nach innen schauen, die Erfolge des Sommers genießen und bewahren, was sie sich erarbeitet haben. Die Schwankungen, denen die Natur unterworfen ist, bestimmen auch die Stärke der männlichen und weiblichen Energie im einzelnen Menschen. Je stärker die männliche Energie (Sonnenenergie), umso stärker ist die Impulskraft im Menschen, neue Vorhaben gelingen besser, Aufbauen und in Gang bringen sind hier begünstigt. In den Zeiten der starken weiblichen Energie (Mondenergie) stehen Aufnehmen, Behüten, Pflegen, im Vordergrund. Die Natur macht es vor. In den hellen Monaten wird die Aussaat erledigt, neue Projekte stehen unter guten Vorzeichen, wenn es warm und trocken ist. Im Winter, wenn die Ernte eingebracht wurde, beginnen das
Ruhen und der Genuss der Erträge.
Die Hexenfeste geben immer wieder Hinweise auf die betreffende Zeitqualität. Im Jahreskreis teilen Männlichkeit
und Weiblichkeit sich die Zeit zu gleichen Teilen auf. Die Feste der Sonnwenden, sowie die der Tag- und Nachtgleichen richten sich nach der Sonne, die Jahreszeitenhalbzeitfeste haben eher eine Beziehung zum Mond. Die Daten ändern sich allerdings geringfügig, weil die Hexenfeste nach dem Stand des Mondes terminiert werden. Hexen feiern ihre Feste grundsätzlich am
Neumond bzw. Vollmond.
Abb. 59 Hintergrundbild Blumenwiese zum Thema Jahreskreisfeste von Elisabeth Porzelt.
125
Imbolc – (lIchtmess)Das Fest des Lichts und erste Fest der Reinigung wird am 2. Februar gefeiert. Hexen feiern die Erholung der Göttin von der Geburt des Gottes, die zu Jul stattgefunden hat. Die Göttin ist wieder jungfräulich. Sie erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf und mit ihr die Natur. Die Tage werden wieder länger. Überall im Haus werden Kerzen entzündet, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang brennen, um die Sonne zu begrüßen und das neue Licht zu verstärken. Traditionell findet diese Feier im Freien mit Kostümen und Masken statt. Lieder werden gesungen und Trommeln werden geschlagen, wenn um ein großes Feuer getanzt wird. Schutzherrin des Festes ist die Göttin Brigid, die als keltische Gottheit für Kreativität und Heilkunst steht. Zudem steht ihr die Göttin Aradia, zur Seite. Die Bauern nutzten früher dieses Fest zur Feldbegehung. Mit Fackeln in den Händen liefen sie über ihre Äcker, um diese symbolisch zu reinigen. Sie beteten die Erntegottheiten an,
um für ihren Segen und baldige Aussaat zu bitten.
Für den modernen Menschen heute ist es die Zeit des Planens und der Vorbereitungen. Alles Alte, alles, das wir nicht mehr benötigen, gilt es loszulassen, sowohl im Materiellen, als auch im Geistigen. Imbolc ist die beste Zeit, um das Leben zu klären und zu entrümpeln. Imbolc ist geeignet, um nach dem langen Winter endlich wieder frische Luft einzuatmen, um sich für die kommenden
Aufgaben zu motivieren.
Die Farbe von Imbolc ist weiß. Weiß ist ein Symbol der Unschuld und Reinheit und stellt den Zustand der Göttin als Mädchen in dieser Jahreszeit dar. Weiß ist auch die Farbe des Schnees, denn, vielen Bereichen der Erde liegt immer noch Schnee, obwohl das Land Anzeichen einer
Wiedererweckung zeigt.
Für Zeremonien sind alle weißen Blumen wie weiße Lilien, Tulpen und vor allem Schneeglöckchen geeignet. Bei Ritualen werden Kerzenkreise gebildet, meist aus weißen und orangefarbenen Kerzen. Zur Räucherung wird Weihrauch, Zimt, Myrrhe und Rosmarin verwendet. Noch passender ist eine Räucherung aus Salbei, Basilikum und Rosmarin, denn diese dient speziell der Reinigung, um den
Wintermief hinaus zu bringen.
ostara (FrühjahrsäquInox)Ostara ist des Frühlings Tagundnachtgleiche. Zu Ostara sind Tag und Nacht genau gleich lang. Ab sofort ist der Tag stets länger als die Nacht. Am 21. März, am Ostara-Tag hat der Frühling endlich über den Winter gesiegt. Die Sonne hat jetzt wieder große Kraft. Das Fruchtbarkeitsfest, das ein Mondfest ist, ist voller Symbole, die wir heute z.B. als Osterlamm, Osterhasen und Ostereier kennen. Das Osterlamm ist eher ein christliches Symbol, während Hase und Ei deutlich für die Fruchtbarkeit stehen. Diese Fruchtbarkeit an Ostara war für die Bauern von hoher Bedeutung, da zu diesem Zeitpunkt die Aussaat begann
126
Festes: Die Bitte um einen fruchtbaren Ackerboden, eine reiche Ernte und um gesunde Nachkommen in der Familie. Das Glück in der Liebe versprachen sich junge Paare, in dem sie mit einem beherzten Sprung gemeinsam über das Beltane-Feuer sprangen. Es war weiterhin Brauch, seine Herzenswünsche auf kleine Zettel zu schreiben und sie anschließend ins Feuer zu werfen, auf dass sie Wirklichkeit wurden. Beltane galt als das Hochzeitsfest der Göttin Diana und dem Gott Pan. Fruchtbarkeit und Wachstum stehen im Mittelpunkt. Der Sonnengott ist zu einem Mann herangereift und will sich fortpflanzen. Männer und Frauen verlieben sich und zeugen ein Kind. Die Magie
dieses Abends ist bis heute nicht verloren gegangen. Auch heute noch feiern die Hexen das Fest traditionell im Freien, meist im Wald, auf einer Lichtung, auf einem Berg oder einem Feld. Das Fest wird sehr ausgelassen gefeiert. Der Altar wird mit bunten Blüten, Frühlingsblumen und Bändern geschmückt. Es sind alle Farben vertreten: rot, grün, gelb, blau, auch Pastelltöne. Bei der Beltanefeier tanzen und singen Männer und Frauen um ein Feuer herum.
lItha (sommersonnenwende)Die Sommersonnenwende (oder Mittsommer oder Litha), markiert den längsten Tag des Jahres, wenn die Sonne im Zenit steht. Die Sonnenbahn verläuft zunehmend tiefer, damit werden die Tage kürzer, aber auch heißer - der Hochsommer nimmt seinen Anfang. Litha ist das Fest am Höhepunkt der Fruchtbarkeit der Natur. Hier zeigt sich die Macht und Kraft der Sonne. Das Litha-Fest ist ein Fest des Dankes und der Freude über die hoffentlich zu erwartend gute Ernte. Das Leben und die Arbeit der Bauern sind seit jeher vom Wetter abhängig. Regen ist im rechten Maß notwendig, damit die Feldfrüchte ihr volles Wachstum entwickeln können. Die Sonne schenkt die notwendige Energie dazu. Die Zeit um die Sonnenwende ist auch der
und man die Felder segnen und um entsprechendes Wetter bitten wollte. Traditionell wurden Osterfeuer auf allen Hügelkuppen im Land entzündet. Die Felder und Äcker, von denen das Osterfeuer gesehen werden konnte, sollten dadurch von den Göttern beschützt und gesegnet werden.
Von früher kennt man Ostara als Frühlingsfest der sächsischen Göttin Eostra und der germanischen Göttin Ostara. Schon aufgrund der Namensgleichheit lässt sich eine gleiche Bedeutung vermuten. Beide stehen den Hexen auch heute noch bei ihren Ritualen bei. Für den modernen Menschen ist das Thema des Festes, die Fruchtbarkeit, nicht nur im Kontext zu Sexualität und Kinderwunsch zu sehen, sondern im übertragenen Sinne steht diese Zeit des Frühlings auch dafür, die eigenen Pläne und Wünsche zu überdenken, zu festigen und letztendlich auch in die Tat umzusetzen. Damit dies gelingt, bittet man um den Beistand der Göttin. Ostara wird in der Regel im Freien gefeiert, auf einem geeigneten Platz für eine kleine Feuerstelle. Es handelt sich um das erste Fest der Fruchtbarkeit, deshalb ist es ein ausgelassenes Fest mit viel Musik und Tanz. Die Erde beginnt zu erwachen. Blumenschmuck spielt eine große Rolle. Die Ausgestaltung des Ritualplatzes steht ganz im Zeichen des Frühlings. Die dominierenden Farben sind grün, gelb, rosa und flieder. Der Altar wird nach Osten ausgerichtet. Geräuchert wird mit Weihrauch, und Myrrhe.
Ostara ist dem Element Luft zugeordnet.
beltane (walpurgIs)Beltane wird in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gefeiert und ist das zweite und wichtigere Fruchtbarkeitsfest im Jahreskalender der Hexen. In den Dörfern werden große Maibäume aufgestellt, die ein Symbol für die Unabhängigkeit der Dorfgemeinschaft darstellen und ein Fruchtbarkeitssymbol sind. Der ursprünglich Zweck des
127
Wendepunkt im bäuerlichen Leben. Das Reifen der Frucht zeigt an, dass die Erntezeit heran naht. Die Bauern steckten
Arnika um ihre Felder, um Korndämonen abzuhalten.
Viele alte Bräuche um die Sommersonnenwende haben sich bis heute aus heidnischer Kultur erhalten. Um den 21. Juni brennen in Europa alljährlich in den Dörfern die Sonnwendfeuer. Feuerrituale symbolisieren Lebenskraft und dienen der Reinigung. Noch heute übt ein Feuer Faszination auf uns Menschen aus: stundenlang können wir hineinschauen und werden dabei ruhig und ausgeglichen.In den kirchlichen Gemeinden, welche aus dem keltischen Bräuchen eine christliche Tradition gemacht haben, wird am 24. Juni der Johannistag gefeiert. Begriffe wie Johanniskraut, Johannisbrot und Johannisbeere zeugen
noch heute von der Bedeutung dieses Zeitabschnittes.
Nicht nur im bäuerlichen Leben ist es eine Zeit der Wandlung, auch der Mensch erlebt eine starke Entwicklung und auch er reift heran. Alles, was der Mensch in diesem Jahr gesät hat, kommt nun zur Reife. Das innere Erleben steht dabei im Vordergrund. Wünsche und Pläne, an denen noch festgehalten wird und die an Litha bekräftigt werden, gehen meistens in Erfüllung. Männliche und weibliche Energien sind in dieser Zeit ausgeglichen, eine gute Zeit
für Heirat, vor allem, wenn Beltane erfolgreich war.
Die Farben dieses Festes sind Gelb und Orange. Hexen schmücken in dieser Zeit ihre Häuser mit Spiegeln, um das Sonnenlicht einzufangen. Die Johannisnacht hat für moderne Hexen eine ganz andere Bedeutung: Kräuter die in dieser Nacht gesammelt werden, wird eine besondere Heilkraft zugesprochen. Neben dem Johanniskraut gehören auch Baldrian, Eisenkraut, Klee, Ringelblume,
Kamille und die Schafgarbe dazu.
lammas oder lugnasad (schnItterFest)
Lammas wird von den Hexen am 2. August gefeiert und ist das erste Erntedankfest. Dieses Fest steht im Zeichen von Korn (Brot), Frucht und Wein. Die Bauern haben das erste Korn eingefahren, an Bäumen und Sträuchern sind die Früchte gereift. Die männlichen Energien verlieren allmählich an Kraft, es sollte kein neues Projekt mehr gestartet werden. Lammas ist ein traditionelles Hexenfest. Nicht lärmend und ausschweifend wie die Sonnwendfeier. Die Hexen widmen dieses Fest dem Reichtum und dem Überfluss. Beim Ausüben des Rituals dominiert die Farbe Grün, als Symbol für Hoffnung und Fruchtbarkeit. Das Element Wasser, als Lebensspender steht im Mittelpunkt des Bewusstseins. Den Gottheiten werden an diesem Tag hauptsächlich finanzielle Wünsche vorgetragen bzw.
Bitten für das Wohlergehen der Familie.
Abb. 60 Hintergrundbild Herbstlaub zum Thema Jahreskreisfeste von Elisabeth Porzelt.
129
mabon (herbstäquInox) Der Tag der Herbsttagundnachtgleiche (Äquinox) ist der 21. September. Dies bedeutet, dass Tag und Nacht mit 12 Stunden gleich lang sind. Von nun an wird es jeden Tag etwas später hell und früher dunkel. Der Herbst kündigt sich mit frischen Nächten und Stürmen an. Für die Bauern bedeutet es, die letzten Feldfrüchte von den Äckern zu
ernten. Mabon erinnert die Menschen an die Vergänglichkeit. Die Vorbereitung auf den Winter beginnt. Man beginnt, sich in Geduld zu üben und darauf zu vertrauen, dass ein neuer Frühling sicher kommen wird. Das Fest beginnt am 21. und endet am 23. September. Mabon steht für die Erneuerung des Geistes. Die Göttinen Demeter und Epana werden beim Ritual für gute Mutter-Tochter-Beziehungen oder allgemein für Familienangelegenheiten angerufen. Demeter und Epana stehen aber auch für die Fruchtbarkeit und für eine reiche Ernte. Die männlichen Energien fangen an, sich zurückzuziehen, die weiblichen Energien
gewinnen an Stärke.
Mabon soll den Menschen bewusst machen, was sie im Laufe des Jahres erreicht haben, ob es ihr Tun Wert war und was sie noch tun dürfen, um ihre nächsten Ziele zu erreichen. Wie schon Lammas ist Mabon dem Element Wasser gewidmet. Ein viel verwendetes Hexenwerkzeug
dieser Tage ist der Kelch.
samhaIn (halloween)Samhain, der Vorläufer von Halloween, zählt zu den ältesten Festtagen der Menschheit. Die Kelten feierten am 31. Oktober das Ende des Jahres. Samhain war für die Bauern ein weiteres wichtiges Datum im Mondkalender: Das Ernte- und Arbeitsjahr ging zu Ende. Die letzen Feldfrüchte waren eingeholt worden und man bereitete sich auf die Winterzeit vor. Ruhe kehrte damit auch in die Bauernstuben ein und die Vorbereitung auf das neue Arbeitsjahr, das mit dem Fest Imbloc (Anfang Februar) begann. Die Weisheit der Ahnen spielte im Alltagsleben der Kelten eine große Rolle. Zu Ehren der keltischen Todesgöttin Morrigan wurden auf den Feldern und Hügeln große Feuer entzündet. Es wurde getanzt und getrommelt. Das alte Leben sollte abgelegt werden, neue Vorsätze wurden gefasst. Die Kelten glaubten, dass genau um 12 Uhr Mitternacht das alte Jahr vorbei war und das neue anfing. Beim Übergang gab es nach ihrem Glauben eine Art Zeitfenster, das weder zum alten, noch zum neuen Jahr gehörte, sozusagen ein Raum der Zeitlosigkeit. Darin hätten die Seelen der Toten die Möglichkeit mit den
Lebenden in Verbindung zu treten.
Samhain wird dem Element Wasser zugeordnet. Beim Hexenfest dominieren die Farben Schwarz und Orange. Für die Menschen ist es eine Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurückzuschauen, Erfahrungen zu bewerten, und zu erkennen, an welchen Lebensthemen noch gearbeitet werden muss. Hexen raten, dass man sich an diesem Abend ausreichend Zeit nimmt, für sich und die Mitmenschen.
Wünsche und Anliegen können vorgebracht werden.
Am Anfang des Rituals steht eine gründliche Reinigung der Räumlichkeiten, Werkzeuge und Talismane, der eine neue Weihe folgt. Geräuchert wird mit Muskat. Ein kleiner Altar wird aufgebaut. Er wird zusätzlich mit Kerzen und natürlichen Materialien, wie Nüssen, Äpfeln, gefärbten
130
Blättern, Zweigen und Moos geschmückt. Auch Fotos von Verstorbenen, denen man Gedenken möchte, werden mit aufgestellt. Im Zuge der Christianisierung wurde Samhain bereits im 9. Jahrhundert per Beschluss des amtierenden Papstes Gregor IV zum christlichen Feiertag. Er wollte damit den heidnischen Bräuchen ein Ende setzen. Die keltische Totenverehrung wurde allerdings beibehalten. Als Allerheiligenfest, auf Englisch All Saints Day und der Nacht auf Allerheiligen, dem All Hallows Evening, dient Samhain noch heute an jedem 1. November dem christlichen
Totengedenken.
jul (wIntersonnenwende)Die Festtage des Julfestes beginnen am 21. Dezember. Er ist der kürzeste Tag im Jahr. Ab diesem Tag werden die Tage wieder länger und die Nächte kürzer und damit schließt sich der immer währende Kreislauf von Werden und Vergehen, Leben und Tod, Tod und Wiedergeburt.
Das Julfest ist ein Zeichen für die neue Herrschaft der Götter. Die Wintersonnenwende steht für die Wiedergeburt des Gottes durch die Göttin. Die Männlichkeit meldet sich zurück, von nun an nimmt die weibliche
Energie kontinuierlich ab.
Unser Begriff Weihnachten geht auf die Bezeichnung geweihte Nächte zurück, welche die nachfolgenden zwölf Rauhnächte bezeichnen. Diese elf Tage und zwölf Nächte zwischen dem 21. Julmond und dem 2. Hartung gelten als besonders mystisch und sollen den Menschen die Augen für die darauffolgenden zwölf Monate öffnen. Die Träume in diesen zwölf Nächten sollen den zwölf Monaten des nächsten Jahres entsprechen. Für die meisten Hexen ist jedoch der Tag der Wintersonnenwende am wichtigsten. Das Haus ist geschmückt, der Julbogen steht im Fenster. Es ist ein hölzerner Halbkreis als Kerzenleuchter. Man findet ihn in zahlreichen Ausführungen als Lichterbogen auf den Weihnachtsmärkten wieder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ausgestaltung, wie Gebäck, Früchte und Symbole. Der Julbogen soll ein Stück Lebensbaum symbolisieren. Bei den Farben für Kerzen, Schmuck und Altardecke wählen die Hexen möglichst grün, weiß, rot, silber, gold oder gelb. Die Heilsteine Tigerauge und Rubin passen dazu. Das Haus wird mit Räucherungen
gereinigt.
131Abb. 64 Illustration „Die vier Hexen“ von Gabriele Brunsch, aus Dido und Aeneas oder Die Zwischenzeit des Glücks, Foto Stefan Ernst.
132
Vier Hexen treffen sich
in einer düsteren Höhle von Gabriele Brunsch
An einem menschenleeren Ort zu dämmeriger Stunde
schwirren die Stimmen seltsamster Wesen wirr durch den Raum.
Von edler Gestalt sind sie, verführerisch und hemmungslos.
Die erste ist „Die Lüge“, die zweite nennt sich „Das Gerücht“,
die dritte ist „Die Missgunst“, die vierte, hört, sie ist „Der Neid“.
Wenn sie mit schrillem Lachen ihre bösen Worte spucken,
dann geifern sie, ihr Speichel spritzt, sie wetzen ihre Zungen.
Ihr Atem ist geschwängert von einem fauligen Gestank,
der wie ein schimmeliger Flaum sich an die Steine heftet.
„Wir werden hundertfach uns spalten und durch die Lande zieh‘n
zu schaden Didos Ruf!“, so klingt ihr Schlachtruf durch die Halle.
„Dem Jarbas, der das Land ihr gab, setz ich Rachebegierde
in sein verwundet Herz! Er warb um sie, er schwor ihr Treue!“
„Niedrig, ist sie, die ehrlose Schlampe!“ schreit jetzt das Gerücht,
„dass sie sich legt ins Lasterbett mit diesem Heimatlosen!“
„Zeus, den Göttervater selbst, werde ich heimlich anstacheln,
133
dass er ein rasches Ende setzt, der ehrfurchtslosen Liebe!“
So röcheln sie die Hexen und eh der frühe Morgen graut
sind sie davon geflogen! Mit einer Botschaft voller Gift
zersetzen sie die Liebe, die Zuversicht und auch den Mut.
Auch in Karthago peitscht das grelle Echo von Wand zu Wand.
Die Welt der Liebe ist verdunkelt, in jedem Herzen wächst
die Pflanze Missgunst! Vertrauen ist zerstoben überall!
Von diesen hinterhältigen Gedanken ahnen sie nichts,
die Liebenden, sie durchwandern die Hallen des Palastes,
plaudern vom Jetzt und denken hoffnungsvoll an ihre Zukunft.
13. Kapitel aus „Dido und Aeneas“ oder „Die Zwischenzeit des Glücks“
antikes Drama von Gabriele Brunsch, J. H. Röll Verlag, 2014
Illustration Gabriele Brunsch, Foto Stefan Ernst
Abb. 65 Titelbild zu Dido und Aeneas oder Die Zwischenzeit des Glücks von Gabriela Brunsch, Foto Stefan Ernst.
135
Mark Brooks - ein moderner Schamane in Franken
Wirklichkeiten, die im Unbewussten wurzeln, sind sein Thema. Wer sich auf die Bilder dieses Traumkünstlers einlässt, gerät in Gefahr die Realität zu verlieren und selbst auf Traumreise zu gehen, vielleicht nur für einen Moment. Sein Auge für Details, seine Liebe für Kunst und Architektur und sein Panoramablick bringt in seine Bilder eine überraschende, neue Auffassung für das Einzelne und Kleine sowie eine neue Akzeptanz für
Großes und Monumentales.Geboren in Kansas City kam Mark 1973 nach Deutschland. Bereits nach 3 Tagen war ihm klar, dass er Deutschlang nicht wieder verlassen wollte. Er durchstreifte die fränkische Landschaft und die bayerischen Berge, wandelte durch die Straßen und Gassen europäischer Städte und erforschte die Ebenen und Berge
seiner adoptierten Heimat. Immer mit der Kamera in der Hand.Das Ergebnis sind wunderbare Fotografien, die uns daran erinnern, dass alle Menschen, jeder Fluss, Hügel und Berg, jede Blume und jedes abgefallene Blatt, jede Hütte oder Schloss und jedes Fenster oder jede Tür eine Geschichte erzählen. Aktuell arbeitet er an Fotoserien im Auftrag von Hotelketten und Unternehmen. Aber auch eine regionale Fan-Gemeinde hat sich um den Fotokünstler gebildet, die seine Arbeiten schätzt
und sammelt. Mit seiner neuen Serie Witches wagt der Künstler quasi als moderner Schamane den Grenzgang zwischen Traum und Realität. Einige Aufnahmen aus dieser Serie hat Mark Brooks, ein langjähriger Freund und
Förderer des Städtischen Museums Kitzingen, für diese Publikation zur Verfügung gestellt“With the soul of an aging Hippie, I capture what others do not see when they look.”
And that he does. Very, very well.
Abb. 67 Gut und Böse, aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld.
139
Wenn Gerüchte töten -
Ausgrenzung und Vernichtung von Sündenböcken gestern
und heute
von Manfred Ruppert
Die Jagd auf Hexen hat mit der Verbrennung der Anna Göl-di 1782 in Glarus keineswegs ein Ende gefunden. Noch immer suchen Gruppen und Einzelpersonen Sündenböcke in der pseudo-faustischen Hoffnung durch deren Ausgren-zung, Ausstoßung und Auslöschung das Böse aus der Welt schaffen, eigene Mängel und Schwächen überdecken und den inneren Zusammenhalt der Mehrheitsgesellschaft stär-ken zu können.
Abb.76 The Scapegoat (Der Sündenbock), Ölgemälde von William Holman Hunt (1827-1910).
140
Der todbringende Eifer von Denunzianten, Gerüchtestreu-ern und Neidern, der Hass von Fanatikern und die schiere Verzweiflung von Menschen, die von der Wucht kultu-reller Umwälzungen und wirtschaftlicher Verwerfungen überwältigt werden, finden auch heute noch viele Opfer. Unsere Zeit ist bei weitem nicht so aufgeklärt und liberal, wie es den Anschein hat. Unter der Oberfläche der bürger-lichen und kultivierten Gesellschaft wie auch hinter dem rouseauschen Idealbild des von der Zivilisation noch nicht verdorbenen im Einklang mit sich und seiner Umwelt le-benden Menschen lauern noch immer dieselben untrenn-bar mit dem Menschsein verbundenen Mechanismen und sozialpsychologischen Reflexe die in der Vergangenheit zu furchtbaren Verbrechen, zu Völkermord und Massenver-nichtung geführt haben.
Die Bereitschaft zur Sündenbocksuche, der unbedingte Wille, die Normen der Dominanzkultur noch weiter zu verfestigen, die Verführbarkeit bei der Opferfindung aktiv mitzuwirken, die willentliche Unterdrückung des Mitge-fühls und die bedingungslose Identifikation mit der Macht sind an keine soziale Schicht, an keinen Bildungshinter-grund und an keine kulturelle Prägung gebunden. Täter können sowohl verwirrte Einzelpersonen als auch von kühl berechnenden Psychopathen aufgehetzte Massen sein. Autoritäre Herrschaftssysteme greifen bei der Ver-folgung tatsächlicher oder vermeintlicher Gegner auf Ele-mente der Entmenschlichung und auf Diffamierungstech-niken zurück, die sich in ihren Grundzügen nicht von den Handlungsmustern der Hexenverfolgung unterscheiden.
Selbst in einer aufgeklärten Demokratie wie den Verei-nigten Staaten von Amerika, die wenige Jahre zuvor un-ter großen Opfern Krieg gegen Diktatur und ideologische Verblendung geführt hatten, gelang es Senator Joseph R. McCarthy noch Anfang der 1950er Jahre mit Hilfe des Po-lizei- und Justizapparates und unter Einbindung von Teilen der Medien einen überschießenden Verfolgungsdruck ge-
gen vermeintliche Anhänger unamerikanischer Ideen auf-zubauen. UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, Amnesty International und viele weitere Hilfs-organisationen müssen noch heute in ihrer täglichen Arbeit gegen die todbringenden Auswirkungen eines in vielen Teilen der Welt grassierenden Hexenwahns ankämpfen. Schätzungen zufolge sind allein im 20. Jahrhundert in Südostasien, Afrika und Lateinamerika mehr Menschen der wahnhaften Furcht vor Hexen und Zauberern zum Op-fer gefallen, als während der gesamten europäischen Ver-folgungsperiode.
Der Glaube an Hexerei und Schadenszauber vergiftet vor allem in Afrika noch heute das Leben vieler Menschen. In den Dörfern laufen arme alte Frauen, die sich keinen Gas-kocher leisten können und deren Augen vom Rauch der Holzfeuer rot und entzündet sind Gefahr, dass dies als unt-rügliches Zeichen ihrer Hexeneigenschaft ausgelegt wird.
Wer der Armut auf dem Land in die großen Städte entflie-hen und es dort zu bescheidenem Wohlstand bringen kann, gerät schnell in den Ruch sich schwarzer Magie zu bedie-nen. Da einige besonders erfolgreiche Politiker und Ge-schäftsleute tatsächlich den Rat von Zauberern und Wahr-sagern einholen, verdichtet sich dieser vage Verdacht in der Wahrnehmung vieler vom Leben weniger Begünstigter zur absoluten Gewissheit. Manche wollen dann das vermeint-liche Erfolgsgeheimnis auch für sich nutzen und hoffen mit hexerischen Praktiken ihr Los verbessern zu können. Häufig fallen Menschen, die an Albinismus leiden, die-sem wahnhaften und im Wortsinn über-Leichen-gehenden Streben nach Glück zum Opfer, denn ihre Augen, Haare und Knochen gelten als heilkräftig und ihrem Blut wird wohlstandsfördernde Wirkung zugeschrieben.
Oft geschürt von selbsternannten Heilsbringern im Na-men dubios-christlicher oder islamistischer Sekten kommt es vielfach zu Exzessen. Jeder kann unabhängig von Ge-schlecht, Alter und sozialer Stellung, den Argwohn und
141
den aus Furcht erwachsenen Hass der Hexenjäger, oder Gier und Gewinnsucht der Möchtegern-Magier auf sich ziehen. Häufig trifft es arme, verwitwete ältere Frauen, die in Zeiten zerbrechender (Groß-)Familienstrukturen und eines rasanten Schwindens der zwischenmenschlichen So-lidarität nicht länger auf den Schutz und die Unterstützung zerfallender Dorfgemeinschaften zählen können.
Bürgerkriege, Abwanderung, Hungersnöte, Dürrekatastro-phen und die Aids-Pandemie haben in manchen Regionen zu einem dramatischen Rückgang der Erwachsenenbevöl-kerung mittleren Alters geführt. Oft müssen dort Greisin-nen, die selbst kaum genug zum Leben haben noch für ihre verwaisten oder von den Eltern verstoßenen Enkelkinder sorgen. Arme Alte und Kinder, die man als nutzlose Es-ser empfindet, sind neben HIV-Infizierten und Menschen mit Albinismus die Ersten, gegen die sich die Aggression richtet. Schätzungen zufolge leben alleine in der kongole-sischen Hauptstadt Kinshasa 15.000 als Hexenkinder ver-stoßene Jugendliche ohne Schutz und Fürsorge und jeder Art von Gewalt ausgesetzt.
Für ethnozentristische Überheblichkeit besteht allerdings kein Anlaß. Auch in der aufgeklärten Ersten Welt haben sich Reste magischen Denkens erhalten und geschickte politische oder religiöse (Ver-)Führer könnten auch hier den Hass auf Sündenböcke jederzeit wieder aufflammen lassen.
Der Kulturanthropologe und Religionsphilosoph René Girard stellt die These auf, dass die Entwicklung hin zu höherer Kultur, provokativ und vereinfacht ausgedrückt, ursprünglich auf gemeinschaftlichen Mord, begangen an willkürlich zum Sündenbock bestimmten Opfer(n), be-ruht. Diese kollektive Gewalt gegen völlig schuldlose Op-fer wurde von den Tätern nicht als unmoralisch empfun-den, sondern zu einem gottgefälligen, geradezu heiligen Werk überhöht. Auch die Opfer werden mit zunehmendem zeitlichen Abstand zu dem an ihm begangenen Urverbre-
chen vom personifizierten Bösen zu Heiligen stilisiert. Ri-tualisierte Aggression gegen Außenseiter oder Menschen, die man zu Außenseitern machte, war das einigende Band, das archaische Gemeinschaften. zusammenhielt und die gelenkte Gewalt gegen einen oder einige verhinderte den regellosen Krieg aller gegen alle.
Abb. 77 Eclipse of the Soul, aus der Serie Witches, Kunstfotografie von Mark Brooks, Euerfeld.
142
In komplexeren Gesellschaften muss diese archaische Form der Konfliktbeilegung und Triebabfuhr aber versa-gen. Die Jagd auf bewährte Schuldige wie Hexen, Juden, Kapitalisten, Kommunisten und Fremde stärkt nicht länger den allgemeinen Zusammenhalt und die von miteinander konkurrierenden Gruppen betriebene Suche nach zeitge-mäßeren Sündenböcken führt nur zu einer weiteren Zer-splitterung der Gemeinschaft. Kulturen und Wirtschafts-systeme, die Konkurrenz- und Rivalitätsdenken zum höchsten gesellschaftlichen Ideal erheben, sind von jeher besonders gefährdet nach zunächst beeindruckenden Er-folgen vollständig und folgenschwer zu scheitern.
Heute stehen politischen Haßpredigern, radikalen Grup-pierungen und kranken Einzeltätern Mittel zur Verfügung, die weit über die Möglichkeiten früherer Sündenbockjäger und Demagogen hinausgehen. Häufig sind die Intrige und der Vernichtungswunsch keinem Täter eindeutig zuorden-bar. Gewalt und Hass haben oft kein Gesicht. Sie finden sich säuberlich institutionalisiert und nahezu klinisch rein aufbereitet in Statistiken, werden von seelenlosen Büro-kratien verwaltet oder mit geheucheltem Bedauern zu unvermeidbaren strukturellen Zwängen erklärt. Einzelne anonyme Cybermobber können mit geringem Aufwand Leben nicht nur virtuell zerstören. Sie haben die Macht unerkannt zu vernichten ohne in die Augen ihrer Opfer se-hen zu müssen.
Der archaische Ansatz, Gewalt mit - häufig noch massi-verer - Gewalt zu begegnen, kann nicht nur aus diesem Grund keine Lösung sein. Es gilt vielmehr den Sünden-bockmechanismus zu überwinden und den Kreislauf von Stigmatisierung, kollektiver Ausgrenzung und schließli-cher Vernichtung erst gar nicht in Gang kommen zu lassen. Wer nicht Marionette im Intrigenspiel sein will, darf nicht mitmachen beim scheinbar harmlosen Gerüchtestreuen, Wer nicht (Mit-)Täter werden will, darf nicht schweigen, sondern muss sich auf die Seite der Opfer stellen.
Sündenbockjäger und Mobber haben nur soviel Macht wie wir bereit sind ihnen zu geben.
Quellen:
Research Paper No. 169, Jill Schnoebelen, Wit-chcraft allegations, refugee protection and human rights: a review of the evidence,
http://www.underthesamesun.com/sites/default/files/Witchcraft%20allegations,%20refugee%20protec-ton%20%26%20human%20rights%20-UNHCR.pdf
Research Paper No. 197 Breaking the spell: respon-ding to witchcraftaccusations against children
http://www.refworld.org/p fid/4d8879542.pdf
GIRARD, René: Je vois Satan tomber comme l‘éc-lair, Paris: Grasset & Fasquelle 1999
GIRARD René: Das Heilige und die Gewalt, Frank-furt: Fischer 1992
143
Ist Cybermobbing eine moderne Form der Hexenverfolgung?
von Stefanie Glaschke
Was machte die Hexenverfolgung aus?
Mit den schaurigen Bildern der großen Kostümfilme hat sie nur wenig gemeinsam.
Die Hexenverfolgung war eine brutale Form der Zerstörung von Menschen. Oft bediente man sich dabei der Hilfe durch die Inquisition, jedoch sind die beiden Themen nicht einfach zu vermischen oder gar gleichzusetzen.
Das Hauptthema der Inquisition (lat. Untersuchung) war die Verfolgung von Menschen, die eine andere Anschauung hatten als die katholische Kirche sie vorschrieb. Inquisition herrschte in Europa vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. Menschen, die ihren Glauben frei vom Papsttum leben wollten, Freidenker, die sich den Dogmen der Kirche nicht unterordnen wollten und auch Personen, die Kritik an der offiziellen Glaubenslehre übten, waren von der Inquisition betroffen.
Es ging nicht darum, schädigende oder bösartige Menschen für ihr Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Es ging darum, jede Form von anderer Denkweise zu unterbinden. Notfalls wurde der anders Denkende gefoltert und getötet.
144
Inquisition geschah im Auftrag einer herrschenden Klasse, die ihre Stellung behaupten und festigen wollte.
Doch allein die katholische Geistlichkeit wäre nie in der Lage gewesen, die Greueltaten der Inquisition allein zu bewerkstelligen. Schnell konnten weltliche Stellen als Unterstützer gewonnen werden. In Europa geht man von einer Opferzahl zwischen 30.000 und 100.000 Frauen und Männern aus. Wissenschaftler streiten allerdings immer wieder über die Zahlen, da viele Verurteilungen von weltlichen Gerichten gesprochen wurden, also indirekt von der Inquisition getroffen wurden.
Die Hexenverfolgungen begannen schon weit früher und endeten auch später. Es gibt eine Schnittmenge mit der Inquisition und zwar dort, wo sich die Kirche dafür einsetzte, unliebsame Kritiker aus dem Weg zu schaffen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Hexenverfolgungen aus dem Volk heraus geschahen. Wenn Umstände die Lebensbedingungen verschlechterten, wurde ein Schuldiger gesucht. Man konnte sich nicht erklären, warum Ernten misslangen oder Kinder und Vieh starben. Schuld konnte nur der Teufel sein.
Der Glaube an den Teufel war vom Glauben an Gott nicht zu trennen. Wer aber stand im Kontakt und im Dienst des Teufels? Das waren nach damaliger Überzeugung die so genannten Hexen. Da der Teufel nicht erreichbar war, wurden an seiner Stelle Menschen aus dem Weg geschafft. An der Tatsache, dass Hexenverfolgungen sich immer dann häuften, wenn die Rahmenbedingungen sich verschlechterten, zeigt der Anstieg der Zahlen zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg, in der kleinen Eiszeit und während Hungerkatastrophen.
Wie aber verlief Hexenverfolgung hinter den Kulissen und was hat das alles mit
Cybermobbing zu tun?
Damit eine Anklage erfolgen konnte, musste ein Opfer angezeigt werden. Das bedeutete, jemand musste verdächtigt werden. Hier ist ganz wichtig zu sehen, dass es nur um haltlose Verdächtigungen gehen konnte, denn de facto kann der Straftatbestand eines Bündnisses mit dem Teufel ja gar nicht vorliegen. Danach kamen die Verhöre der Beschuldigten.
Diese Verhöre konnten auf unterschiedlichste Weise gestaltet sein. Von einem einfachen Gespräch bis hin zur Folter mit Todesfolge war alles denkbar und möglich. Schließlich wurde eine Verurteilung ausgesprochen. Die Anzeige durfte anonym erfolgen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Angezeigt wurde also vordergründig grundlos, das klingt dogmatisch, muss aber so festgehalten werden.
145
Was waren die Hintergründe der Anzeigen? Wissenschaftler gehen davon aus, dass Ängste und Hysterien zu den Anschuldigungen führten. Unerklärbare Not macht den Menschen irrational.
Und wie verläuft Cybermobbing? Cybermobbing liegt vor, wenn eine Person oder seltener Institution über das Internet verunglimpft, beschimpft oder auf andere Art quasi schlecht gemacht wird. Cybermobbing hat zum Ziel, die betreffende Person und ihren Ruf zu schädigen. Man spricht von einer Diffamierung der Opfer. Hauptsächlich tauchte das Phänomen in Schulen auf. Hier wurden zuerst Lehrer die Opfer. Aus Sicht der Schüler sind die Lehrer die, die eine andere Weltanschauung vertreten, vor allem in der Pubertät. Und Lehrer sind diejenigen, vor denen ein Schüler Angst haben kann. Dass Schule in der Neuzeit oft mit Angst und Druck einhergeht, ist sicher hinlänglich bekannt. Ein Schüler, der sich nicht erklären kann, warum seine Leistung schlecht bewertet wird, bekommt Unsicherheiten und Ängste.
Gleichzeitig ergibt sich in der Schule aber auch die Angst vor Isolation. Es ist wichtig, zu einer Gruppe zu gehören. Das festigt die soziale Stellung und damit das Selbstwertgefühl. In der Adoleszenz ist die Zugehörigkeit eine Notwendigkeit.
Damit entsteht quasi Existenzdruck. Cybermobbing hat sich also auch auf andere Personen als auf Lehrer ausgeweitet. Inzwischen schätzen Fachleute, dass etwa ein Drittel aller Schüler im Laufe ihres Schulbesuchs von Cybermobbing betroffen sind. Es verläuft ganz ähnlich wie die Hexenverfolgungen. Eine Person wird angezeigt, das bedeutet, eine unwahre Aussage wird über sie gepostet. Auch direkt ist eine Diffamierung möglich, indem die Person die unwahre Aussage direkt als Mail, sms oder
ähnliches erhält. Ein Mensch wird an den Pranger gestellt. Warum? Die Täter, die Cybermobber, geben sehr häufig an, dass sie Angst haben, Opfer zu werden. Hier arbeiten sie nach dem Prinzip Angriff ist die beste Verteidigung. Das Internet ist unüberschaubar. Wer einmal seinen Namen dort abgelegt hat, kann unmöglich verfolgen, was mit seinem Namen geschieht. Eine Angstsituation also. Diese Angst ist unaufhörlich latent im Hintergrund.
Man könnte morgens aufstehen und wäre über Nacht der Lächerlichkeit preisgegeben. Da de Täter auch oft anonym arbeiten, ist die Misere nicht ohne weiteres abzustellen. Und die Internetnachrichten werden verbreitet und geteilt. Niemand weiß, wo die diffamierenden Äußerungen oder Fotos schon überall veröffentlicht sind. Wer sich ins Internet begibt, spürt die Gefahr unbewusst. Sie ist auch nicht einzudämmen. So wird zwar nicht entschuldbar, aber verständlich, dass Angst aufkommt.
Und hier liegt eine Ähnlichkeit zu den Hexenverfolgungen vor. Es geht um Angst. Als Hexe konnte jeder und jede angezeigt werden. Im Internet kann jeder Nutzer diffamiert, verleumdet und verunglimpft werden. So denken viele Täter: Lieber der andere als ich. Ist erst mal ein Opfer gefunden, kann man entspannen.
Es gab Hexenprozesse als Schauprozesse und wenn der Scheiterhaufen brannte, brauchte man für einen kurzen Moment nichts zu fürchten, das Volk war ja beschäftigt. Kehrte Ruhe ein, war man wieder auf der Hut. Auffallend ist hier auch, dass viele Cybermobber sowohl Opfer als auch Täter sind. Es geht also um einen Wettstreit in Diffamierung. Was kann Abhilfe schaffen? Die Hexenverfolgung ist noch nicht vorbei, noch heute gilt Hexe bei vielen als Schimpfwort. Die letzte Hexe wurde in Europa erst gegen Ende des 19. Jhdts verbrannt. Aber
146
Das geht nur, wenn der Mensch etwas MACHEN darf, statt als Konsumtier gehalten zu werden. Wenn Cybermobbing, eine Handlung, die bis zum Suizid des Opfers führen kann, aus der Gesellschaft verschwinden soll, muss ein Umdenken erfolgen. Erst dann liegt das Opfer nicht mehr auf der menschlichen Seite. Allerdings müsste dann einiges an Autorität und Konsumgewinn geopfert werden.
Wenn Hexenverfolgung enden soll, dann geht das nur durch Aufklärung und Verstand. Dann müssten die Menschen die Verantwortung für ihr Handeln auf sich nehmen und somit auf einen Sündenbock verzichten können.
Das bestehende Prinzip Druck von oben erzeugt Treten nach unten, das so genannte Radfahrerprinzip in unserer Gesellschaft kann nur durch einen einzigen Schritt beendet werden. Der Druck von oben muss aufgehoben werden. Solange Ängste erzeugt werden, wird es Mobbing geben, Cybermobbing, Hexenverfolgung und Diffamierungen anderer Art. Wir müssen also eine neue Form der Kommunikation finden, wenn wir die dunklen Kapitel unserer kulturellen Geschichte nicht immer wieder neu schreiben wollen.
die Hexenverfolgung ist immer dann zu spüren, wenn mutige Frauen die Stimme erheben und gesellschaftliche Missstände anprangern.
Die Meute stürzt sich dann, aus Angst vor Veränderungen oder aus Scham, auf diese Frau und nicht selten hören wir den Begriff Hexe in diesem Zusammenhang als Anklage.
Auch Cybermobbing wird nicht einfach so aus der Mode kommen. Was wirklich bekämpft werden muss, ist die Angst. Die Angst, Opfer zu werden, lässt solche Taten entstehen. Angst kann einerseits auf der persönlichen Ebene durch eine Stärkung der Selbstsicherheit und des Selbstwertgefühls entstehen. Gerade für junge Menschen hilft sicher auch eine Stärkung der Eigenverantwortung, die zur Autonomie führen kann.
Aber will unsere Gesellschaft unabhängige junge Menschen, die sich selbst verantworten? Diese würden sich ja fast benehmen wie Hexen. Sie würden sich Entscheidungen nicht abnehmen lassen wollen und ihr Leben selbst gestalten.
Das wäre Pech für Autoritäten und Wirtschaft. Selbst denkende Menschen sind nicht leicht zu führen, sie sind demnach nicht bequem und auch nicht wirklich gewinnbringend für die herrschenden Systeme. Also befinden wir uns in einer Ambivalenz. Es gilt, Ängste abzubauen und gleichzeitig Autoritäten zu erhalten.
Das passt nicht. Wir brauchen Aufklärung und Verstand, um Ängste zu minimieren. Aber gerade Aufklärung und Verstand macht Menschen zu bewussten, zu selbstbewuss-ten Individuen. Manche nennen sie Hexen. Keine Angst haben bedeutet, seine eigene Macht wahrnehmen.
147
Die Hexe in der Psychologie
von Stefanie Glaschke
Immer wieder mussten und müssen wir erleben, dass schon das Wort Hexe eine Abwehr auslöst.
Die Hexenbilder in Märchen werden oft gleichgesetzt mit Verderbnis. Das Bild der bösen Stiefmutter entspricht dem der Hexe weitgehend. Die böse Stiefmutter will sich nicht entthronen lassen. Die Prinzessin wird entrechtet, zur Dienstmagd degradiert oder sogar getötet.Die Hexe im Märchen kann bisweilen sogar Kinder verspeisen. Dieses Verschlingen mit Haut und Haar ist der größte, denkbare Besitzanspruch einem anderen Lebewesen gegenüber. Das Wort Hexe ruft einerseits positive Bilder von Wehfrauen und Kräuterkundigen hervor, auf der anderen Seite werden aber auch Erinnerungen an böse (meist) alte Weiber in Märchen geweckt. Wie kommt es zu diesem Widerspruch im Verständnis von der Hexe? Der Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker C.G. Jung hat die Lehre von den Archetypen als eine wertvolle Erweiterung der Psychologie entwickelt und damit für die Psychoanalyse wichtige Impulse gesetzt. Jungs Archetypen entsprechen seiner Theorie nach so genannten Urbildern, die sich im Laufe der Menschheitsentwicklung in jedem individuellen Menschen verfestigt haben. Somit sind sie Bestandteil des kollektiven Unbewussten. Unter Jungs Archetypen ist auch der Typus Hexe. Er ist eine spezielle Ausprägung des Mutterarchetypus, der im Grunde positiv ist, jedoch auch Schattenseiten darstellen kann. Jung sieht Hexe inhaltlich als die besitzergreifende, unterdrückende Mutter.
Abb. 63 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld.
148
Die archetypische Hexe darf nicht verwechselt werden mit der weisen, heilenden Hexe in der europäischen Spiritualität. Der Begriff Hexe ist daher seit Jung doppelt besetzt, mit fast schon gegensätzlichen Bedeutungen. Die archetypische Hexe verhindert das Wachstum. Sie unterdrückt Lernprozesse und arbeitet gegen die Abnabelung. Äußerlich tarnt sie sich durch die Rolle der Versorgerin und der Übermutter. Hinter der Fassade steckt ein Kontroll- und Dominanzanspruch. Die vordergründig immer sorgende, stets bereitwillig helfende Mutter, die ihren Nachwuchs vor der Welt beschützt, entspricht diesem Archetyp. Durch ihre Art, Wachstum zu verhindern, wird sie zu einer lebensfeindlichen, negativen Mutterfigur. Die unantastbare Autorität dieser Mutterfigur schüchtert das Kind nachhaltig ein, so dass sich Neurosen und Beziehungsstörungen entwickeln können. Sie unterscheidet sich von anderen, problematischen weiblichen Archetypen noch durch ihr hohes Maß an Intuition. Sie erkennt sehr genau und schnell, welche Manipulationen sie nutzen muss, um den anderen zu binden und zu hindern. Ihr Pendant auf positiver Seite ist die Prinzessin. Sie verkörpert das verspielte, spontane weibliche Wesen, dass viel Freude daran hat, sich zu erkunden und zu erleben. Sind Prinzessin und Hexe als Archetypen ausgewogen, wird dem Hexenanteil die Macht entzogen. Die Unbekümmertheit der Prinzessin hilft dabei, auch anderen, vor allem den eigenen Kindern, das Wachstum zu gönnen. Die Vermischung zwischen dem Seelenanteil Hexe und der Kompetenz zur heilenden Magie ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass es schwer ist, eine Unterscheidung zu treffen. Warum Jung den Begriff Hexe gewählt hat, der doch in seiner Wortherkunft nichts mit possessiver Mutter zu tun hat,
Abb. 78 Morbidia, aus der Serie Creatures of the Night, Kunstfotografie Hans Will, Kitzingen.
ist vollkommen unklar. Zwar ist die Entstehung des Wortes nicht vollständig geklärt, doch lässt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Hexe rein sprachlich Geist/ Seele an der Hecke oder Zaunhockerin/ Heckensitzerin bedeutet.
149
Die Angst vor dem Weibe
von Stefanie Glaschke
Wie können wir begreifbar machen, dass die Hexe in der Geschichte eine gefürchtete Figur war?
Warum werden Frauen, die sich wehren und durchsetzen, auch heute noch als Hexe bezeichnet?
Was kann eine Ursache dafür sein, dass man die Hexe als alt und hässlich darstellt oder alternativ zur bösen
Alten als aufreizend und promisk?
Auffallend ist, dass die Hexe nahezu niemals als eine durchschnittliche, erwachsene Frau gezeigt wird, die keine extremen äußerlichen Merkmale hat. Bei näherer Betrachtung wird erkennbar, dass sie als Sexualpartnerin entwertet ist. Entweder ist sie alt und unattraktiv oder sie ist jung, verführerisch schön und moralisch nicht tragbar. Hexe und Sexualität hängen also zusammen. Sexualität ist die Natur des Menschen. Mit einer Hexe darf und will kein Mann sich einlassen. Eher wird noch der Hausdrachen akzeptiert.
Der Mann, der sich in eine Hexe verliebt, erfährt meist Übles und wird verhext. Die Hexe ist angeblich diejenige, die dem Menschen Schaden durch Kontrollverlust einbringt. Da nun gerade und speziell die Sexualität mit der Hexe unmöglich gemacht wird, kann sie auch nicht Mutter werden. Ihr ist der Zugang zu lebensschaffenden Aspekten
unmöglich. Dadurch, dass der Mann sich nicht auf sie einlässt, bringt er seine eigene Sexualität nicht in Gefahr. Er behält die Kontrolle und muss nicht befürchten, durch den Kontakt mit der Frau verändert zu werden. Kontrolle ist der Kernpunkt im Umgang mit der vermeintlich bösen Hexe.
Die Hexe hat Macht und ist, wie die Natur, nicht kontrollierbar. Alle negativen Schilderungen, ob im Märchen oder in anderen Kontexten, beschreiben letztlich eine sehr mächtige Frau, die Einfluss nehmen kann. Das muss nicht gleichzeitig böse sein, es wird nur zur Warnung unterstellt. Dabei ist die Hexe diejenige, die sich besonders den Gesetzen der Natur hingibt. Denken wir an Jahreskreisfeste, Geburtsrituale oder Initiationsriten, es geht der Hexe um Natur. Auch die Hexenregeln und das Hexencredo behandeln den Umgang mit der Natur zum Wohle des Menschen. Hier liegt die Verbindung.
Auch die Natur ist letztlich nicht kontrollierbar. Sie ist eine Kraft, die Hingabe und Vertrauen verlangt, ohne dafür Garantien oder andere Entschädigung zu bieten. Jede Frau ist nah an der Natur. Trotz aller Versuche sind der Zyklus der Frau, ihre Empfängnis und andere körperliche und seelische Vorgänge in der weiblichen Biologie bis heute nicht vollständig erfasst. Erst ganz langsam entwickelt sich ein Blick dafür, dass weibliche Medizin anders ist als allgemeine. Erst langsam erkennt man, dass weibliches Karrieredenken andere Komponenten enthält als allgemein üblich.
Da gibt es etwas Weibliches, was nicht in starre Regeln zu fassen ist. Wenn Frauen zickig oder launisch sind, dann kann man auch sagen, die Natur sei zickig oder launisch. Doch weder die eine noch die andere Behauptung ist korrekt. Nein, das Weib in der Frau ist Natur. Es ist
150
Werden-Wachsen-Vergehen, und damit nicht statisch. Somit sind Statussymbole und Machtansprüche in der männlichen Welt gefährdet. Der Umgang mit Veränderung braucht Achtsamkeit und Hingabe. Natur muss beobachtet und wahrgenommen werden. Nur so kann die Natur für den Menschen positiv erfahren werden.
Der ständige Prozess der Veränderung macht jede Form von Macht und Dominanz unmöglich. Wir werden zur Flexibilität aufgefordert, wenn wir mit der Natur umgehen. Auch der Umgang mit dem Weiblichen erfordert Flexibilität. Frauen verändern sich, je stärker sie sind, umso freudiger und mutiger.
Sie werden zur Mutter, sie nabeln ihre Kinder ab, sie gehen das Mammut jagen und wenn sie menstruieren meditieren sie und geben sich der Innenschau hin.
Die weibliche Natur verhindert patriarchales und uniformes Denken, denn sie lebt nach eigenen, verborgenen Gesetzen. Vor allem braucht die Natur, und das hat die Hexe mit ihr gemeinsam, keine Berechtigung zum Dasein. Sie hat eine unabhängige Existenz und bezweifelt diese nicht. Die Natur hat ihre Bestimmung einzig darin, sich zu leben. Damit kann sie durch keine Drohung und keinen Druck eingesperrt und funktionalisiert werden. Natur und Hexe brauchen nicht verstanden zu werden. Entweder der Mensch respektiert sie freiwillig oder eben nicht. Das macht das Weib gefährlich für ein Denken in starren Grenzen und angstvollem Festklammern an Unveränderlichkeiten und Besitz.
151
Nachbetrachtungvon Stephanie Nomayo
Das Häuschen, neben dessen Tür der Reisigbesen steht, wo eine schwarze Katze aus dem Fenster späht und ein Rabe auf dem Gie-bel krächzt, wird in unserem Kulturkreis unwill-kürlich die Assoziation Hexenhaus wachrufen, selbst wenn weder Hexe noch Lebkuchen in der Nähe sichtbar sind, und selbst wenn im entspre-chenden Märchen Hänsel und Gretel weder von Besen, noch Raben, noch schwarzen Katzen die
Rede ist!
Dieses Buch versucht Antworten auf Fragen zu geben, die sich bei der Beschäftigung mit der Thematik Hexenhaus und damit auch mit dessen Bewohnerin, der Hexe, erge-ben.
An der Schwelle zur Neuzeit konnte der Hexenaberglaube, der vorher, selbst der Verfolgung ausgesetzt, in Nischen überdauerte, dank der Erfindung des Buchdrucks in Flug-schriften und Büchern verbreitet, in allen gesellschaftli-chen Gruppen Fuß fassen und abstruse Blüten treiben.
Als Katalysator der aufkommenden Hexenverfolgung wirkte der sogenannte Hexenhammer, ein Kompendium über und gegen das Hexenwesen, das als das erfolgreichste Handbuch der Hexenjäger tragische Berühmtheit erlangte. Herausgegeben von den Dominikaner Patres Jakob Spren-ger und Heinrich Institoris, erstmals gedruckt 1487, findet man in dieser komprimierten Sammlung tradierten Volks- und theologischen Aberglaubens die wohl wesentlichste Eigenschaft, die eine Frau zur Hexe machen konnte, be-zeichnet:
Ihre Unregierbarkeit!
...da es ihnen ein Laster von Natur ist, sich nicht regieren zu lassen, sondern ihren Ein-
gebungen zu folgen, ohne irgend welche Rücksicht, so strebt sie danach und dispo-
niert alles im Gedächtnis.[...] und zeigt, dass das Weib sich nicht lenken lassen, sondern
nach eigenem Antriebe vorgehen will; selbst in ihr Verderben, wie man von vielen Wei-
bern liest1.
Wer in die Geschichte der Hexenverfolgung eintaucht, dem kommen drängende Fragen in den Sinn. Wie konnte es soweit kommen, dass Menschen mit fanatischem Ei-fer Angehörige ihrer eigenen Gemeinschaft auf qualvolle Weise in den Tod schickten? Welches waren die Ursachen und Auslöser für den Genozid, der sich gegen Frauen, und hierbei schwerpunktmäßig gegen Greisinnen und junge Mädchen richtete? War der frühneuzeitliche Hexenwahn eine zufällige Laune der Geschichte oder stehen dahinter unvermeidbare gesellschaftliche Regelmechanismen? Gab es Menschen oder Gruppen die sich der Massenhysterie verweigerten und Widerstand leisteten? Wie verläuft die moderne Rezeptionsgeschichte der Hexe und welche Spu-ren des Hexenwahns finden sich noch heute in unserem Denken? Wie lässt sich Vergleichbares in der Gegenwart und in der Zukunft verhindern?
Unser Buch möchte mit seinen engagierten Beiträgen für einige dieser Fragen Lösungsansätze aufzeigen, sei es eine Untersuchung zu den historischen Mechanismen des He-xenwahns in Franken, seien es Betrachtungen zur Psycho-logie der Hexe und des Weibes an sich oder seien es Unter-suchungen zum Sündenbockprinzip und zur Rezeption des
Abb. 79 Aus der Serie Creatures of the Night, Kunstfotografie Hans Will, Kitzingen.
152
Hexenwesens heute. Abschließende Antworten können dabei naturgemäß nicht gegeben werden.
Auch unsere Zeit kennt mannigfache Gewaltexzesse ge-gen Frauen. Man denke nur etwa an die Welle von Verge-waltigungen und Morden an jungen Frauen in Indien oder an die Ermordung von Mädchen, weil sie eine Schule be-suchen, in manchen islamischen Gesellschaften.
Pogrome, die sich gezielt gegen jugendliche und alte Frau-en richten, scheinen insbesondere in Zeiten aufzutreten, in denen traditionelle, patriarchalische und religiös legi-timierte Gesellschaften erste Schritte in eine aufgeklärte, den Wissenschaften verpflichtete und von freiem Denken getragenen Gesellschaft unternehmen. Verunsicherte Pat-riarchen versuchen an der prekären Epochenschwelle mit kaschierter oder unverhohlener Gewalt den Flächenbrand der Emanzipation ihrer Töchter und angehenden Mütter im Sinne einer Bewahrung der Traditionsgesellschaft zu verhindern.
Wie Institoris und Sprenger 1487 bereits thematisiert ha-ben, gelten Frauen im Gegensatz zu Männern als unregier-bar. Selbst wenn sich Frauen in patriarchale Ranghierar-chien einfügen, bleiben sie doch unberechenbar, da ihnen das hierarchisches Denken im Prinzip wesensfremd ist (s. Beitrag von Stefanie Glaschke Die Angst vor dem Weib).
Neben einer möglichen biologischen Disposition spielt hierbei auch die Tatsache eine Rolle, dass für Frauen in patriarchalen Systemen lediglich untergeordnete und fremd bestimmte Rollen vorgesehen sind. Bildungs- und Wissenstransfer zwischen Frauen, vornehmlich im Aus-tausch zwischen sehr erfahrenen, meist alten Frauen und jungen Mädchen sowie durch schulische Bildung an Frau-en, stellen für patriarchale Gesellschaften eine Bedrohung dar, denn sie fördern unter anderem das Erkennen und In-fragestellen einseitiger und ungerechter gesellschaftlicher Normen.
Bemerkenswert ist, dass die Diskrepanz der Geschlechter auch bei der Rollenverteilung von Heinrich Kramer (ali-as Henricus Institoris) in ihrem Verhältnis von Magie und Wissenschaft definiert wird. Die Männer befänden sich demnach in Positionen, die sie aufgrund ihres Wissens einnähmen, während sich die Frauen der Magie bedienten und Schaden anrichteten2. Bis heute wird Frauen vorge-worfen, ihnen mangele es am Respekt vor Tradition und wissenschaftlicher Gelehrsamkeit! Sie wären zu wissbe-gierig und kommunikationsfreudig. Man bemängelt ihre allzu unkonventionelle Anwendung erworbenen Wissens.
Es ist unschwer vorstellbar, was ein ungebremster Zu-gang von Frauen zu Bildung und Wissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert, als sich an den Universitäten neben der Theologie und Philosophie erstmals Fakultäten für Medi-zin und Jura etablierten, und zudem der wissenschaftliche Allmachtsanspruch der Theologie auch durch die konfes-sionelle Spaltung der Kirche in den Grundfesten erschüt-tert wurde, im gesellschaftlichen wie wissenschaftlichen Bereich bedeutet hätte. Die mit den humanistischen Strö-mungen der Zeit programmierte geistige Emanzipation der Frau war daher, zumindest aus der Sicht konservativer Kräfte, zu verhindern. Bewährte Instrumente hierfür wa-ren Abwertung, Entwürdigung und, wenn das nicht half, Gewalt!
Die Hexenverfolgungen dauerten im fränkischen Raum bis zum letzten Prozess am 21. Juni 1749 an. Das Vorhaben der Verfasserin, den letzten fränkischen Hexenprozess an-lässlich einer 1250 Jahrfeier, im Jahr 1998 auf der Gemar-kung Hexenbruch, dem Originalschauplatz in Höchberg, als Passionsspiel aufführen zu lassen, erzeugte 1997 eine Welle der Entrüstung in der Bevölkerung, die sich in eine Flut von ablehnenden und empörten Leserbriefen in der Regionalzeitung Main Post ergoss. Die Höchberger ver-wahrten sich vehement dagegen, dass ihre Gemeinde mit der Hinrichtung der letzten fränkischen Hexe, Maria Rena-
153
ta Singer, in Verbindung gestellt wurde. Von Seiten der Gemeinde sah man sich daher gezwungen, auf die Uraufführung des Passionsspiels zu verzichten.
Dieses Beispiel mag als Hinweis dienen, dass der Hexenwahn in Franken auch nach zweieinhalb Jahrhunderten nicht gänzlich bewältigt ist, sondern im kollek-tiven Gedächtnis der Menschen nach wie vor als Trauma empfunden wird.
Früher wie heute verkörpert die Hexe den archetypischen Zwiespalt im Um-gang mit allem Fremden: Sie ist fremd und zugleich vertraut, faszinierend, aber auch gefährlich, sie kann Gutes tun, aber auch Verderben bringen, man ist nie si-cher, ist sie Freund oder Feind.
Hier kommt die moderne Hexe ins Spiel. Sie verarbeitet und kontrastiert diese la-tente Xenophobie, sie lebt tatsächlich ihre Unregierbarkeit, weil sie sich im Idealfall nur ihrem Willen und keinerlei hehren Tugenden verpflichtet fühlt, und vor allem versteht sie sich als Sympathi-santin der einst verfolgten Hexen, und damit als fortschrittliche, und vor allem emanzipierte, weil in keine Hierarchie sich fügende, Frau! Die Faszination, die heute von der Protagonistin Hexe aus-geht, ist vielschichtig:
Im Märchen ist die romantische Hexe angelegt als Gegenentwurf des als alt-germanisch interpretierten Ideals ed-ler Weiblichkeit, das sich in der Mutter Gottes oder der Urmutter mit all ihren
Abb. 80 Aus der Serie Creatures of the Night, Kunstfotografie Hans Will, Kitzingen.
154
später sogar als völkisch assoziierten Tugenden wie De-mut, Hingabe und Mitleid spiegelt. Sowohl die moder-ne, wie auch die romantische Hexe kontrastieren dieses geschlechtsspezifische Rollenbild und sind daher im 19. und frühen 20. Jahrhundert für erzieherische Zwecke und sogar, verschärft im Sinne eines aufkommenden Nationa-lismus, als abschreckendes Beispiel des Artfremden, der Außenseiterin mit allen zugehörigen Untugenden, bestens geeignet. Diese Untugenden aber, die seit dem Entstehen des Hexenaberglaubens auch sexuell konnotiert sind, sind ein Faszinosum, das seit jeher die Gestalt der Hexe für Männer wie für Frauen eines Teils abstoßend, andererseits aber auch anziehend macht.
Hinzu kommen die historisch tradierten Eigenschaften, die man Hexen im Volksaberglauben zugesteht, nämlich das Verfügen über magische Eigenschaften und ungewöhnli-che Kräfte, sowie ein Wissen nicht nur um die Schadens-, sondern auch um die Heilkräfte der Natur. Exotik und Ver-führungskunst der Hexe, die im Gegensatz zur Märchen-hexe durchaus jung und hübsch sein konnte, regen hierbei die Fantasie weiter an!
Nicht zu vernachlässigen ist zudem der Aspekt einer auf-geklärten, als Erkennungszeichen weiblicher Emanzipati-on oftmals zur Schau gestellten, Solidarität mit dem Bild der einstmals verfolgten Außenseiterin! Hierbei gibt es eine große Bandbreite, die von der Koketterie mit guten Kinderhexchen (Bibi Blocksberg etc.) und Hexenhäus-chen zu Dekorationszwecken bis hin zur persönlichen Identifikation als Hexe oder Schamanin reicht!
So treffen sich auch die Hexen der modernen Gothic-Szene mittlerweile seit mehr als zwei Jahrzehnten zu festen Ter-minen. Auf dem WGT (Wave Gothic Treffen) in Leipzig, dem M´era Luna in Hildesheim, dem Blackfield in Gel-senkirchen oder dem Amphi-Festival in Köln entkommen sie zusammen mit gleichgesinnten Männern und Frauen für wenige Tage ihrer gesellschaftlich festgelegten Rolle,
um für einen Moment scheinbar frei von Konventionen im Rahmen eines modernen Hexensabbat sich selbst (aus-)leben zu können.
Eitel und selbst verliebt prunken sie in ihren fantasievol-len, oftmals auch hoch erotischen Aufzügen und Gewan-dungen. Die Sehnsucht nach dem eigenen Ich, nach Indi-viduation, bei gleichzeitiger größtmöglicher persönlicher und auch sexueller Freiheit, erfordert hierbei nicht nur Toleranz gegenüber dem/den Anderen, sondern im Gegen-teil suchen die SzeneprotagonistInnen sogar das Fremde, das Befremdliche, das Schräge, das Andere. Und, auch wenn die Treffen der Schwarzen Szene eher unpolitisch und, im Vergleich zu den rebellischen Jugendbewegungen der 1968er Jahre, eher friedlich und verspielt anmuten, so schärfen sie doch die Sinne gegen alles ideologisch gleich Richtende und sind im Idealfall formend für eine von To-leranz, Menschenliebe, kritischer Vernunft und Emanzipa-tion getragenen Grundhaltung unserer Gesellschaft.
Heute spielen Mädchen mit Hexenhäuschen und moder-ne Hexen gehen auf Musikfestivals, es dürfen auf offener Straße Kopftücher genauso getragen werden, wie schwar-ze Mieder und hochhakige Schuhe, ohne dass den Prota-gonistinnen Nachteile entstehen. Aber auch heute diskutie-ren Frauen immer noch gerne ihre Kochrezepte, allerdings kann es passieren, dass sie sich im gleichen Atemzug über chemische Formeln, medizinische Inhalte oder Gesell-schaftstheorien austauschen. Und genauso pragmatisch wie sie ihre Kochrezepte anwenden, fangen sie an, Bil-dungsinhalte im täglichen Leben umzusetzen. Je weiter sie hierbei vordringen, umso bohrender werden ihre Fragen.
Diese Mädchen und jungen Frauen sind es, die mittler-weile an den Universitäten zunehmend die Mehrheit der Studierenden stellen. An der altehrwürdigen, 1582 von Julius Echter neu gegründeten Universität Würzburg wa-ren 2013/2014 26.725 Studierende eingeschrieben. Der Frauenanteil lag hierbei bei 57,3%! Vor diesem Hinter-
155Abb. 81 Aus der Serie Creatures of the Night, Kunstfotografie Hans Will, Kitzingen.
grund wird deutlich, welches Potenzial an Wissen und gesellschaftlicher Entwicklung durch die Verfolgung, den Genozid, vor allem aber durch die Jahrtausende währende Unterdrückung von Frauen bisher verspielt wurden!
Dieses Buch wurde nicht nur von Frauen geschrieben, aber es besitzt ein weibliches Konzept mit einem ganzheitli-chen Anspruch. Es reicht daher, wie sollte es anders sein, vom Backrezept fürs Hexenhäusle, zum Schnitt- und Bas-telbogen bis hin zu den grundlegenden Fragen nach den Wirkmechanismen des Hexenwahns. Es verzichtet aber bewusst auf minutiöse Beschreibung von Foltergräuel und
die bildliche Darstellung obszöner Hexenphantasien, die den Opfern anstelle des Erinnerns und des Gedenkens das Letzte, nämlich ihre Würde, nähmen.
Anmerkungen
1. Malleus Maleficarum, Übersetzung J.W.R Schmidt, Nach-druck der Vorlage von 1906, München 1982, S. 102 ff.
2. http://de.wikipedia.org/wiki/Hexenhammer, Abruf 08.2014.
156 Abb. 68 Lebkuchenhäuschen des Backwettbewerbs im Rahmen der Sonderausstellung „Hexenhäuschen“ 2010 in Volkach.
157
Mitmachen...Abb. 69 Prunkhexenhäuschen von Stefan Schneidmadel, Referent für Museumspädagogik im Stadtmuseum Kitzingen.
159
Rezept Lebkuchenteigvon Stefan Schneidmadel
Lebkuchenmischung:
Zutaten:
500 g Bienenhonig
125 g Wasser
125 g Farinzucker
425 g Weizenmehl
375 g Roggenmehl
Stefans Hexenhäuschen
160
Abb. 71 Richtfest, der Hexehausrohbau steht!
Abb. 72 So sieht Stefans Hexenhäuschen in der Deluxe-Ausstattung aus.
161
20 g Natron
15 g Lebkuchengewürz
15 g Milch
8 g Backpulver
Verarbeitungsweise:
Bienenhonig, Wasser und Farinzucker bis 80 ° C erhitzen.
Weizen- und Roggenmehl mit dem Lebkuchenge-würz mischen und sieben.
Unter die erwärmten Zutaten kneten.
Fertigen Teig ca. 24 Stunden ruhen lassen.
Backpulver und Natron in der Milch auflösen und unter den Teig kneten.
Mit dem Nudelholz ca. 5 bis 8 mm stark ausrol-len und verschiedene Gebäckformen ausstechen (z. B. Hexenhaus) und vor dem Backen mit Milch
bestreichen.
Abb. 73 Philippe Gala bei der Arbeit an seinem Hexenhaus für den Hexenhäuschen-Wettbewerb in Volkach 2010.
162 Abb. 75 Vorlage für Stefans Lebkuchenhäuschen Nr. 2, entwickelt von Stefan Schneidmadel und Alexander Witt.
163
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.
Backtemperatur: ca. 200 ° C
(Ober- und Unterhitze)
Backzeit: ca. 10 Minuten
Hexenhauskleber:
250 g Puderzucker und
2 Eiweiß zusammen aufschlagen.
Stefan Schneidmadel ist Referent für Museumspädagogik
und Mitarbeiter des Städtischen Museums Kitzingen,
bei Fragen ist er über das Museum, unter:
09321 972063 zu erreichen.
Abb. 74 Florian und Christine Bender mit ihrem Hexenhaus für den Häuschen-Backwettbewerb 2010 in Volkach.
164
Abb. 75 Bastelbogen für Stefans Lebkuchenhäuschen Nr. 2, entwickelt von Stefan Schneidmadel und Alexander Witt, grafisch bearbeitet von Stephanie Nomayo.
165
Wer nicht backen möchte, kann auch basteln!
Einfach den nebenstehenden Schnittbogen kopieren, einscannen oder durchpausen und ein Papierhäuschen basteln!
...aber hinterher Aufräumen nicht vergessen!
166
Abb.1 Hexenhäuschen der Lebküchnerei Will anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender. Abb.2 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender. Abb. 3 Eröffnung der Ausstellung in Volkach: Stellvertretende Landrätin Christine Bender, Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Klaus Reder, Leiterin des Städtischen Museums Kitzingen, Stephanie Nomayo. Abb. 4 Das Team um Christine Bender bei der Eröffnungsveranstaltung in Kitzingen 2011, Foto: Rudi Bender. Abb. 5 Februar 2011: Volkacher Hexenhäuschen auf dem Weg nach Kitzingen, sachgerecht eingepackt von Norbert Muther, Foto: S. Nomayo. Abb. 6 Das Kombiticket der Kitzinger Museen für das Hexenhäuschenprojekt Februar 2011, Layout: S. Nomayo. Abb.7 Hexenhäuschen der russischen Hexe „Baba Yaga“ auf Hühnerfüßen, gebacken von Stefan Schneidmadel anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender. Abb. 8 Der Kitzinger Marktplatz nach einer Zeichnung Georg Martins in der Topographia Kitzingae Codomanni3. Foto: Hein Vetter. Abb. 9 Conditorei Georg Friedrich Gebhard. Teilansicht auf einer Schützenscheibe von Andreas Schmiedel vom Mai 1865 der Kgl. Privil. Schützengesellschaft von 1408 Kitzingen. Älteste bekannte Ansicht der ehemaligen Lebküchnerei/Conditorei im Haus Marktstr. 26, Firmenschild: „Fr. Gebhard“. Abb. 10 Dachziegel aus einer Kitzinger Ziegelhütte bei Repperndorf, Bestand des Städtischen Museums Kitzingen. Foto: Michael Herbert, Kitzingen. Abb. 11 Zwei Hungerthaler 1818, Bestand des Städtischen Museums Kitzingen. Foto: Michael Herbert, Kitzingen. Abb. 12 Ein charakteristisches Hexenhäuschen der Volkskunde Arbeitsgruppe des Städtischen Museums Kitzingen. Foto. Rudi Bender. Abb. 13 Großer Lebkuchen-Model, 18.Jh. 42 x 27 cm. Motiv: Zwei Doppelköpfige Reichsadler im Blätterkranz. Großer Lebkuchen für offizielle Anlässe und Feiertage (Kaiser’s Geburtstag). Herkunft: Kitzingen aus der ehemaligen Lebküchnerei Haus Nr. 2 (heute Marktstr. 26). Slg. Poganietz Inv.Nr. A.05.067 Abb. 14 Großer Lebkuchen-Model, um 1810. 58 x 22 cm., Motiv: Dame mit Täschchen und Federhut. Herkunft: Kitzingen aus der ehemaligen Lebküchnerei Haus Nr. 2 (heute Marktstr. 26),.Slg. Poganietz Inv.Nr. A.05.008. Abb. 15 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender. Abb. 16 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender. Abb. 17 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender. Abb. 18 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender. Abb. 19 Hexenhäuschen des Backwettbewerbs anlässlich der Ausstellung in Volkach 2010; Foto: Rudi Bender. Abb. 20 Papiertheater, Bühnenbild und Figuren Hänsel und Gretel, entworfen und gefertigt von Helga Kelber, Kitzingen. Abb. 21 Papiertheater, Bühnenbild und Figuren Hänsel und Gretel, entworfen und gefertigt von Helga Kelber, Kitzingen. Abb. 22 Papiertheater, Bühnenbild und Figuren Hänsel und Gretel, entworfen und gefertigt von Helga Kelber, Kitzingen.Abb. 23 Papiertheater, Bühnenbild und Figuren Hänsel und Gretel, entworfen und gefertigt von Helga Kelber, Kitzingen. Abb. 24
Abbildungsnachweise
Abb. 62 Waldelf, aus der Serie Witches, Kunstfotografie von Mark Brooks, Euerfeld
167
Hexenhäuschenautomat Reichert 1928, Foto: Helmut Dierolf. Abb. 25 Hexenhäuschenautomaten (Stollwerk und unbekannte Firma), Foto: Helmut Dierolf. Abb. 26 Bilsenkraut, Fotos: Reinhard Feisel. Abb. 27 Stechapfel, Fotos: Reinhard Feisel. Abb. 28 Klatschmohn, Fotos: Reinhard Feisel. Abb. 29 Hexennacht im Deusterturm, Februar 2011, Museumsleiter Robert Endres mit Besuchern, Foto: Reinhard Feisel.Abb. 30 Hexennacht im Deusterturm, Februar 2011, Museumsleiter Robert Endres mit Kitzinger Turmhexen, Foto: Reinhard Feisel. Abb. 31 Hexennacht im Deusterturm, Februar 2011, Kitzinger Turmhexen, Foto: Reinhard Feisel. Abb. 32 Hexennacht im Deusterturm, Februar 2011, Kitzinger Turmhexen mit Anführerin Karin Böhm, Foto: Reinhard Feisel. Abb. 33 Die Maske der Allersberger Flecklashex ist durch die große Nase und die zahlreichen Warzen entstellt. Foto: Viktor Meshko. Abb. 34 Die Allersberger Flecklashex. Foto: Viktor Meshko. Abb. 35 Die Maske der Lauinger Hexe zeigt ein zweiteiliges Gesicht: während die eine Hälfte schelmisch lächelt, ist die andere grotesk verzerrt. Foto: Viktor Meshko. Abb. 36 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld Abb. 37 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld Abb. 38 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld Abb. 39 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld Abb. 40 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld Abb. 41 Johann Philipp von Schönborn, Ölgemälde im Städtischen Museum Kitzingen, Foto: S. Nomayo Abb. 42 Malleus maleficarum, Lyon 1669. Abb. 43 Markgraf Joachim Ernst von Brandeburg-Ansbach, Kupferstich, Städtisches Museum Kitzingen.Abb. 44 Johann Caspar Barthel, Kupferstich, Städtisches Museum Kitzingen. Abb. 45 Hinrichtung Maria Renatas, Bleistiftskizze zur Illustration des Passionsspiels,Stephanie Nomayo 1999. Abb. 46 Das Mahnmal von Vardö, Fotos von Rainer Werthmann. Abb. 47 Das Mahnmal von Vardö, Fotos von Rainer Werthmann. Abb. 48 Um 1776/79. Die Darstellung wurde als Geisterbeschwörung, Hexenküche zum Faust, Walpurgisnacht oder Illustration zum Medea-Mythos interpretiert. Aus: Goethe und die Kunst, Seite 126, Feder in Grau laviert, auf weißem Papier. 29,0 * 47,0 cm. Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum. Abb. 49 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie MarkBrooks, Euerfeld. Abb. 50 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie MarkBrooks, Euerfeld. Abb. 51 Hexendolch, Leihgabe aus Privatbesitz, Foto: S. Nomayo. Abb. 52 Dreifuß mit Räucherwerk, Städtisches Museum Kitzingen. Foto: S. Nomayo. Abb. 53 Stechapfel oder Engelstrompete, (Nachtschattengewächse), die Blüte zeigt ein Pentagramm, sie galt als Hexenkraut und wurde als Aphrodisiakum verwendet, hoch giftig! Aufnahme: Elisabeth Porzelt. Abb. 54 Schale mit Salz, Städtisches Museum Kitzingen. Foto: S. Nomayo. Abb. 55 Hexenkessel, Leihgabe Stefan Schneidmadel. Foto: S. Nomayo. Abb. 56 Schattenbuch, Schenkung, Foto: S. Nomayo. Abb. 57 Collage zum Thema Zaubersprüche basierend auf einer Fotografie von Mark Brooks.Abb. 58 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld. Abb. 59 Hintergrundbild Blumenwiese zum Thema Jahreskreisfeste von Elisabeth Porzelt. Abb. 60 Hintergrundbild Herbstlaub zum Thema Jahreskreisfeste von Elisabeth Porzelt. Abb. 61 Waldelfin, aus der Serie Witches, Kunstfotografie von Mark Brooks, Euerfeld Abb. 62 Waldelf, aus der Serie Witches, Kunstfotografie von Mark Brooks, Euerfeld Abb. 63 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks,
Euerfeld. Abb. 64 Illustration „Die vier Hexen“ von Gabriela Brunsch, aus Dido und Aeneas oder Die Zwischenzeit des Glücks, Foto Stefan Ernst. Abb. 65 Titelbild zu Dido und Aeneas oder Die Zwischenzeit des Glücks von Gabriela Brunsch, Foto Stefan Ernst. Abb. 66 Aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld. Abb. 67 Gut und Böse, aus der Serie Witches, Kunstfotografie Mark Brooks, Euerfeld. Abb. 68 Lebkuchenhäuschen des Backwettbewerbs im Rahmen der Sonderausstellung „Hexenhäuschen“ 2010 in Volkach. Foto: Rudi Bender. Abb. 69 Prunkhexenhäuschen von Stefan Schneidmadel, Referent für Museumspädagogik im Stadtmuseum Kitzingen. Abb. 70 Die einzelnen Arbeitsschritte zu Stefans Lebkuchenhaus. Foto. Stefan Schneidmadel. Abb. 71 Richtfest, der Hexehausrohbau steht! Abb. 72 So sieht Stefans Hexenhäuschen in der Deluxe-Ausstattung aus. Abb. 73 Philippe Gala beim Werkeln am Hexenhaus für den Hexenhäuschen-Wettbewerb in Volkach. Abb. 74 Florian und Christine Bender mit ihrem Hexenhaus für den Häuschen-Backwettbewerb 2010 in Volkach.Abb. 75 Vorlage für Stefans Lebkuchenhäuschen Nr. 2, entwickelt von Stefan Schneidmadel und Alex Witt, Grafiken S. Nomayo. Abb. 75 Bastelbogen für Stefans Lebkuchenhäuschen Nr. 2, entwickelt von Stefan Schneidmadel und Alex Witt, grafisch bearbeitet von Stephanie Nomayo.Abb.76 The Scapegoat (Der Sündenbock), Ölgemälde von William Holman Hunt (1827-1910). Abruf 2014 von http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Holman_Hunt_-_The_Scapegoat.jpg. Abb. 77 Eclipse of the soul, aus der Serie Witches, Kunstfotografie von Mark Brooks, Euerfeld. Abb. 78 Aus der Serie Creatures of the night, Kunstfotografie Hans Will, Kitzingen. Abb. 79 Aus der Serie Creatures of the night, Kunstfotografie Hans Will, Kitzingen. Abb. 80 Aus der Serie Creatures of the night, Kunstfotografie Hans Will, Kitzingen. Abb. 81 Aus der Serie Creatures of the night, Kunstfotografie Hans Will, Kitzingen. Abb. 82 Philipp Adolph von Ehrenberg, Kupferstich, Städtisches Museum Kitzingen. Abb. 83 Ausschnitt aus dem Ratsprotokoll, Stadtarchiv Kitzingen, Rat 3 1602-1613, fol. 185, 186. Foto: Stadtarchiv Kitzingen. Abb. 84 Inhaltsverzeichnis und Einband, Brandenburgische Halsgerichtsordnung, Stadtarchiv Kitzingen MAN 1 1516 (alt: 347). Abb. 85 Foltergeräte, Illustration auf Vorsatzblatt, Brandenburgische Halsgerichtsordnung, Stadtarchiv Kitzingen MAN 1 1516 (alt: 347). Abb. 86 links: Wappen der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach mit dem gevierten Wappenfeld der Burggrafen von Nürnberg im Zentrum, rechts: Artikel zur „Straff der Zauberey“, Brandenburgische Halsgerichtsordnung, Stadtarchiv Kitzingen MAN 1 1516 (alt: 347). Foto: S. Nomayo.Schmuckgrafiken im Buch: Stephanie Nomayo;
Einbandgestaltung: Elisabeth Porzelt
Gestaltung der Kapitellseiten:1. Es war einmal ein Hexenhaus: Gra-phik Stephanie Nomayo 2. Magie, Aberglaube und Hexenspuk: Hin-tergrund: Mark Brooks, Waldelfin, Im Vordergrund Schleiereule „Pau-la“ der Falknerei und Tierauffangstation Karl Josef Kant, Würzburg, Foto: Stephanie Nomayo. Collage: Stephanie Nomayo 3. Hintergründe des Hexenwahns: Collage von Stephanie Nomayo auf der Basis einer Fotografie von Mark Brooks. 4. Naturenergien und Kräuterheilkunst: Collage und Bilder: Stephanie Nomayo sowie eine Fotografie (Hexe)von Mark Brooks. 5. Hexenjagd in der Gegenwart: Foto: Mark Brooks.
168
Stephanie Nomayo (Hrsg.), Frank Falkenstein (Hrsg.):Der Bullenheimer Berg im Fokus moderner Methoden der ArchäologieSchriftenreihe des Städtischen Museums Kitzingen Band 5 (Kitzingen 2012)86 Seiten, 107 AbbildungenVerlag: H.-D. SauerbreyISBN 978-3-924694-27-2 (vergriffen)
In der Schriftenreihe des Städtischen Museums Kitzingen sind seit der Wiedereröffnung des Museums im Jahr 2007 erschienen:
Stephanie Nomayo (Autor/Hrsg.), Saufeder Hirschfänger und Federspiel – Waidwerk in Franken bis zum Ende der Feudaljagd, mit einem Beitrag von Dipl. Forstwirt Reinhard Feisel, Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Städtischen Museum Kitzingen, Schriftenreihe des Städtischen Museums Kitzingen, Band 7 (Kitzingen 2014). 136 SeitenVerlag: H.-D. SauerbreyISBN 978-3-924694-31-9 13,90 Eur[D] / 14,30 Eur[A] / 20,50 CHF
169
Helmut Gebelein; Rainer Werthmann; Stephanie Nomayo (Hrsg.),Johann Rudolph Glauber - vom Barbier zum AlchemistenKatalog begleitend zur Ausstellung,Schriftenreihe des Städtischen Museums Kitzingen, Band 3 (Kitzingen 2008)Auflage 1 (1. Aufl.); 32 Seiten;ISBN: 3-89014-296-67.50 Euro
Erich Schneider; Stephanie Nomayo (Hrsg.), Kitzing am Mayn, darüber da ein starcke steinerne Bruck gehet - Bilder und Beschreibungen der Stadt Kitzingen von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Schriftenreihe des Städtischen Museums Kitzingen, Band 2 (Kitzingen 2007)Auflage 1 (1. Aufl.); 200 Seiten;19.80 Euro
Helmut Gebelein; Rainer Werthmann; Stephanie Nomayo (Autor/Hrsg.), Johann Rudolph Glauber Alchemistische Denkweise, neue Forschungs-ergebnisse und Spuren in Kitzingen Schriftenreihe des Städtischen Museums Kitzingen, Band 4 (Kitzingen 2009)Verlag: H.-D. SauerbreyAuflage 1 (1. Aufl.); 310 Seiten;ISBN: 978-3-924694-25-817.80 EuroStephanie Nomayo (Autor/Hrsg.),
Reinhard Feisel (Autor/Hrsg.):Der Sieboldgartenin Kitzingen am MainSchriftenreihe des Städtischen Museums Kitzingen Band 6 (Kitzingen 2013)56 SeitenVerlag: H.-D. SauerbreyISBN 978-3-924694-27-2 7.20 Euro
170
Das Hexeneinmaleins - Die Auflösung
Du mußt versteh‘n, aus Eins mach Zehn. Die Zwei lass geh‘n.
Die Drei mach gleich, Also kommt in die erste Reihe: 10, 2, 3
So bist du reich. Reich an Wissen, denn man weiß jetzt
schon: die Summe muß immer 15 ergeben. Verlier die Vier!
Aus Fünf und Sechs, So sagt die Hex,
Mach Sieben und Acht, Aha, also in die zweite Reihe: 0, 7, 8 - und
siehe da, die Summe ist wieder 15. So ist‘s vollbracht:
Es ist erst fast vollbracht, aber man hat jetzt alles zusammen, um die dritte und letzte Reihe zu erstellen: die „verlorene Vier“ taucht wieder auf, so dass sich 5, 6, 4 ergibt. Die Summe ist wieder 15.
Und Neun ist Eins, Diese neun Felder ergeben ein
magisches Quadrat... Und Zehn ist keins.
...und magische Quadrate mit zehn Feldern gibt es nicht.
Das ist das Hexen-Einmaleins!
10 2 3 = 15 0 7 8 = 15 5 6 4 = 15 =15 =15 =15
171
gilt als eines der ältesten Kommunalmuseen Frankens. Es wurde 1895 durch den Kitzinger Stadtrat gegründet und befand sich zunächst in zwei Räumen des Kitzinger Rathauses. Während des 2. Weltkrieges war es in die Kitzinger Landwehrkaserne ausgelagert. Im Jahre 1964 zog es in den Fürstlich Brandenburgischen Kastenhof ein Im April 2007 wurde das Städtische Museum Kitzingen, nach Neukonzeption und umfangreichen
Sanierungsarbeiten, wieder eröffnet.
Die nach modernsten Maßstäben gestaltete Dauer-ausstellung präsentiert zahlreiche Exponate zur Stadt-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte Kitzingens. Eine eigene Abteilung beschäftigt sich mit der Archäologie und der Siedlungsgeschichte des Landkreises. Im ersten Obergeschoss des Museums befindet sich eine historische Schlossapotheke sowie eine Dokumen-tation zu Leben und Werk des Alchemisten und Vaters
der Chemie, Johann Rudolph Glauber.
Das Städtische Museum Kitzingen
Öffnungszeiten:Dienstag, Mittwoch, Freitag: 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 15.00 - 20.00 UhrSamstag, Sonntag: 14.00 - 17.00 Uhr
Erwachsene 2.- EuroKinder, Jugendliche bis 18 J. frei
Kontakt:Städtisches Museum Kitzingen
Landwehrstr. 23, 97318 KitzingenTelefon: 09321 - 929 915
Sekretariat: 09321 - 927 063E-Mail: [email protected]
Internet: museum.kitzingen.info
Gruppenführungen sind nach Vereinbarung währendder Öffnungszeiten des Museums sowie Samstag
möglich, Gebühr pro Gruppe 35.- Euro.Das Museum verfügt über einen behindertengerechten
Zugang und Aufzug.
Das Städtische Museum Kitzingen bietet inregelmäßigem Turnus Sonderausstellungen zu Themen
der Stadt- und Siedlungsgeschichte des KitzingerLandes, zu laufenden Forschungsprojekten und
Kunstausstellungen an.
Eine Übersicht erhalten Sie im Jahresprogramm desStädtischen Museums unter: www.kitzingen.info/418.0.html
Zudem bietet das Städtische Museum Kitzingen aktuelldie Möglichkeit zur ehrenamtlichen Mitarbeit in vierArbeitsgruppen, die sich mit Themen der Stadt- und
Siedlungsgeschichte des Kitzinger Landes, sowie mitlaufenden Forschungsprojekten in den Bereichen
Archäologie, Philosophie, Alchemie und Volkskundebefassen. Eine Übersicht erhalten Sie unter: www.kitzingen.info/
besucherinformation.0.html
Weiterhin bietet das Städtische Museum KitzingenSchülern, aber auch Teilnehmern von Fortbildungsmaßnahmen
die Möglichkeit zum ein- oder mehrwöchigen Praktikum.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte persönlich an dieMuseumsleitung, Stephanie Nomayo,
unter: 09321/929915




















































































































































































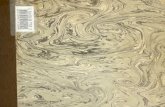

![Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631bc0ca93f371de19011b9c/wer-nutzt-social-tv-die-nutzer-als-treiber-sozialer-interaktion-mit-fernsehinhalten.jpg)







