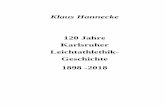Klaus Masanz »Und ich steh immer draußen, vor der Türe!«
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Klaus Masanz »Und ich steh immer draußen, vor der Türe!«
Klaus Masanz
»Und ich steh immer draußen, vor der Türe!« Exklusionsprozesse und biographische Strukturierung von jungen, psychisch kranken, suchtkranken und wohnungslosen Menschen
Biographie – Interaktion – Gesellschaft 14
kasseluniversity
press
Die Arbeit setzt sich auf der Basis einer sowohl teilstandardisierten quali-tativen, als auch biographisch-narrativen Untersuchung, mit dem Verste-hen und Herausfordern für eine Gruppe auseinander, die in der Arbeit als Transsektorale-Systemprüfende definiert wird. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe mit multiplen Exklusionserfahrungen, die sowohl durch komplexe biographische Beeinträchtigungen als auch durch signifi-kante institutionelle Erfahrungen geprägt und charakterisiert wird. Die Felder Sozialer Arbeit, die sich im Zuge ihrer Funktionen und der darin verorteten Aufgabenstellungen der Inklusionsvermittlung, der Exklusions-verwaltung und Exklusionsvermeidung im Besonderen um diese Klientel engagieren und bemühen, erfahren durch sie gerade in der professio-nellen Selbstreflexion und Identität, wie auch in der Grundhaltung, eine Herausforderung. Durch diese Gruppe werden strukturelle Barrieren und erschwerende Zugänge entlarvt, durch sie werden qualitative Mängel und Schwachstellen unter und zwischen den unterschiedlichen Versor-gungssystemen evident. Aus diesen Erkenntnissen werden, im Sinne von »best-practice«, 25 qualitätssichernde Handlungsstandards und Ergeb-nisparameter entwickelt, die innerhalb einer Versorgungsregion fortlau-fend zu prüfen, zu bewerten und gegebenenfalls zu etablieren sind.
Kla
us
Ma
san
z„U
nd
ich
ste
h im
me
r d
rau
ßen
, vo
r d
er
Türe
!“
14
9 783737 602709
ISBN 978-3-7376-0270-9
Klaus Masanz
„Und ich steh immer draußen, vor der Türe!“
Exklusionsprozesse und biographische Strukturierung
von jungen, psychisch kranken, suchtkranken und wohnungslosen Menschen
�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������!�����"����#��$�"��$%����������$��������� ��������&� !���$���$�'�������������(�������������������)������� ��������&�� !���$���$�!����� ������(�����������������*�������+��������!�+���� ,$�-���./01����������������������������2�������������3�������������������������4�����������������������������4����������������������������������!���������������������������4����������������5����������������������������������������3��������+�������"&66���$�7��$�������������)�$&������(�����$(�����$��./01�3824�91:7;7:<.097/.1/79�#"����%�3824�91:7;7:<.097/.107<�#�7����%��=3&����"&66�>$�����$��60/$09.006��!91:;1;1</.1/9��?4&����"&66���7�������$��6���&���&��&///.7@/.10.��A�./01(����������������B�"����� ���(����������$�"����$���7�����$������������������&�2�������2����� ���������(�C+������!���������� �����B�
V
Vorwort
Das vorliegende Buch greift zentrale Herausforderungen einer sozialarbeitswissen-schaftlichen Theorie und Handlungsforschung auf:
Es zielt auf das Verstehen und Herausfordern von sozialpsychiatrischen Fachkräften für eine Gruppe, die im Buch als Transsektorale Systemprüfer (TSSP) vorgestellt werden. Mit diesem Begriff versucht der Autor, die negative Etikettierung einer Per-sonengruppe aufzuheben, die in der Praxis viele Fachkräfte an die Grenzen ihrer Pro-fessionalität und Konzepte bringt. Er bezieht sich damit sowohl auf eine deutsche sozialpsychiatrische Tradition „Dort beginnen, wo es sich am wenigsten lohnt; mit den Schwächsten!“ (Klaus Dörner) wie auf Dienstleistungstheorien Sozialer Arbeit, die im englischsprachigen Raum als „serving the hardest to serve“ bezeichnet wer-den. In diesem Feld der Versorgung und Begleitung junger Menschen mit multiplen Exklusionserfahrungen und komplexen Beeinträchtigungen ist von besonderer Be-deutung sowohl die subjektiven Erfahrungen der Betroffenen wie auch die Rahmen-bedingungen und Theoriebezüge der jeweiligen Arbeitsfelder einzubeziehen. Die hier vorliegende Arbeit geht jedoch noch weit darüber hinaus – sie bezieht nicht nur un-terschiedliche disziplinäre Perspektiven ein, sondern macht auch biographisch-gene-alogische, gesellschaftspolitische, ideologiekritische und systemtheoretische Ansätze als Forschungs- und Begründungsperspektiven geltend.
Die Arbeit bewegt sich folglich in der Gefahr einer zu breiten Explikation. Wohl wis-send, dass eine Vereinheitlichung von Theorie und Praxis in Bezug auf das Thema die Gefahr birgt, dass eine systematisierende Darstellung das Leben in seiner Einheit und Vielfalt verfehlt, gelingt es weitgehend die sehr breit angelegte Auseinanderset-zung einzugrenzen. Die Arbeit entzieht sich so dem Zugriff einer einzelnen diszipli-nären Sicht, wirkt damit auch der durch wachsende Spezialisierung Sozialer Arbeit zunehmenden Asymmetrie von Problementwicklungen und disziplinären Entwick-lungen entgegen. Damit kommt diese Analyse – über das Konzept einer Interdiszip-linarität bzw. Multiprofessionalität in der Sozialpsychiatrie hinausgehend – zu einem Verständnis von Wissenschaft, die Verbindunglinien zieht. Der Autor greift soziale Kategorien wie Ethnizität, Unterversorgungslagen, das Einwirken gesellschaftlicher Krisen und Kriege nicht isoliert sondern in ihren‚ ’Verwobenheiten’ mit individueller Biographie, psychischer Entwicklung, psychischen Störungen und Abhängigkeitser-krankungen, Bindungsmustern der Primärfamilie und den sozialen Nahräumen auf.
Es geht folglich nicht allein um die Berücksichtigung mehrerer Erklärungsansätze und -Dimensionen, sondern um die Analyse ihrer Wechselwirkungen. Die Arbeit knüpft so auch an ein zentrales Erklärungsmodell der Ätiologie psychischer Störun-gen aus der sozialen Psychiatrie an – dem Vulnerabilitäts-Stresskonzept oder biopsy-chosozialen Modell. Er geht jedoch über diese Diskurse hinaus, weil es die instituti-onalisierten Strategien von Hilfe und Kontrolle wie die gesellschaftspolitischen Felder mit einbezieht. Einbezogen sind die aktuellen Debatten der Gemeindepsychi-atrie, wie der Forensik, der Jugendhilfe, der Suchtkrankenhilfe und Wohnungslosen-hilfe – weil in all diesen Arbeitsfeldern sich Transsektoral Systemprüfende bewegen.
VI
Besonders wichtig an diesem Buch ist aber, dass der Autor die komplexe Thematik sich auch forschend erarbeitet. Dies geschieht sowohl teilstandardisiert wie qualita-tiv, biographisch narrativ. Von besonderer Bedeutung für die Ergebnisse der Arbeit sind die Erträge der biographischen narrativen Inhaltsanalyse. Ausführlich und poin-tiert werden exemplarische Ergebnisse als komplexe Fallerarbeitungen über eine Mehrebenenanalyse vorgestellt: sowohl Kontextklärung, Rekonstruktion des geleb-ten Lebens, Hypothesenbildung, historisch-gesellschaftliche Exkurse zum zeitge-schichtlichen Feld, eine Analyse des erzählten Lebens, eine fallspezifische Interpre-tation und Rekonstruktion, machen die vielschichtigen Dimensionen des Lebens der einzelnen Personen deutlich. Fachlich und methodisch sensibel sind diese Fallbe-schreibungen in Zusammenarbeit und Dialog mit seinen Biographen entstanden. An-erkennung – als zentraler Bezugspunkt theoretischer Erkundung im Feld – wird hier spürbar als Haltung in der Begleitung und Beteiligung der Experten aus Erfahrung deutlich.
Kontrastierend werden im Buch die überwiegend standardisierten Erhebungen zur regionalen Versorgung der Zielgruppe im Gemeindepsychiatrischen Verbund in Stuttgart vorgestellt; von besonderer Bedeutung ist hier die gute Kontextklärung zur Generierung der Daten. Inhaltlich kann Herr Masanz eine Vielzahl von Bezügen zu den erarbeiteten Erkenntnissen wie den qualitativen Forschungsergebnissen herstel-len. Folgerichtig wird dann auch erst nach der Darstellung des „Feldes“ – der Ange-bote für die Zielgruppe im Kontext des Großraums Stuttgart – eine zusammenfas-sende Verdichtung der Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit den Erträgen der biographisch narrativen Analysen erarbeitet.
Von großem Gewinn für das Verständnis der Zielgruppe der Arbeit ist auch die Dar-stellung der unterschiedlichen Arbeitsfelder: Der Autor bewegt sich hier sicher und vertieft mit den jeweiligen Praxisfeldern und deren handlungsleitenden Konzepten.
Insgesamt besticht an diesem Buch, dass die Anforderungen, die aus einem Fallver-stehen an Hilfe- und Unterstützungsstrategien gestellt werden können, auch auf die strukturelle Gestaltung von Angeboten umgesetzt werden. Der Autor kommt zu sehr praxisrelevanten Empfehlungen, die Fallverstehen mit Aspekten der Grundhaltung und methodischem Handeln im Kontext Sozialer Psychiatrie und Sozialer Arbeit ver-binden. Insgesamt sind seine Empfehlungen ausgezeichnet aus den Ergebnissen be-gründet und transparent entwickelt.
Thematisch ist die forschend erarbeitete wissenschaftliche Originalität hervorzuhe-ben, die erstmals ein vertieftes Verständnis der Lebenslage und Psychodynamik der Gruppe der Transsektoral-Systemprüfenden erarbeitet (von Veröffentlichungen der Wohlfahrtsverbände auch als „junge Menschen zwischen den Hilfesystemen“ be-zeichnet). Ich empfehle diese Veröffentlichung uneingeschränkt.
Kassel, im September 2017 Prof. Dr. Petra Gromann
VII
Vielen Dank!
Ich bedanke mich herzlichst bei folgenden Personen, ohne deren Mitwirken meine hier vorliegende Arbeit nicht zustande gekommen wäre. Mein Dank geht an Birgit Reiff für die Transkription der Interviews.
Mein besonderer Dank geht an Dagmar Schuppert, Antonia Hillegaart, Tamara Ha-gen, Stepanie Reiff und Kendra Wolkewitz für die detaillierte Lektorierung. Mein Dank geht an die Einrichtungsleitungen für das Mitwirken an der Erhebung der quan-titativen Daten im geschlossenen Heimbereich innerhalb des Gemeindepsychiatri-schen Verbundes in Stuttgart.
Bei Iris Schüle bedanke ich mich für die gemeinsame Erstellung einer Sozialhotel-statistik und einer Datenbank und für die vielen Diskussionen zu weiteren Schluss-folgerungen und Interpretationen. Bei Andres Plieninger bedanke ich mich für die Unterstützung bei der Datenverarbeitung, der graphischen Darstellung und der For-matierung.
Meinen Dank geht insbesondere auch an die Biographen Fr. A. und Hrn. A, die ebenso von mir interviewt wurden, deren Material ich aber nicht in dieser Arbeit ver-wenden konnte oder durfte. Mein ganz besonderen Dank geht sowohl an die Biogra-phinnen Fr. Brandt (Falldarstellung 2) und Fr. Satic (Falldarstellung 3) als auch an die Biographen Hrn. Grün (Falldarstellung 1) und Hrn. Noller (Falldarstellung 4), deren Verlauf ich von Oktober 2011 bis Juli 2016 miterleben und beobachten konnte und die mit mir viele Stunden mit und ohne Aufnahmegerät geredet und mir tiefe, intime und persönliche Einblicke in Ihre Lebens- und Familiengeschichte gewährt und mir dabei so viel Vertrauen geschenkt haben. Insbesondere gilt mein Dank den Eltern von Herrn Grün, die sich an der biographischen Rekonstruktion und an der Erstellung eines Genogramms aus Sicht der Angehörigen beteiligt haben.
Tiefe Dankbarkeit geht an meine Frau, die die letzten Jahre mit mir überstanden hat, mit mir durch die Durststrecken gegangen ist und mir dabei in meiner „Alltags- und Lebenswelt“ den Rücken gestärkt und freigehalten hat!
Herzlichen Dank gilt Petra Gromann für das entgegengebrachte Vertrauen und ihr Vorbild-Sein sowie an Wolfram Fischer, der mich noch als einen seiner letzten Dok-torandenbetreuungen „mitgenommen“ hat!
Bewusstsein dieser Grenzsituationen ist nach dem Staunen und dem Zweifel der tiefere Ur-sprung der Philosophie. Im bloßen Dasein weichen wir oft vor ihnen aus, indem wir die Augen schließen und leben, als ob sie nicht wären. Wir vergessen, dass wir sterben, verges-sen unser Schuldigsein und unser Preisgegebensein an den Zufall.“1
Karl Jaspers
1 Jaspers, K (1943): Einführung in die Philosophie, S: 18.
VIII
Inhaltsverzeichnis
A: Einführung .................................................................................... 1
1. Kapitel.......................................................................................... 1�1.1. Verortung des Forschungsthemas ................................................................ 5�
1.2. Einführung in den Untersuchungsgegenstand ............................................ 13�
1.3. Eine erste Charakterisierung der Gruppe der Trans-Sektoralen-Systemprüfenden ......................................................................................... 16�
1.3.1. Exkurs: Entwicklung des Gehirns, Bindung und desorganisierte Bindungsmuster ................................................................................. 21�
1.4. Bedeutung von Trans- oder De-Institutionalisierung für die Gruppe der TSSP ..................................................................................................... 32�
1.5. Handlungsleitende Zielsetzungen der Untersuchung ................................ 36�
1.6. Thesen zu den biographischen Fallrekonstruktionen ................................ 36�
1.7. Thesen zum sozialstatistischen Sample ..................................................... 37�
2. Kapitel........................................................................................ 38�2.1. Konzept der Theorie der Alltags- und Lebenswelten nach THIERSCH... 38�
2.2. Alltags- und lebensweltorientierter Ansatz sozialpsychiatrischen Handelns nach OBERT ............................................................................................... 46�
2.3. Theorie der Anerkennung nach HONNETH .............................................. 50�
2.3.1. Theorie der Anerkennung nach HONNETH bezogen auf die Gruppe der TSSP ......................................................................... 62�
2.3.2. Konzept zum Umgang mit der Gruppe der TSSP ............................. 64�
3. Kapitel........................................................................................ 69�3.1. Exklusion und Inklusion im allgemeinen Sinne ......................................... 69�
3.2. Exklusionsprozesse ..................................................................................... 76�
4. Kapitel........................................................................................ 85�4.1. Diskurs von Exklusion in einem systemtheoretischen Kontext ................. 85�
4.2. Diskurs von Exklusion in einem interaktionstheoretischen Kontext .......... 89�
4.3. Diskurs von Exklusion in einem intersektionellen Kontext ....................... 93�
4.4. Diskurs von Exklusion in einem sozialarbeiterisch/sozialpädagogischen Kontext ........................................................................................................ 95�
4.5. Diskurs von Exklusion im Feld der Gemeindepsychiatrie ....................... 101�
4.6. Diskurs von Exklusion im Feld des Straf- und Maßregelvollzugs ........... 114�
4.7. Diskurs von Exklusion im Feld der Wohnungslosenhilfe ........................ 128�
IX
4.8. Diskurs von Exklusion im Feld der Suchtkrankenhilfe ............................ 136�
5. Kapitel ...................................................................................... 141�5.1. Biographie und die Bedeutung des narrativen Interviews ........................ 141�
5.2. Biographische Fallrekonstruktion im Allgemeinen und Teilaspekte ....... 143�
5.2.1. Aspekt der Erzählschwierigkeiten in biographischen Fallrekonstruktionen ....................................................................... 144�
5.3. Forschungsdesign und methodisches Vorgehen ....................................... 147�
5.4. Methodologie oder die Frage, was soll mit dem sozialstatistischen Sample und der biographischen Rekonstruktion gezeigt werden? ........................ 149�
5.5. Verallgemeinerbarkeit und Validität ........................................................ 153�
5.6. Besondere Bedeutung des Leib-Begriffes bei der Gruppe der TSSP für die Biographie ................................................................................................ 155�
5.6.1. Text- und thematische Feldanalyse nach FISCHER-ROSENTHAL und ROSENTHAL .......................................................................... 157�
5.7. Forschungspraktisches Vorgehen ............................................................. 169�
5.8. Sampling, Anbahnung und Kontaktgestaltung mit den Biographen ........ 171�
B: Erster Teil der empirischen Untersuchung: .............................. 175�
6. Kapitel ...................................................................................... 175�6.1. Erste Falldarstellung: Herr Grün .............................................................. 175�
6.1.1. Einführung und Kontextklärung ...................................................... 175�
6.1.2. Gelebtes Leben - biographische Daten - ......................................... 178�
6.1.3. Erste Hypothesenbildung zum gelebten Leben ............................... 185�
6.1.4. Hypothesenbildung aus dem Genogramm ...................................... 192�
6.1.5. Erzähltes Leben ............................................................................... 197�
6.1.6. Hypothesenbildung zum erzählten Leben ....................................... 205�
6.1.7. Fallspezifische Interpretationen und Rekonstruktion der Fallgeschichte ................................................................................. 211�
6.1.8. Typenbeschreibung und Typenbildung ........................................... 213�
6.2. Zweite Falldarstellung: Frau Brandt ......................................................... 216�
6.2.1. Einführung und Kontextklärung ...................................................... 216�
6.2.2. Gelebtes Leben -biographische Daten- ........................................... 217�
6.2.2.1. Erste Hypothesenbildung zum gelebten Leben ..................... 222�
6.2.2.2. Exkurs: Historische Entwicklung der Russlanddeutschen in der Sowjetunion ................................................................ 227�
X
6.2.3. Erzähltes Leben -Text- und thematische Feldanalyse ..................... 231�
6.2.3.1.Hypothesenbildung zum erzählten Leben .............................. 242�
6.2.4. Fallspezifische Interpretation und Rekonstruktion der Fallgeschichte .................................................................................. 245�
6.2.5. Typenbeschreibung und Typenbildung ........................................... 247�
6.3. Dritte Falldarstellung: Fr. Satic ................................................................ 249�
6.3.1. Einführung und Kontextklärung ...................................................... 249�
6.3.2. Gelebtes Leben –biographische Daten ............................................ 251�
6.3.2.1. Erste Hypothesenbildung zum gelebten Leben ..................... 256�
6.3.2.2. Exkurs: Historische Entwicklung des Balkan ...................... 257�
6.3.3. Erzähltes Leben -Text- und thematische Feldanalyse ..................... 261�
6.3.3.1. Hypothesenbildung zum erzählten Leben ............................. 271
6.3.4. Fallspezifische Interpretation und Rekonstruktion der Fallgeschichte .................................................................................. 272�
6.3.5. Typenbeschreibung und Typenbildung ........................................... 275�
6.4. Vierte Falldarstellung: Herr Noller ........................................................... 277�
6.4.1. Einführung und Kontextklärung ...................................................... 277�
6.4.1.1. Exkurs: Heimkinder und Gesundheit..................................... 279
6.4.2. Gelebtes Leben –biographische Daten ............................................ 282�
6.4.2.1. Erste Hypothesenbildung zum gelebten Leben ..................... 283�
6.4.3. Erzähltes Leben -Text- und thematische Feldanalyse- .................... 286�
6.4.3.1. Hypothesenbildung zum erzählten Leben ............................. 299
6.4.4. Fallspezifische Interpretation und Rekonstruktion der Fallgeschichte .................................................................................. 301�
6.4.5. Typenbeschreibung und Typenbildung ........................................... 303�
7. Kapitel...................................................................................... 305�7.1. Vorgehen bei der Heimaktenrecherche und der Kontaktgestaltung ......... 305�
7.1.1. Einführung zur quantitativen Studie der Gruppe der TSSP ............ 305�
C: Regionale Versorgung der TSSP im GPV-Stuttgart ................ 352�
8. Kapitel...................................................................................... 352�8.1. Regionale Versorgung der Gruppe der TSSP am Bspl. des GPV
Stuttgart ..................................................................................................... 352�
8.2. Eingliederungshilfe als Maßnahme für die Gruppe der TSSP .................. 353�
8.3. Strukturen, Angebote und Aufgaben am Beispiel des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Stuttgart ........................................ 354�
XI
8.4. Gremienstrukturen des GPV Stuttgart ...................................................... 357�
8.5. Versorgung der Gruppe der TSSP in einer Hotel-Plus Einrichtung ......... 359�
8.5.1. Ergebnisse eines sozialstatistisches Samples einer Hotel-Plus-Einrichtung in Stuttgart ................................................................... 359�
8.5.2. Abhängigkeitserkrankungen ............................................................ 361�
8.5.3. Psychische Erkrankung ................................................................... 362�
8.5.4. Fachärztliche Behandlung der Gruppe der TSSP ............................ 363
8.5.5. Komorbidtität .................................................................................. 364�
D: Ergebnisse und Zusammenfassung ........................................... 365�
9. Kapitel ...................................................................................... 365�9.1. Zielsetzungen ............................................................................................ 365�
9.2. Ergebnisdarstellung der biographischen Rekonstruktion ......................... 366�
9.2.1. Gemeinsame Merkmale und Kategorien der vier ausgewählten Biographen ...................................................................................... 366
9.2.2. Chronologische Einrichtungs-Matrix der 4 Falldarstellungen ........ 371
9.3. Ergebnisdarstellung des sozialstatistischen Samples ............................... 374�
9.4. Spezifische Merkmale am Beispiel der Falldarstellungen ....................... 379�
9.5. Handlungsempfehlungen in der Versorgung der Gruppe der Trans-Sektoralen Systemprüferinnen .................................................................. 387�
E: Anhang ....................................................................................... 391�
Quellen- und Literaturverzeichnis ................................................. 391�Schaubilderverzeichnis ........................................................................ 406�Tabellenverzeichnis ....................................................................................... 407�
Abkürzungen ................................................................................................. 408�
Transkriptionszeichen ................................................................................... 409�
1
A: Einführung
1. Kapitel
Hinführung, Gliederung und thematische Schwerpunkte
Bei einem ersten Kontakt mit einem jungen Bewohner2 eines Heims, der am Tag der Aufnahme einer geschlossenen Unterbringung mit mir über den Flur der Einrichtung ging, sagte er folgendes zu mir, als wir schließlich vor einer der drei verschlossenen Eingangstüre angekommen sind:
„Sie wissen, was ich alles durchgemacht habe, dort draußen? Sie wissen, ich will hier raus. (… ) Glauben Sie mir, ich werde einen Weg hier raus finden! Sie wissen, dass die Leute da (…) draußen, so einen nicht brauch (….) nicht will. Schauen Sie, obwohl Sie mich hier einschließen, die Türe ist zu (rüttelt mit beiden Händen an der Türe).Und ich steh` immer draußen, vor der Tür! Verrückt ist das? Für mich aber jetze, ich stehe hier drinnen vor dieser verdammten Türe. Zu! Draußen ist auch zu! Verstehen Sie, was ich meine?“
Der junge Bewohner, der mit 16 Jahren von der Ukraine nach Deutschland ausgesie-delt ist, den Gymnasialbesuch in der 9. Klasse abbrach, experimentierte früh mit Dro-gen und trank bereits mit 13 Jahren hochriskante Mengen an Wodka. Er lebte immer wieder monatelang auf der Straße, weil seine Familie mit ihm nicht mehr zu Recht kam. Mit 19 Jahren kam er zum ersten Mal in Haft. Zwei Jahre später wurde er für vier Jahre im Maßregelvollzug behandelt. Im Anschluss daran wurde er drei Jahre im Ambulant Betreuten Wohnen mit Sicherheitsauflagen betreut. Dann heuerte er für ein Jahr bei der Fremdenlegion in Frankreich an und fand schließlich kurze Zeit darauf auf einer Baustelle als Tagelöhner im Großraum Stuttgart Arbeit. Er nahm während der geschlossenen Unterbringung, auf der Basis eines disziplinierten Trainingsplans mit mir am Stuttgarter Stadtlauf 2013 teil und bewältigte die 8 km Strecke in respek-tablen 32:43 Minuten. Dabei erlaubte er sich noch bei km 4 eine selbstgedrehte Ziga-rette! Tage später sprang er mit einem Rucksack über den sogenannten Übersteig-schutz des abgegrenzten Außenbereichs einer Terrasse von 2,80 m Höhe und kletterte dann noch weitere 5 m�hinab bis auf eine Parkplatzebene. Er blieb unverletzt und flüchtete auf die Straße und wieder zurück in die Wohnungslosigkeit. Monate später rief er mich noch einmal an, um mir mitzuteilen, dass es ihm gut gehe und ob wir nicht wieder beim nächsten Stadtlauf 2014 teilnehmen werden. Danach brach der Kontakt vollends ab.
Die Zustandsbeschreibung „Und ich werde immer draußen, vor der Tür, stehen“, legt die Assoziation des Theaterstücks von Wolfgang Borchert „Draußen vor der Tür“ nahe. Das allegorische Bild für die seelische und geistige Verfassung der Kriegsheim-kehrer des Zweiten Weltkriegs, die in ihre Heimatstädte zurückkehrten und sich ab-
2 Zum Zwecke einer leichteren Lesbarkeit des Textes wurde auf die Erwähnung von männlichen und weibli-chen Formen verzichtet. Alle erwähnten und angesprochenen Gruppen wurden in der männlichen Form belas-sen, somit sind selbstredend auch alle Mitarbeiterinnen, Patientinnen, Bürgerinnen, Klientinnen, Biographin-nen usw. gemeint.
2
mühten, an ihr altes Leben wieder anzuknüpfen. Viele von ihnen sind daran geschei-tert, da die Schatten des Krieges, die dunklen Dämonen, die Bilder, die sie in sich trugen, sie nicht in Ruhe gelassen haben. Doch auch bei den Menschen, die in den vier Fallkonstruktionen vorgestellt werden und stellvertretend für die Gruppe der jun-gen, psychisch kranken, suchtkranken und wohnungslosen Menschen stehen, die Trans-Sektoralen-System-Prüfenden (TSSP), die in Kapitel 1.3. beschrieben werden, sind ungünstige Startbedingungen für ein gelingendes Leben zu überwinden. Auch sie tragen unterschiedliche Hemmnisse in sich, sind erschwerten familiären und so-zioökonomischen Strukturbedingungen ausgesetzt und müssen gewaltige Hürden, kräftezehrende Barrieren und kränkende Stigmatisierungen auf dem Weg zu einem autonomen Individuationsprozess überwinden.
Sie sehnen sich aber allesamt nach einem sicheren Ort. Nach einem Ort, den sie Hei-mat nennen. Nach festen, vertrauensvollen und zuverlässigen Bezugs- und Bindungs-personen, nach Freundschaften, die tragen und von Bestand sind. Sie sehnen sich nach einer vollständigen Familie, die zu ihnen steht und sie anerkennt. Sie sehnen sich nach einem Leben, in dem sie gebraucht werden und das ihnen Perspektiven und Entwicklungsräume aufzeigen kann. Sie hätten gerne eine Schulausbildung erfolg-reich abgeschlossen, sie hätten gerne einen Beruf gelernt. Sie würden gerne alleine in einer Wohnung oder noch besser in Partnerschaft mit Kindern und einem eigenen Auto leben. Sie wären gerne finanziell autark, ohne auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Die Wirklichkeit ist hingegen, dass sie seit ihrer Pubertät in Institutionen, in Facheinrichtungen, in unsicheren Wohnräumen oder sogar auf der Straße leben. Sie gefährden sich selbst und andere. Die Dämonen, die sie bekämpfen und mit denen sie leben, sind ihr Suchtverlangen. Die dunklen Dämonen sind psychotische Stimmen, die ihnen ihr Denken und ihre Handlungen komparativ einflüstern oder imperativ vorgeben, die sie verhöhnen oder abwerten. Die dunklen Dämonen sind Halluzinati-onen, feste Wahngewissheiten und Strukturen, die sakrosankt sind. Viele von ihnen haben sich bereits schwer verletzt, sind aufgrund eines toxischen Drogencocktails fast verstorben, haben eine Essstörung entwickelt oder haben ernsthafte und schwere Suizidhandlungen mit bleibenden Folgen vollzogen.
Wie eine Gesellschaft, wie das Gemeinwesen, wie die regional-verorteten Versor-gungslandschaften der Gemeindepsychiatrie, der Suchtkrankenhilfe oder der Woh-nungsnotfallhilfe und die damit assoziierten Kostenträger mit diesen jungen Men-schen umgehen wollen, die von sich sagen, sie stünden draußen vor der Tür, stellt einen qualitativ-ethnischer Gradmesser für jede Gesellschaft und ihre Entwicklung dar. Er ist ein Indikator dafür, wie viele ökonomische und strukturelle Räume und Ressourcen für jeden einzelnen Menschen zum Einsatz kommen sollen.
So kontrovers auch der fachliche Diskurs über die Sinnhaftigkeit von geschlossenen Einrichtungen, der „psychiatrischen Schattenwelt“ auch geführt und weiterhin ge-führt werden, so unbestritten ist die vorübergehende Notwendigkeit dieser Hilfe und die Tatsache, dass es einige Orte, Städte und Regionen in der Bundesrepublik Deutschland gibt, die sich um diese besonders helfensbedürftige Personengruppe im Zuge eines Selbstverständnisses von Pflichtversorgung kümmert und sich mit ihr aus-einandersetzt. Sie wird häufig auf der gesetzlichen Grundlage der Hilfe zur Pflege,
3
nach § 61 Sozialgesetzbuch (SGB) XI, in dezentral gelegene, geschlossene Pflege-heime, vermittelt, die sich häufig in privater Trägerschaft befinden. Sie wird häufig in andere Bundesländer, teilweise sogar über Landesgrenzen hinweg vermittelt. Diese Gruppe, die draußen vor der Tür steht, deckt Versorgungslücken auf, sie offenbart Mängel an regionalen Versorgungsverpflichtungen und Verantwortung auf. Für diese Gruppe passen häufig nicht die konventionellen und etablierten Instrumente zur Hil-febedarfsmessung, die Einrichtungsstrukturen, Behandlungsmethoden und Ange-bote. Sie zwingt Einrichtungen in einem besonderen Maß dazu, ihr Tun, ihr Selbst-verständnis und ihre konzeptionelle Ausrichtung auf den Prüfstand zu stellen. Diese Gruppe offenbart und bietet im gleichen Maße an, Entwicklungsräume für eine Dis-kussion zu Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der psychiatrischen Ver-sorgungslandschaft zu initialisieren. Diese Gruppe muss jedoch zuvor eingehend identifiziert, beschrieben, untersucht und somit erst einmal wahrgenommen werden. Diese Gruppe muss in einem besonderen Maße in den Mittelpunkt der Versorgungs-landschaften rücken. Diese Gruppe muss in ihren Bedürfnissen, in ihren Strukturen und ihrer Binnenlogik, im Rahmen biographischer Rekonstruktionen verstanden wer-den, als Voraussetzung dafür, dass die betroffenen Personen genau die Hilfen und Unterstützung bekommen, die sie akzeptieren, die sie annehmen und von denen sie auch profitieren können. Das ist die Absicht dieser Arbeit.
Die Arbeit besteht aus sechs Teilen: A: Einführung, B: Erster Teil der empirischen Untersuchung, C: Zweiter Teil der empirischen Untersuchung, D: Regionale Versor-gung der Gruppe der TSSP am Beispiel des GPV Stuttgart, E: Zusammenfassung und Konklusion und F: Anhang. Die sechs Teile der Arbeit sind wiederum in 9 Kapitel untergliedert.
In der Einführung (Teil A) geht es zunächst im Allgemeinen um die Darstellung und Verortung des Forschungsthemas und im Konkreten um eine erste Skizzierung der Merkmale und Spezifika der zu untersuchenden Gruppe der Trans-Sektoralen-Sys-tem-Prüfenden (TSSP), die sich unter anderen dadurch auszeichnet, dass sie typi-scherweise querschnitthaft, entsprechend ihrem Lebensalter, mit der Kinder- und Ju-gendhilfe und in der Folge intermittierend mit der Wohnungsnotfallhilfe, der Suchtkrankenhilfe, dem Straf- oder Maßregelvollzug und der Sozialpsychiatrie in Kontakt geraten ist, Hilfen erhalten oder angeboten bekommen und Interventionen erfahren hat. (Kapitel1)
Im 2. Kapitel wird der theoretische Rahmen umrissen und die Einbettung der Gruppe der TSSP im Fokus von Exklusion und die darin wirkenden Ausschließungsprozesse präsentiert, die im Folgenden mit unterschiedlichen und weiterentwickelten Konzep-ten (THIERSCHS Konzept der Lebensweltorientierung, der daran orientierte sozial-psychiatrische Handlungsansatz von OBERT und HONNETHS Theorie der Aner-kennung) in Zusammenhang gebracht werden, wobei der Kontext und Bezug zur Gruppe der TSSP äquivalent zu den unterschiedlichen Feldern der Sozialen Arbeit variieren.
Die Gruppe der TSSP erfährt über weite Strecken ihrer Biographie reziproke Erfah-rungs- und Erlebensprozesse, wie sich aus dauerhaften und fortlaufenden gesell-schaftlichen Abwertungen, Missachtungen, menschenfeindlichen Einstellungen,
4
Stigmatisierungen und Ausgrenzungen gegenüber bestimmten Gruppen3, z. B. Men-schen, die ethnisch oder kulturell „fremd“ oder „anders“ kategorisiert werden, Men-schen mit körperlicher oder geistiger Behinderung, obdachlose Menschen und lang-zeitarbeitslosen Menschen, die den Normalitätsvorstellungen eines geregelten Lebens nicht nachkommen und sukzessive intrapsychische Veränderungen in der Selbstwahrnehmung und Selbstsicht der eigenen Person und Identität entwickeln und so manifestieren können. Die Theorie der Anerkennung bietet nicht nur individuelle Erklärungsansätze in der emotionalen Zuwendung als wichtige Anerkennungsformen für die Gruppe der TSSP an (Bindungen, Primärbeziehungen, Liebe), sondern sie be-rücksichtigt darüber hinaus auch die prägnanten gesellschaftlichen Anerkennungs-verhältnisse im Bereich der kognitiven Achtung und führt zum einen als typische Missachtungsform, die Entrechtung und die Ausschließung (Exklusion) und zum an-deren, im Bereich der sozialen Wertschätzung, die Entwürdigung und Beleidigung an.4
Das Kapitel 3 setzt sich grundlegend mit den Begriffen von Exklusion und Exklusi-onsprozessen auseinander.
Der Ausschließungs- bzw. Exklusionsprozess, der auf die Gruppe der TSSP einwirkt und wechselseitige Einflüsse in Gang bringt, wird in Kapitel 4 im Kontext von vier Diskursen mit unterschiedlichen Theorien und Ansätzen in Zusammenhang gebracht (Systemtheorie, Intersektionstheorie, Interaktionstheorie und Sozialpädagogik), die sowohl auf der Ebene des Umgangs, als auch auf der Ebene des Verstehens grundle-gende Aspekte aus der Perspektive der Gruppe der TSSP hervorheben. Im weiteren Verlauf erfolgt eine Auseinandersetzung des Exklusionsbegriffs mit den an der Ver-sorgung der Gruppe der TSSP teilnehmenden Feldern der Sozialen Arbeit.
Im 5. Kapitel werden die Methodologie und das Forschungsdesign bzw. das metho-dische Vorgehen des Forschens beschrieben. Hierbei werden die in den biographi-schen Rekonstruktionen verwendete Methode der Text- und thematischen Feldana-lyse nach FISCHER und ROSENTHAL (1997) skizziert und Angaben zum forschungspraktischen Vorgehen sowie zum Sampling der Biographen vorgestellt.
Im Teil B wird ein sozialstatistisches Sample als eine Vollerhebung präsentiert, be-schrieben und interpretiert, das sich gerade auf die Gruppe der TSSP bezieht (junge, psychisch kranken, suchtkranken und wohnungslose Menschen), die in drei Einrich-tungen innerhalb einer psychiatrischen Pflichtversorgungsregion im Gemeindepsy-chiatrischen Verbund Stuttgart (GPV), im Erhebungszeitraum vom 1.1.2005-31.7. 2013 wegen Eigen- und auch Fremdgefährdung behandelt, versorgt und betreut wur-den.
Der Teil C beschreibt vier biographische Fallrekonstruktionen von Interviewteilneh-mer, die die Gruppe der TSSP in ihrer individuellen Komplexität, Diversität, in ihrer professionalisierten Vernetzung von Hilfen, in ihrem institutionellen Werdegang und
3 Heitmeyer, W./ Zick, A. (2012): Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland. Eine 10-jährige Langzeitun-tersuchung mit einer jährlichen Bevölkerungsumfrage zur Abwertung und Ausgrenzung von schwachen Grup-pen. S: 8-9. 4 Honneth, A.: Kampf der Anerkennung. 2. Auflage. Suhrkamp Verlag. 1998 Frankfurt/M. S.: 211.
5
in ihren verallgemeinerten Merk malen und Charakteristika „sättigend“ abbilden. Ge-meinsamkeiten, Unterschiede und spezifische Merkmale sollen durch die Anwen-dung der Text- und thematischen Feldanalyse herausgearbeitet werden.
Die gesammelten Zwischenbilanzen und generierten Ergebnisse, Konklusionen und Interpretationen des sozialstatistischen Samples und der biographischen Rekonstruk-tionen werden im Teil D abgebildet und zusammengefasst.
Den Abschluss bildet Teil E, in dem das Quellen- und Literaturverzeichnis, das Schaubild- und Tabellenverzeichnis und weitere Anhänge aufgelistet werden.
1.1. Verortung des Forschungsthemas
Der Begriff, die Gruppe der Trans-Sektoralen-Systemprüfenden (TSSP)5, wird vom Autor geprägt, Die Gruppe der TSSP stellt auf unterschiedlichen Ebenen eine große und komplexe Herausforderung an die professionellen Akteure dar. Dies gilt insbe-sondere in der Kontakt- und Hilfeplanprozessgestaltung, in der Methodik und Spezi-fikation der Einzelhilfe, in der sozialen Gruppenarbeit aber auch in der Gemeinwe-senarbeit. Im Bereich der Wirtschaftlichkeit, also der Frage folgend, welche Bedeutung die Einführung ökonomischer Verfahren in der Sozialen Arbeit hat und schließlich in der Wirkungsorientierung stellt die Gruppe der TSSP die beteiligten Stakeholder auf den Prüfstand. So gerät die Soziale Arbeit unter dem Einfluss der Ökonomisierung unter spürbaren Legitimationsdruck, denn sie hat mutmaßlich Aus-wirkungen auf die Arbeitsbeziehung und beeinflusst zudem mit hoher Wahrschein-lichkeit die Wahrnehmung von Hilfebedürftigkeit.
Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik führt im besten Fall zu einer Perspekti-venerweiterung und stellt weniger eine Reduzierung der Sozialen Arbeit auf ökono-mische Aspekte dar, da sie aufruft, sich mit den Zielen und Wirksamkeiten zu be-schäftigen. Sie fragt vielmehr danach, so SIEGLER, „ob, beziehungsweise, inwieweit sich Soziale Arbeit an den Bedürfnissen der Klienten als Nutzer orientiert, und wer, beziehungsweise wie letztlich die Qualität Soziale Arbeit definiert wird.6 Dieser Schwerpunkt wird jedoch nicht das Thema dieser Arbeit sein, die versucht jedoch den erforderlichen Betreuungs- und Behandlungsrahmen für die Gruppe der TSSP zu definieren.
5 Ein vom Autor geprägter Begriff für die Gruppe der jungen psychisch kranke, suchtkranke und wohnungslose Menschen beschreibt, die bereits als Kind und Jugendliche umfangreiche Hilfen im Feld der Kinder- und Ju-gendhilfe erleben und eine hohe Aufmerksamkeit der weiteren Felde der Sozialen Arbeit, der Wohnungsnot-fallhilfe, der Suchtkrankenhilfe und der Psychiatrie erfahren. Sie wandern durch die Felder, durch diese unter-schiedlichen Sektoren hindurch (trans-) und präsentieren dabei eigen- oder fremdgefährdendes Verhalten, z.B. durch eine riskante oder hochriskante Lebensgestaltung. Dieses durch alle Felder und Hilfen und Angebote Hindurchwandern geschieht teils in kurz intervalligen Etappen, dabei werden aus Sicht der professionellen Hilfen, die Versorgungsschwächen und Defizite, an den Schnittpunkten und Übergängen der andere Felder der Sozialen Arbeit offensichtlich. Grenzen und Entwicklungsräume in der Betreuungs- und Behandlungsabläufen werden aufgezeigt. Die Helfer erleben Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Zurückweisungen in der Kontaktgestal-tung. Zur täglichen Routine gehört es, eine dauerhafte vitale Eigengefährdung zu vermeiden, Kontakte zu hal-ten, materielle Grundversorgung sowie eine Verhinderung einer weiteren Verschlechterung des Status quo. Die gemeinsamen Merkmale auf der Handlungsebene sind: eine massiven Selbstgefährdung, Kriminalität, Ma-nipulation, Prostitution, Suizidalität, Impulsivität, Bedrohung, eine hohe Aggressivität sowie eine hohe Attrak-tivität von Waffen und Drogen. 6 Siegler, Beate Finis: Ökonomik sozialer Arbeit; Lambertus. 2009 Freiburg i.B. S.: 11.
6
Die Wirkungsorientierung zielt darauf ab, dass die zur Verfügung gestellten Ressour-cen effizient und zielgerichtet zum Einsatz kommen. Die Wirkung der Hilfen, so der zunehmende Anspruch der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, soll präziser ermittelt und konkreter nachgewiesen werden, als das in früheren Zeiten gefordert und auch ge-genwärtig der Fall ist. Die Feststellung des Hilfebedarfs steht so mehr und mehr in Korrelation mit dem Kriterium der Wirtschaftlichkeit einer bestimmten Maßnahme sowie einer gezielten Applikation einer geeigneten und angemessenen sozialpädago-gischen Intervention. Doch auch dieser Aspekt würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, obwohl insbesondere die Gestaltung der Behandlung, die Strukturierung, die Kooperation und Vernetzung der verorteten Versorgungssysteme für den Lang-zeitverlauf von psychischen Erkrankungen eine große Bedeutung einnimmt.
In der Versorgung, Behandlung und Therapie von chronisch psychisch kranken Men-schen in der Bundesrepublik sind in meiner Wahrnehmung alternierend immer wie-der neue Personen- bzw. Patientengruppen identifiziert und in den Fokus der Versor-gungsforschung gestellt worden. So dominierte in den Publikationen der 80er Jahre die Gruppe der chronisch kranken Heimbewohner, die meist fernab ihrer Heimat- und Herkunftsgemeinde, in sogenannten Langzeiteinrichtungen, versorgt und verwahrt wurden. Sie galt es über Jahrzehnte hinweg, im Zuge von De-Institutionalisierung7, sukzessive in gemeindepsychiatrische, vorwiegend ambulante Versorgungsangebote dabei zu integrieren und zu begleiten und somit zu enthospitalisieren. Es folgte eine Epoche, in der sich die Fachtagungen mit Fragestellung und der Bedeutung von „Komorbidität in der psychiatrischen Versorgung“ auseinandersetzten. Es ging als-dann um die Betreuung und Behandlung von Menschen mit Suchtabhängigkeit oder intellektuellen Beeinträchtigungen in Kombination mit einer psychischen Erkran-kung. Im Anschluss daran konzentrierte sich die Fachöffentlichkeit auf die Klientel der wohnungslosen und psychisch kranken Frauen und Männer, die zwischen den Feldern der Sozialen Arbeit, also der Wohnungsnotfallhilfe, der Suchtkrankenhilfe und der Psychiatrie, hin und her oszillierten. Mitte der 90er Jahre beschäftigte sich die psychiatrische Fachöffentlichkeit akzentuiert mit Menschen mit Persönlichkeits-störungen. Ende der 90er Jahre übernahmen die „jungen Wilden“8 innerhalb der so-zialpsychiatrischen Versorgung die „Themen-Hitparade“. Kurze Zeit darauf folgte der Ansatz der transkulturellen Bedeutung der psychisch Kranken und Suchtkranken in der Sozialpsychiatrie, vgl. MACHLEIDT (2002)9, anschließend traten 1997 skan-dinavische Behandlungsmodelle nach dem Ansatz von need-adapted-treatment von ALANNEN u.a. (1997)10, Behandlungsansätze von home-treatment nach
7 Beispielhaft in der BRD waren die ersten Auflösungen psychiatrischer Langzeitinstitutionen in Merzig im Saarland (in den 80er Jahren), im Kloster Blankenberg bei Bremen (1988) und in der Karl-Bonnhöfer Klinik in Berlin („Bonnys Ranch“) im Zeitraum 1985-1990. 8 „Junge Wilde“: Die Definition dieser Gruppe in der sozialpsychiatrischen Versorgung versteht darunter die Altersklasse der 18-25 Jährigen, die mit psychischen Vorbelastungen, Traumatisierungen und Suchtabhängig-keiten aus der Jugendhilfe in die Sozialpsychiatrie kommen. 9 Machleidt, W.(2002): Die 12 Sonnenberger Leitlinien zur psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von Migrantinnen in Deutschland. In: Nervenarzt; 72 S.:1208-1209 10 Alanen, Y (1997): Schizophrenie: Entstehung, Erscheinungsformen und bedürfnisangepasste Behandlung Klett-Cotta Verlag. Stuttgart
7
WEINMANN & BECKER et al (2011),11 der sozioökonomische Status oder das wie-der entdeckte Konzept von Empowerment von KNUFF (2007)12 aus dem Recovery-Ansatz von AMERING13 (2007) in den Vordergrund der sozialpsychiatrischen Ver-sorgungsarbeit. Die Gemeindepsychiatrie entdeckte im Verlauf ihres Schaffens, den wirkungsvollen und auf Theorien begründeten methodischen Einsatz u.a. von syste-misch-familientherapeutischen Handlungsansätzen nach ARMBRUSTER et al (2007)14 oder des alltags- und lebensweltorientierten Ansatzes sozialpsychiatrischen Handelns nach THIERSCH (1995) und OBERT (2001). Die Gemeindepsychiatrie ergründete und anerkannte im gleichen Maße die Notwendigkeit, fachärztliche und soziotherapeutische Hilfen mit in die sozialpsychiatrisch-fachärztliche Behandlung als selbstverständlich zu integrieren, und bemühte sich schließlich, wenn auch nur vereinzelt, um empirische und evidenzbasierte Untersuchungen.
Die sozialpsychiatrische Versorgungsforschung hob Ende der 90er Jahre die Bedeu-tung und Wirkung der häuslichen psychiatrischen Pflege für die Versorgungarbeit hervor und wies in einer Untersuchung von OBERT (2001) wirksame Ergebnispara-meter durch die ambulant-assertive Betreuungsarbeit der Sozialpsychiatrischen Dienste innerhalb einer sich selbst verpflichtenden Grundversorgung nach. Gemäß dieser Studie reduziere sich sowohl durch eine gelingende und frühzeitige Koopera-tion und Kontaktaufnahme als auch durch eine intensive Vernetzungsarbeit innerhalb der Betreuung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst, mit der für die Region veror-teten Pflichtversorgungsklinik, die Krankenhausverweildauer pro Klient um durch-schnittlich 52,4 % sowie die Anzahl der stationären Klinikaufenthalte pro Klient um durchschnittlich 36 %. Schließlich sinke durch die enge Zusammenarbeit und Kon-taktgestaltung zum Zeitpunkt der Patientenaufnahme, im Verlauf der akuten Klinik-behandlung und während der Entlassungsvorbereitung die Zahl der zwangsweisen Unterbringungen im Durchschnitt um 40 % pro Klient ab.15
Die wesentliche Aufgabe und Zielsetzung dieser Arbeit wird es nun sein, typische Merkmale von Exklusionsprozessen aufzudecken und diese an vier beispielhaften Bi-ographien zu rekonstruieren, die der Gruppe der „Trans-Sektoralen-Systemprüfen-den“ (TSSP) zugeordnet werden können.
Die rein wissenschaftlich-analytischen Zielsetzung der Arbeit überschreitend, geht es mir auch darum, geeignete Maßnahmen und wirksame Interventionen für die Behand-lung und Versorgung der untersuchten Personengruppe, der jungen, psychisch kran-ken, suchtkranken und wohnungslosen Menschen, zu beschreiben und im Sinne von „best practice“ als Handlungsstandards abzuleiten.
Anfang 2000 wurde eine ehemals sozialpsychiatrisch betreute Klientel in der foren-sischen Psychiatrie und im Strafvollzug ausgemacht und es begann eine intensive 11 Weinmann, Stefan/ Becker, Thomas et al: Akutbehandlungen im häuslichen Umfeld. Systematische Über-sicht und Implementierungsstand in Deutschland. In: Psychiat. Praxis 2011; 38. S. 114-122. 12 Knuf, Andreas/ Osterfeld, M. Steinert U.: Selbstbefähigung fördern. Empowerment und psychiatrische Ar-beit, 5. überarb. Aufl. Psychiatrie Verlag. Bonn 2007 13 vgl. Amering M. Schmolke, M.: Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit. Psychiatrie Verlag, Bonn 2007. 14 Vgl. Armbruster Jürgen/ Rein Gabriele.: Systemische Praxis in der Gemeindepsychiatrie. In: Soziale Arbeit: systemisch. Ritscher, W., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, S.: 148 ff. 15 Vgl. Obert, Klaus: Alltags- und lebensweltorientierte Ansätze als Grundlage sozialpsychiatrischen Han-delns. 1. Auf. Psychiatrie Verlag. Bonn 2001. Seite: 53-85.
8
Auseinandersetzung mit der Nachsorge und Reintegration von ehemals forensisch-psychiatrischen Patienten nach § 63 Strafgesetzbuch (StGB) in einem qualifizierten sozialen Empfangsraum in unterschiedlichen gemeindepsychiatrischen Institutio-nen.16
Die Wohn-, Beratungs-, Betreuungs- und Beschäftigungsangebote der psychosozia-len und gemeindepsychiatrischen Träger haben sich im Verlauf der letzten 25 Jahre in der Bundesrepublik weiter ausdifferenziert und spezialisiert. Es entstanden für die spezifische Klientel zeitlich begrenzte Modellprojekte, die im günstigsten Fall in re-gelfinanzierte Betreuungsangebote übergingen. Während sich KRISOR17 bereits 1992 mit dem HERNER Modell noch für die Empfehlung einer heterogen durch-mischten Zusammensetzung und Belegungsplanung von Stationen im Klinikbereich aussprach, begann sich in der klinischen Psychiatrie schrittweise ein gegenläufiger Trend und eine gegenläufige Bewegung, nämlich eine spezielle diagnosefokussierte Psychiatrie mit evidenzbasierten und krankheitsspezifischen Therapie- und Behand-lungskonzepten zu etablieren.
Ob die Zunahme einer Spezialisierung von Hilfen und eine in den letzten Jahren fast schon unmerkliche Fragmentierung von Hilfsangeboten, die durch hochschwellige Zugänge charakterisiert sind, positiv zu bewerten ist, ist ebenso weder das Thema dieser Arbeit noch eindeutig monokausal zu beantworten. Wie so oft spricht einiges dafür, dass spezielle Angebote für eine bestimmte Patientengruppe vorgehalten und abrufbar gestaltet werden. Ebenso gibt es Argumente, die sich für eine heterogen durchmischte Patientengruppe aussprechen, die nachweislich eine deeskalierende Behandlungsatmosphäre befördern und einen gewaltreduzierenden Einfluss auf die Behandlung und das Stationsleben nehmen. Ziel dieser Arbeit soll es auch sein, für diese Fragestellung strukturelle Empfehlungen anzubieten.
Seit ungefähr 2010 beschäftigen sich die Fachöffentlichkeit und die Kostenträger in zunehmendem Maße mit dem Patientenkreis der TSSP in der sozialpsychiatrischen Versorgung, der sich überwiegend selbst gefährdet und in einem Betreuungssetting versorgt wird, das geschlossen und somit geschützt und beschützt zu führen ist bzw. geführt werden kann. Hier geht der Gesetzgeber davon aus, dass eine Unterbringung der zu betreuenden Person auf Antrag der gesetzlichen Betreuerin, die mit Freiheits-entziehung verbunden ist, nur zulässig ist, solange sie zum Wohl der Betreuten erfor-derlich ist, weil nach § 1906 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) „,auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung des Betreu-ten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen
16 Vgl. Masanz, Klaus: Falldarstellung (von Hrn. A.) zur Betreuung eines ehemals forensisch-psychiatrischen Patienten. In: KERBE. Forum für Sozialpsychiatrie. 19. Jg. Nr. 01/2002. Seite: 17-18. Am Bespiel des Ge-meindepsychiatrischen Verbundes in Stuttgart fanden modellhaft für das gesamte Bundesland Baden-Würt-temberg Besuche, Kooperationen von sozialpsychiatrisch Tätigen mit der Forensischen Fachklinik Weissenau statt, die für den Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart zuständig ist. Dabei stellte sich heraus, dass eine große Anzahl an ehemalige Klienten der Sozialpsychiatrie, die plötzlich verschwunden waren, im Maßregelvollzug auftauchte. Im Zuge der Gespräche wurde eine gemeinsam strukturierte und verbindliche forensische Nach-sorgearbeit in der ehemaligen Herkunftsgemeinde in den folgenden Jahren vereinbart. Der Autor, der Mitglied der Kooperationsgruppe war, hat in der Falldarstellung zu Hrn. A. erstmals forensische Nachsorgestandards für die Gemeindepsychiatrie beschrieben. 17 Krisor, Mathias.: Wege zur gewaltfreien Psychiatrie. Das Herner Model. 1992. Psychiatrie Verlag. Bonn
9
Schaden zufügt, oder 2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitli-chen Schadens eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung o-der ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann.“18
Nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (Psych KG) bzw. in Baden-Württemberg, das ehemals im Unterbringungsrecht für Baden-Württemberg verankert war und nach § 1906 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Zwangsunterbringungen gemäß WUNDER (2011) mit der UN-Konvention nur dann vereinbar, „wenn sie final mit der tatsächlichen Selbst- oder Fremdgefährdung begründet sind und nicht kausal mit der Behinderung oder Erkrankung (…) ebenso sind Unterbringungsbegründungen, wie Selbstgefährdung, die nicht anders abgewendet werden kann oder der Verlust der Eigensorge, mit der UN-Konvention vereinbar. Alle anderen Begründungen oder Anlässe stehen nicht im Einklang mit der UN-Konvention!“19
Um der Gruppe der TSSP, die vorwiegend in geschlossenen Einrichtungen betreut und versorgt wird20, nun mehr Kontur und ein Gesicht zu geben, ist es notwendig, sich über die wesentlichen Merkmale, aber auch über die individuellen Spezifikatio-nen, die diese Gruppe charakterisieren, anzunähern.
Im Zuge der Verortung der Thematik und aus der Perspektive der praktischen Arbeit in der Sozialen Arbeit/ Sozialpädagogik ist es auch von Bedeutung, auf das Selbst-verständnis und die Präsentation der sozialpädagogischen Fallarbeit auf der Grund-lage eines sozialpädagogischen Handelns und Verstehens nach MÜLLER (2012) ein-zugehen.
Sozialpädagogisches Handeln, so MÜLLER,21 ist in eine Verwaltung, in eine Büro-kratie eingebunden und impliziert somit selbst einen Charakter von „Verwaltungs-handeln“. In diesem Sinne ist sozialpädagogisches Handeln eher nicht als freie pro-fessionelle Tätigkeit in unbeschränkter oder losgelöster Autonomie zu verstehen und wird so zu einem Fall von der Eingliederungshilfe und akzentuiert in diesem Fallver-ständnis die zu klärenden Sachaspekte. Es gilt diese zu identifizieren und zu benennen und zu bestimmen sowie sie abzuwägen. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn sie in einem Spannungsfeld oder in einem Widerspruch zueinander stehen. Dies ist z.B. dann gegeben, wenn aus Sicht der Eingliederungshilfestelle schon langjährig die
18 Bürgerliches Gesetzbuch § 1906 Abs. 1; hierbei soll auch erwähnt werden, dass ein Gesetzesentwurf aus 2013 die Einführung eines Landesgesetzes zur Hilfe für psychisch kranke Menschen (Psych KHG) in Baden-Württemberg in 2014 auf den Weg gebracht werden soll. 19 Wunder, M (2011): Fürsorgliche Zwangseinweisung. Eine Herausforderung in der diakonischen Praxis. S.5-6. 20 Es ist auch davon auszugehen, dass sich ein Teil der Gruppe der TSSP, die eigentlich von der Gemeinde-psychiatrie versorgt werden sollte, überwiegend in der Wohnungsnotfallhilfe aufhält, die sogenannte „Schlan-gengrube der Gemeindepsychiatrie,“ wie dies Thomas Reker auf einem Fachtag in Bethel zum Thema „Woh-nungslosigkeit und das menschliche Gehirn“ am 29.9.2010 bezeichnete, um sich so, aus der Perspektive der Erfahrenen, erfolgreich dem Gesichtsfeld der Gemeindepsychiatrie und deren Versuche der Annäherung und Kontaktaufnahme zu entziehen. 21 Müller, Burckhart: Sozialpädagogisches Können.7. Aufl. Lambertus Verlag. Freiburg i. B. 2012, S.38-64.
10
Maßnahme Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) finanziert wird und die Zielsetzun-gen der Maßnahme als nicht wirksam genug interpretiert werden, wohingegen der Leistungsanbieter des ABW eine Konsolidierung des gesundheitlichen Status quo, die weitere Vermeidung von Klinikaufenthalten und das Gelingen des Alltags als mi-nimale Zielsetzungen gegenüberstellen. Das ist auch dann gegeben, wenn die Ein-gliederungshilfestelle in einem eigenen Hilfebedarfserhebungsverfahren auf der Grundlage eines eigens entwickelten Hilfeplanes in Konkurrenz zum etablierten Hil-feplanverfahren der Leistungsanbieter geht und unterschiedliche Hilfebedarfe äqui-valent einem unterschiedlichen Betreuungssatz und Geldwert zuordnet, die wiederum aus Sicht des Trägers eine überwiegend nachgehende und aufsuchende Einzelfallhilfe oder die Koordination und Absprachen mit einer Vielzahl an beteiligten Stakeholder unberücksichtigt lassen.
In einer weiteren Dimension von sozialpädagogischem Handeln stehen die Fälle in einem Kontext mit anderen Instanzen (einrichtungsübergreifend) und Professionen (interdisziplinär), sodass die Fallarbeit zu einem Fall für die Polizei, für die Justiz oder für die Verwaltung, für die behandelnden Fachärzte, für die Suchtberatungs-stelle, für das Jugendamt, für die Forensische Fachklinik oder für die gesetzlichen Betreuer wird.
In den sozialpädagogischen Arbeitsfeldern beschäftigte Professionelle sind auf das Handeln, auf die Kompetenz der flankierenden und beteiligten Instanzen und Dienste angewiesen. Damit die Kompetenzen auch abgerufen und wirksam angewendet wer-den können, benötigen nach SPRONDEL (1979) die Sozialpädagogen für Ihre Kli-enten sogenanntes Verweisungswissen22, um nachzuvollziehen, warum ihre Klientel auch gleichzeitig zum Fall für andere Instanzen wird. Sie müssen die Folgen für ihre Klientel kennen, über die Bedingungen und Zugangskriterien fachkundig sein, unter denen die möglichen oder beteiligten Instanzen sich ebenso in der Fallarbeit engagie-ren.
MÜLLER unterscheidet in der sozialpädagogischen Fallarbeit, dass hierbei in den unterschiedlichen Dimensionen mit den unterschiedlichen Perspektiven und Kontex-ten Schwerpunkte gesetzt werden.
Bei der Betrachtungs- und Bearbeitungsweise als Fall für ist es notwendig, die Tä-tigkeit der anderen für den Fall relevanter Instanzen zu erkennen und das Mögliche dafür zu tun, dass diese ihren Part auf eine förderliche und gelingende Weise mitspie-len und entsprechend zusammenwirken. „Sozialpädagogische Fallarbeit unter Sach-aspekten heißt Nutzung anerkannten Expertenwissens auf eine fallangemessene Weise“, so MÜLLER.23 Sie soll sowohl über sozialanwaltliche und behördliche Zu-gänge und Abläufe sowie relevante sozialrechtliche Grundlagen und medizinisches, diagnostisches, pharmakologisches, sozialwissenschaftliches als auch pflegerisches und methodisches Wissen (Interventionen) verfügen, um die Sachlage zu klären.
22 Sprondel, W. M.: Experte und Laie zur Entwicklung von Typenbegriffen in der Wissenssoziologie. In: Sprondel, W. M, Grathoff, R (Hg.) Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften. Stutt-gart 1979. S: 140 ff. 23 vgl. a.a.O. Müller (2012). S.: 50.
11
Sozialpädagogische Fallarbeit soll ganzheitlich und alltagsorientiert für die Klienten sein und zu einem Fall für werden, denn sie hat die Klienten nur selten ganz alleine in der Hand, sondern ist von fremden Zuständigkeiten und Kompetenzen abhängig. Fall für bedeutet Wissen über ein anerkanntes Allgemeines zu nutzen und kompetent auf den Fall anzuwenden. Es wird lokales Wissen erfordert, darüber, welche Dienste es z.B. innerhalb des Gemeindepsychiatrischen Verbundes einer Region gibt. Wie sind die Zugänge, die gesetzlichen Grundlagen und die Finanzierung, auch der Dienste, die in der Wohnungsnotfallhilfe, der Suchtkrankenhilfe oder der medizi-nisch-pflegerischen Hilfe angesiedelt sind. Es geht um juristisches und sozialrechtli-ches Know-how und um das Wissen und die Erfahrung eines sozialadministrativen Vorgehens oder auch darum, welche Leistungsspektren und Module die jeweiligen Dienste anbieten. Es geht darum, sowohl zu wissen, wie, wo und von wem Unterstüt-zung zu holen ist, als auch um das Wissen, das Handeln jener Instanzen fallbezogen kritisch prüfen zu können.
Fall mit steht für eine Fallarbeit, die als Beziehungsarbeit betrachtet wird und die Fingerspitzen- und Taktgefühl, einen respektvollen und humanen Umgang erfordert mit dem anderen, mit dem jeweiligen Klientel. Es ist in der Fallarbeit damit zu rech-nen, dass gerade diese Fähigkeiten hart geprüft werden, wenn sich Menschen in Le-benskrisen, in psychiatrischen oder gar suizidalen Krisen befinden. Geduld, Selbstsi-cherheit, Bodenhaftung und Langmut müssen hierfür professionell kultiviert werden.
Es gilt die Mitarbeit, die Compliance der Klientel zu gewinnen. Es gilt, die Klientel zu motivieren, ihr Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen, für die es sich lohnt, sich oder Teile seines bisherigen Lebens, des bisherigen Lebenswandels und seine Einstellungen und die entsprechende Haltung dazu zu überdenken, auf den Prüfstand zu stellen und zu verändern, um schließlich neue Wege, anderes Verhalten, alterna-tive Bewältigungsstrategien (coping-Muster) auszuprobieren. Zentrale Aufgabe ist es hierbei, die Hindernisse und Barrieren abzubauen, und dabei z.B. materielle Siche-rung, Wohnraumsicherung, eine gesundheitliche Grundversorgung und Schuldenbe-ratung zugänglich zu machen und sicherzustellen, um Vertrauen, Motivation und Raum für Veränderungsbereitschaft zu schaffen.
MÜLLER24 geht bei der multiperspektivisch ausgerichteten sozialpädagogischen Fallarbeit davon aus, dass es eine Grundlage ist, eine soziale Diagnose, in der Dimen-sion ein Fall mit, zu erstellen, um individuelle Lösungswege innerhalb einer be-stimmten sozialpädagogischen Rolle an einem bestimmten Ort und Zeitpunkt zu su-chen. Hierbei tauchen folgende Fragestellungen auf: Was genau ist für welche Beteiligten das Problem? Was ist für mich als Professioneller das Problem? Was be-nötigt aber auch was wollen die Adressaten? Die Professionellen müssen Vertrauen schaffen und einen angemessenen Umgang, sowohl mit den eigenen als auch den Fremdgefühlen entwickeln. Im psychoanalytischen Verständnis gilt es einen selbst-reflektierenden und selbstreferentiellen Blick im Umgang mit Übertragungen und Gegenübertragungen zu finden, die in der Beziehungsarbeit maßgeblich Einfluss neh-men und auf den Beziehungs- und Kontaktprozess einwirken. Sie entstehen in der
24 vgl. a.a.O. Müller, B. (2012), S. 122-137.
12
Einzelfallhilfe, in der sozialen Gruppenarbeit und stellen selbst wichtige Elemente in einem Prozess des Suchens und Findens von Lösungswegen dar.
Darüber hinaus ist auch zu hinterfragen, wer unter den beteiligten Instanzen und Pro-fessionen welche Erwartungen, wer darin welches Mandat hat und was der Inhalt dabei ist? Konkurrieren diese miteinander? Neutralisieren sie sich? Sind die Zielset-zungen realistisch, erreichbar und umsetzbar?
Schließlich ist innerhalb der sozialpädagogischen Diagnose die Frage zu klären, über welche Mittel zur Lösung des Problems verfügt werden kann? Dabei sind auch die daraus möglichen und resultierenden Nebeneffekte der Lösungswege zu prüfen und ob vordringliche Problemlösungen notwendig sind, die vorgeschaltet werden müssen, aber noch nicht mit dem grundsätzlichen Lösungsweg zu tun haben? Im Rahmen der einzelnen Beratungs- und Betreuungsschritte stellt sich die Frage nach den Zustän-digkeiten, welche Schritte und Ziele aus der Helferperspektive heraus geschaffen werden können und welche durch das Einschalten und Initiieren anderer Instanzen und Professionen zu aktivieren sind.
HILDENBRAND hebt hervor, dass das Problem des Einzelnen, aus der Perspektive der Wissenschaft nicht bedeutsam sei. Das Einzelne ist unter das Allgemeine zu sub-sumieren oder aber in eine fallrekonstruktive Forschung, als Ausgangspunkt für die Generierung allgemeiner Erkenntnisse, einzubetten. In der klinischen Soziologie, so der Autor, geht es darum, sich mit Fällen aus der Sozial- und Gesundheitspraxis zu beschäftigen. Hierbei ist es von Bedeutung, weit auszuholen und dabei wichtige Kon-zepte auf einem Kontinuum von Distanz und Nähe zur gesellschaftlichen Praxis an-zuordnen. HILDENBRAND unterscheidet dabei Varianten von Beziehungen sozio-logischer Erkenntnis zur gesellschaftlichen Praxis innerhalb von mehreren Dimen-sionen. Zum einen gibt es den Gesellschaftskritiker, der der Gesellschaft den Spiegel vorhält und die gesellschaftlichen Machtverhältnisse kritisiert, dann die Dimension der Intellektuellen, die mit kritischer Distanz auf den Zeitgeist blicken und gleichzei-tig bemüht sind, den gesellschaftlichen Akteuren nahe zu sein.25 Die Aufgabe der Intellektuellen sei es, seine Diagnose an den politischen Konsens im demokratischen Willensbildungsprozess zu binden und ein Gespür für das politisch Machbare zu ent-wickeln (Honneth 2001:71.)26
In der klinischen Soziologie wird der einzelne Fall familienorientiert und interdiszip-linär betrachtet und der Fall wird auf der Grundlage eines klinischen Verfahrens, auf eine Person in ihrem sozialen Umfeld gerichtet. Der Fall präsentiert konkrete Prob-leme, die unter der Perspektive mehrerer Spezialisten betrachtet werden. Klinische Verfahren haben direkte therapeutische Ziele, hierzu gehört auch die Formulierung und Dokumentation eines Therapieprogramms, eine grundlegende Analyse der Fak-ten, und eine daran abgeleitete Diagnose. In diesem Sinne geht es hierbei nicht nur um die Praxis, sondern auch um eine Kombination aus theoretischen und praktischen
25 Hildenbrand, Bruno: Die Stellung der klinischen Soziologie zwischen Wissenschaft und Lebenspraxis. In: Psychotherapie & Sozialwissenschaft (2009) Heft 2 (11. Jg.), S. 10-24 26 Honneth, Axel: Idiosynkrasie als Erkenntnismittel. Gesellschaftskritik im Zeitalter des normalisierten In-tellektuellen. In: U. J. Wenzel (Hgs.). Der kritische Blick. Über intellektuelle Tätigkeiten und Tugenden. Fi-scher Verlag. Frankfurt a. M. (2002). S.: 61-18.
13
Interessen, wie WIRTH zusammenfasst. Es schließen sich innerhalb des Falls Unter-suchungen zur Überprüfung und Bewertung des Programms sowie der Diagnose an, um schließlich weitere Anstrengungen zu unternehmen, um zu validen Generalisie-rungen der Prinzipien und der Verbesserungen der Techniken zu gelangen (Wirth 1931:51).27
Klinische Soziologie wird im Feld von Professionen tätig, liefert Deutungen und ver-wendet spezifische Methoden. So stellen Professionen einen gesellschaftlichen Ort der Vermittlung von Theorie und Praxis dar. Zum allgemeinen Wissen ergänzt sich das fallverstehende Wissen. Den Zugang zu den individuellen Problemlagen der Kli-enten oder Patienten finden die Professionen insbesondere über eine entsprechende emotionale Rahmung (Empathie), die zu den zentralen Wirkfaktoren von Beratung und Therapie zählt. Profession sind fallorientiert und gemeinwohlorientiert ausge-richtet, da sie es mit Menschen zu tun haben, die in ihrer Autonomie beschädigt sind. Entsprechend folgen sie einer spezifischen Ethik, die die Klienten und Patienten schützt (HILDENBRAND 2005:10-24).
In einem weiteren Artikel setzt sich HILDENBRAND damit auseinander, dass in der Feldforschung eine Praxisform eröffnet wird, bei der sich das grundlegende Soziali-tätsprinzip methodologisch in einem Ungleichgewicht befindet. Denn es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis einer Fallstudie nützlich für die Ver-besserung der Lebenspraxis der Untersuchten sein kann und es bleibe auch offen, ob das Aushändigen des Forschungsberichts an den Beforschten sinnvoll ist, denn er wird mit den verborgenen Sinnstrukturen konfrontiert und mit einem „Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit“, so Blankenburg, provoziert. Die Übersetzung wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse in die Lebenspraxis ist hingegen Auf-gabe dafür ausgebildeter Professioneller. Es müssen adäquate Rahmen für die Ver-mittlung von Untersuchungsergebnissen außerhalb des Interaktionszusammenhangs Forscher/Untersuchte geschaffen werden, deren Kunst darin besteht, als Geburtshel-fer latente den Akteuren verborgene Sinnstrukturen aufzuzeigen und zu verdeutli-chen, was z.B. in der klinischen Soziologie beansprucht wird. Ob der Fall und die Arbeit damit schließlich gelungen sind, kann nur die Profession nicht aber der Unter-suchte entscheiden. 28
Das sozialpädagogische Fallverstehen und Vorgehen erscheint in Kombination mit der von HILDENBRAND beschriebenen klinischen Soziologie im Umgang mit der Klientel der TSSP besonders geeignet und sollte im Hilfe-, Unterstützungs- und Be-handlungsprozess die Grundlage für das methodische Vorgehen darstellen.
1.2. Einführung in den Untersuchungsgegenstand
Während seit Mitte der 90er Jahre ein zunehmender Diskurs mit der Personengruppe der psychisch kranken und wohnungslosen Menschen auf Tagungen und in der Fach-literatur stattfand und diese Gruppe in Studien durch RÖSSLER (1994), FICHTER (1996), NOUVERTNE (1996), REKER (1997), TRABERT (1998), WESSEL
27 Wirth, L : Clinical Sociology. In: Americain Journal of Sociology, 37, S. 49-66. 28 Hildenbrand, B.: Was ist für wen der Fall? Problemlagen bei der Weitergabe von Ergebnissen von Fallstu-dien an die Untersuchten und mögliche Lösungen. In: Psychotherapie & Sozialwissenschaften (1999) 1(4),S.265-280.
14
(2002), ROMAUS & GAUPP (2002), MASANZ (2008)29, ROSENKE (2009) und BÄUML (2010) identifiziert und charakterisiert wurde, wurde der Patientengruppe der jungen, psychisch kranken, suchtkranken und wohnungslosen Menschen inner-halb des sozialpsychiatrischen Versorgungssystems bisher noch wenig Beachtung und Forschungsinteresse geschenkt.
Fokus dieser Arbeit soll eine Auseinandersetzung mit dieser Patientengruppe sein, die auch als „high utilizer“ (LEFEVRE, REIFLER et al 1999, KAPUR & YOUNG et al., 2000, KLUGE, KULKE et al., 2002), als „high users“ (GOLDMAN & TAUBE 1988), „frequent callers“ (HILDEBRANDT, WESTFALL et al 2004), „schwierige Patienten“ (WEIG & CORDING 1998), „Hochkostenfälle“ (SOMMER & BIERSACK 2006, FRICKE & FRICKE 2008) oder „Difficult-to-place-Patients“, „Systemsprenger“ (FREYBERGER et al. 2004), beschrieben wird.
FREYBERGER et al 30 haben erstmals in Deutschland am Beispiel des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern diese Patientengruppe unter der Fragestellung unter-sucht, durch welche Merkmalsgruppen eine Integration in das bestehende psychiatri-sche Versorgungssystem erschwert wird oder gar daran scheitern. Die Studie geht dabei von vier Merkmalsgruppen aus, die sich aus dem 1. Faktor Aggressivität, Un-angepasstheit, Impulsivität und Belästigung, den 2. Faktor Suizidalität, den 3. Faktor Delinquenz und Konsum von Drogen und schließlich dem 4. Faktor Manipulation und Belästigung zusammensetzen.
DUDECK (2004) hat diese Gruppe auch als verloren gegangene, ungute oder unpas-sende Patienten bezeichnet. BORBE hat sie auf einer Fachtagung schlicht „severe mental patients“31 genannt.
Es wird im Übrigen auch in anderen medizinischen Fachgebieten, wie z.B. der Inne-ren Medizin oder der Chirurgie, von “severely or extremely difficult to help patients“ gesprochen, die z.B. in einer Studie in drei Kliniken mit 22 % einen beträchtlichen Anteil ausmachen und sich dadurch auszeichnen, dass sie unzufrieden sind, sich nicht helfen lassen wollen oder häufig wiederkehren. Gerade psychosoziale Probleme wer-den von den Nicht-Psychiatern bei dieser Gruppe als besonders relevant bezeichnet. Die Etikettierung „schwierig“ ist also interpretationsbedürftig. Schwierigkeit, so HAMBRECHT (2010), ist ein Merkmal für die Beziehung und nicht der Akteure, hervorgerufen durch Unterschiede in der Sozialisation, der biogra-phischen Erfahrungen, der Werte und Bedürfnisse. Mit der Etikettierung läuft das psychiatrische Team eher Gefahr, den Zugang zu einem Verständnis dieser Unter-schiedlichkeiten zu definieren. Es ist in aller Deutlichkeit aber auch sinnvoller, das
29 Masanz, K.: Krisenintervention bei wohnungslosen, psychisch kranken Menschen. In: wohnungslos. 50. Jg, 3.Quartal Nr. 3/ 2008. S: 106-110. 30 Freyberger H-J., Ulrich I., Dudeck M., Barnow S., Kleinwort K & Steinhart I.: Woran scheitert die Integra-tion in das psychiatrische Versorgungssystem? In: Sozialpsychiatrische Information, 2, 2004. S:16-21. 31 Fachtagung des Diakonischen Werks Württemberg in Hohenwart bei Pforzheim. 1.-2.10.2013 zum Thema: Umgang mit den Schwierigsten. Vortrag von Borbé, Raoul.
15
konkrete Behandlungsproblem zu benennen, wie z.B. eine hohe Re-Hospitalisie-rungsquote, häufige und ernsthafte Selbstverletzungen oder dissoziales Verhalten, als sich hinter einem inhaltsleeren und stigmatisierenden Begriff zu verstecken.32
Diese Patientengruppe kann a priori auch als „Systemprüfende“ oder spezifischer nach MASANZ (2013) als Trans-Sektorale Systemprüfende33 (TSSP) bezeichnet werden, da sie im Verlauf ihrer Biographie, ihrer Einrichtungs- und Krankheitskarri-ere sowohl mit unterschiedlichen Versorgungssystemen, als auch mit unterschiedli-chen Kostenträgern (Krankenkasse, Sozialamt, Arbeitsverwaltungs-, Rehabilitations- und Rentenstellen) in Kontakt kommen und somit unterschiedliche Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit transinstitutionalisierend durchwandern. Dies geschieht abhängig vom aktuellen Lebensalter, der sozioökonomischen Lebenslage bzw. dem sozioöko-nomischen Status, dem regional verorteten Wohnumfeld, der Intensität des Suchtmit-telkonsums oder der juristisch-ordnungsbehördlichen oder psychosozialen Bewer-tung des aktuellen Grades an Eigen- oder Fremdgefährdung. Dies geschieht auch im Zusammenhang mit der aktuell vorherrschenden Krankheitssymptomatik, die sich in einem unterschiedlichen Maße in ihrer Form und Ausprägung nach außen hin präsen-tiert.
Diese Gruppe der Trans-Sektoralen-Systemprüfenden, die die bestehenden Felder der Sozialen Arbeit, also der Kinder- und Jugendhilfe, der klinischen Psychiatrie bzw. der Allgemein- oder Gemeindepsychiatrie, der Wohnungslosenhilfe, der Suchtkran-kenhilfe oder gar des Straf- oder Maßregelvollzugs in Anspruch nimmt, macht die in ihrer Binnenlogik und in ihren sozialrechtlichen Zugangsvoraussetzungen (oder dem Grad der Nieder- bzw. Hochschwelligkeit) benachbarten und sich abgrenzenden Ver-sorgungssysteme zunehmend auf sich aufmerksam. Das gelingt der Gruppe der TSSP auf eine Weise, dass diese bestenfalls miteinander kooperierenden und untereinander kommunizierenden Versorgungssysteme zum Handeln aufgerufen werden, indem sie sich über die Erreichbarkeit, die Vernetzung, Versorgung und Behandlung grundle-gende Gedanken machen müssen. Es handelt sich hierbei nicht um eine regional be-grenzte Herausforderung, sondern um eine für die gesamte bundesdeutsche Versor-gungslandschaft gestellte Kernaufgabe, die in ihrer Wahrnehmung, in ihrer sozialrechtlichen Bewertung und praktischen Umsetzung stark differenziert. Die ge-wollte Auseinandersetzung innerhalb des z.B. Gemeindepsychiatrischen Verbundes in Stuttgart betrachte ich als modellhaft, denn sie könnte als wegweisende Orientie-rung für andere Regionen wahrgenommen und genutzt werden.
32 Vgl. Hambrecht, M.: Debatte: Pro & Contra: Es gibt keine „schwierige Patienten. In: Psychiatrische Praxis. 2010. Heft 37; S. 56-58 33 Masanz, K., Baur, J. (2013): Vortrag einer Fachtagung des CBP e.V. mit dem Thema -Die geschlossen Unterbringung im Spannungsfeld zwischen dem Recht auf Erkrankung und dem Recht auf Fürsorge-: Praxis eines geschlossenen Wohnheims 15-16.5.2013 in Freiburg i. B. http://www.cbp.caritas.de/aspe_shared/form/download.asp?form_typ=370&ag_id=1123&nr=377297. Down-load am 31.5.2013.
16
1.3. Eine erste Charakterisierung der Gruppe der Trans-Sektoralen-Systemprüfenden
Der Mittelpunkt dieser Arbeit soll die weitgehend unbeachtete und unerforschte Sub-gruppe der „Trans-Sektoralen-Systemprüfenden“ sein, die in den sozial-psychiatri-schen Studien der letzten zehn Jahre nur marginal in den Fokus genommen wurde (vgl. BORBÉ, FLAMMER et al 2009).34
FRICK & FRICK35 (2008) beschreiben die Klientel aus drei Perspektiven heraus:
a. Biomedizinische Perspektive: Symptome stehen in Vordergrund, für Menschen mit schwersten multimorbiden und langanhaltenden Störungen mit rezidivierenden Ver-läufen, die lange und wechselvolle institutionelle Karrieren nach sich gezogen haben. Starke Einschränkungen in der Organisation der Selbstsorge, in der Selbst- und Fremdwahrnehmung, in der Zeitstrukturierung, Beeinträchtigungen in der Impuls-kontrolle, im angstauslösenden und aktiv störenden, manipulierenden Verhalten. b. Publik-Health-Perspektive: Das Hilfesystem steht im Vordergrund: angemessene Hilfe ist bedingt möglich durch mangelnde Ressourcenausstattung, fehlendes ange-messenes therapeutisches Milieu oder auch Eingangsschwellen (Gruppenfähigkeit, Mindestmaß an Motivation). c. Juristische Perspektive: Die Leistungszuständigkeit bei medizinischer Rehabilita-tion nach SGB V oder VI ist oft unklar. Ebenso die Eingliederungshilfe nach SGB XII oder gar nach der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XI bieten in der Betreuung und beim Wohnen große Spielräume. Die Krankenhäuser stehen unter einem immensen Reduzierungsdruck der Verweildauer. Pflegeeinrichtungen legen ihren Schwerpunkt nicht unter Teilhabeaspekten aus. Regelhafte gemeindepsychiatrische Einrichtung entledigen sich gezielt und konzentriert der schwierigen Klientel, so die große Be-fürchtung, sodass dieser Prozess in eine Ghettoisierung der „Letzten, Kränksten und Bedürftigsten“, so DÖRNER36, münden würde. Die Folge wäre, es käme schließlich, so die Befürchtung, zu einer Erodierung der regionalen Versorgungsverpflichtung.
Schon allein die hohe Prävalenzrate von psychischer Störung insbesondere bei der Klientel der jungen wohnungslosen Menschen (FICHTER et al 1999:80ff) oder die Zunahme an Plätzen der geschlossenen Versorgung nach § 1906 BGB innerhalb der Eingliederungshilfe bei der Altersgruppe der 18 bis 34-Jährigen in Stuttgart und Ba-den-Württemberg (MASANZ 2012)37 fordern eine Auseinandersetzung, eine Bestan-daufnahme und Prüfung der Versorgung sowie eine tiefgreifende Charakterisierung dieser Subgruppe. Dies soll auf der Grundlage von biographischen Rekonstruktionen, von erzählten Leben und gelebten Leben in freien biographischen Interviews erfol-gen, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt von familiären, sozialen, materiellen und emotionalen Erschütterungen und biographischen Erosionen gekennzeichnet sind. Es
34 Borbe, R./ Flammer, E./ Borbé, S./ Müller, T.: Sozialpsychiatrische Forschung- und Entwicklung über die letzten 10 Jahre im Spiegel deutschsprachiger Zeitschriften. In: Psychiatrische Praxis. 2009,36, S. 362-367. 35 Frick, U. & Frick, H. (2008): Basisdaten stationärer psychiatrischer Behandlung. Vertiefungsstudie „Heavy User“-Literaturanalyse (Obsan Forschungsprotokoll 5), Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservato-rium.http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/de/index/01/02. Document. 105425.pdf. Download am 25.11.2015 36 Dörner, Klaus: Alles dreht sich um den autonomen Patienten, aber was ist ein guter Arzt? In: Die aus-geblendete Seite der Autonomie. Illhardt, Franz Josef (Hg.). Lit-Verlag. Münster 2008, S. 174 ff. 37 Masanz, K.: Vortrag im Steuerungsgremium des GPV Stuttgart am 18.6.2012 im Rathaus Stuttgart: Charak-teristika der Bewohnergruppe.
17
sind Lebensverläufe, bei denen die Biographen im Laufe der Adoleszenz durch devi-antes Verhalten, z.B. durch Schulverweigerung, tagelang nicht nach Hause kommen und mit den Peers auf der Straße leben, aber auch durch kriminelles Verhalten (Dieb-stahl, Verstoß gegen BtMG) und suchtgefährdetes Verhalten (Konsum von THC, Al-kohol und synthetischen Drogen) auf sich aufmerksam machen. Ein Teil der Sub-gruppe weist anamnestisch strafrechtliche Handlungen auf, die zu Kontakten mit der Jugendgerichts- oder der Bewährungshilfe führten oder gar forensische Vorbehand-lungen auf der gesetzlichen Grundlage von § 63 StGB zur Folge hatten. Die Biogra-phen dieser Gruppe der Trans-Sektoralen-Systemprüfenden kommen entsprechend ihres Alters, dem Schwerpunkt ihres Hilfebedarfs und dem Fokus der Lebenslagen, mit unterschiedlichen Feldern und Professionen der Sozialen Arbeit in Kontakt und durchwandern vom 8. bis 18. Lebensjahr die Kinder- und Jugendhilfe, erhalten kin-der- und jugendpsychotherapeutische Interventionen, haben Kontakte mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit dem Haus des Jugendrechts38, durchwandern die Woh-nungsnotfallhilfe, die Suchtkrankenhilfe, den Strafvollzug, die Allgemein- oder Ge-meindepsychiatrie und andere Rehabilitations- und Eingliederungshilfeeinrichtun-gen.
Es ist eine Gruppe, die häufig psychische, physische oder sexuelle Gewalt erfahren oder indirekt erlebt hat, sie wurde mittel- oder unmittelbar kriegstraumatisiert oder sie war in ihrem Herkunftsland behördlicher oder polizeilicher Willkür und Ausgren-zungen ausgesetzt.39
Ziel dieser Arbeit ist es auch, der Frage nachzugehen, ob bzw. wie die Biographien der Trans-Sektoralen-Systemprüfenden von typischen Prozessen der Ausgrenzung geprägt sind und ob eine Kumulation von belastenden soziobiographischen Merkma-len typischerweise Exklusionsprozesse begünstigt, wobei auch der sozioökonomi-sche Status eine Rolle spielen könnte.40 41
Die besondere Bedeutung der ethnischen und kulturellen Herkunft der Trans-Sekt-oralen-Systemprüfenden erfordert den Einblick in eine weitere Dimension der Aus-einandersetzung, auf die u.a. MACHLEIDT (1997)42 innerhalb einer transkulturellen psychiatrischen Behandlung und Versorgungsarbeit als grundlegende Voraussetzung in der Auswahl der Maßnahmen, der Interventionen und des Kommunikations- und Therapieprozesses hingewiesen hat.
38 Ziel der einstigen Modelleinrichtung, die am 1.4.2003 in Stuttgart gegründet wurde, ist es, bei jungen Men-schen unter 21 Jahren, die eine Straftat begangen haben oder sozial auffällig wurden, Verhaltensänderungen zu bewirken, um langfristig die Jugenddelinquenz zu reduzieren. Ein wichtiger Schritt zu diesem Ziel war die Unterbringung von Polizei, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwaltschaft in einem Gebäude. Die Behörden im Haus des Jugendrechts arbeiten Hand in Hand mit den zuständigen Jugendrichtern in unmittelbarer Nachbar-schaft. 39 Masanz, K. (2012): Vortrag am 27.3.2012 in der Hilfeplankonferenz Stuttgart: „Statistische Charakteristika der Patientengruppe eines geschlossenen Heims der Eingliederungshilfe nach § 53 ff SGB XII in Stuttgart“ 40 Hudson, C.G. (2005): Socioeconomic Status and mental Illness: Tests of social Causation and selection Hypotheses. In: American Journal of Orthopsychiatry. Vol 75 No.1,3.18 41 Peukert, R. (2007): Soziokulturelle Aspekte. Sozioökonomischer Status und psychische Erkrankung. MAPS HS RheinMain-HS Fulda. GP1 42 Machleidt, W. (Hg.) (1997): Psychiatrie im Kulturvergleich. Berlin. Verlag für Wissenschaften und Bil-dung.
18
Ein weiterer Inhalt dieser Arbeit soll sich auf den retrospektiv vermuteten psychiat-rischen Krankheitsbeginn (Wirkfaktoren und Einflussnahme) der Trans-Sektoralen-Systemprüfenden beziehen und dessen Auswirkung auf den schulischen Verlauf, auf das erreichte Ausbildungsniveau und die Entwicklung und den Erwerb von lebens- und alltagspraktischen Fertigkeiten und Kompetenzen berücksichtigen. Während CIOMPI (1979)43 und HÄFNER (2000)44 von einer Prodromalphase mit initialen Krankheitshinweisen von durchschnittlich 3 bis 7 Jahren bis zum Ausbruch einer akuten Psychose mit spezifischen Symptomen nach dem Diagnoseschlüssel des ICD 10 GM45 ausgehen, beschreibt KERNBERG (2005)46 im Kindesalter und der Adoles-zenz unterschiedlich ausgeprägte Persönlichkeitsstörungen vom narzisstischen, anti-sozialen oder emotional instabilen Typ, die sich im Zuge des Erwachsenwerdens ver-stärkt ausbilden und alle Lebensbereiche durchdringen können.
Zu guter Letzt beabsichtigt diese Arbeit, im Sinne der sozialwissenschaftlichen Le-benslaufforschung, dem Interesse an Lebenszyklen bestimmter Personengruppen mit spezifischen sozialen Merkmalen (z.B. Wohnungslos-Sein oder von Wohnungslosig-keit bedroht sein,) aber auch an diagnostizierten Merkmalen von an Schizophrenie-Erkrankt-Sein oder Suchtkrank-Sein nachzugehen. Sie will bekannte, aber auch neue Aspekte der definierten Gruppe weiter identifizieren und beschreiben. Schließlich will sie die generierten Erkenntnisse und Ergebnisse in einen Zusammenhang mit den bestehenden Professionalisierungsansprüchen bringen, im Sinne einer handlungsori-entierten Ableitung, qualifizierte Interventionen und Maßnahmen als Handlungsemp-fehlungen im Sinne von Best-Practices anbieten kann.
Gerade negative Ereignisketten wie z.B. Arbeitslos-Werden, Wohnungslos-Werden oder Drehtürpsychiatrie-Patient-Werden greifen die Identität des Biographen an und nehmen Einfluss auf das persönliche Schicksal der Betroffenen. Der Einfluss kann sich auf die Gestaltung und Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben beziehen, auf die eigene Lebenshaltung und Einstellung gegenüber der Selbstwirk-samkeit des Lebens, auf den Gesundheitszustand, auf den Umgang mit der zur Ver-fügung stehenden Zeit oder auch auf die Strukturierung und Gestaltung des Tages usw. vgl. JAHODA et al (1975).47
Negative Ereignisketten können auf der Grundlage von Beobachtungen in einer ge-schlossenen psychiatrischen Einrichtung Einfluss darauf nehmen, ob und wie es ge-lingt, die eigene Alltags- und Lebenswelt positiv, beeinflussbar und hoffnungsvoll zu interpretieren, Zielsetzungen zu definieren, um somit an den zwischen Leistungser-bringer und Leistungsnehmern kongruenten Rehabilitations- und Behandlungszielen
43 Ciompi, L. (1979):Affektlogik. Klett-Cotta. Stuttgart 44 Häfner H (2000) Das Rätsel der Schizophrenie. Eine Krankheit wird enträtselt. C.H. Beck Verlag. München. 45 ICD-10-GM: International Classifikation of desease, german modifikation 46 Kernberg, O. (2005):Narzissmus, Aggressionen und Selbstzerstörung. Fortschritte in der Diagnose und Be-handlung schwerer Persönlichkeitsstörungen. Klett-Cotta. Stuttgart 47 Jahoda, M.; Lazarsfeld, P. F.; Zeisel, H: Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch. 1.Auflage. Suhrkamp. Frankfurt a. Main und Leipzig 1975.
19
im Sinne von Compliance48 und Adherence49 aktiv mitzuwirken. Mit der Zielsetzung, einen zukunftsorientierten Lebensentwurf und soziale Anpassungsleistungen zu er-werben bzw. das eigene Verhaltensrepertoire von erworbenen, erlernten Verhaltens-mustern zu überprüfen, zu verändern und weiterzuentwickeln.
Im Rahmen einer durchgeführten psychoedukativen Einzelhilfe und Gruppenarbeit50 hebt sich ein in der Tendenz einheitliches Grundgefühl der TSSP ab. Es bestehe bei den Vertreter der Bewohnergruppe der Eindruck, es werde sich um die anderen, z.B. die jüngeren Geschwister mehr gekümmert, man sei sehr allein auf sich gestellt und gewisse Dinge für den Alltag werden einem nicht vermittelt. Als Erklärungsversuch für ihr Verhalten wird häufig angemerkt, man wachse zu sehr alleine gelassen auf, dann betätige man sich in der Folge mit Dingen, die Tabus brechen, wie z.B. die Schule schwänzen, Alkohol trinken, Drogen ausprobieren und (klein)-kriminelle Handlungen ausüben. Die Primärfamilien werden als unzuverlässig erlebt, in ihr herr-schen prägnante, chaotische Zustände. Da kein zuverlässiger und fürsorglicher oder eingeschränkt nur ein chronisch kranker Erwachsener zur Verfügung stehe, der einem richtig beibringe, wie das „im Leben“ so gehe, oder auch Rückhalt und Unterstützung anbiete, vermisse man, so der Tenor der befragten TSSP einheitlich, Normalität, Rou-tine und Alltag, die den Tag und die Woche strukturieren und Grundregeln für das Handeln vorgeben.
Lediglich in Peers verschwinde zumindest phasenweise das Gefühl von Allein-(ge-lassen)-Sein, von Nutzlos- und Wertlos-Sein. Man erlebe häufig ein bestimmendes und wiederkehrendes Gefühl, das ein Desinteresse am eigenen Leben, ein Gefühl von Sinnlosigkeit und Unfähigkeit, „Dinge“, den Alltag zu verstehen und das Richtige zu tun, zum Ausdruck bringt. Das Erleben von Sinnhaftigkeit als zentrales Element der salutogenetischen Theorie hebt das Konzept zur Kohärenz hervor, und stellt eine glo-bale und stabile Grundorientierung dar. Es geht hier um eine Wahrnehmung der in-neren und äußeren Welt, die als strukturiert und nicht chaotisch erlebt und wahrge-nommen wird und die mit den personalen Bewältigungsressourcen von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit begreifbar wird und in der Auf-gaben zu bewältigen sind, wie ERHART (2007)51 ausführt.
48 Definition von Compliance: In der Medizin spricht man von Compliance des Patienten als Oberbegriff für dessen kooperatives Verhalten im Rahmen der Therapie. Der Begriff kann mit „Therapietreue“ wiedergegeben werden. Gute Compliance bedeutet konsequentes Befolgen der ärztlichen Ratschläge. Besonders wichtig ist die Compliance bei chronisch Kranken in Bezug auf die Einnahme von Medikamenten oder die Veränderung des Lebensstils. 49 Definition von Adherence: (engl. für Einhalten, Befolgen), im Deutschen auch Adhärenz, bezeichnet das Ausmaß, in dem das Verhalten einer Person, wie die Medikamenten-Einnahme oder eine Lebensstiländerung, mit den vereinbarten Empfehlungen der Behandler übereinstimmt. Grundlage einer erfolgreichen Therapie ist, dieser Auffassung entsprechend, die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Patienten, sowie die Berücksichtigung von Faktoren, die es dem Patienten erschweren, das Therapieziel zu erreichen. Gute Adhä-renz entspricht konsequentem Befolgen des mit dem Therapeuten/ Behandler vereinbarten Behandlungsplanes. 50 Innerhalb von 24 Monaten, 01/2012-12/2013, durchliefen 6 Gruppen neun Schulungseinheiten, mit einer Größe von 4-6 Teilnehmenden (n=28), die in einem geschlossenen Heim der Eingliederungshilfe betreut und behandelt wurden, ein psychoedukatives Gruppenprogramm nach JENSEN, SARDRE-CHIRAZI. Im Zuge der Lerneinheiten und der Vor, und Nachgespräche sind diese Aufzählungen von typischen Grundgefühlen ent-standen, zusammengetragen und im Forschungstagebuch von Masanz, K. erfasst worden. 51 Erhart, M. (2008): Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey: Risiken und Ressourcen für die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bundesgesundheitsblatt 2007. 50, S.800-809.
20
Auf dieser Grundlage soll in den Erhebungen in den drei Einrichtungen (Kapitel 7) und den biographischen Rekonstruktionen (Kapitel 6) auch ein Augenmerk auf die von BETTGE (2004)52 beschriebenen Schutzfaktoren, Prädikatoren und die indivi-duellen Ressourcen gerichtet werden.
Es ist auch beabsichtigt, Einblicke in das Familienklima, in den familiären Zusam-menhalt, aber auch in die Strukturierung der Familien und den Erziehungsstil bzw. das Erziehungsverhalten der Primärfamilie zu bekommen. (HOFFMANN 1993) cha-rakterisiert die Situation der Bewohnergruppe mit dem gemeinsamen Merkmal, dass sie sozusagen „chronisch jung“ ist und in einer Übergangsphase zwischen kindlicher Abhängigkeit und erwachsener Unabhängigkeit steckt. Dabei handelt es sich in der alltäglichen Betreuungsarbeit tatsächlich um eine konstant begleitende Thematik, die geschützte Räume zur Nachentwicklung und Nachreifung benötigt, in der soziales Miteinander, Konfliktbewältigung, der Erwerb von Alltagskompetenzen geübt und trainiert werden können. Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass gerade in den hoch-strukturierten Settings, z.B. in geschlossenen Einrichtungen oder im Maßregelvoll-zug, die vorwiegend die Gruppe der TSSP versorgen und betreuen, Strukturen von totaler Versorgung vorherrschen, die bereits nach kürzester Zeit zu einer Versandung basaler Fähigkeiten der Selbstsorge führen können. So betrachtet, sind nach SCHULZE STEINMANN (2003)53 die der Klientel zugeschriebenen Chronifizierun-gen auch Artefakte eines Versorgungssystems. Die Kunst der Therapie und Behand-lung ist dann, die im geschützten Behandlungsrahmen erworbenen und erlernten Ver-haltensweisen in eine Alltags- und Lebenswelt außerhalb eines institutionellen Rahmens gelingend und nachhaltig zu transferieren. BARGFREDE (1999)54 be-schreibt in einer Langzeituntersuchung, inwieweit es der sogenannten longstay-Pati-entengruppe einer forensischen Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen gelingt, verän-derte Verhaltensweisen, die sich intramural als tauglich erwiesen haben, in eine extramurale Lebenswirklichkeit zu übertagen und dort fortzuentwickeln. Als Hemm-schuh flexibler psychosozialer Reaktionsmöglichkeiten erweist sich, nach BARGFREDE, gerade die Einwirkungsdauer von institutionellen Wirkfaktoren, durch die Bildung und Formung von sogenannten Unterbringungs-Artefakten, die eine anschließende Nachbetreuung oder forensische Nachsorge erschweren können.
Nicht nur wegen historisch-gesellschaftlicher Strukturentwicklungen55, sondern auch aufgrund der Frage der Hilfegestaltung ist es angezeigt, sich bei der Gruppe der TSSP mit dem Einfluss von Institutionalisierung und dem Prozess des Krank-Werdens ei-nerseits und dem Zusammenhang von Schichtzugehörigkeit andererseits zu beschäf-tigen.
Allen Betroffenen gemeinsam ist jedoch aus biologisch-hirnphysiologischer Sicht eine spezifische früh- bzw. kleinkindliche Prägung durch traumatisierende oder stö-rungsinduzierende Ereignisse und Erfahrungen. Diese prägnanten Erlebnisse wirken
52 Bettge, S.: Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Charakterisierung, Klassifizierung und Operationalisierung. 2004 Berlin. 53 Schulze Steinmann, L.: Junge psychisch kranke-die „new chronics“ der Sozialpsychiatrie? In: Schulze Steinmann et al.; Die Zukunft sozialpsychiatrischer Heime. Bonn 2003. S. 8 ff. 54 vgl. Bargfrede, H.: Enthospitalisierung forensisch-psychiatrischer Langzeitpatienten. 1. Aufl. Psychiatrie Verlag. 1999 Bonn, S. 382. 55 Das ist der Prozess, den Beck als“ Individualisierung in der Risikogesellschaft“ bezeichnet.
21
sich nachhaltig beschädigend auf eine entwicklungspsychologisch normale Entwick-lung des Bindungsverhaltens aus, das wiederum reziprok auf eine gesunde Entwick-lung des Gehirns einwirkt und so ein desorganisiertes Bindungsmuster, (vgl. BRISCH 2013:277ff), zur Folge hat. Diese Form des Bindungsmusters wird durch schwerwiegende Störungen und Komplikationen in der zwischenmenschlichen Inter-aktion und in der Verarbeitung von Informationen und Wahrnehmungen und von Er-lebten bei der Gruppe der TSSP evident.
1.3.1. Exkurs: Entwicklung des Gehirns, Bindung und desorganisierte Bindungsmuster
Der familiäre Hintergrund der Gruppe der TSSP ist durch frühe Kontaktabbrüche, das Fehlen von Bezugspersonen in der Lebens- und Familiengeschichte, durch eine Kindheit und Jugendzeit in unvollständigen und fragmentierten Familien, bei Ver-wandten oder in Heimen charakterisiert. Es fanden häufige Wohnortwechsel und da-mit verbunden, ein Wechsel von Bezugspersonen, Erziehenden, Lehrern oder Freun-den statt. Weiter imponieren im alltäglichen professionellen Kontakt die frühen Erfahrungen mit chronisch somatisch kranken oder suchtmittelabhängigen Erzie-hungsberechtigten, schwer belastende und traumainduzierende Erlebnisse mit psy-chisch kranken Eltern, mit behinderten Geschwistern, ein frühzeitiger Substanzmiss-brauch, riskante, deviante und kriminelle Handlungen bis hin zu frühen Kontakten mit Polizei, Justiz und Jugendamt. Es kam zu frühen prägenden Grunderfahrungen von massiver Überforderung über lange Zeiträume hinweg, die Herkunftsfamilie zu versorgen, zu stabilisieren, oder in der Rolle als Vermittler, Mediator oder Streit-schlichter zu agieren. Die Gruppe der TSSP übernahm im Zuge einer Parentifizierung eine Rolle und Funktion, in der sie sich selbst versorgen oder auf ihre evtl. noch jün-geren Geschwister aufpassen mussten, weil die Mütter bestenfalls stunden- aber ta-gelang abwesend waren. Es kam zu Erfahrungen von Gewalt, zu traumatisierenden Ereignissen, weil die Eltern selbst traumatisiert sind und in einem transgenerativen Sinne ihre eigenen und teils schwer beeinträchtigtes Kontakt- und Bindungsverhalten auf ihre Kinder übertragen.
HÜTHER (2003)56 hat sich mit den Auswirkungen und Folgen traumatischer Erfah-rungen im Kindesalter auf die Entwicklung und Ausgestaltung des Gehirns beschäf-tigt und erklärt diese auf der Grundlage hirnphysiologischer Entwicklungen und Wechselprozesse von neurologischen Verschaltungen und der Bedeutung der Neuro-transmitter und anderen Botenstoffen, die für den Transport und die Verarbeitung von äußeren Einflüssen auf eine Binnenverarbeitung im Bereich Denken, Handeln und Fühlen Einfluss nehmen.
In dem Maße, wie Proliferation57 und Wachstum erlöschen, kommt es zu einem Ver-lust des sich bereits entwickelten Gehirns und der wesentlichen Triebfeder einer Ei-gendynamik. In dem Maß, wie das Gehirn zunehmend Verbindungen zur Außenwelt
56 Hüther, G.: Auswirkungen traumatischer Erfahrungen im Kindesalter auf die Hirnentwicklung. In: Bindung und Trauma. Brisch, K. H. und Hellbrügge, T. (Hg.). 5. Auflage. Klett Cotta, Stuttgart 2015, S. 94-104. 57 Unter Proliferation ist zu verstehen, in welchen Bereichen die Nervenzellen wandern, in welche Richtungen ihre Fortsätze (Dendriten) auswachsen, wie sie sich verzweigen und vernetzen, und mit welchen anderen Ner-venzellen sie synaptische Verschaltungen und funktionelle Netzwerke ausbilden, fortentwickeln und ausdiffe-renzieren.
22
erlangt, werden die bereits etablierten Verschaltungen und Erregungsmuster über die sensorischen Eingänge mehr und mehr von außen beeinflusst. Die durch sensorische Eingänge getriggerten Erregungsmuster führen zu einer Stabilisierung bestimmter neuronaler Verschaltungsmuster, sodass ab diesem Entwicklungsmuster, die Hirnent-wicklung nicht mehr autonom gegenüber sensorischen Input und dem Einfluss von Reizen geschieht, sondern durch die sensorischen Eingänge der Außenwelt bestimmt wird und von ihnen abhängig bleibt.
Die Herausbildung und Stabilisierung neuronaler Verschaltungen wird immer dann nachhaltig beeinflusst, so HÜTHER,
wenn es zu anhaltenden Veränderungen von bisher konstanten physikalischen, nutri-tiven oder metabolischen Variablen während der Entwicklung des Gehirns kommt;
wenn anhaltende Veränderungen eines konstanten sensorischen Inputs auftreten;
wenn bisher entwickelte Vorstellungen, Grundhaltungen und Erwartungen mit den realen Wahrnehmungen nicht vereinbar sind.
Dann führe dies, sagt HÜTHER, zu einer Störung bereits etablierter Regelkreise und neurologischer Verschaltungsmuster, die ihrerseits eine Sequenz von gegenregulato-rischen Mechanismen im Gehirn auslösen. Bei dieser Reaktion innerhalb des Gehirns werden bestimmte Neurotransmitter und Neuromodulatoren, wie z.B. Serotonin oder Katecholamin, aktiviert. Immer dann, wenn es zu wiederholten oder permanenten Störungen bereits etablierter Regelkreise und Verschaltungen kommt, die zur wieder-holten oder langanhaltenden Aktivierung einer Stressreaktion führen, wirken die dadurch ausgelösten Veränderungen als Trigger für die adaptive Möglichkeit oder Reorganisation der bereits etablierten Regelkreise neuronaler Verschaltungen.
Die Stressaktivierungen werden so zu einem Instrument im Dienste der Optimierung zentralnervöser Verarbeitungsmechanismen an die jeweils vorgefundenen Bedingun-gen. (vgl. HÜTHER 1996)58
Wiederholt auftretende, kontrollierbare psychosoziale Belastungen bzw. Herausfor-derungen können somit zu einer Stabilisierung, Faszilitation und verbesserten Effizi-enz der in die Antwort involvierten neuronaler Netzwerke und Verbindungen führen. Wenn also eine Belastung auftritt, so HÜTHER weiter, für die eine Person keine Lö-sungsmöglichkeiten sieht oder auf keine Bewältigungsstrategien durch das eigene Handeln zurückgreifen kann, kommt es zu unkontrollierbaren Stressreaktionen. Ein hoher Spiegel an Glucokortikoiden ist die Folge und fördert die Löschung von erlern-ten Verhaltensweisen und führt gleichzeitig zur Elimination von Verhaltensmustern, die für eine erfolgreiche Beendigung des Stressreaktionsprozesses ungeeignet sind.
Die Aneignung neuer Bewertungs- und Bewältigungsstrategien sowie grundsätzliche Veränderungen im Denken, Fühlen und Handeln werden durch die vorangehende De-stabilisierung und Auslöschung unbrauchbar gewordener Muster erst ermöglicht.
58 Hüther G: The Central Adaption Syndrom. Psychsocial Stress as a Trigger for adaptice Modifications of Brain Structure and Brain Function Progress. In: Neurobiology.1996, S. 569-612.
23
Dies gilt insbesondere für prägnante Lebensübergänge, wie z. B. der Verlauf der Pu-bertät, die Ablösung vom Elternhaus, berufliche Qualifikation, die allesamt zu psy-chosozialen Neuorientierungen zwingen, und deshalb besonders häufig mit langan-haltenden unkontrollierbaren Herausforderungen einhergehen. Beide Arten von Stressreaktionen, die kontrollierbaren Herausforderungen wie auch die unkontrollier-baren Belastungen, tragen jeweils spezifisch zur Strukturierung und Selbstorganisa-tion neuronaler Verschaltungsmuster des Gehirns bei. Herausforderungen stimulieren eine Spezialisierung, verbessern die Effizienz bestehender Verschaltungen und füh-ren entwicklungspsychologisch betrachtet zu einer Weiterentwicklung, schließlich zu einer Ausprägung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale. Schwere unkontrollierbare Belastungen ermöglichen durch die Destabilisierungen bereits entwickelter aber un-brauchbar gewordener neuronaler Verschaltungen eine Neuorientierung und Reorga-nisation von bisherigen Verhaltensmustern. Ein Reorganisationsprozess ist mit Risi-ken verbunden, unter Umständen bestimmte Fähigkeiten im Denken, Fühlen und Handeln zu verlernen oder im Verlauf des Prozesses zu entgleisen.
Je früher entweder de- oder stabilisierende Erfahrungen im Verlauf der Individual-entwicklung strukturell im Gehirn sich verankert werden, desto tiefgreifender und nachhaltiger bestimmen sie weiterhin die Nutzung, aber auch Ausformung der etab-lierten neuronalen Verschaltungen und auch die in der Vorstellungswelt des Men-schen verankerten Erfahrungen und die von ihm festgelegten Erwartungen.
Die zentralen Bedeutungen und grundlegenden Erfahrungen in der frühkindlichen Entwicklung sind es, im Umfeld Schutz und Geborgenheit zu finden. Zu den zweiten wichtigen Erfahrungen zählt, dass der Mensch durch eigenes Handeln in der Lage ist, Bedrohungen oder Störungen seines inneren Gleichgewichts gleichzeitig unter Kon-trolle zu bringen. Wenn dies gelingt und diese beiden Grunderfahrungen im kindli-chen Gehirn fest verankert werden, kann ein optimales Gleichgewicht zwischen Bündnisfähigkeit und Selbstvertrauen entwickelt werden.
Wenn Erfahrungen überwiegen, dass das Eingebundensein in eine soziale Gemein-schaft wichtiger erscheint als die Fähigkeit, Probleme selbstständig zu lösen, bleiben Kinder mit diesem Erfahrungshintergrund, im weiteren Verlauf von anderen Men-schen abhängig und es kommt zu einer mangenden Autonomie und psychischen In-stabilität, wie in der Falldarstellung 4 (Hr. Noller) gezeigt wird.
HILDENBRAND (1991) sieht in der Entwicklung einer schizophrenen Erkrankung einen Zusammenhang zwischen geschlossenen, nach außen hin sich abriegelnden Fa-miliensystemen und einem gelingenden Ablösungs-prozess eines jungen Erwachse-nen aus dem Elternhaus, wie das in der der Falldarstellung 4 exemplarisch vertreten wird.
In einem anderen Fall gestalten sich Bindungen mit anderen Menschen schwach aus. Dafür ist das Selbstwertgefühl stark entwickelt und die Bedeutung der eigenen Kom-petenz wird sehr hoch bewertet. Hier liegt eine Grunderfahrung vor, nach der Ent-scheidungen in erster Linie für das individuelle Wohlergehen zu nutzen sind. Diese Pseudoautonomie, narzisstische Selbstbezogenheit und Ich-Zentrierung wird in der Falldarstellung 1 (Hr. Grün) beschrieben.
24
Schwer seelisch traumainduzierte Belastungen, die nicht allmählich, sondern für Kin-der oder auch Erwachsene unerwartet eintreten, sind nach HÜTHER (2003) sehr ge-fährlich, da es möglich ist, die mit den unkontrollierbaren Stressreaktionen einherge-hende Destabilisierung für eine Reorganisation zu nutzen, unmöglich ist. Diese Bedingungen können irreversible Schäden verursachen, z.B. eine Degeneration von Dendriten oder sogar von ganzen Nervenzellen, vor allem im Hippocampus, der für das Zusammenfließen unterschiedlicher Informationen und verschiedener sensori-scher Systeme zuständig ist, die verarbeitet und von dort zum Cortex zurückgesandt werden. Damit ist er enorm wichtig für die Gedächtniskonsolidierung, also die Über-führung von Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis.
Dies könnte lebensbedrohliche Ausmaße für die Person haben, denn sie geht davon aus, dass um Stress und Belastungen unter Kontrolle zu halten, sie sich auch nicht auf psychosoziale Unterstützung verlassen kann. Der Glaube an familiäre psychosoziale Geborgenheit geht verloren, sowie der Glaube und die Überzeugung an ihre Fähig-keiten, Bedrohungen abzuwenden. Es bleibt für die Person die einzige Strategie, näm-lich die Abkopplung der traumatisierten Erfahrungen aus dem Erinnerungsschatz durch eine gezielt veränderte Wahrnehmung, durch assoziative Verarbeitung von Phänomenen der Außenwelt. Dies kann bei manchen zu bizarr anmutenden und aber auch selbstgefährdenden Bewältigungsstrategien bis hin zur Entwicklung ausgepräg-ter Zwangsgedanken und Handlungen führen, um die Erinnerungen mit hohem Ener-gieaufwand und Anstrengungen zu unterdrücken, wie das in der Falldarstellung 3 (Fr. Satic) vorgestellt wird. Traumatisierte Kinder und Jugendliche, so HÜTHER weiter, geraten oft schnell ins soziale Abseits. Sie werden als persönlichkeitsgestört oder an-tisozial attribuiert und diagnostiziert, wie das bei den Falldarstellungen 1, 3 und 4 beschrieben wird.
Die Kinder entwickeln sich zwangsläufig anders im Vergleich zu nicht traumatisier-ten Kindern. Spezifische Merkmale und Eigenschaften sind z.B. Beeinträchtigungen der geistig-emotionalen, aber auch motorischen und körperlichen Entwicklung, Stö-rungen des Sozialverhaltens, aggressive destruktive Handlungen (gegen sich und an-dere gerichtet), Störungen der Affektregulation, Zustände von Betäubung und Über-erregung, häufig kombiniert mit impulsivem und riskantem Verhalten. Sie sind in ihrer Selbstwahrnehmung und in der Wahrnehmung von anderen gestört, sie haben Schwierigkeiten, zwischen sich und anderen Grenzen zu ziehen und auch aufrecht-zuerhalten. Häufig entwickeln sich auch Bewusstseinsveränderungen, Amnesien, Hypermnesien, dissoziative Bewusstseinszustände, Depersonalisations- und Dereali-sationsphänomene, Flashbacks und Alpträume. Typisch sind auch ein korruptes Wer-tesystem, brüchige Normen, an denen man sich orientiert, oder gar eine generell feh-lende Orientierung, sowie schwere Lern-, Aufmerksamkeits- und Kontaktstörungen.
„In der bisherigen Sozialpsychiatrischen Entwicklung wurde sowohl auf die theore-tische Bedeutung als auch auf die praktische Auswirkung des Begriffes Bindung mit einer geringen Resonanz und Aufmerksamkeit reagiert. Bindung und Bindungserfah-rungen sowie deren prägende und nachhaltige Einflüsse auf die Lebensgestaltung, auf die Entstehungsgeschichte und die Krankheitsdynamik stellen bisher marginale Einflussfaktoren innerhalb eines sozialmedizinischen Selbstverständnisses dar, das vorwiegend von sozioökonomischen Einflussgrößen determiniert ist. In erster Linie
25
assoziiert Sozialpsychiatrie mit dem Begriff der Bindung vorrangig Lebensphasen des Klienten, entwicklungspsychologischen Episoden, die mit spezifischen Fragestel-lungen und Anforderungen im Anschluss an weitere Übergänge und Entwicklungs-phasen ausgestattet sind. Die vorherrschende Atmosphäre und die prägende Kom-munikation innerhalb des Binnensystems Familie seien aus Sicht der Sozialpsychiatrie ebenso signifikante Variablen wie auch kritische und einschnei-dende Lebensereignisse auf die gesundheitliche Entwicklung eines Menschen“, so BRISCH (2013):249.59
Die entwicklungspsychologische Forschung der Bindungstheorie liefert den Nach-weis, so BRISCH60, dass ein Säugling in den ersten Lebensjahren eine spezifische emotionelle Bindung an eine oder mehrere Bindungspersonen, die allesamt Sicher-heit bilden, entwickelt. Wenn dem Säugling eine solche sichere Bindung zur Verfü-gung steht, weiß er sich in seinem Leben geschützt, sicher, er entwickelt Urvertrauen und ihm ist gewiss, dass er mit Hilfe der Bindungsperson überleben wird.
Die Bindung, vorzugsweise durch ein Netzwerk von unterschiedlichen Bindungsper-sonen ausgestaltet, bietet einen sicheren emotionalen Hafen an61, so GROSSMANN & GROSSMANN, von dem aus ein durch Neugierde und positive Bestärkung ange-regtes Explorationsverhalten entwickelt werden kann.
Je sicherer die Bindung zu den Bezugspersonen, desto sicherer ist die Basis, von der aus das Kind seine Umwelt erkundet, wahrnimmt, ausprobiert und exploriert, desto größer ist der Radius der Erkundung usw.
Die Exploration bezieht sich nicht nur auf eine sozialräumliche bzw. geographische Dimension, sondern auch auf eine Exploration und Erkundung sowohl der eigenen Gefühle als auch der Körperwahrnehmung. Bis zum Kindergartenalter erwirbt typi-scherweise das Kind die Fähigkeit, aufgrund einer sicheren Bindungsentwicklung, sich die Perspektive oder in die Gefühle von anderen hineinzuversetzen und dabei zu erkennen, dass seine Gefühle, Gedanken und Handlungsabsichten von denen anderer Menschen vollständig differenzieren (können). Um mit Menschen in einem Sinne von Nähe und Intimität in Kontakt zu kommen und in Beziehung zu treten, stellt die mögliche Wahrnehmung von Gefühlen, Gedanken und Handlungsabsichten anderer, so BRISCH, eine Grundvoraussetzung für die menschliche Beziehungsentwicklung und -Fähigkeit dar.
Ganz entgegen dem körperorientierten Umgang in traditionellen Kulturen, wachsen im heutigen Trend, Säuglinge mit weniger Körperkontakt bzw. körperlicher Nähe auf. Da jedoch gerade das Bindungsbedürfnis durch Angst und Trennung aktiviert wird und durch körperliche Nähe und Körperkontakt zur Bindungsperson beruhigt wird, stellt diese gegenläufige Entwicklung ein zeitgenössisches Dilemma dar.62
59 Brisch, K. H. :Bindung und Trauma. In: Jugendhilfe 51, S. 249 60 Brisch, K.H. (Hg.): Bindung und Sucht. Klett-Cotta Verlag. 2013 Stuttgart. S. 277-296. 61 Grossmann K.; Grossmann K.K. (2012): Bindungen. Das Gefüge psychischer Sicherheit. 5. Aufl. Klett-Cotta. Stuttgart. S. 277. 62 vgl. Bowlby J.: Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendungen der Bindungstheorie. Reinhardt Verlag, 2008 München u.a.
26
Um starke Affekte regulieren zu können, lernt ein Säugling, wie er durch eine gelin-gende Koregulation seiner Bindungsperson starke Affekte wie z.B. Angst, Wut, Trau-rigkeit oder Furcht erlebt und darin unmittelbar beruhigt und auf ein mittlere, erträg-liches und aushaltbares Maß an Stressniveau zurückbegleitet wird. „Dazu muss die Bindungsperson den vom Säugling ausgedrückten, nicht mehr steuerbaren Affekt selbst wahrnehmen, zunächst richtig dekodieren und innerlich aushalten, somit auch bei sich selbst regulieren“.63
Gelingt es nun dem Säugling, seinen in abgeebbter Form nicht mehr regulierbaren Affekt in kleinen Dosierungen und in abgeschwächter Form zurückzuspiegeln, kann er den Affekt im Beisein der Bindungsperson aushalten, von dem er jedoch alleine überfordert und vollkommen überwältigt wäre. Im selben Maße wie die positiven und gelingenden Erfahrungen einer wirksamen Koregulation wächst die Kompetenz zur Selbstregulation von sowohl starken Affekten als auch in Stressreaktionen.64
Kommt es aber dazu, dass die Bindungsperson nicht zur Verfügung steht, nicht an-wesend ist oder die Stresssignale des Säuglings nicht wahrnimmt, weil sie z. B. selbst suchtkrank oder psychisch erkrankt ist oder das Kleinkind aus Überforderung ver-nachlässigt, bleibt der Säugling in einem Zustand von Übererregung. Da er weder weglaufen kann noch in der Lage ist, Hilfe zu holen, gerät er wegen der Erregung des Sympathikus, als Teil des autonomen Nervensystems, in einen Zustand der Dissozi-ation, in dem er quasi seine Wahrnehmung „abschaltet“. Sowohl die Motorik als auch die Affekte werden eingefroren, der Säugling begibt sich in eine Schockstarre, in der er keine Gefühle, keine körperlichen Schmerzen und auch keine Körpersignale oder Affekte wahrnimmt. Evolutionsbiologisch betrachtet, handelt es sich hier um einen Überlebensmechanismus, der bei allen Altersstufen wirksam ist.
Ganz im Gegenteil zum erregten Sympathikus kann es auch einen parasympathischen Erregungszustand zur Folge haben. Dissoziiert der Säugling oder das Kleinkind in dieser Erregungssituation, tritt ein Erschlaffungszustand ein, weil der Puls und Blut-druck absinken, die Gefäße sich weiten und so der Säugling bzw. das Kleinkind in einen Zustand des Weggetreten-Seins gerät. Da er Parasympathikus für Funktion des Magen-Darm-Trakts zuständig ist, führt es in dieser Situation zum Wasserlassen, Einkoten, Erbrechen oder Schluckauf.
Nun kann es zu prägenden Schlüsselerfahrungen beim Säugling oder dem Kleinkind kommen, indem es in Stresssituation oder bei starken Affekten keine unmittelbare und wirksame Koregulation erlebt und erfährt, sondern sich quasi ersatzweise diese Koregulation durch ein Suchtmittel, das dann das „Bindungspersonen-Surrogat“65
63 Vgl. a.a.O. Brisch, S. 278. 64 Anmerkungen: In den flankierenden Gesprächen mit den Angehörigen der interviewten Biographen der Gruppe der TSSP fällt auf, dass gerade über die ersten Lebensjahre, bzw. ab dem einschlägigen, traumaindu-zierenden Ereignis (z. B. plötzlicher Tod des Vaters im Bürgerkrieg, massive Vernachlässigung oder Gewalt-erfahrungen in der Familie, Inobhutnahme, Aufnahme in Kinderheim usw.), von Auffälligkeiten im Sozialver-halten, im Kontakt, beim Spielen mit anderen, im Umgang mit Frust, Enttäuschungen und Wut und deutlichen Veränderungen auf der Beziehungsebene berichtet wurde. Es kam zu mehreren Wechseln des Kindergartens oder der Grundschule; es wurde von frühen heilpädagogischen oder sozialpädiatrischen Konzilen und Diag-nostiken berichtet. Dies scheint Hinweise dafür zu liefen, dass es sich hierbei um typische Merkmale für die Gruppe der TSSP handeln könnte. 65 a.a.O. Brisch S.: 278-296.
27
darstellt, ersetzt. Die Suchtmittel können als heranwachsender oder erwachsener Mensch z.B. Essen, Alkohol, Drogen oder neurotoxische Stoffe wie Kleber sein, die allesamt neurobiologisch auf das autonome Nervensystem (ANS) einwirken und beim Parasympathikus und Sympathikus zu einer Verringerung der Stressregulierung führen. Beim Säugling kommt es zum Lernprozess, dass er, zu einem späteren Zeit-punkt66, durch den Einsatz eines Suchtmittels rasch zur Beruhigung kommt, wenn keine Bindungsperson zur Koregulation zur Verfügung steht. Somit ersetzt das Sucht-mittel die fehlende Interaktion mit einer Bindungsperson.
Die Beruhigung beim Säugling, so BRISCH (2013), erfolgt häufig durch Nahrungs-aufnahme, statt den Säugling z.B. wegen Angstreduktion zu beruhigen, ihn körperlich zu beruhigen, zu streicheln und mit sanften Worten zu trösten. Besonders in stress-vollen Situationen, in denen das Bindungssystem von Menschen massiv aktiviert wird, können Suchtverhaltensweisen mit einer selbstbehandelnden Wirkungsabsicht starten:
- nach schmerzhaften Trennungserfahrungen;
- nach dem man in der Beziehung vom anderen verlassen wurde;
- in Situationen großer Einsamkeit;
- in Angstsituationen;
- nach traumatisierenden Erfahrungen;
- wenn Beziehungserfahrungen chronisch stressvoll sind;
- in dauerhaften Überforderungssituationen, wenn sich z.B. jemand allein gelassen, hilflos, vom Tod bedroht fühlt oder bei extrem intensiv erlebten Affekten, bei denen keine Affektsteuerung mehr möglich ist, sodass die Affekte überborden und den Be-troffene in Alltagshandlungen und Situationen soweit einschränken, sogar lähmen, dass ein normales Leben nicht mehr möglich ist.
Beim Absetzen des Suchtmittels entsteht bekanntermaßen, neben einem psychischen Entzug, ein körperlicher Entzug, der Symptome wiedergibt wie bei dem Verlust einer Bindungsperson. Physische Schmerzen, Gefühle von Angst und Panik, Hilflosigkeit, Ohnmacht und Todesbedrohung können hierbei ebenso auftauchen. Eine bindungs-orientierte Psychotherapie67 kann eine angemessene Hilfe sein, die auf eine themati-sche Berücksichtigung der Trias aus Trauma, Bindung und Sucht eingeht und mit
66 Bei der Gruppe der TSSP ist auffällig, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt, erste Erfahrungen mit Rauchen von Nikotin und Cannabis, Alkohol und synthetischen Drogen berichtet werden. Der erste Rausch, die erste „Kippe“ im Schulhof, der erste Joint bei Freunden hat bei dieser Gruppe zu einem sehr frühen Zeitpunkt (ab dem 8. Lebensjahr) stattgefunden. 67 Nach den AWMF Leitlinien bzw. den S2 und S3 Leitleine der DGSS (Deutschen Gesellschaft für Sucht-forschung und Suchttherapie) werden als weitere evidenzbasierte, wirksame und standardisierte Therapien: motivierende Gesprächspsychotherapie, verhaltensorientierte-kognitive Therapie, soziales Kompetenztrai-ning, Expositionsbehandlung, Verhaltensverträge und Kontingenzmanagement, psychodynamische Therapie, Paar- und Familientherapie, psychoedukative Gruppenprogramme, wie z.B. das PEGPAK Nachsorge-Pro-gramm nach Wessel, T. und Westermann H. empfohlen.
28
unterschiedlichen Akzentuierung auf die Bereiche Bindungsprozesse, traumatische Erfahrungen, das individuelle
Suchtverhalten und die psychosoziale Problemlage im gleichen Maße in den Fokus der Behandlung integriert.
Der stärkste Prädiktor für eine desorganisierte Bindung ist Kindesmisshandlung (siehe Falldarstellungen 2, 3 und 4) (vgl. LYONS-RUTH & BLOCK 1996)68. Der zweitstärkste Prädikator mit einem Effekt auf die Entwicklung einer desorganisierten Bindung des Kindes besteht in erlebten Traumata der Eltern, wie in der Falldarstel-lung 1 berichtet, in der die Elterngeneration Berufsverbot, Haft und Folter als politi-scher Häftlinge erlebt haben oder in Falldarstellung 2, in der vom Suizid des heroin-süchtigen Mannes in der gemeinsamen Wohnung und von der jahrelange Stigmatisierung als ethnische Randgruppe erzählt wird oder in Falldarstellung 3, in der massive Gewalterfahrungen im Bürgerkrieg, der Verlust der Heimat oder der ge-fallene Ehemann als Prägungen bekannt werden.
So ist nach BRISCH (2011) und BESSER (2006) bekannt, dass Traumatisierungen und damit einhergehendes, dissoziativ-ängstigendes Verhalten der Erziehungsperso-nen die Entwicklung einer desorganisierten Bindung beim Kind stärker beeinflussen als eine Scheidung der Eltern oder eine depressive Erkrankung bei einem Elternteil.
Es wurde eine Vielfalt an Erkenntnissen und Zusammenhängen in den Studien von GROSSMANN (1997), SPANGLER u. ZIMMERMANN (1995)69 und BRISCH (1995 und 2002) erfasst und beschrieben, die für eine gesunde und sichere Bindungs-entwicklung eines Kindes eine maßgebliche Rolle spielen.
Daraus können folgende Ergebnisse zusammengetragen werden:
- Eine sichere innere Bindungsrepräsentation der Eltern ist durch eine stabile und eine von gegenseitiger Wertschätzung und Empathie gekennzeichnete Partnerschaft zu gestalten, die auf längere Zeit hin ausgerichtet und für beide Seiten befriedigend ist.
- Im Rahmen dieser optimalen Konstellation, in der sich die Elternteile auf eine fein-fühlige Interaktion mit dem Säugling und seinem Verhalten einlassen, seine Signale erkennen, richtig und angemessen darauf reagieren, ohne Über- oder Unterstimula-tion, dabei ein entwicklungsförderndes Zeitfenster berücksichtigen, das weder zu übergroßer Frustration noch zu übermäßiger altersangemesssener Verwöhnung führt. Feinfühligkeit, so GROSSMANN (1999)70, kommt hierbei insbesondere in der Spra-che zum Ausdruck.
68 Layons-Ruth, K. Block. D. (1996): The disturbed Caregiving System. Relations among Childhood Trauma, maternal Caregiving and infant Affect and Attachment. Infant Mental Health Journal, 17, (3), 257-275. 69 Spangler, G. Zimmermann, P. (Hg.) (1995): Die Bindungstheorie. Grundlagenforschung und Anwendung. Stuttgart. Klett-Cotta. S. 170ff 70 vgl. Grossmann 1999:171-192
29
In diesem Rahmen kann ein Kind eine sichere emotionale Bindung an seine Eltern entwickeln, die als Schutzfaktor innerhalb seiner Entwicklung dient und es bei emo-tionalen Belastungen durch angstauslösende Ereignisse und Momente „widerstands-fähig“ machen wird.
Bei Aktivierung der Bindungssysteme, dies geschieht z.B. durch Trennung, Angst und Gefahr, sucht das Kind üblicherweise die Eltern auf, will körperliche Nähe her-stellen. Auf diese Weise wird seine emotionale Erregung wieder beruhigt (vgl. AINSWORTH und WITTING 1969) Auf dieser Grundlage kann sich sichere Bin-dung entwickeln, die eine Voraussetzung für ein mit Neugierde geleitetes Explorati-onsverhalten gegenüber der Umwelt darstellt, nämlich neue Personen interessiert und freundlich zu untersuchen, den Kontakt herzustellen, schließlich neue Beziehungen zu knüpfen, die wiederum die innere Entwicklung des Kindes fördert. (GROSSMANN 1999).
Wenn Eltern in ihrer Bindungshaltung unsicher-vermeidend oder unsicher-ambiva-lent sind, ist ihre Partnerschaft spannungsreicher aufgeladen, weil eine Vermittlung von Distanz- und Nähewünschen schwieriger ist. So wird durch die Geburt diese At-mosphäre weiter potenziert, weil der Säugling gerade Nähe und Versorgung einfor-dert. Werden diese Wünsche jedoch zurückgewiesen, unvorhersehbar oder wider-sprüchlich beantwortet, so entwickelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit, so STEELE et al. (1996)71 eine unsicher-vermeidende oder unsicher-ambivalente Bindungsquali-tät heraus, die durch ein distanziertes oder ambivalentes Verhalten geprägt ist. Dieses unsichere Bindungsmuster stellt einen Risikofaktor in belastenden Situationen dar, weil die Bewältigungsstrategien eingeschränkt sind, da solche Kinder nur zögerlich Hilfe einholen und annehmen (wie in den Falldarstellungen 1 und 4) oder andere Personen in hohen Ambivalenz in einen Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt verstri-cken, wie das beispielhaft in der Falldarstellung von Fr. Brandt 2 und Fr. Satic 3 gegeben ist.
Unverarbeitete traumatische Erfahrungen der Eltern spiegeln sich in kohärenten Sprachstilen, Gedankenabbrüchen, Absencen, tranceartigen, assoziativen Zustände wider, wenn „Erwachsen-Bindungs-Interviews“ geführt werden. (vgl. GEORGE et al. (1985)72 Diese charakteristischen Merkmale wurden auch in den freien biographi-schen Interviews in den Falldarstellungen 2, 3 und teilweise auch in der 4. evident und in den jeweiligen Kapiteln zum „Erzählten Leben“ in Variationen beschrieben.
Sobald unverarbeitete Erfahrungen von Trennung, Verlusten, Gewalterfahrungen, Unfällen zum Thema werden, die von zwischen menschlichen Erlebnissen oder na-türlichen Katastrophen herrühren können, kommt es dazu, dass die Interviewten ihren Sprachfluss für mehrere Sekunden unterbrechen, pausieren oder den Blickkontakt vermeiden. Sie zeigen in den weiteren Sätzen Gedankenabbrüche, unlogische Kom-binationen und es kommt zu Verwechslungen von Raum, Zeit und Personen (vgl. MAIN 1991).
71 Steele, H. Steele, M. Fonagy, I. (1996): Infants Sensitivity to Manipulations of material Touch during face to face Interactions. Social Development. (5). 41-55. 72 George, C., N. Kaplan (1985); The Attachment interview for Adults. Berkely, University of California (unveröffentlichtes Manuskript)
30
Wenn die Bindungsperson selbst durch ihre Bedrohung die Bindungssicherheit des Kindes zerstört, bleibt ein irritierbares, desorganisierte Bindungsarbeitsmodell zu-rück, sodass sich das Kind auf keinen Fall auf ein sicheres Bindungsgefühl verlassen kann, wie auch in den Falldarstellungen 2, 3 und 4 exemplarisch der Fall ist. In der Falldarstellung 1 gibt es dafür Hinweise.
Oftmals waren Eltern, die ihre Kinder misshandeln (wie in der Falldarstellung 2 be-richtet), selbst in ihrer Kindheit Opfer von Gewalterfahrungen in der Beziehung mit ihren Eltern oder Elternteilen. Die Eltern, die diese Erfahrungen erlebt haben, müssen in einem hohen Maß aufpassen, dass ihre traumatisierten Bindungserfahrungen nicht aktiviert werden. Durch Vermeidung entsprechender Themen, Aktivitäten und Per-sonen versuchen sie diese Erfahrungen mit den Gefühlen von Ohnmacht, Angst und Desorientierung zu vermeiden (BRISCH 2002:108). Wenn diese Eltern Kinder be-kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, ein desorganisiertes Bindungsmuster zu entwi-ckeln, sehr hoch.
SCHUENGEL (1999) hat den Nachweis über den Mechanismus der Weitergabe von elterlichen Traumaerfahrungen auf die Kindergeneration untersucht und herausge-funden, dass traumatisierte Eltern sich eher aggressiv-feindlich verhalten, ihren Kin-dern Angst machen oder durch ihre Kinder geängstigt werden. Manche geraten sogar in Ohnmacht und in Zustände von Hilflosigkeit, wenn sie mit Kindern spielen und sie pflegen.
In diesen Konstellationen macht der Säugling in der Beziehung zu seiner Bindungs-person keine konstanten und verlässlichen Erfahrungen von emotionaler Sicherheit, gerade weil die Eltern selbst mit einem ängstigenden, ängstlichen oder hilflosen Ver-halten dem Säugling kein Gefühl von einem sicheren emotionalen Hafen vermitteln können. Die Interaktion wird zu einer unvorhersehbaren Quelle der Angst und der eher potentiellen Sicherheit. Allerdings weiß es nie genau, worauf er sich verlassen soll (HESSE und MAIN 1999).
Hieraus, so BRISCH (2013), entwickelt sich vermutlich ein desorganisiertes multip-les inneres Arbeitsmodell von Bindung beim Säugling. Er zeigt in bindungsrelevan-ten Situationen und Interaktionsmustern widersprüchliche, motorische Verhaltens-weisen, indem er sich der Bezugsperson nähert, Schutz bei ihr sucht und kurz darauf wieder wegläuft, sich mit motorischen Stereotypen bewegt, in tranceartige Zustände gerät, wie dies bei Eltern selbst aus Bindungsinterviews bekannt ist (vgl. MAIN und SALOMON 1990).
BRISCH73 fasst auf der Grundlage von unterschiedlichen Studien zusammen, dass etwa 80 % der Kinder von traumatisierten Eltern ein desorganisiertes Bindungsmus-ter mit solchen Verhaltensweisen zeigen. Diese können dann in bindungsrelevanten Situationen und in anderen Beziehungen, zwischen z.B. dem Kleinkind und der Er-zieherin, auftreten und sehr irritierend und verunsichernd auf die Bezugspersonen wirken. Wenn Kinder über einen längeren Zeitraum traumatisierende Erfahrungen erlebt haben, entwickeln sie desorganisierte Bindungsmuster, in deren Folge sich eine Bindungsstörung herausentwickeln kann, die unterschiedliche Auswirkungen auf das
73 vgl. a.a.O. Brisch. S. 108 ff.
31
Verhalten hat. Diese Kinder entwickeln andere Verhaltensweisen, so z. B. Überle-bensstrategien, die häufig den Bindungskontext nicht erkennen lassen, und je nach der Schwere in Formen von emotionaler und körperlicher Verwahrlosung und Depri-vation münden.
Sie manövrieren sich durch einen sozialen Rückzug in eine eigene innere Welt mit Zeichen von körperlichem Verfall, wie in den Falldarstellungen 1 und 4), Marasmus (Falldarstellungen 1, 2 und 4), stereotype Bewegungsmuster (Falldarstellungen 2 und 3), Selbststimulation (Falldarstellung 3), selbstverletzendem Verhalten (Falldarstel-lungen 1 bis 4), in extremen Fällen sogar Bisswunden (Falldarstellung 2), wie dies nur noch in rumänischen oder russischen Kinderheimen dokumentiert ist.
Die Traumatisierung besteht in einer sequentiell-permanenten Traumatisierung durch eine emotionale Isolation und Nichtverfügbarkeit einer Bezugsperson, die entspre-chend dem Konzept der Feinfühligkeit auf die Kinder eingehen könnte. In der Fall-darstellung 1 waren das die Eltern, in der Falldarstellung 2 die Großmutter, in der Falldarstellung 3 die Mutter und in der Falldarstellung 4 die SOS Kinderdorf-Mutter.
Weitere schwerwiegende Traumatisierungen, die zu Bindungsstörungen führen, sind:
- wiederholte Verluste von Bindungspersonen in den ersten Lebensjahren, durch Tod, Unfall, Naturkatastrophen oder aber Kriege. In Bürgerkriegen sind es Ereignisse, in denen die Kinder mit der Trennung von Bindungspersonen oder mit einem plötzli-chen und endgültigen Verlust konfrontiert sind. In der Falldarstellung 3 bleibt Fr. Satic solange über den Verbleib ihres Vaters im Ungewissen, bis 17 Jahre später, in einem Massengrab, sein Leichnam gefunden und identifiziert werden konnte.
- Erleben von sexueller Gewalt durch Bindungspersonen oder durch Personen, die im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht in einer solchen Rolle zum Kind stehen, wie das zu traumatisierenden Erfahrungen in der Falldarstellung 2 und in der Falldarstellung 4, hier nur angedeutet, geführt hat. 74
Ähnlich geschieht dies bei körperlicher Gewalt und Misshandlungen durch Bin-dungspersonen. Typische Reaktionen sind, dass die Kinder weglaufen oder sie Stra-tegien entwickeln, Gewalt zu entgehen, indem sie ihrerseits auf ihre Eltern sorgend und feinfühlig eingehen, wie in den Falldarstellungen 2 und 4. Diese Form der Bin-dungsstörung nennt sich Rollenumkehr, weil die Kinder ihre eigenen Bindungsbe-dürfnisse zugunsten der Eltern aufgeben.
Das Verhalten wird internalisiert und kann im Erwachsenalter dazu führen, wenn sie andere versorgen, dass es ihnen unmöglich ist, sich selbst zu versorgen oder sich ver-sorgen zu lassen, weil sie die Übertragung befürchten, der andere könne, ähnlich wie früher der Misshandler, unberechenbar zuschlagen oder sie auf andere Weise verlet-zen. Wie in den Falldarstellungen 2 und 3 der beiden weiblichen Biographinnen, die sicher häufiger als männliche Biographen eine Form der Rollenumkehr erleben.
- Gewalterfahrungen, auch Missachtung der physischen Bedürfnisse, z. B. bei großer Vernachlässigung, indem der Säugling nicht gepflegt, (wie in der Falldarstellung 2
74 vgl. a.a.O. Brisch. S. 112 ff.
32
und 4) nicht ausreichend gefüttert, gewindelt und mit warmer Kleidung versorgt wird. Dies führt zu schweren Beeinträchtigungen des Körpererlebens.
Traumatisierende Erfahrungen zerstören die Bindungssicherheit und führen zu einer schwerwiegenden psychopathologischen Entwicklung. Bindungsstörungen sind dann die Folge, die zu schweren Persönlichkeitsstörungen, emotional-instabilen Persön-lichkeitsstörungen vom Borderline-Typ, wie in den Falldarstellungen 2 und 3 oder zu schweren narzisstischen Persönlichkeiten wie in der Falldarstellung 1 exemplarisch führen können. Sie können zudem Einfluss nehmen auf kognitive oder somatische Entwicklungen. Sie können sich negativ auswirken in Form einer Wachstumsretar-dierung, wie in der Falldarstellung 2 oder sie können symptomatologisch in Form von Schulversagen auftreten, das mit Zeichen von Pseudodemenz, wie in den Falldarstel-lungen 2 und 3, auftreten.
Wenn die Schwangerschaft, so BRISCH, oder die Geburt in ihrem normalen Ablauf durch Komplikationen gefährdet wird, kann dies ebenso zu spezifischen Risikokons-tellationen für das Entstehen von Bindungsstörungen führen.75
1.4. Bedeutung von Trans- oder De-Institutionalisierung für die Gruppe der TSSP
Eine der zentralen Fragen der Psychiatrie in den letzten vier Jahrzehnten war, ob die sozialpsychiatrisch orientierten, gemeindenahen Versorgungangebote für den Perso-nenkreis der chronisch psychisch kranken Menschen, angestoßen durch die Psychi-atrie-Enquete 197576, die Versorgung der chronisch psychisch Kranken verbessert hat. Wie können die Patienten trotz zunehmend kürzerer Verweildauer im kliniksta-tionären Bereich, in ambulant nachsorgenden Betreuungsangeboten, dem individuel-len Hilfebedarf entsprechend, ausreichend und adäquat versorgt werden? Im selben Maße, wie die Klinikplätze in Deutschland systematisch abgebaut wurden, hat sich die Anzahl der Angebote der Ambulanten Angebote erweitert und weiter ausdiffe-renziert. Wie wird innerhalb dieser Versorgungsstrukturen die Patientengruppe der wohnungslosen und psychisch kranken Menschen mit Suchtmittelabhängigkeit be-handelt, versorgt und berücksichtigt? Sind die bisher entwickelten und abrufbaren Angebote ausreichend nach den Bedarfen und Bedürfnissen der Klientel ausgerich-tet? Konkret, werden die Arbeitszeiten den Bedarfen angepasst, werden flexible und durchlässige Leistungsangebote, wie z.B. Krisenintervention auch am Wochenende, am Abend und in der Nacht, Krisenbetten in der stationären Versorgung, vorgehal-ten? Welche Bedeutung und Nutzung erfahren das Persönliche Budget, die Integrierte Versorgung und Home-Treatment-Modelle in den jeweiligen Versorgungsregionen?
Im anglo-amerikanischen Sprachraum wurde bereits seit Mitte der 80er Jahre über eine zunehmende Zahl der homeless mentally ill berichtet. Dem als Sogeffekt be-zeichneten Anstieg dieser Adressatengruppe wurde kausal ein Versagen der psychi-atrischen Versorgung durch die als deinstitutionalization bezeichnete rapide Reduk-tion der psychiatrischen Klinikbetten unterstellt. Aus den USA kamen darüber hinaus
75 vgl. a.a.O. Brisch. S. 114. 76 Psychiatrie-Enquete: 1975: Bericht über die Lage der Psychiatrie in der BRD zur psychiatrischen und psy-chotherapeutischen-psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung. Download am 11.8.2016 unter https://www.dgppn.de/schwerpunkte/versorgung/ enquete.html.
33
erste Anstöße zu einer methodisch anspruchsvollen epidemiologischen Forschung, sowie zur Entwicklung und Evaluation von meist ambulanten Therapieprogrammen für diese Patientengruppe. Der internationale Forschungsstand wurde von KELLINGHAUS et al. (1999)77 detailliert zusammengefasst.
In Deutschland hingegen entstanden im Zuge der seit Anfang der 90er Jahre entwi-ckelten Programme zur Enthospitalisierung sukzessive eine Vielzahl kleiner Versor-gungseinrichtungen für entlassene psychiatrische Langzeitpatienten. WESSEL (1998) spricht von einer Transinstitutionalisierung, die fast unmerklich innerhalb der Heimstrukturen stattfinde. Damit gehe eine Fragmentierung der Versorgung sowie eine Aufspaltung der Versorgungsverantwortung einher. Es komme zudem zu einer Abwanderung der psychiatrischen Langzeitpatienten in die Justizvollzugsanstalten, in den Maßregelvollzug oder in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe bzw. in Ob-dachlosenasyle.78 Ein damit verbundenes Zuständigkeitsgerangel zwischen der Woh-nungsnotfallhilfe, der Sozialpsychiatrie und der Suchtkrankenhilfe hält bis heute vielerorts konstant und perpetuierend an. Kooperationsstrukturen vor Ort sind häufig nur als Modellprojekte oder vernetzte und finanziell instabile Rudimente entwickelt. Es kommt zu einer Kultur der Aus- bzw. Abgrenzung des Personenkreises der psy-chisch kranken und wohnungslosen Menschen mit Suchtproblematik, die im Bermu-dadreieck der beteiligten und verantwortlichen Versorgungssysteme im Zuge der Zu-ständigkeitsfrage und der Zugangskriterien vernachlässigt werden und eine geringe bzw. marginale Aufmerksamkeit erfahren.
Wohnungslosigkeit, so TRABERT (2002)79 ist ein soziales Phänomen und keine psy-chische Erkrankung. So lange wie diese Patientengruppe wahrgenommen wird, so lange bemühen sich Studien, die Zusammenhänge zwischen psychischer Krankheit und Wohnungslosigkeit zu verstehen und zu entschlüsseln, um entsprechend Inter-pretationen für praxisrelevante Interventionen und bestehende bzw. innovative Ver-sorgungsangebote auszurichten, zu vernetzen, nachzujustieren oder zu optimieren. REKER (1997) liefert in der Kontextbetrachtung von psychischer Krankheit und Wohnungslosigkeit zwei Interpretationsoptionen. Psychische Krankheit ist entweder als Folge der extremen Lebenssituation, die durch fehlende Sicherheit für das eigene Leben und Eigentum, mangelnden Schutz vor Witterung, fehlende Intimität und Rückzugsmöglichkeiten, Armut, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, soziale Ausgrenzung, Kriminalität, Gewalt, Alkohol- und Drogenkonsum, schlechte Hygiene und medizi-nische Versorgung gekennzeichnet ist, zu verstehen, oder aber psychische Krankheit mündet umgekehrt unter dem Einfluss einer konzentrierten Akkumulation ungünsti-ger Bedingungen in soziale Marginalisierungs- und Segregationsprozesse und schließlich in Wohnungslosigkeit.80 Diese Diskussion, die durch die breeder- oder auch shift-Hypothese gekennzeichnet ist, beschäftigt die Sozialwissenschaft seit den 30er Jahren und setzt sich z. B. mit den Zusammenhängen und möglichen Korrelaten zwischen schizophrener Erkrankung und sozialer Schicht auseinander. (vgl. FARIS 77 Kellinghaus, C. (2000): Wohnungslos und psychisch krank: Eine Problemgruppe zwischen den Systemen. LIT Verlag. Münster, Hamburg, London. 78 vgl. Müller-Isberner, R. (2000), Schanda, H. (2003), Angermeyer, M.C.(2004), Freese, R. (2004) u.a. 79 Trabert, G. (2002): Sozialmedizinische Forschung zum Thema: Wohnungslosigkeit und Gesundheit. In: wohnungslos. Aktuelles aus Theorie und Praxis zur Armut und Wohnungslosigkeit, 1/02, Bielefeld. S.: 15-18. 80 vgl. Reker, T. (1997): Wohnungslosigkeit, psychischer und psychiatrischer Versorgungsbedarf, In: Deut-sches Ärzteblatt 94, Heft 21; S. 1439-1441.
34
& DUNHAM 1939, HOLLINGHEAD & REDLICH 1959, BRENNER 1973, DOHRENWEND 1980, RICHTER 2003, HUDSON 2005).
Die groben Herausforderungen und zentralen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Gruppe der TSSP sind somit akzentuiert und skizziert. Nun gilt es, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, auf welchem theoretischen Fundament und Diskurs die Gruppe der TSSP in der Folge als Grundlage einer weiteren Vertiefung und Ausdif-ferenzierung der biographischen Lebenswelt und der individuellen Alltagswelt in all ihrer Ausgestaltung könnte eingebettet werden. Die Gruppe der TSSP kann in dem nun folgenden Konzept von THIERSCH, in ihrer Komplexität und Vernetzung der Felder sozialer Arbeit, wegen ihrer professionellen Herausforderung und der unter-schiedlichsten gesellschaftlichen und sozialpolitischen Dimensionen verortet und be-greifbar gemacht werden. Dieses Konzept nimmt zum einen die Bestimmungsmerk-male heutiger Lebensverhältnisse in den Fokus und entwickelt zum anderen Kritik an den Institutionen und Strukturen der Sozialen Arbeit.
Die Gruppe der TSSP lediglich im Fokus eines klinisch individualisierenden Kon-zeptes zu betrachten, würde den komplexen fachlich-methodischen Herausforderung in der Versorgungsarbeit der Gruppe nicht gerecht werden.
Das Lebensweltorientierte Konzept greift gerade die Ungleichheiten und Prozesse der Erosionen in der heutigen Lebenswelt auf und fragt lange vor dem gegenwärtigen Diskurs zur Exklusion und Inklusion nach den strukturellen, institutionellen, gesell-schaftlichen, aber auch sozialpolitischen Einfluss- und Wirkfaktoren.
Das Konzept der Alltags- und Lebensweltorientierung (siehe Kapitel 2.1) umfasst im Sinne von THIERSCH & GRUNWALD (2008)81 zum einen ein Rahmenkonzept der Theoriebildung Sozialer Arbeit, das als Orientierung ihrer Praxis dient, zum anderen beansprucht es auch eine sozialpolitische Einflussnahme auf die strukturellen Rah-menbedingungen der Adressaten, die sich auf der Grundlage von institutionellen Pro-grammen und Modellentwicklungen in Konzepten sozialpädagogischen Handelns in einem professionalisierten Betreuungs- und Beratungskontext bewegen.
Gerade dieses Konzept nimmt Bezug auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen Ent-wicklungen und deren Folgen, die durch diversifizierende und wieder zunehmende soziale (Chancen)Ungleichheiten sowie durch Verunsicherungen lebensweltlicher Erfahrungen in Deutungs- und Handlungsmustern charakterisiert sind und die schließlich in einem Prozess der Individualisierung der Lebensführung und einer Plu-ralisierung von Lebenslagen verankert sind.82
Die sozialen Ungleichheiten zeigen sich in der unterschiedlichen Ausstattung von materiellen Ressourcen, sind aber auch Ungleichheiten, die sich auf die Zugehörig-keiten zu Nationen, Generationen, Geschlecht, auf den Bildungszugang und Bil-dungsgrad, auf die Arbeit, die Infrastruktur der Gesundheitsförderung und die Aus-gestaltung der sozialen Dienstleistungen beziehen.83
81 vgl. Thiersch, H. (Hg.) & Grunwald, K. (2008):Praxis lebensweltorientierter Sozialer Arbeit. 2. Auflage. Juventa Verlag. Weinheim und München, S. 13. 82 vgl. a.a.O. Thiersch & Grunwald (2008), S.15. 83vgl. Jurzcyk, H./Rerrich M.: Die Arbeit des Alltags. Freiburg. Lambertus Verlag. 1993 Freiburg. S. 276 ff.
35
Gerade die Kinder und Jugendlichen, die unter erschwerten Entwicklungs-, Lern- und Entkulturationsbedingungen aufwachsen, wie z. B. jene, die körperlich, geistig und psychisch beeinträchtigt sind, in großstädtisch-sozialen Brennpunkten84 aufwachsen oder durch Flucht oder Bürgerkriege traumatisiert sind, werden gesellschaftlich seg-regiert und wohnen häufig abgeschottet in zugewiesenen Quartieren mit schlechter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Das erfolgreiche Bestehen in und die Barrieren zu Bildungsinstitutionen, zu sozialen Einrichtungen, zu einer durchschnitt-lichen technisch-materiellen Ausstattung sind erschwert, gestalten sich für die Be-troffenen aufwendiger. Sie werden schließlich hochwelliger, unerreichbarer und be-lastender erlebt, als das bei den übrigen Bevölkerungsschichten und Familien der Fall ist.
Die theoretisch-methodische Brücke, die OBERT (siehe Kapitel 2.2.) baut, verbindet auf der einen Seite das originär aus der Kinder- und Jugendhilfe entwickelte theore-tische Konzept der Alltags- und Lebensweltorientierung THIERSCHs mit den sozi-alpsychiatrischen Grundideen, Zielsetzungen und Haltungen auf der anderen Seite und entwickelt daraus einen praxisorientierten, methodischen Transfer, der sich auf die Klientel der chronisch psychisch kranken Menschen bezieht, die in sozialpsychi-atrischen Institutionen begleitet und versorgt werden bzw. dort verortet werden sol-len. Die Gruppe der TSSP, die zwar quantitativ nur eine Minderheit innerhalb des Personenkreises darstellt, beansprucht jedoch qualitativ eine hohe Aufmerksamkeit der beteiligten Felder Sozialer Arbeit und fordert in personellen, zeitlichen, finanzi-ellen und strukturellen Dimensionen eine hohe Ressourcenauslastung heraus.
Im Verlauf der institutionellen Lebensverläufe oder der Patientenkarrieren der TSSP Gruppe, kommt es typischerweise zu Berührungen und Kontakten mit den Arbeits-feldern der Wohnungsnotfallhilfe, der Suchtkrankenhilfe zu unterschiedlichen bio-graphischen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Stadien des Krank-Werdens bzw. Krank-Geworden-Seins (siehe Kapitel 4. und 5.5. bis 5.8.), und im Besonderen mit der Einrichtungen und Behandlungsangeboten der Sozial- und Allgemeinpsychiatrie. Meist übernimmt innerhalb der (bestenfalls) definierten (Pflicht)Versorgungsregion die Sozialpsychiatrie durch eine koordinierende Bezugsperson die Fallverantwor-tung. Sie leitet mit der Zielsetzung von strukturierten und personenzentrierten85 Hil-feleistungen geeignete Interventionen ein. Dabei werden die hierfür benötigten sozi-alhilferechtlichen Grundlagen ausgewählt, geprüft und schriftlich gegenüber den örtlich und sachlich zuständigen Institutionen geltend gemacht.
Aus den bisher subjektiv-persönlichen Eindrücken, Einschätzungen und Gemeinsam-keiten, die ich im Rahmen der Einzelfallhilfe (Einzelgespräche), der sozialen Grup-penarbeit (z. B. Psychoedukationsgruppen und themenspezifische Gruppen) oder im Zuge von Gemeinwesenarbeit im Umgang mit der Gruppe der TSSP erlebt und ge-
84 Es handelt sich hier um (vor)-belastete Familien, in denen materielle Armut (eine hohe Anzahl an Empfän-ger von Transferleistungen von z.B. Sozialhilfe oder ALG II), Migration, Bürgerkriegs- und Fluchterfahrun-gen, (Jugend)-Arbeitslosigkeit, Sucht- oder Drogenmissbrauch, Gewalt in der Familie eine einflussreiche Be-deutung und einen hohen Stellenwert beanspruchen. Es sind Familien, die in räumlich zu engem und begrenztem Wohnraum leben, um nur ein paar signifikante Merkmale zu beschreiben. 85 Aktion Psychisch Kranke (Hg.): Personenzentrierte Hilfen im gemeindepsychiatrischen Verbund. Psychi-atrie-Verlag, 2006 Bonn.
36
sammelt habe, möchte ich im Folgenden meine allgemeinen Hypothesen, Fragestel-lungen (zum sozialstatistischen Sample und zu den biographischen Rekonstruktio-nen) sowie die Zielsetzungen meiner Arbeit aufführen.
1.5. Handlungsleitende Zielsetzungen der Untersuchung
Die Anwendung von biographischen Fallrekonstruktionen ermöglicht sowohl Einbli-cke in die sequenzielle Entstehung des Erlebten der Biographen als auch in die ge-genwärtigen biographischen Geschichten der „Trans-Sektoralen-Systemprüfenden.“ (TSSP-Gruppe)
Durch ein kontrastierendes Sampling der Interviewpartner können Anregungen und Erkenntnisse für geeignete Interventionen und Präventionen in der Gesundheitsver-sorgung der Patientengruppe generiert werden.
Erkenntnisse zur Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung von Exklusions-prozessen bei der Klientel der „TSSP-Gruppe“ können gewonnen werden.
Es gibt wenig Wissen um wirksame bzw. evidenzbasierte Präventionen, Interventio-nen und Maßnahmen, das sowohl von den betroffenen Biographen als auch von deren Angehörigen evaluiert wurde.
Es gibt Qualitätsindikatoren (vgl. WEINMANN & BECKER 2009) und Ergebnispa-rameter (vgl. THORNICROFT & TANSELLA 1999) in der Gesundheitsversorgung psychisch kranker Menschen, die auf den Personenkreis der Gruppe der TSSP über-tragen, fort- und weiterentwickelt werden können. Diese sind jedoch bisher in der Versorgung zu gering identifiziert worden und haben demzufolge zu wenig Berück-sichtigung gefunden.
1.6. Thesen zu den biographischen Fallrekonstruktionen
Es gibt typische Exklusionsprozesse, die am Beispiel von Negativverkettungen von Biographien auf die Gruppe der TSSP einwirken.
Es bestehen Faktoren, Einflüsse, Strukturen und Bedingungen, die Exklusionspro-zesse in den Lebensgeschichten der Gruppe der TSSP befördern, begünstigen und verstärken und dauerhaft aufrechterhalten.
Es gibt Muster, Strukturen, Erklärungen und Interpretationen, die aus der Perspek-tive der „Trans-Sektoralen-Systemprüfenden“, auf der Grundlage der gelebten und erlebten Lebensgeschichten, zu den Exklusionsprozessen (Wendepunkte) zu erfahren und abzuleiten sind.
Es gibt im Umkehrschluss, Faktoren, Strukturen, die in einem präventiven Sinne Ex-klusionsprozessen entgegen wirken. Dazu gehören auch Eigenleistungen und Struk-turierungskompetenzen der Biographen. Es gibt methodische Ansätze, die Inklusion befördern und begünstigen können und somit Exklusionsprozesse abwenden können.
Am Beispiel der Klientel der „Trans-Sektoralen-Systemprüfenden“ können Verände-rungen und Transformationsprozesse von Identitäts- und Lebensentwürfen herausge-arbeitet werden.
37
Es können Ableitungen und Anregungen auf der Grundlage von rekonstruktiver Biographieforschung bei der Patientengruppe der „Trans-Sektoralen- Systemprü-fende“ entwickelt werden. Diese basieren auf den Grundlagen der generierten Ergeb-nisse, die Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Hilfen und Handlungsempfehlungen und Qualitätskriterien für eine Versorgung im Sinne von Best-Practice liefern.
Es gibt genderspezifische und herkunfts- bzw. etniespezifische Merkmale in der Ana-lyse der „Trans-Sektoralen-Systemprüfenden.“
1.7. Thesen zum sozialstatistischen Sample Es können auf der Grundlage einer regionalen quantitativen Studie (n=114), am Bei-spiel des GPV Stuttgart, Erkenntnisse und Charakteristika über spezifischen Eigen-schaften der Gruppe der TSSP in einem repräsentativen und verallgemeinernden Sinne generiert werden.
Es können allgemeine Charakteristika über die institutionelle Vorgeschichte der Gruppe der TSSP erhoben und somit Erkenntnisse über sich verändernde Problemla-gen entsprechend der biographischen Abschnitte gewonnen werden.
Der Großteil der TSSP befindet sich, bevor sie im Straf- oder Maßregelvollzug oder in geschlossenen Heimen behandelt und betreut werden, in Einrichtungen der Woh-nungsnotfallhilfe, der Suchtkrankenhilfe aber auch der Gemeindepsychiatrie.
38
2. Kapitel
Theoretischer Rahmen
2.1. Konzept der Theorie der Alltags- und Lebenswelten nach THIERSCH
Die alltags- und lebensweltorientierte Theorie THIERSCHS (1986 und 1995) bezieht sich vorrangig auf die Ansätze von SCHÜTZ (1979 und 1993) mit den spezifischen Analysen alltäglicher lebensweltlichen Lebens- und Wissensformen, nach BERGER und LUCKMANN (1980), GOFFMAN (1956, 1973).
Diese Ansätze werden mit einer kritischen Alltagstheorie der Vertreter KOSIK (1986), HELLER (1981) BOURDIEU et al. (1997) verbunden, die Alltag im Kontext materialistischer Traditionen als Spannungsfeld interpretieren, in dem gegebene All-tagsverhältnisse gleichzeitig auch als borniert und zweideutig verstanden und kriti-siert werden und gegen die Optionen besserer und gelingender Alltagsverhältnisse stehen.
Der Ansatz Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit ist im Kontext seiner theoretischen Annahmen und Konzepte zu verstehen und greift auf insgesamt vier unterschiedliche Wissenschaftskonzepte zurück, die THIERSCH spezifisch für die Felder Sozialer Ar-beit verknüpft und assoziiert.
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit steht in der hermeneutisch-pragmatischen Tra-dition der Erziehungswissenschaften, wie sie von DILTHEY (1954), NOHL (1949, 1988) und WENIGER (1952) begründet und durch ROTH (1962) zur sozialwissen-schaftlichen und kritischen Pädagogik weiterentwickelt wurden. Die zentrale Frage-stellung richtet sich nach dem Alltag und der vom Mensch selbstbestimmten Lebens-welt aus. Die hermeneutisch-pragmatische Pädagogik ist interessiert an dem alltagspraktischen Verstehen und dem darauf bezogenen Handeln. Schließlich rekon-struiert dieser Alltag Praxiswissen, von dem aus Methoden auf der Grundlage eines „höheren Verstehens“, so DILTHEY, entwickelt werden können. Ausgangspunkt ist stets die vorgefundene, vorinterpretierte, jedoch veränderbare Lebenswirklichkeit in ihrer historischen, kulturellen und sozialen Dimension.
Der Lebensweltorientierte Ansatz ist zudem durch das phänomenologische-interakti-onistische Paradigma und seine kritische Reformulierung geprägt. Die stark in der Tradition der Chicagoer Schule entwickelten Analysen von der Alltags- und Lebens-welt wurden von SCHÜTZ (1971, 1972, 1974), den Wissenssoziologen BERGER & LUCKMANN (1977) und GOFFMANN (1973) vertreten.
Im Kontext der kritischen Alltagstheorie wurde diese von HELLER (1978), KOSIK (1967) LEVEBVRE (1977) und BOURDIEU (1993) weitergeführt, wenngleich sich dieser methodische Ansatz sehr von den vorhergehenden Vertretern unterscheidet und auch von völlig anderen gesellschaftshistorischen Annahmen ausgeht.
Lebenswirklichkeiten und Handlungsmuster werden auf der Grundlage der Alltäg-lichkeit rekonstruiert. Dabei stellt der Alltag die ausgesuchte Wirklichkeit für die
39
Menschen dar, die durch eine erlebte Zeit, den erlebten Raum und die erlebten sozi-alen Bezüge strukturiert ist und in ihr wirkt. Die Menschen werden in ihren alltägli-chen Verhältnissen geprägt, die sie mitbestimmen, aber auch aktiv mitgestalten kön-nen.
Die kritische Alltagstheorie, (vgl. KOSIK 1967 und BOURDIEU 1993), in einer Va-riation, setzt sich mit der darin verborgenen Doppelbödigkeit von Gegebenem und Aufgegebenem, von Realitäten und Möglichkeiten, die in den Vordergrund gestellt werden, auseinander. Der Alltag wird dialektisch behandelt, denn er bietet zum einen Routinen an, die entlasten und Sicherheit geben. Gleichzeitig ermöglicht er die Pro-duktivität im Handeln, aber zum anderen führt er zu einer Enge, zu einer Unbeweg-lichkeit und Borniertheit, die menschliches Leben im Grund bedingt, in seinen Schranken festsetzt und schließlich behindert.
Aus dem Alltag heraus können bessere und alternative Lebensverhältnisse anvisiert werden, die motiviert sind durch neue, aber auch andere Ansprüche, durch Trauer, Wut, Hoffnung und Träume. Im Alltag können Ressourcen wahrgenommen werden, wenn es gelingt, sich von der Borniertheit zu distanzieren und die in ihr unentdeckten und verborgenen Möglichkeiten wahrzunehmen. Dann könne, so THIERSCH, gelin-gendes Leben hervorgehen und gelebt werden.
Des Weiteren bezieht sich Lebensweltorientierung auf eine Analyse gesellschaftli-cher Strukturen. Erfahrene Wirklichkeit ist immer bestimmt durch gesellschaftliche Strukturen und Ressourcen. Die individuelle Lebenswelt wird als Ort der Erfahrun-gen und der Bewältigung angesehen. Die Lebenswelt ist die Bühne, auf der Menschen in einem Stück, in bestimmten Rollen, mit bestimmten Bühnenbildern nach bühnen-spezifischen Regeln miteinander agieren. Zur Rekonstruktion dieser konkreten Mög-lichkeiten, aber auch Grenzen von lebensweltbestimmenden Mustern bezieht sich der Ansatz auf die Analyse alter und neuer Ungleichheiten und die Analyse der neuen Formen von Anomie und Verunsicherungen, im Zeichen einer reflexiven Moderne, (vgl. BECK 1986, BAUMANN 1999, RAUSCHENBACH 1999).
Lebensweltorientierung stützt sich auf die Darstellung gesellschaftlicher und sozialer Ressourcen von Lebenswelten (materiellen, sozialen und ideologischen Ressourcen) oder Kapitale und auf die Untersuchung zur gesellschaftlichen und sozialen Bezie-hung von Lebensmustern der Geschlechtermerkmale, der Migrationskultur, der Ar-beits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. THIERSCH fasst den Ansatz der Lebens-weltorientierung und seine Verortung in unterschiedliche Theorien wie folgt zusammen:
„Im Zusammenspiel der vier Traditionen kann das Konzept der Lebensweltorientie-rung in der Sozialen Arbeit als theoretisches Konzept verstanden werden, das seinen Ausgang nimmt in der Verbindung der Traditionen der hermeneutisch-pragmati-schen Erziehungswissenschaften mit dem interaktionistischen Paradigma, refomu-liert im Zusammenhang der kritischen Alltagstheorie und bezogen auf Gesellschafts-analysen zu Ungleichheiten und Offenheiten in der reflexiven Moderne.“ 86
86 Vgl. a.a.O. Grunwald /Thiersch (2008), S.: 19.
40
Darin wird methodisch ein Handlungskanon für sozialpädagogisches Handeln gene-riert, dabei assoziiert THIERSCH das Verstehen und berücksichtigt die spezifischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und nimmt so auch Bezug auf eine Dialektik von Individuum und Gesellschaft sowie von System und Lebenswelt. (vgl. HABERMAS 1995).87
Nach THIERSCH88 entwirft Alltag eine ganze Palette an vielschichtigen Aufgaben und Anforderungen, die erfüllt und bewältigt werden müssen. So ergeben sich auch aus ihm Situationen, die gemanagt, und Herausforderungen und Konflikte, die geklärt und gelöst werden müssen. Des Weiteren entsteht und entwickelt sich aus dem Alltag ein „Alltagswissen von vertrauenswerten Konzepten, um damit die soziale Welt aus-zulegen und mit Dingen und Menschen so umzugehen, damit die besten Resultate dieser Situationen mit einem Minimum von Anstrengung und Vermeidung uner-wünschter Konsequenzen erlangt werden können.“89
THIERSCHS Ansatz der Lebensweltorientierung (1995) bildet das Fundament einer niederschwelligen sozialpsychiatrischen Arbeit und fügt sich so geeignet in die Dis-kussion und Auseinandersetzung mit der Gruppe der TSSP ein.
Der Ansatz THIERSCHS hat sich parallel zur Expansion und Entwicklung der Sozi-alen Arbeit seit den 60er Jahren vollzogen, die ihre Kernmerkmale und Inhalte in einer zunehmenden Verrechtlichung, Vergesellschaftlichung menschlichen Lebens und einer ihr entsprechenden wachsenden Institutionalisierung, Professionalisierung und Verwissenschaftlichung akzentuierte. In dieser Epoche prägten eher klinisch-in-dividualisierende Konzepte die Felder Sozialer Arbeit. Mehr und mehr rückten ge-samtgesellschaftliche Kontexte und Entwicklungen in den Vordergrund der Sozialen Arbeit, die schließlich mit einer radikalen Gesellschaftskritik, in der sich die alte dis-ziplinierende Soziale Arbeit in eine kritische Auseinandersetzung begibt, einhergeht. Ganz entgegen einer Entwicklung hin zu einer Spezialisierung und kritisch-abstrak-ten Theorie geriet im Zusammenhang der sozialen Bewegungen und Frauenbewe-gung die Frage und das Interesse nach dem Alltag, nach den Erfahrungen der Men-schen in ihren Lebenszusammenhängen und Fähigkeiten und der Zielsetzung einer ganz praktischen Selbstständigkeit in den Fokus der Sozialen Arbeit.
Angesichts der neueren gesellschaftlichen Entwicklungen, die durch die charakteris-tischen Beschreibungen einer Risikostruktur, einer Gesellschaft der Unübersichtlich-keit, einer reflexiven Moderne oder einer neuen Anomie gekennzeichnet werden, (vgl. BECK 1986, 1994, BÖHNISCH 1994 und RAUSCHENBACH 1999), be-kommt der Ansatz Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit Aufwind und Bedeutung. Im Kontext einer Individualisierung von Lebensführung und einer Pluralisierung von Lebenslagen in der Gesellschaft kommt es zu Verunsicherungen lebensweltlicher Er-fahrungen in Deutungs- und Handlungsmustern.
87 Habermas, J. 1995: Band 2 S. 171-293. 88 Vgl. a.a.O. Thiersch (1986), S. 17. 89 Vgl. Schütz, A: Strukturen der Lebenswelt. In: Schütz, A.: Gesammelte Aufsätze. Band 2. Studien zur soziologischen Theorie. Den Haag. 1972, S. 153 ff.
41
Die Gesellschaft ist bestimmt durch eine sich diversifizierende und erneut zuneh-mende soziale Ungleichheit, wie sie BECK (1994) beschreibt. Soziale Ungleichhei-ten zeigen sich in den Unterschieden bezogen auf die materiellen Ressourcen, sowie auf die Zugehörigkeit zu Nationen, Generationen oder Geschlecht. Soziale Ungleich-heit kommt zum Ausdruck bei der Teilnahme an Bildungschancen, am Arbeitsmarkt, bei der Gesundheitsförderung und den sozialen Dienstleistungen. Die Auswirkungen der Globalisierung, die eine Erosion bestehender Lebensstrukturen und Muster sowie eine Expansion einer Wissens- und Informationsgesellschaft mit sich führten, erge-ben eine völlig neue Gewichtung von Arbeit und Freizeit, sowie eine Neuformation der Geschlechterrolle und ihre Ansprüche, auch im Verhältnis der Generationen zu-einander. Neue Formen gesellschaftlicher Inklusion und Exklusion sind daraus ent-standen und stellen die gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit dar.
Der Wunsch, die Sehnsucht nach verlässlichen Bezügen, einer aktiven Gestaltung des eigenen Lebensarrangements wird mehr und mehr aufwendig, schwierig und anstren-gend.
Die Rede vom Alltag und der Lebenswelt wird so zum Indiz der Krise der lebens-weltlichen Verhältnisse. Die Erfahrungen der Ambivalenz des Alltags muss sich ver-mitteln mit neuen gesellschaftlichen Chancen und Verunsicherungen.90
Das Konzept der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit bezieht sich auf die Un-gleichheiten und Erosionen in der aktuellen Lebenswelt.
Zeitgemäße Soziale Arbeit verbindet traditionelle Aufgaben einer kompensierenden Unterstützung in Armut und Not mit neuen Aufgaben der Unterstützung in den Kri-sen heutiger risikoreicher Normalität, so RAUSCHENBACH (1999).
In der Zunahme der traditionellen sozialen Probleme und im wachsenden allgemei-nen Bedarf an Hilfe, bei der alltäglichen Bewältigung von Normalität, werden in der Sozialen Arbeit die klassischen Zielgruppen um ein generelles Hilfsangebot für alle als lebensweltorientierte Hilfe zur Lebensbewältigung. Soziale Arbeit rückt mit an-deren sozialen Dienstleistungen somit in die Mitte der Gesellschaft und wird zu ei-nem integralen Moment heutiger Daseinsfürsorge und einer heutigen unterstützenden sozialen Infrastruktur innerhalb einer breiten Angebotspalette.
Ökonomische Interessen werden vorherrschend und in ihnen der Neoliberalismus, in dem die Bestimmungskraft des Prinzips der sozialen Gerechtigkeit unterlaufen und die Bedeutung Sozialer Arbeit dethematisiert wird, so GUNWALD & THIERSCH (2008).
Das Konzept der Lebensweltorientierung stieß von Beginn an auf Kritik und Wider-stände. So bezieht sich die Kritik zum einen auf den Bezug der Lebensweltorientier-ten Sozialen Arbeit auf Alltag und Lebenswelt. Alltag sei das, worüber eh alle verfü-gen, bei den Alltagsressourcen ist es ebenso und dies müsse nicht in den Fokus einer spezifischen Reflexion gesetzt werden. Zudem binde man Professionswissen an Je-dermannwissen, somit an den gemeinen, gesunden Menschenverstand, genau an das,
90 vgl. a.a.O. Grunwald & Thiersch (2008), S. 15.
42
was durch Professionalität gerade überwunden und geklärt werden solle. Somit dro-hen die spezifischen und konstituierten Kompetenzen für professionelles Handeln un-terlaufen zu werden, zumal noch die Lebensweltorientierung eine strenge und grund-legende Kritik an stigmatisierenden institutionellen und professionellen Handlungszugängen übe. Daraus ergebe sich zum einen der Eindruck einer diffusen theoretischen disziplinarischen Selbstdarstellung, zum anderen werde dadurch die schon eh teilweise verbreitete Verunsicherung unter den Praktikern befördert. Ein weiterer Kritikpunkt sei, dass durch die Unklarheit im professionell-institutionellen Zugang eine in der praktischen Arbeit bekannte Tendenz bestehe, im Namen von Alltag und Alltagspraxis Probleme, Schwierigkeiten und Konflikte im Leben der Ad-ressaten einzuebnen und zu unterschlagen. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die, auch anerkannten Handlungs- und Gestaltungsmaximen91 und ihre Durchsetzung in den 70er Jahren. Dennoch sei das Konzept zunehmend beliebig in andere Interes-sen hereingezogen und zu einem „Catch as all“ Konzept verflacht. Ferner trage das Konzept zu einer Ausrichtung bei, die Arbeitsmöglichkeiten Sozialer Arbeit auf Kos-ten der Adressatinnen zu stabilisieren. Schließlich berücksichtige der Ansatz nicht ausreichend Aufgaben auf der Grundlage einer empirischen Bestandsaufnahme und die Arbeitskonzepte zu Effizienz, Effektivität und Organisationsgestaltung blieben weitgehend unbearbeitet.92 Der an der jeweiligen Lebenswelt der Adressaten orientierte Ansatz ist entstanden, so THIERSCH in einem Interview an der Hochschule für Soziale Arbeit Wallis, um sich gegen eine in den 60er und 70er Jahren weitverbreitete Tendenzbildung einer Pädagogisierung und Spezialisierung in den Feldern der Sozialen Arbeit zu richten. Lebensweltorientierung hat die Intention, die Menschen in ihren Erfahrungen, in ih-ren Lebensumständen und in ihren eigenen Lebensmöglichkeiten ernst zu nehmen und richtet sich gegen eine pädagogische Überfrachtung. Sie insistiert darauf, sich in einem pragmatischen Sinne an den Menschen zu orientieren, die Erfahrungen und Kompetenzen haben. Sie haben sich eigene Geschicklichkeiten angeeignet und auch einen Stolz, mit ihren eigenen Erfahrungen, mit ihrem Eigensinn umzugehen. So soll der Ansatz professionalisierte Möglichkeiten einsetzen und zur Anwendung bringen, ohne das Leben selbst zu professionalisieren. TIERSCH ist weiter der Meinung, dass
91 Prinzip der offensiven Einmischung in sozial- und bildungspolitische Prozesse, in Gremien der Kommunal-verwaltung und einer aktiven Beteiligung, Mitgestaltung und Teilhabe auf Kommunalebene, auf Bezirksbei-rats- oder Gemeinderatsebene; das Prinzip der Prävention: d.h. um die Herstellung günstiger und belastbarer Alltäglichkeiten und Lebenswelten; das Prinzip der Alltagsnähe: Zugänge, Präsenz und Erreichbarkeit der Hil-fen unter Einbezug sowohl durch Einfluss auf das Verhalten und Ressource als auch auf eine Strukturierung von Raum, Zeit und den sozialen Bezügen zu nehmen; Prinzip der Regionalisierung und der Sozialraumorien-tierung der Adressaten, wie sich die Hilfen und Bedürfnisse je nach den sozialen Lagen, den Wohnquartieren, nach den kulturellen und ethnischen Traditionen oder nach besonderen Lebenskonstellationen für Familien, Kinder, Jugendliche oder alten Menschen artikuliert werden; Prinzip institutionelle und nicht-professionelle, also zivilgesellschaftliche, bürgerschaftliche, partnerschaftliche Hilfen im Gemeinwesen zu identifizieren, zu aktivieren und zu vermitteln; Prinzip der Integration und weitergeführt in der Debatte zur Inklusion, das sich auf den Grundsatz einer von Menschenrechten und eines Bürgerstatus orientierten Sozialen Arbeit ausrichtet; Inklusion betont die Gleichheit aller miteinander lebenden Menschen in der Anerkennung einer grundlegenden Gleichwertigkeit; Prinzip der Partizipation: Nachdem die Adressaten sich in Selbstvertrauen und Verantwor-tung übernehmende Selbständigkeit erfahren, miteinbezogen werden, bei einer gemeinsamen Gestaltung von Hilfen durch das Markenzeichen des Verhandelns statt Behandelns. vgl. a.a.O. Grunwald & Thiersch (2014), S.19-24 92 Grunwald, K. Thiersch, H. (2014): Lebensweltorientierung. Enzyklopädie Erziehungswissenschaften On-line; ISSN 2191-8325, Fachgebiet/ Unterüberschrift: Soziale Arbeit, Grundbegriffe. Schröder W. (Hrg.) Schweppe C. Beltz Juventa. Weinheim und Basel. DOI 10.3262/EEO 14140320, S. 4-6.
43
die Lebensweltorientierung innerhalb der Sozialen Arbeit gerade nicht die Nicht-Spe-zialisierung, sondern die praktische, am jeweiligen Alltag der Adressaten orientierte und daran ausgerichtete praktische Arbeit bevorzugt. Sie lässt sich auf die Gesell-schaft ein, sie lässt sich auf den Alltag der Menschen ein, in all seiner Komplexität. Wenn es, eine Dignität des Alltagshandelns gibt, so THIERSCH, dann gibt es eine eigene Bedeutung. Eine Würde für Menschen, die anderen dabei helfen, sie darin zu unterstützen, in ihrem Alltag zurande zu kommen. Dieses Geschäft, das alles zusam-menhält, wird in der Gesellschaft jedoch nicht anerkannt. In einer zweiten Dimension beabsichtigt Lebensweltorientierung eine Spezialisierung für das Komplexe, das All-gemeine, denn der komplexe Alltag reicht vom Umgang mit der Hygiene, bis hin zur Beziehungsgestaltung in der Familie. Er reicht von den eigenen Ängsten bis hin zu den sozialen Kompetenzen. Professionelle müssen sich dann einmischen, wenn es zu Gewalt und Missbrauch oder Eigengefährdung in der Familie kommt oder wenn z.B. eine magersüchtige Patientin ein bereits riskantes Grenzgewicht nicht mehr einzuhal-ten in der Lage ist. Dann ist es notwendig, pädagogisch zu intervenieren, damit der Mensch in seinem Leben voller Komplexität leben kann.
Dabei gibt die Lebensweltorientierung eine moralisch inspirierende Kasuistik vor, die einerseits den Menschen, so wie er ist, akzeptiert. Sie gibt eine moralische Orientie-rung vor, dass es gut ist, wenn z. B. Menschen selbst bestimmen können, dass es gut ist, wenn sie ihre eigene Möglichkeiten und Fähigkeiten ausprobieren und entdecken. Es ist gut, wenn sie solidarisch sind, wenn sie in ihren Verhältnissen, Situationen und Gelegenheiten gesehen werden. Lebensweltorientierung beansprucht, im Rahmen des Einzelfalls zu verhandeln und fortwährend zu prüfen, ob mit den vorgehaltenen professionalisierten Hilfen das Leben verbessert werden kann. Lebensweltorientie-rung folgt, nach THIERSCH, einer doppelten Moral, denn einerseits respektiert sie den Menschen, wie er ist, andererseits respektiert sie die Möglichkeiten, die Optio-nen, auf die der Mensch innerhalb seiner Lebenswelt zurückgreift. Lebensweltorien-tierung beinhaltet eine Ethik des Zuhörens, des Einlassens, des Rekonstruierens aber auch des Gelten-Lassens. Es ist eine Ethik, die den Schmerz, das Klagen aushält, den Unwillen und den Stolz respektiert, das der Mensch in seinem Leben schon gezeigt und Wissen und Erkenntnisse darüber generiert hat, was gut für ihn ist und was hilf-reich für ihn sein könnte.
Lebensweltorientierung hat Respekt vor dem Verborgenen des Menschen, das frei-gesetzt werden kann. Sie hat den Anspruch, dass Menschen in gelingenden Lebens-verhältnissen bei gerechter Ressourcenausstattung leben sollen. Dies ist schwer aus-zuhalten. Es ist schwer, Faulheit, Unwillen oder Behaglichkeit gelten zu lassen. Insbesondere dann, wenn die gesetzlichen Lebensmöglichkeiten nicht zulässig sind. Professionelles Handeln im Lebensweltorientierten Ansatz bedeutet, sich auf einen Kampf verpasster Möglichkeiten einzulassen. Es gilt, sein Handeln nach dem Prinzip der Zumutung des Lernens und Umlernens auszurichten, sodass der Mensch neue, andere Wege zu gehen versucht. In diesem Sinne, so THIERSCHS Idee, ist die Dop-pelmoral der Lebensweltorientierung zu verstehen. Die folgenden zwei Ebenen erge-ben sich: a.) Ich respektiere den Mensch, so wie er ist und ich respektiere, dass etwas aus ihm werden könnte. b.) Auf der anderen Ebene „liebe“ ich den Menschen in ei-nem altmodischen Sinne. Ich vertraue dem Menschen, so wie er ist, dass er Möglich-
44
keiten hat, mit diesen ausgestattet ist. Ich bin neugierig, welche Möglichkeiten, wel-che Phantasien er entwickelt, welche Entwicklungen er vollziehen möchte, die er dann in sein neues Leben übertragen wird. Nach THIERSCHS Verständnis ist Le-bensweltorientierung in der Sozialen Arbeit das Geschäft für die Zukurzgekommenen in der Gesellschaft. Sie stehe für Solidarität und Gerechtigkeit in einem weit gefassten Sinne. Es bestehe z. B. nicht die Idee und Absicht, einen Menschen wieder rasch arbeitsfähig zu machen, um dem Selbstverständnis z. B. der Arbeitsagentur oder der Krankenkassen zu entsprechen. An diesem Punkt stellt die Lebensweltorientierung auch ein Menschenbild dar, das der unheiligen Allianz zwischen Neokapitalismus und Neokonservatismus entgegensteht, die in der Gesellschaft prägend vorherrscht und in der nur jemand etwas gelte, wenn er etwas leiste oder die vorgibt, dass jeder sein eigener Regisseur seiner eigenen Verhältnisse sei, der im Verständnis von Hu-mankapital brauchbar und nützlich für die Gesellschaft sein solle. Ist er es aber nicht, so sollen die Aufgaben, die von der Sozialen Arbeit erledigt werden, zudem noch mit geringen Kosten ausgestattet sein. Lebensweltorientierung steht einem Menschenbild der Gesellschaft entgegen, die in der Dimension Leistung denkt. Diese zeitgenössi-sche Sicht auf den Menschen ziehe es vor, in Leistungssteigerung, in Effektivität und Effizienz zu investieren und gerade nicht in Kommunikation.
Lebensweltorientierung beinhaltet eine pädagogische Haltung des Verstehens, Un-terstützens, aber auch des Widersprechens und des Einsprechens. Im Kontakt geht es darum, mit dem Menschen mitzugehen, um Möglichkeiten freizusetzen. Es gilt, nicht für allen und jeden Bedarf fremde und fachliche Hilfen oder stets ein Denken, eine Fachlichkeit einzubeziehen, um so einer drohenden Gefahr, einem Prozesses der Ent-mündigung entgegenzuwirken.
Der Ansatz der Lebensweltorientierung ist zum einen institutionskritisch, da er nicht zu einer Selbstbedienung entsprechend den eigenen Interessen der Leistungsanbieter beitragen und eine Expansion befördern will, zum anderen ist er professionskritisch, gerade gegenüber der Angst vor den Bemächtigungsmöglichkeiten, die insbesondere in pädagogischen Berufen stecken. Lebensweltorientierung ist, so Thierschs Über-zeugung, positiv interessiert, sowohl an der Eigensinnigkeit und Eigenwilligkeit, als auch an den eigenen Phantasien, Kräften und Möglichkeiten der Menschen, um im Leben zurande zu kommen.93
Alltagsorientierte Sozialarbeit/Sozialpädagogik stellt den Menschen in seiner Lebenswelt in den Mittelpunkt des Handelns. Der Respekt vor dem Anderen und dem Anders-Sein, die Akzeptanz und Förderung des Eigensinnes der Adressaten sind grundlegend für das Handeln und das Verstehen des „Menschen im Kontext von Lebenswelt: Sie erscheinen immer im zunächst gegebenen Zusammenspiel sozialer, struktureller und individueller Faktoren, also nicht als gleichsam isoliert, für sich bestehende Individuen, sondern innerhalb eines sozialen Netzes, in dem sie sich als sich selbst erfahren können“, so Thiersch (1986)94.
93 vgl. youtube.com Hans Thiersch im Interview 5.5.2014 (Frage1/10) zum Thema Lebensweltorientierter Ansatz in der Sozialen Arbeit durch Hanspeter Utz an der Hochschule für Soziale Arbeit Hes-so Wal-lis/Schweiz 94 Thiersch, H. (1986): Verstehen oder kolonialisieren. Verstehen als Widerstand. In: Müller, S. Otto, H-U (Hg.): Grundprobleme sozialpädagogischen Handelns und Forschens. 2. Auf. Bielefeld, S. 122-123
45
Der Mensch erwirbt in der Interaktion mit seinem Umfeld die Kompetenzen, die es ihm ermöglichen, das Aufgegebene zu bewältigen und das Neue zu integrieren. Erst wenn dieser Ausgleich und die Befindlichkeit von Individuum und Umgebung (gelingender und misslingender Alltag) auseinanderdriften und damit Fähigkeiten, Ressourcen und Möglichkeiten nicht (mehr) in adäquatem Maße vorhanden sind, können Spannungen, Irritationen, Missverständnisse und in fließendem Übergang, krankheitsrelevante Verhärtungen entstehen.
Der diesem Konzept aus der Alltagstheorie95 zugrundeliegende multifaktorielle Ansatz geht vom Zusammenwirken somatischer und genetischer Konstitution, psy-chischen und sozialisationsbedingten Entwicklungsmöglichkeiten, sowie von defizitären und unzumutbaren materiellen, sozialen und kulturellen Lebensbedingun-gen aus, was letztlich zu einer Manifestation einer psychischen Erkrankung führen kann. Es besteht nicht zufällig, so OBERT (2001)96 eine hohe Deckungsgleichheit von sozialpsychiatrischen Leitlinien (z. B. Menschenbild, Verständnis von Gesund-heit und Krankheit, Methodik, politische Implikationen) und dem alltags- und lebensweltorientierten Ansatz.
Sozialpsychiatrisches Handeln, unter der Voraussetzung einer regionalen, gemeinde-nahen und personenzentrierten Versorgungsverpflichtung, kann in seiner Orientie-rung und methodischen Ausrichtung letztlich nur dann erfolgreich sein, wenn es sich konstitutiv auf den Alltag der Betroffenen bezieht, sich darin verortet und sich schließlich am Subjekt, an seinen Ressourcen und Möglichkeiten und an seinen Er-fahrungen innerhalb seiner erlebten und erfahrenen Lebenswelt orientiert.
Der Ausgangspunkt der Alltagstheorien ist, dass jeder Mensch einen Alltag hat. Ein Leben ohne Alltag, innerhalb dessen sich der Mensch aufhält, handelt, denkt und fühlt, ist nicht möglich.
Ziel ist es, zu einem gelingenden Alltag für den Einzelnen und seine Umgebung beizutragen. Dabei geht sozialpsychiatrisches Handeln vom Schwächsten („Trans-Sektoralen-Systemprüfende“) aus und findet in der Lebenswelt der Adressaten statt, orientiert sich an ihren Ressourcen und ihrer Umgebung. Sie trägt zur Emanzipation, zur Erweiterung der Persönlichkeit und des damit verbundenen Handlungsrahmens im Sinne von Selbstbefähigung und Verselbstständigung bei und versucht sozial zu integrieren, z.B. in eine Nachbarschaft, in ein Gemeinwesen, in einen regionalen Sozialraum (Teilhabe- und Sozialraumorientierung). Letztlich ist sozialpsychia-trisches Handeln einerseits eine ethisch-moralisch motivierte, andererseits aber auch gesellschaftskritische Bewegung, die als professionelle Grundhaltung gegen eine Welt von Ausgrenzung bzw. Exklusion vorzugehen verlangt. Sozialpsychiatrie hat
95 Die alltags- und lebensweltorientierte Theorie ist im geisteswissenschaftlichen Paradigma verankert, wel-ches Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand. Das Paradigma definiert sich letztlich darüber, den Menschen in seinem Alltag, in der Interaktion mit seiner Umgebung zu verstehen. Es ist von Bedeutung, sein Verhalten, sein Handeln, seinen Lebensplan und seine Identität im Kontext zu begreifen und sein Verhält-nis zur Gesellschaft als davon untrennbar zu betrachten und zu bestimmen. So nimmt z. B. die Fundierung des Sozialen in der Struktur des Handelns und die Einführung der Kategorie des Verstehens in der Tradition der Hermeneutik Schleiermachers und Diltheys bei Schütz eine große Bedeutung ein. (Fischer-Rosenthal (1995) In: Flick 1995:80-82, Habermas 1968 und 1995, Band 1: 225 - 366, Lamnek 1995, Band 1: 87, Schütz 1979 und 1993, Kosik 1986, Heller 1981). 96 Vgl. a. a. O. Obert, K. (2001), S. 133-138.
46
primär den Anspruch, einen ambulanten und außerklinischen Widerpart in der Ver-sorgung darzustellen, mit der Kernaufgabe zu deinstitutionalisieren und zu enthospi-talisieren, damit die Betroffenen ihre eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten entwickeln und erweitern können, sofern das der eigene Umgang mit der Krankheit, die Hilfeannahmebereitschaft- und Behandlungsmitwirkung zulassen und möglich machen.
Der Ansatz wie auch die Handlungs- und Strukturmaximen sollten für die folgenden unterschiedlichen Felder Sozialer Arbeit mit unterschiedlicher Bedeutung angepasst und entworfen werden. Soziale Arbeit kann mit der Ausrichtung von Lebensweltori-entierung als ein Projekt mit dem Leitziel zur Realisierung sozialer Gerechtigkeit ver-standen werden. Dieses Projekt, so HEIMANN (1980)97, habe sich in der Auseinan-dersetzung zwischen Machtinteressen und Naturrecht, zwischen ökonomistischen, wirtschaftsliberalen Interessen und der Intention von Aufklärung und Demokratisie-rung zunehmend profiliert. Es geht hierbei um eine Fortentwicklung der Geschichte in immer neue Phasen und Auseinandersetzungen um einen für den Kapitalismus „wesenswidrigen Kompromiss“, der sich in den dramatischen Kämpfen um Anerken-nung der unterprivilegierten Bevölkerungsschichten und exkludierten Personengrup-pen vollzieht. Es geht hierbei um die Abschaffung der Leibeigenschaft, die Anerken-nung des Proletariats und der Arbeiter, die Emanzipation der Frau, schließlich um die Eigensinnigkeit und Selbstbestimmung der Kinder, der Jugendlichen und der Men-schen mit Behinderungen. Im Wesentlichen geht es um die materiellen Rechte zur Gleichstellung von Lebensverhältnissen, die alle Menschen zu einer gesellschaftli-chen Teilhabe befähigen und zwar unter gleichen Voraussetzungen und die somit auch auf Chancengleichheit abzielen.
THIERSCHS98 Ansatz der Lebensweltorientierung berücksichtigt in der Zusammen-fassung die Strukturmaximen der Prävention, der Regionalisierung und der Alltags-nähe, also der Erreichbarkeit, der Präsenz von Hilfen und der Niederschwelligkeit oder einer Barrierefreiheit des geeigneten Angebots. Der von OBERT entwickelte alltags- und lebensweltorientierte Ansatz sozialpsychiatrischen Handelns bezieht sich mit weitgehender Kongruenz auf dieselben Strukturmaximen und wird im Folgenden vorgestellt. Dieser Ansatz, der Lebensweltorientierung assoziiert, bietet einen geeig-nete Überblick und Handlungsleitlinien in der anspruchsvollen Betreuung, Beglei-tung und Versorgung der Gruppe der TSSP an.
2.2. Alltags- und lebensweltorientierter Ansatz sozialpsychiatrischen Handelns nach OBERT
In der Gegenüberstellung der Grundprinzipien und Haltungen der Sozialpsychiatrie99, mit dem alltags- und lebensweltorientierten Ansatz, stellt OBERT eine hohe Über-einstimmung von gemeinsamen Merkmalen auf unterschiedlichen Ebenen fest.
97 Heimann, E. (1980): Soziale Theorie des Kapitalismus. Theorie der Sozialpolitik. Tübingen: Mohr 1929) Frankfurt am M, Suhrkamp. 98 vgl. a.a.O. Thiersch. S. 27. 99 Grundsätze der Sozialpsychiatrie: Häfner, H. (2001). In: APK Band 27, S. 96. -www.psychiatrie.de/dgsp/soltauer-initiative/ Download vom 25.10.2016; -Peukert, R.: MAPS-GP1-Geschichte der Psychiatrie-Die 2. Reformphase (Gemeindepsychiatrie) www.ibrp-online.de. Download vom 25.10.2016.
47
Sozialpsychiatrische Arbeit, so OBERT, ist bestimmt durch die Förderung des eman-zipatorischen, eigenverantwortlichen Umgangs mit der psychischen Erkrankung und nicht deren ursächlichen Beseitigung. So ist die Arbeit der sozialpsychiatrischen Fachdienste in der Arbeitsweise und in der inneren Haltung und dem Menschenbild zu verstehen, die sich auf Kontinuen bewegen, an deren gegenüberliegendem Ende, sich die Positionen jeweils gegenüberstehen (können). Das heißt, sie reichen von Selbstständigkeit und eigenverantwortlichem Handeln der Erfahrenen bis hin zu weit-gehenden Einschränkungen und Ein- und Begrenzungen der Autonomie, die dann von den professionellen Akteuren der sozialpsychiatrischen Dienste und Einrichtun-gen durch die Übernahme von Verantwortung und Entscheidungen für die Klienten in bestimmten, zeitlich meist begrenzten, zugespitzten und eskalierenden Situationen und Lebensereignissen getragen werden.100
(Sozial)Psychiatrie ist ein Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit und bleibt auch von den ökonomischen Entwicklungen nicht unberührt. Psychiatrie bewegt sich in besonde-ren Maßen zwischen verschiedenen Spannungsfeldern. Die prägnantesten sind das doppelte Mandat zwischen Zwang und Stigmatisierungen und einer personenbezoge-nen Dienstleistung, sowie der Bedeutung des Kundenbegriffes und der Frage nach der Wirksamkeit, einer Kosteneffizienz und dem Nutzen sowie einem sinnvollen Res-sourceneinsatz in der Sozialen Arbeit bzw. einer zunehmenden Bedeutung betriebs-wirtschaftlicher Kennwerte.
Psychiatrie weist spezifischen Besonderheiten auf, die begründet sind in ihrer Ge-schichte, z. B. aus der Psychiatrie-Enquete101 und den daraus resultierenden positiven Veränderungen und Verbesserungen der Versorgungsangebote, sowie der dadurch entwickelten Impulse zur Qualitätsentwicklung durch Professionelle, durch die Psy-chiatrie-Erfahrenen selbst, deren Angehörige und der Bürgerhelfer.
OBERT geht von Zielen und Leitlinien sozialpsychiatrischen Handelns aus, die er auf der Grundlage des lebensweltorientierten Ansatzes als Handlungskanon für die Professionelle Arbeit ableitet.
Der Mensch ist in seinem sozialen Feld, in seiner Lebenswelt zu sehen und von hier aus ist der Mittelpunkt des professionellen Handelns anzusetzen.
OBERT setzt spezifische Handlungsleitlinien im Zusammenhang mit zentralen und bedeutsamen Kategorien fest, wie z. B.:102
Anfragesituation und der erste Kontakt: Hier kommt es auf die Inhalte der Informa-tion und auf die dargestellte Lebenslage an. Wie wird diese eingeschätzt und festge-stellt, z. B. welche weiteren Beteiligten und Vertrauenspersonen spielen aus Sicht des
100 vgl. Obert, K (2008): Alltags und lebensweltorientiertes Handeln. In: Grunwald, K. Thiersch, H. (Hg.): Praxis lebensweltorientierter sozialer Fragen. 2.Auflage. Juventa-Verlag. 2008 Weinheim und München, S. 305-316. 101 Psychiatrie Enquete von 1975 und Expertenbericht von 1988 und Theoretische Grundalgen der Ge-meindepsychiatrie von Peukert, R. www.ibrp-online.deanzeig2.html vom 12.08.2016 102 a.a.O. vgl. Obert (2001), S. 403-419.
48
Erfahrenen eine Rolle? Welche Fragestellungen, Probleme stehen aktuell im Vorder-grund? Wie ist die Absprachefähigkeit und welche bisherigen Erfahrungen mit pro-fessionellen oder psychiatrischen Hilfen wurden gesammelt?
Erhalt und Gestaltung des Wohnraumes bzw. der Wohnung, sowie die Erweiterung des Lebensraums;103
- Strukturierung der Zeit für den Tag und die gesamte Woche;
- Strukturierung durch das Tätig-Sein, durch Arbeit, Beschäftigung, durch eine Tä-tigkeit, in der der Klient gebraucht sein will, als Tages- und Wochenstrukturierung;
- Struktur der Kontakte, der sozialen Beziehungen, der Kommunikation und des so-zialen Gefüges;
- Handlungsleitlinien für die Fortschreibung, Pausierung oder Beendigung des Kon-taktes.
OBERT geht davon aus, dass die Professionellen innerhalb der fünf Handlungsleitli-nien, über folgendes methodisches Können und Kompetenzen verfügen bzw. befähigt sind, diese bei Bedarf angemessen abrufen zu können:
1. Einsatz von beratenden Einzelgesprächen, die dazu dienen, den Kontakt zu suchen, eine Beziehung aufzubauen und Vertrauen mit „Fingerspitzengefühl“ herzustellen;
2. Sozialanwaltliche Hilfen und sozialrechtliche Ansprüche prüfen und initialisieren; sich um die materielle Grundsicherung kümmern;
3. Die Nutzung der Ressourcen beim Betroffenen, bei Angehörigen und im sozialen Umfeld identifizieren und zusammentragen;
4. Nicht-psychiatrische/-professionelle Hilfen, z. B. durch Vereine, die Nachbar-schaft, durch ehrenamtliche oder bürgerschaftliche Unterstützung oder durch die Kirchengemeinde, gemeinsam erörtern und die Nutzung prüfen, sowie psychiatri-sche, psychotherapeutische, medizinische, gesundheitsfördernde Hilfen abwägen;
5. Kooperation und Vernetzung der Hilfen bei Einwilligung und Akzeptanz des Be-troffenen pflegen, steuern und koordinieren.
103 Es gibt verfahrene Lebenslagen bei Betroffenen, dass es über weite Strecken nur noch klinische Hospita-lisierungen und einem Leben auf der Straße oder in unsicherem Wohnraum kommt. Die eingetretene Woh-nungslosigkeit steht dann einer Erweiterung des Lebensraums entgegen, da zweifellos ein Leben auf der Straße in Kombination mit einer psychischen Erkrankung keine Erweiterung des Lebensraums darstellen kann, viel-mehr stellt dies die ungewollte Alternative gegenüber einer untragbaren Wohnsituation dar. Die Erweiterung des Lebensraums, so Obert (vgl. a.a.O. S.: 326) geht von der Verfügung von Wohnraum aus und beschreibt konkret das Hinausgehen, das Verlassen der Wohnung und die (Wieder)-Eroberungen der Umgebung, der un-mittelbaren Nachbarschaft oder des Stadtteils. Bei dieser Fallsituation hat der professionelle Dienst zu motivieren, anzuregen, zu unterstützen oder zu beglei-ten, um einer massiven sozialen Rückzugsentwicklung, um ein Sich-Einigeln, um ein Nachgehen der starken phobischer und paranoiden Ängste entgegenzuwirken.
49
OBERT unterscheidet hier zwischen zwei potentiellen Reaktionsmustern: einerseits zwischen einer Akzeptanz der angebotenen oder vorgehaltenen Hilfen oder anderer-seits einer möglichen Ablehnung der Hilfe.
Wenn der Betroffene die Hilfe akzeptiert, den Kontakt zulässt, besteht das offensicht-liche Ziel des Handelns darin, einen selbstverantwortlichen und eigenständigen Um-gang mit der psychischen Erkrankung zu erreichen. Die Thematisierung der Problem- und der Lebenslage ist mit Fingerspitzengefühl zu besprechen. So soll zunächst auf einsichtige Themen eingegangen werden. Wenn der Kontakt entsteht, sich entwi-ckelt, ist eine kontinuierliche Betreuung möglich. Im Rahmen eines selbstverantwort-lichen Umgangs, aber auch eines unsicheren Umgangs mit der psychischen Erkran-kung empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Hier soll der innere und äußere Konflikt und deren Zusammenhang angesprochen und besprochen werden. Es soll ein Ge-spräch, eine Auseinandersetzung zum Thema psychische Erkrankung und deren Fol-gen thematisiert werden. Der biographische Werdegang soll in die aktuelle Lebens-lage einbezogen und verstanden werden. Individuelle Krisenzeichen sind zu beschreiben, auf krankheitsfördernde Situationen, Verhalten und Hinweise, wie auch auf bisherige Erfahrungen und den Umgang damit ist einzugehen. Daraus resultierend können Erkenntnisse abgeleitet und ausgewertet werden. Auf diese Weise können Vereinbarungen im Umgang mit zukünftigen Krisensymptomen getroffen werden. In der Folge ist auf die Bedeutung und die Haltung gegenüber einer medikamentösen Behandlung, der Wirkung, der notwendigen Kontrolluntersuchungen, aber auch auf die Nebenwirkungen und auf die potentiellen Spätfolgen (wie z. B. Spätdyskenesien, Gewichtszunahme, Diabetes, chronische Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthoch-druck, Leberschädigung, Beeinträchtigungen des Sehens, des Sexuallebens einzuge-hen. Es soll ein Austausch angeregt und eine Aufklärung mit anderen Betroffenen und Erfahrenen, geleistet werden.
Wenn dies jedoch nicht der Fall ist und das Reaktionsmuster mit einer geringen und fehlenden Akzeptanz der psychischen Erkrankung beschrieben werden kann, gilt es zuerst, eine akute oder dauerhafte Krise zu vermeiden.
MASANZ und MENZLER-FRÖHLICH (2016) bringen einschränkend Anregungen vor, die bei einer Einzelfallprüfung auch die Applikation einer provozierten Krise als sozialpsychiatrische Intervention unter bestimmten Voraussetzungen und Standards befürwortet.104 In diesem Fall geht OBERT von einer Intensivierung an aufsuchenden und nachgehenden Kontaktbemühungen aus, ebenso von einem Mehr an Kontrolle.
104 Masanz K. /Menzler-Fröhlich, K.-H. (2016): Ideen für eine sozialpsychiatrische Praxis der Ermutigung. In: KERBE. 4. Quartal. 2016, S. 14-17. (..”Die professionelle Unterstützung ist inhaltlich auf Schützen, behut-sames Fördern und Begleiten hin ausgerichtet. Eine “Pass- bloß- auf-Haltung” der Vorsicht, der Angst vor dem Rückfall oder der weiteren Verschlechterung kann dominieren. Chronizitätsfördernde Interaktionen können die Folgen sein, wenn das Prinzip Vorsicht stärker bleibt als der Mut zum Risiko. (…) Wie können wir unsere Arbeit im ABW so angemessen ungewöhnlich, so mutig bleiben oder werden, dass der Weg für Ermutigung und die damit verbundenen notwendigen Zumutungen zu einem gelingenden Alltag für die Nutzer unseres Angebots offenbleibt, so die Ausgangshypothese von MASANZ & MENZLER-FRÖHLICH. Folgende quali-tätssichernde Strukturen können einen Beitrag hierfür leisten, wie z. B. eine Hilfeplankonferenz mit Versor-gungsverpflichtung, ein kompetentes Fallmanagement, eine auskömmliche Vergütung, eine angemessene Teamgröße, regelmäßige und strukturierte Fallbesprechungen, Beziehungsarbeit als methodisches Handwerks-zeug, Kursgespräche mit einem standardisierten Vorgehen, die Arbeit mit der Methode “reflecting-Team oder anlassbezogene ethische Fallbesprechungen.
50
Absprachen sollen gegenüber den Betroffenen in ein transparentes und eindeutiges Vorgehen eingebettet sein, z. B. bei der Medikamenteneinnahme soll situationsab-hängig vom Grad der Selbst- und Fremdgefährdung des Betroffenen ausgehend der professionelle Dienst ein Mehr an Verantwortung übernehmen. Dies gelingt dann, in dem Maße, wie der Erfahrene die Selbstverantwortlichkeit reduziert und somit in sei-ner Autonomie eingeschränkt wird.
• Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Handeln versus weitgehende Ein-schränkungen und Eingrenzung der Autonomie durch den professionellen Dienst;
• Offenheit, Flexibilität, Klarheit, Eindeutigkeit und Transparenz beschreiben eine Haltung für das professionelle Handeln, dagegen kann nur in Ausnahme bei akuter Selbst- und Eigengefährdung verstoßen werden, da im Zuge einer Fürsorgepflicht der Professionelle dann für und anstatt des Patienten/ Klienten, u. U. auch gegen seinen Willen, Hilfen und Behandlung einzuleiten hat.
Die Vermittlung der Doppelfunktion beim Professionellen von Hilfe und Kontrolle, von institutionellem Kontakt und menschlicher Beziehung, von Öffentlichem und Privatem gilt es, im Kontakt und im Gespräch zu verdeutlichen und gegebenenfalls fortlaufend darzustellen. Der Ansatz der Lebensweltorientierung wie auch der sozi-alpsychiatrische Handlungsansatz akzentuieren die historischen und biographischen Erfahrungen, den Eigensinn des Adressaten innerhalb seiner Lebenswelt. Entspre-chend sind ein Umgang mit Fingerspitzengefühl und das Nachgehen des sozialpoli-tischen Postulats des offensiven Einmischens für Ansprüche und Rechte der Adres-saten und einen auf Respekt und Wertschätzung ausgerichteten Umgang mit der Klientel als grundsätzlicher Handlungskanon eine zentrale Maxime. Die darin veran-kerte professionelle Haltung, Einstellung und Handlungsleitlinien gehen davon aus, dass das, was der Mensch in seinem Alltag, in seiner Geschichtlichkeit und individu-ellen Lebenswelt zustande bringt und gebracht und überstanden hat, Respekt, Ach-tung und vor allem Anerkennung abnötigt.
Insbesondere bei der Gruppe der TSSP nimmt gerade der Begriff der Anerkennung, der sich nach HONNETH aus unterschiedlichen Dimensionen, nämlich der Liebe, des Rechts und der Wertschätzung, speist, eine herausragende Bedeutung sowohl für die professionelle Haltung, das Menschenbild als auch für handlungsleitende Stan-dards in der Kontaktgestaltung, der Hilfeplanung, des methodischen Umgangs, der Begleitung und der Behandlung ein.
Gerade der Gruppe der TSSP ist mit einem menschenwürdigen Umgang zu begegnen. Gerade die Gruppe der TSSP ist in ihren Rechten zu stärken und zu fördern. Ein Pro-zess des gesellschaftlichen Ausschlusses ist zu verhindern. Gerade die Gruppe der TSSP ist mit Gewalt in unterschiedlichen Formen erfahren und benötigt hierbei ein Verstehen, eine Auseinandersetzung mit ihrem biographischen Verlauf und der darin wirkenden Krankheit und deren Folgen.
2.3. Theorie der Anerkennung nach HONNETH
Ausgangspunkte der Theorie der Anerkennung sind zum einen die Auseinanderset-zung der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, mit deren Vordenkern ADORNO und HORKHEIMER und die durch die späteren Vertreter, HABERMAS und
51
FOUCAULT weiterentwickelt wurde. Zum anderen die Beurteilung HONNETHS darüber, dass den verschiedenen Ansätzen der jeweiligen Vertreter etwas fehlte und dieses Fehlen mit einer umfassenden Theorie zu kompensieren sei. Leitend für HONNETH war jedoch HEGELS Idee vom Kampf um Anerkennung, die er aufgriff, um die fehlenden Bausteine von ADORNO und HORKHEIMER auszugleichen, nämlich, denen es an der Vorstellung der Konfliktfähigkeit auch scheinbar integrier-ter Gesellschaften mangele. Bei FOUCAULT hingegen, fehle es nach HONNETH an einer Bestimmung des Worums der sozialen Kämpfe, während es bei HABERMAS an der Konzentration auf die Verständigung und an einem Blick für die Konfliktqua-lität zur Verständigung mangele.
Auf der Grundlage des HEGELSCHEN Denkmodells, eines Kampfes um Anerken-nung, entwickelte HONNETH eine Gesellschaftstheorie der Anerkennung, die zu-dem durch MEADS sozialpsychologischen Ansatz gespeist wird und ein intersubjek-tivitätstheoretische Personenkonzept entwirft, innerhalb dessen sich die Möglichkeit einer ungestörten Selbstbeziehung als abhängig von drei Formen der Anerkennung, nämlich Liebe, Recht und Wertschätzung, erweist. Den drei Formen der Anerken-nung entsprechen nach HONNETH drei Typen der Missachtung (Vergewaltigung, Entrechtung und Entwürdigung), deren Erfahrungen wiederum als Handlungsmotiv in die Genese sozialer Konflikte einfließen können. 105
Missachtung in Form von Vergewaltigung beschreibt eine Verletzung der leiblichen und psychischen Integrität durch z. B. körperlichen Schmerz, Folter oder durch ein schutzloses Ausgeliefert-Sein einer schädigenden Person oder einem institutionellen Rahmen. Die Folgen dieser Missachtungsform können Scham und die Zerstörung ei-nes elementaren Selbstvertrauens einer Person sein, die mit einem „dramatischen Verlust an Selbst- und Weltvertrauen und somit mit einem Zusammenbruch des Ver-trauens in die Zuverlässigkeit der sozialen Welt und damit der eigenen Selbstsicher-heit einhergehen.“106
Die beiden anderen Formen der Missachtung sind hingegen in einem Prozess des historischen Wandels einbezogen.
In der Entrechtung geht es um den Ausschluss, die Exklusion vom Besitz bestimmter Rechte innerhalb einer Gesellschaft und darum, als vollwertiges Mitglied einer Ge-sellschaft zu bestehen. Legitimierten Ansprüchen, auf die eine Person hoffen kann, werden gewisse Rechte vorenthalten, sodass ihr nicht wie den Gesellschaftsmitglie-dern moralische Zurechnungsfähigkeit zugebilligt wird. In dieser Form von Missach-tung, Entrechtung, sozialem Ausschluss geht es vielmehr um die Verknüpfung mit dem Gefühl, nicht denselben Status eines vollwertigen, moralisch gleichberechtigten Interaktionspartners zu besitzen. Es geht mit der Erfahrung der Entrechtung um den Verlust an Selbstachtung, sich auf sich selbst als gleichberechtigter Interaktions-partner aller Menschen zu beziehen. In der dritten Form, die sich negativ auf den sozialen Wert des Einzelnen oder von Gruppen bezieht, die Beleidigung oder Ent-würdigung, kommt es zu einer Herabwürdigung von individuellen und kollektiven Lebensweisen. Mit der Ehre, Würde, dem Status einer Person ist das Maß an sozialer
105 vgl. Honneth, A: Kampf um Anerkennung. S.: 8. 106 vgl. a.a.O. Honneth. S. 215.
52
Wertschätzung gemeint, das ihrer Art an Selbstverwirklichung im kulturellen Über-lieferungshorizont einer Gesellschaft zugebilligt wird.107
Häftlinge, ethnische oder religiöse Minderheiten, psychisch kranke Menschen oder psychisch kranke Straftäter, geistig oder körperlich behinderte Menschen, langzeitar-beitslose Mitbürger, wohnungslose Menschen oder Kriegsflüchtlinge aus Syrien, Flüchtlinge aus Afrika oder Afghanistan vertreten Menschengruppierungen, die durch eine unterschiedliche soziale, religiöse, kulturelle und ethnische Herkunft cha-rakterisiert sind. Sie gehen verschiedenen Lebensstilen innerhalb der Gesellschaft nach und repräsentieren eine lobbyschwache Gruppe, die über wenig Einfluss und Macht verfügt. Sie werden mit abwertenden und diskriminierenden Einstellungen und diskriminierendem Verhalten anderer Personen konfrontiert. Sie erfahren alle-samt wenig Anerkennung und sind den feindseligen und um Abgrenzung bemühten Einstellungen in ihrer Alltags- und Lebenswelt ausgesetzt.
Anerkennung ist zu einem Schlüsselbegriff unserer Zeit geworden. Es ist, als sei er als ehrwürdige Kategorie der HEGELSCHEN Philosophie wieder durch HONNETH zum Leben erweckt und durch die politische Theorie erweitert worden. Anerkennung scheint ein Begriff zu sein, der heute von zentraler Bedeutung für die Analyse von Kämpfen um Identität und Differenz ist. Anerkennung als Kategorie ist wieder zu einer elementaren Referenz für die Praxis moderner Gesellschaften geworden. Öko-nomische Kriterien haben die Forderungen sozialer Bewegungen nach sozialer Ge-rechtigkeit, Chancengleichheit ebenso dominiert wie der akademische Diskurs über das Thema. Ein zunehmender Druck auf etablierte Systeme, Pluralisierungen ethni-scher Horizonte, Politisierungen kultureller Identitäten, wirtschaftliche Globalisie-rungen und neue Kommunikationstechnologien lassen eine Fixierung auf ökonomi-sche Konzeptionen des Sozialen obsolet erscheinen108.
Die (global)gesellschaftliche Lage und auch die Zusammenhänge, die Phänomene wie Arbeitslosigkeit, Armut und andere soziale Problemlagen fordern geradezu, im Angesicht einer Schieflage bei der Verteilung der Güter, im Angesicht einer sozialen Ungerechtigkeit, einer Chancenungleichheit, einer ungerechten Verteilung der mate-riellen Güter und Rohstoffe und im Angesicht von transgenerativen Eskalationen und Konflikten in bestimmten Regionen der Welt eine Auseinandersetzung auf der Grundlage der HONNETHSCHEN Theorie, die im Folgenden weiter ausgeführt wer-den soll.
Die drei Formen der Anerkennung im HONNETHSCHEN Sinne, Liebe, Recht und Wertschätzung, sollen im Folgenden dargestellt und in einem weiteren Schritt auf die institutionelle Alltags- und Lebenswelt der Trans-Sektoralen-Systemprüfenden über-tragen werden.
Form der Anerkennung: Liebe
Nach HONNETH umfasst die Anerkennungsform Liebe, als grundlegende reziproke Anerkennung, nicht nur die Primärbeziehung im Sinne der Eltern-Kind-Beziehung als die eigentliche genuine Primärbeziehung, sondern sie bezieht sich auch auf die
107 vgl. a.a.O. Honneth (1998). S. 215-217. 108 vgl. Fraser, N. Honneth, A. (Hg.) 2003: Umverteilung oder Anerkennung? Suhrkamp. Frankfurt/M., S. 7.
53
romantisch-sexuelle Intimbeziehung, die erotische Zweierbeziehung, aber auch auf Freundschaften, die allesamt mit der gemeinsamen Kategorie, starke Gefühlsbindun-gen zwischen wenigen Personen charakterisiert sind.109
„Liebe ist als besonderes Verhältnis der wechselseitigen Anerkennung, Liebesver-hältnisse aller Primärbeziehungen, soweit sie nach dem Muster von erotischen Zwei-erbeziehungen, Freundschaften, Eltern-Kind-Beziehungen aus starken Gefühlsbin-dungen zwischen wenigen Personen zu verstehen.“110
Die Herausbildung dieser Anerkennungsform teilte HONNETH in zwei Prozesse auf:
Die institutionelle Herausbildung der Kindheit aus dem Lebensweg eines Menschen als besonders schutzbedürftige Phase; und der allmähliche Abbau des ökonomischen, ständischen Zwangs bei der Wahl des Lebenspartners leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Herausbildung.
In einer bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft erfahren Menschen auf unterschied-liche Weise Bestätigung für Aspekte ihrer Person: In der Sphäre der Liebe die Ach-tung der unantastbaren Integrität eines jeden Menschen, in der des Rechts die Wür-digung als Vernunftperson mit moralischen Kapazitäten und in der Sphäre der sozialen Wertschätzung, die Anerkennung besonderer, sozial wertvoller Eigenschaf-ten und Fähigkeiten.111
Auf dieser ersten Ebene reziproker Anerkennung soll der Einzelne sich selbst als In-dividuum erfahren lernen, das mit elementaren anerkennungswerten Bedürfnissen ausgestattet, aber auch auf andere und deren Zuneigung angewiesen ist, um ein in-taktes Verhältnis zu sich etablieren zu können.112
Die auf reziproke Anerkennung ausgerichteten Beziehungen sind auf eine „prekäre Balance zwischen Selbstständigkeit und Bindung“ angewiesen. Das Gelingen hinge-gen hänge im Hinblick auf den besonders sensiblen Bereich der Sozialisation im Kin-desalter von der wechselseitigen Aufrechterhaltung einer Spannung zwischen symbi-otischer Selbstpreisgabe und individueller Selbstbehauptung.
Inmitten der Ausführung der Theorie der Anerkennung fügt sich assoziativ eine the-matische Exkursion in die Psychopathologie ein, die sich gerade bei der Ursachensu-che von Psychosen auf den zentralen entwicklungspsychologischen Prozess zwischen symbiotischer Selbstpreisgabe und individueller Selbstbehauptung bezieht. Die den Fokus also darauf legt, wie und ob ein gelingender Ablöseprozess aus der Primärfa-milie bzw. dem elterlichen Gesichtsfeld vollzogen werden kann. Aus sozialisations-theoretischer Perspektive kann z. B. die Diagnose schizophrene Psychose als eine Krankheit am Erwachsenwerden bzw. Nichterwachsenwerden-können, wie BLANKENBURG das formuliert, beschrieben werden. Der aus der eigenen Kernfa-milie herauslösende und ablösende Prozess gerät somit in den Fokus der Betrachtung.
109 vgl. Honneth, A. (1998): Kampf um Anerkennung. Suhrkamp. 2. Auflage. Frankfurt a.M. S. 153. 110 a.a.O. Honneth: Kampf um Anerkennung, S. 169. 111 vgl. Düwell, M. (2002): Handbuch der Ethik. Stuttgart. Metzler. S. 299. 112 vgl. a.a.O. Honneth: Kampf um Anerkennung. S. 153.
54
Ablösung von der eigenen Familie, so HILDENBRAND113, „heißt Grenzüberschrei-tung zwischen der partikularen Welt der Familie und der Welt außerhalb der Familie. Zwischen den unüberschaubaren Perspektiven innerhalb des Familienmilieus und der Multiplizität von Perspektiven in der komplexen Gesellschaft außerhalb.“
Aus bindungstheoretischer Sicht114 hingegen kann die Zielsetzung einer begünstigen-den Sozialisation durch ein gelingendes Bindungs- und Kontaktverhalten zwischen Kind und Bezugsperson, auf der Grundlage einer wechselseitig ausgerichteten Aner-kennung, als handlungsleitend anvisiert werden.
Das Erlernen der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme (Empathie) und somit zur Teilnahme an sozialen Beziehungen legt den Grundstein, sei elementar für ein affek-tives Erleben und Wahrnehmen der Bezugsperson, sonst könne eine fremde Perspek-tive nicht als bedeutungsvoll erfahren werden und es bestünde kein Interesse, die Be-dürfnisse, Wünsche, Ansichten eines Dritten zu erkennen, wahrzunehmen und schließlich zu verstehen.115 ADORNO hob schon in seiner Schrift MINIMA MORALIA hervor, „das Humane haftet an der Nachahmung, ein Mensch wird zum Mensch überhaupt erst, indem er andere Menschen imitiert.“ 116
Mit dem schrittweisen Erwerb dieser Kompetenzen entwickeln sich Selbst- und Welt-vertrauen, das wiederum befähigt, Sozialbeziehungen aufzunehmen und anderen Per-sonen Anerkennung zukommen zu lassen. Wenn eine Störung dieser Dialektik zwi-schen Verschmelzung und Entgrenzung, in deren Verlauf das praktische Selbstverständnis des Selbstvertrauens, das Bei-sich-selbst-Sein im Anderen entsteht, könnte dies pathologische Folgen für den Einzelnen haben und die Voraussetzungen, intakte Sozialbeziehungen aufzubauen und einem individuellen Lebensplan zu fol-gen, schwer beschädigen. 117
Bei der Gruppe der TSSP scheint gerade hier häufig ein bedeutsamer Schritt nicht erworben und entwickelt worden zu sein. Zumindest erfährt gerade dieser Bereich, beeinflusst durch die psychische Krankheit und deren Folgen, eine massive Beein-trächtigung. Diese zeigt sich oftmals prägend in einer auf sich Bezogenheit (Egozent-rizität), sie zeigt sich aber auch im Bereich der Fremd- und Eigenwahrnehmung, der Kontaktgestaltung und Kommunikation sowie in einem Mangel an Resonanzfähig-keit im und durch den anderen.
Diese Ebene gewonnener Anerkennung, versteht HONNETH im Übrigen als exis-tentiellen Modus, der allen anderen Formen zugrunde liegt.
113 Hildenbrand, B. (1991): Alltag als Therapie. Ablöseprozesse Schizophrener in der psychiatrischen Über-gangseinrichtung. Bern und Stuttgart, Huber. S.:11. 114J. Bowlby hat sich als Mitbegründer der Bindungstheorie auf die Ausrichtung einer möglichst gesundheit-lichen Entwicklung konzentriert, sodass sich beim späteren Erwachsenen ein gutes Maß an Selbstwertgefühl und ein autonomes Bindungsverhalten entwickeln bzw. herausbilden kann. M. Ainsworth hat sich hingegen mit den spezifischen Bindungstypen und Bindungsverhalten auseinandergesetzt; bei den primären Bindungs-personen konnte sie als maßgeblich begünstigendes Verhaltensrepertoire positive Affekte, Selbstvertrauen so-wie Respekt und Empathie identifizieren. 115 a.a.O. Honneth: Kampf um Anerkennung, S.151. 116 Adorno, T.W.(1944): Minima Moralia.GS 4. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1998. S.176. 117 a.a.O. Honneth: Kampf um Anerkennung. S.168.
55
Form der Anerkennung: Recht
Die zweite Ebene nennt HONNETH die Anerkennungsform des Rechts. Damit rückt das Individuum als ein mit besonders emotionalen Bedürfnissen und Erwartungen ausgestatteter Mensch in den Vordergrund.118
Die soziale Sphäre des Rechts stellt eine völlig andere Form der reziproken Anerken-nung dar, die der Dimension Liebe, auf eine diametrale Weise gegenübersteht. Die soziale Funktion des Rechts fasst DÜWELL so zusammen, dass diese auf HEGELS Konzept der Rechtsphilosophie fußt, nach dem er die Form der Anerkennung als hö-herwertig gegenüber der Liebe begreift, da die Menschen als Rechtspersonen und nicht nur als Bedürfniswesen anerkannt werden.119 HEGELS Verständnis des Ur-sprungs des Rechts geht davon aus, dass das Recht aus der vernünftigen Anlage des Menschen selbst mit der Notwendigkeit hervorgehe, dass der Mensch als moralischer Akteur, der in die Anerkennungsformen eingebettet ist, welche maßgeblich für den Verlauf der Vergesellschaftlichung sind. Es geht hier nicht um den Kampf um das Überleben, sondern um den Kampf um erweiterte Formen der Anerkennung. 120
Die personale Anerkennung eines Individuums in der Rechtssphäre ist die eines mo-ralischen, urteilsfähigen und autonomen Subjekts. HONNETH sieht eine Entwick-lung in der Rechtssphäre angelegt, die auf eine qualitative Ausweitung drängt. Die Eigenschaften, auf deren Anerkennung Personen ein Anrecht anmelden, werden zu-sehends umfangreicher, entsprechend müsse das Personenkonzept, das dem Recht zugrunde liege und das hypothetisch zustimmungsfähige Moment im Recht, an-spruchsvoller werden. HONNETH sieht in diesem Fortschritt eine schrittweise Ein-lösung des moralischen Gleichheitsversprechens, auf dem sich das moderne Recht gründet. Auf die Durchsetzung negativer liberaler Freiheitsrechte folgten die demo-kratischen Partizipationsrechte und schließlich die erfolgreiche Erkämpfung positiver sozialer Wohlfahrtsrechte.121 Unabhängig von Geschlecht, Alter und Stand wird ein sozialer Status zugewiesen. Somit beabsichtigt die Anerkennungssphäre des Rechts egalitär alle Menschen als freie Wesen anzuerkennen.122 Das Konzept der individu-ellen Autonomie integriert das Recht als notwendige, entwicklungsfähige Größe, die einen bedeutsamen Baustein in einer Theorie der sozialen Gerechtigkeit ausmacht.
Form der Anerkennung: Soziale Wertschätzung
Die dritte Dimension der Anerkennung stellt die soziale Wertschätzung dar, auf der die Individuen sich positiv auf sich selbst, als mit besonderen Talenten und Eigen-schaften ausgezeichnete Personen beziehen können. An dieser Stelle weicht
118 a.a.O. Honneth: S. 163. 119 a.a.O. Honneth: Leiden der Unbestimmtheit. Reclam. Stuttgart: 2011, S. 96. 120 Im Gegensatz zum „homo oeconomicus“ der sich seine Fähigkeit zu einem uneingeschränkt rationale Verhalten auszeichnet. Handlungsbestimmend ist sein Streben nach Nutzenmaximierung, das für den Kon-sumenten oder bei Gewinnmaximierung für den Produzenten angemessen wird. Eine weitere charakteristische Annahme stellt die lückenlose Information über sämtliche Entscheidung-alternativen und deren Konsequen-zen, im Sinne einer vollkommenen Marktransparenz dar. Er stellt das Model eines ausschließlich wirtschaftlich denkenden Menschen dar, das der Analyse der klassischen und neoklassischen Wirtschaftstheorie zugrunde liegt. vgl. http://wirstchsftslexikon.gabler.deArchiv/8004/homo-oeconomivus-v12.html. Download vom 25.10.2016 121 a.a.O. Honneth. S. 180. 122 a.a.O. Honneth. S.192.
56
HONNETH am deutlichsten von HEGEL ab, der in der höchsten Ebene der Sittlich-keit den „tugendhaften Staatsbürger“ einordnete.
Im Gegensatz zur rechtlichen Ebene, in der das Allgemeine, das generelle Vernunft-potential hervorgehoben wird, werden in dieser Sphäre gerade die besonderen, indi-viduellen, ihn unverwechselbar machenden Merkmale des Menschen in der Sphäre sozialer Wertschätzung zur Geltung gebracht.123
Wenn gerade das Unterscheidende und Individuelle an den Menschen in den Fokus dieser Dimension gerückt wird, so wird ein soziales Medium benötigt, durch das jene Besonderheiten auf intersubjektive Weise zum Ausdruck kommen.
In bürgerlich-kapitalistisch geprägten Gesellschaften, so VOSWINKEL,124 dient das Leistungsprinzip als normativer Maßstab. Das Medium, das quasi das Recht auf An-erkennung hervorbringen soll, stellt die mit Mühe und Anstrengung verbundene Ar-beit dar.
Der Ort, der Anerkennung anbietet, ist unter kapitalistischen Bedingungen der Markt. Bereits HEGEL erkannte in ihr das Potential zur pathologischen Verzerrung, da die Konkurrenz das Band zwischen den Menschen zerreiße und schließlich drohe, sie in die Vereinzelung zu entlassen.125
Sowohl die Dimension des Rechts als auch die der sozialen Wertschätzung bauen beide auf der Überwindung traditioneller Standesgesellschaften auf. In diesen richten sich kollektive Verhaltenserwartungen an eine stark vorgegebene Form der Lebens-führung, die sich weniger an lebensgeschichtlich individuierte Subjekte als an sozial typisierte Gruppen ausrichte. Bei der Bewertung von gesellschaftlich erbrachten Leistungen richtet sich die Wertschätzung weniger auf das Besondere und Einzigar-tige des Menschen als vielmehr auf seine Fähigkeiten, strikte Verhaltensdogmen zu erfüllen.126
Erst der Bruch des europäischen Bürgertums mit der Feudalherrschaft im 18. bis 19. Jahrhundert127 mit den traditionellen Wertemustern eröffnet die Möglichkeit einer grundsätzlichen Neuinterpretation des Modus der Zumessung sozialer Wertschät-zung.
123 a.a.O. Honneth. S.183 124 Voswinkel, T. (2002): Bewunderung ohne Würdigung? Paradoxien der Anerkennung doppelt subjekti-vierter Arbeit. In: Honneth, A. (Hg.) Befreiung aus der Mündigkeit. Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalis-mus. Campus. Frankfurt/ M., S. 65. 125 a.a.O. Honneth (2000): Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphiloso-phie. Stuttgart. Reclam. S. 95. 126 Honneth, A (2003): Umverteilung als Anerkennung. Eine Erwiderung auf Nancy Fraser. In: Fraser, N. Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Frankfurt /Main. Suhrkamp. S. 200. 127 „Der Kampf, den das Bürgertum an der Schwelle zur Moderne gegen feudale Vorstellungen des Adels zu führen beginnt, ist nicht nur der kollektive Versuch einer Durchsetzung von neuen Werteprinzipien, sondern auch die Eröffnung einer Auseinandersetzung um den Status solcher Werteprinzipien überhaupt. Zum ersten Mal steht jetzt zur Disposition, ob sich das soziale Ansehen einer Person an dem vorweg bestimmten Wert von Eigenschaften bemessen soll, die ganze Gruppen typisierend zugeschrieben werden. Nunmehr erst tritt das Subjekt als eine lebensgeschichtlich individuierte Größe in das umkämpfte Feld der sozialen Wertschätzung ein.“ vgl. a.a.O. Honneth (2003). S. 202.
57
Im Zeitalter der Aufklärung, in der der Baron de Montesquieu die Gewaltenteilung erdachte, um dem einzelnen Bürger seine Freiheiten und Rechte zu garantieren oder in der sich KANTS Philosophie der Aufklärung die zentrale Frage stellte: Wenn der einzelne Mensch die zentrale Instanz sei, was kann er dann wissen, was solle er tun und was dürfe er schließlich hoffen? Als Vordenker um das Jahr 1770, entwarf J. G. HERDER, den Begriff der Individualität und hob hervor, dass “jedes Individuum ein eigenes Maß, gleichsam einer eigenen Stimmung aller seiner sinnlichen Gefühle zu-einander in sich trüge.“ HERDER ergänzt weiter „der tiefste Grund unseres Daseins ist individuell, sowohl in Empfindungen als Gedanken“. Die Frage bleibt bis heute bestehen, denn auf sie folgen und sie produziert weitere. Wie nur stimmt der Mensch mit sich selbst überein? Wie überwindet er das Maskenhafte, die Routinen und die sich wechselnden Rollen, die mit dem Leben in Zwängen auf Erden einhergehen, um sich selbst zu finden, auf der Suche nach der eigenen Authentizität, auf der Suche, sein wahres Gesicht zeigen zu können? Spätestens nach der Ankunft im kapitalisti-schen Arbeitsmarkt ist man klug beraten, inmitten des Kampfes um Anerkennung sein sehnsüchtiges, hassendes, liebendes, gieriges oder verzweifeltes Gesicht seltener zu zeigen. In der Moderne angekommen, benötigen Institutionen das Individuum, je-doch nicht jeden, sondern nur die geeignetsten. Der Wettkampf mit dem selbstbe-stimmten, authentischen Ich, mit seinem wahren Gesicht, rennt schon bald mit dem Ich um die Wette, das Anerkennung, Mitbestimmung und Rechte einfordert und be-nötigt, um existieren zu können und Anerkennung zu erhalten, als unverwechselbarer Mensch. Mit dem Individuum war zugleich die Logik vom Wettbewerb um Einzig-artigkeit und Originalität, spätestens von 1800 an in der Welt. Was als Befreiung für den Einzelnen gedacht war, legte sich als Fesselung um jeden Einzelnen, wie das A. HONNETH mit den Paradoxien der Anerkennung vor Augen führt. “Es mag der alte Motor der Freiheit noch in Betrieb sein, der uns ins Offene entlässt, er treibt unwei-gerlich neue Zwänge hervor.“ Im Angesicht der zunehmenden Ansprüche an Flexi-bilität, an Veränderungen in der Arbeitswelt muss ein jeder im Beruf Erfolg haben, dem beruflichen Tun alles weitere unterordnen. Er muss als Staatsbürger und Rechts-person, als erkennendes Subjekt und als fühlendes und handelndes Individuum zu-rechnungsfähig sein und Verantwortung tragen. 128
Die Suche nach der Übereinstimmung mit sich selbst verwandelt sich in eine fortge-setzte Anpassung an Umstände, die eine andere Echtheit abverlangen als zuvor. (ROSA 2016:299)129 weist darauf hin, dass der moderne Mensch im Kampf gegen Entfremdung und Beschleunigung umfassend geprägt ist. Die Herausforderung ist es, durch äußere, exogene Anregungen, Begegnungen, Wahrnehmungen, z. B. durch Na-turerleben, religiöse, ästhetische, musikalische Erlebnisse oder Sexualität in Reso-nanz gebracht zu werden. In eine Resonanz, mit der Absicht, dass das Individuum seine Selbstwirksamkeit erfährt und erlebt. Das Suchen, das sich auf den Weg ma-chen nach Resonanzen, bleibt ein Leitmotiv, ein starker Antrieb des modernen Indi-viduums, sei es in der Rolle als Konsument, als Partner oder als Mensch, der sich nach einer Selbstverwirklichung im Beruf, im Privaten, im Wohnen und der Freizeit sehnt.
128 Vgl. von Thadden, E. (2014): Bin das wirklich ich? In: ZEIT:Nr.34 vom 14.08.2014, S. 29. 129 Vgl. Rosa, H. (2016): Resonanz. Suhrkamp. Berlin, S. 299-315.
58
Der Preis für eine Ausdifferenzierung der individuellen Lebenslagen wird durch HONNETHS Individualisierungsdiskurs, der in drei Ebenen kategorisiert ist, und da-rin die Ebene der Individualisierung im eigentlichen Sinne, die Ebene der Privatisie-rung und die der Autonomisierung unterscheiden.130
Mit der Ablösung der feudalen durch die bürgerliche Gesellschaft wird das Leistungs-prinzip als soziale Norm zur Bewertung individueller Beiträge gesetzt. „Neben den Menschenrechten und der Anerkennung der Bedürftigkeit stelle es eine dritte Funda-mentalnorm im Selbstverständnis moderner Gesellschaften dar.“131
NECKEL & DRÖGE (vgl. 2002:94) führen weiter aus, dass das Leistungsprinzip Kriterien vorgibt, nach denen materielle und soziale Lebenschancen verteilt, Teilhabe am wirtschaftlichen Reichtum gewährt, Hierarchien im Aufbau und der Organisation begründet und die soziale Ungleichheit zwischen Personen, Gruppen und Klassen gerechtfertigt werden sollen.
Im Grunde genommen steht das Leistungsprinzip im Selbstverständnis moderner Marktgesellschaften dafür, Einkünfte, Zugänge, Ränge und Ämter allein nach den Maßstäben von Wissen und Können zu vergeben, so HONNETH.132
Da ein allgemein verbindlicher Maßstab zur persönlichen Auszeichnung einer Le-bensform unter Bedingungen der Moderne abhandengekommen ist, hängt von der Beschaffenheit des normativen Orientierungsrahmens einer Gesellschaft der Inhalt der sozialen Wertschätzung ab. Damit ist ein dauerhafter soziokultureller Konflikt geebnet. Die Interpretationen der gesellschaftlichen Ziele sind hingegen umkämpft und bleiben historisch variabel.
Die Unablässigkeit, so NECKEL & DRÖGE, mit der moderne Gesellschaften an der Debatte vom Leistungsbegriff festhalten, und der fortgesetzte Dissens, der sich in der Debatte offenbart, dokumentiert, dass Leistung für die moderne Gesellschaft gleich-bleibend von fundamentaler Bedeutung geblieben ist.133
KAMBARTEL lieferte den Verweis auf eine langanhaltende Auseinandersetzung im Pflegebereich, der traditionell als Familienarbeit betrachtet wird und entsprechend
130 Honneth. A. (1994): Aspekte der Individualisierung. In: A. Honneth: Desintegration. Bruchstücke einer soziologischen Zeitdiagnose. Frankfurt a.M., S.: 20-29. Die Ebene der Individualisierung geht davon aus, dass individuelle Lebenslagen nicht mehr nach schicht- oder milieuspezifischen Mustern resultieren, sondern aufgrund der anwachsenden Optionsvielfalt, sowie die nicht-gewählten Kontingenzen, in zentrale und periphere Lebensdimensionen individuell ausdifferenziert sind. Die Privatisierung als mögliche Folge der Individualisierung, geht davon aus, dass sich Gemeinschaften auf-lösen (auch wenn Peergroups und soziale Bewegungen diese teilweise ersetzen), dass zentrale und periphere Lebensentscheidungen für jeden Einzelnen zur individuellen Privatsache wird, weil sie in Folge zunehmender Vereinzelung aus konstitutiven und identitätsbildenden Gemeinschaftsbindungen herausgefallen sind, bzw. sich daraus gelöst haben. Die 3. Eben der Autonomisierung geht davon aus, dass die unendlich große und schwer zu überschauende Vielzahl an Optionen und Kontingenzspielräume von den Einzelnen in einer Weise genutzt werden können, die sie zu größerer, selbstbewusster, reflektierter und im Lichte der je eigenen Lebensgeschichte und Identität vernünftiger Selbstbestimmung befähigt. 131 Neckel, S., Dröge, K (2002) : Die Verdienste und ihr Preis: Leistung in der Marktgesellschaft. In: Honneth, A.: Befreiung aus der Mündigkeit. Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus. Campus. Frankfurt/M., S. 94. 132 a.a.O. Honneth, A. (2003): Umverteilung als Anerkennung, S.: 166. 133 a.a.O. Neckel, S., Dröge, K. (2002). S. 93.
59
nicht anerkannt bzw. geldlich honoriert wird. Im Zuge des Älterwerdens einer ge-samten, zumindest bundesrepublikanischen Gesellschaft, bei gleichzeitig geringen Geburtenjahrgängen, kann dieses Konfliktthema von einem Gerechtigkeits- zu einem gesellschaftlichen Stabilitätsproblem werden.134
Für HONNETH ist der Dauerkonflikt, in dem Gruppen um Einfluss und eine Deu-tungsvormacht werben und buhlen, der Motor für historische Veränderungen, der auf unterschiedlichen Ebenen der Anerkennung stattfindet.135
Es sind nach HONNETH gerade die drei Anerkennungsformen der Liebe, des Rechts und der Wertschätzung, die erst zusammengenommen die sozialen Bedingungen schaffen, unter denen menschliche Subjekte zu einer positiven Einstellung gegenüber sich selbst gelangen können. Denn nur, HONNETH weiter, dank des kumulativen Erwerbs von Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstwertschätzung vermag eine Person sich uneingeschränkt als ein, sowohl autonomes, wie auch individuiertes We-sen zu begreifen und mit ihren Zielen und Wünschen zu identifizieren.136
In dem Buch, The hidden injuries of class, von SENNETH & COBB, das konkrete Hinweise für die Gruppen von Ausgeschlossenen liefert, geht es um die Feststellung, dass sich Konflikte und Kämpfe in Gesellschaften im Wesentlichen um Anerkennung unter den Beteiligten regeln. Anerkennung heißt nichts anderes als die Befürwortung und die Wertschätzung von Subjekten in unterschiedlichen Hinsichten, die wiederum durch gesellschaftliche Produktionsformen und Organisationsweisen festgelegt wer-den. Anerkennung ist ein geeigneter Schlüssel, um sowohl Integration von Gesell-schaften als auch deren dauerhafte Konfliktualität zu verstehen. Alle Gesellschaften integrieren sich durch selektive oder symmetrische Formen der Anerkennung. Alle Gesellschaften kennen dauerhafte Konflikte, um eine angemessene Auslegung und Interpretation dieser Anerkennungsprinzipien vorzunehmen.
In der Geschichte der Bundesrepublik gibt es hierfür viele Beispiele von Bevölke-rungsgruppen, die in unterschiedlichen Epochen einen Konflikt und Kampf der An-erkennung und Wertschätzung geführt haben und noch immer führen. Hierzu gehören nach dem Ende des zweiten Weltkrieges die Gruppen der sogenannten Heimatver-triebenen, die aus Pommern, Preußen, Schlesien, Ost-Brandenburg und dem Sude-tenland zwangsweise mit jeweils 20 kg Handgepäck aussiedeln mussten und im di-rekten Anschluss sowohl um eine geographische als auch personale Anerkennung und Beheimatung gerungen haben. In den 60er und 70er Jahren war es die Gruppe der Gastarbeiter der ersten Generation, die durch den Industrieboom im Nachkriegs-deutschland, ökonomisch motiviert, vorwiegend aus Griechenland, Spanien, Italien und Portugal und wenige Jahre darauf aus der Türkei und dem ehemaligen Jugosla-wien in die Produktionsstätten und Fabriken der BRD angeworben wurden. In den 80er und 90 er Jahren war es dann die Gruppe der sogenannten Russland-Deutschen und die der russisch-jüdischen Kontingentflüchtlinge, die Gruppe der Siebenbürger-Sachsen, die nach dem Niedergang der rumänischen Diktatur unter Ceausescu bzw.
134 Kambartel, Friedrich (1994): Arbeit und Praxis. In: Honneth, A. (Hg.):Pathologien des Sozialen. Fischer. Frankfurt/M., S.123-139. 135 a.a.O. Honneth, A. (2003),S. 159. 136 Honneth, A (2003): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frank-furt/M. Suhrkamp. Sonderausgabe. S. 271.
60
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des „Eisernen Vorhangs“, in die BRD über- und umsiedelten und zwischen zwei Lebenswelten oszillierten, in denen sie einerseits wegen ihrer religiösen-ethnischen Zugehörigkeit unterschiedliche For-men der Missachtung erfuhren und andererseits in der neuen Heimat häufig als un-willkommene, zwar deutschstämmige, aber letztendlich als Bürger 2. Klasse empfan-gen und behandelt wurden. Nach der Wende am 09.11.1989 erlebte dies teilweise eine Gruppe von Bürger der ehemaligen DDR (wie im Falldarstellung 1) und ab Mitte der 90er Jahre eine Gruppe (kriegs)traumatisierter und seelisch notleidender Bürger-kriegsflüchtlingen, die aus Bosnien-Herzegowina (siehe Falldarstellung 4), Kroatien und dem Kosovo, den Gräueltaten des Balkankriegs entkommen konnten, um in der Bundesrepublik Deutschland Schutz, Sicherheit und materielle Grundsicherung zu suchen.
Im Sinne HONNETHS sind die Menschen in ihrer Lebensführung, in ihren Hoffnun-gen und Ängsten darauf ausgerichtet, Anerkennung zu erfahren, geachtet, geliebt und vom anderen wertgeschätzt zu werden. Wenn diese Erfahrung wider- oder versagt wird, die Anerkennung schließlich ausbleibt, leidet der Mensch. Der Zustand von Nicht-Entfremdung ist somit als ein Zustand einer wechselseitigen Anerkennung zu verstehen. Wir fühlen uns wohl, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die wir achten, wertschätzen, respektieren und lieben.
Es gibt aber auch Formen des Leidens, der Entfremdung, die nicht als Missachtung verstanden werden können. Nach ROSA (2014), der die Theorie der Anerkennung mit weiteren Argumenten bereichert,137 bewegen wir uns in einer Welt, die uns ge-genüber stumm, kalt und gleichgültig erscheint. Wir werden durch diese Welt nicht bewegt und können in ihr nichts bewegen.
Ein Zustand von Fremdwerden der eigenen Biographie, wie RIEMANN (vgl. 1987) das beschrieben hat, könnte auch zu einer Entwicklung und in einen Zustand des „Psychisch-Krank-Werdens“ ausgestalten. Im Prozess des Fremdwerdens kann dann Wirklichkeit nur noch als Reaktion durch eine Flucht des Unbewussten in eine bizarre Wahnwelt, in einen Mikrokosmos aus Stimmen-Hören und Eingebunden-Sein oder als Person, die sich selbst für auserwählt hält, sich selbst übermenschliche Bedeutun-gen und Fähigkeiten zuschreibt, ausgehalten, ertragen und gelebt werden.
ROSA schränkt HONNETHS Theorie weiter mit Beispielen ein, sodass es auch zu einem beruflichen, (einerseits besteht eine berufliche Herausforderung, jedoch bei ständig wechselnden Arbeitskollegen), religiösen oder sexuell-körperlichen Fremd-Werden (durch z. B. Transsexualität), und einer Entfremdung ohne offenkundige Missachtungserfahrungen bzw. ohne fehlende Anerkennungsdefizite kommen kann.
ROSA entgegnet HONNETH weiter, dass unsere Lebensführung nicht auf ein Stre-ben nach Anerkennung beschränkt werden kann, denn der Mensch strebt zudem nach Momenten und Erfahrungen des gelingenden Lebens. Er sehnt sich nach Resonanz-momenten, die ihm im Erleben der Natur, der Ästhetik oder in der Musik oder in der
137 vgl. Rosa, H. (2014): Rasender Stillstand -Die beschleunigte Gesellschaft-: Hörbeitrag in SWR 2 Aula am 9.3.2014, S. 5 ff.
61
Religion oder Spiritualität erfahrbar und erlebbar werden können. Das sind die Mo-mente, so ROSA, in denen wir durch etwas Äußeres in unserem Innersten berührt und derart ergriffen werden, dass „Innen und Außen eine räsonierende, konstitutive Ver-bindung eingehen“.
Diese Resonanzmomente können sich jedoch nicht mechanisch reproduzieren lassen. Man kann sich ihnen gezielt und bewusst aussetzen, ohne dabei berührt oder dadurch bewegt, in Schwingung gebracht zu werden. Es kommt im Sinne ROSAS zu einem Verstummen der Resonanzachsen und zu einem Gefühl, zwischen uns und der Welt schleicht sich sukzessive ein Gefühl der Entfremdung ein. Dauerhaft kann es durch ein solches Verstummen zu einem völligen Resonanzverlust, auch zu einem indiffe-renten Zustand der Weltenkontexte kommen, die zu einem Verstummen der Reso-nanzfähigkeit der betroffenen Subjekte führen und durch Formen der Psychopatho-logie (z. B. Depression138, Burn-out-Syndrom, Ängste, Süchte) zum Ausdruck kommen.
Der Pathologiediagnose der Verdinglichung, auf die sich LUKACS, ADORNO und auch HONNETH beziehen, geht ein Prozess voraus, innerhalb dessen die Beziehun-gen zur Welt, den Menschen und Dingen verstummen, erkalten, sich entfremden, ver-festigen und verhärtet werden und so ihre Resonanzqualitäten verlieren.
HABERMAS139 formulierte die Angst vor dem Resonanzverlust und die große Sorge, dass die Lebenswelt durch die systemischen Imperative der Wirtschaft und der Ver-waltung „kolonialisiert“ würde. Er konstruiert die Sphäre der Lebenswelt als eine, die auf Verständigung und lebendigen Austausch angelegt ist. Die Systemwelt dagegen sei eine Sphäre, in der instrumentelle und strategische Kalküle als stumme Imperative dominieren.
Nicht zwangsläufig führen Entfremdungserfahrungen und Entwicklungen sowie die darin begünstigenden Faktoren zu einem Prozess der Verdinglichung, der schließlich in einer psychopathologischen Diagnostik zu münden hat. Dem steht ein Anwachsen der Resonanzsensibilität gegenüber, die sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte me-dial-gesellschaftlicher Entwicklungen herausgebildet hat.
Auf der Grundlage dieses Diskureses muss nun die Frage der Entfremdung der Le-benswelten stets im Zusammenhang der Gruppe der TSSP gesehen werden. Genauer gesagt, ist nun der Fokus darauf zu setzen, wo und wodurch die Entfremdungspro-zesse bei bestimmten Gruppen der Gesellschaft offensichtlich entstehen? Und wie sind diese Prozesse des Ausschlusses, der Exklusion gekennzeichnet? Ferner interes-siert am Beispiel der Population der TSSP, wie aus ihnen eine Gruppe von Exkludi-erten, von Ausgeschlossenen und Überflüssigen innerhalb einer Gesellschaft wird. Ist die Gruppe der TSSP vielmehr als ein repräsentatives Konzentrat, als Barometer einer gesellschaftlichen Diagnostik zu sehen, die Hinweise dafür liefert, welche Werte, 138 Ähnlich wie bei der Geschichte von Herrn Keuner von B. Brecht, in der Herr Keuner durch eine Begeg-nung auf der Straße mit einem Bekannten, den er seit vielen Jahren wiedersieht, feststellt, dass der Bekannte sich im Gegensatz zu ihm offensichtlich verändert und entwickelt habe. Bei sich selbst stellt Herr Keuner, angeregt durch die Reaktion des Bekannten, einen Zustand von Stagnation fest, als sei er in seiner Entwicklung und seinem Dasein eingefroren, indem er keine Höhen und Tiefen erlebt, nicht an der Welt teilnimmt, sondern passiv in ihr wirkt und ist, sich und sie depressiv erlebt und wahrnimmt. 139 Habermas, J. (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1-2.Frankfurt/M. S.163ff
62
welche Identifikationen, Haltungen, Einstellungen, aber auch Zuschreibungen in ei-ner Epoche bestehen? Bilden sie in der Rolle als „Stellvertreter einer Epoche“ durch ihr Anders-Sein, ihr Ausgeschlossen-Sein, durch ihren Lebensausdruck, durch die bi-ographischen Spezifika und Charakteristika lediglich die Symptome einer teilweise entfremdeten Gesellschaft ab, die in Auseinandersetzung mit einer Pathologiediag-nose der Verdinglichung steht?
2.3.1. Theorie der Anerkennung nach HONNETH bezogen auf die Gruppe der TSSP
In der Auseinandersetzung mit den TSSP und den Bemühungen, diese Gruppe in ih-rem Verhalten, ihren Handlungsmotiven, ihren Erfahrungen und ihrer typischen in-stitutionellen Karriere zu verstehen, eingerahmt in einem spezifischen biographi-schen Verlauf, ist es sinnvoll, den Zusammenhang zwischen typischen Fallbeispielen, ihren Wesensmerkmalen und dem Begriff der Anerkennung, wie ihn HONNETH ver-steht, herzustellen.
In der praktischen sozialpsychiatrischen Betreuungsarbeit von Trans-Sektorale-Sys-tem-Prüfenden geht es in einem hohen Maß um eine dauerhafte und perpetuierende Auseinandersetzung mit der eigenen beruflichen Identität, der professionellen Rolle-ninterpretation. Es geht um das Selbstverständnis von Gesundheit und Krankheit, aber auch um die Frage der Auseinandersetzung, einer demütigenden und kränkenden Wirkung von Institutionen auf die Menschen, wie sie MARGALIT (1996)140 be-schreibt, die darin versorgt, betreut, behandelt, geschützt, bestraft, verwaltet, gesi-chert, therapiert oder rehabilitiert werden. MARGALIT untersucht die Bedeutung von Konzepten wie Selbstachtung, Selbstwert, Ehre und Integrität sowie die Frage, wie Demütigungen in Bereichen wie Wohlfahrt, Beschäftigung oder aber auch Bestrafung oder Zwangsbehandlung auf die Menschen wirken, die darin leben und in einem direkten Kontakt darin wirksam werden.
Den Spagat zwischen Personenzentrierung und der lebensweltorientierten Idee von fürsorglicher Belagerung, zwischen Autonomie und freiheitsentziehenden Maßnah-men oder Kontrolle, den die sozialpsychiatrischen Leitideen141 auch vorgeben, gilt es Tag für Tag neu auszuloten. Es gilt, diese selbstreferentiell und reflektierend immer und immer wieder zu überprüfen. Dies geschieht, und orientiert sich maßgeblich am individuellen Handlungs- und Verhaltensrepertoire, am Hilfebedarf des einzelnen Klienten. Die Fähigkeit, ein autonomes und eigenverantwortliches Leben zu führen, orientiert sich am Grad der Bewusstseinsbeeinträchtigung, am Schweregrad der Sui-zidalität, der Fremdaggressivität oder es wird abhängig vom Wirkungsgrad und der Produktivität der Krankheit, z. B. durch eine pathologische Verkennung auch von vertrauten Personen, in einem bekannten Umfeld und Raum, vollzogen. Noch immer
140 Margalit, A (1996): The Decent Society oder übersetzt Goldblum, N: Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung. Suhrkamp. Berlin. 141 Die sozialpsychiatrischen Leitideen geben einen schmalen Grad zwischen Zwang und Freiheit, zwischen Fremdbestimmung und Autonomie, zwischen Gewalt und einem demokratischen, gleichberechtigten Aushand-lungsprozess, zwischen Verantwortung entziehen und Verantwortung zumuten, zwischen ver- und behandeln, zwischen therapeutischem Nihilismus und Zuversicht und Hoffnung auf der anderen Seite und schließlich zwi-schen Defizit- und Ressourcenorientierung sowie zwischen Personenzentrierung und Institutionsorientierung als Handlungsempfehlung im Umgang mit der Klientel vor.
63
sucht die Sozialpsychiatrie nach ihrem Typischen, nach ihrem spezifischen Charak-ter, nach dem Wesentlichen eines sozialpsychiatrischen Umgangs mit der Klientel. Da gibt es Vertreter, die unter der Sozialpsychiatrie nicht das Medizinische, das Pa-thologische, die Bündelung von Symptomketten und die Einordnung in Diagnosen sehen, sondern vielmehr die Reaktivierung der individuellen Ressourcen und Kom-petenzen, das Hervorheben des Sozialen und Anthropologischen innerhalb einer Be-gegnung auf einer Gesprächsebene sehen (siehe Kapitel 4.1.). Da gibt es jene, die sich gegen institutionelle (Macht)Strukturen und eine medizinische Hegemonie und deren Deutungsansprüche in der Behandlung, gegen eine extramural-außerklinische Betreuung und Rehabilitation wehren, und somit das Soziale unberücksichtigt lassen. Es gibt Vertreter, die die Angehörigen und Familien miteinbeziehen oder die sich für die Bedeutung von Arbeit, Beschäftigung aussprechen. Es bleibt aber nach wie vor offen und uneins, eine umfassende Theorie der Sozialpsychiatrie zu beschreiben und die für die Ansätze, Konzepte und die Methodenvielfalt ein Fundament darstellen kann. Die Sozialpsychiatrie bleibt, wie auch die biologisch-medizinische Psychiatrie, auf der Suche nach der Genese, den multifaktoriellen Ursachen und Wirkfaktoren für psychische Erkrankungen. Wiederkehrende Begriffe der Sozialpsychiatrie lauten z.B. Personenzentrierung, soziokulturelle Einflussfaktoren, Salutogenese, Empowerment, subjektorientierte Krankheitskonzepte, Prävention, therapiespezifische Angebote und Gestaltung des strukturellen und sozialpolitischen Rahmens sowie der besondere Bezug auf signifikante Lebensübergänge bzw. Transitionen (z. B. Adoleszenz und junges Erwachsenenleben, Elternschaft, Scheidung und Berentung usw.) und der Ein-fluss auf psychische Gesundheit stellen typische Methoden und Verfahren, Erklä-rungs- und Behandlungsansätze in der Sozialpsychiatrie dar142. Sie stecken die pro-fessionalisierten Handlungsfelder ab und bieten schließlich Anker- und Verortungskonzepte an, auf die sich die Leistungsanbieter, die Adressaten, die Kos-tenträger oder die Angehörigen beziehen können.
Die Theorie der Anerkennung könnte für die Sozialpsychiatrie das gesuchte Puzzle-stück, das Missing-Link, sein, da sie sich sowohl auf signifikante und prägende Pri-märbeziehungen, als auch auf die gesellschaftliche Anerkennung der Individuen in der Moderne und auf die darin möglichen Fehl- und Missentwicklungen, auf die mög-lichen Pathologien des Sozialen, bezieht.
142 E. Wulff (1988) hat hierzu in einem Aufsatz mit dem Titel „Sozialpsychiatrischer Krankheitsbegriff?“ einen Versuch unternommen, das Phänomen „psychische Gesundheit in einem sozialpsychiatrischen Sinne einzubetten und zu charakterisieren. Psychische Gesundheit zeichnet sich als abkürzend zusammengefasst durch die Momente der Geschichtlichkeit (d. h. der Vergangenheits- und Zukunftsbezogenheit), der Struktu-riertheit, der Teilhaftigkeit sowie der Entwicklungsfähigkeit und -möglichkeit wie der Befriedungsfähigkeit aus, und sie beruht auf der Artikulation einer somatopsychisch-psychosomatischen Austauschbeziehung inner-halb eines gesellschaftlichen Verhältnisses. Mit Hilfe solcher Kriterien könnte ein sozialpsychiatrischer Krank-heitsbegriff sich artikulieren, an ihnen muss er sich aber auch messen lassen.“ In: Pfäfflin, E u. a. (Hg.): Der Mensch in der Psychiatrie. Springer. Berlin und Heidelberg, S. 33.
64
2.3.2. Konzept zum Umgang mit der Gruppe der TSSP
In Anlehnung an die Maslowsche Bedürfnispyramide143 entwickelte KENNEDY (2002)144 auf der Grundlage von Studien über traumatisierte Kinder und die Auswir-kungen von belastenden Kindheitserfahrungen auf den Gesundheitszustand bei Er-wachsenen eine erweiterte Hierarchiepyramide, die sich auf unterschiedliche Bedürf-nisebenen von Kindern bezieht und dabei geeignete Handlungsleitlinien anbietet. Sie kommt zu dem Schluss, dass Kinder zunächst und in der höchsten Dosierung Auf-merksamkeit, dann Ermutigung, Begrenzung, positive Lenkung, Ermahnung und schließlich Konsequenz erfahren und erleben sollten, um optimal zu wachsen, zu ge-deihen und sich zu entwickeln. Der praktische Alltag und das konventionelle Selbst-verständnis von Erziehung gehen jedoch meist davon aus, dass ein konsequentes Ver-halten die oberste Handlungsmaxime darstellt und in einer auf den Kopf gestellten Vorstellung Aufmerksamkeit die zuletzt bedeutende Leitlinie im Umgang sein sollte.
Schaubild 1: Bedürfnishierarchie als handlungsleitender Umgang mit der Gruppe der TSSP
143 Maslow hat in einer von 1970 Bedürfnispyramide als Grundlage für menschliche Entwicklung und menschliches Leben in einem aufsteigenden und somit hierarchisch bedeutsamen Sinne, folgende Bedürfnis-komponenten definiert. Zunächst 1. die physiologischen Bedürfnisse (Schlaf, Essen, Trinken, Körperlichkeit), also materielle Grundversorgung, dann 2. ein Sicherheits- und Schutzbedürfnis, 3. soziale Bedürfnisse (Liebe, Zuneigung und Geborgenheit, soziale Interaktionen mit Bezugspersonen, Kontakte und Beziehungen und Kommunikation), 4. Individualbedürfnisse (Wunsch nach Erfolg, Unabhängigkeit und Freiheit aber auch der Wunsch nach Wertschätzung, Achtung und Wichtigkeit), 5. kognitive Bedürfnisse, 6. ästhetische Bedürfnisse, 7. das Bedürfnis zur Selbstverwirklichung und schließlich 8. das Bedürfnis zur Transzendenz auf einer religi-ösen, philosophisch-spirituellenn Ebene. 144 Hilary Kennedy auf einer „home-video“ Tagung 2002 in den Niederlanden/in Reehurst, mit Stephen Church: Was brauchen Kinder?
65
So hat z. B. eine Studie einer amerikanischen Krankenversicherung im Jahr 1995 bei 17.421 Versicherten bezüglich des Zusammenhangs zwischen belastenden Kind-heitserfahrungen (adverse childhood experiences) und dem aktuellen Gesundheits-stand folgende Untersuchungsergebnisse generiert. Zu den belastenden Kindheitser-fahrungen wurden die Faktoren sexuelle Gewalt, psychische und körperliche Gewalt, Kriminalität, emotionale und/oder körperliche Vernachlässigung, Alkoholismus oder Drogen in der Familie, Trennungen oder Tod bzw. Verlust durch Tod in der Familie und psychische Störungen eines Elternteils identifiziert. Die Ergebnisse der Studie hoben hervor, dass, je mehr belastende Kindheitserfahrungen auftraten und sich an-häuften, desto mehr körperliche und seelische Störungen bei den Erwachsenen zu finden waren. Zu den Störungen gehören typischerweise Adipositas, Alkoholabhän-gigkeit, Alkoholabusus, Substanzmittelmissbrauch, Rauchen, Depression, Konsum von Antidepressiva, Halluzinationen, unerklärliche somatische Symptome, Herz- und Kreislauferkrankungen, Suizid, eine verringerte Arbeitsfähigkeit oder geringere Le-benserwartung. Die Untersuchung lässt die Schlussfolgerung zu, dass es offensicht-lich einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen frühen Erlebnissen im Kindesalter und der späteren körperlichen und psychischen Gesundheit von erwachsenen Men-schen gibt. Die belastenden Kindheitserlebnisse überfordern die Verarbeitungsmög-lichkeiten (siehe Kapitel 1.3.1.) des Körpers und des Gehirns. Diese Überforderung führt zur Schädigung des Immunsystems, verhindert eine gesunde Entwicklung des Gehirns und mündet schließlich in psychischen und körperlichen Erkrankungen.
Wenn man nun die Bedürfnispyramide von KENNEDY teilweise uminterpretiert und anpasst an die Bedürfnissen der Bewohnergruppe der TSSP, so steht das einfluss-reichste Bedürfnis und der Wunsch nach Aufmerksamkeit, der den Begriff der Aner-kennung von HONNETH identisch wiedergibt, als fundamentale Grundlage fest. An-erkennung als Mensch, der an einer schweren psychischen Erkrankung leidet und der sich in einem besonderen Maße ein verlässliches, individuell-personenzentriertes und nachvollziehbares Versorgungs- und Behandlungssystem erhofft und wünscht, in dem die Kontakte, die Begegnungen und Kommunikation auf Respekt und Wert-schätzung ausgerichtet sind.
66
Schaubild 2: Grundhaltungen und methodische Handlungsansätze im Um-gang mit der Gruppe der TSSP.
In der Kategorie der Ermutigung liegt zum einen der sozialpsychiatrischen struktu-relle Standard von verlässlichen und flexiblen Hilfen, zum anderen aber auch die Idee des Ansatzes der Zumutbarkeit sozialpsychiatrischen Handelns nach HILDEN-BRAND, in dem gemeinsam mit dem Klienten gefragt, bewertet und eingeschätzt wird, welches Maß an Autonomie und Selbstverantwortung in der gegebenen Lebens-situation als angemessen und sinnvoll erscheint, unabhängig vom Selbstverständnis der Professionellen von „Helfen“. Es ist kein statisches, sondern ein sich stets verän-derndes Maß innerhalb eines stets variablen Kontinuums, auf dem lebensgeschichtli-che Ereignisse und therapeutische Prozesse vorgestellt und bearbeitet werden kön-nen. Diese Ebene der Auseinandersetzung setzt bei den professionellen Helfern ein hohes Maß an Belastbarkeit voraus. Nämlich dem Gegenüber immer wieder auf ihn zurückwerfend, die anstehenden Aufgaben des Alltags einzufordern und abzuverlan-gen, sie nicht stellvertretend abzunehmen, um Zeit zu sparen und Konflikten und Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen.
In der Kategorie der Begrenzung handelt es sich um eine offensiv sich stellende und auseinandersetzungssuchende Haltung. Es geht hierbei darum, auf eigensinnige Handlungen und Verhalten der Adressaten zu reagieren. Die Sicherheit der Klienten, aber auch der Mitarbeitenden ist ein wichtiges Ziel. Autonomie zu üben und dabei eine Selbsteinschätzung mit Vereinbarungen zu prüfen, ob diese umsetzbar und er-reichbar sind. Die Gruppe der TSSP kann sich z.B. im Zuge sogenannter freier Aus-gänge im geschlossenen Heimbereich darin üben, ob sie mit anfänglichen Minuten-intervallen bis zu mehreren Stunden mit ihrer Autonomie und den Vereinbarungen zurechtkommen. Mit Hilfe von Begleitungen durch Mitarbeitende, durch Selbstbe-
67
obachtungsmanuale, einer perpetuierenden Rückfallprophylaxe und einer gemein-same Bewertung des Verhaltens, Erlebens und Handelns von Klient und Mitarbei-tende kann diese Lernerfahrung trainiert, geübt, analysiert und ausgewertet werden.
Auf der Ebene der positiven Lenkung geht es darum, Perspektiven in den einzelnen Lebensbereichen (Wohnen, Freizeit, soziale Kontakte, Haushalt, Selbstsorge, sozial-anwaltliche und finanzielle Aufgaben, Beschäftigung und Arbeit, Gesundheit etc.) herauszuarbeiten und Vereinbarungen zu definieren, um diese zur Erreichung einzel-ner Schritte individuell anzupassen. Bisher Unversuchtes gilt es, inmitten einer un-überschaubaren Optionsvielfalt auch einmal anzuregen. Es gilt aber auch die Ent-wicklungsräume abzustecken und abzugrenzen, die realistisch und in kleinen Schritten und Behandlungsvereinbarungen erreichbar und umsetzbar sind.
Hier ist es von Bedeutung, gerade nicht einem wohlfahrtsstaatlichen Handlungsmus-ter zu folgen, das nach einer fürsorglich-bevormundenden bzw. kontrollierend-für-sorglichen Tradition ausgerichtet ist und sich an einem Disziplinierungsbestreben des Obrigkeitsstaats, aber auch am kapitalistischen Wirtschaftssystem und schließlich ei-ner obrigkeitsangepassten Sozialarbeit und Sozialpädagogik orientiert, wie HOLTMANSPÖTTER das formulierte145. Es geht vielmehr darum, der Phase des methodischen Handelns und der sozialarbeiterischen Intervention eine Phase vorzu-schalten, die nach MASANZ, einem im Schwerpunkt sozialintegrativen Ansatz folgt, der auf die Beobachtung der hochgradig differenzierten Klientel ausgerichtet ist, der den Faktor Zeit, Raum und Struktur maßgeblich berücksichtigt, der die erlebte und gelebte Zeit der Klientel zu verstehen und interpretieren beabsichtigt, der nach einer Verstehbarkeit des Handelns, Wahrnehmens und Erlebens bei den Adressaten ausge-richtet ist und der schließlich bei den Adressaten motiviert, wirbt und anregt, auf der Grunderfahrung von Beziehungs- und Vertrauensarbeit in einen Interaktions- und Kommunikationsprozess ein zusteigen.146
Auf der Ebene der Ermahnung und der Konsequenzen gilt es, der von der Gesellschaft zugedachten Funktion Sozialer Arbeit, nämlich den Spagat zwischen Personenzent-rierung und fürsorglicher Belagerung, zwischen Autonomie und freiheitsentziehen-den Maßnahmen und Kontrollen situationsbezogen und individuell auszuloten und zu entscheiden, um schließlich eine gesellschaftsstabilisierende Zielsetzung, quasi als Puffer zwischen Gesellschaft und den „Ausgeschlossenen„ methodisch anzustreben. Der Puffer ist notwendig, um sozialen Ungleichheiten, z. B. regional und sozialräum-lich unsicheren und unterschiedlichen sozioökonomischen Status oder die migrati-ons- und bildungs- und arbeitslosigkeitsbedingten Schichtunterschiede auszuglei-chen, mindestens abzufedern oder zu lindern.
Die gewählten Interventionen orientieren sich maßgeblich am individuell erworbenen Handlungs- und Verhaltensrepertoire, an den einzelnen Bewältigungsstrategien, am einzelnen Hilfebedarf, der geprägt ist durch die konstituierte Alltags- und Lebens-welt. Sie orientieren sich am Grad der aktuellen Bewusstseinsbeeinflussung durch z. B. Suchtstoffe oder den Einfluss einer psychischen oder somatischen Erkrankung. Sie
145 Holtmannspötter, H.: obdachlos und psychisch krank. Psychiatrie Verlag. 2002 Bonn. S.17 ff. 146 Vgl. a.a.O. Masanz, K. (2008): a.a.O. S. 3-4.
68
orientieren sich am Schweregrad der Störung selbst, am Grad der Suizidalität oder am Grad des fremdaggressiven Verhaltens.
In der Helfer-Klient-Beziehung, die eine Begegnung auf einer Subjekt-Subjekt-Ebene beansprucht, kann es zu einem oszillierenden Verhalten von Verantwortungs-übernahme und Autonomie kommen, in deren Verlauf der Helfer aus der Subjekt-Subjekt-Ebene heraus- bzw. hervortreten muss, um materiellen und gesundheitlichen oder personalen Schaden abzuwenden. Wenn alle psychosozialen Interventionen nicht mehr greifen, ist schließlich ein ordnungsrechtliches Eingreifen, auf der juristi-schen Grundlage von BGB, StGB oder PsychKG die Ultima Ratio. In dieser Situation entscheidet der Helfer für den Klienten, für den er bestenfalls im Rahmen eines pflichtversorgenden Betreuungssettings fallverantwortlich ist. Der Klient durchwan-dert typischerweise alle sechs Ebenen bzw. Dimensionen, die wiederum entsprechend dem Schwerpunkt mit spezifischen Interventionen ausgestattet sein sollen. Auch bin-nen kurzer Zeit kann es zu einem Durchwandern und Schreiten durch mehrere Di-mensionen kommen, die nicht in zeitlich definierten Epochen zu sehen sind, sondern vielmehr situations- und ereignisabhängig oder mit der gesundheitlichen Verfassung korrelieren.
69
3. Kapitel
Exklusion und Exklusionsprozesse
„Die starke internationale Resonanz des Ausgrenzungsgedankens erklärt sich dar-aus, dass er auf die Gefährdung des sozialen Bewusstseins durch die Wiederkehr der gesellschaftlichen Probleme (wie z.B. Arbeitslosigkeit, Armut etc.) abhebt: auf die Erosion der wechselseitigen Abhängigkeiten in der Erwerbsarbeit; auf die Abspal-tung von Gruppen, die in wichtigen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens nicht mehr eingebunden und von Teilhabemöglichkeiten ausgeschlossen sind; auf die wachsenden Schwierigkeiten, aber auch politischen Blockierungen des Sozialstaats, auf diese Erosionen angemessen zu antworten. Daher rührt vor allem auch die At-traktivität des Begriffs Exklusion in Europa. Er ist, stärker noch als der Underclass-Begriff, seinem Wesen nach politisch normativ und diagnostisch in einem.“147
3.1. Exklusion und Inklusion im allgemeinen Sinne
In diesem Kapitel soll sowohl auf einzelne Aspekte der Begriffe Teilhabe, Integration und Rehabilitation, als auch auf das dichotomische Begriffspaar von Inklusion und Exklusion eingegangen werden, die sich allesamt auf die Gruppe der Menschen mit psychischer Erkrankung beziehen.
Nach KASTL (2014)148 gibt es keine anerkannte Anthropologie, der nicht eine un-aufhebbare Ambivalenz menschlicher Beziehungen und damit von sozialer Teilhabe und „Gemeinschaft“ aufgefallen wäre. PLESSNER (2002) nennt das in Anlehnung an KANT die „ungesellige Geselligkeit“ des Menschen und sieht darin ebenso die Möglichkeiten wie die Grenzen des gemeinschaftlichen Miteinanders. Inklusion und Gemeinschaft haben immer ihre harten, strukturellen Grenzen, Integration und Inklu-sion sind niemals vollständig, von Anfang an und völlig voraussetzungslos.149
Das Gegenstandsfeld der Sozialen Arbeit ist nicht klar umrissen. Vorschläge, sie zu fassen, zu beschreiben, in ihrem Wesen, ihrer Methode und ihren Zielsetzungen, un-terbreiten die Theorien der Sozialen Arbeit150, die ebenfalls die inhaltlichen und nor-mativen Positionen ihrer Protagonisten widerspiegeln.
Innerhalb eines organisierten und etablierten Wohlfahrtsstaates, so VON SPIEGEL (2013), werden generelle Exklusionsrisiken seiner Funktionssysteme durch generali-sierte Sicherungspotentiale, wie z. B. durch den Arbeitsmarkt, durch das Gesund-heits-, Rechts-, Erziehungs- oder Politiksystem, bearbeitet. Soziale Arbeit übernimmt hier die Aufgabe einer Auffang- und Zweitsicherung für diejenigen Menschen, die aus diesen Sicherungssystemen herausfallen151 oder auch immer wieder herausfallen,
147 Kronauer, M.: Exklusion. 2. aktuelle und erweiterte Auflage. Campus. 2010 Frankfurt/M., S. 38-39. 148 Kastl, J.M. (2014): Vortrag bei der DGSP Landesverband Baden-Württemberg am 5.2.2014 in Stuttgart: Ganz normal psychisch krank? Inklusion, Integration und die Sozialpsychiatrie, S. 9ff 149 Plessner, H. (2002): Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus. Suhrkamp Verlag. Frankfurt/M., S.249 150 Thiersch/Rauschenbach, Staub-Bernasconi, Niemeyer, Thole, Hamburger, Fussenhäuser, May, Wendt, Heiner, Otto u. a. 151 vgl. a.a.O. von Spiegel, H. (2013) S.22.
70
neu aufgefangen werden (müssen) oder im Verlauf ihres Lebens mit unterschiedli-chen Problemlagen in unterschiedlichen Lebenslagen durch unterschiedliche Felder Sozialer Arbeit im Zuge einer Transinstitutionalisierungen nach Hilfe und Unterstüt-zung suchen, wie das bei der Gruppe der TSSP spezifisch und typisch der Fall ist.
Nach BOMMES und SCHERR (1996) kristallisieren sich drei Funktionen der Sozi-alen Arbeit heraus, so stehe zum einen die Inklusionsvermittlung im Vordergrund als Unterstützung und Hilfe der Adressaten, beim Erwerb und der Aneignung von Fähig-keiten sowie der Motivation die definierten Zugangsbedingungen der Funktionssys-teme zu erfüllen. Die Exklusionsvermeidung sei hingegen als Kernaufgabe der Sozi-alen Arbeit zu verstehen, die einen Ausschluss der zu beratenden, betreuenden und versorgenden Klientel abzuwenden versucht. Hieraus leitet sich eine Exklusionsver-waltung ab, da es zunehmend Menschen gibt, die aus den Funktionssystemen heraus-gedrängt werden, durchfallen und auch keinen neuen Zugang erhalten sollen.152 Das hat zur Folge, dass sich jede professionelle Kraft eine Position, eine Haltung und ein professionelles Selbstverständnis hierzu zu entwickeln habe, welche Funktion sie in ihrem Feld der Sozialen Arbeit ausübe, um eine professionalisierte und berufsgrup-penspezifische Identität zu zementieren, die wiederum großen Einfluss auf Motiva-tion, Engagement und das Selbstverständnis des Helfens und des Nähe-und-Distanz-Haltens ausüben wird.
Die daraus abgeleitete und wesentliche Frage ist nach STAUB-BERNASCONI (2006)153 daraufhin zu stellen, wie diese Aufgaben Sozialer Arbeit ethisch-moralisch zu bewerten sind. Dabei geht sie von der Grundlage aus, dass die Klienten innerhalb unterschiedlicher Arbeitsfelder über individuelle und kollektive Bedürfnisse und Wünsche als psychische und soziale Tatbestände verfügen und diese zum Ausdruck bringen, unabhängig von politischen Definitionen. Hierbei unterscheidet sie zwi-schen legitimen und illegitimen Wünschen. Während die Bedürfnisse befriedigt wer-den müssen, gestalten sich die Hilfen auf die Wünsche begrenzt, denn es gebe illegi-time und legitime, wobei letztere zur Gesundheit beitragen und nicht die Bedürfniserfüllung anderer Menschen beeinträchtigen. Die unterschiedlichen Le-benslagen, Lebensweisen und Deutungsmuster der Adressaten, die zeitlich begrenzt oder auch dauerhaft unfähig sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, Lernprozesse zu bewältigen oder eigene Ressourcen zu erarbeiten, bilden die Kriterien für eine Posi-tionierung gegenüber den Funktionen der Sozialen Arbeit in der Gesellschaft.
Aus der Sicht STAUB-BERNASCONIS ist Soziale Arbeit, orientiert an der UN-Menschenrechtsdeklaration, eine Menschenrechtsprofession, die zwischen Fachkräf-ten und Berufsverbänden aus über 70 Ländern ausgehandelt wurde, innerhalb der die Menschen befähigt werden, ihre Bedürfnisse aus eigener Kraft, d. h. durch geförderte und geforderte Lernprozesse zu befriedigen. Auf der anderen Seite versucht Soziale Arbeit darauf hinzuwirken, dass menschenverachtende soziale Regeln und Werte, be-hindernde Machtstrukturen in begrenzende Machtstrukturen transformiert werden,
152 vgl. Bommes, M. Scherr, A. (1996): Soziale Arbeit als Hilfe zur Exklusionsvermeidung, Inklusionsver-mittlung und/ oder Exklusionsverwaltung. In: Merten et al. (Hg.). S.95 ff. 153 vgl. Staub-Bernasconi, S. (2006): Theoriebildung in der Sozialarbeit. Stand und Zukunftsperspektiven einer handlungswissenschaftlichen Disziplin- Ein Plädoyer für einen integrierten Pluralismus. In: Schweizer Zeitung für Soziale Arbeit. Heft 1. S. 10-36; 26.
71
soweit sie der Sozialen Arbeit überhaupt zugänglich sind. So zählt aus ihrer Sicht die aktive Einflussnahme auf die Wirtschaft, auf das Bildungssystem, auf die Sozialpo-litik und das Rechtssystem zum professionellen Instrumentarium. In diesem Sinne muss Soziale Arbeit ihr Wissen über soziale Probleme für öffentliche Entscheidungs-träger zugänglich machen und sich in sozialpolitische Entscheidungsprozesse über mögliche Problemstrategien (offensiv) einmischen,154 wie das auch THIERSCHS Ansatz der Lebensweltorientierung postuliert.
„Die Hilfe der Sozialen Arbeit ist individuell, also auf verschiedene Fälle zugeschnit-ten. Sie setzt dann ein, wenn generalisierte, versicherbare Absicherungen nicht grei-fen oder einsetzende Exklusionsdynamiken nicht aufzuhalten sind. Als Funktion der Sozialen Arbeit kann also einerseits die stellvertretende Inklusionsvermittlung und Exklusionsvermeidung und andererseits die Exklusionsverwaltung gelten.155
Die Debatte von Inklusion und Exklusion ist meiner Einschätzung nach in erster Linie ein theoretischer Diskurs, der den Status quo der Gesellschaft und die in den unter-schiedlichen Bevölkerungs- und Subgruppen ebenso unterschiedlich entwickelte Ethik der Wertschätzung von Vielfalt, außer Acht lässt. Inklusion als Zielsetzung und Handlungsmaxime im Umgang mit den Ausgeschlossenen und „Überflüssigen“ für eine Gesellschaft zu definieren, ist ein Ideal, dass in erster Linie Orientierung anbie-tet, jedoch mit den tatsächlichen institutionellen Erfahrungen nur eine geringe Kon-gruenz abbilden kann.
Inklusion sollte in meinen Augen nicht als das neue Heilserum ausgerufen werden, das die gesellschaftlichen Widersprüche, die Ungleichheiten und die sozialen Miss-stände durch Soziale Arbeit endlich auflöst und im Gegensatz dazu die bisherigen Bemühungen im Namen der Integration schließlich ad absurdum führt.
Seit es Menschen gibt, gab es immer Gruppen von „Ausgeschlossenen“, von denen sich das Gros der Gesellschaft distanziert, abgegrenzt, sich dagegen gewehrt und diese aus der Mitte der Gemeinschaft hinausgedrängt haben. Eine Gesellschaft, in der alle gleichgestellt sind, gibt es nicht. Innerhalb einer Gesellschaft muss es um das „Anderssein“ gehen, denn wenn alle Menschen vollkommen gleichgestellt sind oder eine Gleichstellung simuliert wird, wo gäbe es dann den, der anders ist, auch anders sein darf? Es geht eher um einen Prozess des Sich-Bewusst-Werdens, dass es Vielfalt und Anders-Sein gibt, dass es Menschen gab und weiterhin geben wird, die darin ihre Identität finden und auf Anerkennung im HONNETHSCHEN Sinne hoffen.
Ein weiterer Gedanke, der Bezug nimmt auf die gesellschaftliche Konzentration des Konsums, verdient es, mit in den Diskurs von Inklusion und Exklusion aufgenommen zu werden.
Es ist vielmehr ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass die Bedeutung von Kon-sum zunimmt, der unseren Alltag vollkommen im Griff hat und in seiner Gesamtheit
154 Vgl. Staub-Bernasconi, S. (2002): Soziale Arbeit und soziale Probleme. In: Thole (Hg.): Grundriss Sozia-ler Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Leske und Budrich. Opladen. S. 254; 245-258. 155 von Spiegel, H. (2011): Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. 4. Auflage. Beltz. München/Basel, S. 26-27.
72
organsiert. Es kommt in der gegenwärtigen Moderne zunehmend, in der Interpreta-tion BAUDRILLARDS (1970), zu einem Prozess der Vereinheitlichung, innerhalb dessen die einst unterschiedlichen Lebensbereiche wie Arbeit, Freizeit, Sexualität und Natur über Begriffe wie Wohlbefinden, Glück oder Selbstverwirklichung in die Sphäre des Konsums gezogen und somit vereinheitlicht werden. Selbst die Katastro-phe gehört dazu: sie wird weniger im eigenen Leben als vielmehr über das Fernsehen erlebt bzw. besser nacherlebt. In Live-Reportagen wird die Katastrophe dramatisiert und aktualisiert aufbereitet und vermittelt dem modernen Menschen die Illusion, an einem besonderen Geschehen teilzuhaben. Dabei sitzt er nur vor seinem Apparat und konsumiert „Bilder“ 156 .
Es wird dem modernen Menschen zudem vermittelt, es gebe in der Welt der Objekte und Besitzgüter eine formelle Gleichheit zwischen allen Menschen. Gerade so, als scheine jeder frei zu sein, sich per Kredit das zu kaufen, was er sich wünscht. In Wirklichkeit ist es eine Gesellschaft der Konsumgüter, die die sozialen Unterschiede zwischen den Menschen nur noch verfestigt. BAUDRILLARD unterstellt der Politik und Wirtschaft, daran auch gar nichts (ver)ändern zu wollen. In einer virtuellen Welt taucht man in Spielwelten ein oder Kraft heroischer Figuren mit anderen Identitäten ab, sodass das eigentliche Erleben droht, in eine tiefe Bedeutungslosigkeit zu versin-ken.
Man könnte sagen, dass in besonders polarisierender und offensichtlicher Ausprä-gung das Identitätserleben der Gruppe der TSSP stellvertretend für eine moderne Ge-sellschaft steht, in der sie sozialisiert ist, in der sie beschädigt wurde und in der sie zu leben hat. Man könnte sagen, dass die von den TSSP erlebte Realität durch eine Pa-thologisierung ihres Selbst, durch einen Prozess des „Fremd-Werdens“ ihrer Biogra-phie, ihres Lebensentwurfs und erlebten Lebens verzerrend, beeinflussend und stö-rend, erfahren und wahrgenommen werden kann. Man könnte mit BAUDRILLARD sagen, dass das Reale verloren gegangen oder gar vollständig verschwunden ist, da das Reale aber einen Anfang voraussetzt und eine Zweckbestimmtheit, die im Verlauf der Pathogenese, der Lebensübergänge abhandengekommen sind; da das Reale eine Vergangenheit, eine Zukunft, Kontinuität, Ursachen und Wirkungen voraussetzt157, offenbaren sich gerade in der charakteristischen Beschreibung der Gruppe der TSSP die möglichen ätiologischen Ursachen und Problemlagen der Exklusionsdebatte.
Die Gruppe der TSSP steht quasi stellevertretend dafür, dass es ein Anders-Sein gibt, ja sogar geben muss. Selbst die Gruppe der Professionellen, die sich über einen lan-gen Zeitraum nicht ausreichend genug mit dieser Gruppe auseinandergesetzt hat, steht nun in der Versorgung des praktischen Arbeitsfeldes vor der Aufgabe, wie der Rahmen, der Umgang, die Angebote, die Perspektiven zu gestalten sind und in wel-chen Bezügen darin sozialpolitische, historische und gesellschaftliche Wechselwir-kungen eine Rolle spielen.
156 vgl. Baudrillard, J. (1970): Die Konsumgesellschaft. S. 25, 27, 31. 157 vgl. Baudrillard, J. (1996): Das perfekte Verbrechen. Matthis & Seitz. Berlin
73
Aus der Geschichte der Psychiatrie ist bekannt, dass auch der Umgang mit z. B. Men-schen mit psychischer Krankheit mit einer räumlichen Ghettoisierung und Asylbil-dung bis hin zu einem staatlichen, gesellschaftlichen und medizinisch gewollten sys-tematischen Töten (durch Hungern, Medikamente, Giftgas, durch Arbeitslager, Menschenversuche) in den Jahren 1908 bis 1946 einhergegangen ist. Unter den Op-fern waren Waisen, geistig oder körperlich Behinderte, Wohnungslose, Häftlinge, re-ligiöse oder ethnische Gruppen, Anstaltsinsassen, Kinder, Jugendliche, Frauen, Män-ner und alte Menschen.
Der Exklusionsdiskurs soll ein aktiver und praxisorientierter Anstoß dafür sein, die strukturellen Defizite, die für die Zugänge von psychisch kranken Menschen in die Gesellschaft existieren, zu identifizieren und abzubauen. Zudem soll er die hierfür benötigten Ressourcen, die sozialrechtlichen Veränderungen und geeigneten Anpas-sungen innerhalb der Sozialverwaltung, die die Kosten trägt, auf den Weg bringen und vorstellen.
Psychiatriehistorisch betrachtet gab es bereits vor über 150 Jahren Ansätze und Mo-dellversuche, „Gemüts- oder Nervenkranke“ in Familien zu integrieren, mitten in die Gemeinde zu führen, sie in die unmittelbare Nachbarschaft einzubeziehen und sie mit einfachen Tätigkeiten im Haushalt, auf dem Hof oder im Garten, z. B. in den damals gegründeten Hilfsvereinen, in der Familienpflege zu beschäftigen und zu begleiten. Die Bereitschaft der Gesellschaft, „Verrückte“ im Rahmen der offenen Irrenfürsorge zu betreuen, stieß vor dem Ersten Weltkrieg sicher auf eine größere Akzeptanz, als das dann bis in das Jahr 1946 hinein der Fall war. Die Versorgung und Behandlung der Klientel fand lange Zeit in ländlich geprägten und dezentralen Großkrankenhäu-sern statt.
Die ersten Versuche, psychisch Kranke in Familien, in der Gemeinde zu betreuen, sind lange Zeit innerhalb einer medizinisch-biologistischen dominierenden Psychiat-rie in Vergessenheit geraten und rückten erst lange nach der dunklen Epoche der Eu-thanasie wieder in das Bewusstsein der deutschen Psychiatrieversorgung. Die zent-rale Frage lautet, ob und wie die Gesellschaft mit psychisch Kranken zusammen leben, zusammen wohnen will? Will sich die Gesellschaft, im Sinne einer wechsel-seitigen Zumutbarkeit und Toleranz einer Gruppe des Unterschiedlich-Seins oder An-ders-Sein, die nur eingeschränkt beruflich belastbar ist oder durch andere soziale Be-sonderheiten charakterisiert ist, auseinandersetzen? Ist die Gesellschaft bereit, sich ihren Vorurteilen, Ängsten und Befürchtungen zu stellen, sich damit zu konfrontie-ren? Oder bevorzugt sie ein Dasein der „Überflüssigen“, das lieber weit entfernt, au-ßerhalb der Gesellschaft, nach dem Leitmotiv „Aus den Augen, aus dem Sinn“ statt-findet?
Der gegenüberliegende Pol der Inklusionsdebatte ist durch den Begriff der Exklusion besetzt. Auch der Begriff der Exklusion umspannt mehrere Aspekte und Verständ-nisebenen. Die von Exklusion, Ausgrenzung, Ausgliederung oder Ausgeschlossen-Sein betroffene Gruppe kann sich auf Arbeitsmigranten, Kranke, Behinderte, ethni-sche Minderheiten oder kulturelle Kleingruppen beziehen, die für die Gesellschaft als überflüssig betrachtet werden, jedoch in gleiche sichtbare soziale Zustände und un-terprivilegierte Lebenslagen geraten, eventuell auch in ähnliche existenzielle Lebens-umstände.
74
Der Prozess des Überflüssigwerdens setzt sich nach BUDE158 aus einem zusammen-hängenden Cluster von Problemen zusammen, dass die Arbeit, die Familie, Instituti-onen oder den Körper zusammenbindet. Es ist aber auch eine Clusterbildung, die in einer desaströse Karriere aus gesellschaftlichen Anerkennungszusammenhängen her-ausführen kann.
Während in der UN-Behindertenrechtskonvention der Begriff von Inklusion geprägt und verwendet wird, wird in der deutschen Übersetzung von Integration gesprochen. Integration basiert auf dem Normalisierungsprinzip und bemüht sich gemäß der Leit-idee um einen aktiven Einbezug von Menschen mit Behinderung in gesellschaftliche Abläufe und Prozesse und Teilhabe. Der Integrationsgedanke ist zudem als Entwick-lungsschritt in einer gesamten Epoche zu verstehen. Integration zielt auf Anpassungs-bemühungen an die Norm ab, sie beansprucht, eine Leitkultur zu sein. Die Integrati-onsmöglichkeiten im Bereich Wohnen, Arbeit oder kulturelle Teilhabe sind vom individuellen Integrationsgrad des jeweiligen Menschen mit Behinderung abhängig (readiness-Modell). Das Integrationsmodell geht von zwei gesellschaftlichen Grup-pen aus: diejenigen, die zu integrieren sind, und jene, die integrieren. Was ist aber, wenn die Gruppe, die integriert werden soll, nicht will? Was ist, wenn die Gruppe, die integrieren soll, nicht bereit ist, diese Bemühungen auf sich zu nehmen, oder für diese Leistung nicht motiviert ist oder einfach ablehnt? Was ist, wenn sie weder ei-gene Motive oder eine innere Motivation oder Bestreben erkennen können?
Inklusion, so WUNDER (2010)159 weiter, stellt die vorbehaltlose und nicht weiter an Bedingungen geknüpfte Einbezogenheit und Zugehörigkeit dar. Der leitende Ge-danke ist die Gemeinschaft aller Menschen in einer Region oder in einer Lokalität, die innerlich differenziert und vielgliedrig ist und sich durch Diversity auszeichnet. Adornos Reflexionen über Auschwitz, in denen er das Leitprinzip „Miteinander des Verschiedenen“ einer freien Gesellschaft formuliert, könnte so WUNDER, der Ur-sprung dieses Diversitätskonzeptes sein. Die Achtung des anderen in seinem So-Sein führt auch dazu, dass grundsätzliche Gedanken über den Begriff von Gesundheit und Krankheit, als Auseinandersetzung der Haltung, vorangestellt werden.
Inklusion bezieht sich im allgemeinen Sinne auf strukturelle, meist rechtliche, orga-nisatorische (z. B. auf Mitgliedschaften), politische (z. B. das seit über 100 Jahren bestehende Frauenwahlrecht) oder ökonomisch gesicherte grundsätzliche Möglich-keiten, an bestimmten sozialen Kontexten zu partizipieren, bzw. darin einbezogen zu sein. Im 3. Buch Mose z. B. besteht ein Verbot für Menschen mit Behinderung das Priesteramt zu bekleiden. Somit wird dieser Gruppe der Zugang, unabhängig von der Eignung, per se verwehrt, und es kommt zu einem Ausschluss, einer Exklusion für dieses Amt, und die Person wird zum Ausgeschlossenen.
Man kann nicht mehr oder weniger inkludiert oder exkludiert sein, somit sind die Begriffe Inklusion und Exklusion nur als dichotomes Kategorienpaar sinnvoll, da sie ein komplementäres Begriffspaar darstellen, das in der Folge die Einteilung eines
158 Bude, H.: „Die Überflüssigen“-Ein Gespräch zwischen D. Baecker, H. Bude, A. Honneth und H. Wiesent-hal: Exklusion. Suhrkamp. 1. Aufl. 2008 Frankfurt/ M. S.. 31 ff. 159 Wunder, M.: Inklusion-Eine Frage der Kultur. In: Wittig-Koppe, Holger (Hg.): Teilhabe in Zeiten ver-schärfter Ausgrenzung. Paranus Verlag. Neumünster: 2010; S. 22ff
75
Gegenstandsbereiches in zwei einander komplementäre Bereiche bzw. Begriffe be-zeichnet.
Einzelpersonen, Gruppen, Familien können besser oder schlechter integriert sein. Der Bezug ist stets die Frage nach der Qualität der Einbeziehung einer Person in einen sozialen Zusammenhang bzw. der Qualität der Einbindungen dieses Zusammenhangs als solchen. Eine schlecht integrierte Gruppe hat z. B. Einschränkungen an Bindun-gen, Kommunikation oder Konfliktregulierungsmöglichkeiten oder Anpassungskom-petenzen. Sie verfügt markanter Weise über wenige Ressourcen bzw. kann diese nicht in der geeigneten Situation abrufen.
Die strukturellen Möglichkeiten der Teilnahme und die faktische Qualität der Teil-nehmer sind jedoch auseinanderzuhalten, da man z. B. inkludiert sein kann, aber schlecht integriert, wie das in inklusiven Schulformen der Fall sein kann.
Die beruflichen Integrationsbemühungen der „Ausgeschlossenen“ in den ersten Ar-beitsmarkt werden von VAN BERKEL/ROCHE (2002)160 als der Königsweg in die Inklusion bezeichnet. Dabei wird Inklusion auf das Grundverständnis von Integration in den Arbeitsmarkt verkürzt, also Arbeit für alle Menschen, unabhängig davon, wel-cher Preis zu zahlen und mit welchen Auswirkungen zu rechnen ist. So entsteht aus einem solchen Verständnis von sozialer Exklusion heraus, dass soziale Schutzrechte gegen andere Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenschancen benachteiligter Be-völkerungsgruppen ausgespielt werden.
Die Soziologie stellt Inklusion und Integration als komplexe gesellschaftliche Sach-verhalte dar, die sich nur begrenzt politisch und sozialpädagogisch steuern und be-einflussen lassen. Während sich Inklusion auf die strukturelle Zugänglichkeit sozialer Systeme bzw. von Menschen zu ihnen bezieht, bezieht sich Integration, wie ESSER (2000)161 definiert, auf die Qualität der in sozialen Systemen wirksamen Bindungen und Einbindungen, also auf deren Zusammenhalt. Die Zugehörigkeit bzw. der Zu-gang und die Einbindung bzw. die Beschaffenheit des Zusammenhalts sind unter-schiedliche Ebenen.
Einige der wesentlichen Aspekte sind genannt. Nun gilt es, sich mit dem anderen „negativen“ und nicht gelingenden Begriff des dichotomen Kategorienpaars, nämlich der Exklusion, die einen Prozess beschreibt, auseinanderzusetzen bzw. sich diesem zu widmen.
160 van Berkel, R./Roche, M. (2002): Activation Policies as reflexive social policies; in: Moller Hornemann, Ivar (eds.): Active Social Policies in the European Union Bristol (Policy Press), S. 207. 161 Esser, H.(2000): Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 2.Die Konstruktion der Gesellschaft. Campus. Frankfurt/M.- New York.
76
3.2. Exklusionsprozesse
Am Beispiel von nicht gelingenden, negativen institutionellen Patientenkarrieren und Krankheitsverläufen können Faktoren und Merkmale identifiziert und beschrieben werden, die Exklusionsprozesse begünstigen und forcieren und somit soziale Aus-schlussprozesse verstärken und befördern können.
Ende der 80er Jahre kam der Begriff der Exklusion erstmals im Kontext arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Diskurse in Anlehnung und als Kontrapunkt der westeuropäi-schen Nachkriegsperiode mit Vollbeschäftigung, zurückgehender Armut, der Aus-weitung sozialpolitischer Absicherung und expansivem Konsum auf. Une exclusion (franz.) wird mit Ausschluss, Ausgrenzung, Ausklammerung oder Ausgliederung übersetzt. Dieser Begriff wird als antagonistischer Begriff zur Inklusion und heute in der Soziologie in Anlehnung an den WEBERSCHEN Begriff der sozialen Schließung verwendet.
Nach PARKIN (1983) gehe es WEBER bei der sozialen Schließung „ (…) um einen Prozess durch den soziale Gemeinschaften Vorteile zu maximieren versuchen, in dem sie den Zugang zu Privilegien und Erfolgschancen auf einen begrenzten Kreis von Auserwählten einschränken. Das führt dazu, dass bestimmte, äußerlich identifizier-bare soziale und physische Merkmale als Rechtfertigungsdruck für den Ausschluss von Konkurrenten hervorgehoben werden.“ WEBER nimmt weiter an, dass praktisch jedes Gruppenmerkmal, wie z. B. Rasse, Sprache, soziale Herkunft, Abstammung „ (…) herausgegriffen werden kann, sofern es nur zum Monopolisieren bestimmter, in der Regel ökonomische Chancen benutzt werden kann. Die Monopolisierung richtet sich gegen andere Mitbewerber mit der Zielsetzung in irgendeinem Umfang stets
Zwischenfazit: Die Gruppe der TSSP erfährt sowohl durch eine Vielzahl an charakteristischen Merkmalen (z. B. ethnisch oder kulturelle Minderheit) als auch durch beeinflus-sende Faktoren (niedriger sozioökonomischer Status, Armut, Krankheit oder Be-hinderung in der Familie usw.), die sie zu einem Anders-Sein werden lassen, in ihrer möglichen biographischen Entwicklung und Sozialisation eine Drift aus der Gesellschaft. Gerade am Beispiel der TSSP können in einem konzentrierten und fokussierenden Sinne die strukturellen Einflussgrößen beschrieben und identifi-ziert werden, um Handlungsempfehlungen und methodische Ableitungen zu ge-nerieren. Die bundesrepublikanische Gesellschaft organisiert sich nach (vgl. BOMMES & SCHERR (1996): 99) an den Erfordernissen der Wertmehrung und nicht an den Bedürfnissen der Menschen. Jeder Mensch befindet sich zunächst außerhalb aller Funktionssysteme (z. B. Familie, Schule, Berufsausbildung, Nachbarschaft, Arbeit, Sozialsystem) und muss daran arbeiten, sich einen Zu-gang in die Systeme zu verschaffen, denen er angehören möchte oder auch soll.
77
Schließung der betreffenden (sozialen und ökonomischen) Chancen gegen Außenste-hende.“162
Eine weitere Form von sozialer Exklusion ist nach DAHRENDORF (1965) die Chan-cenungleichheit beim Zugang von Schule und Bildung. Er postulierte deshalb Bil-dung als Bürgerrecht in seinen Schriften und setzte sich für mehr Gerechtigkeit und die Förderung für alle sozialen Schichten an der Teilnahme und dem Erfolg von Bil-dungskarrieren ein.
SIMMEL hat schon vor annähernd 90 Jahren innerhalb einer Auseinandersetzung am Beispiel der Armen hervorgehoben, dass das Drinnen und Draußen ihn nicht als lo-gischen Gegensatz interessiere, sondern als soziales Verhältnis und als solches ist es nicht durch einen wechselseitigen Ausschluss, Drinnen oder Draußen, sondern als Gleichzeitiges gekennzeichnet, als ein Drinnen und Draußen.
Eine bundesweite Anti-Diskriminierungspolitik und Gesetze zur Geschlechtergleich-stellung (s. Gender-Mainstreaming) zielen auf ein Verbot ethnischer, rassischer, reli-giöser, sexueller oder kultureller Diskriminierung ab. Sie beabsichtigen einen Schutz von Menschen mit Behinderungen, von Menschen, die von Wohnungslosigkeit be-troffen oder bedroht sind. Sie wollen einen Schutz für Menschen, die ehemals im Straf- oder Maßregelvollzug inhaftiert waren, die suchtkrank oder suchtgefährdet sind oder sexuell divers orientiert bzw. geprägt leben.
Die Kategorie der sozialen Schließung, der Ausschließung, bezeichnet einen grund-legenden sozialen Sachverhalt, der sich nicht beseitigen lässt. Denn alle sozialen Be-ziehungen beruhen darauf, dass sie bestimmte Personen einbeziehen, andere außen vor oder zielgerichtet fernhalten. Problematisch wird es erst dann, wenn es zur phy-sischen Einschließung im Sinne von erzwungener räumlicher Immobilität kommt, wie es im Haft- oder Maßregelvollzug, in psychiatrischen Kliniken oder in geschlos-senen Heimen für Kinder oder für Menschen der Fall ist, die als eigengefährdet, psy-chisch kranke oder suchtkrank diagnostiziert werden oder eine Gefahr für die Allge-meinheit darstellen.
Problematisch wird es, wenn es durch physikalische Ausschließung, zu einer erzwun-genen räumlichen Mobilität kommt (z. B. bei wohnungslosen Menschen oder bei eth-nischen Minderheiten wie Sinti und Roma, Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen) oder es durch soziale Schließung zu einer Ressourcenkonzentration kommt, die auf wenige andere monopolisiert (Kluft Arm und Reich, Essen, Nahrung, Maschinen, Tiere) wird. Weitere Formen räumlicher Schließung beziehen sich auf Ghettos, sozi-ale Brennpunkte mit niedrigem sozioökonomischen Status und signifikant qualitativ und quantitativ geringerer Ausstattung, sowie auf alle Formen von totalen Institutio-nen (z.B. Gefängnisse, Kloster, Psychiatrische Kliniken oder das Militär), die GOFFMAN (1973)163 beschrieben hat.
162 Weber, M. (1964): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Studienausgabe. Herausgegeben von Johannes Winkelmann. Köln/Berlin, S.260. 163 Goffman, Erving (1973): Asylums. Essays on the Social Situations of Mental Patients. 1. Auflage. Frank-furt am Main
78
GOFFMAN verwendet den Begriff in der Darstellung der Mittel zur Eroberung und Durchsetzung von Macht. Dies geschieht durch physikalische Einschließung, das Er-zwingen von räumlicher Mobilität oder durch soziale Ausschließung von Ressourcen (z. B. die Schlüsselmacht für die Aus- und Eingänge, der exklusive Zugange zu Geld, Medikamenten, Telefon oder auch Wissen und spezifischen Informationen), die wie-derum andere Privilegierte (z.B. Pflegekräfte, professionelle Akteure des Arbeitsfel-des der Psychiatrie, des Haft- oder Maßregelvollzugs) monopolisiert haben.
In der Auseinandersetzung mit Exklusion geht es auch um eine Teilhabe an sozialge-sellschaftlichen Prozessen, um die Zugehörigkeit a.) zum Bürgerstatus, der ausgestat-tet ist mit persönlichen, politischen und sozialen Rechten; b.) zu der Einbindung in die objektivierte/objektivierende Wechselseitigkeit der gesellschaftlichen Arbeitstei-lung und schließlich c.) zu den Reziprozitätsverhältnissen in sozialen, familiären und verwandtschaftlichen Nahbeziehungen.
KRONAUER (2002) führt drei weitere Aspekte in der Exklusionsdebatte an, nämlich den Ausschluss vom schulischen Leben, vom beruflichen Leben und schließlich den dauerhaften und kategorischen Ausschluss vom Arbeitsmarkt. Gerade an diesen mar-kanten biographischen Übergängen ist die Gruppe der TSSP besonders vorbelastet und beeinträchtigt, da z. B. die ersten initialen Symptome der Prodromalphase in der Adoleszenz, die bereits im Schnitt drei bis sieben Jahre vor Ausbruch der Krankheit wirken, auf einen frühen Ersterkrankungsbeginn hinweisen und somit sowohl die schulische Qualifikation als auch die daran anknüpfende berufliche Entwicklung ne-gativ beeinflussen. Innerhalb dieses Prozesses kommt es zu einer erhöhten Belastung und Drucksituation, die auf die Familie einwirken und diese sich dann in der Folge droht evtl. aufzulösen. Die sozial-familiären Bindungen werden einer Drift zur Frag-mentierung ausgesetzt. Freundschaften werden vernachlässigt, es kommt u. U. zum Bruch und schließlich zu Verlust und Abwendung der Primärfamilie, die bei der Gruppe der TSSP meist unvollständig (durch z. B. Trennung, Scheidung, schwere somatische oder psychische Krankheit, durch Suizid, Haft etc.) ausgestattet ist.
In diesem Zusammenhang ist, im Sinne KRONAUERS,164 auch der Exklusionsbe-griff als Kategorie zu verstehen, die zu einer bedeutsamen Zuspitzung der sozialen Frage von heute führt. In ihr liegen sowohl die Frage der gesellschaftlichen Zugehö-rigkeit, der Teilhabe als auch ihre Voraussetzungen verborgen. Dies steht schließlich im Zusammenhang mit der grundsätzlichen Frage der Demokratie, die wissen will, ob die persönlichen und politischen Rechte durch materielle und soziale Teilhabe ab-gesichert sind. Exklusion ist als Schlüsselbegriff für die Analyse der Gegenwartsge-sellschaft zu verstehen, weil dieser Begriff allen anderen dafür ebenfalls notwendigen Begriffen wie denen der Verwundbarkeit, des Prekariats und der Verunsicherung die entscheidende Frage und den Problemhorizont von gesellschaftlicher Teilhabe und Demokratie vorgibt.
In der Debatte zur In- oder Exklusion steckt die soziale Frage der Gegenwart schlechthin, die die einstige Arbeiterfrage im 19. Jahrhundert abgelöst hat. In der
164 http://www.soziologie.uni-jena.de/soziologie_multimedia/Downloads/LSDoerre/KronauerMartinBE. pdf, S.: 4, Download vom 23.04.2014.
79
Auseinandersetzung mit den Kräften und Faktoren, die eine Exklusions-Drift beför-dern und begünstigen, sind nicht nur individuelle und intersubjektive Faktoren, son-dern darüber hinaus auch gesamtgesellschaftliche, sozialpolitische und juristische Entwicklungen zu betrachten und zu berücksichtigen. Es geht hier auch darum, der Frage nachzugehen, warum sich die bundesrepublikanische Gesellschaft zunehmend unsicher fühlt bzw. warum sie in vielen Bereichen größte Unternehmungen aufbringt, um ihrem wachsenden Sicherheitsbedürfnis nachzukommen. Die einstige soziale Frage des 19. Jahrhunderts wird durch verfehlte Integrationsanstrengungen zu kom-pensieren versucht. Der Begriff der „sozialen Frage“ bezeichnet die sozialen Miss-stände, die mit der Phase der industriellen Revolution einhergingen und inhaltlich die sozialen Begleiterscheinungen und Folgeprobleme des Übergangs von einer agrarge-sellschaftlichen hin zu einer urbanen Industriegesellschaft beschreiben und so durch die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts ersetzt werden. Die soziale Frage des 21. Jahrhunderts bezieht sich auf die verfehlten Integrationsanstrengungen einer an so-zial- und marktwirtschaftlichen und wohlfahrtsstaatlichen Prinzipien orientierten Ge-sellschaftsstruktur. Es geht um die Verwerfungen, um die fortwährenden Ungleich-heiten und die ungerechten Verteilung von Gütern und Materialien und um eine Chancengleichheit in der Bildung. Trotz gutgemeinter Integrations- und Inklusions-absichten, die seit 03.05.2008 in der UN-Behindertenrechtskovention gesetzlich ver-ankert sind, ist die soziale Frage als zentrale zivilisatorische Frage, neben der Klima-frage, zu verstehen. Sie ist in einem ansteigenden Sinne bemüht, exkludierenden Prozessen entgegenzuwirken und versucht schließlich, die umfassenden Folgen zu mindern, abzuschwächen, bestenfalls sozialrechtlich zu kompensieren und anzuer-kennen.
Das bedeutet, Exklusion ist einerseits als Status bzw. Ausgestattet-Sein eines exklu-dierten Menschen zu verstehen und zu begreifen, der aus der subjektiven Perspektive der Person eine marginalisierte und segregierte Position beschreibt. Andererseits ist der exkludierte Mensch gesellschaftlich ausgegrenzt u. U. von schulischen Qualifi-kationen, von Ausbildung, von Arbeit, von einem gesicherten Wohnraum, von Kon-sum, von sozialen Beziehungen und kultureller Teilhabe. Als nicht mehr verwer-tungsgeeignete Person ist ihre Exklusion aber auch der auf sie einwirkende Prozess zu verstehen, der den Weg an den Rand der Gesellschaft führt, beschreibt und bein-haltet.
Die Frage, die hier auch von Interesse ist, lautet, wie werden Exklusionsprozesse bei der Patientengruppe der TSSP beeinflusst, begünstigt, befördert und verstärkt?
Selbstbestimmung, so WUNDER165, ist dann gegeben, wenn mindestens diese drei Anforderungen erfüllt sind: 1. anders können, 2. Gründe haben, 3. die eigene Urhe-berschaft anerkennen. In der Erweiterung des Begriffs können unter der Vorausset-zung von Selbstbestimmung noch die Abschätzung der Folgen und damit die Verant-wortung und die Verantwortlichkeit der Entscheidung zählen. Wenn wir von selbstbestimmten Aktivitäten sprechen, müssen die Folgen der eigenen Entscheidung abgeschätzt werden können. Es ist ein Unterschied, ob dies im Nahbereich geschieht, wenn die Folgen zu meinem Vorteil sind oder in meinem Wohlsein, oder in einem
165 vgl. Wunder, Michael (2011): Fürsorglicher Zwang. Eine ethische Herausforderung in der diakonischen Praxis. S. 3.
80
mittleren Bereich, wo es um Folgen für mich und mein Umfeld geht. Oder ob es um den Fernbereich geht und die Folgen auf die Gesellschaft bezogen werden.
Berufliche, medizinische, finanziell-materielle, genderspezifische, sozial-familiäre oder (sozial)rechtliche Aspekte spielen in dem vorrangig soziologisch orientierten Diskurs von Exklusion versus Inklusion konkreter alltags- und lebensweltorientierte Themen eine wichtige Rolle und decken bzw. bilden die gesamte Palette an Lebens-bereichen des Menschen ab.
WALDSCHMIDT (2012:16ff) führt in ihrer von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes publizierten Studie zu „Barrierefreie Dienstleistungen und Benachteiligun-gen von behinderten Menschen beim Zugang zu Dienstleistungen privater Unterneh-men“, eine Vielzahl von Lebensbereiche, Aspekte, Hindernisse, Beeinträchtigungen und Problemstellungen auf, die einen Weg in Richtung eines neuen Denkansatzes der Behindertenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland ebenen und befördern könn-ten.166
Die bestehende Auseinandersetzung der BRD, die sich an dem marktorientierten westeuropäischen Modell orientiert, beschreibt, im Gegensatz zu anderen europäi-schen Ländern, die durch ein staatsorientiertes Modell geprägt sind (wie z.B. in den Niederlanden, Dänemark, Norwegen), noch immer die Schlüsselherausforderung, dass fehlende oder geringe Chancen von Menschen mit Behinderung auf das Vorhan-densein gesundheitlicher Einschränkungen und somit einer daraus resultierenden ge-ringeren Leistungsfähigkeit, ästhetischen Abweichung und kommunikativen Defizi-ten zurückgeführt werden.
Behinderung „verkarstet“ in diesem Selbstverständnis lediglich zu einem individuel-len Merkmal, in dem Behinderung zum einen als Schädigung, zum anderen als Funk-tionsbeeinträchtigung, nicht jedoch als Verhalten der übrigen Gesellschaft begriffen wird, das schließlich dazu beiträgt und aufrechterhält, dass „Behinderte“ dieselben Zugänge zur Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen, beruflichen Leben gewährt bekommen wie Menschen ohne Behinderung. Noch immer wird in der bundesrepub-likanischen Gesellschaft Behinderung als technische, (sozial)rechtliche oder medizi-nische Differenz gesehen und auch als eine stigmatisierende Zuschreibung benutzt. Dies geschieht gerade so, als müsse eine scharfe Trennlinie geschaffen werden, die aufzeigt und deutlich macht, wer den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wird und wer mit einer Behinderung ausgestattet ist bzw. versehen wird, weil er nicht den normalen, üblichen Leistungsanforderungen und Anpassungserwartungen nach-kommt, u. U. auch nicht nachzukommen bereit ist.
Zwischen Behinderung und Nichtbehinderung besteht keine klare Grenze, sondern ein Kontinuum. Somit ist selbstverständlich davon auszugehen, dass Rechte für Men-schen mit Behinderung prinzipiell Rechte für jeden sind.
Auf Seiten des Staates und der Gesellschaft löst Behinderung, so FREHE (2006:80-89), Fürsorgemechanismen aus, um die „hilflosen Menschen“ zu unterstützen und zu
166 Waldschmidt, Anne/Müller, Arne (2012): Expertise der Uni Köln für die Antdiskriminierungsstelle des Bundes.
81
versorgen. Dies geschieht jedoch im Rahmen von Rehabilitations-, und Eingliede-rungsanforderungen nach dem Prinzip des „Forderns und Förderns“, die in Hilfe-, Teilhabe- oder Behandlungsplänen mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielsetzungen und Maßnahmen beschrieben, formuliert und definiert werden. Darin werden die Menschen mit Behinderung aufgefordert, den Erwartungshaltungen gerecht zu wer-den. Von ihnen werden Anstrengungen, Bemühungen, und Verhaltensänderungen ab-verlangt, um den vorliegenden gesellschaftlichen Anforderungen nachzukommen.
Die Möglichkeit, dass der Mensch mit Behinderung jedoch weder Veränderungswün-sche noch Bereitschaft bei sich erkennt oder Motivation vermittelt, bleibt häufig un-berücksichtigt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die finanziellen, sozialen, be-ruflichen, medizinischen und familiären Zielsetzungen und die entsprechend zugeordneten Maßnahmen nicht kongruent sind mit denen des Leistungserbringers und des Leistungsträgers.167
Selten und häufig auch gar nicht berücksichtigt wird, darauf zu schauen, wie ausgren-zende Barrieren abgebaut werden können, um berufliche und soziale Benachteiligun-gen zu beseitigen, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, damit behinderte Men-schen in gleicher Weise in soziale Prozesse einbezogen werden können. Behinderung als Verhalten der Gesellschaft und gerade nicht als stigmatisierende Eigenschaft zu begreifen, beschreibt den Titel eines neuen Denkansatzes.
In der Exklusionsdebatte ist am Beispiel von behinderten Frauen hervorzuheben, dass diese zum einen als Frau (Geschlecht) und zum anderen als behinderter Mensch einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt sind. Sie sehen sich mit Vorurteilen in der Ge-sellschaft konfrontiert, durch die sie in ihrer selbstbestimmten Lebensführung als Frauen eingeschätzt werden. So werden Fragen der Partnerschaft, der Mutterschaft und bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensbereichen, wie z. B. in finanziell-ökonomischen Situationen, in Erfahrungen mit dem professionellen Medizinsystem, die Bewertung von Berufs- und Familienar-beit zu hinderlichen Problemlagen, mit denen sich eine (nicht) behinderte Frau er-schwerend auseinanderzusetzen hat.
Sozialrechtliche Gesetzesentscheidungen, Novellierungen, Nachbesserungen und ju-ristische Entwicklungen, wie z. B. das SGB IX bieten gesetzliche Grundlagen für eine genauere Beachtung von z. B. weiblichen Lebensentwürfen an.
Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) beabsichtigt, allen behinderten Men-schen ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu ermöglichen. Ziel ist es, eine freiheitliche Orientierung der Menschenrechte mit umfassenden sozialen Leistungs-rechten und einem konsequenten Verbot einer paternalistischen Bevormundung an-zustreben.
Es ist kein Leichtes, die erhobenen und definierten Ansprüche auch auf den Perso-nenkreis der TSSP zu übertragen, die phasenweise selbst mit kleinen Ausschnitten von zugestandener Freiheit und Autonomie überfordert sind und in diesen Momenten
167 vgl. Frehe, Horst (2006): Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen. In : Archiv für Wissen-schaft und Praxis der sozialen Arbeit. Vierteljahresheft zur Förderung von Sozial-, Jugend- und Gesundheits-lehre. o. J. H 4, S. 80-89.
82
sich selbst schädigen oder gar andere gefährden. Es stellt sich die Frage, nach wel-chen Kriterien und hierarchischen Argumenten (medizinische, ethische, juristische, kostenträgerspezifische, öffentlich-ordnungspolitische, aktuell alltagsbezogene usw.) Entscheidungsprozesse beeinflusst und schließlich bestimmt werden. Während diese Maßnahmen in der klinischen Behandlung eine ärztliche Entscheidung voraussetzen, bleiben in den stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe die Zugeständnisse innerhalb der Behandlungsvereinbarungen. Das Erlauben bzw. Definieren des Aus-gangsrahmens, der Kontakte und Besuche bleiben formal in der Verantwortung der gesetzlichen Betreuer haften.
Die BRK sind nach meiner Auslegeng als Leitlinien im Umgang mit der Subgruppe der TSSP nur eingeschränkt und bedingt anzuwenden. Wenn es abzuwägen gilt, ob durch Zwangsmaßnahmen oder freiheitliche Einschränkungen die Sicherheit des Ge-meinwohls und der Gesellschaft, die Gesundheit und die Unversehrtheit des Betreu-ungs- und Pflegepersonals sowie der Mitbewohner geschützt und gesichert werden können, so sind stets die Forderungen und erhobenen Ansprüche des betroffenen Pa-tienten oder Bewohners hinten anzustellen. Es ist vielmehr darauf Wert zu legen, dass die gewählten Maßnahmen, nachvollziehbar, zweck- und verhältnismäßig sind. Es ist darauf zu achten, dass stets auf die aktuelle Behandlungssituation und die gesund-heitliche Verfassung des Bewohners Bezug genommen wird und diese abgewogen werden. Der Umgang mit Zwangsmaßnahmen ist dauerhaft auf den Prüfstand einer institutionellen Einrichtung oder Klinik durch geeignete Standards zu stellen, wie z. B. durch eine gesonderte Dokumentation, eine systematische und standardisierte Nach- und Aufbereitung des Ereignisses der Beteiligten, durch Patienten- und Heim-beiräte, die u. a. von externen Beiräten168 besetzt werden. Die fortlaufende Bewusst-machung und Auseinandersetzung durch Schulungen und Trainingseinheiten mit dem Thema Gewalt, Macht, Zwang ist von hoher qualitätssichernder Bedeutung. Wissen, Methoden und Variationen an Deeskalationsstrategien gehören ebenso zu den Inhalten.169
Art. 3 Abs. 3 GG gibt vor, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. So ist hier zu ergänzen, dass die unterschiedlichen Lebensbereiche ge-rade der psychisch kranken Menschen, in einem besonderen Maß die der TSSP, ge-prägt sind durch alltägliche Stigmatisierungserfahrungen sowie durch Formen struk-turaler Diskriminierung in der Arbeitswelt oder im Versorgungssystem. Die unterschiedlichen Ausprägungen von Diskriminierung, so KARDORFF (2010), sind im Hinblick auf diejenigen differenziert zu betrachten, die unter der Sammelkategorie „psychisch krank“ subsumiert werden. So finden z. B. chronische Erschöpfungszu-
168 Besonders empfehlenswert wäre eine Beiratsbesetzung, die sich aus Erfahrenen- und Betroffenen-Ver-tretern (Bund- und Landesverband der Psychiatrie Erfahrenen: BPE e.V., LVPEBW e.V.), der EX-IN Bewegung oder der Angehörigenverbände (LV BW ApK e.V.) , aus Bürgerhelfern und aus trägerüber-greifenden Fachkräfte, die sich aus dem Gemeindepsychiatrischen Verbund der jeweiligen Region stammen, zusammensetzt. 169 Deeskalationstraining nach unterschiedlichen Schulen und Strategien für unterschiedliche Einsatzfelder wie z. B. ProDeMa, für Kliniken, Psychiatrien, Maßregel- und Strafvollzug geeignet oder Paravida für Schul-betriebe, den Arbeitsplatz, für private Haushalt oder für Kinder- und Jugendliche geeignet.
83
stände, ein Burn-out-Syndrom angesichts der beruflich gestiegenen Leistungsanfor-derungen eine gesellschaftlich höhere Akzeptanz wie z. B. die Diagnose einer schi-zophrenen Psychose oder einer Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ.170
Durch ein verändertes gesellschaftliches Behindertenbild und eine kontinuierliche Arbeit der Behindertenorganisation führt die Integration Behinderter zu einem gesell-schaftlichen Thema, das eine höhere öffentliche Aufmerksamkeit erfährt.
In der gesamten Debatte um In- und Exklusion ist zu sagen, dass aus sozialpolitischer Perspektive Behinderung ein Ungleichheitsphänomen darstellt. Die Ungleichheit liegt in der Einschränkung der Lebenschancen, die einer wohlfahrtsstaatlichen Kor-rektur bedarf. Die politischen Strategien der Bearbeitung sehen vor, dass Kompensa-tion, Rehabilitation, Integration bei Armut oder Deprivation, Partizipation und Gleichstellung bei sozialer Exklusion und Diskriminierung angeboten wird. Diskri-minierung wird verstanden als jede Form von Benachteiligung, Nichtbeachtung oder Ausschluss. Die Vermeidung von sozialer Exklusion beginnt z. B. schon in der Städ-teplanung, in der Belegungspolitik von Wohnungen durch die Kommune bzw. das Wohnungsamt, in der Wert auf die Ausstattung des sozialen Wohnungsbaus, auf eine heterogene Durchmischung des Gemeinwesens gelegt wird, um somit eine Konzent-ration von sozialen Problemlagen in sogenannten urbanen Brennpunkten anzuwen-den. Der sozioökonomische Status, die Standards und die strukturelle Beschaffenheit eines Wohnviertels oder Quartiers bieten auf vielen Ebenen Hinweise für die Chan-cengleichheit ihrer Bewohner. Die Gestaltung und Größe der Grünflächen, der Spiel- und Ruheplätze, der Grünflächen, die Infrastruktur von medizinischen und therapeu-tischen Angeboten, Einkaufsmöglichkeiten und der Erreichbarkeit mit den öffentli-chen Verkehrsmitteln stellen wichtigen Faktoren dar. Die Einkommens- und die Al-tersstruktur, die Arbeitslosenquote, die Bezugsrate von Transferleistungen im Quartier, die Jugendkriminalitätsrate aber auch die kulturellen Angebote im Gemein-wesen sind weitere Einflussfaktoren, die über die Konzentration, die Dauer und die Intensität eines Exklusionsprozesses entscheiden bzw. darüber wie hoch sein Einfluss ist.
Mit dem AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) kommt 2006 die Bundesre-gierung, so PERRENG (2006)171, der Umsetzung der europäischen Richtlinien zum Schutz vor Diskriminierung im deutschen Recht nach. Dies beinhaltet die Umsetzung der Antirassismusrichtlinien, der Rahmenrichtlinien zur Beschäftigung, der Gleich-stellungsrichtlinien wegen des Geschlechts außerhalb der Arbeitswelt und der Gen-der-Richtlinien.
Diese Richtlinien definieren, wann z.B. im Arbeits- oder Zivilrecht Diskriminierun-gen vorliegen. Dies hat eine weitreichende Auswirkung und Bedeutung für unter-schiedliche Adressaten. So z. B. für Arbeitnehmer, Vermieter, Mieter, Reiseveran-stalter, Versicherungsgesellschaften und Bankgeschäfte. Hierzu gehören spezielle
170 vgl. Kardorf, Ernst v.: Zur Diskriminierung psychisch kranker Menschen. In: Hamel, U./ Scherr, A. (Hg.): Diskriminierung. Grundlagen und Forschungsergebnisse. Wiesbaden. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden: 2010, S. 279-306. 171 Perreng, M.: Schutz vor Benachteiligungen aufgrund von Vorurteilen. Allgemeines Gleichbehandlungs-gesetz tritt endlich in Kraft. In: Soziale Sicherheit. Zeitschrift für Arbeit und Soziales. 1. Jg., H.8/9, 2006. S.: 296-303
84
Massengeschäfte, die ein erhebliches Volumen beinhalten. Zu den Massengeschäf-ten, Retailgeschäfte genannt, gehören die Bereiche der Kontoführung, der Kreditkar-ten, der Anlagen, der Aktien und Wertpapiere, der Ratenkredite, der Baufinanzierung sowie der Bausparverträge und Versicherungen.
Die Auswirkungen des AGG berühren, am Rande bemerkt, auch die europäische Neuregelung von Fluggastrechten, die Verbesserungen für behinderte oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Fluggäste anstreben.
Gerade die Gruppe der TSSP erlebt in einer ausgeprägten und deutlichen Form die Auswirkungen und Folgen von Exklusionsprozessen auf ihre Gesundheit, auf die Wohn-, Einkommens- und Beschäftigungssituation. Es ist die Frage, ob die belastete Gesundheit ein Auslöser für eine initialisierende Exklusionsdrift darstellt oder ob frühe lebensgeschichtliche Erfahrungen und Erlebnisse und ein flankierend niedriger sozioökonomischer Status schließlich Einfluss auf die Gesundheit nehmen und so eine vielschichtige und nachhaltige soziale Exklusion befördert und begünstigt.
Es ist notwendig, sich in der Folge mit dem Begriff von Krankheit zu beschäftigen als weitere Grundlage und Dimension der Auseinandersetzung, in der dann die Gruppe der TSSP innerhalb der unterschiedlichen theoretischen Ansätze und der Fel-der Sozialer Arbeit spezifischer unter die Lupe genommen und beschrieben werden kann.
85
4. Kapitel
Diskurse zur Exklusion
4.1. Diskurs von Exklusion in einem systemtheoretischen Kontext Im Wesentlichen befasst sich dieser Ansatz mit drei zentralen Fragestellungen: Wie funktioniert und gelingt die Integration sozialer bzw. gesellschaftlicher Systeme? Wie funktioniert und gelingt die Integration der Persönlichkeit und schließlich, wie funktioniert und gelingt die Integration der Persönlichkeit in die Gesellschaft? In Be-zug auf die Gruppe der TSSP ist dies ein besonders geeigneter Ansatz, um Hinweise für Erklärungen und Beschreibungen zu generieren, denn schließlich hat sich „die Systemtheorie“ mit dem Begriff und Phänomen der Exklusion vielschichtig und gründlich auseinandergesetzt.
In der systemtheoretischen Sichtweise, so KRONAUER, bezeichnet der Exklusions-begriff nicht ein historisch erzeugtes und somit der Möglichkeit nach auch überwind-bares Problem in der Geschichte moderner Gesellschaften, sondern eine Funktions-bedingung dieser Gesellschaften selbst. Exklusion wird als logische Voraussetzung für das Funktionieren der Funktionssysteme betrachtet. Da aber die Vertreter der Sys-temtheorie den Anspruch an sich haben, eine allgemeine Theorie der Gesellschaft zu sein, so will sie auch die Phänomene der Arbeitslosigkeit und der Armut, bzw. die auf die Ausgeschlossenen oder „underclass“ wirkenden Prozesse, erklären.172
Bei dem Begriff Inklusion ist Exklusion nicht das Gegenteil, also der Antagonist von Inklusion oder das Fehlen von Inklusion, sondern es ist vielmehr als ein wechselsei-tiger Prozess zu verstehen, der durch das Zusammenspiel von lebenden, physischen und sozialen Systemen auf Ereignisse reagieren, und die, wie es LUHMANN be-schrieben hat, beiden Seiten unerlässlich sind. Inklusion kann es nicht ohne Exklusion geben. Er unterscheidet zwischen In- und Exklusion und hebt hervor, dass die Teil-nahme am sozialen System vom Menschen Eigenbeträge abverlange und schließlich dazu führe, dass sie sich voneinander unterscheiden, sich also gegenseitig exklusiv verhalten, da sie ihren Beitrag selbst erbringen, sich schließlich selbst motivieren müssen. Denn, so LUHMANN weiter, gerade wenn sie kooperieren, müsse gegen alle natürliche Ähnlichkeit geklärt werden, wer welchen Beitrag leiste.173
Da sich Systeme stets über einen Selbstzweck definieren, hat sich die Soziale Arbeit den Zweck zugedacht, die Ambivalenzen der gesellschaftlichen Funktionssysteme zu beantworten. Nach KLEVE174 bewältigt Soziale Arbeit somit Exklusionsprobleme und die in der Gesellschaft entstehende Exklusionsdrift. Sie bewältigt also das Phä-nomen, dass das Ausgeschlossen-Werden aus einem System, das Arbeitslos-Werden, oder Psychisch-Krank-Werden weitere Prozesse im Sinne eines Dominoeffekts nach sich ziehen und es am Ende zu einem Wohnungslos-Werden und einer sozialen Seg-regation kommt. Der Verlust von Bindungen und Beziehungen, der drohende Verlust der Arbeit oder des Wohnraums, können Initialereignisse sein, die psychische und
172 vgl. a.a.O. Kronauer, M. (2010), S. 30. 173 vgl. Luhmann, N.: Soziale Systeme. Suhrkamp. Frankfurt/a.M. (1994), S. 299. 174 Kleve, H.: Die soziale Arbeit ohne Eigenschaften. Freiburg i.B. (2000), S. 118.
86
körperlich Gesundheitsprozesse in Gang bringen, die mit materieller Armut, sozialer Isolierung einhergehen können.
Die Soziale Arbeit versucht diese Prozesse zu bewältigen und aufzulösen, indem sie die Einschränkungen der Ausgeschlossen durch kompensatorischen Leistungen mit den bestehenden Systeme vermitteln. Das geschieht durch Beratungsangebote, Reha-bilitationsmaßnahmen oder sozial-kulturelle Teilhabe in Einzel- und Gruppensettings oder in sozialräumlichen Strukturen.
Die Teilnahme am sozialen System fordert, so LUHMANN, dem Menschen Eigen-beträge ab und führt dazu, dass die Menschen sich voneinander unterscheiden, sich gegeneinander als exklusiv verhalten, denn sie müssen ihre Beiträge selbst erbringen, müssen sich selbst motivieren. Gerade wenn sie kooperieren.
Nachdem LUHMANN bereits Mitte der 90 er Jahre, geprägt und beeindruckt durch Besuche in lateinamerikanischen Favelas, nach Deutschland zurückkehrte, unterzog er den bisherigen Exklusionsbegriff einer neuen Auslegung. Exklusion, so die Er-kenntnis, beinhalte sowohl Probleme mit einer Innen, als auch mit einer Außen-Un-terscheidung. Das Exklusionsverständnis der Systemtheorie befindet sich im wesent-lichen Gegensatz zum Exklusionsgedanken, wie er aus dem „sozialen Bewusstsein“ und der Krise seiner Voraussetzungen entspringt. Das Exklusionsproblem wird in der Systemtheorie aus der historischen Konstellation gelöst und erklärt Exklusion zur Konstitutionsbedingungen moderner Gesellschaften. Damit entzieht die Systemtheo-rie dem Begriff Exklusion in modernen Gesellschaften sowohl einer theoretischen als auch einer praktischen Kritik.175
Nach MOHR (2005)176 beruht der Exklusionsbegriff auf einem dichotomischen Ver-ständnis sozialer Exklusion, bei dem „der stabilen Kerngesellschaft ein problemati-scher -Rand- gegenüber gestellt wird, ohne die Bezüge zwischen gesellschaftlichem Zentrum und Peripherie zu thematisieren. Die Verursachungszusammenhänge von Armut und Ausgrenzung, die im Zentrum der Gesellschaft angesiedelt sind, werden dabei ausgeblendet.“ Der Suche nach den Schuldigen richtet sich auf diejenigen, die am Rand der Gesellschaft verortet sind. Zudem, so MOHR weiter, blende ein solch dichotomischer Begriff sozialer Ausgrenzung Zonen des Übergangs und der Gefähr-dung, ebenso wie soziale Ungleichheiten innerhalb der Zone der Inklusion systema-tisch aus. Problem des ‚Drinnen und doch Draußen’-wie „Armut trotz Arbeit“- gera-ten aus dieser Perspektive erst Recht nicht in den Blick.
Die Gegenüberstellung der Gesellschaft und der Ausgeschlossenen bzw. der under-class provoziert nach KRONAUER Widerspruch, denn nicht die Gesellschaft die Ausgrenzung erzeugt, sondern die Ausgeschlossenen selbst werden zum Problem er-klärt.
Professionelle Helfer versuchen dem Phänomen des Ausschlusses aus einem System, das mit einem Dominoeffekt einhergeht, so zu begegnen, dass weitere Anschlüsse
175 vgl. a.a.O. Luhmann (1994), S. 120. 176 Mohr, K. (2005): Vortrag zu „Grundeinkommen und soziale Inklusion“ vom 7.-9.10.2005 auf Konferenz „Grundeinkommen- in Freiheit tätig –sein“ in Wien
87
möglich sind, so RUF. (2012)177 Es ist davon auszugehen, dass nicht nur die Funkti-onen und Aktivitäten der aus einem System Herausgedrängten beeinträchtigt sind, sondern es bestehen auf sozialer Ebene auch Verteilungs- und Inklusionsprobleme. Sie können an bestimmten sozialen Systemen nicht oder nur eingeschränkt teilneh-men. Somit gilt es zu vermitteln, zwischen dem Betroffenen und den Systemen, teils über kompensatorische Leistungen der ersatzweisen Inklusion, wie z.B. durch Werk-stätten für behinderte Menschen, jedoch stets mit dem Ziel die Inklusion in die pri-mären Systeme (Betriebe auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt) wieder herzustellen. Hier kommt es zwischen den Systemen zu einer intermediären Vermittlung. Es gilt ferner, sich darin zu positionieren, zu Hilfe und Nicht-Hilfe, zu Inklusion, zu einer stellvertretenden Inklusion und Exklusion, zu Integration oder Desintegration. Aus systemtheoretischer Sicht macht es wenig Sinn, so RUF, dem Referenzwert Inklu-sion, Integrationsmaßnahmen und Hilfestellung anzubieten, denn in einer funktiona-lisierenden Gesellschaft wird bei der Berufswahl Mobilität und somit die Fähigkeit, mit sozialer Desintegration umzugehen, vom Einzelnen abverlangt. Gerade dem we-niger naheliegenden Referenzwert, der Nicht-Hilfe, der Exklusion und Desintegra-tion soll Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Bedeutsam erscheint zudem, den Zeitbegriff im Zusammenhang des systemtheoreti-schen Ansatzes hervorzuheben. Üblicherweise stellen wir uns Zeit als eine lineare Struktur, in einem homogenen Sinne vor. Zeit strukturiert wiederkehrende Epochen, also noch zu erwartende, gegenwärtige oder vergangene Ereignisse, als Jahreszeiten oder als Zeitstrahl mit einem definierten Beginn und einem fortlaufenden und end-gültigen Ende der Struktur.
Die Systemtheorie hingegen geht bei dem Zeitbegriff von einem heterogenen Ver-ständnis aus, der je nach erlebtem Ereignis oder Geschehen unterschiedlich lange er-lebt wird, sodass einerseits bereits Vergangenes auch in die Gegenwart hineinwirken kann, andererseits kann Vergangenes aus der Betrachtung der Gegenwart heraus neu gedeutet, verstanden und interpretiert werden. Die dem Menschen zugedachte Fähig-keit zur Eigenreferenz ermöglicht dann, Gewordenes zu verändern, das Gegenwärtige von einer gewünschten Zukunft her zu verstehen oder Entwicklungsverläufe auf eine unterschiedliche Art und Weise auszulegen.
Bei der Gruppe der TSSP besteht häufig eine große Diskrepanz zwischen der gelebte Zeit und der selbst präsentierten, erlebten Zeit. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die typologischen Biographien meist nur bis in die Pubertät hinein mit anderen kon-ventionellen Lebensverläufen zu vergleichen sind. Markante biographische Ereig-nisse oder „Initiationsriten“, wie z. B. die Erstkommunion, Firmung, Schulabschluss, Führerschein, Tanzkurs, erste romantische Beziehung, erster Urlaub ohne Eltern, eine Lehrstellen oder Studienplatz, der Auszug von zu Hause, eine erste eigene Woh-nung, Verlobung, Heirat, Eltern-Werden etc. finden nicht satt bzw. werden häufig nicht erlebt. Zudem ist der Sog zu den Peers ins Milieu, die bereits ein stark abwei-chendes Verhalten, stellenweise auch kriminelles Verhalten, zeigen. Sie konsumieren schon frühzeitig Drogen, leben auf der Straße bzw. halten sich dort überwiegend auf.
177 Ruf, P.: Teilhabeplanung als gemeindepsychiatrischen Kernprozess. In: Gromann. P. (Hg.): Mit profes-sioneller Hilfeplanung zu einer individuellen ambulanten Versorgung. Fuldaer Schriften zur Gemeindepsychi-atrie. Band 2, Psychiatrie Verlag. (2012) Bonn, S. 15ff
88
Häufig treten bereits in der Adoleszenzphase Institution und Behörden, wie z.B. das Schul- oder Jugendamt, Förderschulen, die Polizei, sozialpädiatrische und heilpäda-gogische Hilfen, die Kinder- und Jugendpsychiatrie auf den Plan tritt und drängen in die Kernfamilie ein.
Sogenannte, als „blande“ etikettierte psychotische Verläufe mit einer Minussympto-matik können über Jahre hinweg zu einem Einfrieren und Stillstand im Erleben der eigenen psychosozialen Entwicklung führen und nimmt auch Einfluss auf das zeitli-chen und emotionalen Erlebens der eigenen Biographie. Diese über 5-7 Jahre hinweg vorauswirkende Prodromalphase wird häufig flankierend durch Drogen aus dem Mo-tiv der Selbstbehandlung noch weiter forciert und verfestigt.
Nach LUHMANN178 ist ein Prozess, innerhalb des Zeitbegriffs, die zeitliche Aufei-nanderfolge von Ereignissen, die weder ungeordnet noch zufällig verläuft, sondern im Rahmen einer Sinnselektion auf vorangegangene Ereignisse, die sich fortlaufend aneinanderschließen, aufbaut. So bildet die Selektion eines Ereignisses die Grundlage für die Selektion eines anderen und so weiter. Die zeitliche Verknüpfung des Neuen und Überraschenden mit dem Vergangenen geschieht durch Strukturbildung, so dass aus der Anzahl an möglichen Optionen und Elementen selektiert und gekoppelt wer-den kann. Struktur ordnet die Elemente an, sie weist ihnen Funktionen zu und legt Beziehung und Operationen untereinander fest. Sobald einzelne Ereignisse miteinan-der verknüpft und geordnet werden, z.B. zeitlich nacheinander in Bezug auf Hierar-chien und Handlungsspielräume, entsteht Struktur. Schließlich entstehen innerhalb der Strukturen sozialer Systeme Regeln, Vereinbarungen, quasi ein Codex des sozia-len Miteinanders, feste Vereinbarungen, Abläufe, Verhaltensmuster, aber auch Ta-bus.
Gerade hiermit hat die Gruppe der TSSG größte Mühe, Ereignisse zu selektieren und in Strukturen zuzuordnen. Das hat sicher vielfältige Ursachen, die u.a. mit kognitiven Störungen und einer eingeschränkten Umsetzung ins konkret alltagspraktische Han-deln und Beeinträchtigungen auf einer sozial-kommunikativen Handlungsebene zu erklären sind.
Prozess und Struktur entstehen in einem reziproken Verhältnis zueinander. Struktu-ren halten Zeit reversibel fest, da sie ein begrenztes Repertoire von Wahlmöglichkei-ten offenhalten. Man kann sie, so LUHMANN, aufheben, ändern oder mit ihrer Hilfe Sicherheit für Veränderungen in andere Hinsichten gewinnen. Prozesse markieren hingegen die Irreversibilität der Zeit, denn sie bestehen aus irreversiblen Ereignissen.
178 vgl. a.a.O. Luhmann, N. (1994), S. 70-83.
89
4.2. Diskurs von Exklusion in einem interaktionstheoretischen Kontext
Entwicklungspsychologische Ansätze (psychoanalytische, milieutherapeutische, in-teraktionstheoretische etc.) und Untersuchungen begrenzen sich nicht nur auf be-stimmte Altersphasen, weil Entwicklung einen lebenslangen Prozess darstellt, der je-doch in seiner Prägung und Auswirkung im Laufe der Lebenszeit eher abnimmt. Im interaktionstheoretischen Ansatz, der sich in der theoretischen Tradition u.a. auf den symbolischen Interaktionismus und der phänomenologischen Soziologie bezieht, in seinem Ursprung jedoch auf PIAGET (1948, 1954) zurückgeht, vollzieht sich Ent-wicklung durch die Integration von angeborenen Einflüssen und Umwelteinflüssen. Der Mensch, sein Verhalten und seine Kommunikation werden in seinem fortlaufen-den, lebensgeschichtlichen Werden verstanden.
In diesem grundlegenden Selbstverständnis, so NAGEL & DIETZ179 prägten GLASER und STRAUSS, Vertreter der interaktionistischen Forschungs- und Theo-rietradition der Chicago School, den Begriff der Statuspassagen bzw. den Begriff des Statusübergangs. Darunter verstehen sie die wiederkehrenden Situationen im Verlauf der Biographie, in denen sich das Muster der Zugehörigkeit des Individuums zu den Institutionen und Gruppierungen der Gesellschaft verändert. Statusübergänge werden zum einen in ihrer lebensgeschichtlichen Geordnetheit betrachtet, die in einem fort-laufenden und sich stets veränderten Lebenszyklus eingebettet sind, und die mit Rei-fungs- und Alterszuständen, wie z.B. Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter, Alter, Ehe usw. einhergehen. Zum anderen werden Statuspassagen als Bewegungen innerhalb der Sozialstruktur unter dem Blickwinkel von Teilhabechancen und sozialer Un-gleichheit verstanden. Hier werden die Veränderungen der sozialen Zugehörigkeit im Zusammenhang mit den Ablaufschemata und Karriereleitern des Ausbildungs-, Be-rufs-, Arbeits- und Beschäftigungssystems abgebildet. Während männliche Karrieren von einem kontinuierlichen Verlauf (Ausbildung-Berufsleben-Rente) ausgehen, die 179 vgl. Nagel, U./ Dietz, G.-U. (2001): Statuspassagen. In: Handbuch Sozialarbeit- Sozialpädagogik. Otto, H-U/ Thiersch, H. (Hg.). 2. Auflage. Luchterhand. Neuwied. S.1828.
Zwischenfazit: Der systemtheoretische Ansatz anerkennt, definiert und bewertet per se den Be-griff Exklusion sowohl als Möglichkeit, die Probleme zu überwinden, als auch als Funktionsbedingung der Gesellschaften an sich. Nicht die Gesellschaft, die die Ausgrenzung erzeugt, sondern die Ausgegrenzten, die Übrigen selbst, werden zum Problem deklariert. Dieser theoretische Ansatz bietet die Perspektive, bezo-gen auf die Gruppe der TSSP, strukturelle Anstrengungen und Maßnahmen zu entwickeln, die auf eine Einbeziehung der Gruppe der TSSP inmitten einer stabi-len Kerngesellschaft abzielt. Bereits zu einem frühen biographischen Zeitpunkt wirkt ein Prozess der Exklusion auf die Gruppe ein, die das Ausgegrenzt-Sein teils pflegt, teils dagegen angeht und schließlich dem Stigma unterliegt und sich solange in den Entwicklungsräumen und Lebenswelten aufhält, die ihnen die Ge-sellschaft strukturell zuteilt, bis sie institutionell begrenzt, diszipliniert, betreut und behandelt werden.
90
eher soziale Integration versprechen, ist bei Frauen eher von der Problematik der Ver-einbarkeit von Familie und Beruf und damit einem diskontinuierlichen Verlauf aus-zugehen. Zum anderen wird unter dem Gesichtspunkt von sozialer Integration/Parti-zipation und sozialer Exklusion derjenige Komplex von Statuspassagen zusammen-gefasst, der in das Gesichts- und Wirkungsfeld von Institutionen Sozialer Arbeit und Kontrolle fällt. Konkret handelt es sich hier um Statuspassagen wie z.B. Psychiatrie-, und Drogenkarrieren, Migrations- und Arbeitslosigkeits-, und Sozialhilfeschicksale oder auch Verstrickungen beim Übergang von der Schule zur Ausbildung oder Beruf oder bei der Ablösung vom Elternhaus, beim Übergang von Schule zum Studium in ein eigenständiges und selbstverantwortliches Leben.
Spannungen, Konflikte und der Beginn einer tiefgreifenden Störungen können dann an der Stelle auftreten, an der die Person an der Statuspassagen nicht bereit, motiviert oder schon vorher beeinträchtigt ist, die erforderlichen Anpassungsleistungen und Anstrengungen abzurufen. Nehmen Spannungen Stress, und Frustration im Verlauf von Statusübergängen einer Schul- oder Berufskariere überhand, kann es zum Ab-bruch, zum Erliegen möglicher und alternativer Laufbahnen kommen. Es kann zu einem Krankheitsprozess oder zu vermehrten Bemühungen der Statuserreichung und ihrer Sicherung kommen, die durch einen Kraftakt, der Ressourcen und Kräfte erfor-dert, gekennzeichnet sind.
Bereits 1968 räumte STRAUSS die Schwierigkeiten ein, Zeiten eines radikalen und raschen sozialen Wandels erwachse den institutionellen und individuellen Akteuren der Statusübergange, die Tatsache, dass die Lebensverläufe ungewisser, zugleich ge-fährdeter und erregender werden.180
HONNETH bezieht sich in seiner Theorie der Anerkennung u.a. auf MEADS Inter-aktionstheorie und führt darin aus, dass gerade die intersubjektive Anerkennung, die über die wechselseitige Beziehung zum anderen entsteht, jeder Identitätsbildung vo-rausgesetzt ist, weil die Subjekte zu einem praktischen Selbstverhältnis nur gelangen können, wenn sie sich aus der normativen Perspektive ihrer Interaktionspartner, als deren soziale Adressaten, zu begreifen lernen.181
Eine Identitätsproblematik kann die Selbstsicherheit und den Selbstwert blockieren, wenn es infolge von Brüchigkeit und Unannehmbarkeit der eigenen Biographie schließlich zu einem Erleben einer inkohärenten Lebensgeschichte kommt. Auf der Grundlage meiner letzten 15 Jahre der Berufspraxis habe ich bei der Gruppe der TSSP konzentriert beobachten können, dass sie z.B. sowohl in der eigenen Definition der Person, der eigenen Zielsetzungen, als auch bei der sexuellen Ausrichtung oder der eigenen persönlichen Identität indifferent und unklar darüber ist. Ein kurzer Kontakt, ein schnelles Eintauchen in das Leben, das als abstraktes und nicht auf sich bezogenes Phänomen erlebt wird, gelingt häufig nur durch einen Suchtstoffmissbrauch. Dieses Erleben hält für die Dauer der Wirkung des Suchtstoffes an. Beim Abklingen wird
180 Strauss A.: Spiegel und Masken. Die Suche nach der Identität. Suhrkamp. 1968 Frankfurt/M. S.115 181 vgl. a.a.O. Honneth. S. 148
91
der Konsument wieder in ein passives und verdinglichendes Leben zurück ma-növriert, das er nicht akzeptieren und annehmen kann, weil er sich darin schon Fremd-Geworden ist.
Die Gruppe der TSSP hat große Mühe, sich dem Nächsten oder in einer Gruppe an-zupassen. Sie haben große Schwierigkeiten, die darin definierten und vereinbarten Grundregeln zu akzeptieren und einzuhalten. Die in der Gruppe der TSSP z.B. ent-wickelte Empathiefähigkeit, die im Kern ein rekonstruktives Gefühlserleben im und durch den Anderen erzeugt, ist gering ausgeprägt, so dass der Andere und seine Sicht, nicht nachvollziehbar ist und oftmals rätselhaft bleibt. Dies tritt besonders in delikt-spezifischen Gruppen oder in psychoedukativen Gruppen zum Vorschein, in denen die Perspektive des Opfers, der geschädigt wurde oder des Nächsten, des Anderen, in der Rolle des Mitbewohners, des Familienmitglieds, des professionellen Helfers, des Betreuers etc. häufig eindimensional und monokausal interpretiert wird. Ein Teilneh-mer einer Gesprächsgruppe berichtete über seine Delikte an einem Bahnhof: „Wahr-scheinlich fand die (eine geschädigte junge Frau von Anfang 20) das nicht so gut (sie wurde mit mehreren Kickboxsprüngen in den Rücken und Bauch verletzt)….die stand halt gerade da…wenn ich da jetzt am Automat doch Geld brauch“! Derselbe Teilneh-mer berichtete in einer psychoeduaktiven Gruppenarbeit verharmlosend: „Ich habe doch die Schläge kontrolliert (…) der ist dann auch gleich umgefallen.182“
So wird nicht nur der Raum und die zeitlichen Strukturen, sondern auch die sozialen Bezüge, die identitätsstiftende und strukturierende Eigenschaften phasenweise aber auch langfristig außer Kraft gesetzt und als fremd erlebt. Das geschieht gerade so, als erlebe der Erfahrene durch seine beschädigte, poröse und brüchig gewordene Identi-tät, eine hohe Einflussnahme und Fremdmanipulation durch die Anderen. Die Ande-ren stellen dann institutionelle, gerichtliche und professionelle Strukturen dar, die den bereits gestarteten Prozess des Fremdwerdens der eigenen Biographie nur noch ver-stärken und weiter ausbauen. Zudem überwiegt im Kontakt der Gruppe der TSSP der Eindruck, dass das eigene Selbst abgelehnt wird, weil auch der bisherige lebensge-schichtliche Verlauf, die darin wirkende Krankheit und deren Auswirkungen, sowie die mögliche aktive und selbstbeeinflussende Gestaltung auf ein biographisches Wer-den als nicht zugehörig und unerreichbar identifiziert erlebt werden.
Gerade die für die Gruppe der TSSP so typisch gering ausgeprägte Selbstwertproble-matik liegt in dem Sachverhalt begründet, dass sich der Einzelne seiner Identität nicht durch innere Monologe versichern kann. Erst durch das Eintreten in einen Kreis re-ziproker Sozialbeziehungen, so TAYLOR (1994), WAGNER (2004), die sich zu ei-nem Band an Solidaritätsbeziehungen knüpfen, erschließt sich die Teilhabe am ge-sellschaftlichen Lebenserhaltungssystem als der Realisierungsbedingung von Existenz und Individualität, die der äußeren Anerkennung stetig bedürftig bleiben.
182 vgl. Masanz, K. (2013): Forschungstagebuch zur Dissertation, Aufzeichnungen über Vorbesprechungen der biographischen Interviews, in denen ein Biograph über seine Opfer auf der Straße, die er im Rahmen von mittelschweren Körperverletzungen geschädigt hat, berichtet.
92
Insbesondere diese auf Reziprozität ausgerichtete Sozialbeziehungen, die bestätigen, sich vergewissern aber auch Kritik und Korrektur anbieten und somit Impulse und Motive geben, das eigene Verhalten und Handeln zu verändern, ist ein wenig entwi-ckeltes Charakteristikum innerhalb der Patientengruppe. Umso bedeutsamer er-scheint der Schwerpunkt in der Betreuung und Behandlung, auf eine psychoedukative Auseinandersetzung, auf Vermittlung und Training dieser Kompetenzen zu sein, die als Grundvoraussetzung für ein Leben in einer Gruppe, inmitten der Gesellschaft, zu betrachten ist.
Kriminalität, psychische Krankheit oder Probleme der Bildung und Erziehung wer-den häufig zu Forschungsgegenständen, auf die der interaktionstheoretische Ansatz empirisch wie auch theoretisch versucht war, diese sozialen Phänomene, zu erklären und zu beschreiben so SACK (1976).183 Das allgemeine Prinzip des Ansatzes geht davon aus, dass soziale Tatsachen und Phänomene außerhalb ihrer kulturellen Aneig-nung, Interpretation, Definition, Bedeutung oder Sinngebung keine Existenz haben. Das bedeutet, dass soziale Wirklichkeit nur erfahrbar und erfassbar ist, über die sym-bolische Matrix der Kultur, deren zentralster beobachtbarer Bestandteil, so SACK weiter, die Sprache ist. Die Aufgabe und Zielsetzung besteht in der Beschreibung und Analyse solcher Konstitutionsprozesse sozialer Wirklichkeit und Strukturen, die prinzipiell prekär, offen, alternativ möglich ist. Soziale Wirklichkeit ist umstritten und kontrovers und erst durch das Produkt sozialer Interaktion, Kommunikation und Konflikte subjektiv zu erfahren.
183 Sack, F.: Der interaktionstheoretische Ansatz. In: Bolte, K M (Hg.); DGS. Materialien aus der soziologi-schen Forschung. Verhandlungen des 18. Deutschen Soziologentages vom 28.9.-1.10.1976 in Bielefeld. Lucht-erhand. 1976 Darmstadt, S.676-682.
93
4.3. Diskurs von Exklusion in einem intersektionellen Kontext
Intersektionalität (engl. intersection) stellt den Oberbegriff dar, um das Zusammen-wirken und Überschneiden von verschiedenen Ungleichheitskategorien bzw. Diskri-minierungsmerkmalen zu beschreiben. Diese können sich im Fall einer Diskriminie-rung verstärken oder „aber auch auf ganz spezifische untrennbare Art und Weise zusammenwirken und sich gegenseitig beeinflussen, sodass sie nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden können“, so KARAWANSKIJ et al. (2010)184
Intersektionalitätsforschung interessiert sich dafür, in welcher Weise Ungleichheiten und gesellschaftliche Differenzierungen etwa nach Klasse, Geschlecht, Ethnie aber auch nach Körper, Alter, sexueller Orientierungen sowie vieler anderer Kategorien (psychische Erkrankung, körperliche Behinderung, Armut, Wohnen in einem sozialen Brennpunkt, Suchtabhängigkeit, Alter, religiöse oder weltanschauliche oder ethni-sche Zugehörigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, den Verlust des Wohnraums etc.) in Wechselbeziehungen miteinander stehen und wie sich welche Kategorien aufgrund
184 Karawanskij, S. (Hg.) et al.: Antidiskriminierungspädagogik: Konzept und Methoden für die Bildungsar-beit mit Jugendlichen. Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden (2010), S.: 258.
Zwischenfazit: Die Gruppe der TSSP unterliegt nach diesem Ansatz einem le-benslangen Prozess, entsprechend der entwicklungspsychologischen Phasen und Stadien, die zudem durch angeborene Einflüsse wie auch durch Umwelteinflüsse geprägt und beeinflusst wird. Alters- und entwicklungsabhängig durchlaufen sie nur wenige markante und signifikante Statusübergänge in der Zeit von 18 bis 28 Jahren, an denen sie scheitern, die sie vermeiden und erfahren auch hier somit verminderte Teilhabechancen und soziale Ungleichheit. Dabei werden bereits frühzeitig Krankheits-, Sucht- und andere Milieukarrieren initialisiert. Diese un-terscheiden sich geschlechtsspezifisch in der Akzentuierung einer ebenso früh-zeitigen romantischen Partnerschaft. Während die Frauen der Gruppe der TSSP im pubertierenden Alter langausgerichtete Partnerschaften mit Kinder-, und Ehe-absichten führen, um sich institutionellen Einflüsse auf Abstand zu halten, legen die Männer ihren Schwerpunkt in die berufliche Qualifikation. Sie scheitern je-doch an den Anforderungen und reagieren mit Frust, Abbruch, Verweigerung, Scham und Rausch. Partnererfahrungen fallen hingegen gering und ungeübt aus. Gemäß dem Ansatz, trägt der soziale Wandel bei der Gruppe der TSSP in einem verstärkten Maß zu identitätserschütternden Prozessen bei, die die Fragen nach der Identität, der Zugehörigkeit, nach einem selbstverantwortlichen Umgang, ein autonomes Leben zu führen in den Vordergrund stellt. Diese zentralen Aufga-benstellungen werden typischerweise außerhalb der Herkunftsfamilie, in Institu-tionen stellvertretend bewältigt. In diesen kommt es schon allein von der Struktur her zu einem reziproken Austausch durch Interaktion, Kommunikation und Aus-einandersetzung.
94
ihrer Überkreuzungen gegenseitig abschwächen oder verstärken können vgl. KLINGER/ KNAPP/SAUER (2007) und KNAPP/ WETTERER (2003).185 186
LUTZ und WENNING187 dagegen haben weitere Kategorien der Differenz aufge-stellt: Diese sind Gender, Sexualität, Race/Hautfarbe auch Ethnizität, Nationalität/ Staat, Kultur, Klasse, Gesundheit, Alter, Sesshaftigkeit, Herkunft, Besitz, geographi-sche Lokalität (West-Ost), Religion (religiös-säkular) und der gesellschaftliche Ent-wicklungsstand (modern-traditionell).
Soziale Arbeit setzt sich mit der Entstehung sowie Reduzierung multipler sozialer Ungleichheiten und benachteiligenden Lebensgrundlagen auseinander. Sie versucht sowohl gesellschaftliche als auch politische Problembeschreibungen in pädagogische Probleme entsprechend Handlungshorizonten zu definieren. Die daraus produzierten Auswirkungen und Folgen können ohne ausreichende Analyse weder politisch noch rechtlich bestehen.
Die intersektionelle Mehrebenenanalyse stellt Optionen dar, asymmetrische Un-gleichheitsverhältnisse entlang sozial wirksamer Differenzkategorien in ihren Wech-selwirkungen und Modi der Verknüpfung auf unterschiedlichen Ebenen zu untersu-chen. Die Interdependenzen zwischen den Strukturkategorien Geschlecht, Klasse, Rasse werden mit der Analyseebene der sozialen Strukturen, der symbolischen Re-präsentation und der Identitätsstrukturen herausgearbeitet, so WINKLER (2012: 15).
Neben dem Ansatz der Intersektionalität stellt „Diversity“ eine Perspektive dar, um Ungleichheitslagen mehrdimensional zu erfassen, so LEIPRECHT (2008: 427).
Diversity meint sowohl Unterschiedlichkeit auf Grund der jeweiligen Individualität als auch auf Grund von Merkmalen, die eine soziale Relevanz darstellt, z.B. Ge-schlecht, Ethnizität. kulturelle Prägung, Hautfarbe, Behinderung, Alter, sexuelle Ori-entierung, Nationalität, religiöse Glaubensprägung. Diversity berücksichtigt die Be-dingungen und Beschaffenheit des Andres-Seins und verweist auf Verhältnis-mäßigkeiten und Macht der gesellschaftlichen Praktiken und Beziehungen in der Konstitution von Differenz.
Nach SCHERR (2011:84) geht es mehr um die Ausrichtung des diversity Ansatzes als ökonomischer Faktor, als einen politisch-rechtlichen Antidiskriminierung als kri-tische Perspektive, die die Zusammenhänge und Wechselwirkungen sozialer Klasse mit sozioökonomischen Ungleichheiten herstellt, sowie sich auf politische Macht- und Herrschaftsbeziehungen fokussiert.
Die frühe Intersektionalitätsforschung ist zweifelsohne als Ungleichheitsforschung zu verstehen. Den Begriff der Intersektionalität führte die US-amerikanische Rechts-wissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw (1989) Ende der 1980er Jahre im Rahmen ihrer
185 Klinger, C. (2003): Ungleichheit in den Verhältnissen von Klasse, Rasse und Geschlecht. In: Knapp, G.-A./Wetterer, A. (Hg.): Achsen der Differenz. Gesellschaftstheorie und feministische Kritik II. Münster. S.14-48. 186 Knapp, G.-A./Sauer, B.: Achsen der Ungleichheit. Zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ethnizität. Frankfurt/M.2007 187 Lutz, H / Wenning, H.: Differenzen über Differenz- Einführung in die Debatte. PDF; 120 kB): In: Dies. (Hg.): Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft. 2001 Opladen, S. 11–24.
95
Analysen von Gerichtsentscheidungen zu Diskriminierungsfällen ein. Demnach sind die Überkreuzungen von Achsen (axis), entlang derer Menschen nach sex bzw. gen-der, race und class gesellschaftlich ungleich positioniert und auch diskriminiert sind, in der ökonomischen wie bürgerlichen Gesellschaftsordnung der USA rechtlich nicht angemessen berücksichtigt. Statt der Wechselwirkung unterschiedlicher gesellschaft-licher Machtverhältnisse und den damit verbundenen Überkreuzungen von Diskrimi-nierungsmechanismen als komplexes Geschehen zu verstehen, würde in der Regel, lediglich eine Dimension sozialer Ungleichheit isoliert betrachtet.
In gesamten Feldern Sozialer Arbeit passiert es häufig, dass durch quasi binäre Denkstrukturen ein Wohnungsloser in die Wohnungslosenhilfe, ein Suchtkranker in die Suchtkrankenhilfe usw. zugeordnet und sozialrechtlich nach §§ 53 oder §§ SGB XII 67 bewertet werden. Dabei wird oftmals außer Acht gelassen, dass der Mensch durch mehrere soziale Ungleichheitsmerkmalen gekennzeichnet ist, die soziale Un-gleichheit und sozialen Ausschluss befördern und gegenseitig sogar verstärken.
Intersektionalität gilt als bedeutsamer Forschungszweig innerhalb der Geschlechter-forschung und stellt ein Konzept dar, das als heuristiches Instrument der Analyseper-spektive dient, nach DAVIS (2010:55).
Das Spezifische ist der analytische Blick auf das interdependente Zusammenwirken verschiedener sozialer Konstruktionen von gesellschaftlich wirksamer Differenzka-tegorien und der damit verbundenen Dominanz und der Ungleichheitsverhältnisse. Die sowohl ein- als auch ausgrenzende Folgen wie auch die auf- oder abwertenden Folgen des Zusammenlebens sind Zentren der Betrachtung, so RIEGEL (2012:41).
Die intersektionelle Analyse ermöglicht die Wirkungsweisen von Macht, Herr-schafts- und Normierungsverhalten in den sozialen Strukturen der sozialen Praktiken und Identitäten der Individuen zu ermitteln, so WALGENHARD (2010:258).
4.4. Diskurs von Exklusion in einem sozialarbeiterisch/sozialpädagogischen Kontext
Soziale Sicherung und Soziale Arbeit dienen der Kompensation, bestenfalls der Prä-vention der Anarchie des Marktes. Sie können jederzeit ab- und umgebaut werden, wenn die soziale Idee von der sozialen Bewegung zu schwach vertreten bzw. durch-gesetzt wird. Sozialpolitik als Klassenkompromiss zwischen Arbeit und Kapital, der der Vermittlung des Staates bedarf, führt zwar nachweislich zu Verbesserungen der allgemeinen Lebenslagen gerade bei der armen sowie der arbeitenden Bevölkerung.
Zwischenfazit: Dieser Ansatz setzt sich mit dem Zu sammenwirken verschiedener Un-gleichheitskategorien und Diskriminierungsmerkmale auseinander. Er sucht danach, welche sich davon gegenseitig verstärken oder auch welche entsprechend zur Reduzie-rung beitragen. Soziale Arbeit bemüht sich durch den Einsatz von pädagogischen und psychosozialen Interventionen und Methoden darum, die Entstehung von sozialen Un-gleicheiten nachzuvollziehen und benachteiligte Lebensbedingungen unter Einsatz von politischem Einfuss, bzw. durch eine offensive Einmischung, auszugleichen.
96
Sie entfachte und beförderte aber ungeahnt der in der gesellschaftlich durchtränkten Individualisierungsprozesse, im BECKSCHEN (1983) Sinne, als Freisetzung mit den ambivalenten Folgen des Freiheitsbegriffs. So steht auf der einen Seite ein Bestreben nach Selbstverwirklichung, im Beruf und Freizeit, Flexibilität etc. einer Zunahme an Unsicherheit im Zuge einer Fragmentierung von intergenerativ-familiären sowie be-ruflichen Strukturen auf der anderen Seite gegenüber. Sozialpolitik ist somit Aus-druck der sozialen Idee von sozialer Gerechtigkeit und Verteilung wie auch Kompen-sation von Unsicherheiten im Prozess der Auflösung von Klassen- und gesell-schaftlichen Schichtbedingungen und den Anforderungen der Flexibilisierungen der Alltags-, Lebens- und Berufswelt. Die Risiken sollen aushaltbar erscheinen, ohne dass die Ursachen beseitigt werden (können), die ja gerade innerhalb der Wirtschafts-form und der gesellschaftlichen Ordnung begründet und verortet sind. Die Folgen und Risiken sind im Hinblick auf exkludierende Prozesse, die in einem besonderen Maß auf bestimmte Personengruppen einwirken, als systemimmanent zu bewerten. Exklusion wird gerade innerhalb der Lohnarbeit als immanent interpretiert, da sie als bestand sichernde Struktur der Marktwirtschaft, als notwendig disziplinierendes und natürliches Moment der Konkurrenz verstärkt.188
Ganz im Gegensatz zur Arbeiterbewegung, bei der Exklusion ausschließlich durch grundlegende Veränderungen der Produktionsverhältnisse aufgehoben werden kön-nen, zielt Soziale Arbeit/Sozialpädagogik auf die individuelle Unterstützung und (Selbst)Befähigung ab, durch die das Individuum den eigenen Weg zur Teilhabe an Arbeit und Leben, insbesondere an sozialer und kultureller Teilhabe, aufgrund der Leitidee -Hilfe zur Selbsthilfe- findet.
Soziale Arbeit/SP setzte im 19. Jahrhundert die Tradition der Armenpflege und Für-sorge fort, spezialisierte und professionalisierte in den letzten Jahrzehnten ihre Hilfen und Methoden in den Arbeitsfeldern, in denen sie wirksame Methoden der Einzel-fallhilfe, der sozialen Gruppenarbeit sowie Interventionen entwickelt haben, die sich auf Konzepte von Empowerment, von Ressourcenorientierung, der Sozialraumorien-tierung oder von Quartiers- und Gemeinwesenarbeit begründen, und zum Einsatz kommen.
Nach der Handlungsmaxime der Sozialen Arbeit, die maßgeblich „Hilfe zur Selbst-hilfe“ vorgibt, wird das unter Umständen sukzessive Drosseln der Hilfe und somit eine ebenso geplanten und beabsichtigten Nicht-Hilfe berücksichtigt, um sich so in der Rolle, in der das Aufgabenrepertoire des professionell Helfenden angelegt ist, überflüssig zu machen. Ziel muss es letztendlich sein, sich vollständig aus dem Ge-sichtsfeld des Hilfesuchenden, somit aus seiner Lebenswelt und seinem Alltag zu ent-fernen und sich vollständig zu entziehen. Dieser Prozess unterliegt häufig einem kontroversen Ringen zwischen Helfer und Klient, von dem Ressourcenaktivierung und Autonomie eingefordert wird und er darauf mit Regression, Kränkung, Wider-stand oder Passivität reagiert.
Der Begriff der sozialen Ausgrenzung umfasst über die materiellen Unterstützungs-lagen hinaus zudem Aspekte sozialer und psychosozialer Benachteiligungen, sowie
188 Heitmeyer, W.: Kontrollverluste und Bedrohungsgefühle. In: Frankfurter Rundschau vom 06.05.2000 und vom 08.05.2000
97
eine zeitliche Dimension, die dann von Armutsbiographien und Armutskarrieren be-richtet.189 In dieser Dimension sind auch die Zuschreibungen wie Patientenkarrieren, „Knastbiographien“ oder über mehrere Generationen anhaltende „Jugendamtslauf-bahnen“ etc. einzuordnen, die allesamt einen langanhaltenden, teils generationsüber-greifenden, überdauernden, „genetisch“ induzierten, sozialen Ausgrenzungsprozess beschreiben.
Aus soziologischer Sicht stellt Behinderung und Krankheit, die im wechselseitigen Sinne Ursachen und Folgen für lang andauernde Exklusionsprozesse sein können, nicht nur ein biologisches Phänomen dar, sondern sie basiert auf einer sozialen Re-aktion durch die Gesellschaft, insofern, als sie von Menschen erkannt, bezeichnet und etikettiert wird und als sie durch das eigene Verhalten Rechnung tragen.190
Die soziale Bewertung von Gesunden, Normalen oder Erwünschtem ist der Vorstel-lung von Krankheit und Behinderung konträr, da sie, wie das PARSON ausdrückt, stets „soziale Abweichung“ bedeutet. Die soziale Bewertung beinhaltet stets eine Aussage zur Prognose (dauerhaft), zur Verantwortlichkeit (nicht verantwortlich) und wird durch das Stigma (unerwünscht) besiegelt, worunter GOFFMANN eine „soziale Reaktion“ versteht, die letztendlich dazu führt, dass schließlich die Identität191 be-schädigt wird.
„Der Normale und der Stigmatisierte sind nicht Personen, sondern eher Perspekti-ven. Diese werden erzeugt in sozialen Situationen während gemischter Kontakte Kraft der unrealisierten Normen, die auf das Zusammentreffen einwirken dürften. Die lebenslänglichen Attribute eines bestimmten Individuums können bewirken, dass es als Typ festgelegt ist, es kann die stigmatisierte Rolle in fast all seinen sozialen Situ-ationen spielen müssen, (…) ihre bestimmten stigmatisierenden Attribute determinie-ren jedoch nicht die Natur der zwei Rollen, normal und stigmatisiert, sondern bloß die Häufigkeit mit der sie eine von ihnen spielt“192.
Da es in der Betrachtung GOFFMANS um Interaktionsrollen und nicht um Indivi-duen geht, entfaltet der Stigmatisierte in vollem Umfang die normalen Vorurteile ge-genüber jenen, die in einer anderen Hinsicht stigmatisiert sind.
Solange Kranke oder Menschen mit Behinderung in den therapeutischen Prozess ein-steigen, wird er von normalen Rollenverpflichtungen befreit, er wird nicht verant-wortlich gemacht. Die Gesellschaft beansprucht jedoch das Recht, das Verhalten der Freigestellten sowohl zu kontrollieren als auch zu sanktionieren. Es werden Hilfe-pläne, Eingliederungsvereinbarungen, Rehabilitationspläne, Behandlungsverträge als
189 vgl. Leibfried, S. et al (1995): Zeit der Armut. Frankfurt/M. 190 vgl. Freidson, E. (1979): Berufs-, und wissenssoziologische Durchleuchtung einer Profession. Stuttgart. S.:177 191 Goffmann versteht unter dem Begriff der persönlichen Identität, dass das Individuum mit einem positiven Kennzeichen oder Identitätsaufhänger und den einzigartigen biographischen Lebensdaten und lebensgeschicht-liche Ereignisse das einzelne Individuum ausmacht, schließlich zu einem unverwechselbaren und einzigartigen Individuum werden lässt, das von allen anderen differenziert werden kann, „…und dass rings um dies Mittel der Differenzierung eine einzige kontinuierliche Liste sozialer Fakten festgemacht werden kann, herumgewi-ckelt wie Zuckerwatte, was dann die klebrige Substanz ergibt, an der noch andere biographische Daten festge-macht werden können.“ vgl. a.a.O. Goffmann. S.74. 192 Goffmann, E. (2014): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. 22. Auflage. Suhr-kamp-Verlag. Frankfurt/M., S.170.
98
Teil der Aufnahme und des Leistungszugangs erstellt, in denen der Leistungserbrin-ger und der Leistungsnehmende oder Klient über eine fortan zeitliche Dimension, die erfolgten Maßnahmen und die damit angestrebten Zielsetzungen eine Übereinkunft treffen.
Wird Behinderung oder Krankheit aber generell gesellschaftlich als pathologischer Zustand betrachtet, so zieht der Status wie der des Kranken eine Ausgliederung aus „normalen“ schulischen und beruflichen Einrichtungen nach sich. Langanhaltende Krankheiten lassen normale Lebensperspektiven nicht zu. Das Individuum erlangt zu seinem Schutz einen Sonderstatus, ebenso wie sich umgekehrt die Gemeinschaft vor Krankheit und Behinderung zu schützen trachtet. Der zentrale Verlust von sozialen Kontakten ist die Folge. So wird der Mangel, der Verlust an gesellschaftlicher Teil-habe als eigentliche Behinderung manifest.193
Das trifft genau ins Herz der gegenwärtigen Debatten, die exemplarisch in der Klein-kinderbetreuung und in den Schulbetrieben über die Aufnahme bzw. Ablehnung von behinderten Kindern, in der das Dilemma um Ex- und Inklusion das Wesen des Topos umfasst, geführt werden. Es geht doch auf Seiten der Zögernden und Zaudernden, der Zweifler nicht darum, zunächst und umfassend die Einrichtungen und Schulgebäude „inklusiv“ umzubauen, (hier besteht ja z. B. schon nach § 3 Abs. 4 die Landesbau-verordnung (LBO) für Baden-Württemberg, die vorgibt, dass die Belange behinderter oder alter Menschen, Kinder etc., nach Möglichkeiten, in die Planungen von Gebäu-den, die öffentlich genutzt werden, in einem barrierefreien Sinne, miteinzubeziehen sind). Es geht nicht darum, im Vorfeld gesonderte Schlüsselqualifikationen für Lehr-kräfte und Fachpersonal aufwendig umzusetzen oder gesonderte Strukturen zu schaf-fen oder inklusives Schulmaterial zu entwickeln. Es geht in erster Linie vielmehr da-rum, dass die Trennung zwischen behindert und nichtbehindert, zwischen Regelschule und spezialisierte, örtlich und räumlich abgetrennte Beschulungs- for-men aufgehoben, aufgelöst und letztendlich zu einem gemeinsamen Schulsystem zu-sammengefügt und integriert wird. Es geht hierbei um ein Umdenken, eine Verände-rung der Haltung, der Einstellung, um ein Einbrechen der bestehenden Mauern und Trutzburgen in den Köpfen der Verantwortlichen, die um den Verlust des Ansehens der Schule, um ein Absinken des Notendurchschnitts der Klassen, um Kritik aus der Elternschaft, um eine Reduktion der Anmeldungen und schließlich der Schülerzahlen bangen. Vorbild könnte das „first-place-then-train“ Modell sein, das PLÖSSL & HAMMER194 für den Bereich der beruflichen Rehabilitation für psychisch kranke Menschen entwickelt und etabliert haben. Zunächst einmal ist Schülern dort ein Schulplatz zu geben, wo sie und ihre Eltern das wollen, unabhängig von ihren Beein-trächtigungen und Einschränkungen. Die Strukturen und didaktischen Notwendigkei-ten können in einem weiteren Schritt noch immer platziert und nachjustiert werden.
193 vgl. Metzler, H. Wacker, E.: Behinderung. In: Handbuch der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Otto, H. U. & Thiersch, H. (Hg.). 2. Auflage. Luchterhand. Neuwied:2001, S. 130 ff. 194 vgl. Plössl, I., Hammer, M.: ZERA-Zusammenhang zwischen Erkrankung und Rehabilitation und Arbeit. 6. überarb. Aufl., Psychiatrie Verlag. (2013) Bonn.
99
Ein weiteres Kriterium in der Exklusionsdebatte auf sozialarbeiterischer Ebene ist die Gestaltung des Kontaktes, der Beziehung, der Bindung, des Binnenverhältnisses zwi-schen Helfer und Klient, um Exklusion zu vermeiden, um schließlich exkludierende Prozesse nicht loszutreten.
Wie gelingt der Sozialarbeit/Sozialpädagogik die Gratwanderung in der Ausgestal-tung des Unterstützungsangebotes, um in einem angemessenen, personenzentrierten Sinne die Häufigkeit und das Maß der Hilfe den Vorstellungen, Wünschen und der Lebenslage des Einzelnen anzupassen? Es gibt einerseits Helfer-Klient Beziehungen, die in ihrer Rollendefinition und Zuschreibung eindeutig sind und andere, bei denen Helfen und Unterstützen auch Kontrolle und eine perpetuierende Risikobeurteilung bedeutet, wie z.B. in der Betreuung von ehemals forensisch-psychiatrischen Patien-ten, von ehemaligen Häftlingen, von Klienten mit Bewährungsauflagen, von Patien-ten in psychiatrischen Kliniken, Suchthilfeeinrichtungen oder von Bewohnern, die in geschlossenen Einrichtungen untergebracht sind.
Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien verarbeiten ihre Kommunikation und die daraus folgenden Handlungen in binäre Differenzkategorien. Soziale Arbeit ist ein weiteres Beispiel für eine binäre Codierung, denn sie wählt zwischen Hilfe und Unterstützung versus Kontrolle. So muss der gesellschaftlichen Auftrag, so RUF,195 zu einem Kontrollparadox werden, das da lautet, je mehr Kontrolle, desto mehr ent-ziehen oder flüchten sich die Kontrollierten, oder lehnen das Kontakt- und Hilfsan-gebot ab. Somit ist Soziale Arbeit darauf angewiesen, die eigene Kontrolle selbstre-ferentiell und aufmerksam zu beobachten, die ausübende Kontrolle quasi selbst zu kontrollieren, schließlich als qualitätssichernder Handlungsstandards. Aus diesem Dilemma kann Beziehungsarbeit, nachgehend aufsuchende Hilfsangebote, empathi-sches Zugehen und sensibles Nachgehen und Aufsuchen und u.U. eine konsequente Verantwortungsübernahme auf der Grundlage einer fortlaufenden Prüfung von Au-tonomie und Verantwortung auf Seiten des Klienten, bei gleichzeitiger Abwägung der angemessenen Intervention und professionellen Handlung des professionellen Helfers führen.
BAECKER (2007) empfiehlt für die soziale Arbeit die Codierung Hilfe und Nicht-helfen, bzw. die prüfende Schlüsselfrage, wie lange, wie umfangreich und in welchen Lebensbereichen muss geholfen werden, bis sich jemand ohne Hilfe selbst helfen kann? Die Antwort auf diese zentrale Frage kann schließlich Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Prozess nehmen, in dem sich der Hilfesuchende bzw. Hilfebedürf-tige befindet.
Diese Einschätzung hat sich weiter durch eine zunehmende Ökonomisierung und ei-nem politischen Wandel einer neoliberalen Ausrichtung der Sozialsysteme nach dem Motto „Fördern und Fordern“, die seitdem mit einem soziokulturellen Verände-rungsprozess einhergeht. Dieser Prozess wird von einer ansteigenden Individualisie-rung bei gleichzeitiger Singularisierung und einem Bedeutungsverlust von sowohl
195 vgl. a.a.O. Ruf, P.: Teilhabeplanung als gemeindepsychiatrischer Kernprozess. In: Gromann, P. (Hg.): Mit Teilhabeplanung zu einer individuellen ambulanten Versorgung. Psychiatrie Verlag. 2012 Bonn. Fuldaer Schriften, Band 2. S. 20.
100
sozialer Einrichtungen (wie z.B. die Kernfamilie oder soziale Netzwerke) als auch von institutioneller Einrichtungen, wie z.B. Schule oder Kirche, beschleunigt.
Die in allen Alltags- und Lebenswelten dominierende und zeit- und raumbeanspru-chende Informationstechnologie, die die Generation der „digital native“196 im Gegen-satz zu den vorhergehenden Generationen beherrscht, trägt maßgeblich zu einem Konsum- und Erlebnismuster bei, das durch ein wachsendes Distinktionsbewusst-sein, so BAUMANN (2008)197 zum Ausdruck kommt. Massenmedien, TV-Kanäle, Internet, social media, sozial-virtuelle Kontakträume bestimmen in einem zunehmen-den Maße, wie wir die soziale Welt und schließlich das gesellschaftliche Leben an sich wahrnehmen.
Wir sind nach wie vor verunsichert, da wir zunehmend in einer Gesellschaft leben, die sich nach Sicherheit im Beruf, in der Partnerschaft oder nach materieller Siche-rung sehnt. Durch die Terrorakte durch den IS oder Al Kaida in 2015 und 2016, die auch weiter Europa einbeziehen, dominiert die Angst um eine körperliche und seeli-sche Unversehrtheit und das Bedürfnis nach Sicherheit auf der Straße, bei sportlichen und kulturellen Großveranstaltungen, in Restaurants und Straßencafés nimmt an Be-deutung zu. Gleichzeitig werden in der beruflichen Welt seit Jahrzehnten die Anfor-derungen an Flexibilität, Mobilität, an die jeweilige Veränderungsbereitschaft und Anpassungsleistung erhoben. Die Prozesse von Individualisierung der Nachkriegsge-sellschaft und dem daraus resultierenden Postulat von Selbstverwirklichung, von in-dividuellen Alleinstellungsmerkmale einer möglichst starken, schönen, erfolgreichen und vor allem leistungsfähigen Persönlichkeit, münden, flankierend durch das Vor-leben einer mediale Veröffentlichung der eigenen Person, in folgenschwere und kon-frontative Dilemmata.
Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Spaltungsprozesse und der mit ihnen verbun-denen gesellschaftlichen Machtkonstellationen ist allerdings zu befürchten, so SCHARCHSCHUCH et al198, „dass das Konzept der Dienstleistung mit seinen stark partizipativen Implikationen in erster Linie in all jenen Handlungsbereichen zum Tragen kommt, in denen es um Inklusion der Adressaten geht. In den Bereichen, in denen das Management der Exklusion im Vordergrund steht, ist die Verstärkung zwangsförmiger wie punitiver Handlungsformen wahrscheinlich. Die letztere Ent-wicklung negiert die nutzerorientierte Grundprämissen von Dienstleistung. Soziale Arbeit, die mit Zwang und Strafe operiert, ist keine Dienstleistung.“
196.http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20 Natives,%20Digital%20Immi-grants%20-%20Part1.pdf. Download vom 6.4.2014 197 Baumann, Z. (2008): Flüchtige Zeiten. Leben in der Ungewissheit. Edition Suhrkamp. Hamburg, S. 88. 198 Schaarschuch, A., Flösser, G., Otto, H-U (2001): Dienstleistung. In: Handbuch der Sozialarbeit-Sozialpäd-agogik. Otto H U & Thiersch H (Hg). 2. Aufl. Neuwied. Luchterhand. S. 272.
101
4.5. Diskurs von Exklusion im Feld der Gemeindepsychiatrie
Trotz breiter Initiativen zur Entstigmatisierung, trotz weiterentwickelter Integrations-maßnahmen und Angebote bestehen die Vorurteile gegenüber psychisch kranken Menschen fort. Diese sind mit folgenreichen Klassifikationen verbunden, weil sie so-ziale Urteile beinhalten, die diskriminierendes, also abschätziges, aggressives oder benachteiligendes Verhalten ausdrücken oder aber segregative Strukturen (Heime) legitimeren und somit die Chance zur gesellschaftlich-sozialen Teilhabe konkret be-grenzen. In diesem Sinne können sie Abstiegskarrieren, (Exklusionsbiographien) in-nerhalb der Teilsysteme der Bildung, des Arbeitsmarktes und des Versorgungssys-tems einleiten, verfestigen und setzen schließlich Betroffene einer besonderen Aufmerksamkeit informeller wie auch formeller sozialer Kontrolle aus.199
199 vgl. Kardorff, v. E. (2010): Zur Diskriminierung von psychisch kranken Menschen. In: Diskriminierung. Grundlagen und Forschungsergebnisse von Hormel, U. Scheer, A. (Hg.) VS-Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden. 1. Aufl. S. 279 ff.
Dieser Spagat soll auf der Grundlage von Hilfeplänen, Eingliederungsvereinba-rungen und Behandlungsverträgen erfolgen. Soziale Arbeit wählt innerhalb ihres methodischen Repertoires, zwischen den Dimensionen Hilfe, Unterstützung und Kontrolle aus. Sie ist aber darauf angewiesen mit der ausgeübten Kontrolle selbst-referentiell und reflektiert, als signifikanter Qualitätsstandard, umzugehen. Wann und wie lange, mit welchen Methoden, auf der Basis welcher theoretischer An-sätze soll auf die Gruppe der TSSP, auf ihre biographischen und strukturellen Be-nachteiligungen und dem sozialen Ungleichheitsprozess Einfluss genommen wer-den, sind die Aufgaben, vor der Soziale Arbeit allein dasteht?
Zwischenfazit: Die Gruppe der TSSP könnte für die Gesellschaft stellvertretend die Gruppe sein, die den modernen und flexiblen Ansprüchen der Alltags-, Le-bens- und Berufswelt nicht entspricht. Sie sind stellvertretend den Risiken der Gesellschaft, die nach Sicherheit, nach Prosperität und Anpassung sucht, ausge-setzt und ihr unterlegen. Sie repräsentieren die Übrigen, die Exkludierten und er-fahren in prägnanter Weise, die Formen und Ausgestaltungen von sozialer Aus-grenzung als Gesetzmäßigkeit einer Gesellschaft. Dies geschieht in der Folge von sozialer Abweichung durch ihre mehrfachen Benachteiligungsmerkmale, jung, psychisch krank, traumatisiert, eigensinnig, unangepasst, suchtkrank, wohnungs-los mit entsprechend niedriger schulischer und beruflicher Qualifikation. Die Er-wartungen der Gesellschaft fordern gegenüber der Sozialen Arbeit ein, sich mit dieser Gruppe zu beschäftigen, und auseinanderzusetzen, gleichzeitig soll sie sie auch kontrollieren, disziplinieren und sanktionieren ohne dabei die Ursachen von Exklusion zu thematisieren.
102
„Den nicht Betroffenen hilft die Zuordnung von Personen oder Gruppen zu einer Au-ßenseitergruppe bei der eigene Verhaltensorientierung, bekräftigt die Geltung sozi-aler Normen, mahnt zu Vorsichtsmaßnahme, provoziert spezifische Verhaltensweisen der „Normalen“, (sodass der Kontakt zu den Betroffenen sowohl in der Sprache, Tonfall und Gestik übertrieben bemüht wirkt etc.) und stärkt letztendlich das Zusam-mengehörigkeitsgefühl,“ das den „rechtfertigungsbedürftigen sozialen Ausschluss ei-nes Mitglieds aus der Gesellschaft legitimiert.“, so KARDORFF.200
Die Gruppe, welche mit der Kategorie „psychisch krank“ bezeichnet wird, ist sowohl in deren Symptomausgestaltung, als auch in Auswirkungen auf soziale und berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten hoch differenziert. Die Anforderungen der gegenwärti-gen Arbeitswelt bringen neue Reaktions- und Auswirkungs-Phänomene hervor. Nach EHRENBERG erfährt der starke Anstieg des Burn-Out Syndroms als Krankheit An-erkennung, da die betriebliche Produktivität beeinträchtigt wird und mit dem Risiko einer Frühberentung assoziiert wird. Chronische Erschöpfungszustände als Reaktion auf stark ansteigende Leistungsanforderungen im Beruf und in der Work-live Balance sind zu einem Kennzeichen der gegenwärtigen Zeit geworden.201 Während chroni-sche Rückenbeschwerden ohne Befund und medizinische Erklärung als psychosoma-tische Störung bewertet werden, erfahren im Gegensatz dazu die Menschen mit schi-zophrenen Erkrankungen oder affektiven Psychosen ein vielschichtiges und differenziertes Hilfeangebot. Zugleich sind sie aber mit den stärksten Vorurteilen, die zudem oft mit Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit und sozialem und materiellen Abstieg ausgesetzt; dabei erleben stationär behandelte eine noch stärkere Diskrimi-nierung als ambulant behandelte Patienten, so KRUMM und BECKER202 (2005).
Es besteht jedoch auf Hinweis von HYER & WITTCHEN die Gefahr, dass weit ver-breitete Störungen wie Ängste und Erschöpfungszustände lange unerkannt bleiben, in der Umwelt verharmlost und schließlich von den Versorgungssystemen vernach-lässigt werden.
In den letzten 30 Jahren fand im Arbeitsfeld der Sozial- bzw. Gemeindepsychiatri-schen Hilfen eine bemerkenswerte Entwicklung statt, die zu Beginn eine eher antipo-dische Rolle gegenüber der klinisch-medizinischen Psychiatrie und der Heimversor-gung eingenommen und beansprucht hat; einerseits darüber bewusst, dass der „Antagonist“ Klinik, im gleichen Maße benötigt wird, um selbst zu bestehen und sich weiter zu entwickeln. Die Anfänge der Gemeindepsychiatrie prägten die Handlungs-leitlinien von Enthospitalisierung, Ambulantisierung, Individualisierung und perso-nenzentrierte Hilfeplanung, aber sie legten auch darauf Wert, eine soziale, ethisch-menschliche, eben eine anthropologische Ausrichtung und Bedeutung des professio-nellen Handelns, bei einer sich fortlaufend veränderten Schwerpunktsetzung der Kli-entel (psychisch kranke Frauen, wohnungslos und psychisch Kranke, „junge Wilde“, suchtkranke und psychisch Kranke, aus dem Straf- oder Maßregelvollzug Entlassene, Patienten mit Borderline-Störung, traumatisierte Klienten usw.). Im gleichen Maße
200 a.a.O. Kardorff. S. 279-280. 201 Ehrenberg A. (2004): Das erschöpfte Selbst- Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt. M. 202 Krumm, S., Becker, T. (2004): Versorgung psychisch Kranker zwischen Stigma und Intervention. In: Gaebel, W., Möller, H. J., Rössler, W. (Hg): Stigma-Diskriminierung-Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker. Stuttgart, S. 179-195.
103
haben sich gemeindeferne, psychiatrische Kliniken nach außen hin geöffnet, die Iso-lation zugunsten einer postklinischen Behandlung mittels Psychiatrischer Institut-sambulanzen eingeführt und den Ausbau von Ambulant Betreuten Wohnen durch die angegliederten Hilfsvereine u.a. ausgebaut.
Sukzessive kam es zu einem Abbau und Reduzierung der sogenannten Langzeitstati-onen sowie einer Vermittlung der chronisch psychisch kranken Langzeitpatienten in die schließlich extramuralen, sozialpsychiatrischen Hilfen, in deren originäre Heimat bzw. Herkunftsgemeinden. Die Sozialpsychiatrie entdeckte und anerkannte die Not-wendigkeit einer auch stationären Versorgung im Bereich Wohnen, sowie die Bedeu-tung des Bedürfnisses gebraucht-zu-werden und beschäftigt-zu-sein, zu arbeiten, als eine normale wichtige Tagesstrukturierung von Zeit und ein Ort der Selbstwirksam-keit und der Selbstbedeutung.
Die Finanzierung der psychiatrischen Kliniken forderten aufgrund knapper Haus-haltsmittel eine gewinnorientierte Ausrichtung, privatwirtschaftliche Handlungsleit-linien und Prozesse der Arbeitsverdichtung, der Ausbau von Betten für Privatpatien-ten zum Nachteil der Patientengruppe der chronisch psychischen Kranken. Die die Einflüsse des DRG203 mit den Vorgaben und Ansprüchen der Krankenkassen von verkürzten Verweildauern erhöht massiv den Druck auf eine effizientere und schnel-lere Behandlung und einen rascheren Genesungsprozess. Teilweise geschieht dies mit dem Nebeneffekt, dass Entlassungsprozesse auch bei teilweise instabilen Patienten vorgenommen werden, deren psychosoziale Lebenssituation unklar und diffus ist und deren ärztliche Behandlung außerhalb der Klinik ungünstig ist und eine hohe Wahr-scheinlichkeit einer Rehospitalisierung bzw. eines Rezidivs der bekannten Erkran-kung besteht.
In der Krankenhausbehandlung kehrt zunehmend ein Selbstverständnis ein, das mit dem KAIZEN Prinzip des Erfinders von „Toyota Productions“ zu beschreiben ist:
„Alles was wir tun, ist, auf die Durchlaufzeit zu achten, und zwar von dem Moment an, in dem wir einen Kundenauftrag erhalten, bis zu dem Moment, da wir das Geld in Empfang nehmen. Wir verkürzen die Durchlaufzeit, in dem wir alle Bestandteile eliminieren, die keinen Mehrwert generieren.“204
Hervorzuheben ist die Bedeutung des KAIZENS Prinzips, das von einer starken Pro-zessorientierung im Team ausgeht und zu einer Auflösung hierarchischen Denkens zwischen Ärzte, Pflegekräfte, Sozialdienst und Therapiepersonal kommt, das als hin-derlich, weniger lösungsorientierter bewertet wird. Doch das Beharrungsvermögen an Gewohntem ist stark weil Veränderungen und Neues Angst bereiten und zunächst auf Ablehnung stoßen. Das Klagen über ineffiziente Arbeitszustände oder den ver-schwenderischen Umgang mit Informationen und Zeit durch Kommunikation, die weder vernetzt ist noch mit anderen angrenzenden Prozessen verknüpft, wird bevor-zugt. Dieses konservative Denken und in sich verharrende Systeme können meist nur
203 Diagnostic Related Groups (DRG): deutsch: diagnosebezogene Fallgruppen. DRG bezeichnet ein Klassi-fikationssystem für ein Abrechnungsverfahren (pauschalisiert), mit dem Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden, anhand von medizinischen Daten, von Leistungsbezeichnern (z.B. Diagnosen, demogra-phische Variablen etc.) Fallgruppen aufgrund ihrer methodischen Ähnlichkeit zugeordnet werden. 204 Ohno T.: Das Toyota Produktionssystem. Campus Verlag. 1993 Campus. Frankfurt/M. S.64-67
104
durch das Vorleben der Führungskräfte verändert werden, die verbesserte Arbeitsab-läufe mittels einer Ideologie „Prozessorientiertes Teamwork“ dem gesamten Team als Aufgabe anbieten: Die Attraktion besteht darin, dass das Experimentieren und Ausprobieren als Feld bei jedem Einzelnen beworben wird, um schließlich als Team vereinbarte Standards zu definieren, mit dem Ziel, Warte- und Bearbeitungszeiten zu reduzieren und insbesondere wiederkehrende und wiederholende Prozesse, wie z.B. (Aufnahmen, Einarbeitung neuer Mitarbeitenden, Entlassvorbereitungen von Klien-ten/Patienten, Kostenverlängerungen, Dokumentation etc.) in einem optimalen und effizienten Sinne zu gestalten.
SCHAARSCHUCH, der sich mit dem Nutzen Sozialer Arbeit auseinandersetzt, stellt fest, es könne z.B. in Konzeptionen nachgelesen werden, was die Institution mit ihren Programmen und die Professionellen mit ihrem Handeln und mit Hilfen, auf der Grundlage welcher Methoden und Angebote, beabsichtigen, bewirken zu können. Nicht selten ist es der Fall, dass die Absichten und das Wirken nicht kongruent sind. Es kommt vielmehr, trotz des bemühten professionellen Tuns, zu einem deutlichen Auseinanderklaffen von Absicht und Wirken. So sind auch die Debatten in den letz-ten Jahrzehnten zu den Begriffen um Effektivität, Effizienz, Qualität und Wirksam-keit zu verstehen. Es ist vielversprechend, so SCHAARSCHUCH, sich gerade mit den Prozessen der sozialen Dienstleistungen, der Nutzung sozialpädagogischer An-gebote, der Perspektive der Nutzer und der sozialen Dienstleistungen zu widmen, wie sie auch nach ihrer Sicht den Nutzen des Angebots bewerten, wahrnehmen und beur-teilen.
Die neuere Dienstleistungstheorie konzentriert sich auf den Nutzen und die Angebote Sozialer Arbeit, die davon ausgehe, dass es sich im Dienstleistungsprozess um ein dialektisches Verhältnis von Produktion und Konsumtion sozialer Dienstleistungen handelt. Dass also die Konsumtion einer Dienstleistung zugleich ein aktiver produk-tiver Akt ist. Das entwickelte Verhältnis eines professionellen Produzenten zu einem koproduzieren- den Klienten ist diametral umzukehren. Der Nutzer ist der Produzent seines Lebens, seines Verhaltens und seiner Bildung, wohingegen die Rolle des Pro-fessionellen die Rolle des unterstützenden Ko-Produzenten ist.205
Der Nutzer konsumiert nur das, was einen Gebrauchswert hat, der der sozialpädago-gischen Dienstleistungen auch einen Gebrauchswert zuordnen kann. In dieser Per-spektive bestimmen wir den Nutzen personenbezogener, sozialer Dienstleistungen als die Gebrauchswerthaltigkeit professioneller Tätigkeiten im Hinblick auf die pro-duktive Auseinandersetzung mit den Anforderungen, die sich für den Nutzer aus den sich ihnen stellenden Aufgaben der Lebensführung ergeben.206
Der Begriff Nutzen ist durch eine Doppeldeutigkeit gekennzeichnet, denn er bezeich-net sowohl ein bestimmtes Produkt, den Nutzen, den jemand von einem Angebot hat als auch den Prozess des Nutzens eines bestimmten Angebots.
205 a.a. O. Scharschuch, A. (2005), S. 81ff 206 Oelerich, G. Schaarschuch, A. (2005): Der Nutzen Sozialer Arbeit. In: Soziale Dienstleistungen aus Nut-zersicht. Zum Gebrauchswert Sozialer Arbeit. Reinhardt Verlag. München. S. 9-23.
105
SCHAARSCHUCH differenziert bei der Analyse des Nutzens von sozialen Dienst-leistungen zwischen drei Dimensionen, die a. materielle, die b. personale und die c. infrastrukturelle Dimension.
Bei der a. materiellen Dimension geht es um gegenständliche, instrumentelle Phäno-mene, wie z.B. der konkrete Zugang und das Verfügen bei der Gruppe der TSSP über einen Barbetrag von derzeit 107,-€ p.m., einer Bekleidungspauschale und der Mög-lichkeit, selbständig gegenüber dem Warenwert zu handeln. So sind in der Praxis eine freiwillige Geldverwaltung oder tägliche vorgegebene Auszahlungen dauerhaft Quel-len und Anlass für Konflikte und massiven Auseinandersetzungen und Unzufrieden-heit. Der zweite Bereich des materiellen Nutzens, der sich materiell-stofflich-gegen-ständlich präsentiert, ist von im-materieller Natur und beinhaltet nicht-stoffliche Angebote. Dazu gehören z.B. Informationen zu Wechselwirkungen zwischen der Krankheit und den Lebenserfahrungen oder mit Drogen-, und Alkoholkonsum. Hierzu gehören Fragen nach der Hilfeannahmebereitschaft, der Compliance oder der Motivation der Klientel. Hierzu gehören Hilfestellungen, z.B. die Gruppe der TSSP in ihrem Wunsch bei der Wohnungssuche, der Vermittlung von Arbeit oder Beschäf-tigung, oder bei der sozialrechtlichen Beratung, sowie bei der Vermittlung von Frei-zeitangeboten etc. zu unterstützen. Der immaterielle Nutzen zielt auf eine Erweite-rung der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten ab. Er zielt auf den Erwerb weiterer konkreter alltagspraktischer Fertigkeiten ab, wie z.B. eine ökonomische Geldverwal-tung, eine regelmäßige und sachlich-angemessene Pflege des Wohnraums, beim Wä-sche waschen, soziale Konflikte zu klären, einen besseren Umgang mit den eigenen Ängsten, den Stimmungsschwankungen oder mit der Herkunftsfamilie zu erwerben. Hierzu gehören, sich Strategien für einen besseren Umgang der Selbstkontrolle, der Selbständigkeit anzueignen. Hierzu gehören, z.B. Ressourcen, Stiftungs- oder Spen-dengelder für den Erwerb von benötigten Gegenständen zu ermöglichen oder den Zu-gang zu Ämter, Behörden und spezifischen Beratungsstellen zu vermitteln.
b. Bei der personalen Dimension unterscheidet SCHAARSCHUCH verschiedene As-pekte, wie z. B. den Anerkennungsaspekt, d.h. der im Betreuungskontakt vermittelte oder versagte Respekt, die Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, nämlich als gleichwertiger Interaktionspartner am Unterstützungsprozess beteiligt zu sein. Der Zuwendungsaspekt beinhaltet die von der Betreuungskraft zugelassene oder nicht zu-gelassene emotionale Nähe oder der körperliche Kontakt. Der Macht- und Diszipli-nierungsaspekt, der von der Betreuungskraft ausgeübt wird, sowie die Verhaltens-steuerung durch Zwang, Druck oder die Steuerung der Geldauszahlung oder den Verweis auf die Entscheidungskompetenz über das Verbleiben oder den Leistungs-Ausschluss, bzw. die Kündigung aus dem Angebot oder der Maßnahme, die Umdeu-tung von Kontrolle als hilfreich und unterstützend. Oder die Umdeutung von Pünkt-lichkeit, als Einhalten von Absprachen und Vereinbarungen.
c. Die infrastrukturelle Dimension, die besonders bei den niederschwelligen Hilfen Sozialer Arbeit, wie z.B. in der Straßensozialarbeit, bei der mobilen Jugendhilfe, Dro-genhilfe oder der Sozialhotelbetreuung zur Geltung kommt, geht davon aus, dass schon die potentiell, zur Verfügung gestellte, vorgehaltene Hilfe, einen wirksamen Nutzen für die Nutzer darstellt. Also schon allein die Möglichkeit und den Zugang zu haben, ich könnte Hilfe beanspruchen, wenn ich sie benötige und abrufen würde, ist
106
eine aus Nutzerperspektive wirksame Hilfestellung sozialer Dienstleistung. Hierbei handelt es sich nicht, so MUNSCH, um einen Nutzen, der sich als strukturell konkrete Unterstützung realisiert, sondern bereits die Potentialität der Inanspruchnahme eines infrastrukturellen Angebots hat Nutzen, die persönlichen Aufgaben angehen zu kön-nen.207
Angebote der sozialen Dienstleistung haben bereits als Hintergrundressource, als Inf-rastruktur einen Gebrauchswert und nicht erst im Fall einer konkreten Inanspruch-nahme. Durch eine eigensinnige und aktive Mit- und Umgestaltung von baulich-räumlichen Strukturen der Einrichtung zugunsten eines spezifischen Bedürfnisses der Nutzer, z.B. in einen Fitness- oder Partyraum kann eine Nutzungsänderung der Inf-rastruktur einen Nutzen für die Adressaten generieren.
Weiter beschäftigt sich SCHAARSCHUCH mit dem Aneignungsprozess sozialer Dienstleistungen sowie mit der Bestimmung ihres Nutzens bezogen auf die Bedeu-tung für die alltäglichen Reproduktionsaufgaben, die in soziale, gesellschaftliche und institutionelle Relevanzkontexte, in Zusammenhang zu sehen sind. Während sich der Nutzen stets konkret auf Zeiten, Orte, Institutionen oder Personen realisiert, geht es SCHAARSCHUCH eher um die Relevanz, die diese Kontexte für die Nutzer haben. Hier wird zwischen einem subjektiven oder institutionellen Relevanzkontext unter-schieden.
Wesentlich ist der Gebrauchswert des Angebots von der subjektiven Wahrnehmung der Nutzer abhängig, von der Einschätzung der eigenen Lebenssituation, der aktuell existierenden und der sich ergebenden Problemlagen. Er ist abhängig davon, wie sich eine Problemlage darstellt, welche Ressourcen für die Bewältigung bestimmter Prob-leme zur Verfügung stehen und abgerufen werden können. Er ist zudem davon ab-hängig, welche Kompetenzen zur Verfügung stehen, um mit den Anforderungen des Alltags zurande zu kommen? Individuelle Präferenzen, gute oder schlechte Vorerfah-rungen mit dem Angebot spielen ebenso eine Rolle, wie auch die Frage, ob der Nutzer überhaupt ein Interesse findet, ob der Nutzer Anknüpfungspunkte an bisherige Hilfen schließen kann? Schließlich ist von Bedeutung, ob das Angebot kulturell-normative Orientierungen als Relevanzkontext berücksichtigt, also ob die adressatenspezifi-schen Besonderheiten und Bedürfnisse im Angebot verstanden werden? Der institu-tionelle Relevanzkontext bezieht sich auf die Merkmale der Institution, wie z.B. die Programmmerkmale (Zielsetzungen, Strukturelemente des Angebots: Wohnung, Geld, Beratung, Gruppenangebote, Regeln, Aufgaben, Absprachen etc., die Organi-sationsstruktur (die Hierarchien, die zeitlichen Strukturen, Einbindung im Hilfesys-tem, sowie das professionelle Konzept (Verhältnis von Nähe und Distanz, von Kon-trolle und Freizügigkeit, von Macht und Sanktionierungen).
207 Munsch, C. (2004): Adressatinnenorientierung als verlässliche und ganzheitliche Unterstützung in schwie-rigen Lebenslagen. In: Peters, F. Koch, J. (Hg.):Integrierte erzieherische Hilfen. Juventa. Weinheim, S. 219-246.
107
Hier ist auffällig, dass der Klient der Eingliederungshilfe, wie auch der Patient eines Krankenhauses oder einer psychiatrischen Abteilung als Kunde gesehen wird. Es wird eine Rollenzuschreibung definiert, die eine Begegnung auf Augenhöhe voraus-setzt, die jedoch in einem diametralen Gegensatz zum Binnenverhältnis einer Institu-tion definiert ist, ja, so definiert sein muss.
Schaubild 3: Dimension von Nutzen personenbezogener Dienstleistungen am Beispiel der Gruppe der TSSP in geschlossenen Einrichtungen.
NOUVERTNÉ stellt eine Schieflage in der Versorgung psychisch Kranker fest, schlägt provokante Töne an und bemängelt, dass sie von den zuständigen Institutio-nen nur mangelhaft betreut werden, dass sie in die Verwahrlosung geraten, dass sie ohne adäquate Hilfe auf der Straße leben und die Zahl derjenigen nach wie vor an-steigen, was in vielen Studien auch belegt werde. Es geht weniger um einen neuen Typus Einrichtung oder eine weitere Spezialisierung, als vielmehr darum, die Ar-beitskonzepte in den einzelnen Bereichen der Sozialpsychiatrie und der Suchthilfe zu ändern. Eine Lösung in einer integrierten Verknüpfung unterschiedlicher Perspekti-ven zu suchen, setzt nach NOUVERTNÉ voraus, dass sich der § 67 SGB XII Bereich mit den gemeindepsychiatrischen Einrichtungen in der Beschreibung der Problemla-
108
gen einig werden und entsprechend handeln. Grundvoraussetzung ist eine kontinu-ierlicher Erfahrungs- und Kommunikationsaustausch, der unbequem, schmerzhaft sein wird. Voraussetzung ist eine Analyse der eigenen Arbeitsstile und Konzepte so-wie der Mechanismen die Ausgrenzungen beinhalten. Die Einbeziehung, gerade der schwierigen Patienten in das psychiatrische Versorgungssystem ist offiziell abhängig vom jeweiligen Arbeitsplatzkontext. Die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe ist je-doch weniger entscheidend als die spezifischen Arbeitsbedingungen, der Arbeitsort und dessen gesellschaftliche Verankerung. Im Zuge dieser Betrachtung wird die psy-chiatrische Versorgung sehr unterschiedlich erlebt.208
So stellt NOUVERTNÉ stellt im Zuge einer quantitativen Beschreibung der Prob-lemlagen fest, dass das psychiatrische Hilfesystem weniger als die Hälfte der behand-lungsbedürftigen psychisch Kranken, unabhängig vom Schweregrad der Störung, er-fasst. Ein großer Teil der psychisch Kranken ist vollkommen unversorgt und ohne fachliche und soziale Unterstützung. Sie leben als „Eigenbrödler“ vergessen in den urbanen Ghettos oder in vollkommen überforderten Familiensystemen, so dass An-gehörige psychisch Kranker auch heute noch die Hauptlast der Versorgung tragen. Die Inanspruchnahme der psychiatrischen Hilfen erfolgt abhängig von der Schwere der Störung der jeweiligen Klienten. Das soziale Bezugssystem ist maßgeblich aus-schlaggebend für den Behandlungs- und Versorgungsort. Dabei werden weitaus mehr schwer psychisch kranke Menschen von niedergelassenen Allgemeinärzten als durch Nervenärzte und Psychiater behandelt. Die geringe Zugangsschwelle zum prakti-schen Arzt, die größere Mobilität und Flexibilität durch z.B. Hausbesuche und die Tatsache, dass Hausärzte bis zu 80% der hochpotenten Neuroleptika zur Psychose-behandlung verschreiben, sind Erklärungen und Indikatoren für die Vorzüge der be-schriebenen Zielgruppe.
Die qualitative Beschreibung der Problemlagen fällt bei Nouvertné so aus, dass es gut gemeinte therapeutische Konzepte mit bestimmten Vorstellungen über psychi-sche Gesundheit gibt, die generalisiert werden. Überforderungen und Grenzerfahrun-gen sind Gründe, dass (mancherorts) in ambulant sozialpsychiatrischen Bereichen Selektionsmechanismen entstanden sind, die zur Ausgrenzung geführt haben und an deren Ende der Effekt steht, dass gerade die als schwer gestörte Menschen Bezeich-neten auch als störend aus dem psychiatrischen Hilfesystem herausfallen.
Gerade die weniger Pflegeleichten, die Störenden, die Querulanten fallen aus den Einrichtungen heraus. Ihr Verhalten, das als therapieresistent interpretiert wird, führt bei den Mitarbeitenden zu Ohnmachtsgefühlen, die schwer auszuhalten sind.
Strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen und die Eingrenzung der Zu-ständigkeit des Personenkreises führen verstärkend zu Ausgrenzungseffekten. NOUVERTNÉ setzt seine Kritik fort, indem er analysiert, dass Mitarbeitende in psy-chiatrischen Institutionen i.d.R. nicht für die Menschen und deren Lebenswege ver-antwortlich sind, als vielmehr für die Einrichtung und deren ökonomisches Überle-ben. In-Ruhe-gelassen-Werden ist eines der Grundbedürfnisse von schwer psychisch
208 Nouvertné, K. Wessel, T., Zechert, C. (Hg.): Neue Perspektiven. In: Obdachlos und psychisch krank. Psy-chiatrie Verlag. (2002) Bonn. S.168-170.
109
kranken Menschen, dem diametral eine hohe soziale Stimulation durch das psychiat-rische Versorgungssystem gegenüber steht. Solange psychiatrische Hilfesysteme nicht das Bedürfnis nach Ruhe und Akzeptanz von Anders-Sein integrieren, solange bekommen Angebote eine Attraktivität, die diesen Bedürfnissen entsprechen. Die Straße und „67er-Einrichtungen“ scheinen hier eher Individualität zu ermöglichen, die in der Psychiatrie in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen ist. Es ist notwen-dig und an der Zeit, so der Appell NOUVERTNÉS, eine gemeinsame Problemdefi-nition zu erstellen, weil sie erforderliche Auseinandersetzungen, Konflikte entstehen lassen, um neue Perspektiven in der psychiatrischen Arbeit, um veränderte Versor-gungsstrukturen, von einer moralisierenden auf eine pragmatisch zu bewältigende Ebene herunterzuschrauben. In diesem Sinne müssen sich sowohl die Konzepte der psychiatrischen Einrichtungen, die persönliche Arbeitshaltung und Strategie der Trä-ger als auch die Vorgaben der Kostenträger verändern. Bei der Konzeptumsetzung einer gemeindenahen Psychiatrie ist eine gemeinsame Prioritätenliste der § 53er und 67er Hilfen auf Grundlage einer Bestandsaufnahme der Versorgung, die beide Berei-che abdecken, erforderlich. Welcher Bedarf wird durch bestehende Angebote befrie-digt? Welche Gruppen psychisch Kranker fallen durch die Maschen? Die Versor-gungslücken der Primärversorger, z. B. der Angehörigen, Streetwork, Alten- und Pflegeheime, die für die Betreuung von psychisch Kranken nicht ausgestattet sind, gilt es einzubeziehen. Welchen Unterstützungsbedarf haben diese Primärversorger, um ihre Aufgaben kompetent und effizient nachzukommen? Es gilt zu erheben, wel-che Menschen unversorgt, hilflos und am Rande der sozialen Systeme stehen.
Am Ende einer Bestandsaufnahme wird man sich von der These verabschieden müs-sen, dass psychiatrisch Hilfebedürftige gleichermaßen betreut werden können. Es ist eine Prioritätenliste zu erstellen, die sich nach gemeinsam erarbeiteten inhaltlichen Kriterien ausrichtet. Denn nicht nur diejenigen Klienten, die in regelfinanzierten Ein-richtungen aufzufangen sind, sind zu betreuen, sondern es sollte vielmehr im Vorder-grund stehen, dass die schwer gestörten und störenden Klienten erste Versorgungs-priorität haben und ihnen größere Ressourcen gewidmet werden.
Klienten, die in 67er Einrichtungen leben, so NOUVERTNÉ, sind nach § 53 zu fi-nanzieren. Dadurch wird auch der flexible Bestandsschutz der 67er Einrichtungen gewährleistet. Therapielose Konzepte für schwer gestörte physisch Kranke sind zu initiieren und zu finanzieren, die bei Bedarf die Option der Unterstützung bereithal-ten.209 Im Individualfall ist auch, unter dem Aspekt einer Schadensbegrenzung für Umwelt und für ihn selbst, der einzelne Klient so zu belassen. Mitarbeitende mit ho-her psychiatrischer Kompetenz unterstützen im systemischen Sinne die Primärver-sorger in ihrer Selbstorganisation und Selbstregulation, um so eine Dolmetscher-Funktion gegenüber den Angehörigen und den 67er Einrichtungen anzubieten.
Die Reduktion der therapeutischen und rehabilitativen Ansprüche vieler psychiatri-scher Einrichtungen birgt bei allzu idealistischen Anwendungen die Gefahr, dass Menschen, die ihm nicht genügen, ausgefiltert werden. Reduktion des therapeuti-schen Anspruches heißt, dass sich die Einrichtungen einer Region auf Versorgungs-prioritäten, aber auch auf gemeinsame inhaltliche Zielsetzungen verständigen. Eine
209 siehe Hotel-Plus Konzept in Köln: www. stadt-koeln. Hilfeform für wohnungslose Menschen mit psychi-atrischen Problemen. Download vom 21.10.2016.
110
Hierarchie von Versorgungszielen ist zu erstellen, so dass die Befriedung eines Teil-ziels auf einer jeweils vorangegangenen Ebene gegeben sein muss, bevor auf der nächsten Ebene weitergearbeitet wird.
Schaubild 4:Versorgngsziele in der Betreuung und Begleitung von chronisch psychisch kranken Menschen nach NOUVERTÉ.
Schließlich geht es darum, die Verteilung der Ressourcen und die gemeinsame Ziel-setzung der Psychiatrieplanung in Beziehung zu setzen, so NOUVERTNÉ.210
NOUVERTNÉS kritische Einwürfe, bezogen auf die unterschiedlichen Arbeitsfelder und ihre unterschiedlichen Arbeitskonzepte, methodischen Ansätze, theoretischen Grundlagen und strukturellen Rahmenbedingungen, haben ihre Berechtigung. Unbe-rücksichtigt bleibt jedoch, die in gemeindepsychiatrischen Einrichtungen bestehende Koppelung von Betreuungs- und Mietverträge, die im Gegensatz zu den in der Woh-nungsnotfallhilfe gängigen Nutzungsverträge, den gesetzlichen und mietvertragli-chen Bestimmungen und somit Kündigungsmöglichkeiten ausgesetzt sind. Der häu-fig vom Träger angemietete Wohnraum wird von einer städtischen Wohnungs-baugesellschaft angemietet und weiter an den Personenkreis nach § 53 weitervermie-tet. Nur in wenigen Städten, z.B. in Mannheim wird von der Kommune direkt Wohn-raum für die Betreuung psychisch kranker Menschen angeboten. Die gemeindepsy-chiatrischen Träger übernehmen in diesem Fall dann die fachliche psychosoziale Betreuung und gerade nicht auch noch die Wohnverwaltung oder verantwortet nächt-liche Ruhestörungen, Beschädigungen im Wohnraum, Bedrohungen von Nachbarn
210 a.a.O. Nouvertné et al. (2002) S. 171-178.
111
schließlich oder kostenaufwendige Räumungsklagen vor Gericht gegenüber den Bau-genossenschaften, den Mitbewohnern der Trägerwohnung und gegenüber den Nach-barn, die sich in diesen Einzelfällen beklagen und beschweren. An der Stelle entledi-gen sich vielerorts die kommunale Verwaltung und die Kostenträger der Verantwortung aus einer Situation des akuten, aber andauernden Wohnraummangels, aus Sorge um weitere finanzielle und personelle Ressourcenbelastungen.
Entgegen eines an Einfluss zunehmenden Zeitgeistes von biologistisch-medizini-schen Konzepten in der Allgemeinpsychiatrie, sieht sich die Gemeindepsychiatrie hingegen als Vertreter einer anthropologischen Psychiatrie, die um ein Verstehen des Menschen, um eine Deutung seiner Wahrnehmung und seines Verhaltens und um sprachliche Kommunikation bemüht ist.
Zudem ist das wahrnehmbare, expandierende, analog technokratische Selbstver-ständnis von zeitlichen Genesungs- und Behandlungsverläufen bei Suchterkrankun-gen sowie psychischen Erkrankungen nicht mit Produktionsabläufen im Maschinen-bau und in der industriellen Herstellungsproduktion zu vergleichen. Die Behand-lungsverläufe, z.B. von schizophren Erkrankten, die zuverlässige und valide Wieder-holbarkeit der Wirksamkeit von pharmakologischen Maßnahmen, die psychothera-peutischen und psychosozialen Interventionen und ergänzenden Hilfen sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Letztendlich sind auch die Heilungschancen, die Rezidivwahrscheinlichkeit oder eine sichere Rückfallprophylaxe von Risikofaktoren abhängig, bzw. von begünstigenden Faktoren, wie z.B. das Lebensalter, eine soziale, finanzielle Sicherung, familiäre Integration, tragende soziale Kontakte und Netz-werke.
Einerseits hat sich die Anwendung und Entwicklung von qualitätssichernden Stan-dards bewährt, andererseits gibt es Grenzen der Übertragbarkeit auf Arbeitsfelder der Wohnungsnotfallhilfe, der Suchtkrankenhilfe, der Sozial- und Gemeindepsychiatrie und der forensischen Psychiatrie.
Es entsteht der Eindruck, also könne man die gesammelten Erfahrungen und gene-rierten Erkenntnisse von vollautomatischen Produktionsstraßen der Industrie durch effektivitätssteigernde Maßnahmen und Optimierungsmanagement, auf eine Kran-kenhausbehandlung oder auf den rehabilitativen Heilungsprozess von chronisch psy-chisch kranken Menschen übertragen. Es entsteht der Eindruck und die Erwartung, als könne man die handlungs- und prozessorientierte Zielsetzung, nämlich kürzere Produktionszeiten von Anbeginn der Auftragsannahme bis hin zur Auslieferung auf den gesamten Behandlungsprozess in psychiatrischen Einrichtungen anwenden. Dass z. B. durch die Vorgaben der Krankenkassen in der klinischen Behandlung, Patienten mit bestimmten diagnostischen Indikationen innerhalb einer vorab festgelegten Be-handlungszeit abschließend zu therapieren, kommt es leidglich zu einem Phänomen der Transinstitutionalisierung211, dem nicht Rechnung getragen wird. Kliniken gera-ten in ökonomische Schieflage und versuchen die ausbleibende Einnahme durch eine
211 Starker Anstieg der Betten im Maßregelvollzug in der Bundesrepublik seit Anfang der 90er, im Strafvoll-zug und im Versorgungsbereich der 1906 BGB nach SGB XI (Hilfe zur Pflege) seit etwa 2000 und nach SGB XII (Eingliederungshilfe) seit 2010. Quelle: Vgl. a.a.O. Konrad, N. (2014): Zahlen vom Statistischen Bundes-amt. Wiesbaden. S. 22 f.
112
Erweiterung von ohnehin privilegierten Privatpatienten zu kompensieren. Dies ge-schieht zu Lasten der chronisch psychisch kranken Menschen. So spart in der aktuel-len Behandlung die Krankenkasse Geld ein, u.U. kommt es aber auf das Jahr betrach-tet zu einer häufigeren Behandlung desselben Patienten, da er immer wieder in instabile Zustände auf die Entlassung vorbereitet wird. Es kommt hinzu, dass die ein-gesparten Kosten der Krankenkasse, durch höhere Hilfebedarfe und Kosten in der Eingliederungshilfe oder gar durch Aufnahmen im Straf- oder Maßregevollzug zwar andere öffentliche Haushalte beansprucht, die gesamte volkswirtschaftliche Belas-tung jedoch mutmaßlich höher ausfällt.
Zwischen den Schnittstellen der klinischen Psychiatrie und der Gemeindepsychiatrie, auf der gesetzlichen Grundlage der Eingliederungshilfe basierend, kommt es durch konkurrierende zeitliche und strukturelle Rahmenbedingungen zu unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie schnell Aufnahmen erfolgen sollten bzw. Wohnraum vor-gehalten und mit entlassfähigen Patienten belegt werden sollten. Es kommt zu einem Entlassungsrückstau, einer Bettenüberbelegung, da z. B. zu wenige oder nicht geeig-nete freie Plätze in der Eingliederungshilfe zur Verfügung stehen, deren Zugang ein Aufnahmeprozedere mit einer standardisierten und aufwendigen sozialadministrati-ven Prüfung beinhaltet, die im Verhältnis zu einer Klinikaufnahme, nicht nachvoll-ziehbar erscheint und bisher auch nicht transparent vermittelt wird, ob des hoch-schwelligen Zugangs.
Schwerwiegend und weitreichend sind die sozialen Folgen der Stigmatisierung, die nach FINZEN212 als zweite Krankheit verstanden werden muss. Die Folgen der Schuldzuweisungen und die unmittelbaren Stigmatisierungsfolgen dann für die An-gehörigen stellen zuletzt die dritte Krankheit dar.
Durch Internetforen, den Aktivitäten von Selbsthilfegruppen, der Verbände der Psy-chiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen, aber auch durch die jahrlangen und konti-nuierlichen Bemühungen der Behindertenverbände, die sich offensiv in sozialpoliti-sche Entscheidungsprozesse einmischen, finden endlich eine Öffentlichkeit. Durch ein stetiges Engagement von Fachkräften der Sozialpsychiatrie werden die Benach-teiligungen bei der Jobvermittlung, auf dem Wohnungsmarkt oder aber im Kontakt mit Institutionen und Behörden transparent und evident. Die Forderungen nach ge-sellschaftlicher Teilhabe, nach Barrierefreiheit, die in sozialpolitischen Diskursen und Auseinandersetzung veröffentlicht werden, entwickeln bei den Menschen mit Behinderungen ein Bewusstsein, so, dass aus dieser Gruppe einer anonymen Minder-heit, eine Gruppe werden lässt, die sich allerorts Gehör verschafft.
Eine Anerkennung von Diversität steht nach v. KARDORFF zwar erst am Anfang, aber die Bemühung einer sozialen Integration im Alltag von schwer auffälligen und beeinträchtigten Menschen ist ein Ausnahmefall. Die in der Gemeindepsychiatrie entwickelten Modelle, wie z.B. die psychiatrische Pflege, Enthospitalisierungspro-jekte, Psychoseseminare, ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung, eine Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation befördern den Prozess von Inklusion und tragen zur Entwicklung einer Kultur der Anerkennung im
212 Finzen, A.: (2001): Psychose und Stigma. Psychiatrie Verlag. Bonn. S. 178.
113
Sinne HONNETHS und zu einer Kultur des Respekts, wie SENNET (2003) das be-schrieben hat, maßgeblich bei. 213
213 a.a.O. vgl. von Kardorff, E., S. 300
Kurzum, sie geht von einer anthropologischen Psychiatrie aus. In der Versor-gung der Gruppe der TSSP stößt sie auf ihre eigenen Grenzen, teilweise auch einer „romantisierenden“ Vorstellung, alle zu erreichen und versorgen zu kön-nen. Notgedrungen anerkannte die Gemeindepsychiatrie auch die Entwicklung, dass innerhalb der Versorgungsangebote auch Heime, sogar geschlossene Heime mit sozialpsychiatrischer Konzeption, unter dem Dach der Eingliede-rungshilfe im Laufe der Zeit notwendig wurden. Durch eine fokussierte Ambu-lantisierung und Enthospitalisierung wurde gerade die Gruppe der TSSP nicht mehr erreicht, die sich der Gemeindepsychiatrie gegenüber versuchte, zu ent-ziehen und schließlich im Maß- oder Strafvollzug, in der Obdachlosigkeit, in psychiatrischen Pflegeheimen oder in verelendeten und unbehandelten Lebens-situationen bei ihren Angehörigen mündete. Die Gemeindepsychiatrie hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten mit Prozessabläufen, mit Qualitätsstandards und einem Selbstverständnis von sozialer Dienstleistung (vgl. SCHAARSCHUCH), sowie mit der Perspektive aus Sicht der Adressaten und einem inzwischen etab-lierten Beschwerdemanagement beschäftigt. Gerade in der Versorgung und Be-handlung der Gruppe der TSSP stellen diese Dimensionen bedeutsame Voraus-setzungen dar. Gemeindepsychiatrie berücksichtigt im Gegensatz zur klinischen Psychiatrie die Dimension Zeit, erlebte und gelebte Zeit, und zeitlichen Ver-läufe und anerkennt, dass die Klientel große Intervalle vollzieht und benötigt, um sich zu entwickeln, zu stabilisieren und um sich den institutionellen, alltags- und lebensweltlichen Strukturen anzupassen.
Zwischenfazit: Das Arbeitsfeld der Gemeindepsychiatrie vertritt als Gegenpol, zu einer biologistisch-medizinischen ausgerichteten Allgemeinpsychiatrie, gerade bei der Gruppe der TSSP, ein bedeutsames, ideologisch-professionelles Selbst-verständnis, Menschenbild und Grundhaltung dar. Die Gemeindepsychiatrie be-schäftigt sich mit den methodischen Dimensionen der Enthospitalisierung, der Ambulantisierung, der Individualisierung, der Gemeinwesenorientierung und der Personenzentrierung. Sie fußt gleichzeitig auf eine sozialpsychiatrisch geprägte Haltung, die von einer gewaltfreien, sozialen Psychiatrie, die mit ethisch-morali-schen Prinzipien ausgestattet ist.
114
4.6. Diskurs von Exklusion im Feld des Straf- und Maßregelvollzugs
Nach der bundesrepublikanischen Gesetzgebung wird eine Straftat auf der gesetzli-chen Grundlage nach § 15 StGB wegen vorsätzlichem und fahrlässigem Handeln, bei dem sich der Täter in einem Zustand voller Schuldfähigkeit befindet, als strafbar be-wertet. Während es bei dieser Konstellation eher um eine Verurteilung und Überfüh-rung in den Strafvollzug handelt, (nach dem Sühne-Schuldprinzip und zum Schutz der Allgemeinheit), kommt es hingegen bei einer Straftat, die im Zuge von verminderter Schuldfähigkeit (nach § 21 StGB) oder Schuldunfähigkeit wegen einer seelischen Störung (nach § 20 StGB) vollzogen wurde, zu einer Verurteilung und Anordnung einer Maßregel im Maßregelvollzug (MRV). Hier wird zwischen einer psychisch-seelischen Störung nach § 63 StGB214 in einer forensisch psychiatrischen Fachklink oder aber infolge einer Suchterkrankung nach § 64 StGB in eine geeignete Entzie-hungsanstalt, jeweils nach dem Leitgedanken der Sicherung und Besserung bzw. Be-handlung, unterschieden und beurteilt. Auch diese Taten werden gesellschaftlich ge-sühnt, der Täter wird bestraft. Die gesellschaftliche Ausgrenzung, der physische Ausschluss, ist in beiden Konstellationen beabsichtigt und dient schließlich dem Schutz der Allgemeinheit vor dem Täter, bei dem die Prognose zur Rückfallgefähr-dung und Adhärenz, die Qualität der Deliktauseinandersetzung als zentrale Kriterien für eine Enlassungsentscheidung zugrunde liegen.
Der Begriff des Risikos, so BAUER (2004)215 basiert auf der Berechnung von Wahr-scheinlichkeiten. Dieser Vorstellung zufolge, lassen sich bestimmte Kriterien identi-fizieren und definieren, die das Eintreten vom abweichenden bzw. devianten Verhal-tens statistisch betrachtet, wahrscheinlicher werden lassen und daher als Risikofaktoren klassifiziert werden können. Das Vorliegen oder Fehlen solcher Kri-terien soll Aussagen darüber ermöglichen, wie wahrscheinlich deviantes Verhalten für bestimmte Personen und Personenkreise oder Situationen in der Zukunft ist.
SCHMIDT-SEMISCH (2004) ergänzt hierzu, dass das Risiko damit weder ein objek-tives Merkmal noch eine subjektive Meinung ist, sondern eine bestimmte Art und Weise, wie man konkret Elemente einer Realität zuordnen kann, um sie real erfassbar, berechenbar und damit einflussbar zu machen.216
In den letzten Jahrzehnten ist es zu einer stetigen Suche und Streben nach neuen Ri-sikofaktoren gekommen, um wiederum möglichst genaue Prognosen, z.B. in den Ka-
214 Die sogenannte Maßregel wird durch ein Urteil des jeweiligen Strafgerichts, i.d.R. ist das ein Landgericht, das sich im Verfahren an der StPO orientiert, angeordnet. Die Maßregel kann schon ab dem 14. Lebensjahr (zum Tatzeitpunkt) angeordnet werden. Die Maßregel wird verhängt, wenn vom Täter weitere Gefährlichkeit ausgeht bzw. zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begehen wird. Grundlage hierfür ist auch eine gut-achterliche Stellungnahem zur Kriminalprognose, die nach § 80a StPO für die Urteilsfindung erstellt wird. Die Dauer der Maßregel ist unbegrenzt, jedoch wird 1x pro Jahr die Fortdauer durch eine Prüfungskommission überprüft. 215 Bauer, Patricia (2004): Die politische Entgrenzung von Innerer und Äußerer Sicherheit nach dem 11.9.2001.In:Elsbergen, Gisbert von (Hg.) Wachen, kontrollieren, patrouillieren. Kustodialisierung der inneren Sicherheit. Wiesbaden, S. 55ff. 216 Schmidt-Semisch, Hemming (2004): Risiko. In: Bröckling, U.; Krasmann, S., Lemke, T. (Hg.) Glossar der Gegenwart. Frankfurt/M., S. 222.
115
tegorien Rückfall-, Kriminal-, Medikamenten,- Legal- oder Sozialprognose, zu er-stellen. Diese führte zu einer fortlaufenden Entdeckung neuer Risiken und brachte schließlich neue Risiken hervor. Aus einer zunehmend schwindenden sozialen Kon-trolle der Gesellschaft, die durch pluralisierten und diversifizierten Lebenswelten be-gründet ist, und der Mensch mit einem Leben, das sich unübersichtlicher und risiko-trächtiger präsentiert, mehr und mehr damit konfrontiert wird, wird der Appell an eine staatliche Kontrolle lauter, der sich auf die Verteilung, Bekämpfung und Ab-schirmung von Risiken konzentriert. Somit wird eine Gesellschaft entwickelt, in der die innere und äußere Sicherheit einer gesteigerten Bedeutung gewidmet wird, wie das BECK (1986)217 und CASTEL (2005)218 diagnostiziert haben.
Das Bedürfnis, sich gegen die Gruppen der Unterschichten abzugrenzen, weder mit ihren Lebenslagen noch mit ihnen physisch selbst konfrontiert zu sein, wächst an. Das Bedürfnis, sich gegen die underclass abzusichern, indem man sich quasi der ei-genen Inklusion versichert, gleichwohl das Risiko des eigenen sozialen Abstiegs je-derzeit bestehen bleibt, steigt ebenso an. Dies geschieht z.B., indem man sich auf der einen Seite selbst zu den Etablierten, zur wohlanständigen Mehrheit zählt, und ande-rerseits die wachsende Minderheit der sogenannten „Risikoträger“, der Fremde, Arme oder Gefährliche nicht mehr in den eigenen Reihen zu dulden bereit ist. Insbe-sondere bei der forensischen Re-Integration oder Nachsorge oder aber der Wieder-eingliederung von entlassenen Strafgefangenen könnte sich Soziale Arbeit verstärkt für eine gelingende und überzeugende Antistigmatisierungsarbeit im Sozialraum, im Gemeinwesen oder in der Nachbarschaft engagieren. Doch stellen wir uns einer ehr-lichen Auseinandersetzung. Wer möchte schon in unmittelbarer Nachbarschaft eines an Schizophrenie erkrankten Mieters wohnen, der ambulant vom Sozialpsychiatri-schen Wohnverbund forensisch nachbetreut wird und seinen Vater in einer psychoti-schen Verkennung getötet hat? Aufklärung und Information würden hier fehlschla-gen, schon allein für die jeweilige Betreuung professionelle Fachkräfte zu gewinnen und sie zu motivieren, stößt nicht selten auf große Widerstände innerhalb eines Teams.
Die Anzahl der MRV-Plätze nimmt nicht nur in der in der BRD seit Anfang der 90er Jahre stetig zu. Hier hat maßgeblich die Studie von HODGINS et al. (2006) die Gruppe der schizophren erkrankten Patienten identifiziert, die die größte Gruppe ab-bilden. Die meisten sind über viele Jahre hinweg mit zahlreichen stationären Aufent-halten in der Allgemeinpsychiatrie hospitalisiert und versorgt worden. HODGINS und MÜLLER-ISBERNER (2014) haben eine Kriterienliste erstellt, auf deren Grundlage Hochrisikopatienten bereits zu Beginn ihrer Karriere identifiziert werden, um so gezielt Techniken der Risikoeinschätzung und des Risikomanagements, spezi-fische Behandlungskonzepte gerade in der Allgemeinpsychiatrie zu implementieren. Zu den entscheidenden Interventionen, gehört eine verbesserte Empathie, Verantwor-tungsübernahme für die eigenen Handlungen und eine Verbesserung der sozialen Fer-tigkeiten.
217 Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M., S. 25. 218 Castel, Robert (2005): Die Stärkung des Sozialen. Leben im neuen Wohlfahrtsstaat. Hamburg, S. 82 ff.
116
Bei der Gruppe der TSSP kommt es typischerweise auch zu einer Häufung einer fo-rensische Vorbehandlung, zu fremdaggressiven Handlungen219, zu Haft- oder Be-währungsstrafen, verbunden mit gerichtlichen Auflagen oder zu einer geschlossenen Unterbringung nach § 1906 BGB im Zuge von eigengefährdeten Verhaltensweisen, die bei intensiver Betrachtung und Auswertung auch von fremdaggressiven Handlun-gen flankiert werden.
Der juristisch legitimierte, gesellschaftliche Ausschluss, der durch die Umsetzung ei-ner Maßregel richterlich angeordnet wird oder durch das Urteil eine Haftstrafe zu erfolgen hat, ist sicher das exkludierende Ereignis und ein Erfahrungsmoment, das auf einer vielschichtigen Ebene (privat, beruflich, sozial-familiär, nachbarschaftlich etc.) mit umfassenden und weitreichenden Auswirkungen (Freiheitsentzug, finanzi-elle Einbußen, Meldepflicht, gerichtliche Auflagen über u.U. viele Jahre) einhergeht. Patienten, die in einer forensischen Fachklinik bzw. Entziehungsanstalt behandelt werden oder Häftlinge, die ihre Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt ableisten, wer-den zudem mit umfangreichen Vorurteilen und einer massiven gesellschaftlichen Stigmatisierung konfrontiert. Während die eigentliche Deliktaufarbeitung, die phar-makologische Einstellung der Medikation und die psychoedukativ-psychotherapeu-tische Auseinandersitzung intramural, für die Dauer von drei - sieben Jahren220 er-folgt, bleibt die emotionale Auseinandersetzung mit den Gefühlen von Schuld und Scham innerhalb der Phase der extramurale Re-Integration meist über viele Jahre auf-recht erhalten und benötigt eine fortlaufende soziotherapeutische Begleitung, wenigs-tens für die Dauer der Bewährungsaufsicht.
BARGFREDE (1999)221 beschrieb markant das Dilemma und das maßgebliche Be-handlungsziel der Forensischen Fachklinik, dass gerade die Einflussfaktoren der In-stitution Maßregelvollzug über Jahre hinweg auf eine Verhaltensänderung im in-tramuralen Behandlungskontext einwirken. Es bestehen gesellschaftliche Erwar-tungen von außen, dass da drinnen ein neuer Mensch aus dem Untergebrachten ge-macht wird, also, inwieweit gelingt es durch die Maßregel beim Patienten veränderte Verhaltensweisen, die sich intramural als tauglich erwiesen haben, in eine extramurale Lebenswirklichkeit zu übertagen und dort fortzuentwickeln.
Als Hemmschuh flexibler psychosozialer Reaktionsmöglichkeiten erweist sich, so BARGFREDE, die Einweisungsdauer von institutionellen Wirkungsfaktoren durch die Bildung von sogenannten Unterbringungsartefakten. Diese kumulieren im Ein-zelfall mit den biographischen Vorerfahrungen und führen dort zu einer wesentlichen Beschneidung der Bewältigungsstrategien außerhalb der Mauern
219Das Psychisch Kranken Gesetz (PsychKG), das in der Mehrheit der Bundesländer zur Anwendung kommt, entspricht in Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland dem Unterbringungsgesetz, in Hessen ist es das Freiheitsentziehungsgesetz, das die gesetzliche Grundlage darstellt, nach der ein Mensch mit einer psychischen Erkrankung, auch gegen seinen Willen, in eine psychiatrische Pflichtversorgungsklinik zugeführt werden kann. In Baden-Württemberg ist im Unterbringungsgesetzes auch der Maßregelvollzug geregelt, ganz im Gegensatz zu den anderen Bundesländern, die hierfür auf ein gesondertes Maßregelvollzugsgesetz zurückgreifen. 220 Die Dauer der Behandlung im MRV ist von vielen Faktoren abhängig; maßgeblich aber vom Störungs- und Krankheitsbild des Patienten, von der Straftat, vom zu erwartenden sozialen Empfangsraum in der Phase der extramuralen Beurlaubung/Belastungserprobung, vom Behandlungserfolg während der Maßregel, von den Prognosen (Medikamenten-, Sozial-, Kriminal-, und Legalprognose u.v.m.) von der Rückfallgefährdung etc. 221 Vgl. a.a.O. Bargfrede, H. (1999), S. 382.
117
Diese Erwartungen bestehen ebenso für die Institution des Strafvollzugs, mit dem erheblichen Unterschied, dass die tragfähigen Verhaltensänderungen und entschei-denden Anpassungsleistungen bei ehemals forensisch-psychiatrischen Patienten eher zu erwarten sind als das bei entlassenen Strafgefangenen der Fall ist.
In beiden Institutionen wirken subkulturelle Verhaltensweisen und Strategien zur Be-wältigung des institutionellen Alltags, sowohl zur Aufrechterhaltung der im System zugewiesene Rollen als auch des beanspruchten Status.
Die Anforderungen, die Orientierung innerhalb der definierten Strukturen, die An-passungsleistungen, auf die die ehemals forensisch-psychiatrischen Patienten nach der Maßregel treffen, erfordern anfangs häufig einen großen Kraftakt, der mit einem Grundgefühl von Fremd-Sein im vermittelten sozialen Empfangsraum, der mit Unsi-cherheit und verstärkten Ängsten, erneut an einem Rezidiv zu erkranken oder die Weisungen nicht einhalten zu können, charakterisiert ist.
Durch die Etablierung flächendeckender Forensischer Institutsambulanzen sowie durch eine mögliche Anwendung des Kriseninterventionsparagraphen, § 67 h StGB, der eine befristete Wiederinvollzugsetzung während der Führungsaufsicht im Rah-men einer Krisenintervention in der regional verorteten Pflichtversorgungsklinik oder aber in der durch den Landgerichtsbezirk zuständigen Forensischen Fachklinik bzw. Entziehungsanstalt möglich macht, wurden wirksame Instrumentarien und Hand-lungsspielräume in den letzten sieben Jahren, den nachsorgenden, gemeindepsychi-atrischen Hilfen, der Forensik und Bewährungshilfe zur Verfügung gestellt.
Dennoch bleibt das Rätsel bestehen, das eine seit den 90er Jahren sukzessive Zu-nahme an Plätzen im MRV, sowohl in Baden-Württemberg (siehe Tabelle 1) als auch im gesamten Bundesgebiet, aufgibt. Verschiedene Autoren, wie z.B. FREESE (2003), SEIFERT & LEYGRAF (1997) und MÜLLER-ISBERNER (2004)222 haben hierzu eine Hypothese entwickelt, dass die Zunahme der Betten, die auch im Straf-vollzug und im MRV erfolgt ist, durch Phänomene der Transinstitutionalisierung aus der Versorgung der Gemeindepsychiatrie und der De-Institutionalisierung in der All-gemeinpsychiatrie erklärt werden können. Es bleibt jedoch eine hypothetische Ant-wort, die in ihrer Aussagekraft vage und unscharf ausfällt, denn SCHANDA223 hebt im internationalen Vergleich die zunehmende Tendenz hervor, dass gerade die Gruppe von psychisch Kranken beobachtet wird, die durch Chronizität, Mehrfachbe-einträchtigung, Krankheitsuneinsichtigkeit und Non-Compliance als Risikogruppe für Gewalttätigkeit definiert ist, und diejenige Gruppe darstellt, die von der Allge-meinpsychiatrie in die Forensische Psychiatrie gelangen. Gerade die Tendenz der All-
222 Müller-Isberner, R. (2004): Therapie im psychiatrischen MRV (§ 63 StGB) in: Venzlaff, U. & Foerster, K. (Hg). Psychiatrische Begutachtung. 4.Aufl. München. Urban & Fischer. S. 417-435.; Seifert, D. Leygraf, N. (1997): Die Entwicklung des psychiatrischen MRV in Nordrhein-Westfalen. In: Psychiatr. Praxis., 24 S. 237-244; Freese, R. (2003): Ambulante Versorgung von psychisch kranken Straftätern im Maßregel-, und Jus-tizvollzug-Analysen, Entwicklungen, Impulse. In: Recht & Psychiatrie. S.:52ff. 223 Schanda, H. (2000): Problem bei der Versorgung psychisch kranker Rechtsbrecher-ein Problem der All-gemeinpsychiatrie. In: Psychiatr. Praxis Nr. 27/2000, S.73.
118
gemeinpsychiatrie aber auch der Gemeindepsychiatrie, die durch Sozialpsychiatri-sche Dienste, ambulant Betreutes Wohnen, stationäre Heimplätze224, Tages- und Werkstätten, Arbeitsprojekte strukturiert sind, sich dem ethischen Dilemma einer Be-handlung im Zwangskontext zu entziehen, läuft der forensisch-psychiatrische Be-handlungsvollzug Gefahr, als Instrument sozialer Kontrolle missbraucht zu werden.
Tabelle 1: Untergebrachte in Deutschland im Maßregelvollzug; Strafgefangene, Patienten der allgemeinen Psychiatrie. Bis 1990: Alte Bundesländer einschließlich Berlin-West, ab 1995 Deutschland. In: Konrad, N. (2014): Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Wiesbaden. S.: 22 f.
Eine Zunahme der Fallzahlen bei einer gleichzeitig komplexeren Problemstellung der Anfragenden in den SpDis führte seit Mitte der 90er Jahre zu einem veränderten me-thodischen Vorgehen in der Einzelfallhilfe. Während sie bei geringerer Klienten- anzahl noch stärker durch eine aufsuchende und nachgehende Hilfe gekennzeichnet war, so findet ein schleichendes Selbstverständnis von Delegation und Casemanage-ment bei einer Komm-Versorgungsstruktur statt, die auf ehrenamtliche Hilfen und Kooperation an den angrenzenden Feldern der Sozialen Arbeit, sowie auf eine neu-ausgerichtete Vernetzungsarbeit ausgerichtet ist.
Erklärungsbedürftig ist in diesem Zusammenhang, das seit mehreren Jahren auffäl-lige Phänomen, das eine Abwanderung einer spezifischen Gruppe von chronisch psy-chisch Kranken in den Straf- und Maßregelvollzug, in die Wohnungsnotfallhilfe oder in geschlossene Einrichtungen bei einer Zunahme des Drehtüreffekts in der klini-schen Psychiatrie beschreibt. Unterschiedliche Studien beschäftigen sich damit, wel-che Effekte, mit welchen Einflussgrößen auf die phänomenologische Entwicklung
224 Der Kostenträger der Gemeindepsychiatrie ist überwiegend die Eingliederungshilfe, neben Integrierten Versorgung, ambulante Soziotherapie, SGB V Leistungen, SGB XI Leistungen, Spenden, Stiftungs- und Pro-jektgelder
Jahr MRV§ 63 StGB
MRV § 64 StGB
MRV Gesamt
Strafvollzug Betten
Psychiatr, Planbetten
Gesamt
1990 2.489 1.160 3649 39.178 70.570 113.397
1995 2.902 (+413)
1.372 4274 46.515 (+7337)
63.807 (-6763)
114.596
2000 4.098 (+1187)
1.774 5872 60.798 (+14.283) 54.802 (-9005)
121.472
2005 5.640 (+1542)
2.473 8113 63.677 (+2879)
52.856 (-1946)
124.646
2010 6.569 (+929)
3.021 9590 60.067 54.035 (+1179)
123.692
2013 6.652 (+83)
3.819 10471 56.562 54.433 (+398)
121.466
2015
119
einwirken. So verursachen sowohl gesellschaftliche Transformationsprozesse, als auch gestiegene Ansprüche an berufliche Mobilität, Flexibilität und Schlüsselquali-fikationen, eine zunehmende Kluft in der materiellen Grundversorgung und Vertei-lung der Klientel. Ein sozio-struktureller Wandel, die Einführung der DRGs in der klinischen Psychiatrie, kürzere Verweilzeiten in der psychiatrischen Behandlung, ein akuter Fachkräftemangel, der steigende Einfluss von Suchtabhängigkeit und komor-bide-somatische Störungen auf die psychiatrische Grunderkrankung, ein höheres ge-sellschaftliches Sicherheitsbedürfnis und ein laut werdender Ruf nach staatlicher Kontrolle, härteren Straften und Aufsicht oder auch methodische Verzerrungen könn-ten mögliche Einflussgrößen auf der Suche nach Erklärungen und Antworten zu dem beschrieben Phänomen darstellen.
Durch einen Abbau von psychiatrischen Krankenhausbetten kam es parallel zu einem Anstieg der forensisch-psychiatrischen Betten. Dieses Phänomen wird sowohl in anglo-amerikanischen als auch in deutschsprachigen Studien und Fachjournalen be-richtet und beschrieben. Allein in der BRD betrug der Anstieg an forensisch-psychi-atrischen Betten, im Zeitraum von 1999-2003, 38 %; wobei es im Durchschnitt zu 8,5 Delikten vor der forensischen Behandlung kam. Die Forderung und der Appell nach einer wirksamen Deliktprävention in den Arbeitsbereichen der Allgemein- und Gemeindepsychiatrie, die sich verstärkt den Themen Psychoedukation, im Hinblick auf eine Reduzierung des Gewaltrisikos, dem Thema Substanzmissbrauch, die Be-deutung der Medikation, sowie mit Deeskalationsstrategien auseinandersetzen soll-ten, wird lauter.225
Der Straf- und Maßregelvollzug stellen sicher die Extremfälle eines nach außen hin sichtbaren Ausschlusses dar. Beide Institutionen stellen die maximal geschlossenen Systeme dar, die in unserer demokratischen Gesellschaft bestehen und durch einen physische Freiheitsentzug und eine umfassende Fremdbestimmung der Zeit, des Rau-mes und der sozialen Kontakte gekennzeichnet sind.
KOLLER (2010) hebt hervor, dass der normative Anspruch im Ein- und Ausschlie-ßungsprozess häufig ineinander verwoben ist und parallel abläuft. Die explizite Ex-klusion darin ist es, dass durch die verhängte Freiheitsstrafe letztendlich eine (Re)-Integration und (Re)-Sozialisierung ermöglicht und gefördert wird. Die maßgeblich im Fokus des Exklusionsprozesses stehenden Hauptpersonen sind die Gefangenen der Straf- oder Maßregel, aber auch die Opfer, die daran beteiligten Familien sowie die persönlichen Sozialnetze der Täter. Denn all diese Gruppen sind Adressaten des Inklusionsideals; gleichzeitig erleben sie auch, durch die Straftat exkludiert zu wer-den. So stehen sich nach KOLLER zwei Ansätze gegenüber, nämlich einerseits, eine Soziologie, die normativ ansetzt und vom Ideal einer integrierten und mit sozialen Standards ausgestatteten Gesellschaft geleitet ist. Sie tendiert zur Kritik von Exklu-
225 Priebe S. et al (2005): Reinstitutionalization in mental Health Care: Comparison of Data on Service pro-vision from six european countries. BMJ, 330 (87483). S. 123-126
120
sionsprozessen, die Vorgänge selbst werden als Ausgrenzung von sozialer Beteili-gung und Teilhabechancen beschrieben. In diesem Sinne bedeutet Exklusion eine Ge-fährdung der Demokratie und des sozialen Friedens.226
Die Entwicklung der Belegbetten im MRV Baden-Württembergs ist repräsentativ für die gesamte Entwicklung des MRV in der BRD, die seit Anfang der 90er Jahren bis heute durch einen stetig anwachsenden linearen Kurvenverlauf gekennzeichnet ist. Während die Platzkontingente für Patienten nach § 63 StGB bis 2009 langsam an-stiegen, dann ein Plateau erreichten, stiegen die Plätze für Patienten nach § 64 StGB seit 2008 konstant an und bilden in der bisherigen Korrelation ein Verhältnis von 3 (§ 63 StGB Plätze) zu 2 (§ 64 StGB Plätze).
Schaubild 5: Maßregelvollzug( MRV) Baden-Württemberg: Unterbringung suchtkranker Pati-enten nach § 64 StGB und psychisch kranker Patienten nach § 63 StGB jeweils zum Stichtag am 31.12. der Jahre 2000 bis 2012.227
Der Anstieg ist durch viele Faktoren beeinflusst. 2007 wurden z.B. 45 neue MRV Plätze im ZfP-Weinsberg etabliert. Bis dahin kam es seit Anfang der 90er zu einem dauerhaften Überhang der MRV-Betten im Verhältnis der Plan- zu den Belegbetten. Das im Jahr 2012 erreichte Plateau hält weiter bis 2015 bei der Bettenanzahl von etwa 550 nach § 63 StGB an. Ganz im Gegenteil dazu, nimmt die langsamer anteigende Kurve von Betten nach § 64 StGB von 2007 bis 2012 stetig wachsend an und setzt seinen langsamen Anstieg auch bis 2015 fort.
In einer Studie von 2016 setzen sich BIELESCH, MASANZ und OBERT mit dem Personenkreis auseinander, die im Anschluss an einer forensisch-psychiatrischen Be-
226 vgl. Koller, Edeltraud; Reisinger, Ferdinand, Rosenberger, Michael (Hg.). (2010):Wegsperren oder ein-schließen? Die Praxis der Freiheitsstrafe zwischen Inklusion und Exklusion. Peter Lang Verlag. Frankfurt/M., S.185 ff. 227 Die Daten sind aus Quellen des Sozialministeriums Baden-Württemberg, Stand 02/2009, nach einer E-Mail- Anfrage vom 22.3.2009 sowie der aktuellen Zahlen des MRV Baden-Württemberg von Masanz, K. (2013) zusammengestellt worden.
�
���
���
���
���
���
���
��
��
���
����
��� ���� ���� ���� ���� ����
� ����������
� ����������
������
121
handlung im Maßregelvollzug in Einrichtungen des Gemeindepsychiatrischen Ver-bundes Stuttgart nachbetreut werden. Ähnlich wie in der geschlossenen Versorgungs-arbeit nach § 1906 BGB, in der Wohnungsnotfallhilfe oder der Suchtkrankenhilfe können auch in diesem Arbeitsfeld Vertreterinnen des Personenkreises, die als TSSP charakterisiert, identifiziert werden. Sie werden abschließend in drei Typenbildungen kategorisiert und beschrieben.
In Ergänzung einer Erhebung für den Zeitraum von 04/2004 - 03/2009 durch MASANZ228 erhalten die in 2016 berücksichtigten Gesamtzahlen von n=41 mit der Studie aus 2009 mit n=38 einen annähernd repräsentativen Charakter und bieten mehr als nur Hinweise oder Tendenzen an. Zur weiteren Illustration und näheren Erläute-rung werden drei Fallvignetten von MASANZ erstellt, die aufgrund ihrer Typologi-sierung das Spektrum der Fälle widerspiegeln.
1. Der entwicklungsbereite Typ mit einem positiven Verlauf;
2. Der instabile Typ mit einem unstet-wechselhaftem Verlauf und
3. Der Überforderungstyp mit einem negativ-vorläufig scheiternden Verlauf
Die Ergebnisse der Erhebung sehen folgendermaßen aus:
Von den insgesamt n=41 Personen sind 31 ledig, 9 geschieden und eine Person lebt getrennt. Die Zahlen entsprechen den Erfahrungen der Sozialpsychiatrischen Hilfen insgesamt. Eine frühe Erkrankung in Verbindung mit belasteten Sozialisationserfah-rungen führen schon frühzeitig zu Schwierigkeiten, um verlässliche und kontinuier-liche Kontakte zu knüpfen und tragfähige Beziehungen aufzubauen. Häufig enttäu-schende Erfahrungen in Verbindung mit dem entsprechenden individuellen Verhalten bedeuten vielfach Rückzug und soziale Isolierung.
25 (Studie in 2009 geht von 21) Personen leben im Betreuten Wohnen, davon 9 (2009 war es nur 1 Person) im Betreuten Einzelwohnen. 9 (15 Personen in 2009) Personen leben im Wohnheim, 7 (in 2009 waren es alle 15 Personen) im offenen stationären Bereich, 2 (2009 keine Person) im geschlossenen Bereich; 4 leben im privaten Wohn-raum. Bei 3 Personen sind die Lebensverhältnisse unbekannt. Es ist davon auszuge-hen, dass es sich dabei um Menschen handelt, deren Bewährungszeitraum abgelaufen ist und zu denen kein Kontakt mehr besteht. 2 Personen haben Suizid begangen, was ein nicht repräsentativ, nicht erklärbar hoher Wert darstellt. Hier fällt auch auf, dass das ambulante Versorgungsnetz weiter ausdifferenziert wurde, da in der 1. Erhe-bungsphase von 2004-2009 noch deutlich mehr Personen (15) im stationären Heim als in der 2. Phase (9) nachbetreut wurden.
Die Altersverteilung entspricht ungefähr der Verteilung in der Bevölkerung, zumin-dest was den großen Teil der 41-60 jährigen Menschen betrifft (28 Personen). Zwi-schen 28 und 40 Jahre alt waren 12 (29,3%) Personen. Ein betreuter Mensch war schon über 60 Jahre alt.
228 Kummer, C. Masanz K. (2009): Nachsorge von ehemals forensisch-psychiatrischen Patienten nach § 63 StGB in Baden-Württemberg am Beispiel des Gemeindepsychiatrischen Verbundes in Stuttgart. Masterthesis. HS Wiesbaden. S. 90-102
122
Bei der Altersgruppe der 28-40 Jährigen muss man davon ausgehen, dass es bereits viele Jahre zuvor zum Ausbruch einer psychischen Erkrankung kam, die i.d.R. durch hochriskanten Alkoholkonsum und multiplen Drogenmissbrauch mitausgelöst wurde. Diese Gruppe vermeidet aufgrund negativer Erfahrungen oder traumatisieren-den Zwangsmaßnahmen Angebote und Hilfen der Allgemein- oder der Sozialpsychi-atrie, die selbst mit nachgehenden und aufsuchende Handlungskonzepten diesen Per-sonenkreis nicht oder nur vereinzelt erreichen.
35 (34 Männer in der Erhebung von 2009) Personen der untersuchten Gruppe sind Männer, 6 (4 Frauen in Erhebung von 2009) Frauen. Dieses Verhältnis entspricht den Zahlen im Strafvollzug und in der Forensischen Psychiatrie, wobei der Anteil der Frauen von 8 auf 12 % im MRV in den letzten Jahren (1995-2008) zugenommen hat.
8 Personen haben keinen Schulabschluss, 3 einen Förderschulabschluss. 16 verfügen über einen Hauptschulabschluss, 11 einen Realschulabschluss und 3 haben einen gymnasialen Abschluss.
Auch diese Zahlen überraschen nicht. Sie passen in die Lebenslage eines Personen-kreises, der von Kindesbeinen an, sich am Rande des gesellschaftlichen Alltagslebens befindet und mehrheitlich über wenige objektive wie subjektive Möglichkeiten und Zugänge zu Bildungs- und kulturellen Angeboten verfügt.
Bereits im Kinder- und Jugendalter weisen die drei exemplarischen Biographien Ver-haltensauffälligkeiten und fragmentierte Herkunftsfamilien auf, in denen wenig struk-turierende, eher unzuverlässige und eher willkürliche Erziehungsstile vorherrschen. Häufig ist ein Elternteil sucht- oder psychisch krank. In Verbindung mit häufig beste-henden kognitiven Beeinträchtigungen kann dadurch in vielen Fällen die anvisierte schulische Qualifikation nicht oder nur „unter Wert“ erreicht werden. Hierbei überneh-men die materiellen, sozialen und kulturell prekären Lebensverhältnisse der Eltern (z.B. niedriges Einkommen, benachteiligte-stigmatisierende Wohnorte, Arbeitssituation, Bildungsniveau, Infrastruktur und Ausstattung der Wohnung und der Wohngegend, ge-sundheitlicher Status der Familie) einen großen Einfluss auf die im Kindergarten oder in der Schule schon als auffällig identifizierten Kinder und Jugendlichen.229
Eine frühzeitige psychiatrische Kategorisierungen oder Etikettierungen gilt es hierbei zu vermeiden. Vielmehr wird bei den biographischen Rekonstruktionen, wie z.B. in den drei Falldarstellungen zu lesen, einen für diese Altersgruppe ähnlichen bzw. ty-pischen Lebensverlauf auffällig, der über Gemeinsamkeiten aber auch über individu-elle und einzigartige Merkmale verfügt.
24 Probanden der Untersuchungsgruppe haben eine Lehre begonnen. 13 haben sie abgeschlossen, 11 abgebrochen. 10 haben in dem erlernten Beruf zumindest zeitweise
229 Je niedriger der sozioökonomische Status einer Testperson ist, desto höher ist nach der Studie von HUDSON C. (2005) das Risiko für eine psychische Erkrankung. In Bezug auf eine psychische Erkrankung stellen folgende Merkmale ein erhöhtes Risiko dar: überdurchschnittliche Armut, Arbeitslosigkeit, ein niedri-ger Beschäftigungsstatus (hohe ökonomische Belastungen, Unvermögen, für Wohnraum aufzukommen, Woh-nungs- oder Obdachlosigkeit, soziale Desintegration, Mangel an Autonomie, keine bzw. wenig familiäre Un-terstützung oder Rückhalt (RITCHER, WARNER, JONSON & DOHRENWEND (2001)
123
gearbeitet, 13 waren in einem angelernten oder ungelernten Beschäftigungsverhältnis tätig.
20 arbeiten in einer Werkstatt für behinderte Menschen. 5 Personen nutzen die Ta-gesstruktur in der jeweiligen Einrichtung, 6 Personen arbeiten im „stundenweisen Zuverdienst“. Nur 2 Personen arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt. 3 Personen sind im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit beschäftigt. 5 Personen sind nicht in der Lage, einer geregelten Beschäftigung, in einem Gruppensetting nachzugehen.
Über die Bedeutung und Wichtigkeit einer versicherungspflichtigen und somit ge-sellschaftlich anerkannten Beschäftigung für das Selbstbewusstsein, die Identität des Individuums braucht hier nicht gesondert eingegangen werden. Die Negativspirale von psychischer Erkrankung, mangelnder Ausbildung und prekärer Arbeitssituation in Richtung Ausgrenzung und „beschädigter Identität“ ist bekannt.
10 Personen weisen einen Migrationshintergrund auf. Diese niedrige Zahl ist unty-pisch für den hohen Anteil an Migranten in deutschen Großstädten, oder in Stuttgart (40 %). In den Sozialpsychiatrischen Diensten Stuttgarts beträgt der Anteil der Mig-ranten immerhin 33 %.230
Angesichts der Migrationsquote der Bevölkerung in Stuttgart mit zwischenzeitlich über 40% müsste der zu erwartende Anteil der Patienten mit Migration im Verhältnis deutlich höher sein!231 Migrationsfamilien legen großen Wert darauf, nicht aufzufal-len, das Phänomen von psychischer Erkrankung erfährt einen kulturspezifischen Um-gang, der z.B. als Ursache von einem Fluch, einer Auserwählung oder einem heiligen Medium ausgeht, das mit Magie, einer Zauberformel, mit Ritualen oder z.B. einem Hodscha und anderen Symbolen zu behandeln sei. Die Hürde, sich einzugestehen, fremde Hilfe von außen in die Familie zu holen, sprachliche Barrieren, die Unkennt-nis der regionalen psychiatrischen Versorgungsstrukturen oder die Angst vor behörd-lichen Konsequenzen und Folgen könnten Motive sein, dass z.B. forensisch würdige Delikte innerhalb der Familie nicht zur Anzeige kommen, sondern vielmehr verdeckt und geheim gehalten werden.
37 (34 Personen waren es in der Erhebung in 2009) Personen sind an einer Psychose erkrankt, eine davon an einer organischen Psychose, 3 an Verhaltensstörungen in Verbindung mit einer Suchterkrankung und 1 Person an einer affektiven Störung. In der Erhebung aus 2009 weisen 2 Personen eine Minderbegabung in Kombination mit einer Suchterkrankung auf, 2 Personen haben eine Persönlichkeitsstörung. Es über-raschend nicht der hohe Anteil an psychotischen Erkrankungen. Auffällig hingegen
230 Haben den deutschen Pass und werden aufgrund des ausländerrechtlichen Status, unsicherer Bleiberechte oder Duldung in ihr Heimatland abgeschoben, bei unterer-mittlere Schwerer der Delikte wird eine freiwillige Ausreise angeboten, ohne Rückkehrmöglichkeit; der unsichere Aufenthaltsstatus erfüllt zudem nicht die sozi-alrechtlichen Voraussetzungen für eine anschließende forensisches Nachsorgeoption durch die bestehenden Kostenträger der Eingliederungshilfe. 231 Die Autorengruppe beabsichtigt im Zuge einer Follow-Up Studie z.B. in einem Intervall von 5 Jahren, sich insbesondere mit dem Merkmal der Migration von ehemals nach 63 StGB behandelten Patienten innerhalb der sozialpsychiatrischen Betreuung auseinanderzusetzen. Es stellt sich dann auch die Frage, ob die Pioniergene-rationen sowie die Nachkommengeneration der Russlanddeutschen, aber auch türkischen Bevölkerung oder der Balkanflüchtlinge u.a. oder ob die aktuellen Aufnahmen, Beherbergung oder Beheimatung der unterschied-lichen Flüchtlingen aus den bekannten Bürgerkriegsregionen Auswirkungen auf die Zahlenwerte nehmen wird.
124
ist, dass keine Menschen mit Persönlichkeitsstörungen in der Erhebung von 2015 er-fasst werden.232
Bei 24 (20 Personen von 38 waren es in 2009) von 41 Personen liegt eine diagnosti-zierte Suchterkrankung vor. Zum einen verweist diese hohe Anzahl an Suchterkran-kungen auf die dringende Notwendigkeit, dass die Sozialpsychiatrischen Hilfen eng und vernetzt mit den Suchthilfen zusammenarbeiten müssen und zum anderen auf die Realität der wachsenden Zahl an Menschen mit Doppeldiagnosen und das damit eher verbundene Risikopotenzial für Delikte.
16 von 41 Personen weisen eine körperliche Erkrankung auf. Mehrheitlich handelt es sich um Hepatitis B und C Erkrankungen, HIV Infektionen, sowie Herz- und Kreis-lauferkrankungen und psychosomatische Erkrankungen.
Alle 41 (alle 38 in der Erhebung von 2009) Probanden sind in ärztlicher Behandlung: 32 befinden sich in Behandlung der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA), 9 beim niedergelassenen Nervenarzt. (In der Erhebung von 2009 befanden sich auch alle 38 Probanden in regelmäßiger Behandlung der PIA.)
Aufgrund der bei allen bestehenden gerichtlichen Auflagen ist diese Zahl nicht ver-wunderlich. Gleichwohl trägt diese Tatsache zu einer effektiveren und adäquateren sozialpsychiatrischen Betreuung und Begleitung mit besserer Prognose und Perspek-tive für die betroffenen Menschen bei.
33 (In der Erhebung von 2009 wurden 7 Krisen innerhalb der Einrichtung bewältigt) Kriseninterventionen233 erfolgten in den nachbetreuenden Einrichtungen. 19 Krisen-interventionen erfolgten in einer psychiatrischen Klinik in Stuttgart. 17 (7 Krisenin-terventionen erfolgten in der Erhebung von 2009 auf der Grundlage des § 67 h StGB) Kriseninterventionen erfolgten nach § 67 h StGB in der Forensischen Klinik.
Die Zahlen verweisen auf eine besonders hohe Aufmerksamkeit, welche diesem Per-sonenkreis entgegengebracht wird. Forensisch-psychiatrische Krisensituationen in-nerhalb der Nachbetreuung erfordern ein schnellere Risikobeurteilung, ein flexibleres Handeln und eine raschere Informationsweitergabe und Abstimmung unter den be-teiligten Diensten als das in sozialpsychiatrischen Krisen der Fall ist.
Bei 13 Personen wurde der Kontakt beendet. In gegenseitigem Einvernehmen wurde 1 Kontakt beendet. 8 Beendigungen erfolgten durch eine Anschlussbetreuung in ei-nem anderen psychiatrischen Fachdienst. 2 Menschen sind durch Suizid verstorben, (in der Erhebung 2009 kam es zu keinem Suizid.) Bei 1 Person wurde die Bewährung widerrufen, (in der Erhebung von 2009 waren es 3 Personen.) Es erfolgte die Rück-kehr in die stationäre Behandlung der Forensischen Abteilung. Ein Kontakt wurde
232 Warum das so ist, kann unterschiedliche Gründe haben. So z.B. eine geringe Größe des Untersuchungs-samples oder aber der Hinweis, dass Menschen mit Persönlichkeitsstörungen eher im Strafvollzug als in der Forensik anzutreffen sind. Zudem behandelt die Forensik in der Weissenau einen hohen Anteil an Menschen mit psychotischen Erkrankungen, im Gegensatz zu Maßregelvollzugseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen (50%) oder Niedersachsen. 233 Um vergleichbare Daten bezüglich dieses Items zu erhalten, wurde den befragten Einrichtungen vorgege-ben, dass dann eine Krise vorliegt, wenn krankheitsbedingt zusätzliche und intensivere Interventionen erfor-derlich werden und/oder durch die Nichteinhaltung der gesetzlichen Auflagen zusätzliches Handeln nötig wird.
125
einseitig durch den Betroffenen nach Ablauf der Führungsaufsicht gegen Empfehlung des gesetzlichen Betreuers beendet.
Zu den von NEDOPIL (2012)234 definierten Risikovariablen im sozialen Empfangs-raum gehören neben der Arbeit, die Ausstattung, Gestaltung und Verortung der Un-terkunft, die Kontrollmöglichkeiten, die individuelle Bereitschaft zur Mitarbeit und insbesondere die soziale Beziehungsqualität mit den Kontrollfunktionen durch die jeweiligen Bezugspersonen der Einrichtung. Die Zahlen der Erhebung geben Hin-weise darauf, dass es überwiegend gelingt, durch eine kontinuierliche Kontaktgestal-tung, eine koordinierte und gesteuerte Unterstützung der beteiligten Dienste, eine be-lastbare Beziehungsarbeit zu entwickeln. Damit können für die definierte Dauer der Betreuungszeit auch psychiatrische und psychosoziale Krisen innerhalb des Gemein-depsychiatrischen Verbundes oder unter Einbezug der regionalen psychiatrischen Kliniken bewältigt werden.
Bei den Erhebungen handelt es sich zwar um eine relativ kleine Grundgesamtheit, von n=41 (2015) und (n=38 (2009), die auch keine verallgemeinernde Aussage er-lauben. Dennoch sprechen die Ergebnisse der Erhebungen im Gesamten für sich und bestätigen den eingeschlagenen Weg, ehemals forensisch untergebrachte psychisch kranke Menschen in den Sozialpsychiatrischen Hilfen zu behandeln, zu begleiten, zu betreuen und zu unterstützen und keine forensischen Sonderstrukturen im Gemein-wesen aufzubauen. Der Personenkreis zeichnet sich durch eine materielle, soziale und individuelle Randständigkeit (prekäre Lebenslage) aus. Dies belegen die soziodemo-grafischen Merkmale: Hohe und langfristige Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen, alleinstehend und sozial isoliert in Verbindung mit einem eher geringeren Bildungs- und Ausbildungsniveau.
Aus der genaueren Betrachtung und Diskussion heraus, können drei unterschiedliche Typen von Patienten abgeleitet und gebildet werden, die sich aus der Untersuchungs-einheit ergeben haben. Selbstverständlich erheben diese Kategorien keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr sollen sie der Fachdiskussion dienlich sein. Dabei han-delt es sich um folgende drei Kategorien:
Personen, die sich langfristig gelingend kooperativ, motiviert, veränderungsbereit und entwicklungswillig verhalten. Gleichzeitig sind sie bestrebt, wieder soziale Kon-takte aufzubauen und die gerichtlichen Auflagen zu erfüllen. Die zu dieser Gruppe gehörenden Personen, haben im MRV eine Phase der Auseinandersetzung, der Er-kenntnis und einer bewussten Neuausrichtung und Veränderung ihres bisherigen Le-bensstils durchwandert. Der Eintritt in den MRV und die folgende Behandlungsphase löste eine durchdringende und nachhaltige Erschütterung, ein Wachrütteln mit einer Einsicht beim Probanden aus, dass die deliktauslösende zu Grunde legende psychiat-rische Erkrankung langfristig und langjährig zu behandeln und fortan ein gesund-heitsförderlicher Lebensstil (Abstinenz, Medikamentencompliance, Einhaltung der Auflagen, Adhärenz gegenüber der fachärztlichen, therapeutischen und psychosozi-alen Unterstützung) zu führen sei. Sowohl die forensische Behandlung als auch die Phase der nachsorgenden Behandlung führte bei dieser Gruppe zu einer positiven und erfolgreichen Nachreifung der Persönlichkeit. Die Legal- und Behandlungsprognose
234 Vortrag von Nedopil, N. am 17.11.2012 am 3. Tag der Tagung „Rechtspsychologie“ in Bonn
126
ist bei dieser Gruppe günstig. (Der entwicklungsbereite Typ mit positivem Ver-lauf)
Bei der zweiten Kategorie handelt es sich um Menschen, denen die Stabilität (noch) fehlt und die zwischen Ablehnung und Einhaltung, zwischen Kooperation und Rück-zug, zwischen Abstinenz und Suchtmittelmissbrauch hin und her pendeln. Kranken-hausaufenthalte wie auch Phasen der Behandlung bzw. Kriseninterventionen im Maß-regelvollzug wechseln sich ab mit Krisen, die auch ambulant begleitet werden. Allerdings ist zu beobachten, dass sich langfristig und Schritt für Schritt eine Stabili-sierung der gesamten Lebenslage in Verbindung mit der gesundheitlichen Befindlich-keit einstellt. Bei dieser Gruppe wird zwar durch den MRV ein Nachreifungsprozess angestoßen, der sich jedoch im konkreten Alltag der Nachbetreuung unter den Freiheit-räumen und einer Entscheidungsvielfalt außerhalb des MRV nachgegeben und aufge-weicht wird. In einem Zusammenspiel von nicht ausreichend entwickelter Selbstorga-nisation, Disziplin und zeitlich, räumlich und sozialer Strukturierung reichen die erworbene Einsicht und Motivation nicht aus, um die gesetzten Sicherheitsauflagen vollständig, umfänglich und regeltreu einzuhalten. Sie werden im Zuge einer doppelten Buchführung einerseits als zeitlich definierte und mit den Behandlern kongruente Ziel-vereinbarung bewertet, andererseits gerät diese Gruppe kurz vor Ablauf der Führungs-aufsicht oder auch im direkten Anschluss, aufgrund einer bedingt positiven Behand-lungs-, und Legalprognose wieder zurück in alte Verhaltensmuster, zurück in ein deliktförderliches Milieu oder sie geraten in Lebenssituationen, an Orte und an Perso-nen, die ein rückfälliges, noncompliantes oder rechtsbrüchiges Verhalten und Handeln begünstigen und befördern. (Der instabile Typ mit unstet-wechsel-haftem Verlauf) Hr. Grün, aus der der 1. Falldarstellung, stellt ein Vertreter dieses Typs dar.
Die Patient/innen der dritten Kategorie scheinen zumindest phasenweise über einen längeren Zeitraum hinweg mit den alltagspraktischen Anforderungen des Lebens, in den Bereichen des Wohnens, der Arbeit, der sozialen Kontakte und der Gestaltung der Beziehungen, im Umgang mit den Behörden aber auch mit den Einrichtungen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes überfordert zu sein. Die Strukturen außerhalb der Klinik scheinen für diese Gruppe nicht auszureichen, um z.B. die durch langfris-tige Hospitalisierungen entstandene Unterbringungsartefakte stabilisierend entgegen zu wirken. Überforderung, Frust, Ärger und Stress reaktivieren bei dieser Gruppe wieder alte und schließlich nicht gelingende Problembewältigungs-, und Verhaltens-muster. Dieser Gruppe gelingt es nur unter einem hochstrukturierten Setting, unter intensiven und fortlaufenden Alkohol-, Drogen-, Medikamentenspiegel- und sozialen Kontrollen, fernab ihrer Herkunftsgemeinde einen compliantes Behandlungsalltag zu führen, der sie von milieuspezifischen Angeboten räumlich fernhält. Diese Gruppe wird ebenso lediglich mit einer positiv bedingten Behandlungs-, und Legalprognose vorwiegend in stationäre, nachsorgende Institutionen vermittelt (Der Überforde-rungstyp mit negativem Verlauf)
Für den gesamten Personenkreis ist die hohe Betreuungskontinuität von wesentlicher Bedeutung. Sowohl die zahlreichen Kriseninterventionen als auch kurzfristige Be-handlungen in der Forensischen Klinik führen nicht zu einer längerfristigen Unter-brechung oder gar Beendigung der Betreuung.
127
Auffallend ist die hohe Zahl an ambulanten Betreuungen im Vergleich zur Betreuung in offenen und geschlossenen Wohnheimen, wie das in angrenzenden Landkreisen und in den nördlicheren Bundesländern der Fall ist. Dadurch wird der in Stuttgart eingeschlagene Weg des differenzierten und intensiven Ambulant Betreuten Woh-nens mit der dafür erforderlichen Haltung bei den Mitarbeitenden und den Trägern bestätigt und belegt.
Zwischenfazit: Der starke Anstieg seit den 90er Jahren von Plätzen im MRV nach § 63 und § 64 StGB im gesamten Bundesgebiet, sowie an Plätzen im Strafvollzug ist auf eine Vielzahl an Ursachen und Einflussfaktoren zurückzuführen. Gleich-zeig ist es im selben Zeitraum zu einem sukzessiven Abbau von psychiatrischen Planbetten in der BRD gekommen. Gerade bei der Gruppe der TSSP ist es im Verlauf ihrer anamnestischen Vorgeschichte zu einer Häufung an forensischen Vorbehandlungen, an richterlichen Unterbringungen oder zu Haft- und Bewäh-rungsstrafen und einer kombinierten Suchterkrankung gekommen. Die Gruppe der TSSP kann als Risikogruppe bewertet werden, bei denen es zur Applikation von forensisch-psychiatrischen Interventionen und Methoden kommt, wie z.B. eine fortlaufende Risikobeurteilung, eine gezielte Deliktprävention in Form von Kon-trollen, Gruppengesprächen, Suchthilfegruppen, Psychoedukation und Deeskala-tionsstrategien kommt, die sowohl in der Allgemein-, als auch der Gemeindepsy-chiatrie als „state of the art“ bzw. als Qualitäts- und Handlungsstandards eingehalten werden. Der Weg der Resozialisierung und Wiedereingliederung als forensischer Patient dauert im Schnitt 8-10 Jahren und umfasst eine 4-6 jährige forensische Behandlung, eine anschließende Phase der extramuralen Belastungs-erprobung von 3-9 Monaten, eine Bewährungsphase mit Sicherungsauflagen von 4-5 Jahren, die von nachsorgenden Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie, über-wiegend in einem ambulanten Betreuungssetting, mit einer zentralen Moderati-ons- und Schnittstellenfunktion, durchgeführt wird. Die Typologisierung der Stu-die zur sozialpsychiatrischen Nachsorge von BIELSCH, MASANZ & OBERT (2016), in der drei Typen von Klienten beschrieben werden, werden teils kongru-ente, teils ähnliche biographische und pathogenetische Merkmale und Entwick-lung wie bei der Gruppe der TSSP beschrieben, wie z.B. die frühe institutionali-sierte Einflussnahme, einen frühe Prozess der Medikalisierung und des Fremdwerdens der eigenen Identität und Biographie sowie umfassende und kom-plexe, entwicklungshemmende biographisch-familiäre Widerstände, Hemmnisse und Barrieren.
Am Beispiel des Feldes der forensisch-psychiatrischen Nachsorge können bedeut-same Erkenntnisse und Erfahrungswerte zu einem geeigneten Umgang und zu ei-nem professionalisierten Handeln mit der Gruppe der TSSP abgeleitet und als Standards entwickelt und empfohlen werden.
128
4.7. Diskurs von Exklusion im Feld der Wohnungslosenhilfe
Der Kontext von psychischer Erkrankung und Wohnungslosigkeit ist ein sensibler und medizinhistorisch belastender Bereich. Bekanntermaßen gab es auch schon vor der Epoche des NS-Regimes Erklärungsmodelle, innerhalb der Wohnungslosigkeit bzw. wohnungslos-Sein individualisierend bzw. durch hirnorganisch-pathologische Abnormitäten, die zugrunde liegen muss. Sie reichten von einem krankhaften Wan-dertrieb („Poriomanie“) vgl. DONATH (1899), einer anlagebedingten Psychopathie vgl. STUMPFL (1938), RITZEL (1965) bis hin zu eine konfliktvermeidenden „evasi-ven“ Problemlösungsverhalten. vgl. WICKERT (1976) Diese Interpretation und Hal-tung führte im Zuge der Euthanasie schließlich zu einer menschenverachtenden Um-setzung bzw. Lösung des „Problems“, sodass viele Tausende wohnungslose Menschen, innerhalb eines legitimierten Rahmens, getötet, zwangssterilisiert oder in Lagern misshandelt oder getötet wurden.
Die Ursachenforschung und die Versuche dieses Phänomen in ihrer Genese zu erklä-ren wird heute mit dem gesellschaftlichen, sozio-ökonomischen Wandel, mit dem Umbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme in Zusammenhang gebracht. Familiär-einschneidende, traumatisierende, krankheitsauslösende Ereignisse und Erfahrungen, schwere Krankheiten, der Verlust der Arbeit, veränderte berufliche Anforderungen an Flexibilität, Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft im Beruf, Scheidung oder Tren-nung des Partners, Verlust eines nahestehenden Menschen, andauernde, belastende Arbeits-, oder Lebenssituationen oder Überschuldung etc. können Marginalisierungs-, und Segregationsprozesse initialisieren, verstärken und aufrechterhalten. Diese Pro-zesse können wiederum eine materielle Verelendung und Verarmung, chronische bzw. schwerwiegende gesundheitliche Beschwerden und Beeinträchtigungen, einen drohenden Wohnungsverlust oder unsicheren Wohnraum oder komplexe psychoso-ziale Krisen zur Folge haben.
In der definitorischen Abgrenzung des Personenkreises wohnungsloser Menschen kommt es in der wissenschaftlichen und sozialpolitischen Auseinandersetzung zu ei-ner intensiven Beschäftigung darüber, ob Personen, die in betreuten Wohnungen oder Heimen, also ohne eigenen Mietvertrag zur Gruppe der wohnungslosen Menschen gerechnet werden können? Oder ob auch Personen, die von Räumungsverfahren be-droht oder in unzumutbaren oder unsicheren Wohnverhältnissen leben, zur Gruppe der wohnungslosen Menschen gerechnet werden kann? In angelsächsischen Studien hat sich durchgesetzt, zwischen „literally homeless“ (halten sich auf der Straße auf, nächtigen in Nachtasylen/ Notunterkünften) und „precariously/ marginally housed“ zu unterscheiden. Sie befinden sich in einer eigenen Wohnung, die sie jederzeit ver-lieren könnten.235
Die meist umfangreichen und sogar sichtbaren Stigmata von wohnungslosen Men-schen führen z.B. durch den Verlust der Arbeit, eines geregelten Einkommens, des Krankenversicherungsschutzes zu einem erschwerten Zugang zu medizinischer Be-handlung. Es kommt zur Vernachlässigung des äußeren Erscheinungsbildes (Bart-
235 vgl. Kunstmann, W. Becker, H.: Erhebung psychiatrischer Krankheitsprävalenz unter wohnungslosen Menschen. In: wohnungslos, Heft 3 Jahrgang 1998, S.107.
129
und Kopfhaare, Kleidung, Zahnstatus, Haut, Verletzungen etc.). TRABERTs Unter-suchung von 1989 geht davon aus, dass annähernd 50% der wohnungslosen Men-schen an Herz-, Kreislauf-, Atmungs- und Hauterkrankungen oder an Erkrankungen des Hals-Nasenbereichs oder des Verdauungsbereichs leiden. Zudem haben 1/3 der Wohnungslosen durch körperliche Angriffe und Übergriffe, Verletzungen und Wun-den. Sie sind folglich durch schwerwiegende Infektionen von einem raschen Aus-schluss und einer gesellschaftlichen Exklusion, insbesondere in den urbanen Bal-lungsräumen, bedroht.
Niederschwellige medizinische Hilfen sind deshalb in manchen Großstädten der Bun-desrepublik durch sogenannte Medizinische Mobile236, fahrende Allgemeinarztpra-xen, die in Köln, Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Stuttgart die Plätze, Un-terkünfte und Orte anfahren, die von den wohnungslosen Menschen belebt und als Treffpunkte anerkannt sind, wichtige und unersetzbare Versorgungsangebote.
Der Zugang zu medizinischer Behandlung, von Prävention oder Kontrolluntersu-chungen wird vielen Wohnungslosen verwehrt, weil sie unangenehmen Körperge-ruch haben, ungepflegt auftreten, alkoholisiert sein könnten, im Wartezimmer oder an der Anmeldung auffällig sein könnten, kurzum, das Kriterien der „Wartezimmer-fähigkeit“ nicht erfüllen und so von vielen niedergelassene Arztpraxen ablehnt wer-den.
Bei der Gruppe der TSSP droht oder tritt unter Berücksichtigung des biographischen Verlaufs typischerweise an zwei Momenten der Status Wohnungslos-Sein ein. In der Phase der Adoleszenz kommt es zu einer Phase, in der sich die Gruppe vom Eltern-haus häufig radikal abwendet, die Peers auf der Straße aufsucht, mit der bürgerlichen Welt, der Herkunftsfamilie, bricht und so erstmals mit dem Leben auf der Straße, mit Betteln, Schnorren, Drogen, Kriminalität und Alkohol, mit anderen Wohnungslosen in Berührung kommen. Sowohl der Schulbesuch als auch der Wunsch nach einem Abschluss oder einer qualifizierten Berufsausbildung tritt in den Hintergrund. Es tritt ein Prozess ein, in dem Kräfte (Peers, Pubertät, Traumata, Ablösung usw.) wirken, die dazu führen, dass der Jugendliche aus dem Haus getrieben wird, anfangs häufig, dann regelmäßig riskant-abhängig Alkohol, sowie psychotrope Substanzen konsu-mieren. Bei 2/3-fast ¾ der Untersuchung von VÖLLM (2004) lagen Haftstrafen vor.
Sie haben Angst davor, sich in vorstrukturierte sozialpsychiatrische Angebote zu be-geben, dort Regeln und Vereinbarungen einzuhalten, zudem wirken Alkohol- und Drogenverbot abschreckend und unattraktiv auf diese Gruppe der TSSP. Der hohe Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang, ein Bedürfnis nach Autonomie und die Angst davor, in eine Klinik, in Haft- oder Maßregelvollzug oder in Einrichtungen einge-schlossen zu werden, sind groß. Bereits erlebte Zwangsmaßnahmen, Fixierungen in
236 Aufgaben und Zweck eines „MedMobil“: einem Behandlungsbus suchen Ärzte und Pflegkräfte öffentliche Treffpunkte (Parkanlagen, Bahnhof etc.) von Obdachlosen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen sowie Tagesstätten der Wohnungslosenhilfe auf. Das MedMobil bietet eine medizinische Basisversorgung, Aufklärung zu gesundheitlichen Fragen und Maßnahmen zur Prävention von Krankheiten sowie bei Bedarf unbürokratische Vermittlung zu niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern an. Zusätzlich besteht das An-gebot durch eine sozialpädagogische Kraft für soziale Beratung und Orientierungshilfe bei komplexen Proble-men und Fragestellungen mit dem Ziel, die Menschen in das reguläre Hilfesystem zu vermitteln.
130
der Psychiatrie, zwangsweise Ernährung oder Zwangsdepot sind nachhaltige trauma-tisierte Erfahrungen, die mit einer existenziellen Bedrohung in Korrespondenz ge-setzt werden. Häufig ist auch der Mangel, sich in soziale Gefüge zu begeben und Gemeinschaftsregeln einzuhalten, ein Motiv, sich nicht in Tagesstätten, Patienten-clubs oder Selbsthilfegruppen zu begeben. Das von sich erworbene Selbstbild klafft in der Auslegung der alltagspraktischen und lebensweltorientierten Kompetenzen mit dem Fremdbild, das vom Facharzt, dem Betreuer, den Angehörigen oder den profes-sionellen Helfern erstellt wird, deutlich voneinander ab. In diesen biographischen Momenten kommt es häufig, wenige Jahre nach der ersten Wohnungslos-Phase, er-neut zu einem Leben in unsicheren Wohnverhältnissen, in Einrichtungen der Woh-nungslosenhilfe.
FORTUNATO237 hat sich in einer Studie mit den Belastungsfaktoren und Bewälti-gungsstrategien insbesondere bei jungen Erwachsenen während der Wohnungslosig-keit auseinandergesetzt und unterscheidet darin vier Belastungsfaktoren:
1. Erwartete und tatsächliche wahrgenommene, negative Beurteilung durch Dritte
Hier versteht FORTUNATO die Verletzung von persönlichen Bedürfnissen durch die Erfahrung oder die Angst davor, dass die eigene Lebenslage der Wohnungslosigkeit eine geringe Wertschätzung bzw. Akzeptanz durch Mitmenschen zur Folge haben könnte. Hierdurch seien die Problembereiche bei den Eltern, der eigenen Identität, bzw. des eigenen Selbstbildes, bei den Freunden und der romantischen Beziehung berührt. Die falschen Annahmen von Dritten über die Ursache der Lebenslage, die mit genera-lisierten Rückschlüssen auf die Persönlichkeitsmerkmale einhergehen, gehen von einer minderwertigen, sozial unverträglichen Person aus, die sowohl zu kriminellen Hand-lungen und Alkoholmissbrauch neigt, als auch faul ist und Drogen konsumiert.
2. Gefühl fehlender Sicherheit und zukunftsbezogene Ängste
Aus einer fehlenden Kontrollierbarkeit und Vorhersagbarkeit zukünftiger Ereignisse heraus, wird die Lebenslage als Bedrohung empfunden, die sich durch eine dauer-hafte Konfrontation mit den gegebenen Witterungsbedingungen, mit einer Unterver-sorgung an Nahrung oder von medizinischen Hilfen manifestiert. Die Frage, wie lange die Wohnungslosigkeit andauern wird, ob ein geeigneter Schlafplatz, eine Un-terkunft vor Anbruch der Nacht gefunden wird; zu welchem Zeitpunkt kann wieder an ein beendetes, unterbrochenes Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis angeknüpft oder neu aufgenommen werden, die Schule wieder besucht werden; die Frage, wie und ob die entstandenen Schulden reguliert werden oder strafrechtliche Konflikte be-arbeitet werden, oder die Frage nach dem unsicheren Aufenthaltstitel und Status.
3. Fehlende Teilhabe an Sozialkontakten und zwischenmenschlichen Kontakten und Konflikten
Es kommt typischerweise zu einer Distanzierung der bestehenden und auch etablier-ten Sozialkontakte aufgrund einer verminderten bzw. abnehmenden Attraktivität der
237 Fortunato, Gian-Carlo (2012): Belastungsfaktoren und Bewältigungsstrategien junger Erwachsener mit komplexer Problematik während der Wohnungslosigkeit. Masterthesis. HS RheinMain. Wiesbaden. S. 106-112.
131
Betroffenen während ihrer Wohnungslosigkeit. Dieser Prozess geht in einem rezip-roken Verlauf mit einem mangelnden Selbstwertgefühl und einem zunehmenden Schamgehfühl bzw. der Befürchtung von negativer Bewertung einher, die den Be-troffen veranlasst, sich in einem noch stärkeren Maße als bisher vor der Allgemein-heit zurückzuziehen und gerät so in gesellschaftliche Isolation.
4. Akute Unterversorgung mit Grundgütern
Der fehlende oder unsichere Wohnraum, das der schlechten Witterungsbedingungen Ausgesetzt-Sein, dauerhafter Schlafmangel und eine negative Veränderung des opti-schen Erscheinungsbildes, sowie die Überzeugung, dass man schließlich dazu ge-zwungen wird, deviante, gesellschaftlich nonkonforme Handlungen zu entwickeln, gar deviante Problemlösungsaktivitäten, kriminelle Handlungen auszuführen, wie z.B. Schwarzfahren im öffentlichen Nahverkehr, der Verkauf von Drogen oder Schwarzarbeit, zielen auf eine zeitnahe Befriedigung der übergeordneten Grundbe-dürfnisse und einer gesteigerten und expansiven Mobilität, um soziale Netzwerke zu nutzen und unterstützende Freunde aufzusuchen.
Die Studie FORTUNATOS unterscheidet im Wesen drei Bewältigungsstrategien, die der junge Mensch während der Wohnungslosigkeit nutzt. Zum einen sind es I. prob-lemzentrierte Bewältigungsstrategien, die der Veränderungen des Stressors oder des Verhältnisses zu ihm durch problemlösende Aktivitäten (z.B. informelle Unterstüt-zung, Angebote von Übernachtungsmöglichkeiten bei Freunden und Verwandten, Nutzung von Grundgütern (Nahrung, Kleidung, Hygiene) Inanspruchnahme sozial-arbeiterischer Angebote der Suchthilfe, der Sozialpsychiatrischen Hilfen und der Wohnungslosenhilfe. Hierbei stoßen die jungen wohnungslosen Erwachsenen auf Hemmnisse und Hürden, wie z.B. starke Reglementierungen der caritativen Ange-bote, unfreundliche Mitarbeitende, ein bevormundender Umgangsstil. Zudem haben sie das Bedürfnis, wollen sich in ihrer Eigenwahrnehmung deutlich von den älteren Wohnungslosen, die zur Szene gehören, in den Einrichtungen nach § 67 SGB XII distanzieren und abgrenzen.
Zum anderen sind es II. emotionszentrierte-palliative Bewältigungsstrategien, die dazu dienen die negativen Auswirkungen des Stressors zu beeinflussen, ohne diesen jedoch direkt zu verändern; somit wird eine bestmögliche Anpassung an die gegebe-nen physiologischen und psychologischen Verhältnisse angestrebt. Hierzu gehören gemeinsame Freizeitaktivitäten mit Freunden, Verwandten und Partnern, die allesamt von der belastenden Lebenssituation ablenken sollen, die ein Gefühl und eine Stim-mung von Zugehörigkeit, Geborgenheit und Wertschätzung vermitteln. Dies sind auch Strategien, die eine Veränderung des körperlichen und psychischen Befindens zum Ziel haben; sich mithilfe von Drogenkonsum zu entspannen, ein gemeinsamer Kneipenbesuch oder Spaziergang, Musizieren und Sonnenbaden in der Gruppe. Hinzu verhelfen intrapsychische Strategien, sich in Erfolgsphantasien wähnen, sich einem dem Jugendalter spezifischen Optimismus und Tagträumereien nachgehen, die eigene Lebenssituation durch einen Vergleich mit anderen noch stärker benachteilig-ten Personen zu relativieren oder schließlich, sich immer wieder bewusst machen, dass das eigene Zeitfenster für den Eintritt normativer Ereignisse noch nicht geschlos-sen ist und zu jederzeit die Option besteht, das Steuer umreißen zu können, um so einer subjektiv empfundenen Alternativlosigkeit und entgegenzuwirken.
132
FORTUNATO hebt weiter hervor238, dass die junge Klientel eine ausgeprägte Nor-malitätsorientierung während der Wohnungslosigkeit aufweist, die sich in einer Dis-krepanz zwischen dem eigenen Selbstbild und dem Bestreben, sich nicht von anderen Jugendlichen vom optischen Erscheinungsbild zu unterscheiden und der tat-sächli-chen randständigen Lebenssituation zum Tragen kommt.
BÖHNISCH stellt manifeste Anomieprobleme durch eine neue Armut fest, deren Aus-wirkungen zunehmend junge Menschen erreicht, die sich selbst nicht als potentielle „Penner“ verstehen, mit Eintritt der Notlage jedoch in eine Orientierungskrise verfal-len. 239
Eine fehlende Bereitschaft und das Vortäuschen von Intaktheit bzw. die eigene per-sönlichen randständige Lebenslage zu leugnen, sie nicht zu thematisieren, stellen ty-pische Bewältigungsstrategien dar. Stattdessen wird deren Problembewältigung maß-geblich durch das Motiv mitbestimmt, die eigene Wohnungslosigkeit aus Scham und Angst vor negativen Bewertungen Dritter zu kaschieren, von denen man sich wegbe-wegt, sich abzugrenzen versucht und sich schließlich in einem zunehmenden Prozess in eine exkludierte Lebenssituation manövrieret.
Die III. Bewältigungsstrategie beschreibt die Inanspruchnahme sozialer Unterstüt-zung zur Bewältigung belastender Situationen, die sowohl eine instrumentelle als auch eine palliative Funktion einnimmt. Inanspruchnahme sozialarbeiterischer Ange-bote, Beratung, Vermittlung von Übernachtungsplätzen, zur Sicherstellung des Schriftverkehrs ein Postfach einrichten, Inanspruchnahme des Tagessatzes dienen.
Während für Punks oder Berber gerade die absichtliche Abkehr von gesamtgesell-schaftlich determinierten Werten und sozial erwünschten Lebensentwürfen zur Ma-nifestation ihres Lebensentwurfs auf der Straße beiträgt, ist es bei der Gruppe der jungen wohnungslosen Erwachsenen gerade die Normalitätsorientierung und das Be-streben nach Konformität, welche sie von möglichen Kontakten und stigmatisierende Orten fernhält, die sie schließlich als sozial nicht zugehörig entlarven könnte. (FORTUNATO:132) Dies hat zur Folge, so FORTUNATO, dass die Kontaktherstel-lung über den öffentlichen Raum durch die Methode der Straßensozialarbeit/Street-work oder Gassenarbeit erschwert wird bzw. nicht anschlussfähig ist. Das Bewälti-gungsverhalten der Klientel ist häufig inkompatibel mit den etablierten versorgungsorientierten Angeboten der Wohnungslosenhilfe.
Abweichende Verhaltensweisen bei Unterschichtsangehörigen, insbesondere bei wohnungslosen, männlichen Personen, ist nach einer Studie von BODENMÜLLER und PIEPEL (2003) überrepräsentiert und kommt im Bedürfnis zum Ausdruck, auf Normbereiche verzichten zu können, die allesamt als Zwangshandlungen bewertet werden, da sie aus einer subjektiv empfundenen Alternativlosigkeit heraus als unum-gänglich betrachtet werden.240
238 vgl. a.a.O. Fortunato, S. 131ff. 239 vgl. Böhnisch, L. (2005): Sozialpsychiatrie der Lebensalter. Eine Einführung. Weinheim-München. 4. überarb. Aufl. 1997. 240 vgl. Bodenmüller, M., Piepel, G.: Streetwork und Überlebenshilfen. Beltz-Verlag. 2003 Weinheim.
133
Deviante Verhaltensweisen stellen aus Sicht der jungen wohnungslosen Menschen überlebensnotwendige, jedoch moralisch verwerfliche Handlungen dar, deren etwa-ige Konsequenzen von strafrechtlichen Folgen mit dem Ziel der Reintegration kolli-dieren und zu einem exkludierten Verlauf befördern. Das Streben nach Handlungsfä-higkeit, das bei den Betroffenen darin zum Ausdruck kommt, auf Bedrohungen des Selbstwertes zu reagieren, z.B. indem durch ein gezieltes Einkommen erweiterte Spielräume und ein ausgedehnter Mobilitätskreis angestrebt wird, mit der Zielset-zung, schließlich den tatsächlichen sozialen Status zu verdecken. Der Wunsch nach Normalität, stellt bei den jungen wohnungslosen Erwachsenen eine motivations- und handlungsdeterminierende Größe dar.
Die Klientel, die eine hohe Sensibilität für die Beurteilung der Eigenleistung besitzt, benötigt in der Unterstützungsbeziehung eine durch Anerkennung geprägte Grund-haltung. Während gerade Geringschätzung der erbrachten Eigenbemühungen vor-schnell als Vorurteile gegenüber sozialbenachteiligten Jugendlichen interpretiert werden, belastet die Ausgestaltung und Interpretation der Beratung die Beziehung, mit der Konsequenz, dass es vorzeitig zu Kontaktabbrüchen kommt. 241
Die Tatsache, dass es nach einer der bekanntesten Studie von HOLLINGHEAD & REDLICH (1958) für die USA eine signifikante Korrelation zwischen der Häufigkeit schizophrener Erkrankung und der sozialen Schicht gefunden wurde, ist nicht in vol-lem Umfang auf die BRD zu übertragen, da die Wohngebiete in den USA stark seg-regiert sind. Sie bietet aber richtungsweisende Zusammenhänge für die BRD an, in der eine Aufteilung nach der Schichtzugehörigkeit und des sozioökonomischen Sta-tus eher nach Straßenzügen oder einzelnen Wohnblöcken ausfällt. BRENNER (1973) stellte in seiner Untersuchung in New York, die über einen Zeitraum von 150 andau-erte, eine eindeutige Korrelation zwischen Klinikeinweisung und Arbeitslosigkeit fest, d.h. je häufiger und je länger es zu einer Hospitalisierung kommt, desto häufiger und langanhaltender kommt es zur Arbeitslosigkeit.
Je ärmer die sozioökonomischen Bedingungen einer Person sind, desto höher ist ihr Risiko psychisch zu erkranken und psychiatrisch hospitalisiert zu werden, unabhän-gig von der Schichtzugehörigkeit und den verschiedenen psychischen Erkrankungen und tritt besonders in niedrigen und mittleren Einkommensschichten auf.
So resümiert PEUKERT (2007)242 vier Hypothesen, die in Wechselwirkung mit psy-chischer Krankheit stehen, bzw. diese begünstigen und zur Initialisierung beitragen. Sie erhöhen die Häufigkeit einer Klinikbehandlung und dehnen die Dauer von Hos-pitalisierungen aus. So stellt er psychische Erkrankungen als das Ergebnis der öko-nomischen Bedingungen (a. Ökonomischer Stress) dar, die durch den Bezug von Transferleistungen von z.B. Sozialhilfe, Grundsicherungsleistungen und SGB II Leistungen, die durch Nichtbeschäftigung und die Art und Ausgestaltung des Woh-nens geprägt sind. Psychische Erkrankung ist sowohl das Ergebnis von b. fragmen-tierten, sich auflösenden Familiensystemen und eines Mangels an familiärer Unter-stützung und stellt eine weitere soziale Verursachung psychischer Erkrankung dar.
241 vgl. a.a.O. Fortunato, S. 135-136. 242 vgl. Peukert, R. (2007): Skript für MAPS GP 1 Grundlagen. Sozioökonomischer Status: Soziostrukturelle Aspekte: Sozioökonomischer Status und psychische Erkrankung. Wiesbaden.
134
Psychische Krankheit führt schließlich zu einer sozialen Selektion, die zum einen durch eine c. geographische Drift, d.h. Erkrankte ziehen von Wohngebieten mit hö-heren Status in Wohngebieten mit niedrigeren ökonomischen Status und zum anderen durch eine d. sozioökonomische Drift gekennzeichnet ist, die beschreibt, dass es häu-fig aufgrund der Erkrankung zu einem Abrutschen in einen niedrigen sozio-ökono-mischen Status kommt.
In sozialen Brennpunkten243, wie z.B. im Stadtteil Hallschlag in Stuttgart, der durch einen niedrigen sozioökonomischen Status, eine hohe Rate psychischer Erkrankun-gen gekennzeichnet ist, ist die Anzahl der chronisch psychisch kranken Menschen pro Quadratkilometer deutlich höher als in den benachbarten bzw. angrenzenden Stadteilen der Stadt.
Psychisch kranke Wohnungslose stellen eine besonders problematische Gruppe mit ei-ner hohen Komorbidität und Mortalität dar, die aufgrund der beschriebenen Faktoren unterversorgt sind und eine hohe Diskrepanz zwischen der Behandlungsbedürftigkeit und der aktuelle erfolgten Behandlung aufweist. Diese Auswirkungen, multidimensio-nalen Folgen und Wechselbeziehungen zwischen psychischer Erkrankung und sozia-lem Status üben letztendlich einen umfassend starken Einfluss auf die Lebens- und Alltagswelt des Betroffenen aus, dem es schließlich nur mit viel Unterstützungsange-bote und nachgehenden Hilfen gelingt, in seinem Alltag zurande zu kommen.
Bei Eintritt des Wohnungsverlustes werden die belastbaren Ressourcen aufs Äußerste beansprucht und führen zu einer dramatischen Krise. Die Lebensbedingungen wäh-rend der Wohnungslosigkeit dünnen, nach KELLINGHAUS244, die ohnehin schwa-chen sozialen und wirtschaftlichen Netzwerke weiter aus und gefährden somit die Gesundheit und zwingen schließlich zu einer Anpassungsleistung an das neue Milieu. Innerhalb dieses Anpassungsprozesses kommt es häufig zu (hoch)riskantem Alkohol- und Drogenkonsum, mit der Zielsetzung als social glue245 zur Kontaktknüpfung an die verortete Szene auf der Straße. Tritt eine gelingende Anpassung ein, so kommt es in der Interpretation nach KELLINGAHUS zu einem abwehrenden Verhalten der therapeutischen Interventionen und der sozialpädagogischen Angeboten. Gelingt also die Anpassung, so droht die Initialisierung eines Prozesses, der einen schwer zu durchbrechenden Teufelskreis bildet, in dem Depressionen, Psychosen, Isolation und Vereinsamung und riskanter bis hochriskanter Konsum von Suchtstoffen die gesund-heitliche Situation noch weiter verschlechtern und ein sukzessives Hinausdriften aus den gesellschaftlichen Bezugspunkten und dem sozialen Leben stattfindet. Die häufig daraus resultierenden Denkstörungen, die wie verstärkende exkludierende Zentrifu-galkräfte wirken, machen sowohl sozialpädagogische als auch medizinische oder psychiatrische Angebote schwer zugänglich. Sie werden eher nur in akute Krisen als 243 Revitalisierungskonzept des Stadtteils Hallschlag 2020, ein Stadtteil in Stuttgart, der bereits in den 70er Jahren beispielhaft für einen Problem-Stadteil weit außerhalb der Stadtgrenzen bekannt war und von Pädago-gikstudierenden unterschiedlicher Hochschulen besucht wurde und immer noch wird, in dem eine hohe Ar-mutsquote, eine hohe Jugendkriminalität und Jugendgangs, eine hohe Migrationsquote, eine schlechte Infra-struktur, mangelnde Anbindung an den ÖPNV, maroder und vernachlässigter Wohnungsbau, geringe Wohnfläche pro Kopf, schlechte Wohnungsausstattung etc. 244 Vgl. a.a.O. Kellinghaus, C. (2000), S. 91 ff. 245 Ein von Sterk-Elifson und Elifson geprägter Begriff, der als „sozialer Kleber“ übersetzt werden kann, um an der verorteten Wohnungslosenszene „anhaften“ zu können. Sterk-Elifson, C; Elifson, K. W. (1992): Some-one to count on: Homeless, male drug users and their friendship relations. Urban Anthrppol 21, S.249.
135
annehmbar erlebt, da die persönliche Autonomie und die örtliche Freiheit ein über alles gestelltes Gut darstellt, das die Betroffenen durch stationäre Behandlungsange-bote bedroht sehen. Das institutionelle Wohn-, und Unterstützungskonzept Hotel-Plus246 bietet aufgrund der fachlichen und methodischen Ausrichtung Lösungen an, da sie auf Entaktualisierung und Beruhigung, auf Sicherheit und Versorgung, auf Be-ziehung und Vertrauen sowie auf eine individuelle und versorgende Hotelversorgung, ohne Therapieangebote, ausgerichtet ist.
246 Das ursprüngliche Konzept Hotel Plus wurde in Köln 1997 entwickelt. In Stuttgart kam es im 2014 zu einer sozialpolitischen Willensbekundung, ein HotelPlus-Betreuungskonzept für die Klientel der wohnungslos und psychisch kranken Menschen mit häufig hochriskanten Alkohol-, oder Drogenkonsum auszuschreiben und zu etablieren. In 09/ 2015 hat die Ambulante Hilfe e.V. in einem ehemaligen Gasthof mit Fremdenzimmer in Stuttgart-Wangen „Rössle“, ein HotelPlus eröffnet. von Masanz, K. (2014): Trägerübergreifende Konzeption zur regionalen Umsetzung einer HotelPlus-Betreuung in Stuttgart durch die Evangelische Gesellschaft Stutt-gart e.V. und den Caritasverband für Stuttgart e.V.
Zwischenfazit: Die Gruppe der TSSP gerät im Verlauf ihrer Biographie typi-scherweise an zwei Übergangspassagen in Phasen und Episoden von Wohnungs-losigkeit, bzw. sie geraten sogar auf die Straße und begeben sich ins Milieu. Zum einen geschieht dies in der frühen Phase der Adoleszenz, wenn es zu einer radika-len Ablehnung, Schulverweigerung und Bruch mit der Herkunftsfamilie, des Vor-munds oder mit der Jugendhilfeeinrichtung kommt. Hier dominiert ein Freiheits-bestreben und Autonomiedrang der Gruppe, die sich nach sozialem Zusammen-halt und Verständnis und Sicherheit innerhalb der Peers sehnt und vorgegebene Strukturen, typische Schul- und Ausbildungskarrieren mit einem Verhalten von Leistungsverweigerung und dem Ignorieren von Erwartungen ablehnt. Gerade bei der Gruppe der jungen TSSP kommt es in dieser Phase zu einer verstärkten Ori-entierungskrise, in der zukunftsbezogene Ängste dominieren. Diese Themen wir-ken lange zentral in den folgenden psychiatrischen Behandlungs-, und Betreu-ungsversuchen. Tatsächlich erlebt die Gruppe der TSSP auf der Straße eine Abnahme an Sozialkontakten, einen Verlust an Selbstwertgefühl, ein zunehmen-des Schamgefühl und somit eine verstärkende Stigmatisierung, soziale Isolation und Rückzug, der letztendlich mit einer materiellen, gesundheitlichen und körper-lichen Verelendung und Selbstbeschädigung einhergehen. Ursache hierfür sind disziplinierende, sanktionierende oder auch punitive Maß-nahmen durch Institutionen, Kliniken oder durch die Justiz, den Aufgaben ent-sprechend, ob Behandlung, Beratung oder Wohnen fristlos und vorzeitig beenden. Die Gruppe der TSSP erfährt zudem innerhalb der Wohnungslosigkeit einen Pro-zess der gesundheitlichen und materiellen Verelendung und stellt fest, dass sie sich aufgrund ihrer schweren psychischen Erkrankung nicht im Milieu auf der Straße behaupten können.
136
4.8. Diskurs von Exklusion im Feld der Suchtkrankenhilfe Eines der markanten Merkmale bei der Gruppe der TSSP ist ein meist früh einsetzen-der und regelmäßiger Alkoholabusus, Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Essstö-rung oder Spielsuchtverhalten an Spielkonsolen. Diese im Laufe der Biographie be-gleitende Symptomatik übt einen großen Einfluss auf die z.B. Helfer-Klienten und Klienten-Klienten Beziehung aus, sowie auf die Kontakt-, und Beziehungsgestaltung, auf die Hilfeannahmebereitschaft und die emotionale Fähigkeit, sich auf andere Men-schen einzustimmen, sich in diese, in einem empathischen Sinne, einzufühlen. Auf-fällig wird diese gemeinsame Einschränkung insbesondere in Situationen, in denen es zu strafrechtlichen Handlungen und Bewertungen kommt und der Betroffene die Angst beim Opfer, die Bedrohung, die er beim Opfer auslöst, die existentielle Ge-fühlslage nicht oder nur marginal nachvollziehen, emotional nicht zu rekonstruieren in der Lage ist. In den gerichtlichen Gutachten, die sich mit Rückfallprognosen, Kri-minal-, Legal-, und Sozialprognosen beschäftigen, wird gleichermaßen das Vorliegen einer Suchterkrankung, sowie die fehlende oder deutlich beeinträchtigende Empa-thie-, sowie Introspektionsfähigkeit, eine geringe Frustrationstoleranz, eine erhöhte Impulsivität, sowie eine Beeinträchtigung des Eigen-, und Fremderlebens diagnosti-ziert und stellt einen bedeutsamen Risikoindikator für die psychosoziale Betreuung, die medizinisch-psychiatrische Behandlung und den psychotherapeutischen Umgang mit einer entsprechend ungünstigeren Prognose und Rückfallentwicklung dar.
Während die Sozialpsychiatrie schon seit Jahrzehnten methodisch auf die Ansätze von Empowerment, Gemeinwesenorientierung und Regionalisierung zurückgreift, setzt sie den Schwerpunkt auf salutogenetische, pathogenetische Konzepte und einem subjektorientiert-anthropologischen Krankheitskonzept. Die Suchthilfe hingegen
So sind sie nun zudem den typischen Gefahren der Straße ausgesetzt (z.B. Infek-tionen, Verletzungen, der Witterung oder Gewalt). In diesen Phasen ist es davon abhängig, ob die Professionellen der niederschwellig-aufsuchenden medizinisch-sozialarbeiterischen Hilfen (Med-Mobil, Straßensozialarbeit, aufsuchende Dro-genhilfe, Sozialhotel, SpDI etc.) tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen und Kontakte gestalten können. Auf der anderen Seite bedeutet Alkohol- und Drogen-konsum im Milieu, im Sinne von „social glue“ Kontakt zu knüpfen. Bei einer gelingenden Anpassung wird in der Folge eine mögliche Hilfeannahmebereit-schaft bzw. abwehrendes Verhalten gegenüber den vorgehaltenen Unterstützungs-leistungen erschwert und verfestigt. Häufig gelingt es dann der Gruppe der TSSP nur noch über betreuungs- oder unterbringungsrechtliche Maßnahmen weiteren Schaden abzuwenden und eine zwangs- weise Behandlung einzuleiten. PEUKERT beschreibt vier Hypothesen, die auf eine Wechselwirkung von psychi-scher Erkrankung und Wohnungslosigkeit einwirken und auf die Gruppe der TSSP besonders Einfluss nehmen: ökonomischer Stress, fragmentierte, sich auf-lösende Familiensysteme und ein dadurch einhergehender Mangel an familiärer und sozialer Unterstützung, eine geographische und sozioökonomische Drift.
137
wählt elektische Verfahren, sowie die gängigen kognitiv-behavioralen Ansätze, ein-schließlich „Motivational Interviewing“ nach SMEDSLUND (2011) und stellt immer wieder fest, dass die Sucht längst nicht immer das Hauptproblem darstellt. Sie sucht deshalb immer mehr die Nähe und die Kooperation der Sozial-, und Gemeindepsy-chiatrischen Hilfen in der Versorgungsregion, reduziert therapeutische Ansprüche, überdenkt traditionelle Komm-Strukturen in der Beratung, sie strebt ebenso regionale Versorgungsverpflichtung an und begibt sich in das Feld des Ambulant Betreutes Wohnen bei eigenem Wohnraum innerhalb der Eingliederungshilfe.
So kommt es in den theoretischen Modellen z.B. beim transtheoretischen Model nach PROHASKA zu einem Durchlauf durch fünf klar definierten Stadien der Verhaltens-änderung, doch Betroffene und deren Störungen halten sich nicht einfach an diese Phasen. So kann im Vorfeld nicht wirklich antizipiert werden, welcher Suchtpatient von welchem Behandlungssetting am meisten profitiert. Letztendlich entwickelte sich in den Einrichtungen zunehmend die Erkenntnis dem sozialpsychiatrischen Prin-zip der Personenzentrierung zu folgen, den Patientenwunsch berücksichtigt und es so zu einem erhöhten Erfolg und einer günstigeren Prognose kommt.247
Die erhöhte Koinzidenz einer Substanzabhängigkeit bei einer schizophrenen Psycho-sen, wie sie MOORE (2007) beschreibt, kommt auch bei der Gruppe der TSSP vor, die typischerweise bereits im Stadium der Prodromalphase zu Alkohol, Cannabis, Schlaf- und Schmerztabletten und andere Drogen als Selbstbehandlungsversuch grei-fen, um unangenehme depressive Gefühle oder einer antriebsgehemmten Grundstim-mung entgegenzuwirken oder um bereits eine psychopharmakologischen Behand-lung mit einer sedierenden Wirkung abzuschwächen.
In der Regel führt der flankierende Konsum von Suchtstoffen zu einer weiteren Ver-schlechterung der psychiatrischen Grunderkrankung, die psychosozialen Folgen auf den Wohnraum, die Arbeit, Schule, Ausbildung, auf die Familie, den Freundeskreis, den finanziellen Bereich und die gesamte Gesundheit hat.
In der Suchtkrankenhilfe gab es in den letzten 20 Jahren eine grundlegende Umori-entierung hin zu neuen Begriffe und Konzepte, die regionalisierte und sozialraumori-entierte Hilfen einfordern, die von Kundenorientierung, Personenzentrierung und ge-sellschaftlicher Partizipation sprechen. Mehr und mehr wurden in den letzten Jahren Behandlungskonzepte entwickelt, die nicht mehr den Anspruch auf einen Nullkon-sum, sondern einen risikoärmeren Konsum, verbunden mit der Methodik der Selbst-kontrolle, der Selbstverantwortung und des Selbstmanagements zum Ziel haben.
Zunehmend wird das langjährige Credo des Therapieziels von Nullkonsum durch ei-nen kontrollierten Konsum mit Hilfe von weiterentwickelten therapeutischen Maß-nahmen wie z.B. von Psychoedukationsverfahren, von Betreuungsvereinbarungen o-der von speziellem Training zum Erwerb von sozialen Fähigkeiten (soziales Training, skills-Training), sowie oder der aktuelle Behandlungsansatz von Community rein-forcement Approach Ansatz. Die Wirkung der Hilfen und die Erfolge der Maßnah-men bleiben weit hinter den Erwartungen in diesem Bereich.
247 vgl. Kowalewski, R. Mutschler, J, Peter, F. (2013): Behandlungseinrichtungen für Abhängige. In: Sozial-psychiatrie. Band 2. Rössler, W., Kawohl, W. (Hg.). Kohlhammer. Stuttgart, S. 202-213.
138
BÖKER-SCHARNHOLZ fordert auch für das Feld der Suchthilfe eine konsequente Orientierung am individuellen Hilfebedarf durch eine individuelle Maßnahmepla-nung IBRP248, durch ein Trennung der individuellen Unterstützung und der Wohnbe-treuungsleistungen, durch eine Realisierung von Teilhabe und Inklusion, durch Er-schließung und Nutzung von normalen und bestehenden Angeboten der Versorgungsregion, eine Aufhebung der Versäulung der Hilfen in Bezug auf die Ar-beitsfelder, Psychiatrie, Wohnungsnotfallhilfe, Suchtkrankenhilfe und den Leis-tungsarten ambulant, stationär oder teilstationär. So soll sich die Entwicklung spezi-fischer Settings und Milieus am einzelnen Bedarf und sich weniger an den institutionellen Bedingungen und Strukturen orientieren und ausrichten.249
Die Zugänge zu Behandlungseinrichtungen für Patienten mit Substanzstörungen, ob ambulant, tagesklinisch oder stationär, ist gerade für die Gruppe der TSSP entspre-chend ihrer inhaltlichen Ausrichtungen (Schadensminderung, Abstinenzorientierung, therapeutische Gemeinschaft etc.) oft unerreichbar. Die versicherungsrechtlichen und gesundheitspolitischen Vorgaben prägen die Behandlungslandschaft in der BRD. So kommt es bei der Gruppe der TSSP zwar hin und wieder vor, dass eine Entgif-tungsbehandlung, finanziert von der gesetzlichen Krankenversicherung eingeleitet und durchgeführt wird, eine Entwöhnungsbehandlung hingegen wird jedoch als Leis-tung der Rentenversicherung zuerkannt. Diese ist hochschwellig, antragsbedürftig und zielt vorrangig auf die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit ab, die bei der Gruppe der TSSP wegen fehlender Grundqualifikation und vulnerablen Belastbarkeit gar nicht erfüllt werden kann, so LEUNE (2011) 250.
Es besteht vielerorts eine ungelöste Dialektik im Versorgungssystem der Suchtkran-kenhilfe. Psychische Störungen und Substanzstörungen sind aus einer fachlichen Be-wertung heraus nicht abgetrennt und unabhängig zu betrachten. Dualdiagnosen, die aus einer Substanz und einer weiteren psychischen Störung bestehen, sind nicht Aus-nahmen sondern die Regel.
Insgesamt stellen folgende dialektische Kernpunkte in der Suchtbehandlung die Grundlagen dar:
In den spezialisierten Einrichtungen können und sollen nicht alle Süchtigen behandelt werden, vielmehr soll aber Fachwissen für komplexe Fälle vorliegen und fortentwi-ckelt werden.
Bereits in Ausbildung und Studium sollen profunde Grundkenntnisse zu der hoch differenzierten Klientel mit Substanzstörungen vermittelt werden.
248 IBRP, der suchtspezifische Aspekte berücksichtigt und auf bedeutsame Themen der Suchtkrankenhilfe eingeht, wie z.B. in dem er eine Suchtanamnese, den Motivationsstatus oder sozialmedizinische Angaben er-hoben werden, sowie Fragen zur psychopharmakologischen Behandlung oder zu vergangen oder aktuellen Substitutionsbehandlung; weitere bedeutsame medizinischen Angeben zu Infektionserkrankungen, körperli-chen Erkrankungen, Motivation und Sichtweise des Klienten, Fragen zum Selbstkonzept des Klienten, zur Veränderungsbereitschaft, justitiablen Belastungen, ergänzende Angaben zu Hafterfahrungen, Erfahrungen im MRV, deliktspezifische Straftaten, zur Schuldnersituation, IBRP MV 2006 249 Vgl. Böker-Scharnholz (2009): Hilfen wie aus einer Hand - die personenzentrierte und sozialräumliche Integration von Suchthilfe, Wohnungslosenhilfe und Psychiatrie. Psychiatrie Verlag. Bonn. S. 189-198. 250 vgl. Leune, J. (2011): Versorgung abhängigkeitsranker Menschen in Deutschland. In: Jahrbuch Sucht. Geesthacht Neuland Verlag. S. 181-195.
139
Langanhaltende stationäre Therapie- und Behandlungsaufenthalte haben hospitalisie-renden Effekt und somit negative Wirkungen.
Es gibt kein therapeutisches Verfahren oder Behandlungssetting, das in seiner Wirk-samkeit den anderen überlegen ist und somit favorisiert werden sollte.
An der Ausgestaltung der Komorbidität richten sich das Verfahren und die Behand-lung aus.
Es müssen einige Kautelen gewissenhaft nach den Behandlungsrichtlinien und aktu-alisierten der DGPPN Leitlinien und Standards eingehalten werden (z.B. bei der Opioidsubstitution und beim Alkoholentzug).
Entscheidend ist, ob ein therapeutisches Bündnis zustande kommt, dabei sind Rest-riktionen und Schuldzuweisungen kontraproduktiv und zu vermeiden.
Gesellschaftlich-politische Vorgaben prägen den Behandlungsspielraum und sollten sich entsprechend dem Erkenntnisstand weiterentwickeln, der von den Experten zu benennen, zu artikulieren und überzeugend zu verbreiten ist.251
251 vgl. a.a.O. Kowalewski (2013). S. 210.
vgl. Sadowski, H. (2010): Die Ich-Funktionen und die Funktion des Suchtmittels. In: Psychose und Sucht. Sadowski, H. Niestrat, F. (Hg.). Psychiatrie Verlag. Bonn. S. 62-71.
140
Zwischenfazit: Der Zugang zu Behandlungsangeboten für Substanzabhängige ist für die Gruppe der TSSP durch die bestehenden versicherungsrechtlichen und ge-sundheitspolitischen Vorgaben, sowie durch strukturelle und therapeutisierende Barrieren und Ansprüche der Suchtkrankenhilfe erschwert zu bewältigen. Die Gruppe der TSSP kann insbesondere profitieren von den Ansätzen und Verfahren, die regionalisierte, aufsuchende und flexible Hilfen und die Zielsetzung eines ri-sikoarmen Konsums statt Nulltoleranz bevorzugen. Der überwiegende Teil der Gruppe der TSSP zählt zu den Doppeldiagnose-Patienten, die durch die Einnahme eines Suchtmittels oder durch polytoxikomanen Konsum das quälende, behin-dernde und undifferenzierte Erleben von Affekten vorübergehend zu reduzieren oder vollständig auszuschalten versuchen. So ist gerade bei Rückfällen nach lan-gen und starken Affektspannungen zunächst eine besonders auffällige Entspan-nungsphase wahrnehmbar, die doch von schweren Schuldgefühlen, Angst und Scham abgelöst werden. So trägt bei der Einnahme von Alkohol oder Cannabis einerseits zur Reduzierung von Angsterleben, inneren Unruhezuständen bis hin zur Erheiterung und Löschung von Angstspannung bei. Da aber der Affekt der Angst unter dem Geschehen einer beginnenden floriden Symptomatik einer der wenig wirklichen wahrnehmbaren Affekte von schizophrenkranken Patienten ist, führt die Wahrnehmung der Affektreduzierung andererseits oft zu einem verstärk-ten Empfinden einer inneren Leere, die wiederum eine suizidale Krise oder schließlich eine psychotische Exacerbation auslösen kann. Der flankierende Kon-sum von Suchtmitteln, sorgt zumindest vorübergehend für eine Beruhigung der eigenen Realitätswahrnehmung und trägt zudem zum Aufbau eines Größenselbst, zur Regulierung des Selbstwerts und des Selbstbilds, um dem Leistungsanspruch zumindest scheinbar gerecht zu werden bei, fasst SADOWSKI (2010) prägnant zum psychischen Binnenerleben zusammen.
141
5. Kapitel
Methodik und forschungspraktisches Vorgehen
„Die Grundlage für die Forschung ist die mündliche Exploration der Kranken, das Versenken in ihr Gebaren, ihre Ausdrucksbewegung, ihre Mitteilungen. (…) wir su-chen weiter alles Material zu gewinnen, das uns über den augenblicklichen Zustand und die gesamte Vergangenheit Aufschluss gibt, soweit solches Material im Einzelfall erreichbar ist. Selbstschilderungen des Kranken, Anamnese durch ihn und durch die Angehörigen, Akten, die in Konflikten mit Behörden entstanden sind….“ 252
von Karl Jaspers (1913)
5.1. Biographie und die Bedeutung des narrativen Interviews
Unter den Kategorien der qualitativen Interviews stellt dass narrative Interview, das von SCHÜTZE (1977) entwickelt wurde, eine besondere Form dar. In den Formen der Kommunikation werden zwischen Argumentations-, Beschreibungs- und Erzähl-texten unterschieden. Letztere erfüllen die Merkmale indexikalisch und szenisch zu sein und bilden in genauer Weise die Struktur der Orientierungen des aktuellen Han-delns und der Ereignisabläufe ab. In den Interviews mit der bereits vorab kategori-sierten Gruppe der TSSP, die mit spezifischen Merkmalen ausgestattet sind, werden vom Interviewer Erzähltexte erwartet.
Im Zuge biographischer Forschung und Rekonstruktion erhält man, im Sinne ROSENTHALS, Einsicht in bestimmte Milieus und in die Perspektive der Handeln-den, auf der Suche nach dem verlorenen Subjekt. Es kann damit gezeigt werden, in-wiefern das Konzept „Biographie“ einen Weg aus der dualistischen Sackgasse von Subjekt und Gesellschaft weist.253
Bei der Erforschung des Biographischen als soziale Größe, so FISCHER-ROSENTHAL, gehe es zudem um die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion von Biographien als auch um die sozialen Prozesse ihrer Konstitution.254
Die Konzeption der Biographie, die sowohl soziale Wirklichkeit als auch Erfahrungs-welten und Erlebniswelten der Subjekte konstituiert, bietet die Chance, den Antwor-ten auf eine zentrale Frage der Sozialwissenschaften, dem Verhältnis von Individuen und Gesellschaft, näher zu kommen.
In den Rekonstruktionen hat SCHÜTZE typische Prozessstrukturen herausgearbeitet bzw. vier spezifische Arten der Haltung gegenüber lebensgeschichtlichen Erlebens.
Die Prozessstrukturen des Lebenslaufs, so SCHÜTZE (1983), welche sich als die Verbindung zwischen Deutungsmuster und Interpretation der Biographen mit seiner rekonstruierten Lebensgeschichte analysieren lassen, finden sich in unterschiedliche
252 Jaspers, K. (1948): Allgemeine Psychopathologie, 5. Auflage. Springer Verlag. Heidelberg. S. 20. 253 Rosenthal, G. (1994): Die erzählte Lebensgeschichte als historisch-soziale Realität. Methodologische Im-plikationen für die Analyse biographischer Texte. In: Berliner Geschichtswerkstatt: Alltagsstruktur, Subjekti-vität und Geschichte. Münster; S.:135-138. Download am 14.5.2013 254 Fischer-Rosenthal, W. (1991): Biographische Methoden in der Soziologie. In: Flick, U. (Hg.). S. 253.
142
Kombination, in vielen biographischen Stehgreiferzählungen. Als Prozessstrukturen vermitteln sie zwischen Objektivität und Subjektivität der Lebensgeschichte.
a. Biographische Handlungsschemata können vom Biographen geplant sein, wobei der Erfahrungsablauf ein erfolgreicher oder erfolgloser bzw. nicht gelingender Ver-such darstellt, sie umzusetzen bzw. zu realisieren.
b. Institutioneller Ablauf der Lebensgeschichte: Sie können im Rahmen eines gesell-schaftlichen oder organisatorischen Erwartungsplans vom Biographen, seinen Inter-aktionspartnern und auch Kontrahenten erwartet sein, wobei der Erfahrungsablauf dann in der rechtzeitigen, beschleunigten, verzögerten, behinderten, gescheiterten Abwicklung der einzelnen Erwartungsschritte besteht.
c. Verlaufskurven: Die lebensgeschichtlichen Ereignisse können den Biographen als übermächtigen überwältigen und er kann zunächst auf diese nur noch konditionell reagieren, um mühsam einen labilen Gleichgewichtszustand der alltäglichen Lebens-gestaltung zurückzugewinnen.
d. Wandlungsprozesse können schließlich die relevanten lebensgeschichtlichen Er-eignisse wie im Falle von Handlungsschemata ihren Ursprung in der Innenwelt des Biographieträgers haben, ihre Entfaltung ist im Gegensatz zu Handlungsschemata überraschend und der Biographieträger erfährt sie selbst als systematische Verände-rung seines Erlebens und seiner Handlungsmöglichkeiten.255
SCHÜTZE geht zudem davon aus, dass sich mit Hilfe von drei Zugzwängen des Er-zählens die Differenzen zwischen Erinnerungs- und Erzählprozess weiter systemati-sieren lassen.256
1. Zwang zur Detaillierung derjenigen erklärungsbedürftigen Handlungs- und Ereig-nisabfolgen, die für das Verständnis des Zuhörers als unerlässlich angesehen werden.
In der Falldarstellung 1 berichtet der Biograph wiederholend und detailliert, dass er aufgrund der dauerhaft gefühlten Fremdbestimmung gerade keine eigenen Erfahrun-gen machen konnte und deshalb aus einem bürgerlich-normalen und vorbestimmten Lebensentwurf ausgestiegen sei. In der Falldarstellung 2 berichtet die Biographin ge-nau und erklärend dem Interviewer, dass sie durch die vielen tragischen Schicksals-schläge ihren Lebensmut verloren und sich inzwischen einer lebenslangen Institutio-nalisierung gebeugt habe. In der Falldarstellung 3 hingegen berichtet die Biographin genau und kategorisch darüber, dass sie neben ihrem verstorbenen Vater keine wei-teren Autoritäten in ihrem Leben annehmen könne, auch wenn sie sich damit behin-dere und selbst schädige. Der Biograph in der Falldarstellung 4 berichtet wiederkeh-rend das Motiv, dass er nicht wisse, was er wolle, wohin er wolle und wofür er stehe. Er habe keine Orientierung und irre in seinem Leben umher, wie ein „Korken auf hoher See“. Somit komme es dazu, dass Dritte für Ihn entscheiden, da er inzwischen
255 Schütze, F. (1983): Prozessstrukturen des Lebenslaufs in Matthes J. Pfeifenberger A. & Stosberger M (Hrg.) Biographe in handlungswissenschaftlicher Perspektive. Nürnberg. S. 67-156 256 Schütze, F. (1976): Zur Hervorlockung und Analyse von Erzählungen thematisch relevanter Geschichten im Rahmen soziologischer Feldforschung. In: Arbeitskreis Bielefelder Soziologen (Hg.) Kommunikative So-zialforschung. München. Fink. S. 224 ff
143
gleichgültig geworden ist und nichts zu seinem zukünftigen Lebensentwurf beitragen könne.
2. Zwang zur Gestaltschließung gegenüber den sozialen Erwartungen, eine begon-nene Geschichte zu vollenden bzw. alle ihr wichtigen Teilergebnisse zu erzählen.
3. Zugzwang zur Kondensierung einer Erzählung, die begrenzt verfügbare Erzählzeit und begrenzte Aufmerksamkeit des Zuhörers nötigen den Erzähler zur Relevanzsetzung und Kondensierung. In Fall 3 berichtet die Biographin, gleich zu Beginn das zentrale Erlebnis mit ihrem Vater und das zentrale Ereignis als schmerzlichen Verlust, sowie die tröstende Wahrnehmung, dass er als Geist mit ihr kommuniziere und sie beschütze. In den Inter-views mit Fall 2, 3 und 4 kommt es immer wieder zu Unterbrechungen, zu kurzen Rau-cherpausen oder auch zu längeren Verschnaufpausen, die die Biographen per Handzei-chen, so die Vereinbarung, signalisiert haben. Die Biographen in der Falldarstellung 2 und 3 fragten immer wieder in den Pausen, ob der Interviewer denn noch Zeit habe, ob er noch könne und aufnahmefähig sei, die Lebensgeschichte bis zum Ende an zuhören?
5.2. Biographische Fallrekonstruktion im Allgemeinen und Teilaspekte
Gemäß dem Ansatz, Theorie und Praxis als zusammengehörig zu verstehen, besteht in dieser Arbeit der empirische Teil aus vier biographischen Fallrekonstruktionen, um die spezifischen Merkmale, institutionelle Verlaufsmuster (siehe Schaubild 11: Chronologische Einrichtungsmatrix der 4 Falldarstellungen, S. 371-372) letztendlich zur Konstruktion der Gruppe der TSSP, die vorwiegend in geschlossenen Heimen aber auch in Maßregelvollzug oder in Sozialhotels angetroffen werden, zu generieren. Der zweite Teil, der aus einer quantitativen Vollerhebung der Bewohner (n=107) be-steht, die zum Stichtag 31.07.2013, in einem Zeitraum von fünf Jahren, von 2008-2013, in einem der drei geschlossenen Heimen in der Versorgungsregion des GPV Stuttgart betreut wurden, liefert individuelle und gemeinsame biographische aber auch institutionelle Merkmale sowie Kontakterfahrungen mit den unterschiedlichen Feldern Sozialer Arbeit. Der dritte empirische Teil bildet eine Neuauswertung, mit Hilfe von Kreuztabellen, einer bereits erstellten Datenbank aus 2009, die alle Bewoh-ner mit den Eigenschaften wohnungslos, psychisch krank und suchtkrank eines Sozi-alhotels (n=87) in einem Zeitraum von 3 ½ Jahren erfasst hat und die Gruppe der TSSP im Feld der Wohnungsnotfallhilfe zu identifizieren und zu beschreiben ver-sucht. Ein vierter empirischer Teil stellt ebenso ein Vollerhebung aller ehemals fo-rensisch-psychiatrischer Klienten dar, die im Zeitraum von 2009-2013 im Gemein-depsychiatrischen Verbund in Stuttgart in unterschiedlichen sozialpsychiatrischen Einrichtungen für die Dauer der Führungsaufsicht nachbetreut werden. Dieser Teil beabsichtigt ebenso Erkenntnisse zu biograpschen und institutionellen Verläufen für die Gruppe im Allgemeinen aber auch spezifische Merkmale bezogen auf die Gruppe der TSSP im Arbeitsfeld des Maßregelvollzugs und der forensischen Nachsorge zu gewinnen.
Der Teil der biographischen Fallkonstruktion, besteht aus analytisch getrennten Aus-wertungsschritten, um so Gegenwarts- und Vergangenheitsperspektiven der Biogra-phen, der Handelnden, zu rekonstruieren. Das Verfahren von ROSENTHAL (1987, 1995) bezieht sich auf die Grundlagen der Textanalyse von F. SCHÜTZE (1983), in
144
Verbindung mit der strukturalen Hermeneutik von OEVERMANN u.a. (1979), sowie der thematischen Feldanalyse von FISCHER (1974). Diese ist wiederum in ihrer Ent-stehung und Entwicklung durch ARON GURWITSCH angeregt worden.
HILDENBRAND (1991), WOHLRAB-SAHR (1995) arbeiten ebenso mit einer Ver-bindung aus Textanalyse und objektiver Hermeneutik.
Biographien als erzählte biographische Selbstentwürfe vereinigen nach GOBLIRSCH sowohl gesellschaftliche, also institutionell-familiäre als auch indivi-duelle Regeln sozialen Handelns und bieten insofern die Möglichkeit, die Erzeugung dieser Regelgeleitetheit, also die Genese und Form der Handlungsstrukturen, zu re-konstruieren. Aus diesem Grund sind Biographien für Wissenschaft und für die pro-fessionelle Praxis von besonderem Interesse und Bedeutung.257
In den Interviews mit den Biographen der Gruppe der TSSP tauchten immer wieder Schwierigkeiten in den Erzählungen auf, die ROSENTHAL am Beispiel von Kriegs-veteranen oder bei ehemaligen KZ-Häftlingen oder anderen Gruppen beschrieben hat.
5.2.1. Aspekt der Erzählschwierigkeiten in biographischen Fallrekonstruktionen
Empirische Analysen von Lebensgeschichten bei Kriegsveteranen im I. Weltkrieg zeigen sehr deutlich Phänomene von Erzählschwierigkeiten aufgrund chaotischen Er-lebens, während Veteranen über Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg, an dem sie auch teilgenommen haben, leicht über Stunden erzählen, umschreiben sie ihre Erfahrungen in den Schützengräben des I. Weltkriegs, in denen sie oft über Monate waren, mit knappen Metaphern oder Argumenten. Sie können die Erfahrungen nicht in Ge-schichten mitteilen. Die Erzählblockade resultiert u.a. aus Schwierigkeiten, die Erin-nerungen an das chaotische und diffuse Erleben des Schützengrabens und des Alltags im Schützengraben in eine sequentielle Ordnung zu bringen, so ROSENTHAL.258
Die erlebten Jahre im Schützengraben schrumpfen zusammen auf ein Bild, auf eine knappe Evaluationen, da es den Erinnernden kaum gelingt, einzelne Erlebnisse zu rekonstruieren, die aus der Zeit der zur Routine gewordenen Außergewöhnlichkeiten herausragen. Um temporale Abläufe einzelner Erlebnisse zu rekonstruieren, leichter erinnern zu können, bedarf es einer räumlichen Orientierung, da letztendlich im Ge-dächtnis Zeit verräumlicht wird, so ROSENTHAL.259
Weitere Bedingungen für Erinnerungs- und Erzählschwierigkeiten sind neben chao-tischem Erleben und einem mangelnden Wechsel der Umgebung, die Routinierung von Situationen. Denn erlebe ich Situationen immer wieder, fällt es mir schwer, mich selbst an herausragende Situationen zu erinnern. Die Erinnerung verdichtet sich auf 257 Goblirsch, M. (2010): Biographien verhaltensschwieriger Jugendlicher und ihrer Mütter. VS Verlag. Wies-baden, S.38 258 Rosenthal, G. (1993): Erzählbarkeit, biographische Notwendigkeit und soziale Funktion von Kriegserzäh-lungen zur Frage: Was wird gerne und leicht erzählt? In: Hartewig, K. (Hg.): Der lange Schatten. Wider-spruchsvolle Erinnerungen an den zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit aus der Mitte Europas. bios, Son-derheft, S. 5-24. 259 Rosenthal, G. (1988): Leben mit der soldatischen Vergangenheit in zwei Weltkriegen. Ein Mann blendet seine Kriegserlebnisse aus. In: Bios 1 (2), S.: 162.
145
ein Gesamtbild, diese Verdichtung ist nicht nur der Schwierigkeiten geschuldet, die einzelnen wiederkehrenden Situationen voneinander abzugrenzen, sondern resultiert auch darauf, das einzigartige Situationen, in denen es zu Handlungsblockierungen (wie z.B. Bombenangriffe, Sterben von Kameraden an der Front usw.) kommt, eher memoriert werden.
Neben den Auslassungen, deren Funktionen schon genannt wurden, gibt es auch exemplarisch Einfügungen, wie in der Falldarstellung 4, in der der Biograph über den Schusswechsel des Bruders oder von einer Geschichte über ein paar Typen, die eine Waffe haben und im Auto an einer Tankstelle abhängen, erzählt. Der Biograph be-richtet an mehreren Stellen des Interviews von einer Waffe, die er sich in der Schule besorgt hatte und in der Folge von seiner leitenden Indifferenz und Ambivalenz, dar-über nachzudenken, ob er nun seine Mitschüler, die Lehrer oder sich selbst erschießen sollte.
Bemerkt der Erzähler Vagheiten, Lücken oder Ungereimtheiten, so kann er die Ge-schichte mit Erinnerungen aus anderen Situationen auffüllen, oder mit geänderten Konstruktion ergänzen. Dieses Konzept der Hintergrundkonstruktion nach SCHÜTZE260 hat die Funktion, Vagheiten und Undurchsichtigkeiten nicht nur bei einzelnen Geschichten, sondern auch in Erzählketten zu beseitigen. Sie können Be-schreibungen oder Erklärungen sein, um die Hauptgeschichte zu plausibilisieren. Ein-fügungen werden eingebaut, wenn Unklarheiten in Erzählungen als Ereignis bisher zurückgehaltene oder ausgeblendete Aspekte auftreten und der Erzähler bemerkt, ohne sie ist seine Erzählung unplausibel.
Bei der Suche nach Bedingungen, die es erschweren, ihre Lebensgeschichte zu er-zählen, stoßen wir auf fehlende individuelle Gestaltung der Lebensplanung. Beim Eintritt in totale Institution, wie z.B. Heime, Kloster, das Militär, Straf- und Maßre-gelvollzug verlieren die Individuen ihre Individualität. Im Kloster ist z.B. der Aus-druck von Individualität in der Beichte konzentriert, in einem geschlossenen Heim ein vertrauliches Gespräch mit der pädagogischen Bezugsperson oder dem Facharzt. Die Erzählung einer Lebensgeschichte, d.h., die Erzählung von Geschichten über un-erwartete und von vorgegebenen Fahrplänen abweichender Ereignisse, dient neben der Stiftung von Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, einer einzigartigen, dich-ten und ausführlichen Präsentation eines einzigartigen Lebens, das von niemand ge-teilt wird. Jeder sich darstellende Mensch, so GOFFMAN,261 steht vor dem unlösba-ren Problem, der ambiguen Erwartung, so zu sein wie jeder andere, und doch so zu sein wie kein anderer.
Diese Herausforderung verschärft sich in der Interaktion von zwei Welten bei der Analyse biographischer Selbstpräsentation von Interviewpartnern, deren Vergangen-heit in der Gegenwart sozial nicht anerkannt oder für sich selbst problematisch ist; zeigt sich das Phänomen brüchiger Erzählstrukturen.262
260 Schütze, F. (1984): Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens. In: Kohli, M. Robert, G. (Hg.). S. 97 ff. 261 Goffman, E. (1967): Stigma. Suhrkamp. Frankfurt/M. 262 Rosenthal, G. (1989): Wie erzählen Menschen ihre Lebensgeschichte? Forschungsbericht des Lehrprojekts Biographie. Uni Bielefeld. Fakultät für Soziologie
146
Z.B. kann sich eine Prostituierte, die keine Kinder bekommen kann, ihren problema-tisierten Lebensweg und Infertilität jedoch normalisiert, nicht dem Fluss der Erzäh-lung überlassen, da sich biographische Erlebnisse nicht entsprechend der gewünsch-ten Präsentation darbieten.263
Die Gruppe der TSSP, die sich teilweise für ihren Lebensweg schämen, für die es unangenehm ist, über ihren Lebenslauf von Scheitern und Versagen zu berichten, die sich letztendlich gerne anders präsentieren würden, die sich eine feste Partnerschaft, eine eigene Wohnung, ein festes Einkommen, eine Beschäftigung wünschen, kommt immer wieder in ihren Erzählungen ins Stocken, benötigt Pausen, signalisiert mehr-fach das Bedürfnis, das Gespräch zu unterbrechen. Sie sind weder mit ihrem Lebens-weg einverstanden, noch können sie ihn nachvollziehen, sie lassen Teile aus unter-schiedlichen Gründen aus, sie fügen Ereignisse und Erzählelemente, visionäre Wünsche ein, wenn sie sich in Erinnerungen, in der Wahrnehmung oder in Prozesse der Entfremdung und der Fremdbestimmung befinden.
Überlebende der SHOAH können kaum Erinnerungen in Erzählungen präsentieren, sie erzählen in der Regel ihre Lebensgeschichten bis zum Beginn der Verfolgungen und der Inhaftierung und dann wieder aber der Befreiung aus dem KZ, so ROSENTHAL.
Bei der Gruppe der TSSP kam es ähnlich, wie z.B. in der Falldarstellung 1, zu einer detaillierten Erzählung bis einschließlich der Gerichtsverhandlungen, wohingegen durchgehend über die Zeit im Maßregelvollzug geschwiegen wurde. Der Biograph verlor ebenso über das Leben in der Psychiatrischen Klinik oder im geschlossenen Heim kein Wort.
Zuletzt ist noch hervorzuheben, dass die Biographen in den institutionellen Lebens-welten die darin verbrachte institutionelle Lebenszeit in einem vor- und durchstruk-turierten Alltag i.d.R. auch als fremd und nicht zu sich zugehörig erleben. Es handelt sich hierbei nicht um selbst gelebtes sondern vielmehr um ein fremdgelebtes Leben, das nicht erinnert und somit nicht im Gedächtnis memoriert wird. Schließlich stellt auch dieses Phänomen ein wichtiges Motiv für die Auslassungen in den biographi-schen Textstellen im erzählten Leben der Biographen dar. Insbesondere in stark vor-strukturierten Institutionen nehmen die Bewohner ein überwiegend fremdgelebtes Leben in den Einrichtungen wahr, das sie bereits durch ihre schizophrene Erkrankung als Kernsymptomatik erleben.
Die Einflussnahme auf den hochstrukturierten Heimalltag, der auch den Mitarbeiten-den als zeitlicher Strukturhorizont und als Handlungsorientierung dient, erleben die Bewohner oft als gering; sie erleben sich darin machtlos; sie fühlen sich gedemütigt, gekränkt und teilweise durch die Maßnahme selbst bestraft. Die konzeptionell ausge-dachten Konsequenzen, die im Fall von abweichendem Verhalten, bei Ausgangsver-letzungen, bei Übertretungen der Haus- und Umgangsregeln oder im Fall von man-gelnder Kooperation, bei der Verweigerung von Medikamenten oder anderen
263 Rosenthal, G. (1997): Der Holocaust im Leben von drei Generationen: Familien von Überlebenden der Shoah und von Nazi-Tätern. 2. korr. Aufl. Giessen: Psychosozial-Verlag. S. 62-80.
147
Kontrollen, die durchgeführt werden, greifen sollen, sind i.d.R. auf einer eindimensi-onalen und unflexiblen Handlungsebene, in einem Wenn-Dann-Folgen-Katalog aus-gerichtet, der machtvoll und konsequent von der Institution umgesetzt wird.
5.3. Forschungsdesign und methodisches Vorgehen
Insgesamt konnten sechs Biographen, die die Merkmale der Gruppe der TSSP erfüll-ten, erfolgreich für die Durchführung von zwei freien biographischen Interviews be-worben und gewonnen werden. Der Ablauf der Interviews wurde mit allen Biogra-phen detailliert vorbesprochen, auf Befürchtungen zum Datenschutz oder zu anderen Folgen wurde eingegangen und weitere Fragen wurden in ein bis drei Vortreffen dis-kutiert und beantwortet. Bei vier Biographen wurde zuvor die Einverständnis der ge-setzlichen Betreuungspersonen eingeholt, bei einem Biographen die der Eltern, bei einem wurde auch die Einrichtung, die den Biographen ambulant betreut hat, um Er-laubnis gefragt. Die Orte der Gespräche konnten von den Biographen selbst ausge-wählt werden. Drei Teil-Interviews fanden in den Trägerwohnungen statt, ein Inter-view in einem Park, weitere fünf Teilinterviews in den Appartements des Wohnheims, ein Interview fand in einem neutralen Gesprächsraum eines Heims statt. Die Zeit zwischen den Interviews variierte von 3 - 4 Monaten. Als weiteres ergän-zendes Datenmaterial dienten Gutachten, Sozialberichte und andere ärztlichen Be-richte, forensische Gutachten oder Prognosebeurteilungen oder vorher erstellte indi-viduelle Behandlungs- und Rehabilitationspläne, die den Hilfebedarf, die entsprechenden Maßnahmen und Hilfen, die Intensität der Hilfe und den zeitlichen Umfang bzw. einen Kostenwert der Hilfe beschreiben. Eine Biographin erstellte, handgeschrieben, einen achtseitigen Lebenslauf. Die beiden Teil-Interviews pro Bio-graph wurden im Anschluss transkribiert. Jeder Biograph bekam eine Kopie des In-terviewmaterials auf CD und in Papierform. Nach eingehender Prüfung von mehreren Tagen erhielt ich von drei Biographen die Erlaubnis, den vorgestellten Textkorpus entsprechend der Methode der Text- und Feldanalyse weiter zu verarbeiten. Ein Bio-graph bat mich darum, bestimmte Textstellen zu schwärzen bzw. nicht zu berück-sichtigen, für die er sich sehr schäme.
Die Gruppe der TSSP wurde vom Schweregrad des Hilfebedarfs vorwiegend in den Feldern der Wohnungsnotfallhilfe, der geschlossenen Hilfen innerhalb der Einglie-derungshilfe, im Feld des Maßregelvollzugs, also der forensischen Psychiatrie, sowie in der Suchtkrankenhilfe vermutet. Aus diesem Grund wurde für jedes Feld jeweils eine empirische Erhebung zur Beschreibung von individuellen, biographischen und institutionellen Merkmalen durchgeführt bzw. neu abgeleitet. Im Feld der Suchtkran-kenhilfe wurde der Zugang des Forschungsvorhabens bei drei angefragten Einrich-tungen in Stuttgart von den Einrichtungsleitern abgelehnt bzw. nicht beantwortet.
Die Biographen stehen in der Darstellung der biographischen Erzählung vor einem asymmetrischen Dilemma gegenüber dem Interviewer, der gleichzeitig in der Funk-tion des Heimleiters über sie und ihre Zeit und Alltagsgestaltung verfügt, sowie über die Dauer und Anzahl der Ausgänge und den Verbleib in der Einrichtung kontrolliert und Einfluss darauf nimmt.
148
Im Gesprächssetting von Bewerbungsgesprächen oder vor Gericht, wie HILDEN-BRAND & JAHN berichten, ist die geforderte Darstellung biographischer Erzählun-gen von Erfolg und Misserfolg abhängig und kann somit sehr bedeutsam sein. Im Setting der Beichte hingegen enthält die Art und Weise des biographischen Erzählens einen Disziplinierungs- und Pflichtanteil, in der Seelsorge oder bei der therapeutisch-sozialarbeiterischen Anamnese dient sie der Prävention und der Kontrolle lebensge-schichtlicher riskanter Verläufe. Vor diesem Hintergrund steht die Lebenserzählung im Spannungsfeld von Kontrolle und Entlastungen, von Beurteilt-Werden und Ver-standen-Werden.264
Von der Gesprächsführung, der Einflussnahme und der Mitgestaltung der in den In-terviews dominierenden Gesprächsatmosphäre (Vertrauen und Beziehung), hängt es ab, ob es dem Interviewer gelingt, diese Ambivalenz durch eine eindeutige Klärung und Artikulation im Vorfeld und ein Aussprechen der (Nicht)Folgen der Interviews zu diskutieren. Während es der Biographin in der Falldarstellung 3 darum geht, für ihr Verhalten und Handeln in ihrem schweren Leid nachvollziehbares Verständnis durch das biographische Erzählen zu bekommen, geht es der Biographin in der Fall-darstellung 2 vielmehr darum, bei den professionellen Helfern im Sinne einer Quali-tätsentwicklung und einer Weiterentwicklung der Hilfen im geschlossenen Heim, der Maßnahmen und der Angebote, aus Sicht einer Betroffenen, anzustoßen. Sie ist mo-tiviert, dass durch ihre Perspektive und biographische Darstellung der Betreuungs-rahmen verbessert an den Bedürfnissen und Bedarfen der zukünftigen Klienten aus-gerichtet werden. Sie ist zudem motiviert, umfangreicher und differenzierter beurteilt und besser verstanden zu werden. Der Biograph der Falldarstellung 4 versuchte hin-gegen immer wieder Entlastungen und bessere Bedingungen der Unterbringung aus-zuhandeln. Er forderte mehr Ausgang, mehr Geld, schließlich einen höheren Gut-scheinwert, wenn er mit seiner biographischen Erzählung teilnehmen solle. Beim zweiten Interview, das in einer anderen Einrichtung, vier Monate später stattfand, fragte er gleich zu Beginn, ob ich ihm ein Osternest und Schokolade mitgebracht hätte. Er mache trotzdem mit, sei davon aber ausgegangen. Der Biograph aus dem Fall 1 erzählte offen seine Lebensgeschichte, da er sich damit für die bisherige Hilfe und Begleitung bedanken möchte. Zudem wolle er das auch stellvertretend für seine Eltern tun, die Aufmerksamkeit und Anerkennung in Zuge der Angehörigenarbeit erfahren haben.
Betrachtet man biographische Selbstpräsentationen von Gesellschaftsmitglieder, de-nen ein lebensgeschichtliches Ablaufmuster ohne eine biographische Handlungspla-nung sozial auferlegt wird, offenbart sich, wie schwer die Erzählung über die Lebens-zeit in Institutionen fallen, so GOFFMAN.265 Die Gruppe der Biographen gehören zu den langjährigen Insassen in Institutionen und haben mehr Lebensjahre in offenen oder geschlossenen Heimen, in Kliniken oder im Haft- oder Maßregelvollzug ver-bracht als in Freiheit. Hr. Grün (Fall 1) hat 13 Jahre in Institutionen innerhalb von 33 Lebensjahren verbracht, Fr. Brandt (Fall 2) befand sich 26 Jahren von 28 Lebensjah-ren im Gesichtsfeld von stationären Einrichtungen, Fr. Satic (Fall 3) wurde 16 Jahre institutionell binnen 30 Lebensjahren betreut und Hr. Noller (Fall 4) verbrachte von 264 Hildenbrand, B. Jahn, W. (1988):“Gemeinsames Erzählen“ und Prozess der Wirklichkeitskonstruktion in familiengeschichtlichen Gesprächen. In: Zeitschrift für Soziologie; 15; S. 203-217. 265 Goffmann, E. (1961): Asylums. Anchor. New York.
149
31 biographischen Lebensjahren 28 Jahre in stationären Heimen, vorwiegend war er geschlossen untergebracht. Die Biographen sind in ihrer Handlungspraxis einge-schränkt, sie haben wenig aktivierenden Anteil an der Planung und Gestaltung der Zukunft und des Alltags. Ihr Lebensweg ist institutionalisierend, andere, wie auch der Interviewer, in der Funktion des Heimleiters, bestimmen über Zukunft und Deutung des Lebens.
5.4. Methodologie oder die Frage, was soll mit dem sozialstatistischen Sample und der biographischen Rekonstruktion gezeigt werden?
Im Gegensatz zu hypothesenprüfenden Ansätzen der Sozialforschung, die u.a. POPPER (1972) mitbegründet hat, wird an der interpretative bzw. rekonstruktive Me-thode, die die Grundlage der folgenden Rekonstruktionen bildet, kritisiert, ihr man-gele es an methodischer und wissenschaftlicher Genauigkeit.
Fallrekonstruktive Forschungsmethoden gehen von der Annahme aus, dass die auto-nome Lebenspraxis selber im interaktionellen Vollzug ihre Strukturen schafft, affir-miert und verändert. Dieser ständig laufende Prozess ist forschungsmethodisch zeit- und interaktionssensibel am besten re-konstruktiv nachzuzeichnen, weil die Struktu-ren alltagsweltlich zwar wirken, aber als solche von den Akteuren nicht ohne weiteres erkennbar sind und daher einer Aufdeckung bedürfen, die zwar eng an den alltags-weltlichen Phänomenen bleibt, diese aber in einer (nicht alltagsweltlichen) zum Handlungsdruck entlasteten hermeneutischen methodischen Operation freilegt. So-weit dies gelingt, wird sowohl erfolgtes Handeln besser verstanden als auch künftiges Handeln besser erwartbar. Die an der Sprache und im Falle von Videoanalysen kör-perbezogenen symbolischen Sinn- und Regelsysteme werden im Forschungsvollzug als Regeln formuliert und eben nicht nach Merkmalskategorien (wie in der nomolo-gisch-statistischen Forschung) zusammengefasst. Die methodische Rekonstruktion unterscheidet sich damit auch von der alltagssprachlichen Nacherzählung von Ereig-nissen oder einer journalistischen Berichterstattung, die nicht auf die Struktur- und Regelaufdeckung aus sind, sondern an der Reproduktion materialer Phänomene zur Herstellung von gemeinsam geteiltem Sinn. Diese rekonstruktive Zugangsweise eig-net sich in besonderer Weise auch für den Umgang mit Adressaten der Sozialen Ar-beit, weil sich Strukturaufdeckungen am Ende des Forschungsprozessen kommuni-kativ in den professionellen Interaktionsprozess einspeisen lassen und zu einer Strukturänderung (einer anders erzählbaren Lebensgeschichte, anderen künftigen Le-bens- und Handlungsoptionen) führen kann. In diesem Sinne lässt sich bereits von Rekonstruktiver Sozialer Arbeit sprechen, die zwar die rekonstruktive Forschungs-methode als professionelle Kernkompetenz nutzt, aber in ihrer praktischen Hand-lungskonturierung darüber hinausgeht.266
Bei den fallrekonstruktiven Verfahren gehe es stets um die Rekonstruktion von Er-fahrungen und ihrer Bedeutung für den Fall, so GOBLIRSCH (2008) in einem Auf-satz zu einem interdisziplinären Zugang bei fallrekonstruktiven Verfahren. Sie kann
266 Vgl. Bettina, V. (2015): Rekonstruktive Soziale Arbeit – Ein Konzept zur Entwicklung von Forschung, beruflicher Praxis und professioneller Selbstreflexion. In: Rätz, R./ Völter, B. (2015): Wörterbuch Rekonstruk-tive Soziale Arbeit. Barbara Budrich. Opladen, S. 253-269.
150
schriftlich, verbal, in offen-freien oder strukturierten Interviews oder in Alltagssitua-tionen gewonnen werden. Narrativ-biographische Interviews, wie sie SCHÜTZE267 (1983) entwickelt hat, haben sich zu einem Datenerhebungsinstrument im europäi-schen Sprachraum etabliert, das mit autobiographischen Erfahrungen und Erfah-rungsaufschichtungen in Form von erzählter Lebensgeschichte arbeitet.
Es bleiben jedoch, stellt GOBLIRSCH resümierend fest, einige grundlegende Fragen unbeantwortet, z.B. wie entwickeln Individuen die Kompetenz, Lebensgeschichten zu konstituieren und zu erzählen? Wie verändern sich Lebensgeschichten mit fort-schreitender Entwicklung der Individuen? Wie erfahren oder „machen“ Individuen persönlichen Erfahrungen und was passiert im Prozess der weiteren Erfahrungsauf-schichtung mit bisher gemachten Erfahrungen? Wie entsteht autobiographisches Er-innern? Wie entstehen lebensgeschichtliche Selbstdarstellungen? Dies basiert auf Er-gebnissen von Grunderfahrungen der Soziolinguistik, der Entwicklungspsychologie und der Soziologie, die sich mit sprachlichen Entwicklungsprozessen auseinander-setzen, wie vom Kindesalter an sprachlich die Kompetenz erworben wird, Bezug auf sich selbst zu nehmen und dabei Schritt für Schritt ein konstantes Selbstverständnis von ihrem „So-Geworden-Sein“ zu erlangen, wie sich schließlich Individuen biogra-phisch strukturieren und sich in narrativ-biographischen Interviews präsentieren.268
GOBLIRSCH fasst drei Aspekte empirischer Grundlagen lebensgeschichtlichen Er-zählens wie folgt zusammen: Die Interaktion mit anderen, das autobiographische Er-innern und die biographische Strukturierung.
1. Die Interaktion mit anderen bildet den Handlungskern, in dem Individuen sich selbst und andere von früher Kindheit an konstituieren. Die Individuen, formen von Redezug zu Redezug, gemeinsam mit ihren Interaktionspartner, ihre Selbste und ihr Verständnis von der Welt und verfestigen oder verändern es in jedem neuen Ge-spräch. Dabei erwerben und eignen sich die jeweiligen Interaktionspartner entschei-dende Interaktionsstrategien an, die sie in späteren Interaktionen als Erfahrungsregeln anwenden, um mit ihren Gesprächspartnern eine gemeinsame Wirklichkeit zu schaf-fen, um schließlich ein situationsspezifisches und in der Vergangenheit erprobtes Verständnis von sich selbst wieder herstellen zu können. Konflikte, Krisen oder Miss-verständnisse bringen kommunikative Herausforderungen mit sich, deren Verlauf trotz vergangener kommunikativer Erfahrungsaufschichtungen nicht vorhersehbar sind, sondern jedes Mal neue interaktive Strategien erzwingen, um letztendlich neue Lösungswege zu suchen, die aber auch immer wieder einmal, nicht gefunden werden.
Sprachlich-interaktive Herausforderungen führen zur Ausbildung neuer kommunika-tiver Schemata, zur Veränderung und Weiterentwicklung des Alt-Erprobten. Es kommt somit zu einer Erweiterung des kommunikativen Handlungspotentials der In-dividuen und trägt zur Veränderung ihrer sozialen Wirklichkeit bei, so GOBLIRSCH. Dieser identitätsstiftende Prozess dauert so lange an wie Individuen kommunizieren.
267 Schütze, F. (1983): Biographieforschung und narrative Interviews. Neue Praxis, 13. Jg., Heft 3; S.: 283-293. 268 Goblirsch, M. (2008): Wie entstehen Lebensgeschichten? Ein interdisziplinärer Zugang zu Fallrekonstruk-tionen In: Fallverstehen und Fallstudien. Interdisziplinäre Beiträge zur rekonstruktiven Sozialforschung. Band 1. 2. Aufl. Budrich. Opladen. S. 53-66.
151
Somit unterliegt das Konzept von Identität einem permanenten Herstellungs- und Veränderungsprozess, der ein Leben lang andauert.
2. Das autobiographische Erinnern. Der Einfluss von Interaktionen zwischen Eltern und Kinder auf autobiographische Erinnerungsprozesse wurde von FIVUSH 1994 oder NELSON 2003 studiert. In den Studien wird festgestellt, dass eine in Form von Narrationen gemeinsame geteilte Erinnerung deutlich die Form dessen beeinflusst, wie das Kind selbst später erinnern wird. Bedeutsam ist, dass ein Kind im Gespräch mit seinen Eltern über deren vergangene Erfahrungen einen Interpretationsrahmen entwickelt, der ihm später bei der Rekonstruktion eigener Erinnerungen dienen wird. Beim kommunikativen Prozess der Identitätsherstellung (lebensgeschichtlichen Selbstdarstellung) geht es wesentlich nicht darum, was Eltern mit ihren Kindern ge-meinsam erlebt haben, sondern vielmehr darum, wie sie eine nicht gemeinsam ge-teilte Erfahrungen kommunikativ teilen. Es geht also um die gemeinsam geteilte Er-innerung. Im Wesentlichen geht es darum, wie das Kind später erinnert.
Im Konkreten ist in der Falldarstellung Nr. 1 (Hr. Grün) das Erinnern an die ersten Lebensjahre durch eine Auslassung geprägt, ein großes Vakuum des Nicht-Darüber-Sprechen-Dürfens bzw. ein Schweigegelübde, da die Staatssicherheit alles abhörte und den Eltern jederzeit auf Schritt und Tritt nachspionierte. Das Vertrauen in andere Menschen außerhalb der Familie, das Private, das Intime wird aus der Familie suk-zessive entfernt, entfremdet und entzogen. Vertrauen herrscht nur innerhalb der Tri-ade, doch der Druck eines nach außen hin sich abgeriegelten Familiensystems lastet als schwere Bürde auf den Schultern des jungen Biographen.
Ein weiteres Beispiel. In der 2. Falldarstellung erinnerte Fr. Brandt an einen bunten und reich bestückten Garten, der mit Obst und Kirschen voll war. Ihre Assoziation mit ihrer Oma, ist eine Insel der Erfüllung, nämlich nach Herzenslust zu naschen, sich den Bauch vollzuschlagen, unbeschwert als Kind zu spielen und sich satt zu essen.
In der 3. Falldarstellung erinnerte sich Fr. Satic an ihren Vater, der für sie omnipotent, reich, gebildet und bereist war. Der Vater, der ihr als Prinzessin alle Wünsche erfüllte. Der Vater, den sie als Retter memorierte, die einzige Person in ihrem Leben, die sie zu akzeptieren bereit ist. Die Biographin erinnert sich durchgehend dran, dass sie in einem Leben feststeckt, in dem sie an einem falschen Ort und somit inmitten eines falschen Lebens, unter dem sie leidet und darin nur vor sich hinvegetiert, auszuhalten hat.
Der Biograph in der Falldarstellung 4 (Hr. Noller) assoziiert mit seiner Mutter eine Person, die dauerhaft Hilfe benötigt. Er beschreibt die erste Erinnerung als eine Art Vakuum, in dem er ohne jegliche Bindung und Beziehung lebte. Er berichtete über die Mutter, die ihn nicht versorgen, die nicht alleine leben kann und über sich selbst als jemand, der umherirrt und sein Zuhause nicht findet. Als seine Mutter ihren ersten Sohn durch Suizid verloren hat, lässt sie nicht locker, bedrängt und verlangt nach ihrem zweiten Sohn. Der Biograph fragt sich gleich zu Beginn, wer seine Mutter ei-gentlich ist, was sie von ihm wolle und stellt sich diese Fragen lebenslang. Seine ersten positiven Erinnerungen beschreibt der Biograph erst mit dem 14. Lebensjahr, als er in einem Kinderheim mit anderen Kindern auf dem Hof Fußball spielt.
152
Der interaktiv-sprachlichen Darstellung als Narration kommt bei diesem Prozess be-sondere Bedeutung zu. Nach NELSON (2003) durchlaufen Kinder bis zur Entwick-lung des Selbst sechs Stufen, die von Geburt bis zum 7. Lbj. nacheinander ausgebildet werden. Von den sprachlich-sozialen Interaktionen, an denen Kinder aktiv beteiligt sind, ist es dann abhängig, wie schnell und differenziert die Ausbildung des Selbst vollzogen wird.
Nach dem 1. physischen Selbstverstehen (postnatal), folgt 2. das soziale Selbst (6-18 Monate), dann 3. das kognitive Selbst (16. Monat-3. Lbj.), das 4. repräsentative Selbst (2.-4. Lbj.), das 5. narrative Selbst (3.-6. Jahr). Hier beginnt beim Selbstverstehen die zeitlichen Komponenten Vergangenheit und Zukunft, die in den Narrationen der Kin-der zu finden sind. In dieser Phase wird das autobiographische Gedächtnis entspre-chend der entwickelten Erzählungen ausgebildet. Sie stellt der Beginn der Konstruk-tion einer lebensgeschichtlichen Darstellung dar, die durch ein autobiographisches Gedächtnis und Erinnern möglich wird. Vom 3.-6. Lbj. kann der Beginn einer lebens-geschichtlichen Verortung festgestellt werden. Zwischen dem (6. Phase) 5-7. Lbj. bilden Kinder ein kulturelles Selbst aus, d.h. die bisherige Definition des Selbst wird um kulturelle Aspekte erweitert. Das ist, so NELSON, die Grundlage, auf der Indivi-duen mit fortschreitender Erfahrungsaufschichtung, im Verlauf des Lebens, kom-plexe Entwürfe ihrer in kulturellen Zusammenhängen eingebettete Selbste mit siche-rer Vergangenheit und unsicherer Zukunft sowie eine komplexe soziale Wirklichkeit ausbilden können.
3. Biographische Strukturierung. Die Biographische Strukturierung (FISCHER-ROSENTHAL 1995/2000) dient als Herstellung eines Ordnungs- wie auch Orientie-rungsrahmens und ist die Leistung der Individuen, biographischen Erfahrungen so auszulegen, dass regelhafte biographische Strukturen entwickelt werden, denen man bei der Interpretation der eigenen Lebensgeschichte sowie beim zukünftigen Handeln folgen kann. Die biographische Strukturierung wird jeder neuen Entscheidung bzw. Handlung zugrunde gelegt, um den gelebten Alltag, der mit einer Vielzahl an Wahl-zwängen ausgestattet ist, zu vereinfachen.
Das Biographiekonzept setzt sich aus soziologischer Sicht aus dem Konzept persön-licher Identität und gesamtgesellschaftlichen Bedingungen zusammen. Nach FISCHER-ROSENTHAL vereinigt es drei Ebenen eines Konstitutionsprozesses so-zialer Ordnung und zeichnet sich um eine vierte Ebene quer zu den Ebenen liegenden temporalen operativen Strukturen aus. Biographien fassen sowohl gesellschaftlich gegebene, präskriptive als auch a. selbst bezogene im Sinne von selbst-erlebten, b. eigen-leiblichen Beschreibungen c. ex-post und orientiert zusammen. Diese Be-schreibungen sind Geschichten weil sie Zeit verarbeiten und in ihrer Versprachli-chung Temporalstrukturen der Gesellschaftsgeschichte, des Lebenslaufs und der Ge-neration produzieren und kommunizieren.269
269 Fischer-Rosenthal, W. (1999): Melancholie der Identität und dezentrierte biographische Selbstbeschrei-bung. Anmerkung zu einem langen Abschied aus der selbstverschuldeten Zentriertheit des Subjekts, bios 12, S.143-168.
153
Im Rahmen der regelhaften biographischen Strukturen wird beim Lebensentwurf der eigenen Biografie eine selbstgeschaffene Beständigkeit ermöglicht, so GOB-LIRSCH, bei der das Vergangene und Zukünftige konstant neu strukturieren. Das Sprechen über Vergangenes bietet die Option auch für Erfahrungen, für die kein In-terpretationsschema entwickelt werden konnte, bisherige biographische Strukturen zu verändern. In diesem Fall einer biographischen Strukturtransformation (wie z.B. in der Falldarstellung 1, Hr. Grün)270 wird vergangenes Handeln neu interpretiert und restrukturiert. Die gegenwärtige Zukunft wird auf der Grundlage der neuen Vergan-genheit verändert und neu entworfen. Restrukturierungsprozesse können schmerzhaft sein und stellen den bisherigen Lebensentwurf der gelebten Lebensbiographie auf den Prüfstand.
Biographische Strukturierung ist nicht ein zeitlich abgegrenztes sondern ein zu-kunftsoffenes Konzept, das für professionelle Hilfepraxis, die auch als Re-Struktu-rierungspraxis verstanden werden kann, genutzt werden kann, so GOBLIRSCH.271
Das autobiographische Selbstverständnis der Klienten wird in Interaktionen mit pro-fessionellen Helfern auf der Grundlage bisheriger biographischer Strukturen immer wieder neu hergestellt und kann bei entsprechender Gesprächsführung und reflektie-rend-interaktiver Steuerung (z.B. im Rahmen narrativer Interviews oder anderer so-zialarbeiterischer Intervention verändert, also co-konstruiert werden. Narrativ-bio-graphische Diagnostik, Interventionen und Dialoge sind bei diesem Konzept nicht voneinander zu trennen.
5.5. Verallgemeinerbarkeit und Validität
Die Forderungen nach Repräsentativität und Verallgemeinerbarkeit der Untersu-chungsergebnisse, wie sie in der quantitativ-statistischen Methode wie auch in der der biographischen Fallrekonstruktion angestrebt werden, können mit Hilfe beider Wege erreicht werden. Sie können somit verallgemeinernde Merkmale und Ergeb-nisse des entsprechenden Untersuchungsgegenstandes generieren.
Das bedeutet letztendlich, das trotz repräsentativer Auswahl von Personen (Stich-probe), die mit Hilfe von standardisierten Methoden beforscht werden, die daraus generierten Ergebnisse nicht generalisiert werden dürfen, selbst wenn sie den Krite-rium der Reliabilität (Zuverlässigkeit) und der Validität (Grad der Genauigkeit) ent-sprechen würden.272 Bei der Auswahl der Stichprobe der vier biographischen Struk-turierungen wird dennoch für die Gruppe der TSSP eine Sättigung erzielt.
270 Hr. Grün berichtete von seiner Behandlung im Maßregelvollzug in vielen Einzelgesprächen und berichtete im Strafprozess am LG Stuttgart von seiner durch die schizophrene Psychose beeinflussende Unfähigkeit, sich in die Situation, in die Perspektive und Rolle der Opfer empathisch hineinzuversetzen. Er habe diese Fähigkeit der Empathiefähigkeit durch Psychotherapie, durch Deliktgruppen und Psychoedukation nach und nach erwor-ben und einen anderen Blick auf seine Opfer entwickeln können, die in größter Angst und Panik von ihm bedroht, verletzt und beraubt wurden. Die Integration seines vergangenen Handelns, in die gegenwärtige Iden-tität und Lebensgeschichte hat über viele Jahre angedauert, so dass der Biograph nunmehr. Das Lebensalter spielt als Prognosekriterium eine sehr große Rolle. 271 vgl. a.a.O. Goblirsch S. 60. 272 vgl. Lamnek, S. (2005): Qualitative Sozialforschung. 4. überarb. Aufl. Beltz. Weinheim, S.184.
154
Das Aufdecken von Strukturen gerade am Einzelfall entspricht allerdings bereits ei-ner generalisierbaren Wissensproduktion, die sowohl für die Arbeit am Fall wie dar-über hinaus einen professionellen Mehrwert darstellt.
In Anlehnung an die Methode der Triangulation wurden flankierend quantitative (Voll)Erhebungen in den Feldern Sozialer Arbeit durchgeführt, in denen die Gruppe der TSSP vermutet wurde, um die erhobenen Daten eines gleichen sozialen Sachver-haltes, auf der Grundlage der Kriterien der Repräsentanz zu untermauern, wie FLICK das beschrieben hat.273
Bei der Repräsentativität, so LAMNEK, wird die Allgemeinheit durch rekonstruktive Verfahren gesichert, wobei die Kommunikation als Medium, auf der Grundlage einer abstrahierenden Typenbildung eingesetzt wird. In der qualitativen Sozialforschung geht es um das Typische, das Formen, der Typenbildung, wie Idealtypen, Extremty-pen, Prototypen oder einfach wichtige Typen einschließt. Hierbei wird gegen einen Zufall gearbeitet und Bemühungen unternommen, eine theoretisch-systematische Auswahl zu bilden.
Bei den anfangs sechs ausgewählten Biographen gab es im Verlauf der ersten durch-geführten Interviews bereits thematische Doppelungen, ähnliche, bis hin zu identi-sche institutionelle Vorerfahrungen, wie auch biographische Wiederholungen. So durchlief der Fall 5 ähnlich wie Fall 1 den Maßregelvollzug und Fall 6 erlebte als Frau, wie Fall 2 und Fall 3, einen transkulturellen Entwurzelungs- und Stigmatisie-rungsprozess im Herkunftsland wie auch in der Bundesrepublik Deutschland, wo sie geboren wurde und aufwuchs. Die starke Fokussierung auf einen Partner in der Ado-leszenz und eine unveränderliche Partnerschaft sind weitere Merkmale, die Hinweise für eine Sättigung des ausgewählten Samplings lieferten.
Die vier (ursprünglich sechs) ausgewählten Biographen, von denen zwei weiblich und zwei männlich sind, stehen für vier grundlegende Typen und Kategorisierungen der Gruppe der TSSP. Sie zeichnen sich durch spezifische individuelle wie auch ge-meinsame biographische, familiäre, gesellschaftshistorische, institutionelle Merk-male und Eigenschaften aus. Die vier Biographen weisen einerseits einen ähnlichen institutionellen Verlauf durch die Felder Sozialer Arbeit nach, der mit prägnanten Lebensereignissen (z.B. eine Inobhutnahme, der 1. Suizidversuch, obdachlos-sein etc.) und typischen entwicklungspsychologischen Statuspassagen (z.B. der schuli-sche Bildungsweg, eine berufliche Qualifikation) in Zusammenhang steht. Anderer-seits kommt es ab dem Zeitpunkt einer ersten langfristigen psychiatrischen oder fo-rensischen Unterbringung, z.B. in den Kategorien Hilfeannahmebereitschaft, Leib-und-Biographie-Konzept, bei der Behandlungscompliance, der Nutzungsverhaltens der Dienstleistung, beim zukünftigen Lebensentwurf, beim weiteren Verlauf in der Einrichtung, der Prognosebeurteilung und der Risikobeurteilung zu unterschiedlichen Entwicklungen und somit zu unterschiedlichen Typenbildungen.
Bei allen vier Biographen ist von einer familiär oder biographisch geprägten Trau-matisierung auszugehen. Die vier Biographen, die ab dem 14. Lebensjahr eine Medi-
273 vgl. Flick, U. (2001): Triangulation. Methodologie und Anwendung. Opladen
155
kalisierung erfahren, durchlaufen kulturelle Entwurzelungsprozesse und Stigmatisie-rungsprozesse durch Migration, Flucht, Aussiedlungen oder durch häufige Umzüge. Die religiöse Prägung spielt bei den vier Biographen nur im Feld der Krankheitskon-zepte, insbesondere in der Falldarstellung 3, als Muslima, sowie bei der Falldarstel-lung 2 eine Rolle, die vom russisch-orthodoxen Glauben zur protestantischen Kirche konvertierte.
Als weiteres spezifisches Merkmal der Gruppe der TSSP ist das Verhältnis von Leib und Biographie im Verhältnis zum jeweiligen biographischen Verlauf, der Krank-heitsentwicklung und der institutionellen Verortung hervorzuheben.
5.6. Besondere Bedeutung des Leib-Begriffes bei der Gruppe der TSSP für die Biographie
Nach FISCHER-ROSENTHAL gehören Biographie und Leib zusammen, denn die Last der Kindheit mit ihrer Körperdressur und den Krankheiten, die den Leib in einer gefährlichen Umgebung immunisieren, die Last der Adoleszenz mit starken körper-lichen Veränderungen und ihrer psycho-sexuellen Einübung, die Last des mittleren Lebensalters mit ihrer Erwartung nach leiblicher Reproduktion, die Last des Alters mit ihren körperlichen Mankos und chronischen Krankheiten, sie stellen allesamt Prozesse leiblicher Artikulation im Verlauf biographischer Arbeit dar.274
Es geht nicht darum, wie Biographie oder Leib sind, sondern vielmehr darum, inwie-fern Biographie und Leib als etwas auftauchen, mit dem Menschen ihre Welt und ihr Leben in dieser Welt strukturieren.
FISCHER sagt, ich komme räumlich nicht über meinen Körper hinaus, kann nur dort sein, erleben und handeln wo er ist, dennoch „vergesse“ ich meist die räumliche Per-spektive, die er mir gibt, „nulle“ und normalisiere sie, wenn ich jedoch den selbstver-ständlichen Punkt verliere, von dem aus ich agiere, wahrnehme, bedroht das mich und somit gegebenenfalls meine Gesundheit. Solche Verluste treten z.B. durch frei-willige oder erzwungene Migration an einen anderen sozio-geographischen Ort, in einer anderen Gesellschaft oder durch Veränderungen des Ortes, an dem ich ontoge-netisch, leiblich und soziogeographisch das wurde, was ich bin. Die daraus resultie-renden Irritationen zwingen mir eine neue Perspektive auf, und können auch auf mei-nen Körper einwirken.275
NEUN & DÜMPELMANN beschreiben die möglichen Phänomene, wie sie auch bei der Gruppe der TSSP zum Vorschein kommen als Weltverlust und Depersonalisation, die mit einem gesteigerten Körperfokus bis hin zur Selbstdestruktion beantwortet werden, um sich gewahr zu werden.276
In allen vier Falldarstellungen kommt es mehrfach im Verlauf der Biographie zu ei-gengefährdendem Verhalten, im Sinne einer Selbstschädigung durch Mangelernäh-rung, Dehydrierung, Suizidhandlungen mit Tabletten, Alkohol, polytoxikomaner
274 Fischer-Rosenthal, W. (2002): Biographie und Leiblichkeit. In: Biographie und Leib. Alheit P, Dausien, B., Fischer-Rosenthal, W., Keil, A. (Hg.) 2. Aufl. Psychosozial-Verlag. Gießen, S. 16ff. 275 vgl. a.a.O. Fischer (2002): S. 21-22. 276 vgl. Neun, H. Dümpelmann, M. (1989): Depersonalisation. In: Hirsch, M.: Der eigene Körper als Objekt. Zur Psychodynamik selbstdestruktives Körperagieren. Heidelberg. Springer. S.33-76.
156
Drogenkonsum, durch riskanten Umgang mit Schusswaffen, durch Brand- oder Schnittverletzungen oder durch bewusste Ablehnung der verordneten Medikamente oder von notwendigen (Kontroll)Untersuchungen bei einer schweren körperlichen Erkrankung.
Bei der Lebensspanne, die in einem zweideutigen Sinne, zum einen meine Lebenszeit meines Körpers, zum anderen meine biographische Lebensspanne darstellt, ist zu hin-terfragen, erhalte ich die Lebensspanne von meinem Körper oder verschaffe ich sie andererseits auch durch mein Leben? Hier sind von „therapeutischem Interesse Phä-nomene chronischen Krank-Seins, in denen weitgehend leibliche und biographische Restrukturierungen verflochten sind, weil vorherige lebenslang aufgebaute Orientie-rungsstrukturen durch neue dauerhaft ersetzt werden müssen.“ 277
Es hat sehr viel Zeit benötigt, bis die Krankheiten zur Funktionalisierung des Mecha-nismus Körper und Krankheitsbehandlung zur Reparatur einer geschlossenen Ma-schine wurde. Eine Perspektiveumkehr als therapeutische Strategie zur Rückgewin-nung des biographischen Selbst über den Körper, die Bedeutung von Psychosomatik oder von psychosozialen Einflüssen, die Erkenntnisse von sozialpsychiatrischer In-tervention und von Behandlungskonzepten spielen in der heutigen Medizin bzw. in der klinischen Psychiatrie nur eine randständige Bedeutung.
Die Erfindung, Bedeutungssteigerung und Propagierung des optimierbaren Körpers, in modernen Gesellschaften geschieht auf der Rückseite eines Bedeutungsverlustes des Leibes, der als Konzept zunehmend verloren geht. Krankheit, Schwäche oder Hilfsbedürftigkeit stellen Möglichkeitshorizonte des Lebens dar, das, was zu mir ge-hört, auch wenn es mir nicht gefällt, zu verschwinden und zu verdrängen.278
Die im Buche HIOB im AT aufgeworfene Theodizee-Frage, also die Frage nach dem Sinn von menschlichem Leid im Leben und warum Gott, als Allmächtiger, das Leid zulässt, bleibt die schlussfolgernde Interpretation, dass letztendlich Krankheit, Tod oder Leid zutiefst menschliche Dimensionen und Kategorien des Seins darstellen und somit zum Mensch-Sein dazugehören, wie Lebensfreude, Glücksmomente, Erfolg, körperliche Kraft und Gesundheit.
Die von Kindern und Jugendlichen im Sozialisierungsprozess abverlangte zuneh-mende Körperkontrolle, damit die Neutralisation des Leibes in Situationen sozialer Interaktion, geht einher mit der exponentiell verschärften Macht- und Kontrolle von Organisationen und Institutionen (wie z.B. Haftanstalten, Krankenhaus) über den Körper. So erfährt in einem verstörten Sinn der Leib im sozialen Umgang und Prozess der Zivilisation als Strukturierungsmittel von Integration gelöscht und eliminiert zu werden. Mächtig wirken hier insbesondere sublime, symbolisch vermittelte Körper-bilder, die gesteigerte Schönheit und Genuss versprechen und aktive Inszenierungen, Modulierungen und gar Produzierungen des Körpers unterstützen, so FISCHER. So ist auch der epidemiologische Anstieg von lebensbedrohlichen Essstörungen eher bei den Frauen feststellbar, (wie in Fall 2, aber auch in Fall 4) sodass eine solche Distanz zwischen sich und dem Körper aufgebaut wird, dass das vernichtet wird, was man
277 vgl. a.a.O. Fischer (2002), S. 23. 278 vgl. a.a.O. Fischer (2002), S. 25.
157
eigentlich kontrollieren wollte, nämlich den eigenen Körper. Das Phänomen im Be-reich Techno und der Hipp-Hopp Kultur ist ähnlich, da sie von extremer Körperar-beit, unter Einfluss von Extasy und Musik, gekennzeichnet sind und es zu einer Ver-ausgabung der Kräfte, die im Extremfall zur Dehydrierung und lebensbedrohlichen Erschöpfung führen, kommt279
Chronische Krankheiten sind in erster Linie nicht als Fehlfunktionen des Körpers und der Organe zu lesen, sie können vielmehr, so FISCHER, als Artikulation des Körpers im Ausdrucksfeld des Lebens aufgefasst werden. Angesichts eines konfliktgelade-nen, desorientierten und traumatisierten Lebensverlaufs, bei dem eine soziale als auch ein kommunikativ-gesellschaftliche Reorientierung nur unvollständig möglich war, bildet der Körper eine beredte Manifestation dieser Situation aus. Krankheit als Spra-che des Leibes könnte so biographisch-rekonstruktiv entschlüsselt werden. Krankheit könnte als Antwort, als kommunikativer Anschluss auf einen problembeladenen Le-bensverlauf verstanden werden, auf den man sich im Zuge der therapeutischen und psychosozialen Hilfen, aber auch einer sozialpsychiatrische Behandlung, durch sprachliche Kommunikation, beziehen und thematisiert kann .280
5.6.1. Text- und thematische Feldanalyse nach FISCHER-ROSENTHAL und ROSENTHAL
Das zentrale, konzeptionelle Merkmal dieses struktural-hermeneutischen Auswer-tungsverfahrens ist durch die Differenzierung nach den Dimensionen, 1. der gelebten Lebensgeschichte, 2. der erzählten Lebensgeschichte und 3. der erlebten Lebensge-schichte. gekennzeichnet.281 In der Fallrekonstruktion werden diese Untersuchungs-ebenen, die im Folgenden näher beschrieben werden, getrennt voneinander fokussiert und kontrastiert.
Zu 1.: Bei der Rekonstruktion der gelebten Lebensgeschichte geht es um die biogra-phische Aufschichtung, um „objektive“ biographische Ereignisse und auch prägnante Lebensepisoden, die länger anhalten, die aus Sicht des Beobachters, ohne Wertung von wichtig oder unwichtig, ohne Akzentuierung eines bestimmten biographischen Ereignisses erfolgten, dem eine größere Bedeutung oder gar weniger Gewicht zuge-ordnet wird. Die subjektive Dimension des Biographen wird durch den Beobachter nicht berücksichtigt. Hierbei wird die biographische Struktur der chronologischen Er-eignisabfolge und der prägnanten Lebensepisoden im Lebenslauf untersucht.282
Zu 2.: Die erzählte Lebensgeschichte untersucht die Struktur der Selbstpräsentation im Interview oder wie MOLLENHAUER & ULLENDORFF (1995) im Feld der So-zialpädagogik versuchten, den Begriff der Selbstdeutung zu etablieren. Hierbei geht es um die die zentrale Fragestellung. Wie stellt sich der Biograph dar? Weshalb führt der Biograph dieses Thema an dieser Stelle ein? Weshalb wird dieses Thema in dieser Textsorte (Narration, Beschreibung, Argumentation, Bericht, etc.) präsentiert?
279 vgl. a.a.O. Fischer, S. 25-26. 280 vgl. a.a.O. Fischer, S. 39-40. 281 vgl. Fischer-Rosenthal, W./Rosenthal, G. (2007): Analyse narrativ-biographischer Interviews. In: Flick, U. et al (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 5 Aufl. Reinbeck. Rowohlt. S. 460ff. 282 vgl. a.a.O. Goblirsch (2010): S.: 83.
158
Zu 3.: Bei der erlebten Lebensgeschichte geht es um das Rekonstruieren der subjek-tiven Wahrnehmung biographischer Ereignisse, wie sie sich im Verlauf des Lebens polytheistisch aufgeschichtet haben und zu aktuellen Anlässen monotheistisch repro-duziert werden, so SCHÜTZ.283
Die drei Strukturebenen der Lebensgeschichte können kongruent, also deckungs-gleich sein, sie können aber auch in unterschiedlichen Graduierungen und Umfängen voneinander abweichen. Bei der Gruppe der TSSP können z.B. bestimmte Themen, wie Geschwister, die Beziehung bzw. Bindung zu einzelnen Elternteilen, Verlust durch Krankheit oder Tod, Flucht oder Migration, Gewalterfahrungen oder auch prägnante Lebensepisoden wie z.B. Inobhutnahme als Kind, das Leben auf der Straße, Heimerfahrungen, Drogenerfahrungen und das Beschaffen von Drogen, Me-dikalisierung, Psychiatrisierung, die Zeit im Maßregel- oder Haftvollzug, Bürger-kriegserlebnisse) anders präsentiert, also erzählt als erlebt werden.
Die gelebte Lebensgeschichte, die der realen Chronologie folgt, muss nicht zwangs-läufig mit der retrospektiv erzählten oder erlebten Lebensgeschichte deckungsgleich sein. Aus unterschiedlichen Gründen und Motiven heraus können Ereignisse aus dem gelebten Leben, die sich ereignet haben und faktisch geschehen sind, nicht erzählt werden. Auf der anderen Seite können im erzählten Leben, in der Interviewsituation, wiederum Ereignisse dargestellt werden, die im gelebten Leben nicht oder anders er-folgten, aber in der aktualsprachlichen Präsentation entsprechend der Selbstdarstel-lung erlebt werden. Die unterschiedlichen Betrachtungsebenen, so GOBLIRSCH, werden mit Hilfe der nun folgenden Auswertungsschritte getrennt voneinander und für die jeweiligen Perspektiven biographischer Strukturen herausgearbeitet.284
Nach der struktural-hermeneutischen Analyse wurden Auswertungsschritte entwi-ckelt, die es ermöglichen, jeweils die eine oder andere Perspektive der Biographie zu untersuchen.
Im ersten Auswertungsschritt einer a.) biographischen Datenanalyse wird die Rekon-struktion der gelebten Lebensgeschichte in den Fokus genommen. Im darauffolgen Schritt wird mittels einer b.) Text- und thematischen Feldanalyse eine Rekonstruktion der erzählten Lebensgeschichte, schließlich folgt c.) eine Rekonstruktion der Fallge-schichte, die auf eine Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte abzielt. Auf den letzten Auswertungsschritt, eine abschließende Feinanalyse, verzichte ich in den vier für die Gruppe der TSSP exemplarischen Falldarstellungen, bzw. dieser Schritt er-folgt im Sinne von GOBLIRSCH in den bereits vorhergehenden Auswertungsschrit-ten, denn eine Feinanalyse kann in allen Stellen des interpretativen Prozesses, durch-geführt werden. Das ist insofern sinnvoll, da man sich dadurch von einer möglichen schematisierten, strengen oder einseitigen Zuwendung zu einem Auswertungsschritt distanzieren und einen neuen Zugang zum Thema generieren kann.285
283 Schütz, A. (1971): Einige Grundbegriffe der Phänomenologie. In: Gesammelte Aufsätze. Band 1. den Haag, Nijoff. S.:115. 284 vgl. a.a.O. Goblirsch (2010), S.: 84. 285 a.a.O. Goblirsch, S. 91.
159
Folgende Auswertungsschritte werden bei der Fallrekonstruktion unterschieden:
Zu a.) Biographische Datenanalyse: Hier werden Tatsachen, also biographische Er-eignisdaten der Lebensgeschichte der jeweiligen Biographen in eine feste chronolo-gische Ereignisabfolge gebracht. Ziel ist es hierbei die biographische Strukturierung gelebten Lebens zu rekonstruieren. Die biographischen Ereignisdaten des Biographen werden in eine chronologische Abfolge ihrer Entstehung abduktiv und hypothesen-generierend in Gruppen interpretiert.
Zum einen werden die Familiengeschichte, Daten zu den Eltern, den Geschwistern und zum Biographen, sowie gesellschaftlich-historische Daten hervorgehoben. Zu-dem werden erste Hinweise zur Epoche gelieferte aber auch erste Überlegungen wer-den eröffnet, in welche Familiensituation der Biograph hineingeboren wird und wel-che Zukunftshorizonte damit eröffnet werden, so FISCHER-ROSENTHAL286.
„Bei der biographischen Datenanalyse wird rekonstruiert, welche Handlungsmög-lichkeiten in den spezifischen Zeiten und Kulturen mit der spezifischen Geschichte des Biographen, dem Biographen zur Verfügung standen und welche er innerhalb welcher Struktur realisiert bzw. nicht realisiert.“287
Zu 1. Es wird untersucht, in welcher Reihenfolge die Interviewten ihre wesentlichen biographischen Erlebnisse berichten (z.B. Geburt, Geschwister, Einschulung) und in welcher Textsorte sie ihre Ereignisse und Erzählungen präsentieren. Es wird auch untersucht, wie sich die einzelnen biographischen Erfahrungen in der erlebten Le-bensgeschichte chronologisch aufgeschichtet haben. Die Genese der erlebten Lebens-geschichte soll rekonstruiert werden, und bei der Analyse der biographischen Selbst-präsentation soll die Genese der Darstellung in der Gegenwart entschlüsselt werden,
286 vgl. Fischer-Rosenthal, W. (1996): Strukturale Analyse biographischer Texte. In: Brähler, E; Adler, C: Quantitative Einzelfallanalyse und qualitative Verfahren. Gießen. Psychosozial-Verlag. S.147-209. 287 a.a.O. Goblirsch. S. 88.
Sequentielle Analyse der objektiv-biographischen Daten (Ereignis-daten)
Text und thematische Feldanalyse-Analyse der Textsegmente-Selbst-präsentation des erzählten Lebens
Rekonstruktion der Fallgeschichte (erlebtes Lebens)
Feinanalyse einzelner Textstellen (dies kann jederzeit erfolgen)
Kontrastierung der erzählten und der erlebten Lebensgeschichte
Typenbildung
160
die sich von den thematischen und zeitlichen Verknüpfungen grundsätzlich von der Abfolge der Erlebnisse unterscheidet. (FISCHER (1996): 187)
Die Daten werden aus den transkribierten Interviews, aus dem Archivmaterial, Arzt-briefen, Gerichtsakten, Gutachten und Sozialberichten, etc. generiert.
Historisch-gesellschaftspolitische Daten sind ebenso einzubeziehen, eine historische Kontextualisierung der biographischen Daten ist vorzunehmen, sowie gegenstands-bezogenes, theoretisch und empirisch fundiertes Wissen über die Auswirkungen be-stimmter Lebensereignisse während eines bestimmten Lebensalterns (Entwicklungs-psychologie) zu berücksichtigen.
Es wird danach gefragt, welche Handlungsmöglichkeiten der Biograph in einer be-stimmten Situation hatte oder wie Oevermann es formulierte, „was eine Person ver-nünftigerweise d.h. nach Geltung des unterstellten Regelsystems in einem spezifizier-ten Kontext bei Konfrontation mit einem spezifizierten Handlungsproblems tun könnte oder tun sollte.“ Vgl. OEVERMANN (1980), 23) einen Kontrapunkt einer Determination des Individuums und seiner Lebensgeschichte zu setzen.
Bei der Auslegung eines jeden Datums werden nach dem abduktiven Vorgehen immer wieder Folgehypothesen über den möglichen, anschlussfähigen Fortgang entworfen. Es werden auch Prognosen über den weiteren Verlauf gemacht, die sich nicht nur auf Reproduktionen der sich in der Analyse bereits angedeuteten oder hypothetisch ent-worfenen Strukturen beziehen, sondern auch auf Möglichkeiten für Transformationen beziehen. Es geht schließlich auch darum, mögliche Veränderungen zu entwerfen.
Auszüge einer Biographischen Datenanalyse am Bspl. der 1. Falldarstellung:
Biographische Datenanalyse:
- Rekonstruktion der gelebten Lebensgeschichte (Ereignisdaten-Strukturhypothese zum Lebenslauf)
Familiengeschichtliche Daten
Biograph: wird 198X in Großstadt geboren
Mutter: Akademikerin, „Politische“
Vater: Facharbeiter „Bahner“
Eltern sind verheiratet
Geschwister: Hallbruder, unehelich (väterlicherseits) geb. 197X
Halbschwester, aus 1. Ehe der Mutter, geb. 196X, Akademikerin
Halbschwester, aus 1. Ehe der Mutter, geb. 197X, Angestellte
161
Gesellschaftlich-historische Daten
1981-1990: Finanzkrise in DDR, u.a. durch Wettrüsten der Sowjetunion ausgelöst, dabei geriet die DDR in wirtschaftlichen Schieflagen und einer Destabilisierung des gesamten DDR Regimes
1984: Die von Eppelmann und Havemann gegründete Friedensbewegung ebnet einer anwachsenden Bürgerrechtsbewegung eine breite Plattform
1985: M. Gorbatschow wird sowjetischer Generalsekretär und leitet auf der Grund-lage von Glasnost und Perestroika eine demokratische Entwicklung ein
3.10.1990: Deutsche Wiedervereinigung, die Mauer fällt
Biographische Daten
Nr. Datum Ereignis
1. 198x Biograph wird in X-Stadt geboren
3. 3/1989 Eltern reisen mit Biograph in Westen aus, Stiefgeschwister bleiben im Osten zurück
7. 1995 Biograph hört abrupt auf mit Leistungs-sport, verweigert den Schulbesuch, lebt wo-chenlang mit Peers auf der Straße,
10. 1988 Suizidversuch, 1. Psychiatrische Klinikbe-handlung
usw. …
Die zentralen Fragestellungen lauten bei der Erhebung und Rekonstruktion der fami-liengeschichtlichen und der gesellschaftlich-historischen Daten eines Biographen lauten, in welche Familiensituation wird der Biograph hineingeboren und welche Zu-kunftshorizonte werden damit eröffnet.288
zu b.) Text und thematische Feldanalyse: erzählte Lebensgeschichte
Ziel dieses Schrittes ist, die Regeln für die Genese der in der Gegenwart des Inter-views präsentierten biographischen Erzählungen /bzw. Selbstpräsentation herauszu-finden. Hier ist wichtig, weshalb konzentriert sich ein Biograph ob nun bewusst in-tendiert oder latent gesteuert so und nicht anders. Welche Mechanismen die Auswahl der präsentierten Themen und deren Gestaltung, die temporalen und thematischen Verknüpfungen der einzelnen Teile der erzählten Lebensgeschichte steuern!289
GUREWITSCH versteht unter Thema das, was uns in einem gegebenen Augenblick beschäftigt und im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht. Themen sind jeweils in ein thematisches Feld eingebettet. Das thematische Feld definiert Gurewitsch
288 Fischer-Rosenthal, W. (1996): Strukturale Analyse biographischer Texte. In: Brähler, E; Adler, C: Quan-titative Einzelfallanalysen und qualitative Verfahren. Gießen. Psychosozialer Verlag. Reihe Forschungen, S. 147-209. 289 vgl. a.a.O. Fischer-Rosenthal, W. (1996),S. 196-197.
162
(1974):4) als „die Gesamtheit der mit dem Thema kopräsenten Gegebenheiten, die sich als sachlich mit dem Thema zusammenhängend erfahren werden und den Hin-tergrund oder Horizont bilden, von dem sich das Thema als Zentrum abhebt.“290
Das Feld, so FISCHER-ROSENTHAL, bestimmt das Thema und das Thema das Feld. Mit dem Wechsel eines Themas von einem Feld in ein anderes modifiziert sich das Thema, ebenso wie sich mit der Einbettung eines Themas in ein spezifisches Feld dieses Feld modifiziert. Somit erschließt sich die Bedeutung der einzelnen Bestände einer biographischen Präsentation in deren Gesamtgestalt, dabei spielt auch die tem-porale Abfolge eine nicht unbedeutende Rolle.
Bei jeder aufgeführten Sequenz geht es um die Identifikation inhärenter Verweisun-gen auf mögliche thematische Felder und um den hypothetischen Entwurf der jeweils anschlussfähigen und folgenden Sequenz.
Welche Themen werden nicht thematisiert, obwohl sie vermutlich kopräsent sind?
In welcher Textsorte wird die Sequenz der biographischen Erlebnisse vom Interview-ten präsentiert? Warum wählte die Biographin diese Textsorte für diese Sequenz, be-gründet sich auf die Hypothese, dass die Wahl der Textsorte etwas mit der Interaktion zwischen Interviewer und Interviewten als auch mit der jeweiligen biographischen Erfahrung zu tun hat.
Hier wird auf die Erzähl- und Textanalyse von SCHÜTZE (1983, 1994) sowie auf die Anregungen von FISCHER (1982) zur thematischen Feldanalyse (vgl. a.a.O. Ro-senthal 1995:218) Bezug genommen.291
Das Ziel dieses Auswertungsschrittes ist die Rekonstruktion der Struktur der erzähl-ten Lebensgeschichte, es geht um die Selbstpräsentation im Interview, wie sich kon-kret der Biograph darstellt?
Vor der Analyse des erzählten Lebens wird der Textkorpus des Interviews in Textse-gmenten eingeteilt. Welche Themenbereiche und Lebensphasen gibt er in welcher Textsorte, also im Zuge einer Erzählung oder Narration, welche in Form einer Argu-mentation, einer Beschreibung oder als Unterkategorie Bericht oder verdichtete Situ-ation dar. Es gilt gerade die Lücken der Selbstpräsentation hervorzuheben und wel-chen Themen und Episoden des Lebenslaufs, die der Biograph auslässt, zu akzentuieren? Bei der gesamten Selbstpräsentation steht die Art und Funktion und weniger der subjektiv gemeinte Sinn im Vordergrund.
Es wird eine Sequenzierung erstellt, mit einer chronologischen Aufführung, welche Textsorte der Text wird nach thematischen Modifikationen, Sprecherwechsel und den bereits erwähnten Textsorten, mit der Zeilen- und Seitenangabe gegliedert. Der Inhalt der Sequenz wird kurz paraphrasiert, resümierte, teilweise auch mit wörtlicher Rede, der Sequenzkann ein Teile ausgezeichnet werden, der die Sequenz im Wesen beinhaltet.
Auszug der Text- und Feldanalyse der Falldarstellung von Hrn. Grün:
290 Gurwitsch A. (1974): Das Bewusstseinsfeld. Berlin. New York. De Gruyter, S.: 4. 291 vgl. a.a.O. Goblirsch (2010), S.89-91.
163
Segm
ent
Seit
e/Z
eile
T
exts
orte
T
hem
a/In
halt
1.
1/1-
3 E
inga
ngsf
rage
I:
Zu
ihre
m L
eben
slau
f un
d F
amili
enge
schi
chte
..zu
bei
den
frei
er
zähl
en
2.
1/4-
7 V
erst
ändi
gung
sint
erak
tion
Kon
text
klär
ung
zwis
chen
In
terv
iew
er
und
Bio
grap
h
B: k
ann
ich
frei
erz
ähle
n? E
i ei e
i (la
cht)
als
o gu
t? W
o fa
nge
ich
am B
este
n an
? M
ein
Nam
e?
I: J
a!
B: M
ein
Nam
e B
en (
…)
? 30
Jah
re a
lt..?
���
����
������
��������
��
Segm
ent
Seit
e/Z
eile
T
exts
orte
/Zei
lenu
mfa
ng
The
ma/
Inha
lt
3.
1 /7
-20
Ber
icht
: 13
Zei
len
Her
kunf
t m
it 3
Um
züge
n B
: in
D. a
ufge
wac
hsen
bis
1. K
lass
e, w
ir h
aben
Aus
reis
e ge
stel
lt,
Um
zug
in m
eine
r K
indh
eit,
vom
Ost
en n
ach
W-B
erlin
, da
nn
nach
D. …
.dan
n na
ch F
. In
F. l
ässt
sic
h di
e F
amil
ie n
iede
r.
4.
1-2/
21-3
3 B
eric
ht: 1
4 Z
eile
n 7
Jahr
e L
eist
ungs
spor
t B
: B
. beg
innt
ab
dem
8. L
bj. m
it de
m L
eist
ungs
spor
t T
isch
ten-
nis,
hat
tägl
ich
Tra
inin
gsei
nhei
ten,
B. i
st d
arin
seh
r er
folg
reic
h
5.
2/33
-42
Arg
umen
tatio
n: 1
1 Z
eile
n B
ruch
mit
dem
Lei
stun
gssp
ort
B:
B. h
ört m
it T
T S
port
auf
. Er
zieh
t es
vor,
abe
nds
ausz
ugeh
en,
Dis
co, l
ernt
Mäd
chen
ken
nen,
trin
kt A
lkoh
ol, r
auch
t in
und
mit
de
r C
lique
,
9.
4/11
6-12
9 A
rgum
enta
tion
mit
szen
isch
er P
räse
nz: 1
3 Z
eile
n B
. sie
ht s
ich
als
„Opf
er“
und
beko
mm
t di
e M
aßre
gel
B.:
B. r
äum
t ein
, das
s er
trot
z T
hera
pien
wei
terh
in D
roge
n ko
n-su
mie
re. E
r w
ird
weg
en r
äube
risc
her
Erp
ress
ung
veru
rtei
lt, o
b-w
ohl e
r nu
r ei
nen
Sche
iß m
itgem
acht
hab
e. D
as s
ei a
lles
nur
ein
Spaß
gew
esen
!
usw
.
164
Zu Beginn kommt es nach der offenen, geöffneten und erzählanregenden Atmosphäre zur Eingangsfrage, die das Interview initialisiert und in Gang bringen soll. Hier startet der Interviewer mit der Strukturvorgabe und Bitte an den Biographen, über seinen Lebenslauf, seine Familiengeschichte frei zu erzählen. Es erfolgt die weitere Bemer-kung, dass der Biograph dort anfangen könne wo er wolle, er könne, dürfe, frei er-zählen. Das Interview, die Aufnahme könne jederzeit unterbrochen werden, der In-terviewte könne zu jedem Zeitpunkt des Interviews Pausen signalisieren.
Innerhalb der Verständigungsinteraktion, zu Beginn des Interviews, wird ein über-einstimmendes Verständnis ausgehandelt und vereinbart. In der TA würde man sa-gen, es findet eine Transaktion auf ER-ER-Ich Ebene darüber statt, dass der Inter-viewte nun bereit und gewillt ist, sich in ein Interviewer-Interviewten-Setting zu begeben. Eine vertragliche Übereinkunft und Verständigung der nun folgenden Handlung als lebensgeschichtliche Erzählung ist vollzogen. Er hat verstanden, sich im Folgenden über seine Biographie und seine Familiengeschichte zu äußern. Im An-schluss daran folgt die Haupterzählung.
Die Analyse des Interviewprotokoll erfolgt nun sequenziell, abduktiv und hypothe-sengeleitet und stellt sich von Segment zu Segment, an der direkten Übergänge über mögliche thematische Felder spekuliert und hypothetisiert wird, mit folgenden Leit-fragen auseinander:
1. Weshalb wird dieses Thema an dieser Stelle eingeführt? 2. Weshalb wird dieses Thema in dieser Textsorte präsentiert? 3. Weshalb wird dieses Thema in dieser Ausführlichkeit oder aber auch in dieser Kürze dargestellt? 4. Welche sind die möglichen thematischen Felder, in die sich dieses Thema einfügt? 5. Welche Themen (Lebensbereiche oder Lebensphasen) werden angesprochen und welche werden ausgelassen? 292
Erzählte Lebensgeschichte:
Rosenthal hebt in ihrer besonderen Bedeutung für die Biographie den Begriff der temporalen Einschnitte hervor, die als Wendepunkt im Lebenslauf die „Zeit davor“ von der „Zeit danach“ trennen. Sie stellen so wesentlichen Faktoren bei der Gestalt-bildung der erzählten Lebensgeschichte dar. Es wird in drei bedeutsamen Typen un-terschieden:
Der entwicklungspsychologischer Wendepunkt: Sie führen zu tiefgreifenden Trans-formationen, sie müssen vom Biographieträger weder bewusst erlebt noch memoriert werden. Sie wirken sich insgesamt auf die Organisiertheit der Erinnerungen und auf die Textstruktur der erzählten Lebensgeschichte aus. Es gibt den Übergang von der frühen zu mitterlen Kindheit, den Übergang zur späteren Adoleszenz und zum jungen Erwachsenenalter und den Übergang zum mittleren Lebensalter der 50er Jahre, sowie der Übergang zum späten Alter. Die erste Transformation ca. 5-7 Lbj. in dieser Phase der infantilen Amnesie, kommt es zu einer starken Manifestation, in der der Biograph
292 Fischer-Rosenthal, W./ Rosenthal, G. (2007): Narrationsanalyse biographischer Selbstpräsentation. In: Hitzler, R. Honer, A. (Hg.): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. Opladen. Leske und Budrich S. 153.
165
mit den Erlebnissen aus der Schulzeit beginnt, Erlebnisse aus der Phase davor über-springt oder sich die Textstrukturen seiner Kindheitserinnerungen von Darstellungen späteren Phasen unterscheidet. Die Erlebnisse in der Kindheit werden fragmentiert oder in Bilder und episodenhaften Verdichtungen präsentiert. Die Darstellungen der Schulzeit und zunehmend die spätere Jugend werden eher als Erzählungen aufeinan-derfolgender Geschichten präsentiert. Insgesamt fällt auf, dass der Biograph in keinen Erzählfluss gerät und sich häufig im Gespräch die Frage stellt: “Was fällt mir sonst noch ein?“, wie das im Fall 3 und 4 häufig vorkam. Beim Übergang zur Spätadoles-zenz und zum frühen Erwachsenenalter finden tiefgreifende Identitätsbildungen statt, (ERISKON 1973) in denen der Jugendlichen über sich selbst nachdenkt, seine Zu-kunft entwirft und plant. Biographische Selbstpräsentation in diesem Alter beinhalten auch viele Überlegungen über die weitere Lebensplanung, gerade im Bereich beruf-liche Qualifikation und des Berufslebens. Wird jedoch die Lebensgeschichte im spä-teren Alter erzählt, kann von einer erhöhten Thematisierung der Spätadoleszenz und einer zunehmenden narrativen Verdichtung ausgegangen werden, da mit dieser Phase biographische Entwürfe assoziiert werden, die in ihrer Erfüllung oder Scheitern im spätere Leben zu Bilanzierungen führen. Die weiteren Wendepunkte sind in der bio-graphischen Erzählung für die Gruppe der TSSP nicht relevant, da sie beim Übergang zur schulischen Qualifikation bzw. spätestens bei der beruflichen Qualifikation ge-scheitert sind.
Als sozial typisierter Wendepunkt sind Ausbildungs-, und Berufskarriere in unseren Kulturkreis von Bedeutung, sowie der Schulanfang, der Lehrbeginn, Studium, Be-rufsbeginn, Beförderungen und die Verrentung. Auf familiärer Ebene: Heirat, Eltern-schaft, Scheidung, Tod des Lebenspartners, Auszug der erwachsenen Kinder, Geburt der Enkelkinder usw. Diese Statusübergänge erfordern bereichsspezifische Verände-rungen des Selbstkonzeptes und der Handlungspraxis, ob sie als Einbrüche/biogra-phische Krisen in der Lebensführung erlebt werden, hängt aber davon ab, wann sie im Lebensverlauf stattfinden.293
Im Fall 1 wurde zweimal der Wendepunkt „Lehrbeginn“ und zweimal ein Scheitern der Ausbildung erlebt. Im Fall 2 war der Wendepunkt der Tod des Stiefvaters, die unbekannten leiblichen Eltern und der Tod des Verlobten, kurz vor der Hochzeit. Im Fall 3 stellte der Wendepunkt der plötzliche Tod des Vaters dar, im Fall 4 war es die Inobhutnahme und Trennung durch Dritte von der psychisch kranken Mutter, von der eine massive Gefährdung des Kindeswohls ausging.
Biographischer Wendepunkte mit nachträglicher biographischer Relevanz konstitu-ieren sich durch biographische Prozesse, in deren Verlauf sich der Biograph zur Rein-terpretation seiner Lebensgeschichte genötigt fühlt und sich ihm zurückliegende, bis-her als wenig relevant betrachtete Erlebnisse als Wendepunkt darstellen. Biogra-phische Wendepunkte, die eine Reinterpretation der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft bewirken, sind für die Gestaltbildung der erlebten Lebensgeschichte do-
293 vgl. a.a.O. Rosenthal (1995), S. 134-145.
166
minanter als solche, die diese Reinterpretation nicht hervorbringen. Die Veränderun-gen von Gegenwart und Zukunft fordern dann auch Reinterpretationen ihres bisheri-gen Lebens. Dies führt zu Organisationen von zwei Figuren.294
In den Falldarstellungen Nr. 3 wird die Zeit als unbeschwerte und glückliche Zeit mit dem Vater bis zum seinem Mienentod erzählt. Die Lebensgeschichte wird erst wieder in Deutschland fortgesetzt als ein einziges und durchgehendes Leid empfunden. Im Fall 2 wird die Zeit, wenngleich auch in Fragmenten, bis zum Unfalltod des Verloben und dann die Zeit der Schuld danach erzählt. Im Fall 1 liegt der Schwerpunkt auf eine Zeit, die bis zur Anordnung der Maßregel erzählt wird und dann erst die Zeit außer-halb der geschlossenen Einrichtungen danach. Im Fall 4 gibt es weder eine Zeit vor einem Ereignis und noch eine zeitliche Struktur nach einem Ereignis. Hier hat es den Anschein, als sei die gesamte Biographie ein einziger Wendepunkt und der Biograph strebe nach dem Status Quo zurück, als er aus der mütterlichen Obhut gerettet worden ist, ohne dabei je einen alternativen Lebensentwurf entwickelt zu haben.
FISCHER sieht die Einschnitte als Interpretationspunkte in der Lebensgeschichte, die die Vergangenheit temporal gliedert. So bezeichnet er den letzten Interpretations-punkt, der die Gegenwart von der Nicht-Gegenwart trennt als Gegenwartsschwelle. Es sind sowohl Lebensgeschichten denkbar, die sich unterschiedlichen Interpretati-onspunkten darbieten als auch solche mit nur einem markanten, prägenden Ein-schnitt, der Schwelle also zur Gegenwart.“295
Die Gruppe der TSSP hat zum Zeitpunkt der Interviews, im Lebensalter von 26-32, keine abgeschlossene und erfolgreiche Transformation beim Übergang zur späten Adoleszenz vollzogen. Durch den Einfluss und das frühe Einwirken der psychischen Krankheit bei den Biographen zum Zeitpunkt des 13.-16. Lebensjahres sind die ent-wicklungspsychologisch typischen Zukunftsentwürfe durch massive und schwere Beeinträchtigungen des hypothetisch-deduktiven Denkens nicht erfolgt bzw. weitge-hend ausgeblieben.
Während sich der Biograph (Fall 4) zu seinem Zukunftsentwurf äußert, „(…) er wolle nur Spaß haben, (..) hier und jetzt und den Tag rumbringen“, so sieht auch der Bio-graph (Fall 1) nach seinem schulischen und beruflichen Scheitern keine Attraktion in diesem Bereich erneut zu investieren, aus Angst erneut zu scheitern. Fall 3 geht in den Zukunftsentwürfen davon aus, dass sie ihr Leben lang in Institutionen verhaften bleibt und eh keine Freude mehr empfinde, egal ob sie in einem Schloss oder in einem einfachen Zimmer wohnen werde. Fall 2 macht sich Gedanken über eine möglichen Zukunft: „Ich habe keine Wünsche und Ideen für die Zukunft! Ich weiß es nicht! Ich will nur überleben. Jeden Tag.“
Die Rekonstruktion der Fallgeschichte (erlebte Lebensgeschichte)
Bei diesem Auswertungsschritt wechselt die Perspektive nun auf die Biographie. We-niger das Präsentationsinteresse im Interview als vielmehr der subjektive Sinngehalt einzelner Lebensereignisse, Lebensthemen und Lebensphasen für den Biographen
294 vgl. a.a.O. Fischer (1995), S. 142. 295 Fischer, W. (1978):Struktur und Funktion erzählter Lebensgeschichten. In: Kohli, M. (Hg.) Soziologie des Lebenslaufs. Darmstadt. Neuwied. Luchterhand. S. 311-336.
167
werden nun zum zentralen Fokus. Die biographische Strukturierung der erlebten Le-bensgeschichte gilt es nun herauszuarbeiten.296
Mit Hilfe der biographischen Daten, die im Sinne ROSENTHALS als Kontrastfolie dienten, soll nun diese um die subjektive Ebene, den Erlebensgehalt, angereichet wer-den. Textpassagen zu Lebensereignissen, Lebensbereiche oder Lebensphasen werden ausgehwählt, interpretiert und letztendlich werden darüber Erkenntnissen über die Strukturierung des erlebten Lebens abgeleitet. Der Fokus bei der Materialanalyse wird auf die vergangene Lebenszeit, also auf die Zeit, in der das erzählte Ereignis stattgefunden hat, gesetzt. Auf der anderen Seite werden neben der Rekonstruktion der Ereignisse und Lebensphasen aus der Sicht der Vergangenheit auch Transforma-tionen in deren Bewertung im Verlauf der Lebensgeschichte und deren Bedeutung für den zukünftigen biographischen Verlauf herausgearbeitet. Somit bemüht sich der Forscher, die Struktur des erlebten Lebens chronologisch und kongruent zur Rekon-struktion des erlebten Lebens, zu identifizieren. 297
Bei der Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte sind vor allem die im Inter-view identifizierte Textsorte der Narration oder Erzählung, von Gehalt und Wert. Ge-rade diese Textsorte unterliegt nach RIEMANN (2003) spezifischen „Zugzwänge“, wie dem des Detaillierungs-, Relevanz-, Kondensierungs- und Gestaltschließungs-zwang. Sie stellen darüber hinaus, durch ihren signifikanten Indexikalitätsgrad, auch einen signifikanten Informationsgehalt dar. 298
Narrationen oder Erzählungen sind im Gegensatz zu Beschreibungen oder Argumen-tationen nicht durch einen statischen Charakter gekennzeichnet, sondern sie themati-sieren ein Geschehen, ein Lebensereignis als einen zeitlichen Prozess, der eine chro-nologische Abfolge, mit einem Anfang und ein Ende, umschreibt.
Innerhalb des oft umfangreichen Korpus der Transkriptionen wird diese Textsorte augenfällig, da sie sich mit hoher Konzentration auf die Abfolge von Ereignissen oder an der Prominenzen des und -dann Zusammenhangs reliefartig hervorheben.299 Nar-rationen unterliegen einer festen Binnenstruktur und beginnen mit einleitenden Er-zählungen, auch abstract genannt, des Biographen.
Der Interviewer wird dann im Rahmen einer Orientierung auf die darstellende Hand-lung hin informiert, über den Ort, die Zeit, die Personen oder die Umstände der Hand-lung, mit der Zielsetzung die Ereignisabfolge, wie auf einer Bühne vorzubereiten, auf der das erzählte Ereignis des Biographen nun stattfinden und präsentiert werden kann.
In der Komplikation wird ein Handlungsablauf konstruiert, der nun einen spezifi-schen Aufbau temporaler Ereignisabfolgen der erzählten Situation erzwingt. Das in der Vergangenheit liegende Ereignis wird in seiner chronologischen Abfolge rekapi-tuliert. Das kann auch durch zeitliche Sprünge in die Zukunft, die Gegenwart und Vergangenheit sein, sie heben einzelne Aspekte und Details der Darstellungen her-
296 vgl. a.a.O. Goblirsch (2010), S. 90. 297 vgl. a.a.O. Fischer-Rosenthal/Rosenthal (1997), S.154. 298 vgl. Eisenmann, B. (1995): Erzählen in der Therapie. Westdeutscher Verlag. Opladen, S.: 79. 299 vgl. Fritz, G. (2006): Historische Semantik. 2. Aufl. J.B. Metzler. Stuttgart, S.: 26.
168
vor, differenzieren sie aus oder korrigieren sie nach. Die hierbei dramaturgisch be-deutsamen Textstellen werden mit szenischem Präsens, durch Dialoge der dargestell-ten Figuren (characters) versehen, wie z.B. in der Falldarstellung Hr. Grün in einem Dialog zum Zeitpunkt des forensischen Anlassdelikts zwischen dem Biographen und dem männlichen Opfer. An dieser Stelle des Interviews hat man als Interviewer plötz-lich angespannte Atmosphäre im Raum wahrgenommen, die von der Art des Spre-chens, der starren Mimik und einer bedrohlichen Gestik des Biographen ausging, der die Schlüsselsituation vor Augen reinszenierte, so, als spiele der Biograph dem Inter-viewer sekundenlang die Szene vor. Da hab ich gesagt: “Junge…(plötzlich laut, star-rer Blick) jetzt… (eine Faust geht langsam hoch)… gib das Geld her…!“ Als das Opfer dann endlich das Geld bzw. das Portemonnaie aushändigte, wurde in der in-zwischen aufgeladenen Interviewatmosphäre eine plötzlich entspannte Körperspra-che beim Biographen wahrgenommen, die sich durch eine weiche Tonart und das abschließende, beschwichtigende Hinterherrufen in Richtung Opfer, der sich zügig aus der Bedrohungssituation entfernte, mit den Worten: “Das ist doch nur der Spaß!“300, vollständig veränderte und entlud. Diese Szene fand vor 14 Jahren statt.
Ein weiteres Beispiel für eine Präsentation mit szenischen Präsens erfolgte durch ei-nen Dialog, der vor 12 Jahren im Gerichtssaal des Landgerichts zwischen dem Rich-ter und dem Biographen erfolgt ist, als der Richter in seiner Urteilsbegründung zu-sammenfasste: „Der hat ein Versagenssyndrom mit Negativsymptomatik!“ Der Biograph hatte hierfür folgende Erklärung: „Für den war es das Beste, mich einzu-sperren, das (Beschaffungskriminalität und den Drogenkonsum) zu unterbinden. Ich habe ja nicht gearbeitet….ich kann dem Richter ja nicht sagen: „Entlassen Sie mich jetzt, ich nehm` aber dann wieder Drogen…in 2 Jahren!“301
In der Binnenstruktur der Narration folgt nun das Resultat, das den Ereignisteil der Komplikation abschließt, meist durch eine abfallende Stimme gekennzeichnet. Im direkten Anschluss erfolgt in der Regel die Evaluation oder Coda, die die Funktion hat, die Botschaft der Narration gegenüber dem Zuhörer/ Interviewer bewertend zu-sammenzufassen, um der Darstellung damit einen Sinn zu geben, quasi die Moral der Geschichte damit aufzuzeigen.
Feinanalyse
In der Feinanalyse, die als mikroskopisches Instrument verstanden werden kann, kön-nen nun kleine Textsequenzen in den Fokus gezoomt werden. Die in dem vorherge-henden Auswertungsschritt erfolgten Hypothesen in ihrer Struktur werden nun von weiteren Erkenntnissen flankiert und bestärkt. Die Feinanalyse, so FISCHER-ROSENTHAL/ROSENTHAL302 ermöglicht des Weiteren die Entdeckung bisher un-erklärter Mechanismen und Regeln der Fallstruktur. Sie kann an allen Stellen des interpretativen Prozesses durchgeführt werden.
300 Interview 1, Falldarstellung Hr. Grün. S. 4, Zeile: 116-129. 301 Interview 1, Falldarstellung Hr. Grün. S. 5-6, Zeile: 130-163. 302 vgl. a.a.O. Fischer-Rosenthal/Rosenthal (1997): Narrationsanalyse biographischer Selbstpräsentation. In: Hitzler, R. Honer, A. (Hg.): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. Leske +Budrich. Opladen, s. 54ff
169
Nachdem nun alle auswertungsschritte durchgeführt und die Strukturhypothesen zur gelebten, erzählten und erlebten leben formuliert wurden, werden die Ergebnisse ver-glichen und kontrastiert, gerade die Ebenen des erzählten und erlebten Lebens. Schließlich werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten kondensiert.
5.7. Forschungspraktisches Vorgehen
Da ich seit 1998 in Stuttgart in der Sozialpsychiatrie tätig bin und in mehreren Gre-mien, sowohl innerhalb des GPVs Stuttgart als auch in der Wohnungslosenhilfe303 tätig war, habe ich zunächst mit den Einrichtungsleitern, die meiner Mutmaßung nach, die Klientel der TSSP betreut, Kontakt aufgenommen. Obwohl die Bereitschaft und das Interesse für die Erhebung groß waren, fiel die Resonanz bei den zunächst angesprochen Adressaten selbst sehr gering aus, mit mir ganz konkret, freie, biogra-phische Interviews zu führen.
Bei einem Klienten, Hrn. K., konnte ich die vagen, kargen und in sich nicht kongru-enten Antworten der beiden biographischen Interviews nicht verwerten. Er gestand mir Wochen später in einem Telefonat, er habe es eh nur auf den Gutschein, mit dem ich ihn zur Teilnahme motivieren wollte, abgesehen. Außerdem sei das doch eh alles für die Katz, was ich da tue. Mit einer weiteren Klientin, Fr. A., fanden zwei Treffen vor dem eigentlichen und bereits terminierten Interview statt. Schließlich sagte sie am Tag des Interviews per SMS mit der Begründung ab, ihr Freund wolle das nicht. Sie habe zudem Angst, dass mit den Daten etwas passiere, das ihr schaden könne. Sie bot mir stattdessen einen ausführlichen Lebenslauf an, den sie mir dann auch in einem Brief zukommen ließ. Fr. A. ist wenige Wochen zuvor von einem geschlossenen Wohnheim ins ambulant Betreute Wohnen gezogen. Kurze Zeit darauf wieder schwer drogenrückfällig geworden und wählte die Straße und den Strich. Sie hielt sich in der Folge wieder im Milieu auf, schaffte für einen Dealer an, wurde wohnungslos und wurde wieder geschlossen untergebracht.
Anonymisierte Daten werden gelöscht; schriftliche Einwilligungserklärungen wer-den vom Biographen und Betreuer unterschreiben, eine eigene Verpflichtungserklä-rung zum Umgang mit den erhobenen personenbezogenen Daten ausgehändigt, jeder Teilnehmer erhält eine Kopie der biographischen Interviews als CD Kopie, mit der Möglichkeit, nach dem Hören bis zur Veröffentlichung Textstellen zu streichen.
Die Teilnahme versprach einen Gutschein für Kleidung oder CDs etc. im Wert von 30 €, bei Hollister T-Shirt, zwei Gutscheine bei Media Markt, ein Gutschein für ein Sportgeschäft. Die Doppelfunktion als Heimleiter und Interviewer konnte ich sicher nicht vollständig auflösen. So warb ich bei Hrn. Grün, bei Fr. Brandt, Fr. Satic und Hrn. Noller zunächst in einem Vorgespräch. Darin vermittelte ich Information über mein Dissertationsvorhaben, ich wies auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hin und hob explizit hervor, dass kein Zusammenhang zwischen einer Zusage der Teilnahme und dem konzeptionell verankerten Behandlungsablauf und den bestehenden Verhal-tensregeln im Heimbetrieb bestehe, (es könne z.B. nicht davon ausgegangen werden,
303 Mitglied der HPK Stuttgart, des AKs Freie Träger der Wohnungsnotfallhilfe Stuttgart, der BAG-Wohnungslosenhilfe Fachausschuss Gesundheit, des AK-Heime in Stuttgart, der AG-Wohnen in Stuttgart oder der Stadtteilrunde Bad Cannstatt.
170
dass ausgesprochene Ausgangssperren, aufgehoben werden, dass bei einer Interview-teilnahme mit milderen Konsequenzen bei Alkohol-konsum zu rechnen sei oder dass bei Verdacht auf sogenannte Multidrogenschnelltests (Diagnostik Nord, 7 Substan-zen), auf Zimmer- oder andere Kontrollen verzichtet werde.
Der Interviewtermin fand an dem Ort statt, den sich die Interviewten ausgesucht ha-ben, z.B. im Appartement auf der Wohnebene, im nahegelegenen Park in einer Per-gola (Lieblingsplatz), in einem neutralen Besprechungsraum, im Wohnzimmer der Wohngruppe usw.
Mit einem Türschild „Bitte nicht stören“ versuchte ich ein störungsfreies Setting her-zustellen. Die Telefone wurden ausgeschaltet. Ich bat zwei Bewohnerinnen darum, den Fernseher auszuschalten oder wenigstens auf stumm zu schalten, um den Fokus auf das Gespräch zu richten. Diese Vereinbarung erforderte mehrere Argumente und Versuche.
Den Biographen wurde eine Bedenkzeit angeboten, die bei einer Biographen nur ei-nen Tag und eine Nacht, bei einer weiteren Biographin sieben Tage und bei einem anderen Teilnehmer ein Wochenende von Freitag bis zum nächsten Montag und bei einem Biographen über einen Monat andauerte. Ein Biograph teilte mir mit, er wolle zunächst mit seinen Eltern sprechen und sich dann entscheiden, ob er teilnimmt. In allen vier Fällen habe ich die jeweiligen gesetzlichen Betreuerinnen über meine In-terviewabsichten aufgeklärt und eine schriftlichen Erlaubnis eingeholt. Das 1. Inter-view mit Hrn. Noller (4. Falldarstellung) fand in seinem Zimmer statt, das zweite Interview 4 Monate später in einer anderen Einrichtung, 2 Autostunden von Stuttgart entfernt. Bei Hrn. Grün waren zwischen den beiden Interviews 3 Wochen Pause, bei Fr. Brandt ebenso 3 Wochen, bei Fr. Satic waren es sogar 2 Jahre und 11 Monate, da sie kurz nach dem ersten Interview in eine andere Einrichtung wechselte und vorerst zu keinem zweiten Interview mit mir bereit war. Nachdem sie feststellte, dass sie dort nicht zu Recht kam, hat sie um Rückkehr in das geschlossene Heim gebeten. Während der gesamten Zeit hatte ich mit Fr. Satic telefonischen Kontakt und whats-up Kontakt. Sie rief mich im Verlauf der Interviewpause in Abständen von 4 Wochen an, um zu berichten, wie es ihr gehe. Nachdem ich dann selbst innerhalb von Stuttgart ins Am-bulant Betreute Wohnen wechselte und dort vorwiegend Klienten aufnahm, die ehe-mals in geschlossenen Wohnheimen nach § 1906 BGB oder in den Forensischen Fachkliniken nach § 63 StGB untergebracht waren, wechselte auch Fr. Satic in ein Einzelappartement meines Trägers und bat um intensive Begleitung. Nach einer wei-teren Wartezeit, in denen das zweite Interview mit fünf Anläufen vereinbart wurde, durfte ich schließlich das Gespräch in ihrem Einzelappartement durchführen.
Die Interviews dauerten zusätzlich mit einer Warming-Up-Phase von etwa 15 Minu-ten zwischen von 45 Min. bis 2 Stunden. Es gab Interviews mit minimal einer bis vier Unterbrechungen, die durch Zigarettenpausen gerahmt wurden. Die Transkription wurde jeweils in Kopie an die Biographinnen auf einer CD oder in Papierform aus-gehändigt. Die Reaktion der insgesamt sechs Biographinnen auf die durchgeführten Interviews war sehr unterschiedlich. Zwei Biographen lasen sich die Transkriptionen durch und übergaben sie mir wieder ohne einen Kommentar, zwei Biographen legten sie ungesehen zu ihren Akten in eine Schublade, mit dem Kommentar: „Hr. Masanz, das wird bei Ihnen schon alles richtig sein“, zwei lasen die Transkription durch und
171
hatten Rückfragen, Änderungswünsche bzw. baten darum, bestimmte Stellen zu strei-chen, die Informationen z.B. zu ihrer Kernfamilie enthielt und Aussagen generierten, die ihre Familie in ein kritisches Licht bringen könnte. Es wurden auch Textstellen gestrichen, die etwas über das Verhältnis zu den Eltern oder zum Thema Drogenkon-sum offenbarte.
Die Pausen zwischen den Interviews waren schließlich von der Erstellung der Tran-skriptionsarbeiten des ersten Interviews abhängig, aber auch in zwei Fällen vom ge-sundheitlichen Status quo bei zwei Biographen. Z. B. bei Fr. Brand und bei Hrn. Nol-ler, die kurz nach dem ersten Interview klinikstationär eingewiesen werden mussten. Beide befragte ich dann bei einem Krankenhausbesuch, ob sie der Meinung waren, dass ihre Krise in Verbindung mit dem biographischen Interview stünde, doch beide verneinten dies mit Überzeugung. Während Fr. Brandt ihre Krisen im Zuge einer im-mer wieder aufkommenden suizidalen Krisen bewertete, die im Abstand von zwei Monaten für 1-4 Tage stationär begleitet werde, geriet Hr. Noller durch den zeitglei-chen Kontaktversuche der psychisch kranken Mutter erneut in eine psychotische Krise, die ihn dahingehend zu beeinflussen versuchte, die Medikamente abzulehnen. Nachdem Hr. Nollers Psychose wieder abgeklungen war und er wieder zurück im Heimbereich war, kam es unmittelbar danach zu einem fremdaggressiven Übergriff auf eine Mitarbeitende. Daraufhin kündigte ich den Heimvertrag fristlos und vermit-telte Hrn. Noller in eine Einrichtung außerhalb von Stuttgart. Als ich Hrn. Noller vier Monate später dort besuchte und mich von einer deutlichen gesundheitlichen Besse-rungen überzeugen konnte, erklärte er mir, dass er von der Großstadt und den Drogen weggekommen sei und sich aus dem Dunstkreis der Mutter nun entziehen wollte. Hier habe er Ruhe, frische Luft und eine tägliche Beschäftigung im Garten in ländli-cher Abgeschiedenheit. Im Sommer 2016 erfuhr ich, dass Hr. Noller immer wieder gefahndet werden muss und wieder zurück zur Mutter strebt. Es stehe wieder eine Verlegung in eine andere Einrichtung an.
5.8. Sampling, Anbahnung und Kontaktgestaltung mit den Biographen
Unter einem Sample versteht man eine Stichprobe, also die Auswahl der zu untersu-chenden Fälle aus einer Grundgesamtheit. So stellt die Untersuchung zur Gruppe der TSSP keine Total- oder Vollerhebung dieser Grundgesamtheit statt, sondern sie ist lediglich eine Auswahl der zu untersuchenden Klienten, die der Gruppe der TSSP, mit den Merkmalen:
• junges Alter, 26-32 Jahre z.Z. der biographischen Interviews; • Krankheitsbeginn erfolgte in der Adoleszenzphase; • schwerwiegender Krankheitsverlauf, der durch lange und häufige psychiatrischen
Unterbringungen gekennzeichnet ist und eine chronische Ausprägung einer pri-mären psychischen Erkrankung;
• Erfahrungen von Wohnungslosigkeit und Kontakte mit der Wohnungsnotfallhilfe; • sekundär diagnostisches Merkmal einer Suchterkrankung (stofflichen, nicht-stoff-
liche Sucht;
172
• weitgehend lebenslange Erfahrungen, Erlebnisse und Ereignisse von familiärer, biographischer und gesellschaftlicher Ausgrenzung im Sinne einer Exklusions-drift.
Über das allmähliche Zustandekommen der Kontakte mit den Biographen und dem Prozess der Teilnahme an den Interviews wird in den jeweiligen Falldarstellungen berichtet.
Als Quellen für die Auswertungsschritte einer biographischen Aktenanalyse verwen-dete ich nach Zustimmung der vier Biographen zusätzlich frühere Arztberichte, So-zialberichte, Entwicklungsberichte, sogenannte HB-Gutachten, gutachterliche Stel-lungnahmen für das Amtsgericht, die teilweise einen Umfang von bis zu 40 Seiten hatten und eine Empfehlung für oder gegen eine dem Verhältnis angemessene psy-chiatrische Unterbringung, mit einem zeitlichen Vorschlag, von i.d.R. 6-24 Monate, der vom Amtsrichter im Beisein eines Verfahrenspflegers geprüft und i.d.R. bestätigt wurde. Die Anhörungen fanden allesamt auf dem Wohnbereich der Einrichtung, in einem neutralen Besprechungsraum im Beisein des zuständigen Heimleiters statt.
Die Einbeziehung der Angehörigen der Biographen spielt ebenso eine unterschiedli-che Rolle bei der Rekonstruktion und Erhebung der Daten. Bei Hrn. Grün konnte ich zwei längere Telefonate mit den Eltern zur Erstellung eines Genogramms, sowie mehrere Angehörigengespräch im Beisein von Hrn. Grün und zwei Gespräche unter vier Augen in der Einrichtung führen. Hr. Grün vermittelte ich acht Monate nach den Interviews in ein offenes Wohnheim und stellte mit ihm seinen Lebenslauf mit Hilfe des zuvor erstellten Genogramms in der neue Einrichtung vor.
Fr. Brandt untersagte mir eindeutig, sowohl die Kontaktaufnahme mit ihrer Mutter als auch mit der Großmutter. Sie erstellte für mich jedoch einen achtseitigen Lebens-lauf und erlaubte mir, mit der ehemaligen Heimleiterin der vorangegangen Einrich-tung Kontakt aufzunehmen.
Fr. Satic verbot mir ebenso mit eindringlichen Worten eine Kontaktaufnahme mit ihrer Mutter oder Schwester, mit den Worten, „dass sich die eh nur in einem guten Lichte präsentieren und schlecht über mich sprechen werden“. Das müsse durch ein Gespräch mit mir nicht bestätigt werden. Das wisse sie schon jetzt. Ihre jüngere Schwester wolle sie aus der ganzen Sache raushalten. Auch sie gewährte mir Kontakt mit dem langjährigen SpDI Mitarbeitenden, zu dem sie großes Vertrauen habe.
Bei Hrn. Noller kam es im Verlauf der Betreuung zu mehren Kontakten mit der Mut-ter, die sich jedoch offensichtlich im Zustand einer schweren psychischen Erkran-kung befand und versuchte, ihren Sohn mit abenteuerlichen Methoden aus der Ein-richtung zu holen, um ihn wieder, in einer Kleinstadt an der niederländischen Grenze versorgen zu können. Der Bruder von Hrn. Noller verstarb in der Zeit, in den die Interviews stattfanden, durch einen Suizid mit dem Auto.
Wie haben sich die Kontakte, drei Jahren nach den biographischen Interviews, zu den einzelnen Biographen entwickelt? Von Hrn. Grün erfahre ich indirekt seit seinem Auszug aus dem geschlossenen Heim über den Einrichtungsleiter, der gegenseitig Grüße ausrichten lässt, dass er sich gesundheitlich konsolidieren konnte. Hrn. Grün
173
traf ich seitdem ein paar Mal in seinem Stadtteil, wir hielten einen kurzen Plausch. Hr. Grün wirkte stabil und mit sich und seinem Leben zufrieden.
Fr. Brandt kommt in ihren freien Ausgängen in größeren Abständen auf eine Tasse Kaffee in meinem Büro vorbei oder wir telefonieren miteinander. Sie berichtet dann gerne über den Tratsch und Klatsch der geschlossenen Einrichtung, in der sie noch immer wohnt. Fr. Brandt geht davon aus, dass sie im Wohnheim alt wird.
Fr. Satic treffe ich immer wieder auf der Straße und wir halten Small-talk. Eine Ein-ladung zum Kaffee hat sie bisher nicht wahrgenommen.
Mit Hrn. Noller stehe ich indirekt über die Heimleiterin des Pflegeheims und die ge-setzliche Betreuerin in Kontakt, von denen ich erfahre, wie häufig nach Hr. Noller gefahndet werden muss, wie häufig er fremdaggressiv geworden ist oder wieder Dro-gen konsumiert hat.
Die folgende Tabelle hebt die unterschiedlichen Merkmale der insgesamt sechs aus-gewählten Biographinnen und Biographen hervor. In Tabelle 12 und 13 werden wei-tere spezifische Unterschiede der vier Biographen aufgeführt, die mit der Veröffent-lichung der biographischen Interviews einverstanden waren.
174 B
iogr
aphe
n F
all 1
F
all 2
F
all 3
F
all 4
F
all 5
/ unv
eröf
f.
Fal
l 6/ u
nver
öff.
Alt
er z
.Z. I
nter
-vi
ews
30
26
27
28
23
31
Ges
chle
cht
män
nlic
h w
eibl
ich
wei
blic
h m
ännl
ich
wei
blic
h w
eibl
ich
nati
on. H
erku
nft
ehem
alig
e D
DR
R
ussl
and,
deu
tsch
B
alka
n, B
osni
en
Deu
tsch
land
G
riec
henl
and-
Deu
tsch
land
T
ürke
i
Bes
onde
re V
orbe
-la
stun
g T
raum
a de
r E
ltern
(D
DR
) un
d G
roße
l-te
rn (
II. W
eltk
rieg
)
Ver
lust
Elte
rn, U
n-fa
lltod
des
Ver
lob-
ten,
rus
sisc
hes
Kin
-de
rhei
m, S
ucht
und
ps
ychi
sch
kran
ke
Elt
ern
Kri
egst
raum
atis
iert
, Fl
ucht
aus
Bal
kan-
krie
g in
die
BR
D
Chr
on. K
inde
swoh
l-ge
fähr
dung
; dur
ch-
gehe
nde
Hei
mka
rri-
ere
Del
egat
ion
aus
der
Fam
ilie
, Pen
deln
zw
isch
en g
esch
iede
-ne
n E
ltern
, zw
i-sc
hen
zwei
Kul
tu-
ren,
Hei
mka
rrie
re
Zw
angs
verh
eira
tung
m
it 14
in T
ürke
i,
sex.
und
kör
perl
iche
G
ewal
t in
der
Ehe
Psy
chia
tris
che
Dia
gnos
e P
ersö
nlic
hkei
ts-
Stör
ung,
Psy
chos
e B
orde
rlin
estö
rung
B
oder
line-
Stör
ung,
P
sych
ose
Psy
chos
e D
roge
nind
uzie
rte
Psy
chos
e,
AD
HS
Par
anoi
d-ha
lluz
. P
sych
ose,
Such
t po
lyto
xiko
man
A
lkoh
olab
usus
A
lkoh
olab
- hä
ngig
keit
P
olyt
oxik
oman
ie
Spie
lsuc
ht, p
oly-
to
xiko
man
he
roin
abhä
ngig
Fam
ilent
hem
a Fl
ucht
aus
DD
R,
Fam
ilie
ntra
uma
Übe
rsie
dlun
gen
als
Rus
slan
ddeu
tsch
e V
erlu
st d
es V
ater
s de
r au
f ei
ne M
iene
tr
itt
Hei
mka
rrie
re
aufl
ösen
de F
amili
e
Rel
igiö
s-ku
ltur
ell
frag
men
tiert
e Fa
mi-
lie
In F
amili
e au
fgew
achs
en
bis
zum
14
Lbj
. in
Fam
ilie
K
inde
rhei
m: a
b 2.
T
ag, a
b 2.
Lbj
. A
dopt
ivfa
mili
e
bis
14 L
bj.in
der
Fa-
mili
e ab
2. L
bj. i
n H
ei-
men
B
is 3
. Kla
sse
bei E
l-te
rn, b
ei d
er M
utte
r in
BR
D, d
ann
2 J.
in
Gri
eche
nlan
d,
bis
8. L
bj. i
n de
r T
ürke
i/Fam
ilie,
da
nn U
mzu
g
Insi
tuti
on z
.Z. I
n-te
rvie
ws
§190
6 H
eim
und
M
RV
§
1906
Hei
m
§ 19
06 H
eim
§1
906
Hei
m u
nd
Pfl
egeh
eim
A
BW
mit
Sich
er-
heits
aufl
agen
A
BW
und
Str
aße
MR
V
Ja, 2
x 63
-
- -
Ja, §
64
StG
B
- H
aft
ja
- B
ewäh
rung
-
ja
Bew
ähru
ng
Woh
nung
slos
So
zial
hote
l H
eim
für
Fra
uen
Sozi
alho
tel
ofW
So
zial
hote
l of
w, M
ilieu
A
ufen
thal
t im
Ver
-la
uf 2
011-
16
-190
6-H
eim
, -o
ffen
es H
eim
, -A
BW
-§19
06 (
seit
7 Ja
hre)
-i
m S
chni
tt: 1
0 K
li-ni
kauf
ent-
halte
/p.a
nno
-§19
06, -
AB
W,
-190
6 H
eim
-A
BW
, -§
1906
Hei
m
§190
6 H
eim
P
fleg
ehei
m
AB
W, H
aft,
AB
W
1906
, AB
W, S
traß
e,
Klin
ik, S
traß
e
Schu
le
Hau
ptsc
hule
Fö
rder
schu
le
abge
broc
hen
För
ders
chul
e ab
ge-
broc
hen
Hau
ptsc
hul-
ab
schl
uss
För
ders
chul
e ab
ge-
broc
hen
Mitt
lere
Rei
fe
Ber
uf
2. L
ehre
n ab
gebr
o-ch
en
Pra
ktik
um
kein
e ei
nzel
ne P
rakt
ika
kein
e L
ehra
bsch
luss
Tab
elle
2:
Bio
grap
hisc
he M
erkm
ale
des
Sam
plin
gs
175
B: Erster Teil der empirischen Untersuchung:
Biographische Fallrekonstruktionen
6. Kapitel
„Denn die einen sind im Dunkeln, und die anderen sind im Licht, und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln, sieht man nicht.“
Bertolt Brecht 1930
6.1. Erste Falldarstellung: Herr Grün
6.1.1. Einführung und Kontextklärung
Hrn. Grün lernte ich erstmals im Oktober 2011 auf einer Männerstation einer ge-schlossenen psychiatrischen Pflichtversorgungsklinik kennen. Hr. Grün, der sich im Erstkontakt selbstsicher präsentierte, ist mir wegen seiner Körpergröße von knapp zwei Metern und seiner prägnanten Frisur schon kurz nach dem Betreten der Station aufgefallen. Auf dem Rücken trug Hr. Grün eine Gitarre mit sich. Auf dem Weg in ein Besprechungszimmer klatschte er im Vorbeigehen zwei andere Mitpatienten ab, gerade so, als reüssiere er soeben mit einem entscheidenden Wurf in einem finalen Basketballspiel.
Zwei Wochen zuvor erfahre ich aus der Hilfeplankonferenz304, dass Hr. Grün vor wenigen Tagen wegen Eigengefährdung einen richterlichen Unterbringungsbe-schluss nach § 1906 BGB von 12 Monaten erhalten hatte und nun auf eine baldige Entlassung bzw. Verlegung in ein geeignetes, geschlossenes Wohnheim der Einglie-derungshilfe, auf der gesetzlichen Grundlage nach § 53 ff SGB XII, vorzugsweise in Stuttgart, wartet. Hrn. Grüns Krankenkasse drohte derweil mit der Einstellung der Pflegesatzübernahme, da er schon seit mehreren Monaten auf der Station behandelt wurde. In meiner Funktion als Heimleiter bot ich Hrn. Grün einen Heimplatz in un-serer Einrichtung an und teilte dies den Eltern und dem gesetzlichen Betreuer mit, der für die Wirkungskreise der Aufenthaltsbestimmung, der Behandlungspflege und der Vermögensfürsorge vom zuständigen Vormundschaftsgericht bestellt war.
Hr. Grün akzeptierte den Beschluss und willigte in einen schnellstmöglichen Einzug in das Haus NN.305 ein. Hr. Grün zählte zu den wenigen Bewohnern, die nicht gegen den richterlichen Beschluss in einem Widerspruchsverfahren vorgingen, wobei dieser
304 HPK: Die Hilfeplankonferenz ist ein Gremium innerhalb des GPV, die 1x Monat mit einer festen Tages-ordnung stattfindet, an der alle Anbieter des Ambulant Betreuten Wohnens, des stationären Wohnens, die Re-habilitationseinrichtungen, die Kliniken, die Kostenträger der Rentenversicherung und Agentur für Arbeit, der Forensischen Fachklinik und der acht stadtteilbezogenen Gemeindepsychiatrischen Zentren teilnehmen, um die Klienten und Patienten vorzustellen, die in ein Angebot der teilnehmenden Einrichtungen vermittelt bzw. aufgenommen werden sollen. 305 Haus NN: Eine von derzeit drei geschlossenen Einrichtungen der Eingliederungshilfe im Stadtgebiet Stutt-gart, für 26 Bewohnerinnen im Alter von 22-63 Jahren. Eine detaillierte Charakterisierung und Beschreibung der Behandlung, der Einrichtung und der Bewohnergruppe ist unter http://www.cbp.caritas.de/aspe_shared/form/download.asp?form_typ=370&ag_id=1123&nr=377297 zu le-sen. Download vom 1.9.2013.
176
vor dem Landgericht Stuttgart als weitere Instanz endgültig beurteilt wird. Hr. Grün zog, ohne vorher das Zimmer und die Einrichtung zu besichtigen, wenige Tage darauf mit lediglich vier großen Plastiktaschen ein. Die Mietwohnung, die er kurz vor der Klinikbehandlung noch bewohnte, wurde gekündigt und vom gesetzlichen Betreuer aufgelöst. Die Einrichtungsgegenstände waren überwiegend nicht mehr funktions-tüchtig. Der Wohnraum war mit Ungeziefer- und Schimmelbefall nass vermüllt306 und von Brandflecken, die durch Kerzen oder Zigarettenglut verursacht wurden, übersät.
Von Anfang an suchte Hr. Grün einen engen Kontakt zu mir als Heimleiter. Im Vor-feld wurde ich vor einer Aufnahme Hrn. Grüns gewarnt. Die Warnungen kamen von der Station, den Ärzten, der vorherigen Einrichtung und dem gesetzlichen Betreuer, mit dem Hinweis auf die bisherige anamnestische Vorgeschichte, eine eher schlechte Kriminal- und Sozialprognose und eine hohe Kumulation und Intensität von unter-schiedlichen Straftaten im Zeitraum von 1998-2000, sowie von 2009-2011. Hr. Grün benötige, so die Beschreibung der Hilfen und der Maßnahmen im IBRP,307 ein hoch-strukturiertes Behandlungssetting, konkrete Beschäftigungs- und Arbeitsangebote sowie Hilfestellung bei den lebenspraktischen und hauswirtschaftlichen Anforderun-gen. Fortlaufende und regelmäßige Atemalkohol- und Multidrogenurinkontrollen sind von der koordinierenden Bezugsperson308, die den Hilfeplan erstellt hat, flankie-rend als Maßnahmen definiert worden. Das Betreuungsteam stellte sich zum Zeit-punkt der Aufnahme auf Schwierigkeiten, auf Verweigerungsverhalten, Aggressio-nen und fortlaufende Konflikte ein. Das Team erwartete einen schwierigen, widerständigen und ablehnenden Bewohner, der jede Gelegenheit nutzen wird, ille-gale Drogen zu konsumieren und die Medikation wegzulassen. Die Befürchtungen traten allesamt nicht ein.
Das erste Interview fand dann ein Jahr nach der Aufnahme, im Dezember 2012 statt. In meiner Rolle als Interviewer einerseits, der ein biographisches Interview führen möchte und andererseits als Heimleiter und Verantwortlicher der Einrichtung, der schließlich auch über die Ausgangsvereinbarungen, über das Einleiten einer Klini-keinweisung oder das Durchführen von Drogen- und Zimmerkontrollen, auch bei Hrn. Grün, zu entscheiden und Verantwortung zu übernehmen hat, hatte ich anfangs große Bedenken, ob ich in meiner doppelten Rolle eine „neutrale Position“ gegenüber Hrn. Grün einnehmen kann? Diese Bedenken teilte ich offensiv dem Biographen in
306 Unterscheidung von trockener und nasser Vermüllung bei Menschen mit u.a. Vermüllungssyndrom: Wäh-rend es bei der trockenen Vermüllung meist um das Sammeln (hording) von Zeitungen, Kleidern und Sperrmüll geht, stellt die nasse Vermüllung eine gesundheitlich-hygienische Gefahr für die Bewohner aber auch Mitbe-wohner im Haus dar, da es zur Bildung von Ungeziefer, Silberfischen, Mäusen, Ratten, Motten, Schaben etc. in Verbindung mit Schimmelbefall kommt bzw. kommen kann. 307 IBRP: Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan wird in der Version 2004 und ab Sommer 2013 in der Stuttgarter Version IBRP Stuttgart geführt; er bildet den gesamten individuellen Hilfebedarf, die ge-wählten Maßnahmen mit zeitlichen Werten und anvisierten Zielsetzungen in allen Lebensbereichen für den nächsten Zeitraum von 6 Monaten ab. Der IBRP wird i.d.R. vom Sozialdienst, idealerweise gemeinsam mit allen wesentlichen Bezugspersonen und Helfern, Arzt und hauptsächlich mit der betroffenen Person selbst erstellt. 308 Aufgaben der koordinierenden Bezugsperson im GPV Stuttgart: siehe www.sozialministerium.baden-württemberg.de:Abschlussbericht des Projekts: Implementation des personen-zentrierten Ansatzes in der psychiatrischen Versorgung in Baden-Württemberg. Juni 2004. S. 47-50. Download vom 18.08.2016.
177
einem Vorgespräch mit und offenbarte meine Zweifel wegen der bestehenden Dop-pelrolle, die ich innehatte. Hr. Grün hörte sich meine Ausführungen in Ruhe an und ließ mich wissen, dass er erstens, eher einer bekannten Vertrauensperson („das sind Sie derzeit für mich, …schließlich haben sie mich aus der Klinik rausgeholt und beim Landgericht begleitet“) etwas von sich sagen werde als einem Fremden, der ihn nun befragen wollte, und zweitens habe er auch angesichts des geschlossenen Betreuungs-rahmens die Wahl, wenigstens darüber zu entscheiden, mit wem er frei über sich und sein Leben sprechen möchte.
Als Anreiz und Gegenleistung für die Teilnahme am 2. Interview bot ich Hrn. Grün einen Gutschein im Wert von 40 € an. Der Biograph zeigte sich einerseits zwar er-freut, auf der anderen Seite ließ er mich wissen, dass das seine Entscheidung nicht beeinflusse. Weiter teilte er mir mit, dass er schließlich auch von seinen Eltern finan-ziell unterstützt werde. Nach einer Woche Bedenkzeit, die er einforderte, entschied sich Hr. Grün für die Teilnahme. Den Wertgutschein wollte er bei einem Media-Markt einlösen, um sich zwei Hip-Hop CDs zu kaufen. Im Vorfeld informierte ich zudem den gesetzlichen Betreuer und die Eltern über das geplante Forschungsvorha-ben. Letztere stimmten zu und informierten sich am Telefon und dann auch bei einem Besuch vor Ort genau darüber, wie der Ablauf geplant sei, was mit den erhobenen Daten passiere und wie ich vor allem mit der Speicherung der Daten umgehen werde. Erst zwei Monate später erfuhr ich von der Mutter, dass diese eine SED-Opfer-entschädigungsrente bezog, da sie als „Politische“ schweres Leid erfahren habe. Mit diesem Hintergrund sei man in der Familie zu gebrannten Kindern auf Lebzeiten ge-worden und eher misstrauisch und vorsichtig, wenn es darum gehe, dass Gespräche mitgeschnitten und analysiert werden. Hr. Grün wollte, obwohl er für drei Mal drei Stunden pro Woche freien Ausgang hatte und den Gesprächsort hätte frei wählen können, dass das Gespräch in seinem Zimmer stattfindet.
Am Tag des Interviews suchte mich Hr. Grün mehrfach auf, um zu erfragen, wann es denn losgehe. Hr. Grün bot mir zu Beginn selbstgestopfte Zigaretten und Sprudel an und teilte mir vorab mit, dass er „schon etwas aufgeregt“ sei. Im Verlauf des Ge-sprächs, wurde Hr. Grün mehrmals von einem Bewohner aufgesucht, der keinen Ta-bak mehr hatte. Ein weiterer Bewohner kam in das Zimmer und übergab Münzgeld und geliehenen Tabak, sodass ich Zeuge des subkulturellen Handels wurde. Im Zim-mer von Hrn. Grün hingen zwei große Plakate, auf dem Bob Marley und er selbst mit Gitarre auf einem DIN A2-Foto abgebildet waren. Das Zimmer war abgedunkelt. Das Gespräch fand am Nachmittag zwischen einer Stunde im Arbeitsprojekt, das im Haus angeboten wird, und dem Abendessen, statt. Bevor ich das Aufnahmegerät anschal-tete, erzählte mir Hr. Grün, dass er sich im Vorfeld mit seinen Eltern beraten wollte und es so zu einer Bedenkzeit von der Woche kam. Hr. Grün fragte mich noch, warum ich noch weiter die Schulbank drücke und was ich da noch lernen wolle? Während des Gesprächs rauchte er Kette und bat nach 3o Minuten um eine Pause. Das Ge-spräch dauerte insgesamt 75 Minuten. Nach dem Interview gab Hr. Grün zu, dass er nun doch recht erschöpft sei. So lange und so viel habe er zuletzt nur in der Forensik dem Psychologen erzählt.
178
6.1.2. Gelebtes Leben - biographische Daten -
Nr. Datum Ereignis 1 08/1981 B. (Biograph) wird in Großstadt in DDR geboren, Halb-
schwester +4 und +12 2 1982-1987 Besuch eines Ganztageshort bis Einschulung 3 03/1989 Nach mehreren Ausreiseanträgen, Repressalien, Ausreise in
Western, Halbschwestern bleiben beim Vater, B. beginnt mit Tischtennis spielen
4 1990 Nach mehreren Zwischenstationen, Umzug nach Stuttgart, Vater bekommt Arbeitsstelle
5 1994 B. wird Deutscher Tischtennis-meister -Schülerklasse- 6 1995-1996 B. verweigert Schulbesuch, beginnt Drogen zu konsumie-
ren, lebt wochenlang im Milieu auf der Straße, Kontakte mit Jugendamt, Polizei und Justiz
7 1997 Hauptschulabschluss mit 2,9 Notenschnitt; Beginn Lehre zum Fliesenleger
8 1998 Wiederholung des Lehrjahrs wegen Fehlzeiten 9 8/1999 Suizidversuch auf 18. Geburtstagsfeier, Tablettenintoxika-
tion, 1.Psychiatrieaufenthalt 10 10/1999 Abbruch der Lehre im 2. Lehrjahr, B. beginnt kriminelle Kar-
riere 11 1/2000 Zweite Lehre Fliesenleger nach 3 Wochen abgebrochen 12 3/2000 B. muss von zuhause ausziehen, bekommt von Eltern Ap-
partement in Nachbarschaft angemietet, weitere Psychiatrie-aufenthalte; Diagnostik: drogeninduzierte schizophrene Psy-chose
13 11/2000 B. wird wohnungslos, ofW, SpDi vermittelt Sozialhotel (möblierte Notunterkunft)
14 12/2000 Weitere Psychiatrieaufenthalte u.a. im Schwarzwald 15 01/2001-
07/2005 Landgericht ordnet Maßregel nach § 63 StGB in Forensi-scher Fachklinik in Weissenau/ Ravensburg an
16 07/2005-2007
Extramurale Belastungserprobung, anschließend RPK-Behandlung in Rehaeinrichtung für junge psychisch Kranke in Stuttgart, bei 4 Jahren Führungsaufsicht
17 09/2007 Erneute Anmietung Appartement, bei ABW-Betreuung und PIA Behandlung, Freundin zieht beim B. ein.
18 02-04/2009 Weitere Klinikaufenthalte, Freundin trennt sich, zieht aus, stellt Strafanzeige wegen Stalking
19 04/2009 Eltern ziehen von Stuttgart weg bis an Landesgrenze, sie ha-ben Angst vor B. und werden bedroht.
20 3/2010-04/2011
Gesetzlicher Betreuer wird bestellt, B. setzt kriminelle Handlungen fort, gerät in Unter- und Mangelversorgung, Wohnung wird erneut gekündigt wegen Ungeziefer und Be-drohungen im Mietshaus
179
21 04-08/ 2011 Achter Psychiatrieaufenthalt mit Unterbringung, Betreuer stellt Unterbringungsbeschluss nach § 1906 BGB für ge-schlossenes Wohnheim der Eingliederungshilfe
22 11/2011-09/2013
Aufnahme in geschlossenes Heim, B. beginnt Praktikum in Second Hand Kaufhaus in Kleiderabteilung, intensiver Kon-takt mit Eltern entsteht
23 02/2012 Anklage am LG: 3 Anklageschriften+ 23 Strafanzeigen: u.a. Körperverletzung, Diebstahl, Nötigung, sexuelle Erregung im öffentlichen Raum, BtMG- Verstoß, Strafprozess wird angekündigt
24 02-03/ 2013 Strafprozess + Urteil am LG Stuttgart: Voraussetzung für erneute Maßregel liegt vor, Freiheitsstrafe von 1,6 Jahren, ersatzweise zur Bewährung von 3 Jahren mit Sicherungsauf-lagen
25 09/2013-07/2014
B. zieht in offenes Heim der Eingliederungshilfe in Einzel-appartement, beginnt wieder mit Tischtennis, trainiert Ju-gendmannschaft
26 Seit 08/2014 B. wird im ABW betreut, mit festen Freundin liiert, weiter-hin in Second-Hand-Kaufhaus beschäftigt, gewinnt offenes Tischtennis-Turnier in Stuttgart
Tabelle 3: Biographische Daten zur Falldarstellung 1.
Der Biograph wurde 1981 in einer Großstadt der ehemaligen DDR geboren. Die Mut-ter ließ sich vier Jahre zuvor von ihrem 1. Mann scheiden, mit dem sie zwei Töchter hatte und heiratete erneut 1978. Hr. Grün hat mütterlicherseits zwei Stiefschwestern, von denen die eine vier Jahre, die andere zwölf Jahre älter ist. Väterlicherseits hat Hr. Grün noch einen Stiefbruder, der vor 1978 geboren wurde. Die Existenz des Stief-bruders sei auch seinem Vater erst seit wenigen Jahren bekannt gewesen. Die Mutter, von Beruf Kommunikationswissenschaftlerin, ist zum Zeitpunkt der Geburt, wegen ihrer Sprachkenntnisse, zur Kellnerin in einem Polit-Restaurant für internationale Gäste degradiert worden. Im Zuge einer Haftstrafe in den 70er Jahren als „Politische“ wurde der Mutter Berufsverbot erteilt. Der Vater ist Bahnbeamter bei der Deutschen Reichsbahn und durfte seinen Beruf zum Zeitpunkt seines Sohnes ebenso nicht mehr ausüben. Die Eltern hatten im weiteren Verlauf bereits mehrfach Ausreiseanträge ge-stellt. Erst im März 1989 darf die Fam. Grün endlich ausreisen. Ökonomisch herrschte in der DDR in der Zeit von 1981-1990 eine schwere Finanzkrise, die u.a. durch das Wettrüsten der Sowjetunion verursacht wurde. Die DDR geriet in dieser Epoche zunehmend in eine wirtschaftliche Schieflage, die sukzessive zu einer Desta-bilisierung des gesamten DDR-Regimes führte. Der Pfarrer Eppelmann und der Dis-sident Havemann stießen zu dieser Zeit mittels „Berliner Appel -Frieden schaffen ohne Waffen“ (am 25.01. 1982)309 durch die Gründung der Friedensbewegung auf eine breite Resonanz. Ab 1984 kam es verstärkt zu einer Ausreisewelle, im selben Jahr wuchs die Bürgerrechtsbewegung stetig an. 1985 wird M. Gorbatschow sowje-tischer Generalsekretär und leitete auf der Grundlage von Glasnost (Offenheit) und
309 www.jugendopposition.de/index.php?id=2157. Download vom 28.8. 2013
180
Perestroika (Umstrukturierung) demokratische Entwicklungen hinter dem gläsernen Vorhang ein.
Hr. Grün wurde in den ersten 18 Monaten seines Lebens zu Hause versorgt und be-treut. Von 1983 an bis kurz vor der Einschulung besuchte er einen Ganztageshort bis es 1987 zur Einschulung kam. Bis dahin waren die Eltern berufstätig, so dass die Betreuung des gemeinsamen Sohnes überwiegend in die Verantwortung der zwei Halbschwestern fiel, die im gemeinsamen Haushalt lebten. Schließlich reisten die Grüns mit ihrem Sohn im März 1989 aus der DDR aus und zogen zunächst für sechs Monate zu Verwandtschaft nach West-Berlin, dann im Herbst 1989 weiter in ein Dorf bei Hannover, wo der Vater eine Beschäftigung bei der Deutschen Bahn bekommt. Die beiden Halbschwestern blieben beim leiblichen Vater im Osten. Als Hr. Grün in die 2. Grundschulklasse kam, wird er als herausragendes Talent entdeckt und durch den Vater mit dem Leistungssport Tischtennis in Kontakt gebracht. Anfangs trainierte er dreimal pro Woche. Dies steigerte sich bis zu fünf Trainingseinheiten. 1990 er-folgte, aus beruflichen Gründen des Vaters, der 3. Umzug seit der Ausreise, diesmal in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Hr. Grün war inzwischen in der 3. Klasse und suchte sich erneut einen neuen Freundeskreis. Wegen seiner sportlichen Begabung fand er rasch Anschluss und war bei den Mitschülern beliebt und aner-kannt. Der Vater bekam als ICE-Flottenchef eine Leitungsaufgabe am Standort Stutt-gart. Die Mutter war Hausfrau. Hr. Grün spielte nun mit großem Eifer und Disziplin bis zu sieben Mal pro Woche Tischtennis. An den Wochenenden fanden zudem Tur-niere statt, die auf Landes- und Bundesebene ausgetragen wurden. Er besuchte zu-sätzlich Lehrgänge und gewann schließlich 1994 als 13-Jähriger die Deutschen Tischtennismeisterschaften in der Schülerklasse und galt als Hoffnung für den deut-schen Spitzensport.
1995 kam es plötzlich zum Bruch. Hr. Grün verweigerte als 14 Jähriger den Schul-besuch. Er lernte neue Freunde, eine Clique auf der Straße, kennen. Einige der Peers lebten teilweise auf der Straße oder wurden von Einrichtungen der Kinder- und Ju-gendhilfe betreut, in Notunterkünften für „Straßenkids“. Sie rauchten, tranken Alko-hol, konsumierten Drogen, einige verweigern ebenso den Schulbesuch. Passanten wurden von der Clique um Geld massiv angebettelt. Hr. Grün verweigerte nun abrupt, Tischtennis zu spielen. Er kam tagelang nicht nach Hause, besuchte die Schule nicht mehr. Die Peer-Gruppe übte eine hohe Attraktivität und gleichzeitig eine starke Grup-penkohäsion aus und vermittelte Hrn. Grün „ein Gefühl der Anerkennung, ohne Be-dingungen daran zu knüpfen.“
Das Jugendamt trat bei den Grüns auf den Plan. Obwohl sich der Biograph in der Schule nicht bemühte, nicht motiviert war, zu lernen, außer im Fach Englisch, absol-vierte er 1997 erfolgreich den Hauptschulabschluss mit einem Notenschnitt von 2,9. Hr. Grün begann 1997 eine Ausbildung als Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, die der Vater vermittelt hatte. Das erste Lehrjahr, das ausschließlich aus Berufsschule bestand, wiederholte Hr. Grün aufgrund von Fehlzeiten.
Der Biograph entzog sich und entglitt seinen Eltern zunehmend. Er kam immer wie-der tageweise nicht mehr nach Hause, verweigerte die Berufsschule, stand am Mor-gen nicht mehr auf. Er vernachlässigte seine Körperpflege und seinen Wohnraum. Die Eltern holten professionelle Hilfe ein. Das Jugendamt versuchte Hrn. Grün in
181
eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung zu vermitteln, die er jedoch kategorisch ab-lehnte.
Die Zugehörigkeit zu den Peers wurde im Sinne von BOURDIEU durch den Habi-tus310, d.h., durch das regelmäßige Dazustehen, durch den Kleidungsstil, die Frisur, durch die Sprache, den Geschmack, durch das gesamte Auftreten legitimiert und von den Gruppenmitgliedern anerkannt, sodass durch die Nach-Außen-Hin-Performance der gesellschaftliche Status und Rang mit dem Ziel einer Abgrenzung und gleichzei-tigen Zugehörigkeit kontrastiert wird. Die monetären Bettelerfolge wurden in Alko-hol oder Drogen oder Fastfood umgesetzt und innerhalb des Gruppenverbundes kon-sumiert. 1998 kam es zur Wiederholung des 1. Lehrjahres. Hr. Grün begründete das Scheitern mit dem beschwerlichen und langen Anfahrtsweg von einer Zugstunde, mit der Verlagerung seines Lebensschwerpunktes zugunsten der Peers, mit seiner Freun-din und dem abendlichen Ausgehen und Feiern.
Erstmals wird 1999 die Diagnose hebephrene Psychose311, Alkoholabusus, frühe THC-Abhängigkeit sowie eine dissoziale Persönlichkeitsstörung312 gestellt. Hr. Grün beging in einem Zeitraum von vier Monaten neun Diebstähle, (Lebensmittel, Alko-hol, CDs). Er verlor seine Lehrstelle im 2. Lehrjahr, weswegen die Beziehung zu den Eltern auseinanderzubrechen drohte. Der Vater organisierte und vermittelte seinem Sohn kurzerhand einen 2. Lehrbetrieb. Diesmal ein familiärer Betrieb. Hr. Grün be-gann dort Anfang 2000, doch schon nach 3 Wochen stellt der Ausbildungsbetrieb fest, dass Hr. Grün überfordert sei und die Grundforderungen zum Fliesenleger nicht erfüllte. Hr. Grün konsumierte nun LSD, Kokain, synthetische Drogen, Cannabis in hoher Dosierung und trank riskante Mengen an Alkohol. Inzwischen forderte Hr. Grün mit Selbstverständlichkeit bei den Eltern Geld ein. Immer wieder kommt es zu Auffälligkeiten im öffentlichen Raum und somit zu Ermahnungen, Platzverweisen durch die Polizei, das Ordnungsamt und schließlich zu einer Verurteilung zu Sozial-stunden, dann zu einer Bewährungsstrafe. Die Eltern machten sich größte Sorgen, ließen sich schließlich zum adäquaten Umgang bei Angehörigen mit suchtkranken Menschen von der Suchtberatungsstelle beraten. Hr. Grün lebte nun ganz zurückge-zogen, er sprach wenig, war gereizt, desinteressiert, seine Stimmung war morös und depressiv. Er verlor stark an Gewicht und hat bei der 2. Klinikeinweisung nur 77 kg Körpergewicht, bei einer Größe von 198 cm (BMI: 19.3). Die Eltern beschlossen im Frühjahr 2000, darauf zu insistieren, dass ihr Sohn nun auszieht und mieteten in un-mittelbarer Nachbarschaft ein Appartement an, das von den Eltern geputzt und unter-halten wurde. Hr. Grün bekam Essen und Trinken von den Eltern, sie kümmerten sich um den Zustand der Wohnung und vermittelten gegenüber dem Vermieter und den Nachbarn, die sich konstant beschwerten. Hr. Grün nahm nur sporadisch oder gar nicht die verordnete Medikation ein. Er wurde von der Psychiatrischen Institutsam-bulanz (PIA) und dem Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDI) behandelt und ambulant begleitet. Hr. Grün entzog sich immer wieder den professionellen Helfern und lehnt die vorgehaltenen Unterstützungsangebote ab. Er bedrohte vorwiegend junge und
310 Habitusbegriff bei P. Bourdieu: vgl. Bourdieu, P.: Die verborgenen Mechanismen der Macht. VSA-Verlag. Hamburg:1997, S. 206-208 311 Hebephrene Psychose; siehe ICD 10 F 20.1 312 Dissoziale Persönlichkeitsstörung; siehe ICD 10 F 60.
182
körperlich unterlegene Frauen am Fahrscheinautomaten und forderte Bargeld ein. So-bald er zurückgewiesen wurde, reagierte er fremdaggressiv und schlug zu. Hr. Grün griff dabei auf gelernte Kickboxsprünge zurück. Im Juli 2000 kam es zur 3. Klini-keinweisung, im Rahmen derer bei der Aufnahme eine Vielzahl unterschiedlicher Suchtstoffe nachgewiesen wird. Hr. Grün war stark wahnhaft, zeigte Größenideen und wird anschließend aus disziplinarischen Gründen, nach einem positiven Drogen-test, entlassen. Das angemietete Appartement wird gekündigt. Hr. Grün wird im An-schluss wohnungslos und 08/2000 in eine spezifische Einrichtung für junge, woh-nungslose und psychisch kranke Menschen vermittelt. Die psychosoziale Betreuung übernimmt der regional zuständige Sozialpsychiatrische Dienst313, drei Monate später wird er auch dort wegen seines Verhaltens gekündigt und erhält schließlich einen Platz in einem Sozialhotel.314 Kurz vor Weihnachten 2000 kommt es zur 4. Klinikein-weisung. Die Krankheitsdynamik beruhigt sich gar nicht mehr. Hr. Grün ist kaum mehr zu erreichen, nicht mehr zugänglich, die Erkrankung wirkt in dramatischer Weise. Er stellte zunehmend eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Im Januar 2001 kommt es zu einer Verhandlung am Landgericht, in der mehrere Anklagepunkte be-urteilt und die Maßregel angeordnet wird.
Hr. Grün erklärte dieses Ereignis folgendermaßen: „Dann äh (..) hat der Richter ge-meint .. ja .. auf Bewährung, ja (.) aber nee § 63315 also Gefährdung für die Allge-meinheit (.) war dann auch beim Gutachter (habe dem auch noch erzählt(.) wie das so ist in meinem Leben, und der hat mir eine Negativsymptomatik .. ähm … diagnos-tiziert also aufgrund der Drogen und so was alles, ja, mit Versagenssyndrom irgend-wie so was alles .. weil ich hab ja nicht mehr gearbeitet und so was alles (hustet) .. und dann wars wahrscheinlich für den Richter das Beste (..) ja (..) aufgrund das alles, zu unterbinden (.) diese ganzen Sachen (.), mich in die Forensik einzusperren (.) ja (.) also § 63 (..) und dort war ich dann ab meinem 19. Lebensjahr, war dort 4 ½ Jahre in der Forensik und die Zeit dort war richtig hart (.), ja“ 316
In den ersten zwei Jahren im Maßregelvollzug verweigerte sich Hr. Grün weiterhin. Er lehnte die therapeutischen Angebote ab und verschaffte sich mit einem Mitpatien-ten mehrfach Ausgang, besuchte per Autostopp Open Air Konzerte im Umland, wurde alkoholisiert und unter Drogeneinfluss zurückgeführt. Dies wiederholte sich mehrfach.
Die Forensische Psychiatrie bereitete nach viereinhalb Jahren, im Rahmen einer extramuralen Belastungserprobung, zu der Hr. Grün in eine stationäre Rehabilitati-onseinrichtung in seine Herkunftsgemeinde zieht, sukzessive die Entlassung aus dem Maßregelvollzug vor. In dieser Zeit verhielt sich Hr. Grün unauffällig und konnte die
313 Erklärung zur Funktion und den Aufgaben eines Sozialpsychiatrischen Dienstes. Abschlussbericht des Projeksts: Implementation des personenzentrieretn Ansatzes in der psychiatrischen Versorgung in Baden- Württemberg. Vom 1.April 2001-31.3.2004, S. 47. 314 Sozialhotels sind Notunterkünfte, die i.d.R. vom Sozialamt im Zuge eines Hotelscheins, der für den von Wohnungslosigkeit bedrohten Antragsteller, finanziert werden. Im Stadtgebiet Stuttgart stehen 400 Plätze, die aus einfachen und möblierten Zimmern mit gemeinschaftlichen Duschräumen bestehen, zur Verfügung. 315 § 63 i.V. mit §§ 20; 21 StGB stellen die juristische Grundlage und Voraussetzung für eine Behandlung im Maßregelvollzug, in einer für den Landgerichtsbezirk zuständigen forensischen Fachklinik. Für den Landge-richtsbezirk Stuttgart ist die Forensische Fachklinik Weissenau /Ravensburg mit 110 Plätzen zuständig. 316 Interview Hr. Grün: Teil 1; S. 5, Zeile: 131-148.
183
vom Gericht definierten Auflagen befolgen. Ende 2005 kam es zur formalen Beendi-gung bzw. Entlassung auf Bewährung durch die Staatsanwaltschaft mit einer Füh-rungsaufsicht für die Dauer von weiteren 24 Monaten. Darin waren verankert: Eine regelmäßige Medikamenteneinnahme, sowie fortlaufende Atemalkohol- und Dro-genurinkontrollen, Besuch einer Selbsthilfegruppe, Behandlung durch eine psychiat-rische Institutsambulanz. Zudem hatte Hr. Grün bestimmte Behandlungsmaßnahmen wahrzunehmen. Dies bezog sich auf die Teilnahme an Gruppenangeboten der Ein-richtung, auf die Beschäftigung und darauf, vereinbarte Ausgangsvereinbarungen einzuhalten. Im Rahmen der Rehabilitationsbehandlung für junge psychisch kranke Menschen, durchlief Hr. Grün den Schwerpunkt der medizinischen Rehabilitation für sechs Monate, im Anschluss daran eine Phase der beruflichen Rehabilitation für wei-tere zwölf Monate.317
Hr. Grün blieb bis zur beruflichen Orientierung weitere neun Monate bis Sommer 2007 im Wohnheim und fand dann erneut, vermittelt durch den Vater, ein Apparte-ment, in dem er ambulant zu Hause betreut wurde. Die Beschäftigung erfolgte im Zuge eines Arbeitsprojekts, mit der Zielsetzung, die Teilnehmer auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. In dieser Zeit lernte der Biograph eine Frau kennen, die zur selben Zeit Klientin der Rehabilitationseinrichtung war, und zu Hrn. Grün zieht. Nach kurzer Zeit ließ der Biograph erneut die Medikamente weg, trank große Mengen Alkohol, konsumiert Drogen, kehrte zurück zu seinen Peers auf die Straße, bettelte und bedrohte Passanten.
In der Zeit von 2009-2011 verübte Hr. Grün 23 weitere Straftaten, darunter fielen Körperverletzung, Exhibitionismus in der S-Bahn, Stalking gegenüber der inzwi-schen ausgezogenen Freundin, Freiheitsberaubung, Diebstahl von Alkoholika und Lebensmitteln sowie mehrfache Verstöße gegen das BtMG318. Es folgten weitere Krankenhausbehandlungen in der zuständigen psychiatrischen Klinik. Anfang 2010 wurde vom Kliniksozialdienst eine gesetzliche Betreuung für die Wirkungsbereiche: Gesundheit, Vermögensfürsorge, Aufenthalt, Post und Briefverkehr eingerichtet. Hr. Grün setzte immer wieder nach kurzer Behandlungszeit in der Klinik die verordneten Medikamente ab. Es entwickelte sich ein Drehtüreffekt mit immer höherer Frequenz und kürzeren Phasen der Stabilität. Im Sommer 2011 eskalierte die Situation in der Wohnung. Hr. Grün ließ nun niemand mehr in sein Appartement, auch die Eltern nicht. Er dunkelte die Fenster ab, schlief kaum noch, fand keine Ruhe. Hr. Grün war
317 RPK Behandlung: Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke (RPK) sind gemeindenahe Einrich-tungen (allein 9 RPK Einrichtungen in Baden-Württemberg) für Patienten, die umfassende Hilfen und Förde-rung in den Bereichen der medizinischen und beruflichen Rehabilitation benötigen. Das Angebot umfasst ärzt-liche Behandlung, Psychotherapie, Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Belastungserprobung, Kranken-pflege, Sport, Bewegungstherapie, Training der Fähigkeiten zur selbständigen Lebensführung sowie berufs-vorbereitende Maßnahmen und Arbeitstraining. Hierzu verfügen die Rehabilitationseinrichtungen über ein in-terdisziplinäres Team, Diese Rehabilitationseinrichtungen zielen auf eine weitgehende berufliche und soziale Integration. Die Dauer der Maßnahmen ist in der Regel auf ein bis zwei Jahre befristet. Für die Dauer der Behandlungsphasen- und Schwerpunkte ist die zuständige Krankenkasse, der Rentenversicherungsträger oder die Agentur für Arbeit Kostenträger. Entsprechend kann im Sinne einer Gleichstellung zur somatischen Reha-bilitation Krankengeld und Übergangsgeld bezogen werden, vorausgesetzt die Anwartschaftsbedingungen werden erfüllt. Ansonsten ist der überörtliche Sozialhilfeträger der Kostenträger der Maßnahme. 318 BtMG Betäubungsmittelgesetz: Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (ehemals Opiumgesetz) ist ein Bundesgesetz, das in den Anlagen I bis III des BtMG definiert, welche Stoffe und Zubereitungen vom BtMG, siehe § 1 Abs. 1 BtMG, erfasst werden.
184
nun stark abgemagert, unterernährt und mangelversorgt. In seiner Wohnung waren auf dem Teppichboden, an der Kleidung, sowie im Bett große Brandflecken und Lö-cher, die durch das Aufstellen von Kerzen und einem nachlässigen Umgang mit Zi-garettenglut verursacht wurden. Der Strom war inzwischen abgestellt worden. Ver-schiedene Ungeziefer wurden angetroffen. In der Wohnung hortete Hr. Grün nun bergeweise Müll und Abfall. Der Betreuer leitete erneut eine Klinikbehandlung, zum 6. Mal, ein und stellte beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag für eine Unter-bringung nach § 1906 BGB wegen erheblicher Eigengefährdung, die für 12 Monate genehmigt wurde. Ende 2011 kam es zur Verlegung und Aufnahme in einem ge-schlossen Wohnheim. Hr. Grün bezog ein Einzelzimmer mit eigenem Bad. Die Eltern und die Stiefschwestern mit Familie besuchten Hrn. Grün regelmäßig und hielten re-gen telefonischen oder postalischen Kontakt. Sie waren an der Behandlung und vor-gehaltenen Angeboten im Haus interessiert.
Die nun anstehende Landgerichtsverhandlung wurde zweimal von der Staatsanwalt-schaft verschoben. Grund war die andauernde Überlastung durch die „Stuttgart-21-Prozesse“ und den sogenannten „schwarzen Donnerstag“, die das Gericht a priori behandeln und bearbeiten musste. Im Frühjahr 2012 erhielt Hr. Grün die Anklage-schrift vom LG Stuttgart. Diese berücksichtigte den Zeitraum von 2009- 2011 und führt 23 Anzeigen in vier Anklageschriften auf. Hr. Grün bat das Gericht schriftlich darum, die Wartezeit auf die Verhandlung zu verkürzen, da er sehr unter dem unge-wissen Ausgang, dem langen Warten und der unsicheren Perspektive, wieder in den Maßregelvollzug zurückzukehren, sehr leide.
Inzwischen wurde Hr. Grün zum Heimbeirat gewählt und vertrat so die Rolle des Heimfürsprechers als Interessenvertreter gegenüber der Heimleitung von 26 Bewoh-nern. Immer wieder mischte sich Hr. Grün offensiv bei schwelenden und akuten Kon-flikten in einem förderlichen Sinne ein, z.B. wenn ein Mitarbeitender oder Bewohner von einem angespannten und aggressiven Mitbewohner bedroht wurde oder eine Konfliktsituation zu eskalieren drohte. Durch seine Körperstatur gelang es ihm ein ums andere Mal Konflikte erfolgreich zu schlichten und zu deeskalieren. Hr. Grün besuchte im Heim die Sportgruppe, akzeptierte die Pflichttermine und Behandlungs-angebote (z.B. die Suchtgruppe, Arzttermine etc.). Das Arbeits- und Beschäftigungs-angebot, das er zunächst im geschützten Rahmen im Haus besuchte, dann auf dem 2. Arbeitsmarkt in einem Second Hand Kaufhaus fortsetzte, war Zeichen einer weiteren gesundheitlichen Stabilität. Hr. Grün wurde regelmäßig von seinem Bewährungshel-fer aufgesucht. Der Beschluss zur Unterbringung, wurde erneut um acht Monate ver-längert. Im Februar 2013 begann endlich der Strafprozess am Landgericht, der mit fünf Verhandlungstagen angesetzt war.
Wenige Tage vor der Verhandlung erkrankte Hr. Grün an einer schweren Grippe. Er wollte die Verhandlung dennoch hinter sich bringen und hielt die folgenden Tage fiebrig durch. Am Tag der Urteilsverkündung war er wieder gesund. Im Urteil wurde der positive Betreuungsverlauf in der geschlossenen Einrichtung strafmildernd be-wertet. Das Gericht sieht einerseits alle Voraussetzung und Rahmenbedingungen für eine Zuweisung in den Maßregelvollzug nach § 63 StGB als gegeben. Dennoch be-schloss das Gericht eine 3-jährige Bewährungsstrafe mit festen Sicherheitsauflagen.
185
Hrn. Grüns Unterbringungsbeschluss wurde nach einer Helferrunde mit dem Be-treuer, dem Bewährungshelfer, dem Bezugsmitarbeiter und der Heimleitung im Juli 2013 nicht verlängert. Er zog im Anschluss wenige Monate später in ein offenes Wohnheim. Im November 2014 zog er ins Ambulant Betreute Einzelwohnen. Der Biograph hat wieder mit dem Tischtennisspiel begonnen, seine Arbeitszeit im Kauf-haus erweiterte er um wenige Stunden. Alle folgenden Drogenscreenings fielen ne-gativ aus, sowie auch die vom Gericht geforderten Atemalkoholkontrollen. 2015 ge-wann Hr. Grün wieder ein offenes Tischtennisturnier. Er trainiert seitdem eine Schülermannschaft und fand wieder eine Freundin.
6.1.3. Erste Hypothesenbildung zum gelebten Leben
Hr. Grün wird in der neuen Heimat mit dem Thema der Zugehörigkeit, der Anerken-nung und der Akzeptanz konfrontiert. Wie wird die Familie aus einer Großstadt der ehemaligen DDR auf dem niedersächsischen Land, dann in einer süddeutschen Stadt aufgenommen? Was bedeutet die Betonung der Eltern, „trotz der häufigen Umzüge musste Hr. Grün die drei Schulen nicht wiederholen“. Die erfolgreiche Strategie, sich in der neuen Heimat zu integrieren, setzt voraus, sich schnell anzupassen, nicht auf-fällig zu werden. Dies geschieht unter Umständen auf Kosten der eigenen Identitäts-entwicklung und Überzeugung. Wie viel Kraft kostete Hrn. Grün diese Anpassungs-leistung? Wie kommen die Eltern mit der neuen Welt klar? Welchen Einfluss haben die langjährigen und leidvollen Erfahrungen der Familie Grün durch die ständigen Bespitzelungen, Überwachungen und Repressionen der Staatsicherheitspolizei? Wel-chen Einfluss auf die familiäre Binnenkommunikation und auf die familiale Abgren-zungsleistungen von innen nach außen? Ebnen die ehemalige Inhaftierung des Groß-vaters im Konzentrationslager durch die Nazis, die Haft der Mutter als Politische unter dem SED-Regime und die Berufsverbote beider Elternteile eine dauerhafte At-mosphäre von Misstrauen, Beobachtet-und-verfolgt-Werden auf die Identitätsent-wicklung, das Kontakt- und Bindungsverhalten des Biographen? Es liegt unter Be-rücksichtigung der transgenerativen Erfahrungen nahe, dass die Familie Grün im Bereich der Hilfeannahmebereitschaft erst dann professionelle Hilfe zulassen kann, wenn alle innerfamilialen Ressourcen und Möglichkeiten erschöpft sind. In der Ge-genbewegung dazu, ist die Familie Grün in einem vermutlich verstärkten Maße be-müht, die Fassade einer unauffälligen, intakten, bürgerlichen Familie nach außen hin aufrechtzuerhalten und zu verteidigen.
Hr. Grün begibt sich ganz im Zuge einer Sozial-Drift in den Sog der neuen Peers und das schillernde Milieu der Straßenjugendlichen, dies übt eine hohe Anziehungskraft und Attraktivität auf den jungen Biographen aus. Es kommt im Rahmen der Adoles-zenz zur Akzentuierung eines zumindest zeitlich befristeten Bruchs mit der Lebens-welt der eigenen bürgerlichen Familienherkunft, in der Hr. Grün die elterlichen Hal-tungen in Frage stellt, insbesondere die Sozialbeziehung zwischen Vater und Sohn auf den Prüfstand stellt und sowohl die väterlichen Disziplinierungs- und Leistungs-ansprüche an den Sohn im Sport ins Leere laufen lässt als auch im schulischen Be-reich durch eine rigorose Verweigerungshaltung auf sich aufmerksam macht. Trotz der fortlaufenden Probleme (Hr. Grün schwänzt die Schule, er kommt zu spät, er kommt „bekifft“ in den Unterricht oder kifft im Verlauf des Schulbesuchs) in der
186
Schule, absolviert Hr. Grün mit einem Notenschnitt von 2,9 erfolgreich die Haupt-schule. Im Zuge der später erstellten psychiatrischen Diagnosestellung einer hebe-phrenen bzw. juvenilen Schizophrenie (ICD 10 F 20.1 GM 2013)319 ist davon auszu-gehen, dass bei einer durchschnittlich 5-jährigen Prodromalphase von zwei Symptomkomplexen Hr. Grün im Denken, Lernen, Handeln und Verhalten geprägt und beeinträchtigt war. Die Symptomatik setzt sich aus einer depressiven Grundstim-mung und einer sogenannten Negativ- oder Minussymptomatik zusammen, die in der Symptombildung mit sozialem Rückzug (bezogen auf die Kommunikation und das Grundmisstrauen), mangelndem Selbstvertrauen, Angst, Sorge, einem gehemmten Antrieb, verflachten Affekt, Denk- und Konzentrationsstörungen320 sowie Lern-schwierigkeiten beschrieben werden. Hrn. Grün ist es bei einer offenkundig guten Grundintelligenz gelungen, trotz der einwirkenden gesundheitlichen Einflussfaktoren und Beeinträchtigungen, die Schule erfolgreich zu absolvieren.
Als „Bahner“ mit Leitungsfunktion hätte der Vater seinem Sohn auch eine Lehre bei der Deutschen Bahn „vermitteln“ können, zumal der Arbeitgeber als ehemals staatli-ches Unternehmen zu den wenigen Arbeitgebern gehört, bei dem die weiteren Fami-lienmitglieder der Betriebsangehörigen gerne und häufig eingestellt wurden. Der Va-ter entscheidet sich dafür, seinem Sohn gezielt einen kleinen, familiären Lehrbetrieb zu suchen.
In dieser Lebensphase kommt es zu einer massiven Konfliktualität. Die Eltern sind an der Grenze ihrer psychischen Belastbarkeit angekommen. Sie sind ratlos, wissen nicht wohin sie ihren Sohn geben, was sie mit ihm anfangen sollen? Er entgleitet ihnen sehenden Auges. Vater und Mutter lassen ihren Sohn, durch Empfehlung der Suchtberatungsstelle, an dieser Stelle „fallen“, sie ziehen sich zurück. Verweisen mit Hilfe des Jugendamtes auf eine Institutionalisierung von professioneller Hilfe, um die Probleme des Sohnes zu lösen. Durch den professionellen Erfahrungshintergrund der drei Tanten mütterlicherseits, die im Arbeitsfeld Psychiatrie tätig sind, könnten auch zielgerichtete Hilfen und professionelle Beratung in Anspruch genommen werden.
Adoleszenzprobleme beziehen sich generell auf Anpassungszwänge (Anerkennung, abhängig von erbrachten Leistungen, der moralischen Qualität zwischenmenschli-cher Beziehungen, auf Fragen der Lebensführung.) Die Spannung und Konflikte füh-ren das Familiensystem an Grenzen und hat dabei die Aufgabe, sich erneut anzupas-sen. Schließlich kommt die Nichtkündbarkeit von Familienbeziehungen zum Tragen.
Hr. Grün fordert die maximale Aufmerksamkeit bei den Eltern ein, die sich große Vorwürfe machen, als es während ihres Urlaubs zu einem Suizidversuch kommt. Die elterliche Fürsorge konzentriert sich auf ihren Sohn und wird phasenweise zur Über-fürsorge. 1999 verweisen die Eltern den Biographen aus der gemeinsamen Wohnung und mieten ein Appartement in der unmittelbaren Nachbarschaft an. Version: Hr.
319 ICD 10 F 20.1 GM 2013: International Classifikation of Desease in der 10. Überarbeiteten Fassung als German Modifikation in der aktuellen Fassung von 2013, die F 20 Diagnosegruppe beschreibt die Formen der Schizophrenie, die hebephrenen Schizophrenie ist eine Form, die als Adoleszenz oder als junger Erwachsener festgestellt wird und der Schwerpunkt in der Störung des Affektes und Antriebs liegt, bei einer eher ungünsti-gen Prognose. 320 Häfner, H. (1995): Onset an early course of schizophrenia. In: Häfner, H et al: Search for the Causes of Schizophrenia. Vol. III Springer Verlag. Berlin. S.: 43-66.
187
Grün: „….Mum und Daddy haben mich dann voll rausgeworfen….weil ich nicht mehr zur Arbeit bin und so was alles. “
Version der Eltern: „Wir mussten was tun, für uns..(…) weil er nicht mehr nach Hause kam, weil er uns bedroht hatte(…) um Geld und Alkohol, weil wir Angst hatten vor ihm…wir waren mit den Nerven fertig…(wir haben therapeutische Hilfen bekom-men).
Hr. Grün beschreibt die damalige Situation wie folgt: „die (…) Eltern waren jeden Tag da, haben mich versorgt, verpflegt, Kleidung gewaschen und gebracht und so, ich war viel unterwegs, um Marihuana zu besorgen, …hatte ja soziale Schwä-chen…so sozialer Rückzug und so was alles.“
Nach RIEMANN (1987)321 kann es in drei Kontexten zu einer Aufschichtung eines Verlaufskurvenpotentials bei späteren psychiatrischen Patienten kommen:
-a. Prozesse der Einbindung in/der Ausgrenzung bzw. den Ausschluss aus der Familie und Prozesse, die dann einsetzen, wenn eine Familie zerfällt oder gar nicht vorhanden ist;
-b. Prozesse in der Berufssphäre und
-c. Prozesse, die individuelle Verlaufskurven durch kollektive Verlaufskurven auslö-sen.
Es kann auch zu einer Kombination der aufgeführten Prozesse kommen, die dann in ihrer Wirkung in einem verstärkten Sinne zu einer Aufschichtung eines Verlaufskur-venpotentials beitragen.
Hr. Grün wächst in starren, verdinglichenden Identitätsbestimmungen auf, im Sinne RIEMANNs, die Hrn. Grüns Entwicklung in der Selbstidentität enge Grenzen setzen. Dies geschieht durch die früh initialisierte und fortlaufende Medikalisierung seit dem 17. Lebensjahr bis zum heutigen 33. Lebensjahr. Der Anstoß hierfür kommt von au-ßen, von professionellen Helfern, von psychiatrischen Experten. Sie stellen einerseits die Medikamente bereit, andererseits liefern sie aber keine Antwort, wie in der Fami-lie die Krankengeschichte konstruiert wird und welche biographischen Implikationen die Medikalisierung für Hrn. Grün hat bzw. langfristig haben könnte.
Der frühe Zeitpunkt der medikamentösen Behandlung verleitet die Familie und die Helfer zu der Einstellung, dass ein Leben ohne Psychopharmaka nicht mehr vorstell-bar ist, weder eine Zeit vor den Tabletten noch eine Zeit danach. Das fremdaggressive und bedrohliche Verhalten in unbehandelten Krankheitsphasen verstärkt diese Ein-stellung, dass Hrn. Grün zum Schutz vor anderen und vor sich selbst mediziert wer-den sollte. Für ihn ist das Thema „Medikalisierung“ ein rotes Tuch, das er 1999 in einer Psychose, aus seiner Perspektive, eingebettet in einer religiös-omnipotenten, wahnhaften Inszenierung zum Zeitpunkt eines Aufnahmegesprächs in der Klinik, the-matisiert. Er wird in Begleitung von mehreren Polizisten in Handschließen dem Arzt vom Dienst (AvD) vorgeführt wird. Auf die Frage hin, ob und welche Medikamente
321 Riemann, G. (1987): Das Fremdwerden der eigenen Biographie. Wilhelm Fink Verlag. München; S.: 381 ff.
188
er einnehme, antwortete Hr. Grün “…wenn noch einmal irgendjemand das Wort Me-dikamente sagt, den werde ich richten….denn ich bin der Prophet,(..) kniet also nie-der, ich werde Euch enthaupten,“322 verarbeitet.
Hr. Grün droht, durch die Eltern, endgültig aus den Familiengrenzen ausgeschlossen zu werden. Die Versorgung solle außerhalb der Familie geschehen, in professionelle Hände übergehen. Die Eltern stellen ihrem Sohn die Bedingung: „Wenn du nicht zur Arbeit gehst, wenn du keine Medikamente nimmst, droht der endgültige Bruch mit der Familie. Und wir werfen dich dann aus der Wohnung!“ An diesem Punkt der (Nicht)-Medikalisierung wird der Schutz der Eltern, mit dem Status „Angehörige“ zur obersten Handlungsleitlinie. Der Biograph befindet sich in einem Konflikt, in dem einerseits sein Handlungsrepertoire durch die krankheitsbedingte fehlende Com-pliance geprägt wird, andererseits ist er auf Hilfe und Unterstützung angewiesen, weil die Eltern als Vertrauenspersonen und als verlässlichen Rückhalt interpretiert und er-lebt werden. Die Eltern sind mit der sogenannten Positivsymptomatik des schizoph-ren erkrankten Sohnes konfrontiert, der sie bedrängt, bedroht, Geld und Wertsachen verlangt. Er fleht und bettelt, um sich vordergründig Lebensmittel zu finanzieren, letztendlich aber Drogen besorgt und konsumiert. Nicht zuletzt durch den beruflichen Professionshintergrund der Tanten, die in der Psychiatrie arbeiten und bestärkt durch die Suchtberatung für Angehörige, stehen die Eltern inmitten einer hohen emotiona-len Ambivalenz. Sie wollen einerseits als Eltern ihren Sohn nicht fallen lassen, wollen ihm helfen, anderseits halten sie durch ihr Hilfskonstrukt die Veränderungsbereit-schaft und Motivation ihres Sohnes in einer unveränderlichen Pattsituation. Der Ruf des Sohnes, ihm doch endlich zu helfen, ihn zu unterstützen, gipfelt in der Ambiguität des Helfens, schließlich in der Forderung nach Geld zur materiellen Sicherstellung seiner Grundbedürfnisse. Die Eltern und die professionellen Helfer wissen, dass aus der Sicht von Hrn. Grün, die letzte finanzielle Quelle, um sich Alkohol, Tabak und Drogen zu finanzieren, nun zu versiegen droht. Im gleichen Maße intensiviert Hr. Grün die bedrohlichen Momente und Ereignisse, die sich sowohl auf die Eltern fo-kussieren als auch auf fremden Passanten, die sich in der Fußgängerzone oder am Hauptbahnhof befinden.
Bei den diagnostisch-fachärztlichen Interpretationen kommt es zu unterschiedlichen Schwerpunkten und Varianten, die sich jeweils an der Präsentation des Patienten zum Zeitpunkt der unterschiedlichen klinikstationären Aufenthalten orientieren, und Hrn. Grün einmal eine chronisch affektive Psychose (ICD 10 F 25.9), eine chronisch pa-ranoid-halluzinatorische Psychose (F 20.0, F 20.5), auf Grund der Erstmanifestation im 16. Lebensjahr eine hebephrene Schizophrenie (F 20.1), dann einen multiplen Substanzmissbrauch (F19.1), eine frühe Abhängigkeit mit dem 15. Lebensjahr (F 19.2), sowie eine dissoziale (ehemals antisoziale) Persönlichkeitsstörung (F 60.2), und schließlich ein depressiv-asthenisches Versagenssyndrom in Kombination mit der „Androhung eines erweiterten Suizids“ etikettieren.
Hr. Grün drängt nach Außen, nach Autonomie, nach Erfahrungen außerhalb des an-haftenden Familienmilieus, doch er scheitert in der beruflichen Qualifikation, in der räumlichen Abnabelung, selbst in unmittelbarer Nachbarschaft des elterlichen Ge-
322 Aus einem Klinikbericht zur Indikation der stationären Aufnahme vom xx/08/2000, S. 2.
189
sichtskreises. Er scheitert immer wieder an der Selbstorganisation, an der Strukturie-rung von Raum, Zeit, Kommunikation und schließlich an der Strukturierung des So-zialen.323
Der Versuch eines Ablösungsprozesses ist für Hrn. Grün mit Risiken behaftet, weil er an Sicherheit verlieren würde, wenngleich die Dichte und Aufmerksamkeit an pro-fessionellen Betreuungs- und Behandlungsangeboten sukzessive im Verlauf seiner Lebenszeit zunimmt und sich restriktiver entwickelt. Er kommt mit der Polizei, dem Ordnungsamt und der Staatsanwaltschaft in Kontakt. Hr. Grün büßt zunehmend an materieller, finanzieller, emotionaler Sicherheit ein, sowie an der Sicherstellung einer alltagspraktischen Versorgung durch die Eltern, die ihn mit Nahrungsmitteln und ei-ner regelmäßige Wohnraumpflege versorgen. Schließlich geraten die Eltern selbst mehr und mehr in seelische Nöte und beschließen, als letzte Maßnahme der eigenen Sicherheit, den Wegzug an die äußerste Landesgrenze, um ihren Sohn auf Abstand zu halten.
STIERLIN (1980)324 identifizierte drei Beziehungsmodi zwischen der elterlichen Dyade und dem Kind. Überwiegt im Bindungsmodus, wird eine elterliche Interaktion mit dem Kind bewirkt, in dem es im elterlichen Gesichtskreis festgehalten wird, so dass es zum Einschluss des Kindes im Familienghetto kommt. Ist der Delegations-modus prägend für die Beziehung, gelingt es dem Kind zwar, sich aus dem elterlichen Gesichtskreis zu entfernen, es bleibt jedoch durch eine „lange Leine der Loyalität“ an seinen Eltern gebunden. Im Ausstoßungsmodus kommt es zu einer durchgängigen Vernachlässigung und Zurückweisung der Kinder.
Hr. Grün hat chronologisch in der Zeit vom 15.-30. Lebensjahr alle drei Modi durch-wandert. Innerhalb des Bindungsmodus überwog die Angst und Sorge der Eltern um den jähen Leistungsabfall und die Verweigerungshaltung. Im Anschluss folgte der Auszug aus der elterlichen Wohnung in ein Appartement, das 200 m entfernt von den Eltern angemietet wurde. Dann folgte eine Zeit, in der sich Hr. Grün bedrohlich-er-pressend gegenüber den Eltern verhalten hat, er forderte Geld ein, um sich Lebens-mittel aber auch Alkohol und Drogen zu kaufen. Erworbene oder bereits besitzende Güter, wie z.B. sein Fahrrad oder ein Stereoanlage setzte er in Geld um. Die Eltern versuchten sich zu schützen, gehen räumlich auf Distanz und ziehen weit weg, bis an die Landesgrenze.
Das Kind kann im „psycho-somatischen Familientypus“ nach MENUCHIN seine El-tern nicht verlassen, solange es der Meinung ist, es müsse die Eltern zusammenhalten. Dem Kind stehen zwei Handlungsoptionen zur Verfügung. Zum einen verhält es sich unangemessen, so dass die Eltern zusammenrücken, ja, sich zusammenschließen. Das Kind präsentiert deviantes und rebellisches Verhalten, verweigert sich, geht nicht zur Schule. Zum anderen verhält sich das Kind als Opfer, das die Eltern pflegen müssen, weshalb sie sich nicht trennen können. In aller Konsequenz kränkelt das Kind und zeigt Angst vor dem Leben.
323 Thiersch, H. (Hg.) Grunwald, K (2008): Praxis lebensweltorientierte Soziale Arbeit. 2. Auflage. Juventa Verlag. Weinheim und München; S.: 32-35. 324 Stierlin, H. (1980): Eltern und Kinder. Das Drama von Trennung und Versöhnung im Jugendalter. Suhr-kamp. Frankfurt/a.M.
190
Das Thema, das dem Biographen dann anhaftet und mit dem er in der Familie quasi an seinen Platz gedrängt wird, bleibt erhalten und wird im Laufe der Zeit nur noch durch weitere „sekundäre Elaboration“325 reflexiv verfestigt, so RIEMANN326.
Im Sinne RIEMANNS kommt es bei Hrn. Grün ebenso zu einem Eingebundensein in ein Handlungsschema der Familie, das wie ein Sog wirkt. Der Biograph erlebt das Handlungsschema als etwas Fremdes, mit dem er sich zunehmend nicht mehr identi-fizieren kann und es so zu einem schleichenden Entfernen vom anvisierten Lebens-plan eines bürgerlich geprägten Familienmilieus des Hrn. Grün kommt. Im Vergleich zu den beiden Stiefschwestern, die eine beruflichen Transformation hin zum identi-schen Bestätigen (Studium bzw. eine wissenschaftliche Laufbahn, eine Kaufmänni-sche Ausbildung und eine akademische Gattenauswahl), bleibt dem Biograph, sich nur noch den moralischen Erwartungen zu fügen, denen er durch die Alters- und Ge-schlechtskategorien unterliegt.327 Als Einzelkind gilt ihm hohe Aufmerksamkeit und die Entwicklung und Förderung des Kindes erfährt eine hohe Akzentuierung. Zudem könnte der Eindruck aufkommen, auf Hrn. Grün laste in der „2. Generation“ nach der Mauerflucht der moralische Druck, all die erhofften Erwartungen und stellvertreten-den Lebenswünsche der Eltern übertragen auf den Sohn zu erfüllen. Schließlich sind die Eltern durch das politische System um Lebenszeit betrogen, um Lebensenergie beraubt worden, sie haben finanziellen Schaden und beschämende Erfahrungen durch die Berufsverbote, den Gefängnisaufenthalt, die Verfolgung, das Abhören und Be-lauschen und schließlich durch den stigmatisierenden Status als „Politische“ erlebt.
Die Eltern haben nun den Fokus auf den Sohn konzentriert und ausgerichtet, sie stel-len alle ihre Ressourcen zur Verfügung, auf die sie erzwungenermaßen verzichten mussten. Es ist ein Verzicht auf ihre politischen, beruflichen und biographische Ent-würfe. Dieses Grundgefühl des Verzichts und des Misstrauens nach außen hin wird in schmerzhafter Weise erfahren und bestimmt so das Lebensgefühl der Familie Grün auf ihren Stationen durch den „Westen“.
BLANKENBURG (1985) und HILDENBRAND (1984) führen zum Krankheitsbe-griff „Schizophrenie“ noch ergänzend spezifische Aspekte an, die davon ausgehen, dass Schizophrenie als eine Krankheit am Erwachsenwerden bzw. Nichterwachsen-werden-können beschrieben werden kann. Die Ablösung des Kranken von seiner Fa-milie wird dadurch in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Es geht im Kern, um das Überschreiten von Grenzen, zwischen der Welt der Familie und der Welt, die sich außerhalb der Familie befindet. BLANKENBURG hat hierzu den Begriff des Auto-nomie-Heteronomie-Konfliktes geprägt, der entwicklungspsychologisch dem Auto-nomie-Symbiose-Konflikt entliehen ist. HILDENBRAND (1991) entwickelte und leitete aus einem Autonomie-Heteronomie Modell heraus, drei spezifische familiäre
325 Evans-Pritchard E. E. (1937): Whitchcraft, Oracles and Magic among the Azande. London. S.: 330. 326 a.a.O. Riemann (1987), S. 330. 327 a.a.O. Riemann (1987), S. 393.
191
Milieus ab328, in denen zum einen die Genese von Schizophrenie des Kindes als In-dexpatient begünstigt wird und zum anderen der Krankheitsprozess in einer herme-neutischen Interpretation nachvollziehbar und verstehbar wird, wenn Familien am Spannungsverhältnis zwischen Familienmilieu und der umgebenden Gesellschaft scheitern. Das familiäre Milieu der Familie Grün könnte nach Kategorisierung von HIILDENBRAND dem Typus entsprechen, der durch eine „Außen und Innen gleich-ermaßen abgeschottet lebende Familie“ charakterisiert ist. Dieser familiäre Typus grenzt sich massiv ab, und bindet die Mitglieder in und an die Familie. Es stehen keine oder nur geringe Netzwerke zur Verfügung. Von außen droht und wirkt auf die Familie Gefahr ein und es besteht eine paranoid-ängstliche Atmosphäre und Struktur der Familie, die durch Misstrauen, Zweifel an den Verschwiegenheit und Loyalität von Personen außerhalb der Familie geprägt und dadurch genährt wird.
Der Biograph ist zudem in das Handlungsschema eingebunden, das ausgelöst und gleichsam geprägt ist durch die historischen Rahmenbedingungen, die die Eltern in der DDR durch jahrelange Repressalien erlebt haben. Ausgelöst durch die zunehmen-den Einschränkungen von freiheitlich-autonomer Lebensführung und der Gestaltung des Lebensentwurfs haben sich die Eltern schon vor der Geburt ihres Sohnes dafür entschieden, dem Land und dem SED-System zu entfliehen. Sie zogen es vor, sich selbst zu entwurzeln, zu entheimaten, motiviert durch die Sehnsucht und den Wunsch, im Westen werde alles anders, insbesondere in Bezug auf die Zukunft ihres Sohnes.
Es liegt die Hypothese nahe, Hr. Grün habe sich einem übermächtigen Lebensplan zu fügen, der spezifisch auf seine Person zugedacht wurde, nämlich als männlicher Stammhalter die Familienlinie fortzusetzen.329 Die Art und Weise jedoch wie Hrn. Grün dieser Lebensplan aufgedrängt wird, verhindert u.U. die Entwicklung einer ei-genständigen Identität, einer aus sich heraus entwickelten biographischen Linie und
328 Der Vergleich von Familien mit an Schizophrenie erkrankten Mitgliedern, die die Problematik der Grenz-ziehung und Öffnung zwischen Familie und Gesellschaft bewältigen, mündet in drei spezifische Familienty-pen, deren durchgängige Eigentümlichkeit so charakterisiert ist, „dass die Notwendigkeit, die Balance zwischen Grenzziehung und Öffnung als dauerhaft erforderliche und nicht übersteigbare aufrechtzuerhalten, getilgt wird.“ Typ A ist so beschaffen, dass die Familiengrenzen darin geschlossen gehalten werden und deren Über-schreiten massiv erschwert wird. Hierbei geht eine erhebliche Beeinflussung der Autonomie beim später diag-nostizierten Kind voraus, das zudem eine spezifische Position innerhalb des Familiensystems einnimmt bzw. darin zugeteilt wird. Der Typ B ist gekennzeichnet durch ein Familienleben, das als veröffentlichend struktu-riert ist und somit keine Grenzen oder Filter zwischen der Familie und der außerfamilialen Umwelt gezogen werden, wie z.B. bei Familien, die ein Geschäft oder eine Gastwirtschaft etc. betreiben. Beim Typ C handelt es sich um ein Familienmilieu mit einer widersprüchlichen Innen-Außen-Orientierung, verbunden mit einer starken Außenorientierung etwa im sozialen Aufstieg. Das Familiensystem ist so strukturiert, dass innerfami-liale Aspekte in einem ambivalenten Sinne, nach außen hin gerichtet sind oder in der Familie bleiben, ohne dabei eine erkennbare, nachvollziehbare Interaktion oder Kommunikation zu berücksichtigen. Bezogen auf die biographische Entwicklung unterscheidet HILDENBRAND zwei Typen beim Ablöseprozess. Beim ersten Ty-pus ist es ein Bruch im Autonomiewerden, d.h. nach dem Eintreten eines belastenden Lebensereignisses führt der Weg von der Außenorientierung zurück zur Familie. Hr. Grün hat vier Versuche unternommen, sich von seinem Elternhaus abzulösen. Die Prognose des Krankheitsverlaufes des Krisentyps ist hier eher günstig, wo-hingegen beim 2. Typ die Krankheit im Rahmen einer länger dauernden biographischen Entwicklung zur so-zialen Isolation situiert. Diese Prognose für den Isolationstyp ist eher ungünstig. vgl. a.a.O. Hildenbrand, S.11 ff. 329 a.a.O. Riemann, S.: 384.
192
befördert schließlich die Ausbildung einer passiv-indifferenten Haltung des Biogra-phen gegenüber dem Familienmilieu. Er ist letztendlich nicht mehr zuständig, nicht mehr verantwortlich für sich selbst. Andere, Dritte, nicht mehr Hr. Grün selbst, tref-fen Entscheidungen über seinen Verbleib. Dritte entscheiden über den Ort der Be-handlung und die eingesetzten Behandlungsmaßnahmen, über den Zugang und die Höhe des Einkommens, über den Aufenthaltsort. Diese Haltung des Nicht-mehr-für-sich-selbst-zuständig-Seins wird durch die Wirkung von Cannabis im Rauschzustand geradezu augenscheinlich und erfahrbar, sowohl für Hrn. Grün selbst, als auch für seine Eltern. Polizeibeamte werden vom Amt für öffentliche Ordnung beauftragt, Hrn. Grün gegen seinen Willen wegen Fremdgefährdung einer psychiatrischen Klinik zuzuführen. Dort wird er gegen seinen Willen mit Medikamenten behandelt. Ein ge-setzlicher Betreuer wird bestellt, der die monatlichen Geldleistungen (ALG II) der Agentur für Arbeit einteilt und ihm wöchentlich auszahlt. Schließlich urteilt ein Ge-richt über viele Situationen, ordnet die Maßregel an. Im Maßregelvollzug ist Hr. Grün einem engmaschigen und hochstrukturierten Tagesablauf ausgesetzt, der an ihn her-angetragen wird. Es findet eine Zwangsbehandlung statt, die von einem engen Be-treuungskontext gerahmt ist und die Struktur von Zeit, von Raum und von sozialen Beziehungen vorgibt, so dass Hrn. Grün nichts anderes übrig bleibt, als mitzuwirken, sich einzuordnen, anzupassen.
Bei der Erstellung eines Genogramms, das aus der systemischen Familientherapie heraus entwickelt wurde, haben die Eltern von Hrn. Grün maßgeblich in zwei Tele-fonaten, einem persönlichen Gespräch, sowie durch mehrere E-Mails, bei der Struk-tur und den detaillierten Lebensangaben mitgewirkt. Was soll damit pointiert erreicht oder generiert werden? Auf welche Fragen könnte das Genogramm weitere Hinweise und Hypothesen liefern? In welchem individuell-familiengeschichtlichen Kontext hat die Erkrankung von Hrn. Grün welchen Sinn? Liefert es Hinweise darauf, wozu war diese Krankheit einmal gut gewesen?
Das Genogramm diente in den Vor- und Nachgesprächen, in den biographischen In-terviews und den Gesprächen mit den Eltern in erste Linie als Informationsträger, zur Orientierung der komplexen Familiensysteme und der interaktionellen Beziehungs-strukturen und zur Nachvollziehbarkeit des Erzählens und findet lediglich in der Fall-darstellung Anwendung.
6.1.4. Hypothesenbildung aus dem Genogramm
Zwei Familiensysteme - zwei Lebenswelten
Aus dem Genogramm über drei Generationen der beiden Familien können folgende Hypothesen entwickelt werden. Während die väterliche Linie aus einer traditionell protestantisch geprägten Arbeiterfamilie mit klassischen Professionen des Hand-werks im ländlichen Raum entstammt, ist mütterlicherseits ein deutsch-jüdisches Fa-miliensystem aus dem Bildungsbürgertum im urbanen Siedlungsraum prägend. So-wohl die konfessionelle Ausrichtung, das intellektuelle Bildungsniveau, die geographische Ansiedlung der Familien als auch die Qualität der Gattenbeziehung bilden prägnante Divergenzen in der familiären Binnenstruktur, im Erziehungsstil, im familiären Klima, in der Reproduktion des Nachwuchses und in der beruflichen Transformation der beiden Familiensysteme.
193
Die dyadische Sozialbeziehung zwischen der Mutter des Biographen (als älteste von sieben Geschwistern) und ihrem Vater wird in der Bedeutung und Erinnerung beson-ders erwähnt. Die zentrale Figur der Familie ist der Großvater des Biographen, der als jüdischer Universitätsprofessor für Mathematik und Philosophie 1944 mit dem Berufs- und Heiratsverbot sanktioniert und schließlich im selben Jahr von SS-Schergen aus der Universität geprügelt und in das KZ-Außenlager Blankenburg-Re-genstein/ Hessen deportiert wurde. Dort gelang ihm 1945 kurz vor der Ankündigung einer Massenerschießung, terminiert auf den darauffolgenden Tag, die Flucht mit Hilfe sechs weiterer Häftlingen, die früher ebenso an der Universität beschäftigt wa-ren, im Schutze der Dämmerung den Elektrozaun kurzschlossen und so unverletzt entkommen konnten. Seine 12 Jahre jüngere Verlobte, protestantisch und diplomierte Chemiekauffrau, die aus derselben ländlich gelegenen Kleinstadt kommt wie die spä-tere Familie des zweiten Ehemanns (der leibliche Vater von Hrn. Grün) der ältesten Tochter, durfte er erst kurz nach dem Ende des II. Weltkriegs heiraten.
Die Milieubesonderheiten der sozialen Herkunft der mütterlichen Seite sind in erster Linie geprägt, so ALLERT von der „…Konstanz und Anpassungsfähigkeit des jüdi-schen Milieus, in dessen Selbstverständnis die intellektuelle Durchdringung der Welt oberstes Gebot geworden ist, und das sich durch eine einzigartige Solidargemein-schaft mit besonderen Verpflichtungen für das einzelne Mitglied auszeichnet. Als Träger des Intellektualitätsanspruchs tritt hierbei der Vater als Familienoberhaupt ins Zentrum, dessen Bedeutung auf die traditionelle Rolle als Vermittler des religiö-sen Kultes zurückgeht.“330
Der Großvater versäumte als Oberhaupt der Familie keine Gelegenheit darauf hinzu-weisen, dass es kein Widerspruch darstelle, Philosoph und gleichzeitig Boxer, (seine große Leidenschaft), zu sein, dass es kein Widerspruch sei, aus einer jüdischen Fa-milie zu kommen und kraft der dem Menschen gegebenen Vernunft, sich gegen das Gotteshaus und für den Intellekt zu entscheiden. Der Großvater gibt die Familienma-xime aus: „Ihr seid frei, das zu denken und zu tun, was ihr für richtig erachtet. Schal-tet aber den Kopf und euren Verstand ein, um euch für das Richtige zu entscheiden.“ Über den sonntäglichen Messebesuch urteilt der Großvater. „Wer in die Märchen-stunde gehen möchte, kann das bitte tun.“ Die uneingeschränkte Loyalität innerhalb der Gattenbeziehung, eine fortlaufende kritische Reflexion und das Hinterfragen der herrschaftlichen, gesellschaftspolitischen Verhältnisse setzen weitere Schwerpunkte im Denken und der politisch-geistigen Haltung des Familiensystems.
Innerhalb des Familiensystems der Mutter, das durch ein „extented family system“ geprägt ist, kommt es zur Reproduktion von sieben Kindern. Die ersten vier Kinder sind in Folge Mädchen, das 5. Kind ein Junge, das im 1. Lebensjahr an einer Kinder-krankheit verstirbt. Das 6. Kind ist der erhoffte männliche Stammhalter, der jedoch an Autismus erkrankt und schließlich mit knapp 18 Jahren als Pflegefall verstirbt. Die erhoffte männliche Nachfolge und Stammhalterrolle wird erst von dem 7. Kind er-füllt, das sich jedoch schon kurz nach der schulischen Ausbildung den zugedachte Rollen und Aufgaben innerhalb des Familienmilieus durch Auswandern auf einen
330 Allert, T. (1998): Die Familie-Fallstudien zur Unverwüstlichkeit einer Lebensform. Walter de Gruyter. Berlin. New York, S.: 68-69.
194
anderen Kontinent auswandert und somit dem Gesichtsfeld und Einfluss der Familie entzieht und sich selbst aus dem Familienmilieu exkludiert.
Von den fünf Geschwistern wählen drei Berufe, im Sinne einer beruflichen Transfor-mation hin zum Identischen. Sie besuchen wie der Vater die Hochschule und schlie-ßen mit einem akademischen Titel ab. So wird eine Tochter Psychologin in einer Psychiatrischen Klinik und eine weitere wird Chemiekauffrau wie die Mutter. Die 2. Älteste wird Sekretärin eines Chefarztes einer Universitätspsychiatrie, die 3. Älteste wird Referentin für Pharmazie und legt den Schwerpunkt auf den Vertrieb von Psychopharmaka (ähnlich der Berufswahl der Großmutter als Chemiekauffrau), die 4. Älteste wird approbierte Psychotherapeutin und klinische Psychologin. Die Mutter des Biographen wird Kommunikationswissenschaftlerin. Bemerkenswert ist, dass sich von den fünf Geschwistern, die Älteste und der einzige männliche Stammhalter, weit weg von der Heimatstadt der Familie, die dort seit Generationen lebt, niederge-lassen und beheimatet haben.
In der väterlichen Linie trifft man auf eine Handwerkerfamilie, protestantisch ge-prägt, aus dem ländlichen Lebensraum, die in der 1. Hälfte des 20. Jh. durch eine geringe Anzahl von Kindern geprägt war, da der Kinderreichtum nur bei den Bauern anzutreffen war. Die Kinder in protestantischen Handwerkerfamilien standen im Ge-gensatz zum jüdischen Milieu nicht im Fokus der Familie. Dort, im jüdischen Milieu, wurde hingegen innerhalb des Familiensystems Erziehung und Bildung als wesentli-cher Bestandteil identifiziert und (vor)gelebt. Kinder sind in der Handwerkerfamilie für Botengänge zuständig, diese sollen die Abläufe der Arbeit des Vaters und des Haushalts der Mutter nicht stören! Hier lautet die leitende Maxime, dass durch Arbeit gleichzeitig Erziehung vollzogen wurde.
Der Großvater väterlicherseits entschied sich für eine 17 Jahre jüngere, gleichkonfes-sionelle Gattin. Gehorsamkeit, Fleiß, Schamhaftigkeit und religiöse Werte standen im Vordergrund, nicht selten wurden die Kinder mit Branntwein und Opiaten (z.B. mit einem Mohnschnuller) beruhigt bzw. ruhiggestellt. Bei der Berufswahl kam es eher zur Fortsetzung des Handwerks, (Metzger, Bäcker, Bahner), also zu einer Trans-formation hin zum Äquivalenten, das der Vater ausübt.
Der Vater des Biographen wählte keinen Lehrberuf, vielmehr strebte er eine höhere Laufbahn bei der Deutschen Reichsbahn an. Sein Bruder blieb hingegen im Gesichts-feld der Eltern, wohingegen der Vater von Hrn. Grün in die Großstadt zog, sich dort, politisch motiviert, gegen das Regime der DDR engagierte und wie seine spätere Ehe-frau für die politischen Aktivitäten Berufsverbot erhält, Sanktionen und Repressalien erfuhr, verhaftet und bespitzelt wurde.
Während die Familie väterlicherseits, über Generationen hinweg, auf dem Land lebte, traf diese nun auf eine Familie, die in der 60 km entfernten Metropole traditionell verortet war.
Die protestantisch geprägte Familie des Vaters traf nun auf eine jüdische Familie der Mutter Grün. Zudem traf die väterliche Handwerker- bzw. Arbeiterfamilie auf eine akademische Bürgerfamilie, in der der Großvater und die Großmutter ein Hochschul-studium abgeschlossen haben, bzw. der Vater als Universitätsprofessor tätig war.
195
Preußische Tugenden nach Friedrich des Großen (Leistung, Ordnung, Disziplin etc.), die die väterliche Familie geprägt haben, treffen auf ein Familie, in der religiöse Frei-heit, „Vernunft statt Glaube“, ein liberaler und weltoffener Erziehungsstil gelebt wird bzw. vorherrscht. Das Genogramm der Familie generiert phänomenologisch weitere Themen, die sich diagonal, von der Schwester der Großmutter mütterlicherseits bis hin zum Indexpatient und transgenerativ, vom jüdischen Großvater, über die älteste Tochter zum Indexpatienten aufschichten.
Zum einen fällt das Thema „Psychiatrie“ und „psychische Krankheit“ in Augen-schein, so dass über die Krankheit der Großtante mütterlicherseits von einer Stim-mungskrankheit gesprochen wird. Diese sei schwermütig, wahrscheinlich depressiv gewesen. Die Tante mütterlicherseits ist als psychologische Psychotherapeutin im Arbeitsfeld einer Psychiatrischen Klinik professionelle Akteurin. Eine weitere Tante ist im Sinne der beruflichen Transformation hin zum Äquivalenten im selben Status Pharmavertreterin und versorgt Ärzte und Kliniken mit u.a. Psychopharmaka. Hinzu kommt eine weitere Tante mütterlicherseits, die ebenso im Arbeitsfeld „Psychiatri-sche Klinik“ als Sekretärin angestellt ist und sich dort beruflich beheimatet. Hr. Grün äußerte sich im Laufe des Interview zu dem Thema Psychiatrie, das wie ein roter Faden durch die Familiengeschichte wandert, „schon komisch, gell…irgendwie habe ich ja auch wie meine 3 Tanten was mit Psychiatrie zu tun, (…) aber eben auf der anderen Seite vom Schreibtisch, (…) nicht beruflich, also mehr so selbst in Aktion“. (lacht)
Ein weiteres wiederkehrendes, ebenso transgeneratives Thema ist ein „Berufsverbot“, das den Großvater mütterlicherseits als Professor am Arbeitsplatz der Universität ein-holte, weil er als jüdischer Lehrstuhlinhaber und Regimekritiker den Nazis ein Dorn im Auge war. Er bekam aus ideologischen und rassistischen Gründen die Lehrerlaub-nis entzogen und wurde in der Folge mit einem Berufsverbot und kurze Zeit darauf mit einem Heiratsverbot sanktioniert. Die älteste Tochter und Mutter von Hrn. Grün und der Vater durften Jahre später unter der Diktatur der SED ebenso ihren erworbe-nen Beruf als Kommunikationswissenschaftlerin bzw. als Bahnbeamter nicht ausü-ben.
Während sich die Mutter im Sinne einer berufliche Transformation hin zur Äquiva-lenz, für die Wissenschaft mit dem Schwerpunkt der Verständigung, Sprache und des Transports von Kommunikation und der kommunikativen Präsentation ausbildet, blieb sie im Wesentlichen in der beruflichen Transformation des beruflichen Feldes des Vaters treu. Der Vater Grün grenzt sich hingegen von der handwerklichen Aus-bildung ab und bestätigt bzw. folgt vermutlich seinem eigenen Wesen folgend, nach Sicherheit, im Denken und Handeln, nach Verlässlichkeit und Regelkonformität. Er erwarb vermutlich in der Ausbildung, reziprok zur bisher erworbenen Identitätsbil-dung, die wesentlichen und bedeutsamen beruflichen Skills eines Beschäftigten der Reichsbahn- bzw. der Bundesbahn. Hr. Grün berichtet über den Vater im Wesentli-chen von seiner Strenge, Genauigkeit und Strukturiertheit. Die Partner-, bzw. Gatten-wahl wurde weniger durch den Bildungsstand und die Religionszugehörigkeit als e-her durch Sicherheit und Verlässlichkeit, gleichzeitig durch die gemeinsame geistig-ideologischen Antihaltung gegenüber dem SED Staat, die verbindet, entschieden und besiegelt.
196
Nachdem der Großvater ins KZ-Blankenburg deportiert wurde, wird die Mutter des Biographen von 1975 an, von der Stasi bespitzelt und wegen Regimekritik in der DDR zu einer mehr als sechsmonatigen Haftstrafe331 verurteilt. Hr. Grün hingegen hat zum einen für 4 ½ Jahre die Maßregel nach § 20, 21 StGB i.V. mit § 63 StGB332, mit dem Status „forensisch-psychiatrischer Patient“, angeordnet bekommen und kurze Zeit später war Hr. Grün für weitere zwei Jahre, auf der gesetzlichen Grundlage nach § 1906 ff BGB wegen Eigengefährdung Bewohner einer geschlossenen psychi-atrischen Einrichtung, mit Ausgangsvereinbarungen, Besuchsregeln, Behandlungs- und Therapieauflagen. Über drei Generationen hinweg haben die Aufenthalte in ei-nem KZ, in einer Haftanstalt für politische Gefangene, im Maßregelvollzug bzw. in einer psychiatrischen Einrichtung großen Einfluss auf die familiäre Entwicklung ge-nommen.
So stellen „totale Institutionen“333im Sinne GOFFMANS in der Familiengeschichte der Grüns einen weiteren bedeutsamen Erfahrungs- und Stellenwert dar. Durch die Beschränkungen des sozialen Verkehrs mit der Außenwelt, so GOFFMAN, stellen z.B. Klöster, Gefängnisse, Konzentrations- oder Arbeitslager, Forensische Einrich-tungen, geschlossene psychiatrische Einrichtungen oder Heime für behinderte und kranke Menschen oder für Kinder totale Institutionen dar, die durch einen „allumfas-senden oder totalen Charakter“ geprägt sind. Es handelt sich im GOFFMANSCHEN Sinne um unselbständige und harmlose Menschen, um unselbständige und in irgend-einer Weise eine Gefahr für die Gesellschaft darstellende Menschen, um Menschen, die als gefährlich angesehen werden und zum Schutz der Gesellschaft kaserniert und exkludiert werden müssen.
In der gesamten Betrachtung des Genogramms fällt die Charakterisierung „extented-family-system“ ein, die durch eine vielzählige Geschwisterreihe, die drei Kinder aus zwei Ehen und einem unehelichen Kind des Vaters des Biographen in den Vorder-grund rückt.
331 SED Opferentschädigung als Politische Gefangene: siehe Strafrechtliches Rehabilitationsgesetzt in der Fassung vom 17.12.1999 332 § 20 StGB …“Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen. Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung …….un-fähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln oder § 21 (verminderte Schuld-fähigkeit) hat § 63 StGB zur Folge und somit die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus bzw. eine für den zuständigen Landgerichtsbezirk zugeordnet forensischen Fachklinik.“ In Baden-Württemberg gibt es 6 Forensische Fachkliniken für den obigen Personenkreis, die in Zentren für Psychiatrie in 1. Emmendin-gen/Freiburg, 2. Reichenau/ Konstanz, 3. Bad Schussenried, 4. Weissenau/ Ravensburg, 5. Weinsberg/ Heil-bronn, 6. Wiesloch/ Heidelberg untergebracht sind. Hat also jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) begangen, so ordnet das Landgericht die Unterbringung an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm, infolge seines Zustandes, erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Die Dauer der Unterbringung ist unbefristet, setzt jedoch eine jährliche Prüfung voraus. 333 Erving Goffman: Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Suhr-kamp, Frankfurt/a. M. 1973 [orig.: Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other In-mates. Chicago 1961]
197
6.1.5. Erzähltes Leben
Text- und thematische Feldanalyse
a. Sequenzierung von der Geburt bis zum 15. Lebensjahr -Präsentierte er sich als Looser oder als cooler Typ-?
Hr. Grün beginnt sicher, routiniert mit einer Beschreibung, im Sinne einer orientier-ten Passage, seiner lebensgeschichtlichen Konstruktion. Er beginnt mit einer biogra-phischen Präsentation, mit dem Ort seiner Geburt und Kindheit und der Familiensi-tuation zum Zeitpunkt der Geburt. In bisher vielfach erlebten und vertrauten Gesprächssituationen mit Psychiatern, Polizisten, Richtern, Psychologen oder Thera-peuten, die er im Verlauf seiner psychiatrischen Krankheitskarriere oder aus unzäh-ligen fachpsychiatrischen und juristischen Begutachtungen geführt hat, weiß er um einen konzentrierten Rapport, um eine pointierte Personenangabe zu Beginn eines Gesprächs, mit einer chronologischen Aufzählung der Hauptpersonen und der Schlüsselpassagen. Ausreise-Schule-Leistungssport-Ortswechsel und Pubertät. Hr. Grün stellt sich zuerst mit seinem Namen vor, seinem Status als Einzelkind, erwähnt dabei seine zwei Stiefschwestern und ergänzt sein aktuelles Alter und den Geburtsort.
Entgegen eines nun zu erwarteten, fortgesetzten, chronologisch geführten Fortgangs seiner lebensgeschichtlichen Erzählung, überspringt Hr. Grün acht Jahre und hebt dann plötzlich hervor, dass es im Frühjahr 1989 zur Ausreise in den Westen („…wir (..) 1987 einen Antrag auf Ausreise, (.), einen Ausreiseantrag aus der DDR gestellt haben)334, und in der Folge zu mehreren Wohnortwechseln gekommen ist. Die At-mosphäre dieser Zeit (1981 bis 1989) gibt der Biograph nicht aus eigener Erinnerung wieder, sondern aus den Erzählungen und Schilderungen der Eltern, die ihm die Ge-schehnisse berichteten, die ihm jedoch Erlebnisse mit der Staatssicherheit und der Haft, erspart haben. Hr. Grün erschließt und rekonstruiert sich diese Zeit und ergänzt im 2. Interview. „..in Erinnerung? ... weiß ich eigentlich nichts Besonderes, nee… Doch, das hab ich schon (dass meine Eltern raus wollten) mitbekommen, ja, schon…ich glaub auch, dass die öfters einen Ausreiseantrag gestellt haben.335
SCHÜTZE (1987)336 beschreibt Konstellationen von Erlebnissen, die in der Tendenz in der Erinnerung ausgelassen werden, die im Zusammenhang mit individuellen aber auch kollektiv erfahrenen und bedrückenden Ereignisse zu sehen sind, … „in denen der Schmerz derart einschneidend und hartnäckig sein kann, dass der Betroffene nicht mehr daran denken mag und eine thematische Ausblendung oder partielle Ver-drängung entsprechender Erinnerungsbestände in seinem gegenwärtigen Orientie-rungshorizont vornimmt.“ Dies trifft auf beschämende Erlebnisse zu, die entweder eigenverantwortlich (Selbstüberschätzung, Fahrlässigkeit), durch Degradierung oder durch einen anderen (Vernachlässigung, Enttäuschung) entstanden sind. Hier gehö-ren vermutlich auch die Ereignisse aus der Partnerschaft dazu, die Hr. Grün vollstän-dig auslässt.
334 Interview I: Hr. Grün, S. 1, Zeile: 15-16. 335 Interview II: Hr. Grün, S. 2, Zeile: 25-34. 336 Schütze, F. (1987): Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien. I. Studienbrief der Fern-Universität Hagen, S.: 211.
198
ROSENTHAL (1995) verweist auf drei Charakteristika erinnerter Erlebnisse, auf-grund derer die Ereignisse möglicherweise sprachlich nicht zum Ausdruck gebracht werden (können). Es handelt sich um Bestandteile des aus der Erinnerung Auftau-chenden, die entweder:
• nicht in die Geschichte eingebettet werden können, da sie nicht verstanden oder als nicht konsistent erlebt werden (wie z.B. die Geheimnistuerei der Eltern gegenüber ihrem Sohn und die Absichten das Land zu verlassen, Ausreiseanträge zu stellen;
• sich als peinlich oder beschämend ereignet haben oder die den kulturellen Standards nicht angemessen waren (wie z.B. sexuell enthemmende Handlungen in öffentlichen Bädern oder in der S-Bahn)…trifft auf beschämende Erlebnisse zu;
• verleugnet oder verdrängt wurden (dies kann auch krankheitsbedingt durch eine schi-zophrene Psychose geschehen), da Teile des Bewusstseins, bestimmte Ereignisse nicht memoriert oder nicht abrufbar erinnert werden;
• einfach nicht zum beabsichtigten Thema des Erzählenden gehören.337
Die Eltern berichten über diese sehr schwierige und belastende Zeit, dass sie sich nicht gerne daran erinnern möchten. Jeder in der Familie wolle diese schreckliche, demütigende und beschämende Epoche, in der sie unter materieller Not litten und über Jahre der Willkür des politischen und polizeilichen Apparates ausgeliefert wa-ren, endlich abhaken und hinter sich bringen. Dies beziehe sich sowohl auf die ersten Jahre, als Hr. Grün in der Krippe betreut wurde, als auch auf die erste Schulklasse in der DDR, sowie auf die vielen Umzüge ab 1989, den gesamten Umbruch, ja, Zusam-menbruch des Regimes und schließlich auf die verzweifelte Suche des Vaters nach Arbeit und Beschäftigung. „In unserer alten Heimat waren wir schon lange Fremde, in der neu gewählten Heimat, waren wir plötzlich auch Fremde, …dass wir das Ge-fühl hatten, auch dazuzugehören, dauerte lange.“338
Hr. Grüns Erzählung beginnt gleich mit dem 9. Lebensjahr, gleichzeitig sind das die ersten Erinnerungen des Biographen an die Kindheit, die mit dem Eintritt in den Leis-tungssport einhergehen. Die lebensgeschichtliche Rekonstruktion der Phase seiner Kindheit assoziiert Hr. Grün ausschließlich mit dem Leistungssport Tischtennis. 1990 inzwischen in Stuttgart beheimatet („…dann sind wir letztendlich in Stuttgart gelan-det..“)339 überspringt Hr. Grün auch die Zeit in der Grundschule in einer anderen Großstadt Niedersachsens. In der Textsorte wechselt Hr. Grün in die Beschreibung. In weniger als einer Seite und 27 Zeilen handelt der Biograph im Folgenden gleich 14 Lebensjahre, also fast die Hälfte seines aktuellen Lebensalters ab. Vom 9 - 14. Lebensjahr sei er dann „sehr aktiv gewesen (…) habe das dann auch voll leistungs-mäßig gemacht, jeden Tag ins Training und so was alles und dann auch sehr erfolg-reich, also jede Menge Meisterschaften und so was alles (…) und dann wurde ich älter 15, 16 (..) ja, dann hat mich das nicht mehr so interessiert mit Sport, dann kamen Mädels und andere Gedanken, die man so hat als Jugendlicher(....) ja und und auch
337 Rosenthal, G. (1995): Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbst-beschreibungen. Frankfurt/M. (u.a.) Campus Verlag. 338 Telefonat des Autors mit den Eltern von Hrn. Grün am 22.12.2012 339 Interview I: Hr. Grün, S.: 1; Zeile: 18-19.
199
die ersten Erfahrungen mit Alkohol, Zigaretten und so diese Sachen (..) abends weg-gehen (..) dann habe ich mit dem Sport halt aufgehört, also nicht mehr so aktiv ge-spielt(..) eigentlich abrupt irgendwie.“340
Mädchen kennenlernen, Alkohol trinken, Zigaretten rauchen, in Discos ausgehen „und so diese Sachen(…) ich bin ein lebenslustiger Mensch (…) im Nachhinein ..da kann man schnell hineinrutschen wenn man jung ist“341 führt Hr. Grün als Rechtfer-tigung und Begründung innerhalb der narrativen Selbstdarstellung an, als sei das für einen 15 Jährigen üblich, weshalb er abrupt mit dem erfolgreichen Tischtennisspiel aufgehört hat und sich fortan anderen Lebensschwerpunkten widmete.
Hr. Grün weist an dieser Stelle des Argumentierens auf eine Auseinandersetzung hin, die seinen Vorstellungen, Erfahrungen und Erwartungen entsprechen. Hr. Grün er-weckt den Eindruck, als wolle er sich für die Verlagerung seiner Interessen und die schulischen Leistungseinbußen entschuldigen, andererseits gibt er auch Aufschluss über seine moralische und kognitive Auseinandersetzung mit seiner Lebensge-schichte und betrachtet diese neuerliche Entwicklung, sein Handlungsspektrum, als unproblematisch. Ähnlich wie in der klassischen Musik (vorwiegend in Musikdramen oder Sinfonien anzutreffen) taucht dieses Leitthema erstmals auf und findet in unter-schiedlichen Präsentationskontexten eine kontinuierliche Fortsetzung des Erzählers bis zum Ende seiner lebensgeschichtlichen Darstellung.
Unter der diffusen und bedeutungsschweren Formulierung „und so diese Sachen…“ kann davon ausgegangen werden, dass Hr. Grün schon zu diesem Zeitpunkt einen regelmäßigen Cannabisabusus inmitten der neuen Peers pflegte. Auffallend ist, dass er sich in der Lebensspanne vom 9.-18. Lebensjahr, konstant um 1-2 Jahre in der Erinnerung seiner lebenszeitlichen Einordnung verrechnet. Die plötzliche Schulver-weigerung, der Leistungsabfall in der Hauptschule, das regelmäßige und hochdosierte Kiffen342 mit den Peers oder die andauernde Konfrontation und der mühsame Kon-flikt mit dem Vater und dass das Jugendamt und die Polizei immer wieder auf den Plan treten, erwähnt Hr. Grün im 1. Interview gar nicht. Im 2. Interview räumt er im Sinne einer Beschreibung marginal, eher beiläufig, in einem verharmlosenden und bagatellisierenden Sinne, diese Ereignisse ein. Hr. Grün will dieses Feld nicht weiter ausführen.
Der Sprung und das Leistungsgefälle von der Schülerklasse im Tischtennis im 14. bzw. 15. Lebensjahr in die Jugend sind sehr groß. Die zwangsläufigen Misserfolge für Hrn. Grün und die ersten bitteren Niederlagen könnten einen weiteren Grund dar-stellen, die Hrn. Grün demotivierte und so die spätere Diagnose eines Versagenssyn-droms (depressiv-asthenische Persönlichkeit), im Sinne eines langanhaltenden Pro-zesses, eines Vorschwelens, nach und nach, aufschichtet.
340 Interview I: Hr. Grün, S.: 2, Zeile: 26-40. 341 Interview I: Hr. Grün, S.: 8, Zeile: 200-212. 342 Zusammenhang von THC Konsum als psychoseauslösendes Rauschmittel auf eine schizophrene Erkran-kung: siehe Wuensch, S. (2010): Hasch macht lasch aber alles kann gut werden oder Gefühle, die vernichten, suchen Opiate, die es richten. In: Psychose und Sucht. Sadowski, H. und Niestrat, F. (Hg). Psychiatrie Verlag. Bonn, S.:184-195.
200
Mit „Weil ich wollt halt andere Sachen machen…“ zielt der Biograph auf eine Ab-grenzung gegenüber der Leistungsidentität und Erwartungshaltung der Eltern ab und stellt eine trotzige Botschaft zur Selbstbehauptung und Provokation gegenüber den Eltern dar. Der Vater fordert und treibt seinen Sohn im Leistungssport an, er begleitet ihn von Turnier zu Turnier und lebt Disziplin, Fleiß und Leistungswillen vor. Der Aspekt der Leistungsbereitschaft und einer vollständigen Fokussierung auf den Hochleistungssport nehmen zunehmend Raum ein. Durch ein abruptes Abwenden von den Herausforderungen des Leistungssports, dem gegenseitigen Sich-Messen und der Wettbewerbssituation, versagte Hrn. Grün sowohl die Möglichkeit, sich im Wettbewerb zu stellen und zu messen, als auch die Bestätigung, das Lob, die Aner-kennung und den Zuspruch zu erhalten, den er als talentierter und begabter Sportler sicher weiter geerntet hätte.
Er entzog sich dem Erfahrungsraum, entweder als Sieger hervorzugehen oder aber eine Niederlage zu kassieren. Er entzog sich selbst den Erfahrungen, und entzog gleichzeitig dem Vater, anerkennende und bestätigende Erfahrungen durch ihn selbst zu erleben.
Hrn. Grüns schulische Leistungen blieben, angesichts des in der Familie bestehenden hohen Bildungsstandes, selbst bei optimalen und fokussierten Rahmenbedingungen, vermutlich weit unter seinen Möglichkeiten. Die großen schulischen Probleme, an-wesend zu sein, zu lernen, sich zu konzentrieren, Hausaufgaben erledigen, lässt der Biograph unerwähnt und akzentuiert stattdessen, dass er „fast eine 1 in Englisch be-kommen hätte“ und dass Englisch das einzige Fach gewesen sei, in dem er Spaß hatte. Aus Hrn. Grüns Perspektive ist zu erfahren, „es ging eigentlich locker für mich, Hauptschule mit 2,9 recht gut ausgefallen, hatte keine großartigen Probleme, (.) hab auch nicht viel gelernt„343.
Bereits in dieser Lebensphase, vom 15.-18. Lebensjahr, hat eine initialisierende Pro-dromalphase gewirkt, die sich zu einem späteren Zeitpunkt zu einer schizophrenen Psychose, vorrangig durch eine Minussymptomatik gekennzeichnet,344 fort- und wei-terentwickelt hat.
Seinen 18. Geburtstag verbringt Hrn. Grün bei einem Freund, trinkend und kiffend. Der Biograph nimmt im Verlauf des Abends eine Überdosis Tabletten zu sich („er habe nur Spaß gemacht“). Der Freund alarmierte die Polizei und es kommt zum ers-ten psychiatrischen Klinikaufenthalt. Hr. Grün erklärte dieses Ereignis folgenderma-ßen:„ Ja, damals hab ich nen Witz gemacht, ich hab gesagt, ich habe Tabletten ge-nommen, (….) so jetzt sterbe ich bald und so (lacht) wegen der verhauenen Prüfung in der Berufsschule (…) hab mich um nichts mehr gekümmert..sozial totales Desaster (..) Familie, Freundin, Freunde - ich wollte das auch nicht richtig wahrhaben..aber ich wollt meinen Freund nur verarschen, ja und der hat dann nen Krankenwagen gerufen und so was alles, das haben die mir dann auch ausgelegt, dass ich mir das
343 Interview 1. Hr. Grün, S.: 2, Zeile: 45-47 und Interview 2. S. 17-18, Zeile: 458-506. 344 Definition: Minussymptomatik; vorwiegend den Antrieb, die kognitiven Leistungen, die Motivation be-treffend, grundsätzlich eher depressiv-gedrückte Stimmung, bei Schlafstörungen und Beeinträchtigungen der emotionalen Ausdrucksfähigkeit sowie der Selbstorganisation.
201
Leben nehmen wollte (..) war totale Schwachsinn, ja (..) da hab ich die Leute so ein bisschen verarscht (..) so“345.
Hr. Grün berichtet in seiner Erzählung weder von Kindheitserinnerungen, von Anek-doten oder Erlebnissen mit Gleichaltrigen, noch von anderen Geschehnissen, Buben-streichen etc., die im Kindergarten oder in der Grundschulzeit stattgefunden haben. Er spart Erzählungen mit den Eltern, den Stiefschwestern, bei den Ferien oder im Urlaub vollständig aus. Selbst die Erlebnisse beim Tischtennis, von den vielen Um-zügen, sich immer wieder in die Klasse integrieren zu müssen, neue Freuden kennen-zulernen, bleiben unerwähnt und werden ausgelassen.
b. Von der Ausbildung bis zur Verurteilung und Behandlung im Maßregelvollzug
Nun folgt eine über 22 Zeilen hinweg andauernde, narrative Selbstdarstellung, in der er einen Erklärungs- und Deutungsversuch unternimmt, weshalb er die anschließende Lehre zum Fliesenleger („eigentlich viel Spaß gemacht hat, aber sehr anstrengend“) beendet hat, daran scheiterte bzw. der Ausbildungsvertrag gekündigt wurde. Hr. Grün hatte Probleme mit der Praxis und in der Folge die praktischen Prüfungen nicht be-standen. Die Frage blieb offen, ob die Lehrstelle der Wunsch von Hrn. Grün selbst war oder ob diese Auswahl und Entscheidung von den Eltern getroffen wurde, weil er bei der Ausbildungssuche nicht aktiv und engagiert war. Die feinmotorischen Handfertigkeiten, die sich Hr. Grün durch das jahrelange Tischtennisspiel angeeignet hatte, waren bei der Wahl und Eignung des Lehrberufs handlungsleitend.
Hrn. Grüns Darstellung entspricht der typischen Binnenstruktur der Narration, ent-sprechend leitet er zunächst die Erzählung (abstracts) mit dem Abschluss der Haupt-schule und der beruflichen Lehrstellenwahl ein. Nach dem Hauptschulabschluss mit der Gesamtnote befriedigend folgt nun eine Lehre. In der lebenszeitlichen Orientie-rung ist Hr. Grün im 16. Lebensjahr in einem Stadtteil Stuttgarts. …die Sache habe eigentlich viel Spaß gemacht…anderseits werde die Lehre als anstrengend bewertet. Hr. Grün bereitete seine Bühne vor, in der eine geraffte Erzählung sattfindet, die dra-maturgisch auf ein einschneidendes Ereignis vorbereitet. Dem täglichen Kiffen in der Berufsschule und Zuhause, folgten der Abbruch der Lehre und schließlich eine darauf anschließende erste Klinikeinweisung, welche einen vollständigen Zusammenbruch bedeutete. Dabei erwähnte Hr. Grün schon erste kriminelle Handlungen, die er im Zuge von Beschaffungskriminalität, begangen zu haben.
In der Coda erklärt schließlich der Biograph die eigentliche Ursache für den folgen-schweren Zusammenbruch, …das geschah, weil mich meine Eltern (…) haben mich mit 18 Jahren rausgeschmissen (2) im szenisches Präsens: „haben gesagt ja gut, wenn du nicht mehr arbeitest (.), ja (2) dann kannst du auch gleich gehen.346 An dieser Stelle der Präsentation stellt der Rauswurf der Eltern ein bedeutsames Moment dar, da Hr. Grün mit diesem konsequenten Verhalten nicht gerechnet hat.
Weiter gibt Hr. Grün an, er habe „nicht viel Geld verdient…am Anfang morgens den Blockunterricht verpasst, hatte zwei-drei Mal verschlafen, und da habe ich gedacht, ich pack das nicht mehr, (3) ich war auch auch in der Freizeit viel, ziemlich viel aktiv,
345 Interview 1, Hr. Grün: Teil 1.; S.:18-19, Zeile: 542-550. 346 Interview 1: Hr. Grün, S.: 4, Zeile 91-92.
202
ich habe damals mit 17 hab ich äh (2) angefangen Drogen zu nehmen und so (4), also gekifft (2) gekifft (2) Gras geraucht (2) ja ((abfallende Stimme)) ich habe das dann mit der Ausbildung nicht mehr so ganz (2) äh (2) hinbekommen, ja“.347((abfallende Stimme))
Die Frage der Verantwortlichkeit für das eigene Handeln und Tun sind aus dem Er-leben des Biographen den widrigen Rahmenbedingungen im Sinne einer Fremdattri-buierung entwickelt. Sowohl das frühe Aufstehen (schon nach dem 3. Mal Verschla-fen, gibt Hr. Grün auf!), der geringe Ausbildungslohn, der zunehmende Drogen-konsum, die Clique, die strengen Eltern, die darauf bestehen, dass er um 24 Uhr zu Hause ist, engen schließlich Hrn. Grüns Handlungsrepertoire derart ein, dass er „dann mehrere kriminelle Sachen macht“. In seinem Selbstverständnis wird er geradezu ge-sellschaftlich und finanziell genötigt, kriminell zu werden.
Aus der Sicht von Hrn. Grün ist es nur nachvollziehbar und selbstverständlich, dass der Staat für ihn aufzukommen, ihn zu versorgen habe. An anderer Stelle erwähnt er, dass er nur einen Teil der ALG II Leistungen erhalten habe. Damit habe er sich nicht ausreichend mit Nahrung versorgen können. Er unternimmt jedoch keine Schritte, eine Klärung wegen der fehlerhaften Berechnung mit dem Job-Center anzustreben. Er überlässt alles seinem Lauf, begibt sich passiv und schicksalhaft in einen biogra-phischen Prozess, auf den er geringen Einfluss ausübt. Den Teil an Einfluss, den er geltend macht, findet dann in einem deviant-kriminellen Handlungsrahmen statt.
Die erste Klinikeinweisung erfolgt, weil („irgendwie hatte ich die erste Einweisung in die Psychiatrie (.) wegen Drogen (.), weil meine Eltern mich mit damals mit 18 rausgeschmissen haben“ ((Stimme fällt ab))348
Aus der Perspektive des Biographen folgt nun eine Argumentation, in der er sich als Opfer sieht, sich in der Rolle auch profilieren kann. Aus der Perspektive des Opfers, eines Betroffenen, den die eigenen Eltern ausschließen, aus der Wohnung verweisen oder alternativ konsequente Bedingungen an das Mitwohnen artikulieren und einfor-dern. Erschwerend hinzu, kommen immer wieder auch schlechte Erfahrungen, die Hr. Grün mit Drogen (sogenannte Horrortrips, die die gewünschte Wirkung verfeh-len, dafür bedrohlich, angstauslösend, stimmungsdämpfend wirken) macht.
Hr. Grün hätte in der Erzählung auch aus der Gefühlswelt und Situation der Eltern heraus argumentieren und den Verlauf, mit dem Abstand von fast 10 Jahren, erklären können. Die Eltern sind im höchsten Maße besorgt um ihren einzigen Sohn, sie kom-men nicht an ihn heran, sie wissen weder ein noch aus, sie haben Angst um ihn, haben manchmal auch Angst vor ihm und Angst davor, was er macht oder machen könnte. Er ist im Verhalten, in der Begegnung unberechenbar, mal aggressiv, dann wider schwächlich, lethargisch und müde, er verbringt viel Zeit im Bett. Diese Erfahrungen und Wahrnehmungen bleiben alle unerwähnt.
Trotz einer optimalen pharmakologischen Einstellung mit einem atypischen Neuro-leptikum, kann sich Hr. Grün weder in die Lage der Eltern, noch in die emotional bedrohliche und besorgte Lage der Mitbewohner im Haus, die z.B. Angst vor einem
347 Interview 1: Hr. Grün: S.: 3, Zeile 66-76. 348 Interview 1. Hr. Grün, S.: 3-4, Zeile 80-92.
203
Brand haben, oder auch in die Perspektive der 21 geschädigten Opfer begeben, die in der Verhandlung am Landgericht aussagten. Er bleibt in seiner Erzählstruktur in dem Ich-Erleben egozentriert verhaftet.
Hr. Grün etikettiert vielmehr den Drogen und dem Alkohol die Verantwortung für seinen gesundheitlichen Satus-quo, er begründet damit die Vernachlässigung seiner körperlichen Pflege, das abnehmende Körpergewicht, den vermüllten Wohnraum, das sich Herauslösen der sozialen Kontakte, den sozialen Ausschluss. Doch gerade der frühe und intensive Drogenkonsum könnte die Psychose induziert bzw. ausgelöst haben. Vielleicht versuchte Hr. Grün sich selbst mit Drogen und Alkohol zu behan-deln, um die Stimmung, die Depressivität oder den Antrieb wenigstens für kurze Zeit zu beseitigen oder verschwinden zu lassen,
Hr. Grün führt weitere Gründe an, die sein Leben, sein Autonomiebedürfnis begren-zen, einschränken, den Radius einengen. Er habe „soziale Schwächen“, einen „sozi-alen Rückzug“ gezeigt. Begrifflichkeiten, der Biograph dem sozialpädagogisch-psy-chologischen Fachjargon entlehnt und zum Ausdruck bringen möchte, dass er viel im Bett lag, depressiv verstimmt war, „nicht mehr zugänglich, (.) auch mit meinen El-tern, hat sich entzweit, ich wollte mein eigenes Leben führen“. auch für die Eltern“ und somit letzten Vertrauten,“ … die habe ich nicht mehr verstehen wollen.“ Hr. Grün leistete Widerstand, versuchte sich von seinen Eltern abzugrenzen, er versuchte sich aus deren Gesichtsfeld zu entziehen, zu befreien. Von der Suchtberatungsstelle dringend empfohlen, verweisen ihn die Eltern jedoch der Wohnung, wofür Hr. Grün einerseits Unverständnis zeigt, auf der anderen Seite versorgen sie ihn weiterhin mit Essen und Trinken. Sie kümmern sich zudem um die Wohnraumpflege des Apparte-ments.
Beim ersten Versuch einer räumlichen Ablösung aus dem elterlichen Haus scheitert Hr. Grün. Die erste eigene Wohnung und die damit verbundenen Anforderungen be-wertet Hr. Grün eher als Last, als Anlass von Überforderung, er sieht keine Bereiche-rung, keinen potentiellen Entwicklungsraum für sich. „Dieser Schritt sei zu früh ge-kommen, er sei zu jung gewesen, habe keinen guten Eindruck gemacht (…) hab das noch nicht begriffen, mit den ganzen Fähigkeiten“, die erworben, trainiert, geübt und somit benötigt und abgerufen werden müssen, um alleine zu wohnen, sich selbst zu versorgen.“349.
Die sukzessive und schleichende Entfremdung vor sich selbst und gegenüber der Um-welt ist ein bedeutsames Kernsymptom eines psychotischen Krankheitsverlaufs. Der Betroffene nimmt wahr, ahnt, dass sich die Umwelt, die Menschen seines sozialen Nahraums, die räumliche Umgebung selbst, die zeitliche Strukturen verzerren und verändern. Auf Hilfestellungen reagiert er mit Misstrauen, Gereiztheit und Aggressi-vität. Selbst die letzten Vertrauenspersonen, die eigenen Eltern, geraten in Hrn. Grüns Wahrnehmung in einen Prozess der Entfremdung, eines allmählichen Fremd-Wer-dens. Die gut gemeinten Intentionen und besorgten Motive der Eltern kann Hr. Grün nicht mehr erkennen, er missdeutet diese, interpretiert sie schließlich ins Verkehrte.
349 Interview 1: Hr. Grün, S.: 4, Zeile 92-116.
204
Die Eltern bekommen zunehmend Angst, stehen im Konflikt zwischen Helfen und sich abgrenzen.
Es kommt zur Klinikbehandlung gegen seinen Willen. Die erste Klinikbehandlung anlässlich des 18. Geburtstages, den er mit seinem Freund feierte und „nur so zum Spaß“ eine Überdosis Tabletten einnahm, „und der Freund überreagierte und den Notruf absetzte“, erwähnt Hr. Grün erst bei Nachfragen im 2. Interview.
Gerade so, als sei von fremder Hand ein Autoprogramm des eigenen biographischen Werdegangs gestartet worden, setzt Hr. Grün seine Erzählung mit dem Rollenstatus „Opfer“ fort und rechtfertigt die weiteren Geschehnisse, Handlungen, Entscheidun-gen und Urteile, die nun auf ihn warten und unaufhaltbar folgen. Hr. Grün beklagt und beschwert sich darüber, dass er auf die Gerichtsverhandlung am Landgericht in unzumutbarer Weise warten musste. Für den Biographen war das Urteil letztendlich zu hart ausgefallen. Während er selbst auf eine Bewährungsstrafe hoffte („Sozialstun-den und eine Bewährungsstrafe wurden ja schon einmal ausgesprochen!“), räumte er jedoch dem Vorsitzenden des Gerichts verständnisvoll ein, dass es „für den Richter selbst wohl das Beste war, sein Verhalten zu unterbinden, (.) mich einzusperren.“350
Hr. Grün schweigt in der weiteren Erzählung über die begangenen Taten, die er in den letzten Jahren vor der Heimaufnahme begangen hat. Lediglich von einer Straftat, nämlich räuberische Erpressung, berichtete Hr. Grün….„hab das als Spaß gese-hen…Scheiß gemacht-…hab gesagt, Junge gib das Geld her. Und bei Gericht war das dann gleich räuberische Erpressung…“351 Die übrigen Anklagepunkte (Dieb-stahl, mittel- und schwere Körperverletzung in mehreren Fällen, Nötigung, Verstoß gegen das BtMG etc.) erwähnt Hr. Grün nicht.
Der Biograph sieht sich als Opfer und anerkennt gleichzeitig nicht die Rolle derjeni-gen, die unter seinem Verhalten, auf der Straße, die eigentlichen Opfer waren. Die Fähigkeit, sich in das Seelenleben und die Gefühlslage der Opfer einzufühlen, nach-zuempfinden, wie diese die Taten erlebt haben, was diese emotional aber auch phy-sisch durchlebt haben, ist beim Biographen wenig entwickelt. Wie könnte es für eine junge Frau sein, wenn sie am Abend am Fahrkartenautomat von Hr. Grün mit einem Kickboxsprung verletzt wird, weil sie nicht sofort Geld herausrückt?
Die Erklärung der Mutter zu den Straftaten lautete. „Unser Sohn war ebene überfor-dert, (..) der war fremdaggressiv weil er zu wenig Geld hatte(…) er ist Tischtennis-spieler und weiß um die Dosierung der Schläge mit seiner Hand. Er hat das in der Heftigkeit steuern und kontrollieren können. Wenn er hätte wollen, wären die Verlet-zungen auch stärker ausgefallen. Das muss man auch mal sagen.“352
Der Biograph verweigerte sich in den ersten zwei Jahren im Maßregelvollzug konse-quent und beharrlich, die Behandlungsangebote anzunehmen. Es kam in der Zeit zu mehreren Entweichungen und Polizeieinsätzen, die ihn zurückführten, doch „nach nem Jahr (.) oder zwei Jahren hab ich mich dann ganz gut angestellt (…) eigentlich
350 Interview 1: Hr. Grün, S.: 5, Zeile 130-146. 351 Interview 1: Hr. Grün, S.: 4, Zeile 116-129. 352 Erinnerungsprotokoll aus einem Telefonat mit den Eltern am 23.12. 2013: Forschungsbuch. K. Masanz
205
(.) also Therapie mitgemacht, die anderen Sachen und hatte da richtig ne Vorstel-lung(.) ja (.) wieder draußen Fuß zu fassen (..) auch ohne Drogen! Da war ich zwei Jahre abstinent (hustet) (.) das haben die auch gesehen (.) haben gesagt, ha ja dann dann schafft er das auch draußen (.), ja (ja) dann kann man ihm was Adäquates an-bieten.“353
Die Phase des Maßregelvollzugs, sowie die beide Gerichtsverhandlungen 2000 und 2013 nehmen quantitativ einen sehr großen Anteil in den beiden Interviews ein. Sie werden in der Textsorte Narration bzw. als Erzählungen vorgetragen, im szenischen Präsens erinnert sich der Biograph detailliert an die die Worte des Richters. Ein wei-teres signifikantes, weil umfassendes Feld, breitet der Biograph zum Thema Ablö-sungsprozess aus, sowie seine mehrfachen vergeblichen und anstrengenden Versu-chen, sich vom Elternhaus abzulösen. Hier trägt er vielfältige Gründe vor, warum ihm das nicht gelungen ist, ja, nicht gelingen konnte und wer oder was ihn daran gehindert und beeinträchtigt habe und somit verantwortlich war. Der Biograph verbringt zudem viel Zeit und Energie in der Auseinandersetzung mit der Etikettierungen -Minus-symptomatik- und einem diagnostizierten -Versagenssyndrom-, die im Rahmen der ersten schizophrenen Erkrankungsphase artikuliert wurden.
6.1.6. Hypothesenbildung zum erzählten Leben
Der Biograph ließ die ersten acht Lebensjahre vollständig aus seiner Erzählung aus und stieg erst mit dem Eintritt in die 2. Grundschulklasse und der endgültigen Nie-derlassung im Wohnort Stuttgart ein. „In Erinnerung (…)? weiß ich nichts besonders eigentlich. Nee (bestimmt).“354 Die zeitliche Epoche, die er als Leistungssportler vom 8.-14. Lebensjahr verbrachte, streifte der Biograph nur marginal. Es ist davon auszu-gehen, dass der Biograph bis zum 9. Lebensjahr nur über wenige und fragmentierte Erinnerungen an die Zeit vor und während der Ausreise verfügt.
Weitere Themen ließ der Biograph ebenso aus, wie z.B. die jahrelangen und schwer-wiegenden Konflikte mit den Eltern, das Leben auf der Straße, die Jahre im MRV, die vielzähligen psychiatrischen Unterbringungen sowie der zweite gescheiterte Ver-such, sich im eigenen Wohnraum, gemeinsam mit der Freundin, zu behaupten.
Die Motive des Biographen für die Auslassungen bzw. das Ausgelassene355, ohne dabei eine absichtsvolle oder bewusste Handlung zu unterstellen und die Bestandteile des aus der Erinnerung Auftauchenden darstellen, resultieren entweder daraus, dass sie entweder:
- nicht in die Geschichte eingebettet werden können, da sie nicht verstanden bzw. als inkonsistent erlebt werden, (wie z.B. die zahlreichen Unterbringungen, die infolge von Eigen- oder Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik erfolgten; das kon-sequente Verhalten der Eltern, dem Biographen kein Geld und dafür Lebensmittel oder Kleider; sowie die Strafanzeige der Partnerin des Biographen wegen Stalkings und Bedrohung);
353 Interview Hr. Grün: Teil 1, S.: 6, Zeile 156-163. 354 Interview 1, Hr. Grün. Teil 2. S. 2, Zeile: 25-31. 355 a.a.O. Rosenthal, G. (1995), S.: 90.
206
- mit Peinlichkeit und Scham behaftet sind bzw. den kulturellen Standards nicht ent-sprachen, (siehe ernsthafte Suizidversuche, verwahrloster Wohnraum mit Brandfle-cken und Ungeziefer, körperliche Vernachlässigung, Überforderung in der Woh-nung, die Eltern versorgen den Biographen mit Essen, sie versuchen seine Wohnung zu putzen, Hausverbot in allen städtischen Bäderbetreiben und auch im Saunabe-reich);
- die verleugnet und verdrängt wurden, (wie z.B. enthemmtes Verhalten im öffentli-chen Raum, vollständige Überforderungen, den alltagspraktischen Anforderungen und Aufgaben des eigenen Wohnraums, Eigengefährdung durch starkes Unterge-wicht und Mangelversorgung; als selbst ernannter Prophet zog er durch die Stadt und forderte Passanten auf: „Kniet nieder, ich muss euch enthaupten!“);
- nicht zum intendierten Thema des Erzählenden gehören, wie z.B. über die ersten zwei Jahre im MRV zu berichten; über die starke Angst und das Vermeidungsverhal-ten im beruflichen Bereich zu sprechen, erneut zu scheitern oder den Anforderungen, wie so oft, nicht gerecht zu werden.
SCHÜTZE (1987) berichtet von individuellen wie auch kollektiv erfahrenen, bedrü-ckenden Ereignissen, wie z.B. der Verlust eines Freundes oder einer Freundin oder die Folgen einer Naturkatastrophe, in denen der Schmerz „derartig einschneidend und hartnäckig sein kann, dass der Betroffene nicht mehr daran denken mag und thema-tische Ausblendungen, teils Verdrängungen entsprechender Erinnerungsbestände in seinem gegenwärtigen Orientierungshorizont vornimmt“ 356.
Trotz der schambesetzten und peinlichen Themen spricht sie der Biograph in den Interviews an und umrahmt seine Äußerungen mit verharmlosenden, verniedlichen-den und bagatellisierenden Konnotationen. „Die Wohnung war nicht mehr ganz tippi toppi“ ..“dann hab ich Gras geraucht und hab das dann mit der Ausbildung nicht mehr so ganz ähm. ..hinbekommen (…) bis auf die Psychose fühle ich mich doch, ganz gut soweit.357“ Durchgängig beklagt, beschwert, kritisiert und bemängelt der Biograph, dass ihn die Eltern in seiner Freiheit, in seinem Willen, in seinen Wünschen und Interessen bevormunden und entmündigen. Das Gericht, der MRV, die Psychi-atrie, der gesetzliche Betreuer, die geschlossen Einrichtung setzen die begrenzten Rahmenbedingungen, fremdbestimmte Grenzen, Abläufe und Hausordnungen vor. Die Eltern werden ebenso in ihrer persönlichen, beruflichen und örtlichen Freiheit beschränkt, begrenzt und schließlich daran gehindert. Der Biograph präsentiert sich fremdbestimmt, passiv, aushaltend, erduldend wie das auch die Eltern durch den Staat, die Staatssicherheit, das Gefängnis, durch ein Ausreise- und Berufsverbot, er-lebt haben. Sie mussten sich ebenso über Jahre fügen.
Der Biograph beginnt seine Erzählung erst mit dem Zeitpunkt „im Westen gelandet und gleichzeitig hab ich mit meiner sportlichen Laufbahn begonnen!“
Auch die Folgen und Auswirkungen des Sports verharmlost der Biograph, einerseits bleibt ihm keine Zeit mehr, der Sport, der Trainer, die Mannschaft verfügen ebenso
356 Schütze, F. (1987): Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien. Studienbrief der Universität Hagen. Teil 1 Hagen, S.: 211. 357 Interview 1, Hr. Grün. S.: 3 Zeile: 72-77.
207
über ihn. Andererseits ist der Leistungssport ein Ort, an dem er Anerkennung, Bestä-tigung, ebenso Struktur und Sicherheit angeboten bekommt! Der Leistungssport do-minierte vollständig über den Tagesablauf von seiner Kindheit bis zur Pubertät, bis zum 14. Lebensjahr.
Mit der Pubertät beginnt er einen eigenen Willen, eben andere Interessen (z.B. Mä-dels, weggehen, Disko, Alkohol, kiffen, Musik, Drogen ausprobieren..) zu artikulie-ren. Das, was er tut, muss Spaß machen, er ist rasch demotivierte und verliert das Interesse, und den Ehrgeiz…dann habe er das Leben außerhalb des TT Leistungs-sports entdeckt und verlagert seine Energie in die Freizeit satt in Sport, Schule oder Lehre.
Schließlich dominiert und beherrscht den Biographen der Drogenkonsum, das Be-schaffen von Geld für Drogen, er zieht sich zurück, ist isoliert, er hat nur noch Kon-takte mit dem Milieu.
Ab der 1. Klinikeinweisung, die gegen seinen Willen erfolgte, präsentiert sich der Biograph enttäuscht, als Opfer, der in die Enge getrieben wurde, der nicht anders kann als zu stehlen und sich das holen muss, was er zum Leben benötigt. Er präsen-tiert sich als egozentrisch, er präsentiert sich anders, als er es gegenüber seiner Kind-heit und Jugend tut, er präsentiert sich als ein verlassener und gefühlsarmer und we-niger empathischer Mensch, der sich in die Perspektive seiner Opfer nicht hineinversetzen kann und will. „Hätten sie mir Geld gegeben, hätte ich keine Gewalt anwenden müssen! Ich hatte schließlich Hunger und Durst! (...) wenn die da vom Cannstatter Wasen kommen und dumm mich anlabern!“
Der Biograph geht selbstredend davon aus, dass seine Eltern, die Gesellschaft ihn zu versorgen, zu unterhalten habe. Er gesteht sich ein, frustriert und enttäuscht zu sein, seine Selbstbestimmung verloren zu haben und so sein Verhalten, das aus Widerstand und Verweigerungen bestand, durch die Ablehnung zu kompensieren.
Der Biograph hebt immer wieder hervor, er habe alles im Griff, er könne, wenn er wolle. Bei Druck erreiche man bei ihm nichts.
Er bewegt sich innerhalb eines ambivalenten Selbstverständnisses von überschätzen-der Selbstwirksamkeit, Kompetenz und einem Unverständnis und einer Nichtnach-vollziehbarkeit der sozialen Umwelt gegenüber, die sich besorgt zeigt, die ihn vor sich selbst schützen will. Alleine stellt sich der Biograph hilflos, überfordert, bedürf-tig dar und gleichzeitig versteht er die Anliegen und Konsequenzen seiner Umwelt nicht. Der Biograph erhebt Ansprüche und leistet im selben Moment Widerstand, er gibt seine Haltung und Einschätzung, seine Bewältigungsstrategien nicht auf.
Der Biograph berichtet zum 2. Mal vom Scheitern, sich in seinem Wohnraum zu be-haupten. Er sehne sich danach, sich vom Elternhaus abzulösen, doch man lasse es nicht zu. Der anhaltende Konflikt mit den Eltern, insbesondere der mit seinem Vater, steht im Mittelpunkt seines Berichtes, bis er zum Thema und der Episode des Maß-regelvollzugs übergeht.
Der Biograph verweigert, sich weiterzuentwickeln, er verweigert Änderungen anzu-nehmen, er stellt sich als jemand dar, der keine eigene Willensprüfung vornehmen
208
kann, der als Mitläufer fungiert. Er will und tut schließlich das, wozu die Peers ihn verführen. Als sei sein Leben ein einziger großer Spaß, das er nicht kontrollieren, auf das er keinen Einfluss haben könne.
Er präsentiert einen Ursachenkatalog dafür, weshalb er erneut gescheitert ist: Ich hatte kein Geld, musste betteln, musste bei Passanten massiv Geld abdrücken, ich hatte Hobbies, die wollte ich leben. Der Biograph berichtete diffus von sozialen Schwierigkeiten mit Nachbarn, den Eltern. Er habe Grundbedürfnisse, Durst und Hunger, dann musste er eben stehlen.
So präsentiert sich der Biograph als jemand, der umgehend seine Bedürfnisse befrie-digt haben möchte, der sich nicht kontrollieren, seine Hilfe nicht strukturieren kann, der keine Hilfe einholt, sie nicht zulässt, sich seinem Schicksal ausgeliefert fühlt und in einem selbstwirksamen Sinne, sich das von der Gesellschaft holen muss, was ihm, seiner Meinung nach, zusteht.
Biograph präsentiert sich als jemand, der sich von den Passanten auf der Straße pro-voziert fühlt, die ihn abweisen und er sich abgewertet und stigmatisiert vorkommt. „Wenn die mir dumm gekommen sind, (…) mit blöden Sprüchen regiert, bin ich eben aggressiv geworden.“ Schließlich versiegte ja die Geldquelle der Eltern, sein PC sei kaputt gewesen, er habe Elektrogeräte und das Fahrrad versilbern müssen, die Gitarre wurde auch noch geklaut, und er wollte doch so gerne Musik auf der Straße machen. Der Biograph resümierte diese Zeitspanne mit den Worten:“ In der Zeit war ich also nicht so gut drauf, meistens!“ Quelle! Weitere Ausführungen klammerte Hr. Grün aus, diese wurden dann in vollem Umfang und Ausmaß erst in der 2. LG Verhandlung evident und offen gelegt, als die Opfer und Zeugen zu Gericht aussagten.
Hier präsentiert sich der Biograph als jemand, der auf einen milden Richter hofft, der Bewährung ausspricht, der sein Verhalten aber zu verurteilen habe. „Das macht man doch net!“ Es ist so, als stelle sich Hr. Grün eine Art Freifahrtschein für seine krimi-nellen Handlungen aus, niemand könne ihn belangen oder zur Verantwortung ziehen, „er habe eh kein Geld…ein großer Supermarkt verkraftet es, wenn er darin klauen geht.“
Die Eltern beschreibt der Biograph zum einen als fürsorglich, be- und umsorgend, ängstlich, so die Zuschreibung der Mutter, zum anderen aber auch streng fordernd, ehrgeizig, stets zur Mäßigung ermahnend, nicht aufzufallen, sich besser anzupassen, die Zuschreibung des Vaters. Weiter präsentiert sich der Biograph als jemand, der gerade dagegen rebelliert und revoltiert habe, er wollte ausbrechen, sich von den El-tern abgrenzen, alles sei ihm zu eng geworden, zu fürsorglich, er habe keine Luft bekommen, man habe ihm auch nichts zugetraut. Er konnte weder eigene Erfahrun-gen machen, noch sich entwickeln. Trotz aller Kritik kann der Biograph die Leistun-gen seiner Eltern, gerade wegen der widrigen Umstände (Flucht aus DDR) anerken-nen, dennoch bedauert er, er habe sich als Kind und Jugendlicher allein gelassen gefühlt.
Der Biograph beschreibt die Eltern insgesamt als jemand, auf die er immer bauen konnte, auf die er sich verlassen konnte, die heute eine enge Beziehung zu ihm führen.
209
Trotz der langen und weiten Wege zu den Einrichtungen haben sie ihn besucht, an-gerufen und mit den Einrichtungen kooperiert. Der Biograph bleibt in der Erzählung über die Eltern im Unsicheren und im Zweifel, ob sie die verbindende Beziehung bestätigen und ebenso beschreiben würden?
Die Motive für den Rückzug der Eltern bleiben beim Biograph im Vagen und Unkla-ren, er erklärt vielmehr, welche Folgen und Auswirkungen der Rückzug für ihn hat-ten, die schließlich zu den Straftaten führten: „…weit weg, die waren an der Landes-grenze….und ich hab halt Brot für essen, also was zum Essen, gebraucht und so was alles, da musste ich selber schauen, wie ich da klar kam,…und das ging auch bis auf die Straftaten eigentlich ganz gut.“ Er habe zugleich die Sorgen und Ängste seiner Eltern wahrgenommen.
Der Biograph präsentiert sich als jemand, der aus einem gut bürgerlichen Haushalt und einer Familie mit Akademikern entstammt, die stabil, ehrgeizig und jähzornig sind (lacht dabei) und die beruflich mit Psychiatrie zu tun haben. „Ich pass da direkt rein (lacht nicht mehr) kann man sagen. Ja, bloß in einer anderen Rolle. Ja, bloß in anderen Rolle, genau!“ 358
Der Biograph präsentiert sich als jemand, der sich entweder zu 100% einsetzt oder gar nicht, so bringe eine Trainingseinheit pro Woche im TT nichts. Bis zu seinem 14 Lbj. sei er höchst diszipliniert, leistungsbereit, willig und ehrgeizig gewesen, er be-schreibt sich heute als jemand, der als junger Mensch die Folgen seines Tuns nicht überblicken konnte, der in dieser Zeit die Schule nicht ernst nahm, der sich voll und ganz in die neue Clique begibt, dort auf Ältere stößt, von ihnen den Umgang mit Drogen erlernte und damit beliefert wurde. Er war voll begeistert für diese Welt und habe sich von seiner bisherigen losgelöst, sei grenzenlos gewesen, habe gekifft bis zur Bewusstlosigkeit. Er habe dann auch das Kiffen richtig exzessiv gemacht. Voll und ganz oder gar nicht. Der heute gesetzte und älter gewordene Biograph, kann die Konsequenzen absehen. Er will clean und straffrei bleiben, angesichts der Jahre, die ihm noch verbleiben. Damals haben die Drogen den Takt seines Lebens vorgegeben.
Der Biograph berichtet fasziniert und noch immer begeistert von den Drogenerfah-rungen, durch die er eigene Erfahrungen machen konnte, durch die er sich selbst spürte, wahrnahm, erstmals in Resonanz geriet. Der Biograph präsentiert sich in die-ser Zeit als jemand, der aufgeregt und erregt war, der unruhig und sehr aktiv war und mit den Drogen auch Beruhigung suchte. Er sehnte sich nach Gelassenheit und inne-rer Ruhe. Der Biograph berichtete auch über sich, als jemand, der aggressiv und für die Gesellschaft sicher gefährlich war, der in sich gespalten war, zwei Seiten hatte, sich körperlich und seelisch vernachlässigte und sich enthemmt zeigte.
Er berichtete zwiespältig über die guten und negativen Erfahrungen und Folgen durch Drogenkonsum, (Horrortrips, Stimmenhören, die Identität löste sich auf) dennoch wollte er die Konsequenzen am eigenen Leib erfahren, ausprobieren, einfach experi-mentieren.
Die Verantwortung für seinen hohen Drogenkonsum überträgt er an die Kifferclique, „die waren halt so extrem, was Drogen angeht“ die Folgen sind ihm bewusst. Die 358 Interview 1, Teil 1, Hr. Grün. S.: 22, Zeile: 600-623.
210
Beziehung, die Bindung zu den Eltern, zu den Schwestern ging kaputt. Die Droge machte sein Leben kaputt, auch seinen Lebenswillen, er habe sich selbst damit ge-schädigt, so die generierte Erkenntnis des Biographen aus heutiger Sicht.
Mit schulischen oder beruflichen Niederlagen, so präsentiert sich der Biograph, sei er gekränkt und autoaggressiv umgegangen. Er habe sich nach einer verhauenen Klausur aus Spaß mit einer Tablettenüberdosis vergiften wollen. Als dann sein Freund die Rettung rief, unterstellte er dem Freund, dem Arzt, der eine Unterbringung in der Psychiatrie befürwortet, überreagiert zu haben. Bei der Erzählung dieser Schlüsselszene, im szenischen Präsenz, wird deutlich, dass sich der Biograph nicht annähernd in die Situation und in die beteiligten Personen empathisch hineinverset-zen konnte.
Von einem konsequenten, abstinenten Konsum von Drogen kann sich der Biograph in der Selbstpräsentation nicht eindeutig distanzieren. Nur durch die institutionellen Strukturen wurde der Konsum von außen verhindert. Die Motivation beim Biogra-phen selbst bleibt uneindeutig (…) 1. „Is es ja illegal“, 2. „ist es vielleicht für die Gesundheit (…) vielleicht(..) in Mitleidenschaft gezogen (…) 3. „draußen gibt es nur Ärger und Stress, wenn man konsumiert.“ Zugleich gibt der Biograph bekannt, er habe „ja in den letzten Jahren lediglich nicht so häufig und nicht mehr so viel gekifft wie früher“, und gibt damit zu, mit dem Kiffen nie ernsthaft aufgehört zu haben, oder je aufhören zu wollen.
Über die Zeit der Maßregel präsentiert sich der Biograph als Patient, der sich bestens entwickelt habe, schnell durch alle Ausgangsstufen durchgewandert sei, der auf sein diszipliniertes und kooperatives Verhalten stolz sei und der nach Anerkennung und Bestätigung suche bzw. sich selbstbewusst gibt, „..unglaublich, wie ich das so hinge-kriegt habe, also fast schon perfekt(…) kann mans sagen.“
Der Biograph präsentiert sich als jemand, der im Maßregelvollzug seine alten Eigen-schaften abrufen konnte. Er sei dort ehrgeizig und diszipliniert gewesen. „jeden Tag Fitness gemacht“. Er präsentiert sich als jemand, der theoretisch weiß, was für seine Gesundheit auch in Zukunft förderlich sein kann: „Struktur, (..) vielleicht bisschen Arbeit, den Hobbys nachgehen und soziale Kontakte“.
Zur Prognose stellt der Biograph fest, er habe wenige Ziele für die Zukunft, der genau abwägt, wieviel Engagement er investieren will, sich selbst eine gute und optimisti-sche Prognose gibt, die von seiner Mutter unterstützt wird, die sagt: „mit 30 müsstest du es eigentlich im Griff haben, da dürfte nicht mehr so viel passieren.“ Zu den De-likten präsentierte sich Hr. Grün, dass sie ihm nachgehen, zumindest „ging mir das schon zur Last irgendwie“. Die juristischen Bewertungen, gutachterlichen Beschrei-bungen und die nur bedingt positive Prognose, die Einschätzungen zu seinem eigen-gefährdenden Verhalten kann der Biograph bis aus seinem gegenwärtigen Erinne-rungshorizont nur teilweise nachvollziehen.
211
6.1.7. Fallspezifische Interpretationen und Rekonstruktion der Fallgeschichte
Der Biograph Hr. Grün bleibt in seiner sozialpsychologischen Entwicklung ab dem Zeitpunkt des 14.-15. Lebensjahrs stecken und friert ein. Er lehnt die Schule ab. Er beklagt und bricht unter der Last der Erwartung von Leistungen im Sport und in der Schule zusammen.
Eine familiäre Reinszenierung, ausgelöst durch eine über Generationen hinweg be-einflussende Traumatisierung, findet sowohl bei der Mutter als auch beim Vater statt. Beide haben im Zuge der Repressalien unter dem DDR Regime durch Verhöre der Staatssicherheit, durch dauerhaftes Abhören und durch Berufs- und Ausreiseverbote in ihrer Entwicklung keine Entfaltungsmöglichkeiten erlebt. Erst als die Ausreise be-willigt und umgesetzt wurde, konnte sich der Vater beruflich verwirklichen und ent-wickeln, während die Mutter des Biographen ihre akademische Ausbildung im Beruf nicht bestätigen konnte. Während die Eltern durch das diktatorische Regime der DDR in ihrem persönlichen Entwicklungsprozess und Ablösungsprozess ihrer geographi-schen Heimat gehindert wurden, übernahm diese Funktion bei Hrn. Grün die Psychi-atrie bzw. psychiatrischen Institutionen. Der Richter am LG übernahm in seiner Funktion die Rolle der Eltern, der die Maßregel anordnete und ebnete Hrn. Grün ein strukturelles Setting, in dem er gezwungenermaßen auf sich selbst, sein Können üben und Ressourcen weiter entwickeln konnte. Er wurde auf sich selbst zurückgeworfen, muss sich mit seiner Krankheit, seinem Verhalten, seiner Gefährdung auseinander-setzen. Er wird mit seinem Eigen- und Fremdbild konfrontiert. In diesem hochstruk-turierten Setting konnte der Biograph Entwicklungsschritte vollziehen, in dem er sich mit seiner bisherigen Biographie und Krankheitsgeschichte auseinandersetzen musste. Nach dem MRV übernimmt ein gesetzlicher Betreuer diese Aufgabe, der zu dem Zeitpunkt bestellt wird, (für die Bereiche Briefverkehr und Postangelegenheiten, Geld und Vermögen, Aufenthaltsbestimmung und Gesundheitsfürsorge) als die Eltern die Entscheidung treffen, sich aus Selbstschutz, weit weg aus dem Gesichtsfeld des Biographen zu begeben.
Zwischen dem 19.-33. Lbj. übernehmen der gesetzliche Betreuer, der Maßregelvoll-zug, die psychiatrische Klinik sowie das geschlossene Wohnheim die Aufgabenstel-lung einer Über-Ich oder Eltern-Ich Funktion, so dass sich Hr. Grün entsprechend der Institutionen, in denen er sich aufhält, regelkonform verhält und ohne Delikte aus-kommt. Von ihm wird erwartet, dass er die Hausordnung, die Behandlungsvereinba-rungen, die Grundregeln des sozialen Miteinanders einhält. Der institutionell be-dingte Ablösungsprozess stellt ein konsequentes Verhalten und Reaktionen in Aussicht, die zuverlässig und nachvollziehbar umgesetzt werden. Der Grad der Au-tonomie, die Ausgangs- und Lockerungsstufen in den jeweiligen Institutionen stehen in einem direkten Zusammenhang mit Hrn. Grüns Mitwirkung, Anpassungsleistung, Kooperationsbereitschaft, mit den Behandlungserfolgen, seiner Einsichts-, Empa-thie- und Introspektionsfähigkeit. Der Biograph wird sozusagen in einer fast 12-jäh-rigen geschlossen und hochstrukturierten Institutionalisierung genötigt und gezwun-gen, sich sowohl mit sich selbst, mit seiner Eigen- und Fremdeinschätzung, mit seiner Suchterkrankung, als auch mit seiner psychiatrischen Grunderkrankung, seiner Fa-miliengeschichte und den Auswirkungen der begangenen Delikte auch aus Sicht der
212
Opfer auseinanderzusetzen.359 Der Biograph lernte erstmals Verantwortung für sei-nen Wohnraum, für sein Handeln und für die Gemeinschaft auf der Station zu über-nehmen. Der Biograph wurde in dieser Zeit mit der Aufarbeitung und dem Entstehen seiner Delikte konfrontiert, er wurde mit seinen Fähigkeiten, Grenzen, und Kompe-tenzen konfrontiert. Er lernte sich empathisch zu verhalten und zu erleben. Er lernte, sich in eine andere Person, in die Perspektive eines anderen Menschen hineinzuver-setzen, wenn er z.B. bedroht und geängstigt wird. Er lernte in dieser Zeit zunächst mit starren und engen Vorgaben und Strukturen durch Kontrolle, Sanktionen und nachgehende Überprüfung umzugehen, wie er die Zeit, den Raum und die sozialen Kontakte zu strukturieren hat. Der Biograph strebte darin nach Verselbständigung und Autonomie und stellte gleichzeitig fest, bisher weder im Denken, Fühlen noch im Handeln Selbstverantwortung für sein Leben übernommen zu haben.
Beim Biographen fällt auf, dass er seine biographisch-chronologischen Daten, aber auch die Familienstruktur über seine Kernfamilie hinaus, nur lückenhaft und rudi-mentär abgespeichert hat und wiedergeben kann.
Im Richter sieht der Biograph die Person, die endlich konsequent und folgerichtig das forensisch-psychiatrische Gutachten interpretiert, auslegt und entsprechend so urteilt, dass seine kriminellen Handlungen unterbunden werden. „Für den Richter war es das Beste, mich einzusperren. Damit meine kriminellen Handlungen, die ganzen Sachen und das alles unterbunden werden.“ (…) „Vor dem Richter kann ich dann nicht sa-gen, sie entlassen mich jetzt und dann nehm ich wieder Drogen oder so. Das war alles schon kritisch.“ 360 Für den Richter empfindet der Biograph ein nachvollziehba-res Verständnis für sein Handeln und das Urteil, gleichwohl er das Strafmaß für völlig übertrieben hält. Entsprechend präsentiert sich der Biograph bei der jährlichen ge-richtlichen Anhörung als jemand, der dem Richter mit einer ehrlichen und realisti-schen Einschätzung zu seinem Drogenverlangen und seiner Prognose Auskunft ge-ben will.
Über die Zeit im Maßregelvollzug berichtet und erzählt Hr. Grün besonders lange und ausführlich. Dies kommt an mehreren Stellen durch szenisches Präsens zum Aus-druck, in Dialogen, die sich im Originaldialog so zwischen der Person und ihm abge-spielt haben. Der Biograph, der in den ersten zwei Jahren der Maßregel noch rebel-lierte, aufbegehrte, sich non-konform verhielt, setzte anfangs seine Haltung gegen-über den Autoritäten der Klinik fort, indem er sich weder behandeln lassen wollte
359 Die Idee der Selbstbestimmung, so BIERI (2014), wird noch komplexer, wenn es demnach nicht mehr nur um die Unabhängigkeit der Anderen gegenüber geht, sondern vielmehr um die Fähigkeit, über sich selbst zu bestimmen. Es geht also in der Auseinandersetzung mit dem Feld Selbstbestimmung weniger darum, über das eigene Leben Regie zu führen, indem ich mich gegen die „Tyrannei der Außenwelt“ wehre. In Anlehnung an BIERI kann auch assoziiert werden, dass im sozialpsychiatrischen Arbeitsfeld z.B. psychiat-risch-forensische Institutionen, geschlossene Heime, gesetzliche Betreuungen, Geldverwaltung oder Bewäh-rungsauflagen als „Tyrannei der Außenwelt“ stellvertretend erlebt werden. Im Diskurs der Selbstbestimmung geht es vielmehr darum, in einem erweiterten Sinne, Subjekt meines Lebens zu werden, indem ich Einfluss auf meine Innenwelt nehme. Konkret, auf die Dimension meines Denkens, Wollens und Erlebens, aus der sich heraus Handlungen ergeben, Einfluss zu nehmen. Im Gegensatz dazu kann es auch dazu kommen, so BIERI, den eigenen Willen als Leben wahrzunehmen, das einem nur zustößt und von dessen Erleben der Mensch wehrlos überwältigt wird, so dass statt von einem Subjekt nur von einem Schauplatz des Erlebens die Rede sein kann. In diesem Erleben läuft der Mensch Gefahr, seine persönliche Identität nicht in seine Lebensge-schichte einbetten zu können. vgl. Bieri, P. (2014): Wie wollen wir leben? 3. Aufl. dtv. München. S.: 9-11. 360 Interview 1 Hr. Grün, S.: 5 Zeile: 130-143.
213
noch an Einzel- oder an Gruppenangeboten teilnehmen wollte. Nach etwa zwei Jah-ren Behandlung erfolgt ein Umdenken. „Er habe sich dann ganz gut angestellt und nahm an der Therapie und den anderen Sachen teil“, z. B. an der Gruppentherapie, am Psychoedukationstraining, an der Deliktaufarbeitungsgruppe, an der Arbeits- und Beschäftigungstherapie, an der medizinischen Behandlung, und an den Sport- und Freizeitangeboten. Er konnte zunehmend die Regeln auf der Station einhalten und die den Ausgangs- und Lockerungsstufen ohne Auffälligkeiten durchlaufen.
Während der Biograph im Laufe der Zeit davon ausging, dass „in der Maßregel hatte ich noch konkrete Vorstellungen, draußen Fuß zu fassen, 3 Jahre abstinent (….) das haben die gesehen (…) dann haben die gesagt, so dann schafft er das auch, dann können wir Entlassung vorbereiten und Wohnen und Arbeit und Behandlung anbieten und 2005 bin ich entlassen worden und hab eine Reha gemacht.361.
Der Biograph präsentiert sich als jemand, der einerseits den Anspruch erhebt, aus seinem Leben etwas zu machen, ihm Bedeutung geben will, andererseits will er sich Herausforderungen nicht aussetzen. Er stellt fest, dass er „noch einen langen Weg gehen müsse, die Medikamente machen ihn müde und beeinflussen den morgendli-chen Antrieb und machen somit pünktliches Erscheinen nur erschwert möglich“362
Der Biograph bleibt auch beim 2. Versuch, sich abzulösen, stecken. Er scheitert, und muss erneut seine Ansprüche und Ziele an Autonomie und Selbständigkeit aufgeben. Die Symbiose zu den Eltern wird deutlich bei einem Versprecher: „…2007 sind wir jetzt da dann (…) ähm bin ich in ne eigene Wohnung gezogen.“ Der Biograph, Hr. Grün, verlässt sich voll auf die Hilfe und Unterstützung der Eltern, sie räumen seine Appartement auf, versorgen ihn mit Essen und Getränken, mit Kleidung. Erst als die Eltern 2009 wegziehen, kommt es erneut zu einer schweren Krise. Das Ausmaß der Hilfsbedürftigkeit des Biographen wird evident. Die Interpretation des Biographen: „ich hab in erster Linie so soziale Schwierigkeiten, keine Freunde, Freundin war weg, mit Eltern gab es nur Krach, mit den Nachbarn auch etc.) (…) habe Geldprobleme gehabe bzw. die Eltern wollten mir kein Geld geben, das Job-Center nur einen ver-kürzten Satz (…) das führte dann in die Klinik.“
6.1.8. Typenbeschreibung und Typenbildung
Der Biograph steht für einen bestimmten Typus/ Typologie, er sieht sich als ein Non-Konformist, als Outlaw und Rebell innerhalb der Gesellschaft, mit einer hedonisti-schen Einstellung bei einer egozentrierten Bedürfniserfüllung und Erwartungshal-tung gegenüber dem Staat, der den lebenslangen Exklusionsdrift und Prozess, den Hr. Grün erlebt(e), zu kompensieren hat. Aus Sicht des Biographen stehe die Gesellschaft eindeutig in seiner Schuld. Deswegen habe sie ihn mit Lebensunterhalt, mit Wohn-raum und Unterstützung zu versorgen. Sie hat für seine Existenz aufzukommen. Dem Biographen liegt es fern, sich selbst in die Eigenverantwortung seines Denkens und Handelns zu nehmen.
Nach der Bewertung des Biographen, habe er in jungen Jahren zu viel Leistungsdruck erlebt und verweigerte als Gegenbewegung seine Leistung in allen Lebensbereichen.
361 Interview 1 Hr. Grün, S.: 6, Zeile: 155-159. 362 Interview 1 Hr. Grün. S.: 7, Zeile: 180-188.
214
Der Erwartungsdruck sei zu groß gewesen. Indem er die Herausforderungen in der Schule oder im Beruf etc. nicht annimmt, kann er auch kein Scheitern erleben. So erhalte er sein Selbstbild nach dem Motto konstant aufrecht: Wenn ich wollte, könnte ich ja. Da ich aber nicht will und wenn ja, dann muss sich mein Einsatz spürbar loh-nen. Das ist aber ungewiss. So will ich letztendlich nur ein bisschen, und erlebe dafür weder ein weiteres Versagen noch die Erfahrung, etwas zu bewältigen und geschafft zu haben.
So entwickelte der Biograph auf lange Sicht, eine universell durch alle Lebensberei-che hindurch dringende, Strategie, sich erst gar nicht mit den Aufgaben und Heraus-forderungen, die seine Alltags- und Lebenswelt anbieten, zu konfrontieren, denn, dann kann er auch nicht scheitern. Bereits bei der ersten Klinikeinweisung anlässlich einer Volljährigkeitsfeier wird bei ihm ein Versagenssyndrom und Negativsympto-matik als Teil einer Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.363
Entsprechend der Kategorisierung und Typenbildung, exemplarisch in drei Kasuisti-ken vorgestellt, nach BIELESCH, MASANZ & OBERT364 (2016) zählt der Biograph im Feld der Forensischen Psychiatrie zu der Gruppe der „Wiederrückkehrer“, zum unstet-oszillierenden Typ. Zur Gruppe von Patienten, die bereits im Maßregel- und Haftvollzug waren und nach einer extramuralen Belastungserprobung, einer anschlie-ßenden Bewährungsphase mit definierten Sicherheitsauflagen innerhalb welcher eher in stationären als in ambulanten gemeindepsychiatrischen Einrichtungen forensisch nachgesorgt wird. Bei diesem Typus kommt es unmittelbar nach Ablauf der Füh-rungsaufsicht erneut zum Absetzen der Medikation und zur offensichtlichen Ableh-nung von fachärztlicher Behandlung. Straftaten im Zustand von Schuldunfähigkeit werden erneut begangen, ein Drehtürpsychiatrieeffekt startet erneut und es folgen wiederholte Unterbringungen in psychiatrischen Kliniken und Institutionen. Beim in-stabilen Typ mit unstet-wechselhaften Verlauf) handelt es sich um Menschen, denen die Stabilität (noch) fehlt und die zwischen Ablehnung und Einhaltung, zwischen Ko-operation und Rückzug, zwischen Abstinenz und Suchtmittelmissbrauch hin und her pendeln. Krankenhausaufenthalte wie auch Phasen der Behandlung bzw. Krisenin-terventionen im Maßregelvollzug wechseln sich ab mit Krisen, die auch ambulant begleitet werden. Allerdings ist zu beobachten, dass sich langfristig, Schritt für
363 Negativsymptomatik ist im Kontext einer schizophrenen Psychose ein Teilsymptom, das sich durch sozi-alen Rückzug, Depressivität, Vernachlässigung des Körpers und des Wohnraums, sowie der bestehenden so-zialen Bezüge und durch einen reduzierten Antrieb im Gegensatz zu einer Positivsymptomatik (produktiver Wahn…), die von einer besseren Prognose und von wirksameren Behandlungserfolgen ausgeht, herausbilden kann. Symptomatologisch ist der Begriff der Negativsymptomatik nah verwandt mit dem neurasthenischen Syndrom und Erschöpfungssyndrom. Ätiologisch sind Versagenszustände am ehesten den schizophrenen Formenkreis zuzuordnen, wo sie insbeson-dere als Prodromalsymptom vorkommen können. Während GLAZEL, J. & HUBER, G. (1986): Zur Phäno-menologie eines Typs endogener, juvenil-asthenischer Versagenssyndrome. Psychiatrica Clinica. Basel.1 S.: 15-31) das asthenische Versagenssyndrom als bestimmten Typ innerhalb der Neurasthenie charakterisiert und drei Symptomgruppen: a. Leibgefühlsstörungen (coenesthetische Halluzinationen), Entfremdungserlebnisse und Denkstörungen mit Verlust der Leitbarkeit des Denkvorgangs beschrieben, weist BLANKENBURG W. (1968) Der Versagenszustand bei latent Schizophrenen. Dtsch. Med. Wschr 93; 67-71) darauf hin, dass ein-deutige schizophrene Symptome beim Versagenssyndrom vermisst werden, dass aber dieses sich durch seinen Gesamterlauf als zur Schizophrenie gehörend erweise. 364 vgl. Bielesch, J. Masanz, K., Obert, K. (2016): Aus dem Maßregelvollzug in die Gemeinde. In: Soziale Psychiatrie. Nr. 153, 03/2016. S. 16-18.
215
Schritt, eine Stabilisierung der gesamten Lebenslage in Verbindung mit der gesund-heitlichen Befindlichkeit einstellt. Das zunehmende Lebensalter, der stützende fami-liäre Einfluss und stabilisierende Kontakte der Kernfamilie spielen eine erhebliche Rolle auf eine bedingt positive Legal- und Behandlungsprognose. Sie haften jedoch über viele Jahre hinweg einem institutionalisierenden Lebensentwurf im Bereich Wohnen, Betreuung, Beratung, Behandlung und Beschäftigung an.
FISCHER365 definiert die Kasuistiken, von der Sprachform her betrachtet, als Erzäh-lungen, die ein generell verfügbares Format für ihre spezifische Zwecke benutzen. Sie stellen nachträglich einen Ablauf dar, der sich wiederum mit evaluierenden Mo-menten und Ereignissen auf die Gegenwart bzw. auf eine erwartete professionelle Handlungssituation in der Zukunft bezieht. Kasuistiken, so FISCHER weiter, sind professionelle Narrationen, die erzählt, kondensiert und durch den professionellen Erzähler stilistisch geprägt werden. Die Kasuistik steht jedoch für die asymmetri-schen Beziehung des Professionellen zum Klienten oder Patienten, da der Erzähler darin den Verlauf beschreibt, wie der Patient, sich anfangs von einer problemzentrier-ten, hilflosen und entautonomisierten Situation, nach und nach, mit Hilfe professio-neller Interpretations- und Transformationsleistungen, schließlich und abschließend ein gelingendes Handeln zur Problembewältigung entwickelt kann. Dennoch sollen bei den drei Biographien im Feld forensische Nachsorge, die im Anhang aufgeführt werden, auch auf die Entwicklungspotentiale und Ressourcen Rücksicht genommen werden. Es sollen zudem Hypothesen zu Einflussfaktoren während der Nachsorge-phase generiert werden, die die jeweiligen Verläufe begünstigen bzw. maßgeblich beeinflussen.
365 Fischer, W. (2008): Fallrekonstruktionen und Intervention. IN: Giebeler, C.; Fischer, W.; Goblirsch, M.; Miethe, I,; Riemann, G. (Hrg.): Fallverstehen und Fallstudien. Band 1, 2. Auflage. Opladen. Verlag Barbara Budrich, S.: 22-32.
216
6.2. Zweite Falldarstellung: Frau Brandt
„Wanderung ist Leben und Fortschritt, Sesshaftigkeit ist Stagnation.“ von Ernst Georg Ravenstein
6.2.1. Einführung und Kontextklärung
Fr. Brandt lernte ich 2011 in meiner Funktion als Heimleiter eines geschlossenen Heims kennen. Sie war auf einer benachbarten Wohnebene, nach einer monatelangen Klinikbehandlung, in der mehrere Fixierungen und Phasen der Zwangsernährung über eine Sonde notwendig waren, für eine Dauer von zunächst 12 Monate auf der gesetzlichen Grundlage nach § 1906 BGB aufgenommen worden.
Es fand ein Vorgespräch mit der Biographin statt, im dem der konkrete zeitliche und inhaltliche Ablauf der freien biographischen Interviews besprochen wurde. Fr. Brandt stellte mir in Aussicht, dass sie mir einen handschriftlichen Lebenslauf bis zum letz-ten Interviewtermin erstellen und übergeben wolle. Das Versprechen hat sie gehalten. Es fanden zwei lange Gespräche an einem Lieblingsort der Biograph in statt. Das erste Interview fand in einer mit Blumen umrankten Sitzgruppe in einem nahegele-genen Park statt, den sie in ihren freien Ausgängen aufsuchte, dort Musik hörte, tele-fonierte, rauchte und in Ruhe die flanierenden Spaziergänger beobachtete.
Das zweite Gespräch fand in ihrem Zimmer bei einer Kanne Kaffee und Tabak statt, da Fr. Brandt keinen freien Ausgang, hatte. Auf das Angebot, den zweiten Termin auf ein paar Wochen später zu verschieben, ging Fr. Brandt nicht ein. Sie wollte das gerne abschließen, „sonst zieht sich das wie Kaugummi“. Sie wünschte sich für die Teilnahme einen Gutschein für einen bestimmten Modeladen in der Innenstadt, um sich ein T-Shirt, das sie schon öfter dort anprobiert hatte, zu kaufen. Fr. Brandt hörte sich die Ausführungen zum Ablauf genau an und gab zum Schluss die Rückmeldung, dass sie u.U., angestoßen durch ihre Erzählungen, in seelische Zustände gerate, in denen sie dann zu dissoziieren beginne. Sie sei dann nicht mehr bei sich selbst. Ich solle sie dann wieder zurück auf Station führen, falls ich dazu in der Lage wäre. Zu-dem hätte ich ja auch schon öfter mitbekommen, dass sie in diesen Ausnahmezustän-den dann Dinge mache, die richtig verrückt seien, wie z.B. Rasierklingen und Scher-ben schlucken, an die sie sich später nicht mehr erinnern könne. Sie teilte mir zudem mit, dass das Vorhaben, sie zu interviewen, auch Gefahren in sich bergen, die sie zu ihrem Schutz hier aussprechen wolle. Sie stehe dem Vorhaben positiv und wohl ge-sonnen entgegen, da sie mir großes Vertrauen schenke und denke, dass es dazu diene, dass sich die sogenannten Profis besser um die jungen Leute kümmern, die schon früh in Heime, Anstalten und Kliniken betreut werden. Sie seien allesamt verlorene Seelen, heimatlos und entwurzelt. So sei es auch um sie bestellt. Sie wisse oft nicht, wohin sie gehöre. Sie wisse auch oft nicht, warum sie trotzdem so am Leben hänge. Sie habe sich ja schon so oft versucht, das Leben zu nehmen und oft stand es Spitz auf Knopf. Es sei wohl so, dass sie noch nicht die Erde verlassen dürfe.366
366 Forschungstagebuch: Eintrag vom 21.6.2013 vom Aufzeichnung zu Vorbereitung auf biographische In-terviews: Nr. 2; Fr. Brandt.
217
Bevor wir uns das erste Mal auf der Parkbank im Stadtgarten trafen, holte ich auch das Einverständnis der gesetzlichen Betreuerin ein, die mich um ein äußerst behutsa-mes und vorsichtiges Vorgehen bat.
6.2.2. Gelebtes Leben -biographische Daten-
„ ….deswegen bezeichne ich mich als Girl-Boy, aussehen wie ein Mädchen und sich verhalten wie ein Junge.“
Frau Brandt
Fr. Brandt wurde 1985 in Russland, vor den Toren einer Millionenstadt geboren. Be-reits einen Tag nach ihrer Geburt wurde sie von ihrer Großmutter in ein Säuglings-heim, in dem sie unter spartanischen Bedingungen versorgt wurde, gebracht und schließlich zur Adoption frei gegeben. Drei Jahre später wurde sie von ihren Eltern, deutschstämmige Russen, die ungewollt kinderlos geblieben waren, gegen eine für die Eltern sehr hohe Summe „Freikauf“ adoptiert. Ein Jahr später starb der Adoptiv-vater, der von seiner Ehefrau leblos in der Badewanne der Wohnung entdeckt wurde, an einer Überdosis Drogen.
Im Zuge von Gorbatschows Politik von Perestroika und Glasnost kam es 1988 zur Öffnung des Ostblocks und zu einem sprunghaften Anstieg an Aussiedlungen, die von 1988-1991 einen Höhepunkt mit 400.000 Aussiedlern erreichte, die i.d.R. eth-nisch verfolgt, diskriminiert und stigmatisiert wurden. Die Sowjetunion löste sich nach dem sogenannten Alma Ata Abkommen dann 1991 auf. In der weiteren Folge zogen 2,3 Mio. Aussiedler und sogenannte Spätaussiedler (ab 1991) von der Sowjet-union und die aus den sogenannten Nachfolgestaaten stammten, aus, um in die BRD umzusiedeln. Bei Fam. Brandt kam es erst 1996 mit Verzögerung zur Aussiedlung. Die Biographin war zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt.
Während ihre Adoptivmutter unter der Woche in der Großstadt arbeitete und wohnte, lebte die Biographin bis zur Einschulung bei der Großmutter der Adoptivmutter auf dem Land, in sehr bescheidenen Verhältnissen. Lediglich am Wochenende hatte sie ihre Mutter sehen können.
Die Großmutter, die wichtigste Bezugsperson für die Biographin, hat mit 40 die 3. Tochter bekommen. Sie arbeitete einst in einem Bergwerk, wohingegen der Großva-ter in einer Wachdienstgesellschaft beschäftigt war. Beide entstammen einer einfa-chen Arbeiterfamilie. Die ökonomisch belastende Situation erforderte auch von der Großmutter, einer Arbeit nachzugehen, um den einfachen Lebensunterhalt zu decken. Selbst am Wochenende war sie beschäftigt und setzte ihre Enkelin dann nichts ah-nend dem Großvater in der Zeit aus, der aus gesundheitlichen Gründen das Haus hü-tete und fortan, vier lange Sommer auf die Biographin aufpasste. Diese Zeit, bis zur Einschulung im Jahr 1992, stellte ein Alptraum für Fr. Brandt dar, die in diesen Jah-ren, vom 6.-10. Lebensjahr viel Male missbraucht und in ein Kellerverließ einge-schlossen wurde. Der Großvater hatte damit gedroht, ihr etwas anzutun, um sie mund-tot und weiterhin gefügig zu machen bzw. sie zum Schweigen zu bringen. Viele Jahre behielt Fr. Brandt dieses Geheimnis für sich und vertraute sich erst als junge Erwach-sene einer Therapeutin an. Viele Jahre später dann auch ihrer Familie.
218
Im Jahr 1992 zog Fr. Brandt dann zur Einschulung zur Mutter in die Stadt, die inzwi-schen mit ihrem neuen Partner, der Imker war, zusammenwohnte. Der neue Partner stellte sich als liebevoller und fürsorglicher Ersatzvater heraus, in den Fr. Brandt end-lich auch die gewünschte Vaterfigur gefunden hat. Stets zu den Sommerferien, die drei Monate anhielten, wurde sie zu den Großeltern aufs Land verschickt, obwohl sie mit Angst und Panik reagierte, was auf großes Unverständnis stieß. Dort setzte sich das Martyrium vier Sommer lang fort, dem sie sich auch nicht entziehen und auch nicht darüber sprechen konnte. 1996 sind die Großeltern mit der Tochter und der En-kelin im Zuge des gesetzlich geregelten Zuzugs mit weiteren 225.000 Russlanddeut-schen in die BRD, mit einem zunächst zeitlich befristeten Visum, ausgesiedelt. Sie fanden für das erste Jahr in einem zugewiesenen Übergangswohnheim in den neuen Bundesländern Obdach. In der neuen Heimat musste der Nachweis einer deutschen Abstammung erbracht werden, sowie die Pflege von deutschen Brauchtum und Sprachkenntnissen. Wer dies nicht nachweisen konnte, wurde wieder zurückge-schickt. Da Fr. Brandt und ihre Mutter kaum die deutsche Sprache beherrschten, be-suchten beide einen Sprachkurs. Fr. Brandt wurde wegen ihrer sprachlichen Kennt-nisse in eine Grundschulklasse zurückgestuft.
Sie hat mit ihren zwei Cousinen Kontakt, die beide ebenso mit ihrer Familie in die BRD ausgesiedelt sind. Eine davon ist Hebamme, die andere Juristin.
Im ersten Jahr nach der Aussiedlung, 1997, kamen bei Fr. Brandt (12. Lbj.) erste Suizidgedanken und Selbstverletzungen auf, die sich aufgrund fremdenfeindlicher Angriffe im Ort, sowohl in der Schule als auch auf offener Straße ereigneten, initia-lisiert werden und sich schnell verstärken. Sie wurde selbst mehrfach Zielscheibe von verbalaggressiven Anfeindungen, Beleidigungen, Hänseleien und Beschimpfungen sowie auch von körperlichen Angriffen durch Mitschüler. Fr. Brandt wurde wegen ihrer Kleidung und ihrer rudimentären Deutschkenntnisse zur Zielscheibe von grup-penbezogenen Menschenfeindlichkeiten und Vorurteile gegenüber den russlanddeut-schen Spät- bzw. Aussiedlern. Trotz des kleinen und zierlichen Körperbaus ging Fr. Brandt keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Sie wehrte sich mit Worten und leistete zur Not auch mit Fäusten Gegenwehr. Das familiärere Binnenverhältnis und die Rollenstrukturen der Brandts drohten zu eskalieren. So kam es 1998 zur Inobhut-nahme von Fr. Brandt durch das Jugendamt. Sie berichtete wenige Tage zuvor ge-genüber ihrer Lehrerin in der Schule von der massiven, regelmäßigen und länger an-haltender, körperlichen Gewalt durch Schüler und insbesondere durch ihre Mutter. Der Mutter wurde das Sorgerecht entzogen. Fortan übernahm das Jugendamt die Vor-mundschaft und Fr. Brandt fand in einem Kinderheim ihr neues Zuhause. Dort lebte sie mit acht Jungen als einziges Mädchen zusammen. Erst zum damaligen Zeitpunkt erfuhr sie, dass sie nicht das leibliche Kind ihrer Mutter sei, sondern adoptiert wurde. Im selben Jahr lernte sie im Jugendheim ihren ersten Freund kennen, mit dem sie eine romantische Liebesbeziehung führte. Die Beziehung, die gleich zu Beginn durch eine Verlobung besiegelt wurde, fand durch einen tragischen Unfalltod des Verlobten ein jähes Ende. Dennoch hielt sie trotz widriger Begleitumstände und vielen Höhen und Tiefen insgesamt 7 Jahre an. Als sich Fr. Brandt im 14. Lbj. befand, stirbt ihr Groß-vater. Sie wurde im selben Jahr erstmals in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik in der entfernten Großstadt hospitalisiert und äußerte dort eine große Befrei-
219
ung und Erleichterung. Dort wurde erstmals die Diagnose Borderline-Persönlich-keitsstörung gestellt, zudem wird als komorbide und sekundäre Erkrankung, eine Anorexie, festgestellt. Fr. Brandt wurde von dort aus zunächst in das Kinder- und Jugendheim zurückgeführt, aber schon nach wenigen Wochen in einer therapeuti-schen Wohngruppe aufgenommen. In dieser Zeit nahm die Biographin an einem Pro-jekt in Nordafrika teil und lebte für zwei Monate in einem Heim für „schwererzieh-bare“ Jungen, die kriminell geworden sind.
Als sie sich 2000 mit 15 Jahren evangelisch taufen lässt, wurde ein lange gehegter und geäußerter Wunsch für Fr. Brandt wahr. Fr. Brandt wurde nun von ihrem Ver-lobten räumlich getrennt. Dennoch blieb sie bis 2001 (16. Lbj.) dort betreut und ver-sorgt und zog dann von 2001 - 2003 in den Haushalt der Großmutter ein. Mit der Volljährigkeit entschied sich die Mutter wegen eines lukrativen Arbeitsangebots in der Pflege nach Stuttgart zu ziehen. Für Fr. Brandt wird eine gesetzliche Betreuerin vom Vormundschaftsgericht für alle Wirkungsbereiche bestellt. Wenige Monate spä-ter zog auch die Großmutter nach Stuttgart nach und bezog im selben Mietshaus wie ihre Tochter eine Wohnung. Die Biographin wird 2003 nun erstmals in der Erwach-senpsychiatrie erneut wegen autoaggressiver Handlungen, Angst- und Panikattacken behandelt. Es erfolgte eine Verlegung in eine Fachklinik für Patienten mit Borderli-nestörung, die Behandlung brach sie jedoch nach drei Tagen wieder ab. Im 7. Jahr der Partnerschaft, Fr. Brandt hielt trotz räumlicher Distanz den Kontakt aufrecht, kam es dann zu einem folgenschweren Unfall. Eines Tages, im Jahr 2004, ging es Fr. Brandt wieder einmal seelisch sehr schlecht. Sie rief ihren Verlobten an und bat ihn darum, anders als geplant, mit dem früheren Bus zu ihr zu kommen. Der Bus geriet in eine tragische Kollision mit einem Zug und der Verlobte verstarb noch am Unfall-ort. Die Biographin leidet seitdem unter schweren Schuldgefühlen, da sie sich bis heute verantwortlich für den Unfalltod ihres Verlobten fühlt. Fr. Brandt hielt nun nichts mehr an dem Ort. Sie wurde auf ihr Bitten hin von der Mutter nach Stuttgart begleitet und fand zunächst bei ihr Unterschlupf. Das Zusammenleben gestaltete sich rasch angespannt, explosiv und spitzte sich nach kurzer Zeit so zu, dass Fr. Brandt von ihrer Mutter gedrängt wurde, endgültig die Wohnung zu verlassen. Sie wurde auf die Straße gesetzt und ist nun wohnungslos. Fr. Brandt fand in einem Frauenhaus (2004) eine Unterkunft und musste auch dort schon nach wenigen Wochen wegen einer schweren Alkoholvergiftung in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden. Dort fiel die Entscheidung, dass Fr. Brandt in ein offenes Wohnheim, für die Dauer von eineinhalb Jahren, von 2004 - 2005, verlegt wurde. Die Biographin wurde inzwi-schen 19 Jahre alt und zum wiederholten Male in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung behandelt. Von dort erfolgte eine Verlegung in eine kleine, offene und re-habilitativ ausgerichtete Klinik, für die nächsten 13 Monate. Schließlich kam es zu einer Verlegung in den offenen Heimbereich, der auf dem Klinikgelände verortet war. 2006 kommt es bei der nunmehr 20-Jährigen zum ersten ernsthaften Suizidversuch. Die folgenden 12 Monate verbrachte Fr. Brandt zwischen Klinik und Wohnheim, bis sie schließlich 2007 für weitere 13 Monate klinikstationär behandelt wurde. Erneut kündigten in dieser Zeit Mutter und Oma an, sie wollen wieder zurück in die Heimat, da sie mit den Gegebenheiten der „neuen Heimat“ nicht klar kommen. Die Biogra-phin wurde nun mit 23 Jahren per Unterbringung nach § 1906 BGB in ein geschlos-senes Wohnheim vermittelt. Dort stabilisierte sich Fr. Brandt zunächst und lernte ei-nen neuen Partner kennen, mit dem sie von 2009 -2010 für 18 Monate zusammen zog
220
und im Rahmen des ABW betreut wurde. Der Partner wurde jedoch rückfällig und konsumierte wieder harte Drogen aller Art, die WG wurde daraufhin gekündigt und aufgelöst, weil auch Fr. Brandt das Ende der Beziehung einforderte. Die Biographin unternahm 2011 einen weiteren Versuch in einer frauenspezifisch ausgerichteten Wohngemeinschaft, im Ambulant Betreuten Wohnen. Dort konnte sie sich anfangs vier Monate lang stabil halten und zog wieder zurück in den geschlossenen Heimbe-reich. Fr. Brandt absolvierte nun, vom Heim aus, ein Praktikum in einem Kindergar-ten, denn ihr berufliches Ziel war es, Kinderpflegerin zu werden. Es kam zu weiteren Suizidversuchen, schließlich wurde Fr. Brandt erneut für 6 Monate in einer Klinik (2012) behandelt. Fr. Brandt wechselte Ende 2012 erneut das Wohnheim, wo sie heute, nach weiteren vier Jahren, noch immer lebt und betreut wird. Im Abstand von 2-3 Monaten kam es zu schweren Selbstverletzungen, Verbrennungen, Schnittverlet-zungen und Strangulierungsversuche, sodass kurze Kriseninterventionen für wenige Tage notwendig werden. 2014 lernte Fr. Brandt ihren 3. Partner kennen, der dieselben Diagnose wie die Biographin hat und zudem regelmäßig Cannabis konsumiert. Die Beziehung dauerte neun Monate an. Zum Zeitpunkt der beiden Interviews ist die Bi-ographin 28 Jahre. Wenn Fr. Brandt freien Ausgang hat, kommt sie auf eine Tasse Kaffee bei mir vorbei oder klopft am Fenster und wir reden ein paar Sätze.
Gelebtes Leben –biographische Daten
1985 Geburt in Russland, leibliche Mutter ist suchtkrank 1. Lebensjahr 1985 1 Tag nach der Geburt, Aufnahme in Kinderheim 1. Lebensjahr 1986 Nuklearer GAU im AKW Tschernobyl 1988 Adoption, Vater ist Imker, die Mutter Köchin, ver-
heiratet 3.Lebensjahr
1989 Suizid des Adoptivvaters durch Überdosis Heroin 4. Lebensjahr 1989-1992 Biographin lebt bei den Großeltern, 4.-6. Lbj. 31.12.1991 Auflösung der Sowjetunion 1992-1996 Einschulung, zieht zur Mutter (mit neuem Partner)
in die Stadt 6 ½. Lbj.
1996 Aussiedlung nach Deutschland, 3. Klasse 10 ½ Lbj. 1996-1997 Übergangswohnheim in einem der sogenannten
neuen Bundesländer 11-12. Lbj.
1997 Erste Suizidgedanken, wegen Ausländerfeindlich-keit auf der Straße, im Dorf, in der Schule, und Übergriffen in der Schule gegenüber den Russ-landdeutschen
12. Lbj.
1998 Inobhutnahme durch das Jugendamt, Sorgerechts-entzug der Mutter wegen anhaltender körperlicher Gewalt gegenüber der Tochter, Einzug in ein Kin-derheim, Vormundschaft übernimmt das Jugend-amt
13. Lbj.
1998 Erste romantische Beziehung, 13. Lbj. 1999 Kinder- und Jugendpsychiatrie bei Berlin 14. Lbj.
221
1999 Ausschulung nach der 7. Hauptschulkasse, Mutter nimmt Biographin von der Schule, sie solle eine Lehre beginnen und Geld verdienen
14. Lbj
1999-2000 Kinderheim, dann therapeutisches Kinderheim, Großvater stirbt
14-15. Lbj.
2000 Taufe bzw. Konvertierung vom russisch-orthodo-xen zum protestantischen Glauben
15. Lbj.
2001-2003 Einzug bei der Oma, die Biographin kommt ohne professionelle Hilfe aus
16-17. Lbj.
2003 Mutter, kurze Zeit darauf auch die Oma ziehen wegen eines Arbeitsangebotes nach Stuttgart
18. Lbj.
2003 Erwachsenenpsychiatrie, dann Fachklinik für Borderline-Patienten, am 3. Tag erfolgt der Ab-bruch der Behandlung
18. Lbj.
2003 gesetzliche Betreuung nach § 1886 BGB wird be-stellt
18. Lebensjahr
2004 Verlobter stirbt durch tragischen Verkehrsunfall 19. Lbj. 2004 Fr. Brandt zieht nach zur Mutter und Oma 19. Lbj. 2004 Mutter wirft Fr. Brandt aus der Wohnung, B. wird
obdachlos, es folgt Frauenhaus, eine Alkoholver-giftung, dann psychiatrische Klinikbehandlung.
19. Lbj.
2004-2005 18 Monate
Aufnahme in ein offenes Wohnheim 19-20. Lbj.
2005-6: 18 Mon.
Verlegung in eine offene Klinik, erster schwerer Suizidversuch
20. Lebensjahr
2006: 9 Monate
Ein zweites offenes Wohnheim, 2. Suizidversuch, zahlreiche Klinikunterbrechungen, Rückverlegung
21. Lbj.
2007 Psychiatrische Klinik 22. Lbj. 2007-2008 Aufnahme in ein geschlossenes Wohnheim: Ein-
richtung 1 23. Lbj.
2009-2010 1¼J.
Ambulant Betreutes Wohnen mit Partner, bis zur Trennung
24-25. Lbj.
2011: 4 Monate
Frauenspezifisches Wohnen, Ambulant betreutes Wohnen
26. Lbj.
2011 Geschlossenes Wohnheim: Einrichtung 1, Prakti-kum Kindergarten, mehrere Suizidversuche
26. Lbj.
2012 6 Monate
Psychiatrische Klinik 27. Lbj.
08/2012-heute (10/2016)
Wechsel in 2. geschlossenes Wohnheim: Einrich-tung 2, bis 8 Klinikaufenthalte p.a., für wenige Tage zur Krisenintervention
28.-30. Lbj.
2014 9 Monate
mit Partner, der im ABW ist, zusammen 29. Lbj.
Tabelle 4: Biographische Daten zur Falldarstellung 2.
222
6.2.2.1. Erste Hypothesenbildung zum gelebten Leben
Bedingt durch die historischen Rahmenbedingungen nach dem Zerfall der Sowjet-union wurde Fr. Brandt von einer kollektiven Migrationsbewegung der Familie bzw. einer Volksgruppe erfasst und entwurzelt. Der moralische Druck, der auf die Biogra-phin lastete, wurde durch den Einsatz von Lebenszeit, Energie und Geld für ein Hand-lungsschema, das für die Nachkommensgeneration zur Verfügung gestellt wurde, um ihr in der neuen Heimat ein besseres Leben anzubieten, aufrecht erhalten. Der dadurch erzwungene Verzicht auf eigene biographische Entwürfe wird in schmerz-hafter Weise erfahren und wird schließlich bestimmend für das Lebensgefühl der Bi-ographin.367
Wie bei Hrn. Noller (Fall 4) kommt es auch bei Frau Brandt, allerdings zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt zu einer Entfernung des Kindes aus der Familie und so-mit zur Übertragung der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeit an eine Institution. Durch den neuer Partner der Mutter, wurde die Biographin als störend empfunden. Sie wurde zu einem frühzeitigen Abbruch der schulischen Laufbahn und in eine ra-sche Berufstätigkeit gedrängt, mit der sie sich nicht identifizieren kann.
Als die Mutter bemerkte, dass ihre Tochter, trotz disziplinarischer Maßnahmen, das Migrationsprojekt gefährden könnte, sie im Schulbetrieb noch weiter aus dem Ruder laufen könnte, bearbeitete und beeinflusste sie die Biographien, in der 7. Hauptschul-klasse von der Schule zu gehen, um endlich etwas zu arbeiten und Geld für die Fa-milie beizusteuern.
Nach RIEMANN368 wurde auch Fr. Brandt in ein Familienhandlungsschema einge-bunden. Das bedeutet, sie erlebt grundlegend, einen Prozess der Ausgrenzung. Sie soll aus der Familie entfernt werden und wird umgehend nach der Geburt in einem Säuglingsheim abgegeben. Ein wesentliches Kennzeichen des Prozesses ist ein steti-ger Zerfall der Kernfamilie bzw. eine Nicht-Existenz der Familie, da sich der Schutz-raum der Familie auflöst, allmählich zerfällt und eigentlich für Fr. Brandt von Anfang an nicht bzw. kaum vorhanden ist. Das Grundgefühl bei Fr. Brandt ist ein Gefühl von Alleingelassen-Werden und Fremdheit. Fr. Brandt wächst ohne bestätigende Interak-tionspartner in einem emotionalen Vakuum auf. Sie entwickelte ein geringes Selbst-wertgefühl, fühlte sich permanent fremd, sich selbst und auch anderen gegenüber. Das prägende Körperschema der Biographin wechselt von einem bulimischen Cha-rakter hin zu einem Anorektischen. (siehe Begriff von COOLEY (1902) looking-glass self.369 Fr. Brandt erfährt in ihrer Biographie eine frühestmögliche, schon vom 1. Lebenstag an, und frühzeitige institutionelle Prozessierung. So geriet Fr. Brandt in einen dauerhaften Konflikt, der sie zwischen Fremdbestimmung einerseits und einer beanspruchten Selbstbestimmung und Autonomie andererseits hin- und her pendeln
367 vgl. a.a.O. Riemann, S.: 382-384. 368 vgl. a.a.O. Riemann, S.: 381. 369 Looking-glass-self (Spiegelbildeffekt) beschreibt das Selbstkonzept als sich entwickelnde Folge der wahr-genommen Eindrücke und Bewertungen im sozialen Miteinander. Nach COOLEY gibt es drei Elemente, die in ihrer Gesamtheit und Wechselwirkungen zur Herausbildung der eigen erlebten Identität führen. 1. Wie wird sie von anderen Menschen erlebt und wahrgenommen? 2. Wie wird sie von diesen anderen Menschen daraufhin bewertet? 3. Was für Gefühle erlebt sie aufgrund der Bewertungen? Es geht nicht um Bewertungen durch bedeutsame andere Personen, sondern vielmehr darum, was das Individuum darüber glaubt.
223
lässt. Dabei werden nicht nur die Familie, sondern auch der Aufenthaltsort, ihre Hei-mat, ihr schulischer Weg oder ihre beruflichen Wünsche und Vorstellungen fremd-bestimmt bzw. von ihrer Mutter ignoriert und verweigert.
Im Sinne RIEMANNS gerät Fr. Brandt im Verlauf der institutionellen Prozessierung nicht in eine Aufschichtung des Verlaufskurvenpotentials sondern sie befindet sich bereits schon von Anfang an in einer Verlaufskurve von kollektivem Charakter. In-dividuelle Verlaufskurven können auch von kollektiven, meso-strukturellen sozialen Prozessen mitgerissen werden, die als kollektive Verlaufskurven bezeichnet werden, so SCHÜTZE (1982), WAGNER (1982) weil es sich ebenfalls um sequentiell geord-nete, konditionelle Ereignisverkettungen handelt.
Der plötzliche Verlust des verunfallten Verlobten oder die immer wieder aufkom-mende Handlungsabsicht der Großmutter, die nach handgreiflichen Konflikten mit ihrer Tochter, damit droht, in die alte Heimat zurückzukehren, stellen einschneidende Ereignisse dar. Die Biographin zieht schließlich ihrer Mutter und Großmutter nach, mit der Gewissheit, dass es zu einer Eskalation kommen wird.
SLUZKI beschreibt die Stadien typischer Migrationsprozesse und deren Implikatio-nen für die familiäre Binnendynamik und teilt dies auf in a.) eine Vorbereitungsphase, in b.) den eigentlichen Migrationsakt, einer anschließenden c.) Phase der Überkom-pensierung. Es folgen eine d.) Phase der Dekompensation und mündet schließlich bestenfalls in eine e.) Phase eines generationsübergreifenden Anpassungsprozes-ses.370
Die Familie Brandt stand als Deutschstämmige und bei den Großeltern auch als deutschsprechende Russen lange Zeit, in einem kulturellen Zwiespalt, der durch po-litische Unterdrückung, einer Willkür der Kommunalverwaltung, offensichtlichen Rassismus geprägt war. Zudem wurden den Deutschrussen der Zugang von Bildung durch gezielte Ghettoisierung und Siedlungserlaubnis der, die so weit weg von Uni-versitäten wohnen musste, dass der tägliche Weg dorthin unmöglich war, systema-tisch verweigert. Die Großeltern sahen sich nach dem Zusammenbruch der Sowjet-union zum Handeln aufgefordert und hielten lange nach einer familien-historischen Chance Ausschau. Sie beabsichtigten mit der Aussiedlung, ihrer Tochter und Enke-lin, vor allem bessere ökonomische Lebensverhältnisse zugänglich zu machen. Die Mutter ist in der Aussiedlungsplanung die drängende Kraft, die den Migrationspro-zess maßgeblich vorantreibt und die kollektive Entscheidung alleine verantwortet.
Im Übergangswohnheim verhielt sich die Familie im höchsten Maße anpassungsfä-hig. Mutter und Tochter besuchten Deutschkurse. Die Großmutter pflegte jedoch al-ternierend bis heute den Mythos, einer Rückkehr ins Heimatland, zu thematisieren. Sie vermisse die Werte und Normen und stellt schließlich ernüchternd fest, sowohl im Heimatland als auch in der Wahlheimat unerwünscht und ausgeschlossen zu sein und wohl auch zu bleiben. In der neuen Heimat wiederhole sich nun alles wieder. Das sei ein langes Leid der Familie. Sie wolle deshalb immer wieder zurück und wisse
370 Sluzki, C.E. (2010): Psychologische Phasen der Migration und ihre Auswirkungen. In: Handbuch Trans-kulturelle Psychiatrie von Hegemann, T; Salman, R. (Hg.). Psychiatrie Verlag. Bonn, S.: 108-123.
224
doch, dass diese Türe zu sei. Sie werde wohl hier in ihrem zweiten Heimatland ster-ben. Ob sich das alles gelohnt habe, wisse sie nicht. Für ihre Tochter wohl schon, für ihre Enkelin wünsche sie sich aber eine andere Zukunft, so die ernüchternde und des-illusionierende Einschätzung.371 Kurz nach der Ankunft in der neuen Heimat, wurde der Großvater krank und die Absichten der Großmutter, wieder zurückzukehren, führten zu ernsthaften Überzeugungs- und Motivationskonflikten bei der Tochter und lösten existentielle Ängste und eine ruptive psychiatrische Krisen bei der Enkelin aus. Für die Biographin stellte die Großmutter die einzige verlässliche Bindungs- und Be-zugsperson dar, die sie identifiziert und anerkennt. In der Phase der Migration wurden sowohl die Coping-Fähigkeiten jedes einzelnen Familienmitglieds auf die Probe ge-stellt, als auch das qualitative Zusammenspiel der Familie. Die Familie Brandt drohte an den Rollenzuschreibung und Erwartungen zu zerbrechen, sodass die familiäre Desorganisiertheit schließlich eine familiäre Krise mit einer psychiatrischen Symp-tomatik bei der Biographin entfachte.
In der nun durchlebten Phase, einen funktionierenden Anpassungs- und Akkulturati-onsprozess zu etablieren, wurde viel Kraft und Energie bei der über drei Frauengen-rationen hinweg reichenden Familie abverlangt.
In der zeitlich am längsten anhaltenden Phase der Dekompensation geht es darum, neue Realitäten zu gestalten, die Kontinuität der Familie zu erhalten, wie auch ihre Anpassungsfähigkeit an die neue Umwelt zu entwickeln.
BUDE betont, dass Generationen nicht nur Träger ihrer eigenen, spezifischen Ge-schichte sondern auch Träger von kollektiven Erinnerungen sind. Erinnerungen er-halten so eine Brückenfunktion zwischen Generationen. Die junge Generation der Russlanddeutschen stellt z.B. im Kontext des Stalinismus zwar nicht die Generation dar, die unmittelbar Erfahrungen von Elend, Deportation in Arbeitslager, behördli-cher Willkür, Angst und gesellschaftlichen Ausschluss gemacht hat, sie bildet jedoch mit der alten und der zukünftigen Generation (Nachkommensgeneration) eine Erin-nerungsgemeinschaft.372
Der Ansatz der Vielschichtigkeit eines generationsspezifischen Umgangs mit gesell-schaftlichen Rahmenbedingungen und der Begriff von Generationen als kollektiver Träger von sozialpolitischen Strukturen begründete MANNHEIM.373
Generationen sind als ein ineinander überfließendes, prozessorientiertes Beziehungs-geflecht zu verstehen. In diesem Sinne ist nicht die genealogisch bedingte Unterschei-dung zwischen Generationen von Bedeutung, sondern, dass sie eine spezifische his-torische, soziale, politische Lage in einer bestimmten Zeit widerspiegeln.
Als ein ausschlaggebendes Moment hebt BUDE hervor, dass erst eine Lagerung im sozialen Raum zur Erfahrungsbasis von Gleichaltrigen führen wird. Somit bilde die
371 Forschungstagebuch. Notiz vom 27.7.2013. Zitat aus einem Telefonat mit Fr. Brandts Großmutter, das im Zuge einer konzeptionell standardisierten Re-Vitalisierung der Angehörigenberatung- und Pflege stattfand. 372 Bude, H. (1998): Die Erinnerung. In: König, H.; Kohlstuck, M.; Wöll, A. (Hg.): Vergangenheitsbewälti-gung am Ende des 20. Jh. Leviathan. Sonderheft 18/1998. Zeitschrift für Sozialwissenschaften. Opladen/ Wies-baden, S.: 71-74. 373 Mannheim, K. (1928): Problem der Generation. In: Eckert C. Lindemann, H. (Hg.) et al. Sonderabdruck aus Kölner Vierteljahresheft für Soziologie. 7. Jg. 2.H. München
225
Pioniergeneration der Aussiedler mit der einheimischen Generation eine bestimmte Generation, wobei die Pioniergeneration der Aussiedler jedoch in der Rolle des Au-ßenseiters verharrt. Beide Generationen teilen sich zwar denselben sozialen Raum, unterscheiden sich in ihren Erfahrungen, in ihrer Basis jedoch grundlegend voneinan-der.374
Trotz Umsetzung der Migration von einer Person, i.d.R. übernimmt dies das Ober-haupt der Familie, wird Migration als kollektives Familienprojekt begriffen375, so dass die Beziehungen, die in der Falldarstellung drei Frauen-Generativen umfassen, als ein Grundpfeiler in der Selbstwahrnehmung verankert sind.
Eine Trennung oder Scheidung der Ehe, ein unerwarteter Tod oder eine schwere Krankheit eines Teilnehmers des Migrationsprojektes wird als Versagen des Migra-tionsprojektes verstanden. Der Entschluss und die Entscheidung werden angezweifelt und es werden wieder Gedanken laut, zurückzukehren. Als 2000 der Großvater stirbt, kündigte die Großmutter die Rückkehr in die alte Heimat an, die nun das Projekt massiv anzweifelt und für sinnlos betrachtet. Dies wurde zum Anlass genommen, dass die Ziele des Migrationsprojektes in Frage gestellt und nun radikal und singula-risiert auf jede der drei Frauen umformuliert werden. In der 3er Frauengeneration wird nun das Ziel ausgerufen: „Jeder rette sich, wer kann!“ Es kommt zu einer suk-zessiven Korrosion des Beziehungsgefüges der drei Frauen. Die Großmutter wendete sich in die Vergangenheit ab, in Momenten des Zweifels drohte sie die Rückkehr an. Die Mutter setzte sich unter Aufbietung aller Energie- und Kraftreserven zu einem Solo-Leben an. Eine Rückkehr kommt für sie nun nicht mehr in Frage. Die Genera-tion der Tochter und der Mutter, die Großmutter als Kitträgerin, wie an zwei Seilen-den zusammengehalten hat, korrodieren zunehmend. Auf den körperlichen Krank-heitsprozess und einer inzwischen fortgeschrittenen demenziellen Entwicklung der Großmutter reagierte die Mutter der Biographin mit Überforderung, gerade durch die Mehrfachbelastungen im Beruf, Haushalt und Pflege. Es kam alternierend zu Gewalt-übergriffen. Während es früher zur Kindeswohlgefährdung gegenüber der Biographin kam, bekommt nun die pflegebedürftige Großmutter die Folgen der Überlastung kon-zentriert ab, auf die jedoch die Biographin keinen schützenden Einfluss mehr hat und darunter massiv leidet.
Der kollektive Charakter der Migration rückte in den Vordergrund. Dieser schwankte zwischen Einsamkeitserfahrungen, wie das z.B. auch bei türkischen Pioniergenerati-onen der Fall war und der Absicht, der Familie, sich selbst, den Kindern eine bessere Zukunft zu bieten. Im Gegensatz zur türkischen Pioniergeneration, die sich mit einer relativ schnellen Rückkehr für ein Migrationsprojekt entschieden hat, rückt die Mig-rationszeit, mit all den Schattenseiten, in den Hintergrund. Bei den russlanddeutschen Aussiedlern stellt das Migrationsprojekt hingegen nur eine Option dar, nämlich als “one way ticket and no option for return.“ Mit der Dauer der Migration, so CECIL376 erwiesen sich die anfänglichen Rückkehrvorstellungen als eine Rückkehrillusion,
374 a.a.O. S.: 172. 375 Cil. N. (2007): Topographie des Außenseiters. Schriftenreihe Politik und Kultur. Verlag Hans Schiler. Birkach, S.: 173. 376 a.a.O. Cecil (2007), S.: 138 ff.
226
wohingegen bei der Pioniergeneration der russischen Aussiedler das historische Zeit-fenster, zurückzukehren, immer kleiner wird und von Anfang an eine Rückkehr nicht in Erwägung gezogen wurde. Erst im Laufe der Migrationsdauer und einem anfäng-lichen Anspruch eines Assimilierungsprozesses in der Pionier- und in einem verstärk-ten Sinne dann in der Nachkommensgeneration werden die anfänglichen Zielsetzun-gen aufgegeben. Sie weichen nach und nach von ihrem originären Wunsch ab und ziehen ein Leben unter ihresgleichen vor. Mit dem Preis, sich mit einer gewollten Ausgrenzung durch eine konzentrierte Ghettoisierung inmitten der etablierten Gesell-schaft zu behaupten.
Sowohl die türkische Pioniergeneration, die über Anwerbeverfahren in die BRD in die Fabriken, und vorwiegend in der Elektro- und Stahlindustrie, sowie der Automo-bilbranche gelockt wurden377 als auch die russischen Aussiedler wurden als Arbeits-kräfte in Flüchtlingsheimen, die sich i.d.R. fernab der Verhältnisse deutschen Gesell-schaft aufhielten, als Übergangsphänomen betrachtet. Sowohl der berufliche Aktionsradius, die beruflichen Räume des Verdienstes waren beschränkt, als auch geringe Schulbildung und fehlende bis rudimentäre Sprachkenntnisse, fehlende An-erkennung der schulischen Qualifikation und der beruflichen Abschlüsse, die eine Degradierung und Herabstufung eines vergleichbaren Abschlusses in der BRD, letzt-endlich auch eine niedere Eingruppierung derselben Tätigkeiten erfahren. Somit ent-steht eine ungleiche ökonomische Grundlage, die mit einem begrenzten und benach-teiligten Wohnraum und mit einem niedrigen sozioökonomischen Status einhergeht. So bleiben auch nur noch schwere und minderwertige Arbeiten für diese Pionierge-neration übrig. Die Folgen bei der Pioniergeneration sind mit einer kollektiven Krän-kung und Diskreditierung zu charakterisieren, verbunden mit einer Selbstverpflich-tung, sich für die bisher erbrachte Lebensleistung zu rechtfertigen und auf eine Anerkennung der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen im Hinblick auf eine Altersversorgung zu beharren.
Im Gegensatz zu den türkischen und den anderen südeuropäischen und vom Balkan stammenden Gastarbeitern, die eine Rückkehr im Alter anstreben, steht bei den russ-landdeutschen Aussiedlern eine Rückkehr im Alter, von Anfang an, nicht im Fokus. Während die Gastarbeiter das Pendeln zwischen zwei Identitäts- und Lebenswelten als Kompromiss herausentwickeln und verstehen, um einerseits eine Bindung der ei-gene Bedürfnisse, in dieser Gesellschaft, in der sie ihre jungen Jahre, ihre Familie, ihre Jugendzeit verbracht haben, erlebt hingegen Familie Brandt als Spätaussiedler eine Pendelbewegung, die durch ein stetiges Austarieren der beiden kulturellen Wel-ten und Identitäten, ihrer Herkunft und Heimat, während der gesamten Migrations-phasen, gekennzeichnet ist. Das entwickelte Bedürfnis, ist ein Moment im Migrati-onsprojekt, in dem erstmals die Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt werden und sich eine Selbstwahrnehmung entwickelt, die sich vom Wir-Bild, das ihnen als kol-lektive Migrationsentscheidung aufbürdet, teilweise absetzt. Im Gegensatz zu den Angehörigen der Pioniergeneration verändern sich die Bildungschancen, die Sprach-kenntnisse der Nachkommensgeneration, sowie die Zugänge zu sozialen, kulturellen
377 1961 kamen 7000 türkische Arbeiter, 1962: 15.200, 1974 wurde die Millionengrenze erreicht. 2000 beträgt die Zahl der türkischen l Staatsbürger in der BRD 2,1 Mio., ohne die Anzahl der Eingebürgerten, allein in Berlin lassen sich 2000 türkische Staatsbürger nieder vgl. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Auslandsfragen über die Lage der Ausländer in der BRD, BT Drucksache 14/2674: 9.2.2000, S.:10.
227
Welten, zu den etablierten Gesellschaften, so dass eine Auflösung der Außenseiter-position entstehen könnte. Bei der Biographin lehnte die Mutter eine schulische Bil-dung ab. Sowohl ein erfolgreicher Schulabschluss als auch ihr beruflicher Wunsch zur Kinderpflegerin ignorierte die Mutter. Das Selbstbildnis ist an der etablierten Ge-sellschaft orientiert, es entwickelte sich langsam ein Prozess, so zu werden, wie die Etablierten. Dadurch verringert sich das Machtgefälle. Die nachkommende Genera-tion hingegen erlebte die eigene Unterlegenheit mit Scham. Scham gegenüber der eigenen Identität, der sozial niedrigen Position, schließlich Scham gegenüber dem gesamten sozioökonomischen Status.378
6.2.2.2. Exkurs: Historische Entwicklung der Russlanddeutschen in der Sowjetunion
Historischer Hintergrund: Nach der Gründung des Deutschen Reiches und dem von Bismarck initiierten Berliner Kongress 1878 wurde der slawischen Teil Russlands an die Türkei abgetreten. Dies führte erstmals 1880 zu einer öffentlichen Debatte der „deutschen Frage“ in Russland, die mit einer zunehmenden Angst vor einer Germa-nisierung Russlands einherging. Der Erste Weltkrieg kennzeichnete schließlich den Bruch der Beziehung zwischen Russen und den „Russlanddeutschen“, die nun auch innerhalb Russlands als Feinde betrachtet werden und fortan kollektiven Zwangs-maßnahmen, Enteignungen und einer Deportation nach Sibirien ausgesetzt waren. Die deutsche Sprache wurde verboten. Trotzdem kämpften die Russlanddeutschen loyal an der Seite der Russen gegen die Deutschen.379
1921/22 fiel etwa 1/3 der russlanddeutschen Bevölkerung einer Hungersnot zum Op-fer. 1928 wurde der erste „Fünf-Jahres Plan“ verabschiedet, der eine Akzentuierung in der Kollektivierung der Landwirtschaft und die Lösung der Kirchenfrage setzte. Die Auswirkungen traf die deutsche Minderheit besonders, da sie zum einen über-wiegend in der Landwirtschaft tätig war und zum anderen ein streng religiöses Leben führte. Unter der diktatorischen Ägide Stalins sollten alle Kulaken, sogenannte Groß-bauern, beseitigt werden. Häufig betraf das die Russlanddeutschen, die im Zuge eth-nischer Säuberungswellen (hierfür wurden 1934 alle Russlanddeutschen auf einer Liste systematisch und zweckorientiert erfasst), verhaftet und in Arbeitslager, ab 1939 auch als GUlag bzw. Besserungsarbeitslager bezeichnet, deportiert. Die Rechte der Deutschen in Russland wurden abgeschafft und es kam erneut zum Verbot der deut-schen Sprache. 1936-38 wurde dann die deutsche Minderheit in Schnellgerichtsver-fahren zum Tode, zu Zwangsarbeit mit Lagerhaft verurteilt. Alle Intellektuellen wur-den getötet, nur die Bauern blieben verschont. 1939 schloss Hitler mit Stalin sieben Tage vor dem Überfall auf Polen einen Nichtangriffspakt, an den sich die Russen auch hielten und es in der Folge zu einer Umsiedlung der Deutschen nach Westpreu-ßen kam, wo einst Juden und Polen gelebt haben. Hitlers Überfall 1941 überraschte die Rote Armee, die erst 1942/43 in Stalingrad die Welle der deutschen Wehrmacht abwehren, Paroli bieten und schließlich abwenden konnte. Für die Russlanddeutschen bedeutete die Kriegszeit, die Vertreibung aus den Siedlungen an der Wolga und am
378 vgl. a.a.O. Cecil, S.: 139-141. 379 vgl. Dahlmann, D. (1999): Die Deportation der deutschen Bevölkerung in Russland und Sowjetunion. 1915-1941. Ein Vergleich. In: Gestrich, A, Hirschfeld, G. et al.: Ausweisung und Deportation. Stuttgart. S.: 104.
228
Schwarzen Meer und somit eine Auflösung und schrittweise Fragmentierung sowohl der Strukturen der Großfamilien als auch der Sozialstrukturen (Großeltern). 1945 kam es dann zu gezielten Umsiedlungen nach Sibirien und Mittelasien.380 In der Phase des Kalten Krieges verschlechterte sich die Lebenslage der Russlanddeutschen nochmals, sie wurden ausgrenzt, drangsaliert, stigmatisiert und als Nazis tituliert. Die geographische Zerstreuung der deutschen Minderheit über die gesamte Sowjetunion führte dazu, dass nur wenige russlanddeutsche Bewohner in einem Dorf lebten. Der Assimilationsdruck wurde dadurch erhöht und die Eltern der Russlanddeutschen sa-hen ein, dass nun Ihre Kinder russisch lernen sollten, um weitere Exklusionserfah-rungen zu reduzieren und einzugrenzen. Der Tod Stalins erweckte bei der deutschen Minderheit neue Hoffnungen auf ein normales Leben. Das war ein Irrtum, denn die Situation veränderte sich nicht. Erst im Dekret vom 13.12.1955 waren sie als freie Sowjetbürger anerkannt und waren somit wieder in die Lage, dorthin zu ziehen, wo-hin sie wollten.381
Ohne aktive und lebendige deutsche Gemeinden überlebte die russlanddeutsche Kul-tur nur in Ausnahmen. Selbst die deutsche Sprache, die nur noch im Haus gesprochen wurde, wenn überhaupt, verstummte zusehends. 1970 wurde die religiösen Bestim-mungen gelockert und es entwickelte sich wieder langsam aber stetig ein neues Selbstbewusstsein der Russlanddeutschen, dass zu einer vermehrten Ausreisewelle führte, bei der jüngeren Generation wurde eine Migrationsentwicklung vom Land in die Stadt vollzogen. Mit der Ernennung von M. Gorbatschow als neuen Kreml-Chef kam es zu einer Liberalisierung der Ausreise für die Russlanddeutschen. 1989 schlos-sen sich 105 Abgeordnete der deutschen Siedlungen zu einer „Unionsgemeinschaft der Sowjetdeutschen Widergeburt“ zusammen, mit der Zielsetzung, die russlanddeut-sche Kultur, Sprache und Tradition zu bewahren und zu revitalisieren. Sie beabsich-tigten weitere, neue Siedlungen zu bauen und verzichten auf Eigentumsansprüchen von ehemals enteignetem Landbesitz. Die BRD hat die sogenannten Rayons 1989 unter Selbstverwaltung in Russland gegründet und unterstützte die Organisation „Wiedergeburt“ bis 1994 mit annähernd 150 Mio. DM.382
Im Zeitraum von 1989-2007 sind insgesamt 2,2 Mio. Spätaussiedler aus der UDSSR bzw. ihren Nachfolgestaaten in die Bundesrepublik immigriert.383
Die Möglichkeit einer Familie, für eine Aufnahme als Spätaussiedler in der BRD, benötigt auch nur eine(n) Antragstellerin, wie das die Großmutter der Biographin nach langem Zuspruch der Mutter getan hat. Die Großmutter erfüllte die Zugangskri-terien, da sie als deutsche Volksangehörige im Sinne des Bundesvertriebenengesetzes nach § 6 Abs. 1.) gilt, wenn sie sich in ihrer Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekennen durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt wird. In Abs. 2 wird als Voraussetzung die familiäre
380 Ingenhorst, H. (1997): Die Russlanddeutschen. Frankfurt/ New York. S.: 42-53. 381 vgl. Schmitt-Rodermund, E. (1999): Zur Geschichte der Deutschen in den Ländern des ehemaligen Ost-blocks. In: Silbereisen, R ; Lantermann, E.-D.; Schmitt-Rodermund, E. (Hg.): Aussiedler in Deutschland. Op-laden, S.: 55 ff. 382 a.a.O. Ingenhorst, H. (1997), S.: 62-65. 383 Bundesverwaltungsamt (2007): Spätaussiedler und deren Angehörige, Verteilverfahren. Jahresstatistik 2007. Alter, Berufe, Religion.
229
Vermittlung der deutschen Sprache gefordert. Dieser Nachweis der Volkszugehörig-keit, ab 1993 dann stärker eingefordert, war ab 1996 mit einem Sprachtest verknüpft, forderte zudem das Bekenntnis zum deutschen Volkstum. Als deutsche Volkszuge-hörige gelten nur noch solche, die in einem mündlichen Test ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweisen, die sie nicht in einem Deutschkurs erworben haben dürfen.
Die Lebensverläufe gestalten sich unterschiedlich. Außer durch das Alter bei der Migration sind diese Biographien vor allem von der unterschiedlichen Form des fa-miliären Dialogs beeinflusst, abhängig davon, wie sich die Familiengeschichte und Ausreise vor, während, und nach der Immigration gestaltet und welche Erwartungen die Familie hinsichtlich ihrer Zugehörigkeitskonstruktion explizit und implizit an die Jugendlichen, an die Biographin, kommunizierte. Über die Motive zur Ausreise wurde sie nicht aufgeklärt, teils kommt es zu verwirrenden und widersprüchlichen Informationen über die Ausreise und die deutsche Abstammung, gleichzeitig werden hohe Leistungsansprüche und Erfolgserwartungen an die Kinder und Enkel vermit-telt. Der Umgang mit den Fragestellungen und einer diffusen Lebenslage führt oft auch gegenüber den Familien und der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu Provoka-tionen.384
Manche der Russlanddeutschen entsprechen dem in den Medien häufig produzierten Fremdbild von Kriminellen und Drogenabhängigen. Die Strategie, dem stigmatisie-renden Fremdbild zu entsprechen, diese ironisch zu übertreiben und dabei die Etab-lierten zu provozieren, ist zum einen eine demonstrative Bestätigung des abwertenden Fremdbildes und schafft auch davon ein differierendes Selbstbild. Das ist, so BOGNER (2007), leichter zu ertragen, als der von Misserfolg stets bedrohte, wenig aussichtsreiche Versuch, das Stigma durch bruchlose Anpassung an den Code der Etablierten zu widerlegen. Das betont nonkonforme Verhalten einiger Spätaussiedler kann als Antwort auf die Gruppenvorurteile der Aufnahmegesellschaft verstanden werden, wohingegen eine andere Gruppe Spätaussiedler teilweise mit viel Aufwand bemüht ist, sich anzupassen, unauffällig zu sein und möglichst nicht als Russland-deutsche erkennbar sein wollen.385
Bei Fr. Brandt überwiegt das Leugnen und Schweigen über die Herkunft. Beim Ver-bergen der eigenen Zugehörigkeit wiederholet sich ein bereits in der Sowjetunion etabliertes Handlungsmuster, das durch eine systematische Orientierung an den anti-zipierten Erwartungen und Forderungen der dominierenden Mehrheitsgesellschaft und durch die Verleugnung von allen Bestandteilen der eigenen Biographie gekenn-zeichnet ist, die diesen Erwartungen und Forderungen nicht entsprechen.386
384 Rosenthal, G; Stephan, V. (2011): Gegenwärtige Probleme der Zugehörigkeit und ihre historische Be-dingtheit. In: Brüchige Zugehörigkeit-Wie sich Familien von Russlanddeutschen ihre Geschichte erzählen von Rosenthal G; Stephan, V.; Radenbach, N. (2011). Campus Verlag. Frankfurt/M, S.: 16-17. 385 Bogner, A. (2003): Macht und die Genese sozialer Gruppen. In: Sociologus. Heft 23 (2), S.: 177. 386 a.a.O. (2011). S.:50.
230
Die Familiengeschichte, so ROSENTHAL & BOGNER387 stellt eine wichtige Bedin-gung für die eigene Zugehörigkeitskonstruktion dar. So erlebt sich auch die Biogra-phin nicht individuell und auf der Grundlage ihrer selbstständigen Entscheidung, im Zusammenhang ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit, sondern sie erwirbt eine solche Zugehörigkeit als ein Resultat ihrer Position in der Familie. Lücken und leere Stellen im Familiengedächtnis, die sich nicht ausfüllen lassen, können das eigene Zu-gehörigkeitserlebnis brüchig und problematisch werden lassen, wie das auch bei der Biographin der Fall ist.
Scham, so ELIAS, verdeutlicht, dass die Machtdifferenz zwischen der etablierten Ge-sellschaft und den Außenstehenden erhöht wird, gleichzeitig wird auch der Span-nungsdruck auf die Außenseiter erhöht.388
KÜRSAL-AHLERS ergänzt, dass Scham den Nachweis erbringe, dass die Stigmati-sierten die Etablierten und Mächtigen verinnerlicht haben. In diesem Sinne beschreibt Scham den Willen der Außenseiter, so zu werden wie die Etablierten, die wiederum aus Angst um ihre Machtposition Anstrengungen unternehmen, die Machtschwäche-ren auf Distanz zu halten und so den Anpassungsruck auf sie zu erhöhen. Der Anpas-sungsdruck mündet in Selbstkritik und Selbsttransformationsbemühungen. Scham beschreibt den Näheprozess der Außenseiter an der etablierten Gesellschaft und ist ein Indikator der Anpassung. Im Umkehrschluss sei jedoch ohne Schamgefühl eine Anpassung nicht möglich.389
Die Biographin verweigert sich den Selbstransformationsbemühungen sowohl inner-halb der Familie, als auch innerhalb der unzähligen Institutionen, Heimen und Klini-ken, die sie in den Jahren nach der Migration durchwandert.
Nach der Auflösung der Sowjetunion 1991, dem Mauerfall und der deutsch-deut-schen Wiedervereinigung veränderte sich das sozialpolitische Klima, indem die be-reits vorher bestehenden Grenzen zwischen Dazugehören und Außenseitern deutli-cher zum Vorschein traten. Der gesamte Wendeprozess unterstützte und beförderte ein Deutschland, welches das ethnische Abstammungsverhalten manifestierte und so der gruppenübergreifende und verbindende Slogan, „Wir sind das Volk!“ zu „Wir sind ein Volk!“ mutierte, der die ethnische Abstammung hervorhebt. Die Wahrneh-mung von Differenz, Unmut, Unverständnis und Misstrauen verdrängte die Freude über die Wiedervereinigung, die friedvoll, vom Volke aus und ohne Blut vergießen, erreicht wurde.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam insbesondere bei den Russland-deutschen eine ökonomische und soziale Unsicherheit und Instabilität auf. Ein Pro-zess des sozialen Abstiegs resultierte sich daraus, insbesondere in den sich neu kon-struierenden und konstituierenden Staatsgesellschaften Kasachstans und Kirgisiens verloren die deutschen Minderheiten ihren etablierten Status und fürchten sich erneut 387 vgl. Bogner A. Rosenthal G (2009): Introduction: Ethnicity, biography and options of belongings. In: Rosenthal, G /Bogner A. (Hg.): Ethnicity, Belonging and Biagraphy. Ethnographical and biographical Perspec-tives. Berlin. S.: 13. 388 Elias, N. (1990): Notizen zum Lebenslauf. In: Ders. Über sich selbst. Frankfurt/M. S.:161. 389 vgl. Kürsat-Ahlers, E. (2002): Stigmatisierung, Diskriminierung und ethische Schichtung. In Hartmut, M. Grise u.a. (Hg): Was ist eigentlich das Problem am „Ausländerproblem“? Über die soziale Durchschlagskraft ideologischer Konstrukte. Frankfurt/M. London, S. 50.
231
vor Diskriminierung, Verfolgung, Umsiedlungen und Deportation, wie das die groß-elterliche Generation in der Stalinistischen Ära schon einmal erlebt hatte. Der zuneh-mende Nationalismus in den Nachfolgestaaten der UDSSR produzierte schließlich ein verstärktes Fremdbild von den Deutschen und beförderte und entfachte den fami-lienbiographischen Entwurf, nach Deutschland auszuwandern. In diesem Sinne ent-stand in den Familien eine Rückwendung und Rückbesinnung zu einem ethnischen Wir-Bild als Deutsche hin zu einer Konstruktion von kollektiver und individueller Vergangenheit als verfolgte und diskriminierte Deutsche. Das Migrationsprojekt muss als Versuch verstanden werden, die von einer massiven Ungewissheit und Furcht geprägte neue Lebenssituation dieser folgenden Jahre zu bewältigen. Je mehr Deutsche die postsowjetischen Staaten verließen, desto mehr verstärkt sich die Au-ßenseiterposition vieler dort verbliebenen Deutschen, die lokale Minderheitenposi-tion und den Wegfall sozialer Netzwerke beklagen. Die sozialistische Vergangenheit macht ostdeutschen Bürger in den Augen der westdeutschen Bürger unfähig dazu, sich in eine freie, demokratische und sozialmarktwirtschaftlich orientierte Gesell-schaft und Arbeitswelt anzupassen.390
Die Wahrnehmung der ostdeutschen Fremdenfeindlichkeit, die sich auf reale Ereig-nisse, wie z.B. in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen oder Mölln zurückgeht, wird durch eine reale Bedrohung in der Kriminalitätsstatistik bestätigt, dass nämlich das Risiko, Opfer einer Gewalttat zu werden, für Nichtdeutsche im Osten 26x höher ist als im Westen der Republik.391
6.2.3. Erzähltes Leben -Text- und thematische Feldanalyse
Die Biographin, Fr. Brandt, wurde bereits, so erzählt die Mutter ihrer Adoptivmutter, einen Tag nach ihrer Geburt von der Mutter ihrer leiblichen Mutter, die schwer sucht-krank war, für die Dauer von drei Jahren in die Obhut eines russischen Säuglingshei-mes übergeben worden. Die Biographin lässt die ersten drei Lebensjahre in ihrer Nar-ration vollständig aus. Fast lässt sich zu Beginn des Interviews die Biographin in einen Strudel der Erzählung treiben, doch sie stoppt sich gleich nach der Eröffnungs-sequenz an einer Schlüsselstelle. „Da hatte ich noch Vater, ach Muttter, Oma und Opa (schnauft tief durch) der hat mich ähm..ja. ähm..ähm..ich bin..da hat ähm (schnell) da bin ich bei meiner Oma gewesen, die meiste Zeit bis zur 2.Klasse.“392 Danach setzt die Biographin in der Textsorte Beschreibung393 fort und konstruiert nüchtern und sachlich die Drogenabhängigkeit des Vaters und die nach dem „golde-nen Schuss“ wieder aufblühende (Exacerbation) der bekannten Alkoholabhängigkeit der Mutter. Die weiteren Lebensjahre, ab der Aufnahme in ihre Adoptivfamilie, vom
390 Rauschbach, B. (1992): Erbschaft aus Vergessenheit. In: Ders. (Hg): Erinnern Wiederholen Durcharbeiten. Zur Psychoanalyse deutscher Wenden. Berlin, S.: 26-55. 391 Der Spiegel (2000): Nr. 32 vom 7.8.2000, S.: 26; 28. 392 Interview: Fr. Brandt. Teil 1, S. 1. Zeile: 14-19. 393 In autobiographischen Erzählungen haben Beschreibungen die wichtige Funktion, den Ereignisraum des Geschehens auszugestalten und sprachlich die interessierenden Aspekte der Welt des Erzählers zu konstruieren und zu charakterisieren; es geht darum, was für ihn im Zusammenhang mit seiner Erzählung zu seiner Welt gehört, wie diese beschaffen ist und wie sie funktioniert. (LUCIUS-HOENE, DEPPERMANN 2006) Häufig dienen sie als orientierte Passagen in der lebensgeschichtliche Konstruktion, um Orte der Kindheit oder Fami-liensituation zum Zeitpunkt der Geburt oder wie in diesem Fall, zum Zeitpunkt als die Biographin in die Adop-tivfamilie aufgenommen wurde. Sie umfassen i.d.R. Lebensthemen, die nicht weiter ausgeführt werden können oder sollen, aufgrund emotionaler Bedeutsamkeit.
232
dritten bis zum achten Lebensjahr, lässt sie stark fragmentarisch aus und deutete die negativen Ereignisse im Säuglingsheim und bei den Großeltern nur marginal, dafür umso folgenschwerer, an.
Wie die Versorgung, die Betreuung des Pflegestandards in einem russischen Säug-lingsheim der 80er Jahre aussahen, kann in pädiatrischen Fachbüchern zur Mangel-versorgung, Mangelzuständen, Formen von Deprivationen, Hospitalismus oder feh-lende körperliche Nähe nachgelesen werden. Die einzigen Erinnerungen, die Fr. Brandt noch aus der Zeit im Säuglingsheim hatte, beschreibt sie so, dass sie einmal großen Hunger hatte und etwas essen wollte und nach Essen verlangte. Ihr Bedürfnis blieb von den Kinderpflegerinnen unerhört. Schließlich schrie und tobte die Biogra-phin. Als Reaktion darauf wurde sie auf ihr Bett geschmissen, „festgemacht“ und dann treten Erinnerungslücken in der Narration ein.394 Die spätere herausgebildete Herzschädigung der Biographin infolge einer frühkindlichen Mangel- und Fehlernäh-rung, wird mutmaßlich in Zusammenhang mit der frühen Hospitalisierung gebracht, so die Aussage eines Oberarztes, der Fr. Brandt viele Jahre später fachärztlich behan-delte. Die ersten acht Jahre, die durch Auslassungen der Biographin „als fast weißes Papier“ zur Verfügung stehen, sind durch ein instabiles, chaotisches Bezugs-, und Familiensystem mit diffusen Rollenzuordnungen innerhalb der Familie gekennzeich-net.
Bereits kurz nach der Aufnahme in die „neue“ Adoptivfamilie stellt die Biographin fest, dass sie zum 2. Mal ihren Vater verliert. Während der leibliche Vater erst gar nicht in ihr Gesichtsfeld eintritt, findet sie mit 4 Jahren, gemeinsam mit ihrer Adop-tivmutter, ihren Adoptivvater mit einer Überdosis Drogen in der Badewanne tot auf. Der Verlust auf körperlicher und emotionaler Ebene wiederholt sich auch bei der leiblichen Mutter, die sie nicht kennenlernen wird. Als Reaktion auf den Drogentot des Partners beginnt die alkoholkranke Adoptivmutter ihre Trauer exzessiv mit Wod-kakonsum „wegzutrinken“ und wird im Zuge der unkontrollierten Räusche, die mit schweren Kontrollverlusten gegenüber der Biographin einhergehen, immer wieder gewalttätig. Ein gewalttätiger Umgang mit der Biographin ist eines der zentralen, prägenden und durchgängigen Erfahrungsmuster, das sich bei der Biographin durch alle Lebensphasen und Aufenthaltsorte (vom Säuglingsheim - in der Adoptivfamilie - in der Schule-innerhalb der Partnerschaften - in den Heimen - in der Psychiatrie) hindurchzieht. Inmitten der Trauerphase über den Drogentot des Mannes wird die Biographin zu den Großeltern aufs Land „verschickt“. Dort verbringt sie die folgen-den vier Jahre in den großen Sommerferien, die knapp vier Monate wegen der vorge-gebenen Erntezeiten andauern. Während die Adoptivmutter kurze Zeit darauf wieder einen neuen Partner findet, der Imker ist und sich in der Hochphase der Ernte um seine dezentral verstreuten Bienenstöcke kümmert, wähnt die Adoptivmutter ihre Tochter in Sicherheit. Bei den Großeltern kommt es unter der Woche zu einem gere-gelten strukturellen Ablauf, den die Großmutter sicherstellte und die ihre Enkelin mit Zuneigung und Wärme begegnete. An den Wochenenden hingegen fuhr die Groß-mutter auf die Märkte in der Umgebung und bot ihr Gemüse und Obst feil, während-dessen kam es zu sexuellem Missbrauch durch den Großvater, der seine Enkelin im
394 Interview. Fr. Brandt, Teil 2, S. 1-2, Zeile: 21-36: „Ich wollte was essen, dann wurde ich aufs Bett ge-schmissen und weiß dann nicht mehr (…) vielleicht haben die aus (unverständlich) das Bett (verstummt)….“
233
Keller unter Todesandrohung einschließt. In den angedeuteten Interviewpassagen und offensichtlichen Auslassungen erwähnt sie, dass dann komische Dinge gesche-hen sind und sie darüber hier und auch jetzt nicht reden wolle. Die Biographin be-richtete ferner, dass sie mit ihren beiden Cousinen gemeinsam einen Sommer bei den Großeltern verbrachte. In ihrer Erinnerung holte dann ihre Tante ihre beiden Töchter, die Fr. Brandt in der Folge lange Zeit nicht mehr zu Gesicht bekommen wird, plötz-lich und abrupt wieder zurück. Die Biographin selbst war dann ihrem Großvater al-leine ausgesetzt.
Die Biographin beharrte auf die Rolle der Außenseiterin schon alleine durch ihre eth-nische Herkunft, durch ihre sprachliche Auffälligkeit, durch ihren jungenhaften Klei-dungsstil und durch ihren kleinen und schmächtigen Wuchs. Sie wird trotz Anpas-sungsbemühungen in der Schule und in den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen immer wieder zum Zielobjekt von Gewalttätigkeiten, Hänseleien und Diskriminie-rungen. Zuhause ist die Biographin zusätzlich den gewaltsamen Ausbrüchen der Mut-ter infolge exzessiven Trinkens ausgesetzt.
Anfang der 90er Jahre dominierte auf dem Land in weiten Teilen Thüringens eine fremdenfeindliche Stimmung, in der keine Unterschiede zwischen russlanddeutschen Übersiedlern oder anderen ausländischen Bürgern vollzogen wurde. Die Hoffnung der Adoptivmutter und der Oma, die sich schon nach kurzer Zeit in Luft auflöste, war es, durch die Übersiedlung nach Deutschland, weiteren Stigmatisierungen, Brand-markungen, behördlichen Repressionen, Benachteiligung, Bedrohungen sowie wirt-schaftliche, kulturelle, schulische und berufliche Barrieren, Begrenzungen und Ver-bote zu entgehen, die gegenüber den deutschstämmigen Minderheiten in den ehemaligen Sowjetrepubliken eine gezielte und systematische Anwendung gefunden hatte.
Die kollektive Stigmatisierung findet bei der Biographin eine individuelle, personen-zentrierte Fortsetzung. In der Selbstbeschreibung reagiert sie als Widerstandskämp-ferin, die durch eine dauerhafte Bereitschaft für Mobilität, einer sich androhenden oder realen Entrechtung, Stigmatisierung, Gewalt oder Unterdrückung zu entziehen versucht. Die Biographin ist kompetent darin, sich immer wieder den jeweiligen Zu-ständen und wechselnden Einrichtungsbedingungen anzupassen. Sie präsentiert sich als jemand, die von sich aus nicht aktiv Hilfe und Unterstützung einholt, sondern sie hofft vielmehr auf Impulse und Verantwortungsübernahme von Dritten, die dann in einem fremdbestimmten Sinne für sie, bzw. an ihrer statt, entscheiden. Diese Rolle übernehmen Lehrer, das Jugendamt, das Gericht, die gesetzliche Betreuerin, die Heimleitung, der Arzt, die Polizei etc.
Zusätzlich übernehmen staatliche Instanzen und Institutionen, soziale Einrichtungen, Heime oder Kliniken für die Biographin die Regulation von Nähe und Distanz ge-genüber Personen, die die Biographin schädigen oder negativ beeinflussen.
Das erfolgreiche und kompetente Unterleben der Biographin in den Jugendheimen, Institutionen und psychiatrischen Kliniken stellt eine Anpassungsleistung dar, die sie sich angeeignet und notwendigerweise entwickelt hat. So taucht bei der Biographin immer wieder resilientes Verhalten auf, in dem sie Anteile ihrer Identität und ihres Wesens zugunsten ihrer Anpassungsleistung und Anerkennungsbemühungen unter
234
den Peers aufgibt. Sie entwickelte sich als einziges Mädchen inmitten eines Jugend-heimes, das ausschließlich für Jungen eingerichtet war, im Zuge einer Metamorphose, zu einem „girl-boy“. Sie nimmt und anerkennt einerseits die Identität als Mädchen an, anderseits eignet sie sich im Verhalten einen ruppigen, resoluten, burschikosen und körperbetonten Umgang an, wie er unter den Jungen vorherrscht.
Die Biographin nimmt ab ihrem 13. Lebensjahr wahr, dass sie sich in einem Nega-tivstrudel von Institutionen befindet, der durch eine erste Diagnostik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie initialisiert wird. Von dem Zeitpunkt an zeigt und beschreibt die Biographin bei sich fortlaufend und perpetuierend selbstschädigendes Verhalten in unterschiedlichen Formen. Sie beginnt, mit Vehemenz, sich selbst abzulehnen. Sie hasst sich, ihr Essverhalten gestaltet sich mal bulimisch dann im Wechsel wieder le-bensbedrohlich anorektisch aus. Es kommt zu einer frühen psychiatrischen Etikettie-rung, einer anhaltenden und stark sedierenden Medikalisierung und zu häufigen Hos-pitalisierungen, in deren Verlauf mit unterschiedlichen Medikationen versucht wird, Einfluss auf die häufig und plötzlich aufkommenden Krisen zu nehmen.
Die Biographin bekommt ausschließlich in den Momenten für sich Bedeutung und gewinnt an Selbstwert, wenn sie die Rolle der Hilfsempfängerin verlassen kann und zu einer Person wird, die anderen etwas zeigen, erklären oder Wissen und Erfahrung weitergeben kann.
Sie stößt bei ihrer Mutter, mit ihrem Wunsch, nach schulischer Entwicklung und Aus-bildung auf Widerstand und Unverständnis, die ein frühes Geldverdienen, wie sie das selbst erlebt hat, zugunsten eines Verzichts auf Schule und berufliche Entwicklung, einfordert. Die Mutter holt die Biographin sogar aus der Schule raus, da sie der Mei-nung ist, „das bringe eh nichts, die soll jetzt Geld verdienen und weniger spinnen.“
Die dann einsetzende Dringlichkeit und hohe Frequenz von psychiatrischen Hospita-lisierungen stellen einen nachvollziehbaren und überzeugenden Grund für die Nicht-Beschulung von Fr. Brandt dar, so dass sie nur bis zur 7. Klasse die Schule besucht. So kommt es bei der Biographin zugunsten weiterer episodischen Krankheitsphasen zu einem Verzicht einer schulisch intellektuellen Entwicklung und einer entspre-chend anschlussbedingten beruflichen Ausbildung.
Dritte entscheiden von nun an kontinuierlich und fremdbestimmt über den Aufent-haltsort, die Dauer ihre Aufenthaltes, die Art und Weise der Behandlung oder sogar über die Anwendung von Zwang und Gewalt durch z. B. Infusionen, Bett-Fixierun-gen, Zimmer-Einschlüsse oder geschlossene Stationstüren. Dritte bestimmen, ob Fr. Brandt gegen ihren Willen in einem Überwachungszimmer mit Kameras zu liegen hat oder nicht und lösen somit die letzten Grenzen von Intimität auf.
Die Ablösung und Trennung von der Mutter und Oma gelingt Fr. Brandt durch eine Partnerschaft mit 17 Jahren und einer klaren Ankündigung zum Vorgehen der nächs-ten Schritte: „Der Partner versorgt mich, wir heiraten, ziehen zusammen und bekom-men Kinder.“
Die Projektion ihrer Wünsche und Träume, fokussiert die Biographin vollständig auf ihre erste romantische Partnerschaft, auf einen Jungen, den sie auch aus der Zeit im Kinder- und Jugendheim kennengelernt hat. Die Aussicht auf diese Partnerschaft ist
235
gleichzeitig ein Synonym dafür, wieder bzw. überhaupt eine Zukunft zu haben. Die Partnerschaft lässt Hoffnung, Sicherheit und Halt aufkeimen, sowie die Aussicht auf ein wirtschaftliches Auskommen und eine Grundversorgung, sowie ein endgültig vollzogener Entzug aus dem mütterlichen Gesichtsfeld.
Just in dieser entscheidenden Phase, die einen Wendepunkt der Biographie hätte dar-stellen können, steht eine Ablösung und wirtschaftlich versorgende Perspektive der Biographin durch den Verlobten in Aussicht, entschloss sich die Mutter mit der Groß-mutter nach Stuttgart zuziehen. Die Mutter hatte einen besserbezahlten Beschäfti-gungsvertrag in der Altenpflege abgeschlossen. Just an diesem potentiellen Wende-punkt kommt es abrupt und plötzlich zu einem tragischen und tödlichen Busunfall des Verlobten. Das bis heute hineinwirkende schlechte Gewissen und die Verantwor-tung für den Unfalltod des Verlobten führt bei Fr. Brandt immer wieder zu schweren suizidalen Krisen und selbstverletzenden Verhalten, die meist mit einer psychiatri-schen Hospitalisierung beantwortet werden.
Die Biographin präsentierte sich von ihrem Werdegang und Lebenslauf her innerhalb einer zeitlich chronologischen Struktur. Der vorab erstellte, detaillierte und ausfor-mulierte Lebenslauf stellte für Fr. Brandt eine gute Orientierung in den Interviews dar. Daraus ergibt sich eine Einrichtungsmatrix, im Sinne einer fortlaufend perpetu-ierenden Trans-Institutionalisierung. Die Biographin durchwanderte unterschiedliche Einrichtungstypen. Anfangs ein Säuglingsheim, dann Kinder- und Jugendhilfeheime, psychiatrische und psychotherapeutische Fachkliniken, eine Einrichtung der Woh-nungsnotfallhilfe bis hin zu ambulanten und stationären Einrichtungen der Einglie-derungshilfe mit spezifischen und zunehmend strukturierenden Behandlungssetting, in offenen und geschlossen-beschützenden Formen.
Nach mehreren Heimaufenthalten wählte die Biographin erneut, wenn auch nur für kurze Zeit, das Zusammenleben mit ihrer Mutter und Großmutter. „Dann bin ich halt ebend bei ihr geblieben!“, das erneut durch einen Mutter-Tochter Konflikt eskalierte und die Biographin in die Obdachlosigkeit trieb.
Infolge selbstschädigenden Verhaltens, das bei der Biographin, ein wesentliches Kernsymptom der Persönlichkeitsstörung vom emotional-instabilen Typ darstellt, wechselte sie in zunehmend rasanter Geschwindigkeit und Abfolge die Hilfsformen und Felder der Sozialen Arbeit. In Krisen kommt die Biographin in ein psychiatri-sches Krankenhaus, auf eine Intensivstation, in eine Wohnungsnotfallhilfe, wieder in ein offenes Heim, wieder in die Klinik usw. Durch ein hochriskantes Verhalten der Biographin, indem sie Fußball oder Basketball spielt bis sie blaue Lippen bekommt und infolge Herz- und Kreislaufbeschwerden, indem sie auf Mauern, Dächern um-herklettert, indem sie auf dem Essenswagen der Klinikstation durch die Flure surft und Karambolagen provoziert, zielt sie auf ihre Selbstschädigung ab. Die Biographin lenkt so permanent von einem Innehalten einer aktuellen und gegenwärtigen Orts- und Situations-bestimmung ab. Sobald Stunden oder wenige Tage einkehren, die durch Routinen des Alltags geprägt sind, kommt es zu Ruhestörungen im Zimmer, zu verbal aggressiven Entgleisungen. Es kommt zur Essensverweigerung und Selbstver-letzungen mit Tabletten und durch scharfe Gegenständen. Die Biographin schluckt scharfe Kleinteile, brennt sich mit Zigaretten oder versucht sich sogar anzuzünden.
236
Diese Handlungen vollzieht sie, ohne dabei im Anschluss daran, Erinnerungen abzu-speichern. Diese Handlungen vollzieht sie im Zuge von retraumatisierenden Flash-backs, die sie nicht kontrollieren kann, die durch Musik, durch ein bestimmtes Ver-halten, durch Personen, Gerüche oder Situation aber auch durch Gedanken und Erinnerungen ausgelöst und auch selbstinitialisiert werden können.
Die Biographin oszilliert dauerhaft zwischen suizidalen Krisen, die von Fremdbe-stimmung und Institutionalisierung gekennzeichnet sind und Phasen, in den sie vor-sichtig Lebenswillen zeigt und den Wunsch äußert, wieder auf die Beine zu kommen. In den Phasen des Lebenswillen, handelte es sich gerade um drei zeitlich definierte Phasen, in denen sich die Biographin in einer partnerschaftlichen Beziehung befun-den hat. In diesen Phasen glaubt sie an eine Zukunft, sie kann sich sie von ihrer Mutter ablösen, in diesen Phasen gelingt ihr ein fast institutionsfreies Leben, wenigstens in einem ambulanten Betreuungssetting. Während der zweiten Partnerschaft wohnte Fr. Brandt in einer Trägerwohnung und wurde ambulant betreut. Sie ging in der Zeit regelmäßig einer Beschäftigung nach. Während der dritten Partnerschaft kam es zu-nächst zu einer sichtbar Stabilisierung innerhalb des geschlossenen Wohnbereichs. Doch wie beim zweiten Partner wählte Fr. Brandt erneut einen suchtkranken Partner aus, der sich nach erneuten Rückfällen aus der Partnerschaft entzieht.
So gerät die Biographin sowohl innerhalb des Familiensystems als auch außerhalb des familiären Systems auf Personen, die sie mittel- oder unmittelbar schädigen, auf sie negativen Einfluss nehmen oder die Biographin in co-abhängige Beziehungsstruk-turen drängen.
Die Biographin erweist sich als äußerst kompetent im Unterleben, beim Anpassen Taktieren und sich orientieren inmitten der institutionellen Subkultur. Sie kann sich darin behaupten, versucht zu ihrem Vorteil unter den Bewohnern Strippen zu ziehen. Sie versucht Einfluss auf die Wohnatmosphäre zu gewinnen, sie versucht innerhalb der Hierarchie, Machtverhältnisse unter den Bewohnern zu sichern. Sie setzt ihre Boy-girl-Identität ein, um sich durchzusetzen, zu überzeugen, mal mit Lautstärke und radikalen Widerstand, mal mit Einfühlungsvermögen und Charme.
Die Biographin geht immer wieder über ihre eigenen Leistungsgrenzen und Energie-ressourcen hinweg, vernachlässigt dabei sich, ihren Körper und gerät so in lebensbe-drohliche Situationen.
Sobald die Biographin Unrecht oder Ungerechtigkeiten auch bei anderen in den In-stitutionen wahrnimmt, setzt sie ihre Essstörung in einem instrumentalisierenden Sinne ein, um ein institutionelles Verhalten zu provozieren, um eine Handlung zu erpressen und bringt so demonstrativ ihren Protest zum Ausdruck. Sie verhält sich dann wie ein politischer Häftling, der sich in einem diktatorisch-repressiven Staat befindet. Die Biographin verhält sich dann konsequent ablehnend und kompromisslos bis ein komatöser Zustand, eine massive Sturzgefährdung oder Unterversorgung droht.
Die Biographin kann mit Hilfe von Institutionen, die Nähe und den Abstand sowie den Einfluss durch die Mutter regulieren. Selbst durch eine umfassende Aufklärung des Krankheitsbildes der Biographin durch die Cousine bleibt die Biographin für die
237
Mutter eine „persona non grata“, für die sie sich schämt, deren Existenz sie sogar gegenüber der Verwandtschaft ihres dritten Mannes leugnet
Die Beziehung und Erziehung der Mutter vergleicht die Biographin mit einem gebo-genen Eisen, das mit viel Krafteinwirkung von außen durch körperliche Gewaltein-wirkung behauen wurde. Mit dem Ziel, sich „eine kleine nette Barbiepuppe zu recht“ zu drapieren. Ihre Mutter beabsichtigte eine mädchenhafte Puppe zu erschaffen, die lieb, nett, angepasst, wunschlos, bedürfnislos sei, die keinen eigenen Willen habe. Ihre Mutter wollte sie, ähnlich wie bei einer Barbiepuppe, stets mit bunten Mädchen-kleidern schmücken und „aufhübschen“. Die spätere Auflehnung gegenüber der Mut-ter, und die gesamte Identitätsentwicklung zu einem „girl-boy“ sind dann in einem neuen Lichte zu verstehen.
Die Biographin bedauert und bemängelt das Ausgeliefert-Sein an den Großvater, der sicher auch gegenüber ihrer Mutter übergriffig gewesen sei. Sie bemängelte den aus-bleibenden Schutz und die fehlende Fürsorge der Mutter vor der Gefahr, die sie doch offensichtlich selbst kannte und erlebte. Sie bemängelte die Forderung der Mutter, dass der Schulbesuch eh nichts nütze und übersprungen werden könne, da sie eine Tochter bevorzuge, die möglichst früh Geld verdiene, um auf eigenen Beinen zu ste-hen und die den Dreifrauenhaushalt zu entlasten habe, statt dem Staat auf der Tasche zu liegen.
Die Biographin beschreibt ihre Mutter als eine boshafte, manipulierende zischelnde Schlange und attestiert ihr ein fehlendes Anzeichen von Wärme, Menschlichkeit und Herz. Sie sei eine Person, die Einrichtungen und Profis durch ihr Äußeres, durch ihre sprachliche Ausdruckskraft zu blenden versuche. Aus Sicht von Fr. Brandt seien bis-her alle auf die „Blendkraft“ ihrer Mutter hereingefallen.
Ein weitere identitätsstiftende Entscheidung, die die Biographin als positives Lebens-ereignis akzentuierte, ist die Konvertierung vom russisch-orthodoxen zum protestan-tischen Glauben, die durch eine Erzieherin eines unter evangelischer Trägerschaft stehenden Kinderheims, die sich als Taufzeugin zur Verfügung stellte, in die Wege geleitet wurde. Die Biographin beabsichtigte mit diesem selbst geäußerten Wunsch, sich von ihrer Herkunftsfamilie, zumindest bei der Konfessionszugehörigkeit, abzu-grenzen.
Fr. Brandt versucht vom geschlossenen Heim aus, Kontakt zu den Ehemaligen der Kinder- und Jugendheime über facebook herzustellen. Sie schreibt mehrfach russi-sche TV- Kanäle an, die in ihrem Herkunftsland Formate senden, in denen z.B. die Tochter ihre leiblichen Eltern sucht und es dann zu einer inszeniert tragisch-kitschi-gen Familienzusammenführung kommt. Sie wird aber mehrfach vom Sender abge-lehnt, da es zu aussichtslos erscheine, zu wenig erfolgversprechend sei.
Die Biographin stellt das Thema Essen, Nahrungsaufnahme und Hungerbefriedigung, ausgehend von einer ihrer ersten Erinnerungen im Säuglingsheim in den Mittelpunkt ihrer biographischen Erzählung. Das habe sich bis heute nicht groß verändert. Buli-mie, Anorexie und Essensverweigerung seien Reaktionsmuster, die bei bestimmten Problemen und Konflikten in Gang kommen. Es beginne anfänglich mit einer Appe-
238
titlosigkeit, und ende typischerweise in einem Koma mit Fixierung und Zwangsinfu-sionen. Sie beschreibt sich als jemand, die die Erfahrung gemacht habe, dass auf ihr Hunger- und Grundbedürfnis eh nicht reagiert wurde und sie zwangsläufig in Man-gelzustände geraten sei.
Als sie in der neuen Adoptivfamilie aufgenommen wurde, berichtet Fr. Brandt aus-schließlich über positive Erfahrungen mit ihrem Vater, der mit ihr spielte und über ihre Großmutter, die durchgehend die Bezugsperson und die Ernährerin der Familie gewesen sei. Für ihre Mutter hat die Biographin nur negative Etikettierungen und Adjektive, wie z.B. boshaft, eiskalt, falsch, täuschend, gewaltsam etc. übrig.
Fr. Brandt polarisierte die Oma und Mutter, indem sie einerseits der Mutter zum Vor-wurf macht, sie habe sie nicht vor dem Übergriffen des Großvaters in den großen Ferien geschützt und sie somit vollständig ausgeliefert und preisgegebene, anderer-seits idealisierte sie ihre Großmutter, obwohl diese ihre Enkelin auch in unmittelbarer Nähe und Einflusskreis nicht vor den Übergriffen schützen konnte. Die Biographin assoziierte ihre Oma, mit dem Zugang in einen reich bestellten Garten voll mit Ge-müse und Obst, zu dem sie freien Zugang hatte und sich dort nach Herzenslust bedie-nen durfte. Insbesondere das Naschen der großen Herzkirschen haben es ihr angetan. Diese Vorliebe behält Fr. Brandt bis heute bei.
Die Biographin hebt hervor, sie wolle diese schlimmen Erfahrungen mit ihrem Groß-vater nicht aussprechen. Sie erinnere sich gut und habe über die Erlebnisse einer The-rapeutin berichtet. Später sogar ihrer Mutter und Großmutter.
Die Biographin erinnerte sich lediglich an ein einziges gemeinsames Erlebnis, das sie mit ihren Adoptiveltern erlebt habe, als diese mit ihr über Land gefahren sind, um die Bienenstöcke, die der zweite Vater unterhielt, umzusetzen.
Die Übersiedlung nach Deutschland beschreibt Fr. Brandt als eindrückliches Ereig-nis, zumal sie in eine Schule auf dem thüringischen Land kurz nach der Wende ohne Deutschkenntnisse eingeschult wurde. Die folgenden vier Grundschulklassen, „allein unter lauter Deutschen“ waren für Fr. Brandt durchgehend geprägt mit seelischer und körperlicher Gewalt. In den Pausen oder auf dem Schulweg, selbst im Unterricht wurde sie wegen ihrer Körpergröße, ihrer Gesichtszüge, ihrer Kleidung und sprach-lichen Fähigkeiten gehänselt, sie war dauerhaft fremdenfeindlichen Abwertungen, Ausgrenzungen und Stigmatisierungen ausgesetzt gewesen.
Sie vergleicht diese Zeit mit dem Ausgeliefert-Sein an ihren Großvater, „ (…) da ich mich sprachlich nicht bemerkbar machen konnte, war ich auch nicht in der Lage, Hilfe beim Lehrer zu holen. Erst zu Hause stellte die Oma jetze, immer wieder blaue Flecken und Verletzungen fest, am Körper“. Die Oma versuchte ihre Enkelin zu schützen und zu verteidigen, in dem sie sogar beim Rektor vorsprach. In einem Zu-stand völliger Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit kam es zu einer Tablettenüber-dosis auf der Schultoilette. Sie wurde von Mitschülern gefunden. Die Schulleitung, die Schulbehörde, das Jugendamt, das Gericht und die Polizei intervenieren und staat-liche Institutionen entschieden zum Wohl des Kindes für eine Herausnahme aus der Familie, um Fr. Brandt auch vor weiteren körperlichen Übergriffen der Mutter zu
239
schützen. Der Mutter wurde das Sorgerecht entzogen, Fr. Brandt wurde in ein Kin-derheim überstellt. Dort kann sich die Biographin schnell und erfolgreich an die von Jungen dominierende Welt anpassen, mit einer entsprechenden Kleidung und Ver-halten.
Die Biographin lässt offen, ob sie sich für den plötzlichen Drogentot ihres Vaters, oder für die Trennung, die Scheidung ihrer alkoholabhängigen Mutter verantwortlich fühlt. Es ist unklar, ob sie denkt, dass sie selbst der Anlass für die fortwährenden Konflikte zwischen den Eltern, zwischen der Oma und der Mutter sei.
Aus Sicht der Biographin durchläuft ihre Mutter in ihrer Erinnerung vier Trinkpha-sen. Die 1. als direkte Reaktion auf den Drogentot ihres ersten Mannes, und somit auf den Verlust und Auflösungsprozess der Familie. In diese Phase fällt auch der Ab-schied von einer lange gehegten Hoffnung, den Status als kinderloses Paar, schmerz-haft anzuerkennen, und sich schließlich durch eine hohe Ablösung der Biographin aus dem Säuglingsheim einen Horizont als Familie zu strukturieren. Wie lange die Phase der Kinderlosigkeit anhielt, ob es zu zermürbenden Vorwürfen und Schuldun-terstellungen kam oder ob ein Elternteil aufgrund einer medizinischen Indikation keine Kinder bekommen konnte, bleibt im Unklaren. In welche Aufgabe und Funk-tion wurde nun Fr. Brandt hineingeboren, die sich bei bereits stark vorbelasteten suchtkranken Eltern, die eine stark perforierte Beziehung führen, wiederfindet? Die 2. Trinkphase durchlief die Mutter im Zuge des Migrationsprojekts und der Übersied-lung der Großeltern und der Biographin nach Deutschland. Die 3. Trinkphase vollzog die Mutter nach der Trennung des 2. arabischen Ehemanns, der nach fünf Jahren Ehe einen gesicherten Aufenthaltstitel erwarb. Die 4. Trinkphase beginnt, so die Ausfüh-rung der Biographin, seitdem es der Oma gesundheitlich schlechter geht, sie pflege-bedürftig wird und sich eine dementielle Erkrankung herausbildet. Gleichzeitig kann die Biographin nicht mehr der Oma als Helferin im Alltag stundenweise zur Hand gehen, da sie seit 2011 fast dauerhaft in einer geschlossenen Einrichtung lebt und fast nur begleitenden Ausgang hat.
Die Biographin vermisst zeitlebens ein Frauenmodell, das zu ihrer Identitätsentwick-lung beiträgt und entwickelt im Verlauf eine Girl-boy-Identität. „Innen wie ein Mäd-chen und im Verhalten wie ein Junge.“ Für Fr. Brandt ist Mädchen-Sein ein Synonym für Zurückhaltung und Passivität, wohingegen Jungen-Sein bedeutet, den Mund auf-zumachen, impulsiv zu sein und sich, wenn nötig, körperlich auseinanderzusetzen und zu wehren. Innerhalb der verschiedenen Heime nimmt Fr. Brandt, bezogen auf ihre geschlechtliche Identität, eine Außenseiterrolle ein und begrenzt ihre männlichen Altersgenossen, in dem sie einfordert, „ihr sollt auch mal Respekt mir über bezeu-gen“.
In Konfliktsituationen passt sich Fr. Brandt einem männerspezifischen Verhalten an, indem sie umher schreit, laut Musik aufdreht, Streit und Auseinandersetzung sucht, launisch ist und Mitarbeitende provoziert und beschimpft. Sie unterscheide sich je-doch darin, dass sie nicht so sehr körperlich drohe, wie das die Jungen gleich ma-chen“.
Der Biographin gelingt es, mit langen Pausen, in denen sie nachdenkt, sich genau und detailliert an die Geschehnisse und Ereignisse in ihrer Biographie zu erinnern. Es
240
gelingt ihr, diese chronologisch in eine lückenlose zeitliche Struktur einzuordnen und wiederzugeben.
Insbesondere im Erzählvorgang werden die in die Vergangenheit wirksame Regeln wieder virulent, da die Erzählungen von selbsterlebten Situationen im Gegensatz zu Argumentation und teilweise auch Beschreibungen des Erzählers viel leichter in ei-nen Erinnerungsvorgang und damit in eine größere Nähe zu den vergangenen Situa-tionen bringen können, so ROSENTHAL.395 So kommt es bei der Biographin an meh-reren Stellen der Interviews zu Textstellen der Narration, in denen sie sich im Verlauf selbstvergessen hinfort nehmen lässt und so eine große Nähe zu den erlebten und vergangen Situationen erlebt. Sie rekonstruiert, reinszeniert sie in derselben Laut-stärke, in verstellten Stimmen, in derselben Emotionalität, fast eins zu eins dar, und ist danach so erschöpft, dass sie Pausen benötigt, um eine Zigarette zu rauchen oder einfach nur um 5 Minuten still dazusitzen.
Erleichterung und Entspannung erlebte Fr. Brandt durch ihre Unterbringung in einem Kinder- und Jugendheim, ebenso bei dem Sorgerechtsentzug und der Inobhutnahme durch das Jugendamt. Die Mutter, die nach der Heimunterbringung noch versuchte, ihren Einfluss geltend zu machen und ihrer Tochter „mit dem Tod droht, wenn ich dich erwische“, wurde durch russisch sprechende Erzieher entlarvt, die die Drohun-gen am Telefon aufgenommen und so eine vom Gericht verordnete Bannmeile im Zuge einer Verfügung eines Annäherungsverbotes erwirken konnten. „Die hätte mir das Leben damals noch schwieriger gemacht als es schon war.“, so die Biographin 396
Fr. Brandt berichtete immer wieder von den verbalen und teilweise fremdaggressiven Übergriffen der Mutter gegenüber der inzwischen über 80-jährigen Großmutter.
Das Bild, das die Mutter nach außen hin bemüht ist, aufrecht zu erhalten, bricht durch die Heimunterbringung und die Veröffentlichung des gewalttätigen Erziehungsstils und der häuslichen Atmosphäre auf. Das nach außen hin abgeschottete Familiensys-tem wird entlarvt und dechiffriert.
Auf die Frage, wie die Biographin die diagnostische Etikettierung „instabile Persön-lichkeitsstörung vom Borderline-Typ“ wahrnimmt, entgegnet sie: „(…) Sie habe Stimmungsschwankungen und Gefühlsüberrumpelungen (…) innerhalb einer Minute könne sich das ändern, vom Guten gleich auf ganz abstürzend, Hr. Masanz, (….) das ist doch nicht normal!“(sehr laut)
Sobald die Biographin die Rolle der Heimbewohnerin, die sie als hilfebedürftig per se bewertet, verlässt, und in eine andere Rolle wechselt, erlebt sie sich als bedeutsam, wichtig und gebraucht. „Wir waren sozusagen die Wichtigen, in ne ganz anderen Rolle und die, die im Heim waren, in der Situation dann ne (…) die Hilfebedürftigen,
395 Rosentahl, G. (2009): die Biographie im Kontext der Familien und Gesellschaftsgeschichte. In: Biogra-phieforschung im Diskurs. Völter, B. Dausien, B. Lutz, H. Rosenthal, G. (Hg.). 2. Auflage. VS-Verlag. Wies-baden, S.: 51. 396 Int. Fall 2, Teil 2, S. 11, Zeile: 396-397.
241
den haben wir dann helfen könne.“397 Ein weiteres Beispiel, das die Biographin als Schlüsselerlebnis akzentuierte, ist, wie sie als Heimkind regelmäßig am Mittagstisch der Familie des Heimleiters teilnehmen durfte. Sie vergegenwärtigte sich hierbei exemplarisch, an eine Alltagssituation, die Normalität und ein gemeinschaftliches Er-leben vorbereitet und so ein attraktives Moment von Routine anbieten kann.
Die Oma, so beschreibt die Biographin, übernimmt die Aufgabe und die Funktion, Unrecht zu sehen, anzusprechen und gegenüber der Schulbehörde zu artikulieren, um so die Probleme der Familie abzuhelfen. Sie strukturierte in der Familie vor, glich aus, lotete den Einzelnen die Rolle, mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten zu.
Die Biographin gibt zur Rolle der Mutter und Oma bekannt, „schließlich haben die mich auch adoptiert (…) und dass wir (…) also dass sie eine Verantwortung für mich übernehmen muss! (…) weil ich ja nicht selbst entschieden habe (laut) dass ich zu der Familie geh, sondern die haben mich hergenommen! Und dass meine Mutter eine Verantwortung hat (…..) wenn, die sich halt nicht kümmern tut, dann will die Oma das wenigstens gut machen“
Für die Biographin ist die Mutter, die stets Contra gibt, eiskalt, abwesend, abweisend und diejenige, die andere täuscht. Die Oma hingegen, sei die herzliche, gütige, stets präsent. So polarisiert die Biographin dauerhaft die Zuschreibungen des familiären Binnensystems und hält diese aufrecht.
Im Verlauf der Biographie kann die Biographin eine pharmakologische Behandlung mit sedierenden Psychopharmaka und kurzintervalligen Klinikbehandlungen als not-wendige Hilfe und Unterstützung betrachten. Sie bewerte den Entschluss der Betreu-erin für eine Unterbringung und somit den Übergang in ein geschlossenes Heim als einen großen aber nachvollziehbaren Einschnitt in ihre Freiheit. Sie könne dies aner-kennen und nun im Verlauf ihrer langen Behandlungszeit einsehen, dass sie selbst im Umgang nicht einfach sei. Sie könne definitiv nicht alleine wohnen und auch ohne Hilfe nicht leben. Sie benötige Struktur für den Tag und die gesamte Woche, „sonst verliere ich mich ganz“ weil ich dann nicht weiß, was ich machen soll (…..) auch nicht was ich machen kann (…) was ich helfen kann…“
Die Biographin beschreibt, dass sie den Umgang und Kontakt mit Kindern, den mit Erwachsenen in jedem Fall vorziehe. Sie beschäftige sich gerne mit ihnen, wie sie das schon in einem Praktikum erlebt habe. „Kinder lügen nicht, sie sind ehrlich, ma-chen einem nichts vor. Kinderlachen aus vollem Hals ist Medizin. (…) Meine Ver-gangenheit, Hr. Masanz,(…) hatte nicht ein Lächeln.“
Nachhaltig schockiert und noch immer erschüttert, beschreibt die Biographin im sze-nischen Präsens den Tag, an dem sie mit 22 Jahren, drei Suizidversuche binnen we-niger Stunden unternommen habe. Diese Reaktion sei durch die tragische Nachricht des Unfalltodes eines 3-jährigen Kindes von Freunden, das in ihrem Kinderzimmer
397 Die Biographin nahm für acht Wochen an einem Projekt in Marokko teil und besuchte mit ihrer Jungen-wohngruppe ein Heim für schwer erziehbare und straffällig gewordene Jungen. Dort wies sie die Jungen in die Bedienungsanleitung für mitgebrachte CD- Spieler, Kassettenrecorder etc. ein.
242
verbrannte, ausgelöst worden. Dieser Unfalltod erinnerte und retraumatisierte die Bio-graphin im gleichen Maß wie der tragische Busunfall ihres Verlobten, „dass ein so junger Mensch überhaupt so plötzlich sein Leben verlieren kann!“
In der Gesamtbewertung kommt es bei der Biographin innerhalb der lebensgeschicht-lichen Erzählung zu einem Wandel in der Einschätzung und Bewertung ihrer Mutter. Sie habe Verständnis und Nachsicht, da diese sich ja um meine schwer kranke Oma kümmern müsse. So sei es auch nachvollziehbar, dass sie den Kontakt zu Ihr ver-nachlässige. Sie bedauere beim Blick zurück, auf ihr gelebtes Leben, dass sie von ihrer Mutter nicht mehr Liebe und Unterstützung bekommen habe.
Die Biographin stellt klare Umgangs- und Handlungsempfehlungen an soziale Ein-richtungen im Umgang mit ihren Klienten:
Man solle nicht so, der Typ „meine Mutter“ sein, also eiskalt zu den Leuten, sondern mehr Anteilnahme zeigen, wie das die Biographin über ihre Oma sagt. Man solle den Leuten eine Struktur geben, für den Tag und die gesamte Woche. Gruppenangebote und Freizeitaktivitäten anbieten, so dass die Leute rauskommen aus dem Heim. Sie sollen die Welt sehen. Die Leute sollen immer wieder motiviert werden, man darf sie „nicht vor sich hingammeln lassen oder ganz in Ruhe lassen. Das ist falsch“
Die Biographin hebt zum Interviewabschluss nochmals ihre Identitätsentwicklung hervor, mit der sie sich sehr beschäftigt. Wer bin ich eigentlich? Woher komme ich her? Was macht meine Persönlichkeit aus? Fr. Brandt berichtete, dass sie im Verlauf der Zeit ihre weiblichen Seiten kennenlernte. Sie trage z.B. seit wenigen Monaten Röcke oder enge Kleidung. Das sei früher ein Tabu gewesen, „überhaupt, in eine Mädchenabteilung zu gehen (buaaahh!). Das „hat mein Kopf vorgegeben und ich frage mich heute oft, wie ich wohl von den anderen wahrgenommen werde, eher als Mädchen oder als Junge?“
6.2.3.1. Hypothesenbildung zum erzählten Leben
Die Generation der Enkel, die nach der Migration in Deutschland verblieben sind, haben sowohl mit ihrem Selbstbild der ethnischen Zugehörigkeit als auch mit den erlebten Zuschreibungen der kollektiven Zugehörigkeit weit mehr Schwierigkeiten als jene, die heute noch in den Nachfolgestaaten leben.398
Fr. Brandts Großeltern und Vorfahren waren aus unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlichen historischen Epochen mit massiven und existentiellen Diskriminie-rungen, territorialen Exklusionsabsichten und gezielten Abgrenzungshandlungen konfrontiert. Sie waren in Arbeitslager deportiert, waren in unwirtlichen Gegenden Russlands, z.B. nach Sibirien und Mittelrussland, verbannt worden, in der Hoffnung, so die Russen, das anspruchsvolle Ackerland werde gezähmt und kultivierbar ge-macht, trotz schwieriger Bodenbeschaffenheit und karger Klimabedingungen. Dort durchlebten sie viele Jahre der Entbehrung, des Leidens, sie waren lebensbedrohli-chen Lebenslagen, Hunger, Krankheiten und Kälte ausgesetzt.
398 vgl. a.a.O. Rosenthal & Radenbach (2011), S.: 197.
243
Die mittlere Generation, also die Generation von Fr. Brandts Mutter, distanzierten sich nach und nach emotional, und versuchten sich von den Verfolgungserfahrungen und den kollektiv-transgenerativen Kränkungen zu lösen. Sie definierten sich selbst als Sowjetbürger mit der Orientierung zur russischen Kultur und Sprache. Die extrem traumatisierte Generation der Großeltern nahm in der Familie eine Außenseiterrolle ein. Es interessierte sich in der alten Heimat niemand für ihre Erzählungen und Er-lebnisse. Diese Position änderte sich bei den Großeltern mit deutscher Herkunft, wenn sich nun die Kinder zur Antragstellung für eine Ausreise in die BRD entschei-den. Dies führte zu einem erheblichen Machtgewinn bei der Großelterngeneration. Die mittlere Generation hingegen, so ROSENTHAL et al, hat hinsichtlich der ethni-schen Zugehörigkeit die Definitionsmacht in der Familie und ist verantwortlich für die Folgen der Auswanderungen. Der deutsche Anteil der Familiengeschichte bei den migrierten Familien, die Vergangenheit als Deutsche hat plötzlich eine hohe Signifi-kanz bekommen wie auch für die Selbstdefinition als Deutsche in der Gegenwart.399
„Als Initiatoren der Emigration hatten sie mit der Entscheidung hierzu den Bedarf nach einer dem homogenisierten kollektiven Gedächtnis entsprechenden Familien-vergangenheit und begannen ihre Recherchen zur Familienvergangenheit. Dieser Bedarf wird auch in Deutschland weiter gestärkt, da sie als Deutsche in der Sowjet-union diskriminiert wurden, die Ausreise fortlaufend legitimieren und vor allem ver-suchen zu belegen, …wie ausgeprägt ihre deutschen Familienwurzeln sind.“ Dabei verschweigen und leugnen sie, ihre ehemals ausgeprägte Identifikation mit der Sow-jetunion. Die Auswanderung führte in den Familien zu erheblichen Veränderungen in der Lebensführung und der Familiendynamik. Der bereits erwähnte Machtzuwachs der Großeltern führte zu intrafamilialen Machtbalancen, die Verunsicherung hinsicht-lich der ethnischen Zugehörigkeitskonstruktion und die völlig anderen Fremdzu-schreibungen als noch vor der Aussiedlung führen teilweise zu erhebliche Probleme in der Familiendynamik, so ROSENTHAL & STEPHAN.
Die Großmutter der Biographin gehörte in der historischen Generation dem Jahrgang 1930-1945 an, die die Kindheit während der Kollektivverurteilung erlebte. Diese Ge-neration schaut auf eine traumatisierte Vergangenheit, auf Stigmatisierung, extreme Diskriminierungen während des II. Weltkriegs und der Nachkriegsjahre zurück. Sie hat die historische Phase selbst miterlebt, in der aus inhomogenen Gruppierungen von ethnischen Deutschen eine destruktive Wir-Gruppe von Außenseitern, Ausgegrenz-ten und Exkludierten wurde. Es besteht eine hohe Relevanz kollektivgeschichtlicher Vergangenheit.
Die Mutter hingegen gehört der mittleren Generation einer historischen Generation an, die im Jahre 1945-1958 den sozialen Aufstieg unter erschwerten Bedingungen erlebt hat. Sie war durch eine starke Identifikation mit dem politischen System ge-prägt.
399 vgl. a.a.O. Rosenthal, G. Stepan, V. & Radenbach, N. (2011): S.: 203-204.
244
Kennzeichnend für ihre Biographie, sind ihre Anstrengungen in der Kindheit und Ju-gend, sich in das gesellschaftliche und politische System zu integrieren. Die damali-gen Identifikationen mit dem sowjetischen Sozialismus gehört heute zu den Bestand-teilen der Lebensgeschichte, die nicht thematisiert werden.
Die Tochter gehört zum Jahrgang (1984-1990), somit zur historischen Generation, die in ihrer Kindheit und Jugend die Migrationsphase erlebt hat. Sie wird in eine öko-nomische und soziale Unsicherheit im Kontext des Zusammenbruchs der Sowjet-union hineingeboren. Eine Phase, in der viele Deutsche einen Prozess des Abstiegs erleben mussten. Gleichzeitig herrschte ein zunehmender Nationalismus, eines sich wieder verstärkt abwehrenden Fremdbildes vor den Deutschen, die mit einem fami-lienbiographischen Entwurf, nämlich in die BRD auszuwandern, eine Rückwendung zu einem ethnische Wir-Bild als Deutsche und zu einer Konstruktion von kollektiver und individueller Vergangenheit als verfolgte und diskriminierte Deutsche einleite-ten.400
Nach dem Motto „Besser auszuwandern als erneut die Rolle als sozialer Außenseiter zu akzeptieren“, entschieden sich die Angehörige der mittleren Generation dafür, ein Visum für eine Auswanderung zu stellen. Die Verfolgungsvergangenheit der Groß-elterngeneration dient als Mittel und legitimiertes Motiv für eine Ausreise und domi-niert den gegenwärtigen Dialog über die Familienvergangenheit. Damit einhergehend wird seit Anfang der 90er Jahren jene Phase der Familienvergangenheit verschwiegen oder heruntergespielt, in der sich gerade die mittlere Generation beruflich etablierte, die sich i.d.R. mit dem politischen System der Sowjetunion identifizierte.
Loyalitätskonflikte gegenüber den Eltern sind auch bei der Biographin zu beobach-ten, die mit Irritationen über den Wandel in deren ethnischen Zugehörigkeitskon-struktion oder deren politischen Haltungen verbunden sind. Typischerweise wenden sich die Enkel emotional eher den Großeltern zu und lassen sich in der Kommunika-tion mit ihnen auf Erzählungen über deren leidvolle Vergangenheit ein. Die Enkel kommen erst nach der Phase der Perestroika oder nach der Phase der Migration in die BRD in die Schule und präsentieren ihr Leben oft unter der unausgesprochenen Über-schrift „Mein Leben seit der Ausreise!“ Sie konnten den Verlust ihrer früheren Le-benswelt, sowie die in der Familie im Zuge der gesellschaftlichen Transformation in den Herkunftsländern und im Kontext mit der Ausreise sich vollziehender Reinter-pretation der Familienvergangenheit und der ethnischen Zugehörigkeit weniger ver-stehen und kognitiv verarbeiten als früherer Generationen. Als Reaktion darauf kommt es zu einer auffallenden Anpassung an eine deutsche Dominanz, um gesell-schaftliche und delegierte Aufstiegserwartungen und einen Wunsch nach sozialer An-erkennung zu verwirklichen. Es gibt auch eine gegenläufige Reaktion, in der sich die Enkelgeneration in ethnische und russische Gegenwelten zurückziehen, weil sie ein unsicheres Erleben der eigenen Zugehörigkeit und der Zugehörigkeit der Großeltern und Eltern erleben. Dies stellt schwierige Bedingungen in der Aufnahmegesellschaft dar. 401
400 vgl. a.a.O. Rosenthal et al (2011), S.: 47 ff. 401 vgl. a.a.O. Rosenthal et al. (2011), S.: 57.
245
Die Konstruktion des kollektiven Gedächtnisses umfasst vier historische Phasen: 1. Wir wurden 1762/63 von Katharina der Großen nach Russland geholt; 2. Fast alle Russlanddeutschen lebten bis 1941 in den europäischen Regionen der Sowjetunion; 3. Ab 1941 wurden fast alle Deutsche infolge Kollektivverurteilung in die asiatischen Gebiete der Sowjetunion deportiert. Dort kam es zu sogenannten Arbeits- oder Trudar-meen; 4. Bis zur Ausreise nach BRD wurden wir Deutsche in der Sowjetunion diskre-ditiert.
Die Bestandteile der Vergangenheit, die nicht in die typischen Kollektivgeneration passen, werden eher verschwiegen, ein Aufarbeiten blockiert oder erschwert. Die in den Interviews vorherrschenden Stereotypen und diffusen konkreten Erfahrungen und erlebten Leiden wird weit stärker abgehoben als Erzählung und erschwert das Erinnern und Reflexion und eine interpersonale Kommunikation und Bearbeitung des Erlebten.402
6.2.4. Fallspezifische Interpretation und Rekonstruktion der Fallge-schichte
Die Biographin wird nach einer Fülle von schwer traumatisierenden Erfahrungen in einem russischen Kinderheim mit einer unerfüllbaren Aufgabe und Funktion als neues Familienmitglied in eine stark vorbelastete und bereits fragmentierte Familie hineingeboren bzw. als Adoptivkind aufgenommen, auf der all die Hoffnungen der Mutter lagen, sich nun als triadisches Familiensystem neu zu konstruieren und sich hinsichtlich der dominierenden Suchtabhängigkeit des Paares grundlegend neu aus-zurichten. Der Biographin haftet nun eine Rolle und Funktion in der neuen Familie an, die darauf abzielt, die Heroinsucht des Vaters zu beeinflussen, die Nähe und Dis-tanz der Eltern füreinander zu regulieren. Der Biographin werden Erwartungen auf-erlegt, die sie von vornherein nicht erfüllen kann. Nach dem „goldenen Schuss“ des Adoptivvaters, der eine weitere Trinkphase bei der Mutter der Biographin induzierte, kam es nun lebensgeschichtlich zum wiederholten Male zu einer sofortigen Abgabe und Herauslösung der Biographin aus der sich auflösenden familiären Dyade, die diesmal zur Großmutter aufs Land gebracht wird. Die Biographin erzählt in einem Gespräch nach den beiden Interview403, dass ihre Mutter zum Zeitpunkt der Übergabe an die Großeltern um die Gefahr für ihre Tochter wusste und damit auch rechnen musste, dass der Großvater seine pädophile Neigung an der Enkelin fortsetzte, wie auch die Mutter selbst leidvoll erfahren musste.
Für die Biographin wird das Feld Suchtabhängigkeit in der Familie ein zentrales Le-bensthema. Sie übernimmt diese Konstruktion, in dem sie sich einerseits, betont ge-gen stoffliche Abhängigkeiten wendet und widersteht, andererseits entwickelt sich das Thema für sie selbst zu einer existentiellen und dauerhaften Bedrohung in Form einer Essstörung, der sie ihr Leben lang ausgesetzt bleibt. Bei der Auswahl der Part-nerschaften trifft sie jedes Mal die Entscheidung zugunsten eines suchtabhängigen Partners, den sie im Verlauf und durch die Partnerschaften von den Drogen zu be-freien versucht. Sobald sie im Verlauf der Partnerschaft anerkennt und realisiert, dass 402 vgl. a.a.O. Rosenthal et al. (2011), S.: 58-59. 403 Forschungstagebuch: Eintrag vom 24.9.2014. Nachgespräch mit Fr. Brandt, die mich auf eine Einladung hin besucht und im Verlauf des Gesprächs auf diese Situation ihres Lebenslaufs stößt, über die sie immer wieder nachdenken muss.
246
sie ihr Vorhaben nicht umsetzen kann, kommt es zur Beendigung und Herausbildung einer schweren existentiellen Krise, die i.d.R. in einer Phase mündet, in der die Bio-graphin zwangsweise, in der Fixierung, mit Hilfe einer Sonde in der klinischen Psy-chiatrie ernährt und behandelt werden muss.
Verstärkt wird die von Anfang an problembeladene familiär-biographische Konstel-lation durch eine übermächtige Verlaufskurve, die auf die Biographin einwirkt und sie mitsamt der Adoptivfamilie einem Sog von transgenerativ-ethnischer Segrega-tion, familiärer Stigmatisierung und gesellschaftlichen Exklusion aus setzt, der am Ende als Lösung das Migrationsprojekt und die Aussiedlung nach Deutschland als Neubeginn vorgibt.
Die Überzeugung der Selbstwirksamkeit bzw. der self-efficacy, d.h. die Überzeugung mit Katastrophenerfahrungen umgehen zu können, nimmt im Zuge des institutionel-len Verlaufs und des Lebensalters bei der Biographin ab. So ist für HEINRICHS & GRÜNENBERG404 die Überzeugung der Wirkmächtigkeit des eigenen Handelns mit der Zukunftsorientierung verknüpft.
Vertritt z.B. jemand, wie die Biographin in der Falldarstellung den unerschütterlichen und entwickelten Standpunt, dass von der Zukunft sowieso nichts mehr erwarte, hoffe, wünsche 405 oder an ihr nichts geändert werden könne, dann zeigt sie implizit eine Fokussierung auf die Gegenwart und eine Geringschätzung der eigenen Hand-lungsfolgen und damit auch der individuellen Reaktionsnotwendigkeit. Sie richtet sich somit vollständig nach den ihr vorgegebenen und fremdbestimmten institutio-nellen Strukturen aus und bleibt in ihnen, im Verlauf ihrer biographischen Zukunfts-orientierung, langfristig verhaftet. Die Biographin geht ein Arrangement ein, in dem sie sich auf eine alltäglich-routinierte sozialpsychiatrische Grundversorgung einlässt, die Hilfen und Sicherheit wie z. B. mehrfache Vitalkontrollen anbietet und zur mini-malen Zielsetzung eine Vermeidung von Verschlechterung des gesundheitlichen Sta-tus-quos anstrebt. Die Prognose für eine Entwicklung in Richtung Verselbständigung, Autonomie oder die Auflösung einer Exklusionsdrift, sowie die Prognose, bezogen auf die Krankheitsdynamik, sind ungünstig. In diesem Sinne beschreibt die Biogra-phin einen konstanten Krisen-Plateau-Typ, der langfristig einer geschlossenen-be-schützenden Institution verhaften bleiben wird. Die therapeutische und diagnosti-schen Aufgaben in einer geschlossen Einrichtung stellen hier abgeleitet und übertragen, in Anlehnung an NEDOPILs Vorstellungen für den Maßregelvollzug, eine kontinuierliche Fortschreibung des Therapie- und Behandlungsplanes, Korrek-turen der diagnostischen und therapeutischen Hypothesen, eine Überprüfung des Therapie- und Rehabilitationsfortschrittes und des aktuellen Betreuungsstandes dar. Zu den Sicherungsaufgaben gehören eine fortlaufende und engmaschige Überprü-fung des Risikos der Biographin für sich selbst und der Lockerungshindernisse, die
404 Heinrichs, H. Grunenberg, H. (2009): Klimawandel und Gesellschaften. VS Verlag für Sozialwissenschaf-ten. Wiesbaden, S.: 87. 405 Interview Nr. 2. Fr. Brandt. Teil 1, S. 37. Zeile: 980-988 „..ich habe keine Wünsche… keine Hoffnung, mehr..jetze (..) ich bin schon vier Jahre eingesperrt in geschlossene Einrichtungen(ähm) viele Träume, die ich hatte sind (ähm) kaputt (….) ich habe keine mehr, ich will nur noch auf die Beine kommen, (…) ähm ich denke nicht an Zukunft uns so ähm, nur heute ..Morgen dann an Morgen, jetze halte“
247
Dokumentation intramuraler Zwischenfälle, die Entwicklung von Hypothesen zur Er-fassung von Risiken im Einzelfall, fortlaufende Lockerungsprognosen.406
Bei der Agency-Resilienz-Bedürfnis-Perspektive wird hervorgehoben, dass, wie in der Falldarstellung Nr. 2, die Biographin nicht nur durch Strukturen determiniert wird, sondern, dass auch durch aktive Entscheidungen Einfluss auf Strukturen ausge-übt wird. Dies hängt primär von der Wahrnehmung der möglichen Alternativen und von der Planungskompetenz ab. So kommt es regelhaft in Krisen dazu, dass die ei-gene Ressource unter die Erwartungen fallen, so wird das menschliche Bedürfnis, ein Gefühl von Kontrolle über das eigene Leben und die eigene Biographie zu entwi-ckeln, nicht mehr erfüllt. Um die Kontrolle wiederzugewinnen, können die Erwar-tungen, die Ressourcen angepasst werden. So wird das Agency-Konzept verwendet, um auf strategische Handlungsweisen und Ziele innerhalb der jeweiligen historischen und sozialen Möglichkeiten zu fokussieren. In diesem Sinne stellt ein hohes Maß an Agency eine persönliche Ressource für Resilienz dar.407 Trotz widrigster biographi-scher Umstände und belastender frühkindlicher Erfahrungen, trotz unsicherer Bin-dungserfahrungen gelingt es der Biographin, sich innerhalb der kurzen Krisenzeiten, immer wieder zu stabilisieren. Sie kommt immer wieder auf die Beine und erhält in der Folge einen stabil kritischen Zustand aufrecht.
6.2.5. Typenbeschreibung und Typenbildung
Bei der Biographin handelt es sich um einen „konstanten Krisen-Plateau-Typ“, Typ B, der zum einen eine Beschreibung über den prognostisch-institutionellen Verlauf und zum anderen eine Beschreibung der Hilfeannahmebereitschaft der institutionel-len Angebote liefert. Der konstante Krisen-Plateau-Typ erlebt häufig eine schnelle Transinstitutionalisierung durch alle Felder der Sozialen Arbeit, auf der Grundlage von unsicheren Bindungserfahrungen und frühkindliche Traumatisierungen, sowie eine Akkumulation von häufig erlebten und schnell wechselnden fremdbestimmen-den Lebensereignissen. Die Hilfen und das Behandlungssetting sind komplex und strukturieren einen stationären Rahmen. Er ist bereits ab dem 18.-25. Lebensjahr in einem hochstrukturierten Behandlungssetting angekommen, in dem er wohnt, in dem er behandelt wird und innerhalb dem er stundenweise einer Beschäftigung oder Ar-beit nachgeht. Ein Leben außerhalb eines solchen Settings ist nicht, nur episoden-weise, denkbar. Er bleibt vielmehr den Institutionen und den vorgehaltenen Hilfen verhaftet. Die wiederkehrenden, häufig nicht beeinflussbaren und aus dem Nichts heraus initialisierenden, lebensbedrohlichen und existentiellen Krisen verlangen im-mer wieder einen Wechsel in einen klinikstationären Rahmen. Dort kommt es in kur-zer Zeit zur Beruhigung und Entaktualisierung der Krise und schließlich zur Rück-verlegung in die abgebende Institution. Auf nennenswerte Hilfe oder stabilisierende Unterstützung durch die Herkunftsfamilie kann der Typ B häufig nicht oder nicht mehr zurückgreifen. Die Hilfen, die beim „konstanten Krisen-Plateau Typ“ nötig sind, bestehen aus fortlaufenden Vitalkontrollen, um chronisch suizidale Krisen und Handlungen abzuwenden und zu vermeiden. Dieser Typ benötigt Zeit seines Lebens
406 Nedopil, N. (2006): Prognosen in der forensischen Psychiatrie- Ein Handbuch für die Praxis. 3. Aufl. Papst Science Publishers, Lengerich, S.: 147. 407 Marg, A. (2016): Resilienz von Haushalten gegenüber extremen Ereignissen. Springer VS. Wiesbaden, S.: 105-106.
248
einen Schutzraum. Einen Schutzraum, der durch die Herkunftsfamilie nicht gewährt und eingehalten werden konnte oder missbräuchlich erlebt worden ist. Die Funktion des Schutzes wird als institutionelle Substitution an das Jugendamt, an Kinder- und Jugendheime, Fachkliniken, an das Gericht, an Frauenhäuser oder an geschlossene Institutionen übertragen. Sie haben fortan die Funktion, Gefahren, die von außen auf die Biographen einwirken, abzuschirmen und abzuwehren. Ihnen wird zudem die Aufgabe übertragen, auf ein erträgliches Maß zwischen Nähe und Distanz gegenüber der Familie und anderen Personen, außerhalb und innerhalb der Institution, regulie-rend einzuwirken.
Professionelle Bezugspersonen innerhalb der Institution werden häufig als letzte und einzige Vertrauens- und Bindungspersonen erlebt, ihnen werden übergroßes Erwar-tungen und Projektionen entgegengebracht, die bei einem Wechsel des Arbeitsplat-zes, bei einer Kündigung oder einer längeren Abwesenheit wiederkehrend eine reinszenierte Traumatisierung auslösen und den Krisen-Plateau-Typ schließlich er-neut darin bestätigt, dass er vertrauensvolle und bedeutsame Bindungen abrupt, un-erwartet und kurzfristig verliert. Trotzdem lässt er sich immer wieder auf neue Be-zugspersonen ein.
Der konstante Krisen-Plateau-Typ wechselt im Gegensatz zum unstet-oszillierenden-Typ, wie in Falldarstellung A, von der Einrichtung in die Klinik, stabilisiert sich in kurzer Zeit und kehrt wieder zurück. Im Gesamten findet aber keine oder nicht aus-reichend Entwicklung in Richtung Verselbständigung und Autonomie statt, um sich aus dem Gesichtsfeld der stationären Einrichtung erfolgreich und langfristig zu ent-fernen. In der Eigenwahrnehmung, sich als unvollständige und fragmentierte Identität zu erleben, gelingt es dem Typ B, nur in Phasen, in denen er eine partnerschaftliche Beziehung eingeht und sich dadurch vollständig, sicher und beschützt wahrnimmt, sich in einem weniger strukturierten Behandlungssetting zu behaupten. In diesen Pha-sen kann für diesen Typ interimsweise eine ambulante Begleitung und Wohnform ausreichen, er lässt sich im Gegenzug jedoch auf meist instabile, suchtdominierende, gewalttätige oder finanziell und emotional ausbeuterischen Partnerschaften ein, die unmittelbar nach der Auflösung der Beziehung in eine schwerwiegende, existentielle, häufig suizidale Krise münden. Typisch bei dieser Kategorisierung, aus der Gruppe der TSSP, ist das Merkmal, dass weitgehend eine Zukunftsorientierung im Denken, Planen und Handeln ausgeschlossen werden und stattdessen eine verstärkte Fokus-sierung erlebt wird, lediglich die gegenwärtigen Aufgaben und Anforderungen des Alltags zu bewältigen.
Auf einen stärkenden Einfluss und stabilisierenden Rückhalt durch die Herkunftsfa-milie wie auch durch andere bedeutsame soziale Kontakte kann weit gehend nicht zurückgegriffen werden. Beim institutionellen Verlauf durchwandert dieser Typ schneller durch die Felder der Sozialen Arbeit als alle anderen und kommt in der Einrichtungsmatrix auf einem Plateau zum Stillstand. Im Gegensatz zum unstet wechselhaft-oszillierenden Typ, bei dem es in einem Kaskadenverlauf, in der Ge-samtheit, zu einem fortschreitenden Entwicklungsprozess der Verselbständigung, der Autonomisierung, Genesung und Identitätsentwicklung kommt, ist beim krisenhaften Plateau-Typ von einer Stagnation und einem langfristigen Verbleib bzw. von einem
249
sukzessiv degenerativen Verlauf in einer hochstrukturierten Institution auszugehen, die optional einen beschützenden Betreuungsahmen erfordert.
6.3. Dritte Falldarstellung: Fr. Satic
„Mit dem Wind kommt der heilige Geist(..) das heißt, wenn sozusagen, wenn man was, wenn man dann was Neues spürt oder so, dann dann ist es so, wie kommt es auf einen zu, wie ein Wind…dann ist es reingefahren in mich (….) es fällt mir schwer zu sagen (....) dann war ich krank oder so, ja, so kann mans sagen.“
Herr D.408
6.3.1. Einführung und Kontextklärung
Fr. Satic lernte ich in meiner damaligen Funktion als kooperierender Einrichtungslei-ter in einem geschlossenen Wohnheim kennen. Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit fiel mir Fr. Satic auf, da sie entgegen ihrer Mitbewohner schon sehr früh am Morgen auf war, Kette rauchte und über die zwei benachbarten Wohnebenen im schnellen Schritt entlang des 100m langen Flurs auf und ab marschierte. Dabei beschwerte sie sich, für alle hörbar, während sie mit dem Handy telefonierte, über die Zustände der Einrichtung, über die unsinnigen Hausregeln, die unnützen Behandlungsangebote o-der über die lästigen Pflichtveranstaltungen, wie z.B. die ärztliche Visite oder die Hausversammlungen. Sie beklagte sich Tag für Tag über die ungerechten Ausgangs-regeln und Vereinbarungen, die mit den anderen oder mit ihr abgeschlossen werden. Während ihres „Anklagemarsches“ trug sie stets eine Handtasche und war so geklei-det, als sei sie ausgehbereit für einen Stadtbummel auf der Königstraße.
Fr. Satic weigerte sich, über eine lange Zeit hinweg, die Angebote der Einrichtung anzunehmen oder wenigstens einmal auszuprobieren. Ihre monoton wiederkehrende Antwort lautete, sie sei in keinem Straflager und habe auch keine Straftat begangen. Sie könne eh nicht verstehen, warum sie hier eingesperrt werde. Es hat über viele Wochen, im Rahmen einer vorsichtigen Annährung und Beziehungsgestaltung ge-dauert, bis Fr. Satic Vertrauen fand, nachvollziehen und mittragen konnte, dass z.B. ein freier Ausgang für eine Stunde ohne Begleitung mit der aktuellen psychischen Befindlichkeit und Verfassung in Zusammenhang stehe und die Einrichtung eine Für-sorge- und Aufsichtspflicht zu erfüllen und eine Verantwortung für die Unversehrt-heit der Bewohner zu tragen habe.
Fr. Satic ging gewohnheitsgemäß schon um 19 Uhr früh zu Bett, verbrachte viele Stunden am Tage mit Wasch- und Reinigungshandlungen. Die wiederkehrenden Ver-suche, Medikamente abzusetzen und die daraus resultierenden Selbstverletzungen ha-ben in den Jahren vor der Aufnahme dazu geführt, dass die gesetzliche Betreuerin für Fr. Satic einen Antrag auf eine geschlossen Unterbringung in einer geeigneten Ein-richtung zur Umsetzung nach § 1906 BGB gestellt hatte. Fr. Satic wurde zunächst von einer Psychiatrischen Klinik in ein psychiatrisches Pflegeheim verlegt, das zwei Autostunden entfernt von ihrem Wohnort liegt.
Das Exemplarische an Fr. Satics Fall stellt ihre spezifischen Erfahrungswerte als bos-nisches Flüchtlingskind, bezogen auf das Bindungsverhalten, das erlebte Trauma
408 In: Interview 1, Falldarstellung 5, Hr. D. S.: 10, Zeile: 334-360.
250
durch den Bürgerkrieg, die Grenzziehung zwischen den Generationen, die entwi-ckelte Symptombildung und den Kommunikationsstil innerhalb der Familie dar, um so die besonderen biographischen Strukturen herauszuarbeiten.409
Durch den transkulturellen Hintergrund entsteht bei der Biographin eine Bedeutung, die es zu reflektieren gilt. Genauer formuliert, es gilt in der folgenden Kasuistik fort-laufend zu unterscheiden, worin auf der einen Seite, in der Falldarstellung von Fr. Satic die kulturelle Bedeutungsmuster bestehen, auf der anderen Seite ist aber auch zu beachten, dass nicht jede Verschiedenheit als Kulturdifferenz und jeder Konflikt als Kulturkonflikt aufzufassen ist.410 Typisch für die Gruppe der Kinderflüchtlinge, die aus dem Balkankrieg resultieren, erlebte auch Fr. Satic Phasen langer Trennungen von Bindungspersonen. Häufig handelt es sich um den Verlust des Vaters, die dauer-haften Belastungen durch einen unsicheren Aufenthaltsstatus (durch einen fortlau-fenden Aufenthaltsstatus mit einer Duldung) in der BRD. Meist wachsen die Kinder bei der Mutter oder bei verwandten Familienmitgliedern auf, die wiederum selbst sehr belastet und durch den Bürgerkrieg schwer traumatisiert sind.
Nach dem Ende des Balkankrieges initiierte besonders die Bundesrepublik Deutsch-land sogenannte Rückkehrprogramme, die mit finanziellen Anreizen ausgestattet wa-ren, um die Kriegsflüchtlinge wieder zurück in ihre Heimat zu führen und zu „lo-cken“. Es gab Programme in Form von sogenannten Orientierungsreisen, um die Rückkehrbedingungen vor Ort zu prüfen, zu erkunden oder um konkrete Rückkehr-vorbereitungen zu treffen. Die Familie Satic konnte sich auch im Zuge eines soge-nannten „Bosnienurlaubs“ Ende der 90er Jahre davon überzeugen, wie erschwert eine Rückkehr sein könnte, wie problematisch eine Rückkehr umsetzbar wäre. Darüber hinaus wurden gerade über die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Ba-den-Württemberg die Praxis von Abschiebungen angewendet, um so schließlich größtmöglichen Druck auf die Flüchtlinge auszuüben. Die Familie Satic blieb hier-von verschont. Ihr wird zunächst eine für 3 Monate befristete Duldung411, später eine Aufenthaltsbefugnis ausgestellt. Die Innenministerkonferenz verabschiedete im Jahr 2000 nach langem Bemühen und Engagement durch Flüchtlingsorganisationen und Behandlungszentren für traumatisierte Kriegsflüchtlinge die sogenannte „Traumare-gelung“, die allen traumatisierten Flüchtlingen eine Aufenthaltsbefugnis für jeweils 2 Jahre ermöglichte.
1997 hielten sich laut UNHCR412 etwa 340.000 Flüchtlinge aus dem ehemaligen Ju-goslawien in Deutschland auf. Die innenpolitische Situation und Atmosphäre wenige
409 vgl. Lennertz, I. (2011): Trauma und Bindung bei Flüchtlingskindern. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttin-gen, S.: 362ff. 410 vgl. Ninck-Gbeassor, D. N. Schär Sell, H. Signer, D. Stutz D. u Werteli, E. (1999): Überlebenskunst in Übergangswelten: Ethnopsychologische Betreuung von Asylsuchenden. Reimer. Berlin, S.: 21 411 Duldung stellt keinen Aufenthaltstitel dar, sondern sie bedeutet lediglich die Aussetzung der Abschiebung, d.h. der geduldete Ausländer bleibt, nach § § 55 Abs. 1 und 56 Abs. 1 des Ausländergesetztes, weiter zur Ausreise verpflichtet. 412 UNHCR: Abk. für United Nations high Commissioner for Refugees, hat sich in Genf 1951 gegründet, mit der Aufgabe im Bereich des Rechtsschutzes für Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge; zu Beginn küm-merte sich die Organisation um etwa 245.000 sogenannter „dispalceds persons“, die sich in der BRD, in Folge des II. Weltkriegs aufhielten und ehemalige Zwangsarbeiter oder Insassen von Konzentrationslager waren; national sind zwei Büros in Berlin und Nürnberg vertreten, die UNHCR ist ebenso international tätig und ver-treten.
251
Jahre nach der Wiedervereinigung, die auch viele Zuwanderer aus Osteuropa bedeu-tete, war gegenüber den Flüchtlinge und Asylbewerbern sehr angespannt. Selbst von der Regierungsseite her wurde Deutschland nicht als Einwanderungsland ausgezeich-net.413
6.3.2. Gelebtes Leben – biographische Daten
Biogra-phisches Jahr
Ereignis Lebensjahr
1 1986 Geburt, in Kleinstadt an der bosn.-serbischen Grenze; Vater: Prof. für Ökonomie, Mutter: Bau-technikerin, beide konfessionslos
1. Jahr
2 1988-91 Bei Biographin (B.) starke Schluckbeschwerden festgestellt, sie hat immer „Kloß im Hals“, isst we-nig, viele KH- Aufenthalte
2.-5.Jahr
3 1988 Geburt der Schwester 2. Jahr 1992 B. flieht mit Mutter und Schwester in den Wald,
sie werden von Serben gefangen genommen, ein-gesperrt; Vater befreit, rettet Familie nach Kroa-tien in ein Flüchtlingsheim
6.
4 1992 Vater (40 J.) tritt im Balkankrieg auf eine Mine der Serben und stirbt
6. Jahr
5 1992-1993
Flucht nach D. mit Flüchtlingsbus, Übergangs-heim, Duldung für zunächst 3 Monate, wird über Jahre verlängert
6.-7. Jahr
6 1993 Einschulung in Stuttgart 7. Jahr 7 1992 Bosnien erklärt Unabhängigkeit 6. Jahr 8 1992-
1995 Bosnienkrieg mit 100.000 Toten 6-9. Lbj.
2000 Mutter heiratet zum 2. Mal, der Stiefvater schlägt B. mehrfach, B. + Mutter erstatten Anzeige, Ehe-mann wird nach Albanien abgeschoben
10. Lbj.
10 1999-2005
Erster Freund der B., der 2005 in der Türkei zwangsverheiratet wird
13.-19. Jahr
11 1999 (9 Monate)
B. entwickelt eine Schulphobie, Aufnahme in Kin-der-, und Jugendpsychiatrie
13. Lbj.
12 1999 Mutter erkrankt an Depression und einer Angststö-rung,
13. Lbj.
13 2000 Häufige Kontakte mit Jugendgerichtshilfe, Polizei: erste Sozialstunden im Jugendhaus
14. Lbj.
14 2000 B. bricht 8. Klasse Hauptschule ab, sie wird von der Polizei gesucht, „Schulschwänzerin“
14./15.
413 Der damalige Bundesinnenminister Manfred Kanther (1993-1998) in einer Pressekonferenz: “Deutschland ist kein Einwanderungsland.“ In: FAZ vom 13.11.1996
252
15 2000-2004
B. durchwandert 6 stationäre Jugendheime, wird jeweils wegen Fremdgefährdung und, Alkoholex-zessen disziplinarisch gekündigt
14.-18. Jahr
16 2003 1. Suizidversuch 17. Jahr 17 2003
(8 Monate) Psychosomatische Klinik 17.-18.
Jahr 18 2003-
2004 Kinder- und Jugendpsychiatrie 17. Jahr
19 2004 Von 2004-2011 fast durchgängig stationär in Be-handlung, längst klinikfreie Zeit: 7 Monate, B. entwickelt Liebeswahn gegenüber Psychiater, bzw. Vater-Tochter Beziehung
18.
20 2004-2005 (1 ½ j.)
Stationäre Wohngruppe der Jugendhilfe, diszipli-narischen Kündigung
17.-19. Jahr
21 02-12/2005 (10 Monate)
Wohnt bei der Mutter, erneut wird der Freund der Mutter wegen häuslicher Gewalt angezeigt
19. Jahr
22 2006 Einzug in ein Sozialhotel, Begleitung durch den So-zialpsychiatrischen Dienst
20. Jahr
23 2006-2016
2. Partner der B., bis 02/2015 zusammen 20. Jahr
2006-2007
Stationäre Wohngruppe für seelisch behinderte, junge Menschen
20.-21. Jahr
24 seit 07/2007
gesetzl. Betreuung in allen Bereichen, mit Einwilli-gungsvorbehalt
21. Jahr
25 08-2008-09-2009
Wohnheim in Kombination mit beruflichen Reha-bilitation, disziplinarische Kündigung
22.-23. Jahr
26 07/ 2010 Wohnheim für psychisch kranke Menschen, 24. Jahr 27 2011 Kündigung Heimvertrag wegen Drohungen- MA,
Mitbewohner und Betreuerin und Arzt 25. Jahr
28 2011 psychiatrisches Pflegeheim nach § 1906 BGB, B. nutzt Ausgänge, um Freundin in Stuttgart zu besu-chen, wird mehrfach über Krisendienst in Klinik eingewiesen
25. Jahr
29 11/2011 Freund der B. wird zu 8 Jahren Haft wegen Tot-schlags verurteilt, sie will eine Familie mit ihm gründen
25. Jahr
30 2012 B. bekommt einen Beschluss für 9 Monate in ei-nem geschlossenen Heim der Eingliederungshilfe in Stuttgart
26. Jahr
31 09/2012-02/2013
Frauenspezifisches Wohnen im ambulant Betreuten Wohnen
27. Jahr
32 Seit 02/2013
Rückkehr in geschlossenes Heim mit einem Unter-bringungsbeschluss für 15 Monaten, Beschäfti-gung in externer Werkstatt
27. Jahr
253
33 2013 Die Leiche des Vaters wird in Massengrab gefun-den. Das ehemalige, stark beschädigte Haus der Familie wird notariell veräußert. Der Erlös an Fr. Satic sen. und an ihre Kindern (Pflichtteil) ausbe-zahlt.
27. Lbj.
34 05/2014 Umzug in ein offenes Wohnheim 28. Jahr 35 07/2014 2 Aneurysma, Intensivstation, Stent gelegt 28. Lbj. 36 05/2015-
03/2016 Umzug in ein Einzelappartement des ABW, mit Hausnotruf, 3x täglicher Pflegedienst, intensive ambulante Betreuung 5x Woche,
29. Lbj.
37 Seit 03/2016
1 Jahr Beschluss nach § 1906 BGB geschlossenes Heim, Partner wird aus der Haft vorzeitig nach Ita-lien entlassen, des Landes für 10 Jahre verwiesen, beendet die Partnerschaft mit der Biographin per SMS
30. Lbj.
Tabelle 5: Biographische Daten zur Falldarstellung Nr. 3.
Fr. Satic wird 1986 in einer kleinen Grenzstadt zwischen dem heutigen Bosnien und Serbien geboren. Die Kindheit wird als unbeschwerte Zeit, in Wohlstand und Freiheit und Sorglosigkeit beschrieben. Zwischen den Eltern schwelten jedoch dauerhaft Konflikte, die die Mutter initiiert habe. Fr. Satic sei die Prinzessin ihres Vaters gewe-sen, der alles für sie getan habe. Etwa in dem Jahr, als sie eine Schwester bekam, entwickelten sich massive behandlungsbedürftige Schluckbeschwerden. Ihr Vater suchte mit seiner Tochter Fachkliniken, vom 3.-5. Lebensjahr, im heutigen Slowenien und Italien auf. Die Probleme mit dem Schlucken haben sich bis heute erhalten. Nach-dem die Kriegsfront immer näher an den Wohnort vorrückte, führte der Vater seine Familie zu Verwandten in den damals noch sicheren kroatischen Landesteil. Das ser-bische Militär rückte auch bis dorthin vor, sodass viele Familien in den angrenzenden Wald flohen und sich dort über Monate in Höhlen aufhielten.
Die Familie Satic wurde von serbischen Freischärlern im Waldversteck aufgespürt, verschleppt, eingesperrt und es kam zu sexuellen Übergriffen und umfassenden Ge-walterfahrungen. Irgendwie gelang der Mutter mit ihren zwei Kindern die Flucht, sie vereinbarte einen Treffpunkt mit dem Vater und er führte die Familie erneut an einen sicheren Ort, von dem aus Flüchtlingsbusse die Zivilbevölkerung nach Österreich und Deutschland abfuhren. Der Vater versprach der Biographin noch am selben Tag, er werde wieder zurückkommen und sich von seiner Familie verabschieden. An Fr. Sa-tics 6. Geburtstag erfuhr sie von ihrem Onkel, dass ihr Vater auf dem Weg zu ihr auf eine Mine getreten sei und am Unfallort verstarb. Die Großeltern mütterlicherseits, so die Biographin in einem Vorgespräch des ersten Interviews, seien beide an Krebs noch in Bosnien verstorben. Die Großeltern väterlicherseits seien an Alzheimer er-krankt und leben noch heute in einem Altenheim in Bosnien.
Aus den Arztberichten und gutachterlichen Stellungnahmen geht hervor, dass bei der Biographin sowohl die Aufmerksamkeit, die Konzentration als auch die Auffassung herabgesetzt sei. Es liege ein Vergiftungswahn, eine paranoide Symptomatik in akuten Krisen zugrunde, die zusätzlich durch befehlende Stimmen ergänzt werden
254
und der Biographin vorgeben, bestimmte Handlungen auszuführen, z. B. sich stun-denlang zu waschen, die Wohnung zu verlassen und gleich wieder zurück zu kehren. Zudem gehen aus den Gutachten Zwangsgedanken und Handlungen, sowie Wasch-zwänge hervor, die nicht eindeutig vom Stimmen-Hören unterschieden werden kön-nen. So müsse die Biographin oft unsinnige Dinge für eine bestimmte Zeiteinheit ausüben, damit ihre schlimmsten Befürchtungen (eher) nicht eintreten. So lege sie z. B. eine CD für die Dauer von 30 Minuten immer wieder rein und raus, wende sie, damit die Wahrscheinlichkeit geringer werde, dass ihr Freund eine andere Freundin abbekomme. Es wird im Zuge der ersten Kinder- und Jugendpsychiatrischen Behand-lung die Diagnose, kombinierte Persönlichkeitsstörung (zwanghafte, dissoziale, emo-tional-instabile Anteile), eine leichte Intelligenzminderung sowie eine deutliche Ver-haltensstörung gestellt.
Fr. Satic entwickelt im Verlauf der Behandlung einen Liebeswahn gegenüber ihrem Behandler, weniger in einer sexuellen Ausrichtung als vielmehr in einer fixen Zu-schreibung, es bestehe zwischen ihr und ihrem Facharzt eine Vater-und-Tochter-Be-ziehung. Die Biographin drohte im Verlauf der Verkennung damit, die Familie des Arztes umzubringen oder umbringen zu lassen.
Bereits in der ersten partnerschaftlichen Beziehung, im 13. Lebensjahr, begibt sich Fr. Satic in eine destruktive Abhängigkeitsbeziehung, die immerhin für sieben Jahre mit einem türkischen Jungen anhielt, der dann am Ende der Beziehung in die Türkei zwangsverheiratet wurde und so aus dem Gesichtsfeld der Biographin verschwand. Fr. Satic bedrohte und bestahl für ihren Partner ihre Mutter und Schwester, sie ver-setzt sogar den Familiengoldschmuck, Elektrogeräte und andere Wertgegengestände. Ab 2000 verweigerte die Biographin mit 14 Jahren die 8. Hauptschulklasse und schloss sich einer Mädchengang an. Es kam zu ersten Kontakten mit der Polizei, der Jugendgerichtshilfe und zu Verurteilungen, so musste sie u.a. auch Sozialstunden in einem Jugendhaus ableisten. Die Biographin war im familiären Verbund nicht mehr zu halten und zu beeinflussen. So kam es in der Folge schließlich zu sechs stationären Jugendhilfemaßnahmen in unterschiedlichen Einrichtungen, die allesamt aus diszip-linarischen Gründen beendet wurden. Die Biographin zeigte zahlreiche fremdaggres-sive Gewaltausbrüche, insbesondere bis 2004 kam es zu schweren und zahlreichen Alkoholexzessen. Mit 17 erfolgte der erste Suizidversuch, als die Biographin ver-suchte, sich die Pulsadern längsseits zu öffnen. Es folgten in den nächsten Lebens-jahren weitere ernsthafte Suizidversuche mit einem toxischen Tablettencocktail in Verbindung mit Alkohol. Die Biographin wechselte durch unterschiedliche psychiat-rische Settings, durch die Tagesklinik, die Psychiatrische Institutsambulanz, durch den Krisen-, und Notfalldienst, die Psychiatrische Klinik, eine therapeutische Wohn-gemeinschaft, den Sozialpsychiatrischen Dienst. Zwischen den Einrichtungswechsel und in den Übergängen zog sie für kurze Zeit bei ihrer Mutter ein. Ab dem 18. Le-bensjahr (2004) kam es dann zu unzähligen Klinikbehandlungen, mit kurzzeitigen Kriseninterventionen, teils auch nur für eine Nacht. 2006 wurde Fr. Satic wohnungs-los und über ein Gemeindepsychiatrisches Zentrum in ein einfaches Sozialhotel ver-mittelt. Alternativ lehnten die bekannten (teil)stationären Einrichtungen der Woh-nungsnotfallhilfe eine Aufnahme wegen der Schwere der psychischen Erkrankung und der bekannten Gewalt- und Alkoholexzesse der Biographin ab. Schließlich landet
255
die Biographin in einer stationären Einrichtung für junge, wohnungslos und psy-chisch kranke Menschen und lernte dort ihren zweiten Partner kennen, der vier Jahre später, zu einer 7-jährigen Haftstrafe wegen versuchten Totschlags eines zufälligen Passanten an einer U-Bahnhaltestelle, verurteilt wurde. Fr. Satic besuchte ihren Part-ner die Haftzeit über alle 14 Tage in der Haftanstalt. In der Zeit äußerte sie zuneh-mend den Wunsch, ein Kind von ihm zu bekommen. Von August 2008 bis September 2009 ließ sie sich erstmals auf ein strukturiertes Beschäftigungsangebot in einer WfbM414 ein. Immer wieder kam es beim Partner, der mehrfach die auferlegten An-tiaggressionstherapien vorzeitig beendete, zur Beendigung der Beziehung per SMS und stürzte damit die Biographin in schwere psychische Krisen. Im Jahr 2010 eska-lierte die Situation erneut und die Biographin wird für 7 Monate in einer Klinik be-handelt. Klinik und gesetzliche Betreuerin fiel nichts mehr anderes ein, als einen An-trag für eine geschlossene Unterbringung wegen Eigengefährdung nach § 1906 BGB zu stellen. Zuvor kam es nochmals zu einer Vermittlung in ein offenes stationäres Wohnheim für ein Jahr, doch auch hier wurde der Betreuungsvertrag wegen Drohun-gen und Nötigungen fristlos gekündigt. Die Biographin wurde nun auf der Grundlage eines amtsgerichtlichen Beschlusses für ein Jahr in ein psychiatrisches Pflegeheim im Schwäbischen Wald geschlossen untergebracht. Als ein geschlossener Heimplatz im GPV Stuttgart frei wurde, kam es zur Verlegung von November 2011-August 2012. Fr. Satic setzte sich mit ihrer Erkrankung, mit hauswirtschaftlichen Anforde-rungen, in Gruppenangeboten und auch in Einzelgesprächen mit sich und ihrer Situ-ation erstmals intensiver auseinander. In dieser Zeit erfuhr sie vom Fund und einer DNA-gestützten Identifikation der Leiche ihres Vaters in einem Massengrab in Bos-nien. Das Notariat konnte somit den noch offenen Nachlass bearbeiten und die Ver-mögensaufteilung bewerten und somit an die Familie übertragen. Im Heim stellte sich erneut eine hoffnungsvolle und stabile Phase ein und so kam es zu einem weiteren Übergang in ein frauenspezifisches Wohnen in einer ambulant betreuten Wohnge-meinschaft. Doch auch hier wiederholte sich nach wenigen Monaten, im Januar 2013, ein Krisenverlauf und mündete in eine vorzeitige Beendigung. Fr. Satic wurde nun zum dritten Mal wegen einer akut vorliegenden Eigengefährdung in die zuletzt ver-antwortliche geschlossene Heimeinrichtung für ein weiteres Jahr verlegt. Nach einer weiteren Konsolidierung war die Biographin bereit, in ein offenes Wohnheim umzu-ziehen, in dem sie schon ein halbes Jahr zuvor in der Tagesstruktur stundenweise beschäftigt war. Dort kam es zu zwei lebensbedrohlichen Hirnblutungen, die in letzter Sekunde behandelt werden konnten. Nach einem Jahr, in der Zeit von 2014-05/2015 beabsichtigte Fr. Satic mit viel Zweifeln und Vorbehalte der gesetzlichen Betreuerin erneut in ambulant betreutes Wohnen in ein Einzelappartement im Trägerwohnraum zu ziehen. Dort konnte sie sich für knapp 12 Monate behaupten bis es stufenweise und schleichend zu einer Verschlechterung kam und sich schließlich wieder fremd- wie eigengefährdende Situationen ereignen. In diese Zeit fielen auch der Abbruch der Therapie des Partners in der JVA, sowie die Ausweisung aus der BRD, für mindes-tens 10 Jahre, zurück ins Herkunftsland. Fr. Satic drängte nun zu ihrem Freund. Zuvor ließ sie sich nochmals für viel Geld von einem Hodscha mit heilendem Wasser be-handeln, dessen Kontakt von ihrer Mutter vermittelt wurde. Sie reiste schließlich an Weihnachten 2015 zu ihrem Freund, dort kam es nach zwei Tagen zum endgültigen Bruch und einer schweren krisenhaften Rückkehr. Der Partner, so stellte sich wenig 414 Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung
256
später heraus, beauftragte die Biographin damit, das Smartphone sowie den Laptop ihrer Schwester in Geld zu veräußern, um es dann bei ihm abzuliefern. Als dann der Partner von ihr weiteres Bargeld verlangte, damit seine neue Freundin einen Schwan-gerschaftstest kaufen könne, beendete die Biographin die Partnerschaft endgültig. Im März 2016 wurde für die Dauer von einem Jahr wieder ein Antrag für eine geschlos-sen Unterbringung in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung gestellt und statt-gegeben. Die Biographin wohnt seit Juni 2016 im selben geschlossenen Wohnheim, in dem sie zuvor schon zweimal untergebracht gewesen war.
6.3.2.1. Erste Hypothesenbildung zum gelebten Leben
In welche Familiensituation wird die Biographin in familiärer und historischer Hin-sicht hineingeboren und welche Zukunftshorizonte werden für die damit eröffnet?
Die Biographin wächst in den ersten Lebensjahren mit ihrem über alles geliebten und verehrten Vater und ihrer Mutter in einer Villa, in betuchten und luxuriösen Verhält-nissen, auf. Der Vater war als Honoratior hoch angesehen und erfolgreich. Die Bio-graphin war der Augapfel des Vaters, sein ganzer Stolz. Die politische Umbruchsitu-ation und die langjährigen ethischen und religiös motivierten Konflikte und Anfeindungen kommen auch in der Kleinstadt, in der die Biographin groß wurde, zum Ausdruck und führen zu einer Polarisierung unter der Bevölkerung, so dass es nach und nach zu einer Auflösung der Gemeinschaft kam. Durch die Geburt der klei-nen Schwester sah die Biographin ihre exklusive Vormachtstellung in Gefahr und entwickelte seitdem chronische Schluckbeschwerden ohne organische Ursache. Ob die Eltern wegen der Biographin, wegen ihres innigen Verhältnisses zum Vater, we-gen Trennungsabsichten oder wegen der brisanten politischen Lage Konflikte ausge-tragen haben, ist nur mit Mutmaßungen zu beschreiben.
Die Biographin möchte von ihrem Vater gerettet werden, gleichzeitig beanspruchte sie ihn allein für sich. Sie erlebte es als Strafe, dass sie bei der Mutter zurückbleiben, dass sie bei ihr verbleiben müsste. Mit dem Tod des Vaters ist die eigene Biographie von Fr. Satic beendet worden. Mutter und Tochter sind beide schwer traumatisiert und in ihren Welten gefangen. Sie entfernen sich zunehmend voneinander und be-kommen nicht mit, wie es dem anderen geht. Dabei ist gerade die gemeinschaftlich erlebte Traumatisierung, die beide erlebten, u.a. die Ursache für die tiefen inneren Gräben, die emotionale hoch aufgeladenen ambivalenten Beziehung und Kontaktge-staltung zwischen Mutter und Tochter.
Das Grundgefühl von Angst und von willkürlichen Gewalt- und Verlusterfahrungen haben sich so tief in das Erinnern der Biographin eingebrannt, dass sie bei jeder un-vorhergesehenen Veränderung ihrer Alltagswelt zum Ausdruck kommt.
Die Biographin ist nach dem Verlust des Vaters immer wieder auf der Suche nach Personen, wie z. B. der Lehrer, der Facharzt, kurzzeitig auch die Mutter, Mitbewoh-ner, der Partner und Mitpatienten, die sich um sie kümmern, die für sie sprechen, die sie versorgen, um sie sorgen und ihr Hilfe zukommen lassen.
Ähnlich wie in der Falldarstellung 2 (Fr. Brandt) erlebte auch die Familie Satic als ethnisch-religiöse Minderheit zunehmend eine feindselige Stimmung und Abgren-zung in ihrer bosnischen Heimatgemeinde, die sich im Zufluchtsland Deutschland, in
257
Form von weiteren Diskriminierungen und ausländerfeindlichen Einstellungen, fort-setzten.
Die erneute Partnerwahl der Mutter eines Mannes, der ebenso Kriegsflüchtling war, erlebte die Biographin als Verrat und Demütigung ihrem Vater gegenüber. Sie rea-gierte mit maximaler Kränkung, aggressiven Wutausbrüchen und Abwehr. Für die Biographin kann und darf es keinen weiteren Partner für ihre Mutter geben, weil es für ihren Vater, in ihrer egozentrischen Interpretation, keinen Ersatz geben kann.
Die historische Einbettung der Familiengeschichte der Biographin wird in der folgen-den historischen Exkursion über die multi-nationalstaatliche Entwicklung und den langwährenden ethno-religiösen Konflikt näher erläutert.
6.3.2.2. Exkurs: Historische Entwicklung des Balkan 415
Der jugoslawischen Staat entstand 1918 aus dem vorher unabhängigen Königreich Serbien und Montenegro unter Einschluss der von Serbien in den Balkankriegen 1912/13 erworbenen mazedonische Gebieten, der südslawischen besiedelten Gebiete sowie Teile Österreich-Ungarns, die sich aus dem Kronland Krain, Kärnten, Steier-mark, Kroatien-Slowenien, Dalmatien, Bosnien-Herzegowina und die Vojvodina zu-sammensetzte. Insgesamt haben sich hier über 20 Nationen und noch mehr Nationa-litäten vereinigt. Somit ging eine sehr schwierige Staatenbildung voraus, die vor der Herkulesaufgabe stand, ein multikulturelles, multikonfessionelles und multiethni-sches Sammelbecken mit noch regionalen Identitäten unter ein Dach zu bringen. In den folgenden Jahrzehnten hatte man große politische, soziale und ökonomische In-tegrationsprobleme, den schwelenden Serbien-Kroatien Konflikt, sowie den Konflikt zwischen Föderalisten und Zentralisten zu bewältigen. Die 1. Zäsur erlebte der neue Staat im II. Weltkrieg als Hitler und Mussolini das Reich Jugoslawien 1941 angriffen und in der Folge das Land bis 1945 wieder in unterschiedliche Territorien aufgeteilt wurde, so dass nach Kriegsende 1945 die Föderation VR Jugoslawien proklamiert wurde. Sie setzte sich nun aus Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mon-tenegro, Serbien und Makedonien zusammen. 1946 gewann Tito mit der Kommunis-tischen Volksfront die Wahlen und wählte nach dem Vorbild der Sowjetunion eine entsprechende Verfassung für Jugoslawien, jedoch mit föderalistischer Prägung, die Tito bis 1960 vorantrieb. Die Kombination aus dem etablierten Föderalismus, der eine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Teilrepubliken begünstigte, einer schweren Wirtschaftskrise und schließlich Titos Tod 1980, der die integrative Persönlichkeit für den Multinationalstaat war, führte schrittweise bis 1990 zu Unab-hängigkeitsbestrebungen und nationalistischen Bewegungen bei allen Teilerepubli-ken. Diese kumulierten im Jahr 1991 zu einem Höhepunkt, als Slowenien und Kroa-tien ihre Unabhängigkeit erklärten und es zu ersten Kampfhandlungen mit der jugoslawischen Volksarmee kam.
Im April 1992 begann schließlich mit einem Angriff von serbischen Freischärlern auf die halb serbisch, halb muslimische Stadt Bijeljina in Bosnien der Krieg im ehemali-gen Jugoslawien, der die internationale Staatengemeinschaft und Europa erschütterte. Obwohl das Zusammenleben im ehemaligen Jugoslawien von sozialer Distanziertheit
415 vgl. Calic, M. J.: Krieg und Frieden in Bosnien-Hercegowina. Suhrkamp. Frankfurt/M. 1996, S. 20-32.
258
charakterisiert war, spielte für den Großteil der Bevölkerung die ethnische Zugehö-rigkeit bis in die 80er Jahre hinein kaum eine erwähnenswerte Rolle. In erster Linie definierten sie sich über den Beruf, die Schichtzugehörigkeit und den Bildungsstand. Selbst die religiöse Zugehörigkeit spielte bis Ende der 80-er Jahre keine große Rolle. Gerade aus gemischt bosnischen Gemeinden beschrieben die Einwohner die mul-tiethnische Koexistenz noch Anfang der 90-er als konfliktarm und gut funktionierend. Der Krieg hat ca. 4,25 Mio. Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Bereits 1991 vor dem Kriegsausbruch sind viele junge Männer geflüchtet, um der Einberufung zu ent-kommen. 1995 kam es nach monatelangen Waffenstillstand erneut zu Kriegshand-lungen und schließlich zum Massaker in Srebrenica, bei dem 7000-8000 Menschen, meist bosnisch-muslimische Jungen und Männer umgebracht wurden. Die Hälfte der früheren bosnischen Bevölkerung, 2,2 Mio. Menschen, wurde dauerhaft vertrieben. Terrorakte, Angriffe auf Hab und Gut, Deportationen, Internierungen, Vergewalti-gungen, Folter, Verstümmelungen waren monatelang allgemeine Begleiterscheinun-gen des Krieges. Kampfhandlungen, Zerstörung und Hunger wurden systematisch geplant als Mittel zur ethischen Säuberung. Die physische Vernichtung anderer eth-nischer Gruppen galt weniger als Ziel der Kriegsparteien als vielmehr die Vertrei-bung. Tötungen wurden als eine Methode angewandt. Die ethnokulturelle Identität sollte zerstört werden, so wurden auch viele Moscheen, Friedhöfe, Bibliotheken, Kul-turdenkmäler und Orte, die jahrhundertelang, multikonfessionelles Zusammenleben symbolisierten, zerstört, wie z.B. die in 1566 erbaute Brücke von Mostar. Viele Flüchtlinge, die Bosnien-Herzegowina verlassen konnten, erlebten Belagerungen an Orten, die sie ursprünglich zum Schutz aufgesucht hatten.
Die BRD nahm für die bosnischen Flüchtlinge eine besondere Rolle ein, da sie sehr viele Flüchtlinge aufnahm, gleichzeitig jedoch dauerhaften Schutz über die Dauer der tatsächlich erfolgten Kriegshandlungen verweigerte. So ist die soziale Situation über Jahre hinweg durch teils paradoxe rechtliche Rahmenbedingungen geprägt. Die in-nenpolitische Situation war kurz nach der Wiedervereinigung, die viele Zuwanderer aus Osteuropa mit sich brachte, gegenüber Flüchtlinge und Asylbewerber sehr ange-spannt. Zudem standen auch Länderinteressen einer aufenthaltsrechtlichen Regelung für die Flüchtlinge entgegen. Der 1993 verabschiedete § 23a, nach dem bosnische Flüchtlinge eine Aufenthaltsbefugnis hätten erhalten müssen, kam nicht zur Anwen-dung, da sich die Länder weder auf einen Lastenausgleich noch auf eine Verteilungs-quote einigen konnte.416
In den meisten Bundesländern erhielt der größte Teil der Flüchtlinge, wie auch Fa-milie Satic in Baden-Württemberg eine Duldung, die vom Status her lediglich eine Aussetzung der Abschiebung, siehe § 55 Abs. 1 Ausländergesetz „…der geduldete Ausländer bleibt weiter zur Ausreise verpflichtet, sein Aufenthalt ist nicht rechtmä-ßig.“ Eine Duldung war nur für 3 Monate gültig und so schwelte kontinuierlich ein Abschiebedruck, Unsicherheit, Angst und fehlende Zukunftsperspektive, die sich in dieser Phase auch bei Familie Satic negativ auswirkte.
Nach vier Kriegsjahren einigten sich die Präsidenten Serbiens, Kroatiens und Bosni-ens im Vertrag von Dayton, in dem z. B. Bosnien-Herzegowina als ein einheitlicher
416 vgl. a.a.O. Lennertz (2011), S.: 27-28.
259
Staat in seinen international anerkannten Grenzen erhalten bleibt und aus zwei Enti-täten, der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Serbischen Republik besteht. Zudem besteht das Recht für alle Flüchtlinge an ihren Heimatort zurückzukehren. Motiviert, den belasteten Staatshaushalt einzuhalten, gestärkt durch das geltende Ausländergesetz und in der Vorstellung verhaftet, dass die Flüchtlinge dringend für den Wiederaufbau benötigt werden, änderten sich plötzlich und abrupt die politischen Ausrichtungen der BRD, die nun die Flüchtlinge zur Rückkehr aufforderte. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde statt der Anerkennung der tatsächlichen Situation im ehemaligen Kriegsgebiet, ein Bild des nicht zurückkehrwilligen Flüchtlings auf-gebaut, bis hin zu einer Kriminalisierung der zunächst willkommenen Flüchtlingen in Abschiebegewahr sam. 417
Über viele Jahre befanden sich die Flüchtlinge in einer existentiell unsicheren sozia-len Situation, weil sich die aufenthaltsrechtlichen und administrativen Bestimmungen ständig änderten. So wurde auch bei der Familie der Biographin aus der Duldung eine „Kettenduldung“, so konnten sich selbst 10 Jahre nach dem Krieg keine Zukunftsper-spektive entwickeln. Die Duldungen waren für die bosnischen Flüchtlinge mit gra-vierenden Folgen verbunden. So wurde ihnen z. B. ein Arbeits- und Ausbildungsver-hältnis verweigert und damit die Abhängigkeit von Sozialhilfe aufrechterhalten, weiter wurde damit ein Verbot assoziiert, zu reisen, teilweise gab es noch Auflagen, in dafür vorgesehene Flüchtlingsheime zu leben. Besonders in Bayern, Baden-Würt-temberg und Nordrhein-Westfalen wurden überproportional viele Abschiebungen ausgeführt, um frühzeitig Druck auf die Flüchtlinge auszuüben. In diesen Bundeslän-dern verweilten Ende 1999 nur noch 4-9% der ursprünglichen Flüchtlinge.418
Nach JÄGER und REZO (2000) hielten sich von den ursprünglich ca. 320.000 bos-nischen Flüchtlingen 1999 nur noch 39.829 in der BRD auf, somit sind bis dahin 89 % „freiwillig“ oder gezwungenermaßen nach Bosnien zurückgekehrt oder weiterge-wandert. Eine Weiterwanderung in andere europäische Länder stellte für die Flücht-linge ein kleineres Übel dar. Von Deutschland sind mehr als 40.000 bosnische Flücht-linge weitergewandert, Aufnahmeländer waren die USA, Canada Australien, Dänemark, Finnland und Schweden. Die Verwandten der Biographin sind ebenso weitergewandert, da sie in der BRD keine Perspektive sahen und eine Rückkehr für sie nicht in Frage kam.
Neben dem zu erweisenden Flüchtlingsstatus und einer UNHCR-Empfehlung werden z.B. im U.S. Refugee Program die Anträge nach Prioritäten geprüft und umfassten folgende Kriterien.
- das Leben in einer ethnisch gemischten Ehe; - ehemaliger Lagerhäftling; - Opfer von Folter und Gewalt; - Ehepartner von Personen der beiden vorgenannten Gruppen, die verstorben oder vermisst sind.419
417 vgl. a.a.O. Lennertz (2011), S.: 29-32. 418 vgl. a.a.O. Lennertz (2011), S.: 35. 419 Jäger, T. Rezo, J. (2000): Zur sozialen Struktur der bosnischen Kriegsflüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland. Studie von über Pro Asyl. Frankfurt/M.
260
Hervorzuheben ist, dass die Kriterien nicht an eine psychische Traumatisierung ge-knüpft wurden, auch wenn man davon ausging, sich auf potentiell traumatisierte Per-sonen zu beziehen. So wurde es auch nicht notwendig für die Flüchtlinge, ein Trauma nachweisen zu müssen. In der BRD galt hingegen eine Traumaregelung und so wurde ein nachgewiesenes Trauma als Voraussetzung für Bleiberechtskriterien eingefor-dert. In der Praxis war es für die Therapeuten und den Beratungsstellen häufig nicht möglich, über Kriegs- und Fluchterlebnisse mit den Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen, da die existentielle Frage nach dem Verbleib und Aufenthalt und die Angst vor einer Abschiebung stets im Fokus stand.
Die Traumaregelung wurde kritisch hinterfragt, ob es sich hierbei um eine Errungen-schaft oder eher eine Sackgasse handelte? Einerseits bestehe zwar eine rechtliche Re-gelung, die den Aufenthalt der Flüchtlingen in Zusammenhang mit ihrer Gesundheit bringt, andererseits lässt die gegenwärtige Praxis, vor allem der Umgang mit Gutach-ten fragen, ob hier nicht psychologische Fachkenntnisse für politische nicht gefun-dene Lösungen missbraucht werden, so die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer.420
Wenn, wie in den UNHCR Empfehlungen, die biographische wie auch soziale Situ-ation der bosnischen Flüchtlinge im Aufnahmeland Deutschland berücksichtigt wor-den wäre, hätte der Konflikt, z.B. den Flüchtlingen eine Rückkehrunfreiwilligkeit zu unterstellen, erheblich entschärft werden können.421
In der damaligen Flüchtlingspolitik wurde es über Jahre hinweg versäumt, die per-sönliche und soziale Situation bei potentiell traumatisierten Flüchtlingen zu berück-sichtigen. Vielmehr wurde zusätzlicher Druck aufgebaut, zudem ist der Umgang mit Flüchtlingen bei verschiedenen gesellschaftlichen wie auch politischen Gruppierun-gen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen assoziiert, die nicht miteinander ver-einbar sind, so LENNERTZ. Dieselben politischen Fehlentwicklungen, wie auch stigmatisierende und fremdenfeindliche Provokationen und Unterstellungen wieder-holen sich im Übrigen tagespolitisch derzeit bei den ebenso, sich aus dem Bürger-krieg in Sicherheit rettenden und teils schwer traumatisierten syrischen Flüchtlingen, die nach einer anfangs ebenso überschwänglichen Willkommenskultur zunehmend in bestimmten Teilen der Gesellschaft auf immer größere Ablehnung stoßen. So haben sich vielerorts Bürgerinitiativen gebildet oder sogar Parteien geründet, die auf kom-munaler, landesweiter Ebene mit der Angst vor Überfremdung und Kriminalität, mit einer maxi malen Gefährdung der inneren Sicherheit flächendeckend erfolgreich auf Stimmenfang gehen. Es kam in süddeutschen wie auch in ostdeutschen Städten und Dörfern zu beschämenden fremdenfeindlichen Angriffen und Brandanschlägen auf Flüchtlingsheimen, und Unterkünften. Es überwiegen jedoch positive Integrations- und Anpassungserfahrungen, Kontakte und Begegnungen mit diesen Flüchtlingen. Die fremde Kultur wird in der Bevölkerung als Bereicherung erlebt, mit einem flä-chendeckenden bürgerschaftlichen Engagement konnotiert und die Geschehnisse in 420 BAFF (Hg.) (2006): Begutachtung traumatisierter Flüchtlinge eine kritische Reflexion der Praxis. Karls-ruhe. Loeper Literaturverlag. S.: 12. 421Die Rückkehr von z. B. bosnisch-muslimischen Flüchtlingen nach Srebrenica begann erst 2001, nachdem ein Gedenkzentrum eingerichtet wurde. Es war nicht nur Zeit sondern auch eine Anerkennung und ein Mahn-mal zur symbolischen Erinnerungskultur der furchtbaren Kriegserlebnisse eine Voraussetzung für diese Ent-wicklung, so LENNERTZ, vgl. a.a.O. (2011), S.: 38.
261
Syrien werden mehrheitlich mit einer solidarischen wie auch mitfühlenden Geistes-haltung und Einstellung wahrgenommen.
6.3.3. Erzähltes Leben -Text- und thematische Feldanalyse
Die Biographin, Fr. Satic, präsentiert sich als jemand, für die die Welt am Anfang in Ordnung ist, die sich in der Balance hielt, die geregelt und strukturiert war, denn es gab Eltern, Sicherheit, Schutz, Unversehrtheit und Heimat. Bereits ein Jahr nach Fr. Satics Geburt kam ihre Schwester zur Welt, der im Leben von Fr. Satic keine Bedeu-tung zugemessen wird, die sie schlichtweg versucht zu ignorieren, auf die sie jedoch zeitlebens eifersüchtig ist, da ihr alles gelang und sie erfolgreich in Schule, Studium und in der Berufswelt war. Damit endete die Idylle und die heile Welt drohte bereits zu diesem Zeitpunkt ins Stocken zu geraten. Fr. Satic akzentuierte gleich zu Beginn des Interviews, dass ihre Hauptbezugsperson einzig der Vater war und ist, auf den sie fast schon Besitzansprüche erhob. Sie beanspruchte ihren Vater allein und sah die Mutter als diebische Elster, die ihr den Partner streitig machte. Es mangelte vollstän-dig, so die Biographin, an Gemeinsamen zwischen der Mutter und ihrem Vater. Im Gegensatz zum Vater beschreibt sie, wie wenig Bindung, Liebe und Kontakt (Nähe) sie zur Mutter verspüre und wahrnehme. Sie wirft ihrer Mutter letztendlich vor, wie wenig Liebe ihre Mutter für sie übrig hatte. Sie beschreibt die dauerhaften Konflikte der Eltern, eingebettet in einer Atmosphäre von Zankerei und Vorwürfen und erlebte es schließlich als Höchststrafe, bei der Mutter zurückgelassen zu werden, als der Va-ter zum Militär einberufen wurde.422 Fr. Satic übersprang die ersten acht Jahre ihres Lebens mit großen Zeitsprüngen und markanten Auslassungen und konzentrierte sich frühzeitig auf eine dichte Narration, in der sie ihren eigenen Erinnerungen von der Flucht der Mutter mit ihren zwei kleinen Töchtern berichtete, die mit fünf Jahren (Biographin) und drei Jahren durch den Wald zieht und vor serbischen Freischärlern ein Versteck, eine sichere Zuflucht suchte. Sie nächtigten in Höhlen und alten Holz-hütten. Ob es Tage, Wochen oder Monate waren, ist nicht zu erfahren. Fr. Satics Er-innerungen lösen in diesen bedrohlichen Ereignissen die zeitlichen Dimension und Strukturierung vollständig auf. Unter Todesangst irrlichterte das Trio durch die Wäl-der und wurde schließlich von den Serben gefasst und in Metallkäfige eingesperrt. Sie hungerten und die Mutter und die Biographin wurden nach Willkür und Belieben missbraucht. Die Schwester blieb wegen des noch jüngeren Alters und ihrer zierli-chen Gestalt verschont, so die Erklärung der Biographin. Das hieraus erlebte Grund-gefühl, schutzlos dieser Welt ausgesetzt zu sein, gewalttätigen und unkontrollierba-ren Männern ausgeliefert zu sein, erwächst in der Biographin zu einem dominierenden und allseits leitenden Lebensgefühl. Fr Satic fühlt sich nunmehr voll-ständig verlassen, sie ist in permanenter Angst und Habachtstellung. Die Nachricht vom Tod ihres Vaters durch den Onkel, der an ihrem 6. Geburtstag auf eine Mine getreten war, symbolisiert für Fr. Satic gleichzeitig das Ende ihrer eigenen Biogra-phie. Noch wenige Tage zuvor wird das Käfigversteck von den eigenen bosnischen Soldaten entdeckt und das Trio mit Fr. Satic befreit. Als der Vater seine Familie noch-mals kurz aufsucht („er kam mit einem roten Auto (..) das seh ich noch heute kom-
422 vgl. Interview 2, Falldarstellung Fr. Satic, S.10, Zeile: 346-372.
262
men“, und sie beruhigt, schwört er nach dem nächsten Kampfeinsatz wieder zurück-zukehren, um sie dann ins damals noch sichere Kroatien zu geleiten, von wo aus Fluchtbusse von den IFOR- Soldaten nach Österreich und Deutschland abfuhren.423
Das folgende thematische Feld, das die Biographin nun eröffnete, konzentrierte sich auf das zeitlich anschließende Migrationsprojekt, das die Mutter mit der Tante zwangsläufig einleitete. Die Biographin beschreibt, wie sie mit vielen Frauen und Kindern in einem heillosen Chaos nach Stuttgart gelangten, dafür aber in Sicherheit vor dem Bürgerkrieg gebracht werden, gleichzeitig aber auch in eine große Unsicher-heit, wie es nun weitergeht.424 Bei der Biographin dominierte ab hier ein Grundge-fühl, des nicht mehr Wissens, wohin sie gehöre, einsam zu sein, selbst in der redu-zierten Familie, ohne einen Hauch an Bindung oder Beziehung zur Mutter oder Schwester zu verspüren und wahrzunehmen. Mehr noch, Fr. Static vollzieht gegen-über ihrer Mutter und der Schwester einen Entfremdungsprozess, der in der Grund-schule noch weiter verstärkt wird. Fr. Satic hat vor allem Angst, vor den Mitschülern, dem Schulgebäude, vor dem Klassenzimmer, vor den Lehrern. Sie hat Angst, den Schulweg alleine zu bewältigen. Sie ist so verängstigt, dass sie sich nicht einmal traut, sich zu melden, da sie doch zur Toilette muss. Sie macht in die Hose und ist alsdann nicht mehr in der Lage, aus Scham, in die Klasse, in die Schule, zurückzukehren.425 Die Biographin verweigerte sich, schläft tagsüber, boykottiert offensiv oder passiv den Schulbesuch, in dem sie zwar die Wohnung am Morgen verlässt, sich aber dann auf der Straße herumdrückt. In derselben Zeit weigerte sie sich auch den neuen Part-ner, dann bald Ehemann der Mutter anzuerkennen und zu akzeptieren. Die Biogra-phin provoziert, ist renitent, begehrt im Gegensatz zur Schwester auf, sowohl gegen-über der Mutter als auch gegenüber dem Stiefvater. Es kommt zu ersten gewaltsamen Übergriffen zwischen dem neuen Vater und der Biographin. Diese werden von der Mutter angezweifelt und nicht geglaubt, bis zu dem Zeitpunkt, als die Biographin körperlich so schwer misshandelt wurde, dass sie im Krankenhaus versorgt werden musste. Der Stiefvater wird auch gegenüber der kleinen Schwester gewaltsam und schneidet ihre Haare, die bis zur Hüfte reichten, ab. Die Biographin sucht mit 13 Jahren den Weg zur Polizei und gibt eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.426 Das Jugendamt und Gericht interveniert und es kommt nur wenige Monate später zur Abschiebung des Stiefvaters. Die Biografin definiert den Beginn ihrer psychiatri-schen Erkrankung, die mit Panik- und Angstgefühlen einhergeht, mit der Gewalteska-lation durch den Stiefvater. Sie fordert nun, aus dem Gesichtsfeld des Stiefvaters und der Mutter entfernt zu werden und kommt erstmals in institutionalisierte, feste Heimstrukturen mit Hausregeln, Umgangsregeln, die von Erziehern eingefordert werden. Mit dem Übergriff beendet die Biographin auch den regelmäßigen Schulbe-such. Die Biographin wählt das Mädchenheim, weil sie in der Mutter keine Unter-stützerin und vor allem Beschützerin mehr erkennen kann, die nämlich weder wahr-nimmt, wie schlecht es um sie bestellt ist, noch in der Lage ist, ihre eigenen Kinder oder gar sich selbst vor einem gewalttätigen Partner zu schützen. Erneut zeigt ein staatlicher Funktionsträger, diesmal der Klassenlehrer die Initiative und leitet eine kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung bei der Biographin ein, die auch diese 423 Falldarstellung 3, Interview 1, S. 1, Zeile: 8-56. 424 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 3-4, Zeile: 92-115. 425 Falldarstellung 3, Interview 1, S. 14-15, Zeile: 488-541. 426 vgl. Falldarstellung 3, Interview 1, S. 2, Zeile: 76-92 und Interview 2, S. 4, Zeile: 112-127.
263
Intervention über sich ergehen lässt. Statt sich auf eine wirksame und nachhaltige Behandlung einzulassen, begibt sich Fr. Satic in eine romantische Partnerschaft mit einem jungen Mitpatienten. Sie will ihrer Mutter, die ihr den Vorwurf macht, keine Bindung und Beziehung zuzulassen, dadurch beweisen, dass sie nicht krank und in der Lage ist, eine langfristige Partnerschaft zu führen. Diese dauert sieben Jahre an. Fr. Satic zahlt jedoch einen hohen Preis. Sie beschreibt ihren Freund als einen ge-waltsamen, sehr aggressiven Jungen, der sie ständig erpresst, Geld zu beschaffen. Es sei ein Junge, der von ihr verlangte, Schmuck, Geld und anderen Wertgegenstände ihrer Mutter und Schwester zu entwenden, damit er sie zu Geld für Drogen und Mar-kenkleidung machen könne. Die Biographin berichtet ausführlich und im szenischen Präsens, wie sie von ihrem Partner geschlagen wird und sich Finger, Hand und Nase bricht und immer wieder im Krankenhaus behandelt werden musste. Sie trägt Kopf-verletzungen, Prellungen und Platzwunden davon. Die Biographin bilanziert aus heu-tiger Sicht, „die Beziehung als krankhafte Liebe, die nicht normal war, sie habe nicht das gefunden, nach dem sie gesucht habe“. Die Partnerschaft wird von beiden Seiten „hundertfach beendet und wieder aktiv gestellt“.427 Das Jugendamt und das Gericht beschließen, die Biographin aus dem zerstörerischen, täglichen Gesichtsfeld des Jun-gen zu nehmen und vermitteln sie in ein Heim, das 40 km entfernt liegt. Fr. Satic durchwanderte viele unterschiedliche Einrichtungen, mit unterschiedlichen Konzep-tionen und Angeboten. Sie wird getragen von einer Sehnsucht, in den Einrichtungen einen Ort der Beheimatung zu erleben. Doch sie fühlt sich ein ums andere Mal ent-täuscht und gekränkt. Die Erwartungen an die Pädagoginnen scheitern jedes Mal, bei dem Vergleich, den Fr. Satic mit ihrem Vater als Referenzgröße ansetzt. Niemand kann und wird da bestehen können. Fr. Satic beschreibt sich als jemand, die sich nur von ihrem Vater etwas sagen lässt. Einzig er sei autorisiert und befugt, ihr Grenzen aufzuzeigen, ihr Empfehlungen zu geben oder Kritik zu üben.428 Wieder und wieder lehnt sie die Behandlungen der Kliniken, die Angebote der Einrichtungen und der Heime ab.
Letztendlich bleibt Fr. Satic eine frühzeitig eintretende psychopharmakologische Be-handlung, die einen Entfremdungsprozess der Identität und des Körperlichen bzw. des Leibes einleitet und konstant aufrechterhält. Die Biographin gibt an, sie spüre sich nicht, sie wisse nicht mehr, wer sie eigentlich ist? „Ich komme nicht mehr weg von den Medikamenten, ich bin süchtig (3x) ich weiß nicht, was ich machen soll ..mir ist total schlecht ich komm nicht mehr weg von den Medikamenten. Es (das abhängige Süchtig-Sein) blockiert mich als Mensch.“ Die Biographin fühlt sich nicht als Mensch, sondern als Ding, als Objekt, das willenlos funktioniert und nur noch auf einem geringen Anspruchsniveau am Leben bleibt, vielmehr so dahinlebt.
Die Sehnsucht nach dem Vater als zentrale Dimension ragt über allem heraus. Es ist eine Sehnsucht nach dem Vater, dem sie nicht mehr habhaft werden kann, weil er körperlich nicht mehr präsent ist. Die Biographin sehnt sich nach einer Liebe, die nicht erfüllt wird und auch nicht werden kann, weil sie sich wiederkehrend als eine gewalttätige und zerstörerische entpuppt. Es ist eine Sehnsucht nach Zweisamkeit aus einer existentiellen Angst vor Einsamkeit, vor der Stille des Alleinseins. Es ist eine
427 vgl. Falldarstellung 3, Interview 1, S. 3, Zeile: 99-117. 428 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 7, Zeile: 232-247.
264
grundlegende Angst und Überzeugung, als einzelne Person nicht überlebensfähig zu sein. Dafür geht die Biographin auch den Preis ein, manipuliert, instrumentalisiert, sogar seelisch und körperlich misshandelt zu werden.
Die Biographien begibt sich von Mal zu Mal in abhängige Beziehungen, sowohl ge-genüber ihrem Partner als auch ihrem Facharzt gegenüber, den sie so lange stalkt und massiv bedrängt, bis die Auflösung der Behandlung angezeigt wird und sie mit der Tötung bzw. dem Tötenlassen ihres behandelnden Arztes und seiner gesamten Fami-lie durch ihren gewalttätigen und gewaltbereiten Partner droht. Sie bagatellisierte ihre Reaktion und verharmlost ihre Handlungsabsichten und erkennt hierfür keine Ver-antwortung. Die Biographin erklärte, sie habe lediglich angekündigt: „Dr. NN, ich bringe sie und ihre Familie um (..) besser ich lasse sie umbringen! (….) und obwohl ich mich 1000 Mal entschuldigt habe….was hab ich denn gemacht (laut)? Ich hab` doch keinen Menschen umgebracht, wie das mein Freund (….) warum sperren sie mich hier rein.“ Das sei dann das Ticket für die geschlossene Unterbringung gewe-sen, meinte der Facharzt, in den sich die Biographin seit ihrem ersten Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verliebt hat.429
Sie macht wieder und wieder die Grunderfahrung, dass Dritte, Institutionen, die Fa-milie, der Richter etc. sie von einer gewalttätigen Bindung befreien und erlösen. Beim ersten Partner kommt es zu einer Zwangsverheiratung in seinem Herkunftsland und einer Herausnahme aus dem Gesichtsfeld der Biographin.
Das Verhalten der Biographin oszilliert zwischen zwei Extremen, einerseits zwischen einer von der Biographin selbst ausgehenden körperlichen Gewalt und andererseits einer dauerhaft bedrohlichen und gewaltsamen Atmosphäre, in der sie sich innerhalb der Paarbeziehung, vom 13. Lebensjahr an, dauerhaft aussetzte. Die Biographin schloss sich zu der Zeit zudem einer Mädchengang an, mit der sie um die Häuser zog, dabei Drogen und Unmengen an Alkohol konsumierte. Sie suchten sich dann will-kürlich meist schwächere Mädchen als Opfer aus und schlug sie dann krankenhaus-reif. Das sei der Zeitvertreib gewesen und hat einen Kick gegeben. Dieses Verhalten präsentierte die Biographin auch innerhalb der Einrichtungen, sie beschreibt sich in den Interviews selbst als Bewohnerin, die bedrohte, die laut und aggressiv war, die häufig schrie und explodierte, die sich schnell angegriffen und provoziert fühlte. Die Biographin berichtete weiter, dass sie es nie lange in den Einrichtungen und Heimen ausgehalten habe, da sie mit ihrem Verhalten zur Eskalation bis hin zu Verletzungen mit einem Messer gegenüber einer Erzieherin beigetragen haben.430 Der Biographin musste man schließlich aus disziplinarischen Gründen kündigen und sie entkam auf diese Art, zumindest für den Augenblick, der Institution. Ihr Verhalten mündete je-doch immer wieder in Situationen, in denen sie ohne festen Wohnsitz auf der Straße oder gleich in einer psychiatrischen Klinik landete. Das wiederholte sich viele Male.
Im zweiten Partner erhoffte sich Fr. Satic wieder jemand, der sie von ihren Leiden erlöst, der sie rettet. „Endlich bin ich an einen Partner gekommen, der mich nicht anfasst, mich nie angefasst hat, (…) also noch nie geschlagen hat.“ Sie habe nun einen Partner gefunden, durch den sie ihren Vater nicht mehr so arg vermisst. Sie
429 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 8, Zeile: 265-315. 430 Falldarstellung 3, Interview 1, S. 5, Zeile: 179-196.
265
solidarisiert sich mit ihrem Partner gegen den Rest der Welt, indem sie sogar die schwere Körperverletzung mit Todesfolge rechtfertigt, die ihr Partner in einer U-Bahnstation in Stuttgart begangen hat, als er sich von einem anderen jungen Mann provoziert fühlte. Die Biographin beschreibt, dass sie ihrem Partner blind glaube und vertraue. Und weil eh alle gegen ihn und sie seien, müsse er halt deswegen immer wieder gewalttätig werden. Und so sei er in den Knast gekommen. Die Biographin ordnet ihrem Partner Wundersames zu. „Er ist ein Mensch, ein Wundermensch, der magisches Wissen habt, der halt alles von mir weiß, meine Gedanken kennt sie alle kontrolliert. Er weiß, wann es mir schlecht geht, wenn er helfen muss (…) er weiß alles von mir! Ich bin ein Buch für ihn.“ Sie weiß aber auch um die Folgen, dass sie abhängig von seiner Liebe ist „… er habe auch Macht über sie, könne sie kontrollie-ren und so sei sie auf ihn voll konzentriert“. Eine Besuchseinheit pro Monat für 45 Minuten geben der Biographin Zuversicht und Hoffnung und bestärkt sie in ihrer Vorstellung von einem gemeinsamen Leben nach der Haftzeit, mit einem Kind in einer Mietwohnung, aber ohne Sozialarbeiter.
Die Biographin gesteht sich ein, dass sie aber schwer krank sei. Da sie nie einen Zu-stand des Glücks erlebe, könne sie nie zufrieden sein, selbst wenn sie alles hätte 100.000 € und in einem Schloss wohne (...) das Grundgefühl, das ist dunkel und voll mit Angst und Depressionen. Ihre Gedanken sind immer am Boden und trüb, sie stö-ren und sind so mächtig und determinieren so ein Dauergefühl von Dunkelheit und dem Wunsch niemand zu sehen.
Die Biographin fühlt sich dauerhaft missverstanden, dabei überschätzt sie ihre Res-sourcen und Fähigkeiten, und gibt gleichzeitig vor, sich nicht vor ihrer Umwelt schüt-zen zu können. Es tauchen, wie von alleine, immer wieder neue Bekannte auf, die sich im Leben der Biographen einnisten. Sie bekommen dafür Geld, das sie für sie einkaufen, für sie kochen, damit die Biographin ein für sie angstauslösendes Verlas-sen der Wohnung vermeiden kann. Sie betrachtet die Abhängigkeiten zwar als lästige Notwendigkeit und reagiert selbst dann nicht mit einem Kontaktabbruch, als ein Be-kannter die Biographin aufforderte, sich für ihn gefälligst zu schminken und anzu-schaffen. Beim Kochen verursachte z. B. ein Bekannter zwei teure Feuerwehreins-ätze, die auf das Konto der Biographin gehen. Das Appartement, in dem die Biographin wohnt, befindet sich in einem Gebäudekomplex eines Wohnheims und ist mit den Rauchmeldern direkt mit der Feuerwehr aufgeschaltet. Fr. Satic präsentiert sich als völlig frei, die sich an nichts zu halten habe. Da sie nur auf ihren Vater höre, fühle sie sich schnell bevormundet, zudem traue ihr niemand etwas zu. Die paradie-sischen Zustände, die sie mit ihrem Vater erlebt habe, in einer harmonischen Symbi-ose exklusiv aus Vater und Tochter, seien nicht mehr reproduzierbar. Ihr wohlhaben-der Vater habe sie wie eine Prinzessin behandelt, nur verwöhnt, mit ihr Reisen unternommen und Geschenke gemacht. Sie lebte mit ihm in einer Villa. Über die Mutter oder Schwester verliert sie kein Wort.
Als die Leiche ihres Vaters in einem Massengrab des Balkankriegs identifiziert wurde, konnte das Erbe nach knapp 20 Jahren angetreten werden und der Verkauf des Hauses abgewickelt werden. Da Biographin fühlte sich benachteiligt, da ihre Mutter den größten Erbteil zugesprochen bekam. Selbst der Hinweis, dass sie nur über eine Vermögensgrenze von 2600 € verfügen könne, ignoriert die Biographin
266
vollständig. An ihrer Bewertung ließ sie nicht rütteln. Man wolle ihr eh nur Schaden zufügen und ihr nicht zu ihrem Recht verhelfen.
Die Biographin knüpft bei der Beschreibung des Zustandes der Beziehung zum Vater an ihre ersten fünf Lebensjahre an, in denen sie massive Schluckbeschwerden entwi-ckelte, nichts essen und nicht schlafen konnte. Sie sei von Ihrem Vater von Kranken-haus zu Krankenhaus gefahren, aber niemand konnte ihr helfen. „Dann kam der Krieg und ich habe mich gar nicht mehr getraut zu schlucken…eigentlich ist das bis heute!“ Sie beschreibt ihre Gefühlszustände so „…sie lebte schon immer in Angst und Unsi-cherheit (..) es könnte ihr jederzeit was zustoßen, es könnte was Schlimmes passie-ren..schon als Kind habe sie die Erfahrung gemacht, dass die Ärzte und die ganze Medizin mit ihr katipultiert (kapitulierten)..man könne ihr eh nicht helfen, (..) sie nicht mehr heilen.. alles hoffnungslos…mit ihr sei es hoffnungslos.“431
Die Biographin sieht als einzige und direkte Ursache für ihr schweres Übel den täg-lichen Stress und Streit zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater. Ihr Vater wollte sich eh von ihrer Mutter scheiden lassen, sich endlich trennen. Das war überhaupt keine richtige Liebe, so auch die Beschreibung ihrer eigenen Liebesbeziehungen… „das war nicht normal, krankhaft“ ..“die Biographin weiß um viele Details, Szenen und Worte, die gefallen sind“.. „sie könne sich sehr gut an die vielen „Ehestreits“ zu-rückerinnern. Sogar sehr genau!“432
Sie eröffnete als neues Feld unmittelbar die Ursache für ihre Störung. Die Biographin ist überzeugt, dass sie nicht krank geworden wäre, wenn sie in Bosnien geblieben wäre, wenn sie nicht mit ihrer Mutter und Schwester nach Deutschland gekommen wäre.“ Ich wäre nicht krank geworden, wenn ich mit meinem Vater in Bosnien leben würde“ 433 (..) Sie habe erst durch die vielen Heime und Einrichtungen durch müssen, weil das ständig jemand von ihr verlangte. Die Mutter, die Betreuerin, das Jugendamt, Ärzte, der Richter. Sie habe so schlechten Umgang bekommen, falsche Freunde, über sie sei sie dann alkoholabhängig und süchtig geworden und habe Leute bedroht und noch mehr. An dieser Stelle kommt es zu einer Auslassung in Form eines langen bedeutungsschwangeren Schweigens. Da sie keine richtige Familie hatte, mit einem Vater und einer Mutter, die korrekt waren, wurde sie vielmehr von ihrer Familie aus-gestoßen, ausgegrenzt. Man wollte sie ständig abschieben, in Heime und in Kliniken. Zu den Verrückten. Sie war das schwarze Schaf. Ihre Mutter habe sich aber nicht korrekt verhalten. Sie sei immer auf Distanz gegangen, sei ganz kalt gewesen. Sie habe sich ihr gegenüber nie wie eine Mutter verhalten. Im selben Atemzug erwähnte die Biographin dann halt eben das Leben der Mutter kaputt gemacht zu haben. Wegen ihr habe ihre Mutter auch nie das Leben führen können, wie sie es wollte. Sie habe heute aber große Schuldgefühle ihrer Mutter gegenüber.
Fr. Satic kommt zu der Selbstüberzeugung, dass es eh keine Familie für sie geben könnte, die sie aushalte, ertragen könne (…..) oder dass es Menschen geben könnte, die sie ertragen (..) für längere Zeit (..) auf Dauer, gar nicht (...) so müsse sie halt in
431 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 2-3, Zeile: 44-71. 432 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 1, Zeile: 8-56. 433 Falldarstellung 3, Interview 1, S. 11, Zeile: 378-400.
267
Einrichtungen leben (…). Sie ist davon überzeugt, dass sie Ballast für ihre Umwelt darstellt, der nicht lange ertragen und ausgehalten werden kann.
Diese stellen ein Substitut für eine Familie dar, als bezahlte Dienstleistung, um das Verhaltensrepertoire der Biographin in einem professionellen Verhältnis mit einem Handlungsauftrag, mit Ziel- und Maßnahmevereinbarungen gegen Geld aushalten, zu ertragen, sich auszusetzen. Die Biographin geht davon aus, dass sie ihr Leben lang in Krankenhäusern, Heimen und Einrichtungen verbringen werde. So lange sie lebe!
Über die Schulzeit befragt, erfährt man, dass sie der Schule stets eine Klinik vorziehe, .. „da sie sich dort wenigstens sicher fühlte“!
Fr. Satic hat sofort ein Bild, ihre Rolle und einprägende Erlebnisse parat, die sie vor-trägt. Sie sei Außenseiterin gewesen, die einzig mit einer Freundin Kontakt hatte, die ebenso auf eine Flüchtlingsgeschichte zurückgriff. Die anderen waren normale Kin-der aus normalen deutschen Familien, die schon immer in Stuttgart lebten. Sie be-schreibt, dass sie ausschließlich negative Erfahrungen mit der Schule gemacht habe. In der Schule habe sie sich nie wohl gefühlt, den Schulbesuch verweigert, war zu Hause geblieben. Ich war immer krank. Fr. Satic wird im Interview plötzlich sehr laut, ballt die Fäuste und platzt empört mit der Erklärung hervor..“ was soll ich sagen. Also echt, Hr. Masanz. Ganz ehrlich jetzt…was ich alles gesehen habe…was pas-siert ist…mit mir die Bilder in Bosnien…ich wundere mich, dass ich hier noch sitze und Cola trinke und dann was mit mir passiert ist! (……) Ich bete zu Gott, dass er irgendwas macht, dass ich endlich sterbe“(sehr laut).
Im selben Atemzug berichtete die Biographin, dass sie aus religiösen Gründen nie-mals Hand an sich legen werde. Sie habe 24 Stunden diese Bilder im Kopf. Sie sehne sich nach dem Tod, die vielen Suizidgedanken belasten sie. Die Zwangsgedanken, die wieder und wieder kommen, sie nicht mal in Ruhe lassen. Sie wolle am Liebsten tot sein.
Im 2. Teil des Interviews bedauerte Fr. Satic die Zeit im geschlossenen Heim. Als sie das 2. Mal im geschlossenen Heim war, aktuell möchte sie zum 3. Mal wieder zurück. Sie fühle sich nur dort sicher und geschützt. Fr. Satic stellt sich auch ambivalent dar und äußert, dass sie dort natürlich nicht mehr hinwolle (lacht schelmisch, grinst) auf der anderen Seite könne sie ja nicht ständig im geschlossenen Bereich leben! Die Biographin bewertet die Zeiten in der geschlossenen Unterbringung als positiv…“da-mit verbinde sie auch gute Zeiten, z. B. mit ihrem Freund, der da noch in Haft war“ (und nicht weglaufen konnte). Die Biographin gibt zu, dass sie sich anfangs dagegen gewehrt habe (so wie alle anderen am Anfang) dann habe sie erkennen und erfahren können, „dass es mir sehr viel gebracht hat..ich in der Zeit viel gelernt habe!“
Die Biographin versucht in die Perspektive und Rolle der damals 13jährigen Fr. Satic zu schlüpfen und stellt fest,…die hätte damals auf alle Fälle den Kontakt zu den So-zialarbeiterinnen zulassen sollen! Sie hätte mit ihnen reden, sie hätte erzählen sollen, was sie auf dem Herzen hat. Sie hätte sich nicht zurückziehen, sich nicht entziehen dürfen. Das war ein großer Fehler!“ 434
434 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 1, Zeile: 15-26.
268
Die Biographin beschreibt sich als Gegenpol zur Schwester. Ich bin das Gegenteil meiner jüngeren Schwester. Sie ist ruhig, ich bin laut. Wenn es ihr schlecht geht, macht sie alles mit sich selbst aus. Sie sorge hingegen dafür, dass das alle Welt mit-bekomme, wie es ihr gehe. Ihre Schwester sei erfolgreich, gut in der Schule, hat ein Studium gemacht und arbeite im Ausland. In Afrika. Sie sei geradlinig und baue keine Scheiße. Sie könne sich anpassen und breche keine Regeln, so wie sie das selbst stän-dig und überall veranstalte. Ihre Schwester unternehme auch nichts Verbotenes. Ein großer Unterschied bestehe darin, dass ihre Schwester keine Angst habe, sie hingegen lebe 24 Stunden, rund um die Uhr, in Angst und sei ihr hilflos ausgesetzt. Die Bio-graphin beschreibt sich weiter als jemand, die es nicht ertragen kann, wenn es ihr gut gehe, wenn alles glatt und unauffällig zugehe, in diesem Fall müsse sie wieder etwas in Szene setzen, um sich wieder schlecht zu fühlen. Sie sei ständig damit beschäftigt den anderen zu beweisen, zu demonstrieren, dass es ihr schlecht gehe. Mit ihrer Schwester kam es schon zum Bruch als sie Kinder waren. Mit ihr könne sie nur wenig anfangen, sie habe zu ihr keinen Draht, eigentlich gar keine Beziehung, eigentlich noch nie gehabt.435
Die Biographin beschreibt als besondere Erinnerung, dass sie, seit sie denken könne, immer das Gefühl habe, im Hals stecke etwas fest, dass sie nicht schlucken könne. Die Angst vor dem Schlucken könne sie nur mit Hilfe von Benzodiazepinen und Al-kohol zumindest kurzfristig beseitigen, wobei bei ihrem fast täglichen Alkoholkon-sum die Schluckbeschwerden und Ängste sogar noch verstärkt werden. Sie gerate mit Hilfe des starken Alkoholkonsums sogar in einen Trance-Zustand, in eine vollstän-dige Blockade, in der sich nicht einmal ihre eigene Spucke schlucken könne. In diesen Zuständen erhoffe sie endlich ableben zu dürfen, vielleicht an einem Herzstillstand.436
Neben den Schluckbeschwerden erinnerte sich die Biographin an eine weitere Kind-heitserinnerung, die sie mit ihrem Vater erlebt habe. „Als ich klein war, habe ich eine Sängerin toll gefunden. Ich war Fan von ihr. Und ich war mit meinem Vater auf einem Konzert von ihr, dann hat mich mein Vater auf die Bühne gebracht zu ihr (…) vor 1000 Menschen! (strahlt) Das war ein tolles Gefühl!“ Die Biographin gesteht im 2. Interview, dass sie von ihrem toten Vater geheime Zeichen und Botschaften be-komme, eigentlich täglich, so stehe er mit ihr in Verbindung. Und dass geschieht, seit er tot ist. Sie bekräftigt, dass sie keine Psychose habe! Er gibt mir Zeichen, dass er da ist, hier und jetzt, bei mir und dass ich mich sicher fühlen kann, dass mir nichts pas-sieren wird. Er werde mich nicht verlassen.437
Eine weitere Erinnerung, die sie sehr schamhaft erlebt habe, hebt die Biographin aus der Schulzeit in der Grundschule hervor. Sie habe in der Zeit einen sehr starken Fa-milienzusammenhalt gespürt. Doch die Flucht sei sehr chaotisch gewesen, überall seien Frauen und Kinder gewesen, mit Koffer und Taschen. Als sie einmal im Schul-unterricht auf die Toilette musste, habe sie sich nicht getraut sich zu melden und machte in die Hose. Sie habe sich in der Schule nicht konzentrieren können, nichts
435 Falldarstellung 3, Interview 1, S. 14-15, Zeile: 488-541. 436 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 3, Zeile: 44-71. 437 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 7, Zeile: 72-91.
269
lernen können, weil sie wie in einem Film immer und immer wieder Bilder und Er-innerungen im Kopf abgespielt haben. Es sei nicht möglich gewesen, in der Gegen-wart zu leben.438
Die Biographin beschreibt einen weiteren schweren Gewaltübergriff durch den Stief-vater, der sie schwer misshandelt habe und ihrer Schwester die Haare, „sie hatte einen Zopf bis zur Hüfte, aus Zorn abgeschnitten habe“. Die Übergriffe, die sich auch auf ihre Mutter bezogen, stellten das Wiedererwachen ihrer Ängste dar und führten aus der Sicht der Biographin dann direkt in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Für jede schlechte Schulleistung wurde sie vom Stiefvater bestraft und geschlagen. 439
Wieder und wieder erwähnte die Biographin, dass sie in Angst lebe, die Angst ihr Leben bestimme und sie nachts nicht schlafen könne, schließlich konnte sie auch tagsüber nicht mehr in die Schule. Verständnis habe sie beim Klassenlehrer gefunden, bei Ärzten, schließlich habe sie Hilfe durch das Jugendamt erfahren. Dort habe sie auch den Rückhalt bekommen, den sie sich aber von ihrer Mutter, ihrer Familie so sehr gewünscht habe. Sie habe ihr Zimmer immer abgedunkelt, weil sie die Welt da draußen nicht sehen wolle, nicht ertragen könne, keinen Kontakt haben wolle, sie wolle sich völlig abschotten. Sie sei immer geschont worden, nie richtig gefordert und schäme sich heute dafür, dass sie vieles nicht könne, was die anderen, auch ihre Schwester, in ihrem Alter ohne Probleme konnten.440
Nach dem Aufzählen der fehlenden Fähigkeiten eröffnet die Biographin dafür ein Feld, indem sie ihre Kompetenzen aufzählt, die ihr eine erfolgreiche Strategie eröff-nen, die Nähe zu ihren Partner, zu den Mitarbeitern, Erziehern, zur Familie oder zu Mitbewohnern auszutarieren. Sie könne dies dann zu einem bestimmten Punkt nicht mehr regulieren, könne keinen Einfluss mehr darauf nehmen und sei auf die Hilfe von Dritten angewiesen. So kam es dazu, dass man ihre Partner weggenommen habe, einmal wurde er zwangsverheiratet, das andere Mal kam es zur Verurteilung und zum Haftvollzug. Nur beim Stiefvater sei sie zur Polizei gegangen, habe ihn angezeigt. Daraufhin wurde er von der Polizei ausgewiesen und endlich abgeschoben. Für Ihre Partner zeigt Fr. Satic großes Mitleid bis hin zur Selbstaufgabe. Sie hat ein umfäng-liches Verständnis für ihre gewalttätigen Partner, die ja beide keine gute Kindheit hatten, einer musste ohne Mutter groß werden, der andere hatte keine Eltern. Die Biographin wählt ihre Partner aus stark vorbelasteten Familien aus und entspricht ihrer Zustandsbeschreibung ihrer eigenen Familie. Sie versöhnte sich 1000 Mal und dann bekriegten sie sich wieder. Sie könne aber weder mit noch ohne ihren Freund leben. Sie fühle sich getrennt unvollständig.
Den Begriff der Heimat versteht die Biographin so, dass sie einerseits keine Heimat kenne, eigentlich heimatlos sei, sich nirgendwo zu Haus zu fühlen, andererseits sei ihre Heimat da, wo ihr Vater war (…) aber heute will ich überall weg, egal wo ich bin, nirgendwo ist mir wohl. So pendelt die Biographin mehrfach am Tag von ihrer Wohnung zur Mutter, streitet sich mit ihr, kehrt wieder zurück, dazwischen nimmt sie ihre Medikamente, entzieht sich auch hier den Terminen, entschuldigt sich wieder,
438 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 3-4, Zeile: 92-115. 439 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 4, Zeile: 116-127. 440 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 4-5, Zeile: 138-157.
270
verleugnet sich am Telefon, gibt dann vor, nicht in der Wohnung zu sein, nicht einmal in der Stadt. Sie wird dann von der Polizei gefahndet, wird abgeholt, nächtigt dann wieder bei einer Freundin.
Sie beschreibt sich als rast- und ruhelos. „Ihr könnt mich in ein Schloss einziehen und dort betreuen lassen, dann wollte ich auch dann weg. Ich krieg meine Ruhe einfach nicht, meine Ruhe nicht!“
Zur Krankheitsbehandlung greift sie auf Rituale mit heiligem Wasser zurück, die im muslimischen Glauben von Hodschas angewendet und durchgeführt werden. Die Bi-ographin ist davon überzeigt, sie sei vom Teufel besessen. „Sie habe gar keine Psy-chose oder eine Borderline-Störung, wie man ihr hier nur in Deutschland sagt. Ihr könne aber nur ein Hodscha helfen, der mir Wasser zubereitet, der betet zum Wasser und ich trinke dann aus den Fläschchen. Das kostet halt aber auch viel Geld! (…) „…wenn ich dort unten sage, ich habe eine Depression oder so was dann lachen die mich aus….So was gibt es nicht! (laut) Nur ein paar Schläge helfen, und dann gehst du aber arbeiten (noch lauter).“ Ihre Familie (Mutter, Tante) lässt sie mehrfach von einem Hodscha behandeln. Die Biographin lässt die Behandlung über sich ergehen, wie auch die medizinische Behandlung mit bis zu acht Tabletten pro Tag. Sie lehne sich nicht mehr dagegen auf. Sie habe keinen Willen mehr. „Ich weiß ja gar nicht mal mehr, wohin ich gehöre, hier.. da.. dort und und und (….) wer bin ich eigentlich, Hr. Masanz?“ Sie resümiert, dass es ihr eh alles egal sei. „Die sollen mir doch noch 10 Tabletten verordnen. Dann esse ich die eben auch noch. Ist doch egal!“ Insgeheim ist der Biographin nicht bewusst, in welcher Kultur sie verortet ist, wohin sie gehört. Sie pendelt zwischen zwei Welten und weiß nicht, ob sie verflucht ist oder krank, wie das die Deutschen sagen. „Ich weiß es einfach nicht (…) Ich weiß nicht, was ich glau-ben soll. Ich weiß nicht was ich denken soll!“ 441
Die Biographin ist von den Erlebnissen und Erfahrungen geprägt und wird überwäl-tigt, dass über ihren Kopf hinweg, die Eltern, die Mutter, das Jugendamt, der Richter, Arzt, Betreuer entscheiden, wie sie betreut wird, welche Medikamente sie zu nehmen hat, wo sie zu leben habe. „Der Betreuer sagt, wohin ich muss, in welches Heim. Dort sagt man mir, was ich machen muss, um Ausgang zu bekommen. (….) ich sags Ihnen, das hört nie auf!“
Fr. Satic scheint in einem endlosen Ambivalenz-Kreislauf festzustecken, denn auch hier schätzt sie die Polizei und das Gericht, die sie auch schon geschützt haben vor ihren Peinigern oder dem prügelnden Stiefvater. Gleichzeitig wurde auch der Mann ihrer Mutter zum 2. Mal „weggenommen“.
Die Biographin schließt die Interviews mit einer Anekdote zu ihrer ausgeprägten To-dessehnsucht ab. „Vor etwa zwei Jahren hat ein Freund behauptet, die Welt gehe unter an irgend so einem Datum. Ich war so froh! (lacht schrill und laut auf, kann sich lange nicht beruhigen) Ich war so froh, endlich geht sie unter! Dann ist es später geworden, dann Abend. Ich war dann plötzlich so wütend, ich habe ihn ange-schrien, bin auf ihn los, dass sie am Abend immer noch da war! Die war an diesem Abend immer noch da!“ (sehr laut) Sie sehne den Tod herbei, sie wisse mit ihrem
441 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 7, Zeile: 201-221.
271
Leben doch nichts anzufangen. Denn ihr sei so langweilig! Sie sei so satt vom Leben. „Wenn mir doch nur was mit meinem Kopf passieren würde! Sich zu suizidieren werde sie niemals…denn dann komme ich sicher direkt in die Hölle! Weil Gott ent-scheidet, wenn er das Leben beendet! Ich bin kein religiöser Mensch und so…in Kir-che gehe ich gar nicht (…) aber das ist so! Glauben Sie mir!“442
Die Biographin hebt hervor, dass sie die Medikamente eigentlich grundsätzlich ab-lehne, da sie so stark an Gewicht zugenommen habe (…) ständig müde sei und schla-fen wolle, ihre Haut werde pickelig und großporig (…) ihre Kleider passen nicht mehr, sie gehe auf wie eine Dampfnudel auf (….) schauen Sie mich doch mal an, wie ich aussehe! (laut)443
Fr Satic spricht in den Interviews mit hohem Tempo, sie holpert, poltert, überschlägt sich an manchen Textpassagen. Sie erzählt, wie eien Getriebene, so dass sie am Ende eines jeden Feldes, über das sie gerade berichtet, beschreibt, argumentiert oder davon erzählt, ihre Stimme in den bedeutsame Themen immer lauter, anklagender, aggres-siver und vorwurfsvoller wird. Themenfelder, in denen sie sich in einem szenischen Präsenz präsentiert, sind z. B. Gewalterfahrungen bei der Flucht, Gewalterlebnisse durch den Steifvater und durch den Partner, Ambivalenzen gegenüber den fremdbe-stimmten professionellen Hilfen, Erinnerungen an die Flucht oder die Ankunft in Deutschland sowie Beziehungserfahrungen im sozialen Nahraum. Der Verlauf der Erzählungen, in denen sie eine Erinnerung, Erfahrungen, ein Bild oder Erlebnis wi-dergibt, baut sie wie die Flugbahn einer Kugel auf, die schon zu Beginn schnell an Geschwindigkeit und Dynamik aufnimmt, sich dann in der weiteren Bahn zu einem kumulativen Punkt erhebt, an dem die Biographin teilweise aufsteht, schreit, einen starren Blick bekommt, mit den Händen droht und es dann allmählich zu einem Ab-sinken an Intensität, Dichte und Aufladung, bis hin zur Erschöpfung und Entspan-nung kommt. Die Biographin ringt an den Stellen mit hoher Indexikalität nach Luft, fasst sich an diesen Stellen immer wieder an den Hals.
6.3.3.1. Hypothesenbildung zum erzählten Leben
Es kommt sowohl auf der physischen Eben wie auch auf der Ebene der Identitäten zu einem Transformationsprozess des Fremd-Werdens, den die Biographin als nicht mehr zu ihr zugehörig und inkongruent erlebt. Durch traumainduzierende Fluchter-lebnisse und den plötzlichen Verlust des Vaters entwickelte die Biographin im Zuge der ersten kinder- und jugendpsychiatrischen Behandlung eine Fixierung auf den be-handelnden Arzt, den sie in dem Moment zu stalken beginnt, als er ihr offenbart, die Klinik zu verlassen, um eine eigene niedergelassene Facharztpraxis zu eröffnen.
Die unterstellte Bindungsunfähigkeit stellte ein für die Biographin leitendes Hand-lungsmotiv dar, so fühlte sich die Biographin stets angespornt, um ihrer Mutter zu beweisen, dass sie sehr wohl Beziehungen eingehen und führen kann. Sie will ihr beweisen, dass sie bindungsfähig ist und geht dafür auch gewaltsame, destruktive Partnerschaften ein, in denen sie seelische und körperliche Gewalt wieder und wieder
442 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 8-9, Zeile: 248-275. 443 Falldarstellung 3, Interview 2, S. 9, Zeile: 276-293.
272
erlebt. Doch die Angst davor, alleine zu sein, ist so groß, dass sie durchgehend Partner auswählt, die über sie bestimmen, über sie verfügen wollen, sie als Objekt betrachten.
Die Biographin beschreibt sich in ihrer Selbstkonstruktion als jemand, der zerstört, der kaputt macht, der nichts aufbauen oder entstehen lassen kann. Dafür sei sie nicht geschaffen. Damit bestätigt und bestärkt sie im Sinne einer Self Fullfilling Prophecey schon weit im Vorfeld den Ausgang ihrer Unternehmungen und Handlungen. An die-sem Punkt der Einschätzung präsentiert sie eine Gemeinsamkeit mit der Falldarstel-lung 1 (Hr. Grün), in dem sie sich selber als eine Versagerpersönlichkeit attestiert, die mit einem massiv selbstdestruktiven life-script ausstaffiert ist, in dem nichts ge-lingen kann, ja, darf, oder vielmehr, in dem Gelingen, nicht erlaubt ist.
6.3.4. Fallspezifische Interpretation und Rekonstruktion der Fallgeschichte
Die historische Einbettung des biographischen Verlaufs steht in einem engen Kontext zu einem lange vor sich dahinköchelnden ethno-religiösen Konfliktes, der im Zuge einer Verlaufskurve, die Biographin in ihrer gesamten Identität, in ihrer kulturellen wie auch nationalen Zugehörigkeit und schließlich innerhalb ihrer Bindungserfahrun-gen hinfortreißt.
Wie entscheidend die sozialen Wirklichkeiten und damit auch die Familiengeschichte nach 1918 durch die weit zurückliegenden ethnischen und religiösen Konflikte und Diskriminierungen geprägt sind, geht bereits auf die Besetzungen des serbischen Ge-biets durch die Türkei im 14. Jh. Zurück, die vor allem mit dem Krieg im Jahre 1991 wieder reaktiviert wurden. 1918 wurde hier ein Gebiet zu einem Staat, zunächst unter dem Namen, Königreich der Serben, der Kroaten und Slowenen, zusammengefügt, das noch die weiteren Volksgruppen der bosnischen Muslime, der Montenegriner, Makedonier und weitere nichtslawische Minoritäten umfasste und das aus den so un-terschiedlichen Regionen der unabhängigen Königreiche Serbien und Montenegro, sowie Gebieten der österreichisch-ungarischen Monarchie und des Osmanischen Rei-ches bestand.444
Die Fallrekonstruktion verdeutlicht, dass gerade die Dethematisierung traumatischer Erlebnisse zum einen als Folge ihrer Traumatisierung selbst gesehen werden muss, zum anderen ist sie der hoch ambivalenten Beziehungsdynamik zwischen der Bio-graphin und ihrer Mutter geschuldet, die sich wechselseitig von den qualvollen Erin-nerungen zu schützen suchen. Zugleich bildet dadurch, die Mutter und die Biogra-phin, eine auf die Vergangenheit hin ausgerichtete „verschworene“ Gemeinschaft, wohingegen die jüngere Tochter, die keine Erinnerungen an die Flucht mehr hat, eine in die Zukunft gerichtete und auf Entwicklung basierende Gemeinschaft mit der Mut-ter bildet.
Die Konstruktion der psychischen Erkrankung verortet die Biographin, wenn auch mit Zweifeln, in eine transkulturelle Deutungswelt hinein, die in ihrer muslimisch-bosnischen Herkunftswelt weder existiert, noch anerkannt ist. Sie greift immer wie-der auf Behandlungen durch einen Hodscha zurück (bosn. Hodza), der durch rituelle Gebete und Handlungen, z.B. heilendes Wasser zubereitet, von dem die Biographin 444 vgl. a.a.O. Calic M. (1996): S. 13.
273
in homöopathische Dosierungen zu trinken habe. Am Ende des 2. Interviews riss an manchen Stellen der Erzählfluss plötzlich und abrupt ab und die Biographin blieb in sich tief- und gedankenversunken, starr, auf dem Sofa sitzen. Auf die Nachfrage hin, was sie denn jetzt gerade in ihrem Kopf denke, was sie gerade erlebe, deutete die Biographin ihr monokausales Krankheitsverständnis an, dass sie heute Ängste und Panikgefühle habe, da sie ihren Vater verloren habe. Die Biographin schreibt ihm einen allmächtigen Einfluss, Wirkung und Schutzfunktion zu, denn er hätte, wäre er noch am Leben, niemals zugelassen, dass seine Tochter krank werden würde. Sowohl dem Vater, als auch den Hodschas oder ihren Partnern überträgt die Biographin wir-kungsvolle und heilende Einflüsse. Die Biographin gestehe im ersten Interview die bisher verheimlichte Verbindung und Präsenz des Vaters: „ (…..) er gibt mir heute noch verschieden Zeichen, das erlebe ich wirklich, das ist keine Psychose, ich sage aber nicht, wie er das macht, er ist aber dann da, auch jetzt gerade, und ich fühle mich dann sicher.“ 445
Nach dem Entwicklungsstufenmodel von PIAGET ist das magische Denken im Sta-dium der präoperationalen Phase verortet und stellt die Vorstufe des rationalen Den-kens dar. Es zeigt sich z.B. in der Form des Glaubens an Wirkungen von Zauberei, von Wunschdenken oder Beschwörungen. Das Kind geht davon aus, es existiere eine übernatürliche Fernwirkung, wie das die Biographin dem Vater zuspricht, Gegen-stände könnten Eigenschaften ihrer Besitzer übertragen oder man könne die Außen-welt durch Worte, Formeln, Sprüche oder bloße Gedanken beeinflussen, wie das mehrfach durch Hodschas versucht wurde. Bestimmte Menschen werden in diesen Stufe übernatürliche Kräfte zuerkannt, wie das die Biographin fixierend gegenüber ihrem zweiten Partner zubilligt.
Wie auch in der Herkunftsfamilie der Biographin, für die der muslimische Glaube keine Bedeutung für den Alltag einnimmt und auch nicht gelebt wird, so stellt VOLKAN (1999) fest, definierten sich vor dem Krieg fast 2/3 der muslimischen Bos-nier oder bosnischen Muslime als säkular und so nahmen entsprechend nicht einmal 3% an den Gebeten in der Moschee teil.446
Kinder und Jugendliche, die als bosnische Flüchtlinge, den Bürgerkrieg erlebt haben, wie das auch auf die Biographin zutraf, wirken äußerlich stabil, im Bereich der in-nerpsychischen Repräsentanzen. Sie zeigen zwar Hinweise auf erfolgte Traumatisie-rungen, charakteristisch bei diesen betroffenen Kindern ist, dass sie nicht direkt mit einem Symptom auf Traumatisierung reagieren, sondern, dass vielmehr eine pseudo-resiliente Entwicklung die schwerwiegenden psychischen Folgen überdeckt. 447
Die Fähigkeit zur Kompensation verhindert oder begrenzt zumindest ein Evident-Werden der gesamten Symptombildung. Die Schwester der Biographin über nimmt hier eher eine stabilisierende-mediative und aus gleichende Rolle in der Familie ein. Als jedoch durch wiederkehrende massive Gewalteskapaden des neuen Stiefvaters eine Auflösung und Beschädigung der gesamten Herkunftsfamilie drohte, wurde die
445 Interview 1. Falldarstellung 3, S.:3 Zeile: 72-91. 446 Volkan, V. D. (1999): Das Versagen der Diplomatie. Zur Psychoanalyse nationaler, ethnischer und religi-öser Konflikte. Psychosozialer Verlag.Gießen, S.: 90. 447 Lorenzer, A., Thomä, H. (1965): Über die zweiphasige Symptomentwicklung bei traumatischen Verläufen Psyche. Z. Psychoanal, 18 S.: 674-684.
274
Biographin selbstwirksam initiativ, zeigte ihren Stiefvater an, der schließlich wegen Kindeswohlgefährdung und Körperverletzung aus dem Land und somit vollständig aus dem Gesichtsfeld der Familie verwiesen wurde.
„Mit Mutter und ihrem tollen Freund hatte ich immer Streit, sie hat ihn sogar gehei-ratet! (schnell) Er hat mich fast totgeschlagen, meine langen Haare abgeschnitten, überall Blutergüsse (zeigt am Körper, wo diese waren), da, da, da, da ….ich wurde krankennhausreif geschlagen.. und Mutter war auch Zeuge der Gewalt! …sie hat nichts gemacht nichts(..) ab da hab ich richtige Angstzustände bekommen (sehr laut-schreit und steht vom Sofa auf).“448
Einerseits gibt es hier Hinweise bei der Biographin für eine große Ich-Stärke, gleich-zeitig kommt es zu einer umfassenden Vernachlässigung anderer Entwicklungsberei-che. Gerade bei Themen, die enge Beziehungen und damit mögliche Verluste und Beendigungen betreffen, wie z. B. der Ablöseprozess in der Pubertät, die Entwick-lung einer intim-romantischen Partnerschaft oder bei der Familiengründung, können komplexe Schwierigkeiten auftreten, die sich schwer als Traumafolge erkennen las-sen. Insgesamt kommt es dann aber zu einer ungünstigen Persönlichkeitsentwicklung, die sich nach und nach verfestigt und ausdifferenziert.449
Die Biographin sieht sich als chancenlos, sie betrachtet sich im Gesamten als Opfer, die machtlos ihrer Umwelt, ausgeliefert ist. Sie erkennt keine Veränderungsoptionen, somit auch keine innere Bereitschaft und Motivation in sich. Sie kann nicht zulassen, dass sie etwas an ihrer bisherigen Einstellung und ihren Handlungsstrategien verän-dern oder gar überdenken könnte.
Alle Konflikte, die die Biographin mit ihrer Mutter, ihren Partnern, Freundinnen, den professionellen Helfern oder der gesetzlichen Betreuerin austrägt, alle zwischen-menschlichen Schwierigkeiten werden nach außen projiziert. So kommt es bei der Biographin zu einer exklusiven Fremdattribuierung der eigenen Wohn-, Lebens-, Be-schäftigungs- und Gesundheitssituation, die sie an äußeren Faktoren und Einflüssen festlegt und somit unerschütterlich determiniert. Somit kam es auch über Jahre hin-weg nicht zu einer Thematisierung der Traumatisierung. Das wiederum führte zu ei-ner gestörten Persönlichkeitsentwicklung, die über die Jahre fortschreiten und sich ausdifferenzieren konnte.
Sie hat das Gefühl von durchdringender und konstanter Heimatlosigkeit450 und Ein-samkeit, sie erlebt sich als Außenseiterin, die sich danach sehnt, dazu zu gehören, zu einer Gruppe, zu einem gesellschaftliche Bezugspunkt, zur Familie, zur Welt. Die Biographin fühlt sich unvollständig, alleine. In ihr erlebe sie nur Einsamkeit, Wut und Frust oder Leere. So gerät sie immer wieder in Panik und sorgte dann wieder durch selbst auslösende Ereignisse, dass sie sich wieder spürt und als Mensch erlebt. Sie initiiert einen Feuerwehreinsatz, verstößt gegen Ausgangsvereinbarungen, kehrt al-koholisiert oder unter Drogeneinfluss zurück. Mal muss sie gefahndet werden, dann
448 Interview: 1. Falldarstellung 3. S.: 2. Z: 76-98. 449 vgl. a.a.O. Lennertz S.: 358. 450 vgl. Int. 1, Falldarstellung Nr. 3, S. 6, Zeile: 177-200. „..ich bin ohne zuhause, heimatlos.. egal wo ich bin und auch hingehe, schon will ich wieder zurück ich will überall weg“
275
versteckt sie sich und muss dann nach langem Zureden bei Bekannten abgeholt wer-den.
Die Biographin hebt hervor, dass sie nur einmal im Leben den Zustand von Glück erleben möchte, gleichzeitig weiß sie nicht, ob sie das Gefühl überhaupt erkennen kann. Die Schluckbeschwerden, die die Biographin bis heute begleitet, stehen für eine grundlegende Lebensangst. Sie kann sich das Außen, das lebensnotwendig ist, nicht einverleiben, so wird Essen oder Flüssigkeitsaufnahme zu einer Tortur, die sie ohne Genuss und Maß aufzunehmen hat.
„Ich bin vom Teufel besessen und verflucht, überall bin ich rausgeflogen, aus allen Einrichtungen und Heimen….der Hodscha hat gesagt, ich sei verflucht, ich weiß net, ob ich verflucht bin oder ob ich krank bin, wie das die Deutschen sagen.“451
6.3.5. Typenbeschreibung und Typenbildung
Bei der Biographin handelt es sich um den sogenannten strukturoffenen, fragmentier-ten-Bindungs-Typ, Typ C, der ähnlich wie Typ A, B und D, in kurzer Zeit durch Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen transinstitutionalisiert wird und zu einem frühen Zeitpunkt durch schlechte schulische Leistungen und Abwesenheiten, sowie durch Auffälligkeiten im Sozialen und im Verhalten auf sich aufmerksam macht. Weitere spezifische Merkmale können, eigen- oder fremdaggressive Handlungen, deviantes bis hin zu kriminellem Verhalten sein. Es folgt dann die Rückmeldung, nicht mehr in der Herkunftsfamilie gehalten werden zu können. Sobald der Typ C, ein Plateau in einem maximal hochstrukturierten Betreuungs- und Behandlungsrahmen erfährt, kommt es zwar vorerst zu einer schnellen Stabilisierung und Beruhigung in Form einer pseudo-sicheren-Bindungs-Präsentation, die der Biographie-Typ gegenüber den professionellen Helfenden eingeht und dabei einzelne Helfer zum Fokus der ei-genen Wünsche, Bedürfnisse und Ungerechtigkeiten ausgewählt. Im Gegenzug kom-men die Helfenden häufig in einem verfrühten Sinne zu der zielsetzenden Idee, eine anschließende und weiterführende Einrichtung bzw. eine Vermittlung in ein weniger strukturierendes Setting sei nun indiziert, ohne dass es zu einer ernsthaften und nach-haltigen Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der Selbstverantwortung, der Motivation, der Behandlungscompliance und der Hilfeannahmebereitschaft gekom-men ist.
Im Gegensatz zum Typ B kann sich dieser Typ für eine mittelfristige Episode von 6 -12 Monaten auch in einem weniger strukturierten Betreuungs- und Behandlungsrah-men behaupten, erfährt jedoch gleichzeitig einen sukzessiven Krisenverlauf, der wie-der eine Zurückstufung auf das ursprüngliche Plateau (z.B. geschlossenes Heim, psy-chiatrische Klinik oder Maßregelvollzug) zur Folge hat. In der gesamten Entwicklung ist beim Typ C in der Prognose davon auszugehen, dass er dauerhaft in einer hoch-strukturiert-kontrollierenden und nachgehenden Institution zu halten sei. Die Einrich-tung muss mit einem perpetuierenden Widerstand, Konflikten und Provokationen als Teil seines Verhaltensrepertoires rechnen, das er sich prägend als Handlungs- und Überlebensstrategie aneignet.
451 vgl. Int. 1 Falldarstellung: 3, S. 7, Zeile: 201-221.
276
In der Selbstkonstruktion des Zukünftigen erkennt dieser Typ nur geringe Verände-rungsmöglichkeiten. Der Einfluss auf ein aktives und selbstwirksames Einwirken auf alternative Verhaltensoptionen wird häufig erst gar nicht wahrgenommen oder für möglich erachtet. Entsprechend ist die Hilfeannahmebereitschaft erheblich geprägt durch subkulturelles Verhalten452 und einer Fremdattribuierung auf andere Personen, die exklusive mit einer Retter-Rolle etikettiert werden und denen phasenweise, schicksalhaft, die Verantwortung übertragen wird, die die Biographin dann dorthin vollständig abgibt. Die Aussicht auf Selbstbestimmung gerät so in unerreichbare und unrealistische Ferne für die Biographin.
Die Idee der Selbstbestimmung, so BIERI (2014), wird noch komplexer, wenn es demnach nicht mehr nur um die Unabhängigkeit gegenüber anderen geht, sondern vielmehr um die Fähigkeit, über sich selbst zu bestimmen. Es geht also in der Ausei-nandersetzung mit dem Feld Selbstbestimmung weniger darum, über das eigene Le-ben Regie zu führen, indem ich mich gegen die „Tyrannei der Außenwelt“ wehre. Im sozialpsychiatrischen Arbeitsfeld können z.B. psychiatrisch-forensische Instituti-onen, geschlossene Heime, gesetzliche Betreuungen, Geldverwaltung oder Bewäh-rungsauflagen als „Tyrannei der Außenwelt“ stellvertretend erlebt werden. Im Dis-kurs der Selbstbestimmung geht es vielmehr darum, in einem erweiterten Sinne, Subjekt meines Lebens zu werden, indem ich Einfluss auf meine Innenwelt nehme. Das heißt, auf die Dimension meines Denkens, Wollens und Erlebens, aus der sich heraus meine Handlungen ergeben, Einfluss zu nehmen. Im Gegensatz dazu, kann es auch dazu kommen, den eigenen Willen als Leben wahrzunehmen, das einem nur zustößt und von dessen Erleben der Mensch wehrlos überwältigt wird, so dass statt von einem Subjekt nur von einem Schauplatz des Erlebens die Rede sein kann. In diesem Erleben läuft der Mensch Gefahr, seine persönliche Identität nicht in seine Lebensgeschichte einbetten zu können. Er erlebt vielmehr einen Prozess des Fremd-werdens auf unterschiedlichsten Ebenen der eigenen Identität, wie RIEMANN (1984) das beschrieben hat. Der Typ C präsentiert sich selbst als jemand, der in der Struktur seiner Zeit, in der Struktur des Wohnraums und insbesondere in der Struktur der sozialen Beziehungen sowie in der Struktur seines in die Zukunft gerichteten Handelns grundsätzlich und umfänglich einen Hilfe- und Unterstützungsbedarf aufweist und aufrechterhält. Im Gegensatz zu den anderen drei Typen erlebt er sich im Eingebundensein einer Ver-laufskurve, die die auf ihr einwirkende Exklusion durch eine Entfernung aus der Her-kunftsfamilie, eine frühzeitig initialisierten Institutionalisierung und Medikalisie-rung, eine Fragmentierung, sowohl bezogen auf die psychische, emotionale wie leibliche Identität potenziert und sie in der Thematisierung bzw. Dethematisierung der Selbstpräsentation bestimmt.
452 Begriff aus E. Goffmanns „Asyle“-Über die soziale Situation von psychiatrischen Patienten und anderen Insassen (1972), der das „Unterleben“ als spezielle Technik bei Insassen von psychiatrischen Institutionen und anderen totalen Institutionen verstand, die denen sich die Insassen im Zuge einer Doppelfunktion vor einer Zerstörung der Identität zu bewahren versuchen. Einerseits passen sie sich nach außen hin der Insassenrolle der Institution an, bewahren „ruhig Blut“, andererseits entwickeln sie eine Form der „sekundären Anpassung“ (Subkulturelles Verhalten), in der sie halboffizielle Verhaltensweisen entwickeln, räumlicher Reservate bean-spruchen, um einen Rest an Identität zu bewahren.
277
Der Typ C ist in einer ambivalenten Dauerschlaufe verhaftet, einerseits leistet er ak-tiven bzw. passiven Widertand und Gegenwehr gegen das hochstrukturierte Betreu-ungssetting, gleichzeitig gesteht er sich ein, dass es genau der Rahmen ist, in dem er sich stabilisieren, u.U. entwickeln und gedeihen kann. Es ist der Rahmen, der Schutz, Struktur, Sicherheit und eine zuverlässige menschliche Auseinandersetzung anbieten kann.
„Sie werden lachen, Hr. Masanz, am besten ging es mir im geschlossenen Wohnheim, da war ich 2 mal… ich bin traurig, dass die Zeit vorbei ist, aber ein Leben lang ge-schlossen geht auch nicht.. oder? Da lief alles korrekt ab, da hab ich viel gelernt, anfangs war ich ja schon dagegen, aber es hat mir viel gebracht.“453
6.4. Vierte Falldarstellung: Herr Noller
„Fühle mich nichtig in eigener Gestalt, so lieh ich mir manch andere (…) mein Leben war ein Spießrutenlauf. Da ich nicht schlagen konnte, lief ich. Bald ist man daran gewöhnt.“
Von Alexander März454
6.4.1. Einführung und Kontextklärung
Wenige Tage vor der Eröffnung der geschlossenen Einrichtung, für die ich die Ein-richtungsleitung 2011 übernommen hatte, fuhr ich mit einem Kleinbus bis wenige Kilometer über die baden-württembergische Landesgrenze, wo sich auf einer Anhöhe ein großes psychiatrisches Pflegeheim befindet, das nach Auskunft der Sozialverwal-tung der Stadt Stuttgart annähernd 65 Stuttgarter Bürgerinnen versorge und betreue, die nach § 1906 BGB, wegen Eigengefährdung geschlossen untergebracht seien. Zu einem Großteil handelte es sich um Klienten der Altersgruppe 25-35 Jahren und von 50-60 Jahren. Im Vorfeld kam es bereits zu zwei Telefonaten mit Hrn. Noller, dem ich ein Platzangebot unterbreitete und eine Rückkehroption in Aussicht stellte. Nach genauem Nachfragen, ob er denn gewiss auch ein Einzelzimmer haben werde, wil-ligte er und auch seine gesetzliche Betreuerin, die auch für die Aufenthaltsbestim-mung verantwortlich war, einem Umzug ein. Bei der ersten persönlichen Begegnung im Raucherzimmer des Pflegeheims, eröffnete mir Hr. Noller unaufgefordert und in Zeitraffer einzelne Fragmente seiner Biographie. Dabei erwähnte er zum einen, dass er hier eigentlich auch bleiben könnte, eigentlich sei es ihm egal, wo er sei, zum an-deren berichtete er mir nun unvermittelt, dass er ja schon als kleiner Junge in Kliniken und Heimen lebe und er es nicht anders kenne, ja, daran gewöhnt sei. Er zeigte sich nunmehr im Verlauf des Gesprächs zunehmend unentschlossen, gleichgültig, wog trotz der gepackten Taschen nochmals ab, wie er denn nun davon profitiere, wenn er wieder zurück nach Stuttgart ziehe. Ob er dann dort wohl einen hören Barbetrag be-käme? Wird er mit eher jüngeren Mitbewohnern und nicht mehr mit Pflegebedürfti-gen und Dementen zusammen leben? Der Barbetrag bleibe gleich, der Altersdurch-schnitt war im ersten Halbjahr des Heimbetriebs Anfang 30, eine Pflegebedürftigkeit war ein Leistungsausschlusskriterium für eine Aufnahme. Hr. Noller berichtete, dass er den Erzählungen nach, lange Zeit in einer Kinderklinik behandelt wurde. Daran
453 Interview 2. Fall: 3. S.: 1. Zeile: 1-14. 454 Kipphardt, Heinar: März. Rororo. 14. Aufl. 2001 Hamburg, S. 64
278
habe er aber keine Erinnerungen. Dann sei er durch viele „Hände“ gegangen; zu-nächst durch eine Inobhutnahmestelle, dann eben eine Kinderabteilung der Uniklinik, eine Pflegefamilie, ein SOS Kinderdorf, ein Kinder- und Jugendheim, ein Jugend-heim und schließlich sei er im Betreuten Jugendwohnen gewesen. Eigentlich habe er nur die ersten zwei bis drei Jahre mit seiner Familie bzw. mit seiner Mutter und sei-nem um ein Jahr älteren Bruder gelebt. Dummerweise könne er sich gerade daran aber nicht mehr erinnern. Das sei sehr traurig, aber so sei das in seinem Leben. Er sei noch nie ein Glückspilz gewesen.455 Der Biograph, Hr. Noller suchte während der gesamten Betreuungszeit häufig Kontakt mit mir und kam mehrere Male am Tag mit seinen Anliegen ins „Heimleitungsbüro“. Hr. Noller forderte eine höhere Geldaus-zahlung ein, zudem beabsichtige er die Medikamente zu reduzieren oder abzusetzen. Er forderte mehr und längere Ausgangszeiten und er wünsche sich wieder in den Haushalt seiner Mutter zurückkehren zu dürfen, da es seine Mutter schließlich auch verlange. Manchmal bat er auch einfach darum, dass ich in sein Zimmer komme, um einen neuen Song, den er aktuell hörte, vorzuspielen oder um zu zeigen, wie sauber und ordentlich er sein Zimmer aufgeräumt habe.
Als ich ihn dann erstmals zu meinem Vorhaben ansprach, eine wissenschaftliche Ar-beit zu schreiben und hierfür umfangreiche Interviews über Biographie- und Famili-engeschichten einzelner Klienten führen und ich auch gerne ihn dabei haben möchte, reagierte der Biograph anfänglich sehr verhalten, skeptisch und zögerlich. Er hörte sich lediglich meine Ausführungen an, stellte auch keine Verständnisfragen. Viel-mehr berichtete er mir, dass er schon häufig über sein Leben in sogenannten Gut-achtersituationen Auskunft geben musste oder auch in den Kliniken, in Heimen, in den beschützten Werkstätten, vor Gericht usw. Er wolle sich die Zusage noch über-legen. Selbst der in Aussicht gestellte Media-Markt Gutschein war für Hrn. Noller kein Ansporn seine Teilnahme zuzusagen. Ich ließ Hrn. Noller vier Wochen Bedenk-zeit und in Ruhe, um darüber zu entscheiden. Dann meldete er sich bei mir und stellte überraschend die Forderung und Bedingung, einen umfangreichen Ausgang zuer-kannt zu bekommen, dann wäre er auch bereit teilzunehmen. Ich hob erneut Hrn. Noller gegenüber hervor, dass es sich hier um eine freiwillige Teilnahme, ohne Be-dingungen handele. Ich versicherte ihm nach den bestehenden Datenschutzrichtlinien vorzugehen und mit seiner Identität, mit den erwähnten Orten, seiner Lebensge-schichte anonymisiert umzugehen. Die aufgenommenen Interviews werden transkri-biert, die Fassungen an Hrn. Noller ausgehändigt. Er könne dann noch Stellen strei-chen, die nicht erfasst, berücksichtigt und unerwähnt werden sollen. Eine endgültige Abschrift der Transkription wird in Papierform und als Hördatei auf CD ausgehän-digt. Nach Beendigung der Arbeit, sicherte ich auch Hrn. Noller schriftlich zu, alle Daten zu löschen und entsprechend zu vernichten. Darüber hinaus habe ich ihn nicht als Heimleiter, sondern in der Rolle und Funktion eines Interviewers angefragt, der sich im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit mit dem Thema Biographien von Menschen, die psychisch krank, suchtkrank und wohnungslos sind, beschäftigt. Ich signalisierte Hrn. Noller, dass ich mich nicht erpressen lassen kann und werde. Die Ausgangsvereinbarungen der Einrichtung, der ich vorstehe und verantworte, stünden in erster Linie in Zusammenhang mit seinem aktuellen gesundheitlichen Status, der
455 Dokumentationseintrag im elektronischen Behindertenhilfeassistenten BA. Eintrag am 27.9.2011, am Tag der Aufnahme von Hrn. Noller ins Wohnheim.
279
aktuellen Behandlungsentwicklung, seinem Abstinenzverhalten von Drogen und Al-kohol und dem Verhalten in der laufenden Woche gegenüber den Mitbewohnern und den Mitarbeitenden.
Erneut verstrichen mehrere Wochen. Der lange Weg des Aushandelns konnte endlich abgeschlossen werden und Hr. Noller sagte zu. Das erste Interview fand in seinem Zimmer statt. Ein Ort außerhalb der Einrichtung konnte aufgrund einer aktuell beste-henden Ausgangssperre nicht angeboten werden. Hr. Noller befand sich im ersten Interview in einem gesundheitlich schlechten Zustand. Als er dann wenige Wochen darauf wegen fremdaggressiven Verhaltens gegenüber Mitarbeitenden gekündigt und in ein psychiatrisches Pflegeheim weit außerhalb von Stadt verlegt wurde und ein zweites Interview mit mir führte, machte der Biograph auf mich hingegen einen sehr stabilen, aufmerksamen, konzentrierten und geordneten Eindruck. So gut, wie ich ihn noch nie erlebt hatte.
Der Biograph zeichnet sich in Gegensatz zu den anderen drei Biographen dadurch aus, dass er fast durchgängig seine Kindheit in unterschiedlichen Kinderund Jugend-heimen und somit außerhalb der familiären Herkunftsstrukturen verbracht hat. Der Einfluss bzw. die Wechselwirkungen zwischen der gesundheitlichen Entwicklung und dem Aufwachsen in Heimen, in den spezifische Verhaltens- und Handlungsstra-tegien entwickelt und sich angeeignet wurden, soll im folgenden Exkurs berücksich-tigt werden.
6.4.1.1. Exkurs: Heimkinder und Gesundheit
In einer Studie von SCHMID wurden 689 Kinder-, und Jugendliche in Heimen er-fasst. Durch eine Erhebung der Vorgeschichte und der Herkunft wurden bei 60% der Probanden klinische Diagnosen aus dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie festgestellt. Fast 1/3 dieser Heimkinder ist so schwer gestört wie nur 2% der Kinder der Allgemeinbevölkerung, dabei waren die Störungen selbst häufig der Aufnahme-grund. LEMPP hebt hervor, dass entgegen der gesetzlichen Grundlage, fuße die Maß-nahme nach § 27 SGB VIII auf eine Intervention der Erziehungshilfe. Wenn es aber bei fast der Hälfte dieser Kinder und Jugendlichen eine, als psychische Störung, de-finierte Abweichung von der Norm festzustellen war, dann müsste von Heimtherapie und weniger von Heimerziehung gesprochen werden. Es müssten kinder- und jugend-psychiatrische Angebote, Psychotherapie unter Umständen auch medikamentöse Therapie selbstverständlich zur Anwendung kommen.456
Der Kinder- und Jugendpsychiater Stefan HERZKA hat einmal eine Gegenüberstel-lung von Psychotherapie und Pädagogik vorgenommen: „Das psychoreaktive er-krankte Kind braucht Psychotherapie weil es krank ist- und es braucht Pädagogik weil es ein Kind ist!“
456 Lempp, R.: Die seelische Behinderung bei Kindern und Jugendlichen als Aufgabe der Jugendhilfe. 4.Aufl. Stuttgart. Boorberg
280
Kinder in der stationären Jugendhilfe sind schon durch die Definition der Indikatio-nen für eine Heimerziehung, während ihrer gesamten Entwicklung kumulativen psy-chosozialen Risikofaktoren ausgesetzt und bilden eine Hochrisikopopulation für die Entwicklung und spätere Chronifizierung einer psychischen Störung. 457
Mit der Einführung des § 35a SGB VIII hat der Gesetzgeber erst 1991 die Hilfe zur Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, mit einer wesentlichen seelischen Behinde-rung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind, aus der Eingliederungs-hilfe in den Zuständigkeitsbereich der Jugendhilfe übertragen.458
2004 wurde jede 5. Heimunterbringung vorzeitig beendet, besonders bei psychischen und psychosomatischen belasteten Jugendlichen. Der häufige Wechsel der Betreu-ungsverhältnisse ist hoch problematisch einzuschätzen und als Negativindikator zu bewerten, wie das auch in der Falldarstellung bei Hrn. Noller der Fall ist, da diese häufige Wechsel von Bezugs- und Bindungspersonen die Bindungsproblematik der betroffenen Kinder und Jugendlichen eher verstärken und sich durch diese sich wie-derholenden Lernerfahrungen bei den Kindern ungünstige kognitive Schemata bzw. Introjekte verfestigen können, wie BRISCH das detailliert untersucht und beschrie-ben hat.459
Kinder und Jugendliche, die in stationären Jugendhilfemaßnahmen leben, waren und sind häufig belastenden psychosozialen Belastungen ausgesetzt, wie z.B.:
• sie entstammen aus zerrütteten Familienverhältnissen, mit häufig wechselnden Ehepartnern;
• es liegt eine psychische Erkrankung oder auch kombinierte Suchterkrankungen bei den Eltern(teile) vor;
• dauerhafte Konflikte werden zu Hause ausgetragen, ein Elternteil ist mit Erzie-hungsaufgabe überfordert;
• beengte Wohnverhältnisse liegen vor, Kinder haben nicht ausreichend Platz, für sich und zum Spielen, sie leiden unter zugestellten, ungepflegten Raumstrukturen;
• ein niedriger soziökonomischer Status liegt als schwerwiegender Belastungsfak-tor zugrunde460 (mangelnde Infrastruktur, wie z.B. Ärzte, Discounter, Bank, Post,
457 Schmid, M. (2007): Psychische Gesundheit von Heimkindern. Juventa-Verlag. Weinheim und München, S.: 17. 458 In der BRD leben ca. 77.000 Kinder und Jugendlichen nach § 34 KJHG in stationäre Maßnahmen (Heimen und betreuten Jugendwohnen) 29.602 Jugendliche wurden 2001 in Heime aufgenommen, ca. 25.000 Maßnah-men wurden 2003 beendet. (Quelle: Statistisches Bundesamt 2003. 2003 wurden insgesamt 4,8 Milliarden €von den Landkreisen und Kommunen für Hilfen und Maßnahmen nach § 27 KJHG ausgegebene, davon allein 3,2 Milliarden €, entspricht 66% Anteil für kostenintensive stationäre Maßnahmen und Hilfen. Pro Jahr belau-fen sich die Kosten pro Kind/Jugendlichen in Heimeinrichtungen auf durchschnittlich 36.700€. (Statistisches Bundesamt zitiert nach Hermsen, T. Roos, K. & Zinkl K. (2004): Forschung an/mit Fachhochschulen unter besonderer Berücksichtigung einer Effizienzuntersuchung in der Kinder- und Jugendhilfe. Paper presented at the Mainzer Werkstattgespräche. Mainz 459 Brisch K. H. (2002): Bindungsstörungen. Stuttgart. Klett-Cotta. S.: 277-298 460 Persönlich-generierte, berufliche Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse während mehrerer Praktika im Rahmen der Hausaufgabenhilfe in einem sozialen Brennpunkt für Kinder von 8-12 Jahren in Stuttgart, in einer Vorschule von 6-10 Jährigen und einer Tagesbetreuung für 10-14 für Kinder in Nürnberg, die in Wohngegen-den mit niedrigem sozioökonomischen Status wohnten, sowie aus meiner beruflichen Tätigkeit im Sozialpsy-chiatrischen Dienste Stuttgart -Bad Cannstatt- in Kooperation mit dem Jugendamt Bad Cannstatt in der Beglei-tung von Kindern von psychisch kranken Eltern in zwei Brennpunkten Stuttgarts.
281
Dienstleitungen in der Wohngegend), schlechte Anbindung mit öffentlichen Nah-verkehrsmitteln, weniger Grünflächen, geringer Wohnungsstandard (Ausstattung, schlecht isolierte, kalte, feuchte Wände, mangelnde Sanitärausstattung usw.)
• finanziell belastete Haushalte, Armut, Überschuldung, Pfändungen, Inkas-sobriefe;
• fehlende Spielflächen und Rückzugsorte für die Kinder, die gepflegt sind; • fehlende Tagesstruktur; • Arbeitslosigkeit in der Familie; • unausgewogene Ernährung, einseitiges, kalorienreiches Essen und Trinken; • Nahrungsaufnahme findet bei laufendem Fernseher, als Zentrum der Wohnung
statt; es gibt keine festen Essensstrukturen- mit Frühstück-Mittagessen und Abendessen;
• eine Atmosphäre von Angst und Gewalt, Bedrücktheit und Schweigen be-herrscht das Familienklima, die Kinder schämen sich wegen der Abhängigkeit des Vaters, der psychischen Erkrankung der Mutter oder der unordentlichen oder vermüllten Wohnverhältnissen;
• Kinder sind häufig unbeaufsichtigt, stundenlang, teils tagelang, weil Erziehungs-berechtigten auf Trinktouren gehen, wegen Überforderung plötzlich räumlichen Abstand von ihren Kinder(n) suchen und sich um keine verantwortungsvollen Ersatzpersonen kümmern;
• Kinder werden willkürlich körperlich bestraft, eingesperrt, mit Essens- und Trin-kentzug sanktioniert, an ihnen wird der Frust eines oder beider Elternteile als Blitzableiter abgelassen;
• das Kind wird sexuell missbraucht, oder es wird zur Penetration eines Elternteils missbraucht;
• Kinder werden misshandelt, sie sind verwahrlost, werden nicht gewaschen, Klei-der werden nicht gewechselt, das Kind besitzt kaum Kleidung;
• Kinder sind depraviert, werden nicht gefördert, auf das Leben neugierig gemacht interessiert, sie werden mit Fernsehen, Fast-Food, Medikamente, Süßigkeiten o-der Essen ruhig gestellt;
• es findet ein inkonsequenter, nicht nachvollziehender, strafender Erziehungsstil statt;
• traumatisierte Erfahrungen liegen zugrunde, Kinder sehen Filme und Videos über 18 Jahre, mit exzessiven Gewalt- und Sexszenen, Horrorfilme;
• Kinder spielen ohne Einschränkung an der Spielkonsole und am PC Spiele über 18;
• negative Bindungserfahrungen liegen vor, dysfunktionale Familiensysteme; • suchtkranke Eltern(teile) können die Rolle in der Familie nicht erfüllen, sie fallen
aus, es kommt zu einer, in der Bindungstheorie bekannten, sogenannten Rol-lenumkehr und Parentifizierung der Kinder, die sich früh um den funktionellen Erhalt des Haushaltsorganisation kümmern und sich verantwortlich sehen, sich um die Geschwister (helfen bei den Hausaufgaben, bringen diese zu Bett, kochen u.v.m.) zu kümmern oder um ihre kranken Eltern (z. B. kaufen sie Alkohol ein, putzen Erbrochenes weg, waschen die Wäsche), erledigen den Einkauf, kümmern sich um den Haushalt;
• mangelnde und fehlende soziale Unterstützung, soziale Isolation und Rückzug;
282
• pränataler Konsum von Alkohol, Nikotin und anderen Drogen stellt starken Risi-kofaktor für kognitive Entwicklung des Kindes und der körperlichen Konstella-tion dar. Studien gehen davon aus, dass mehr als 60% der Kinder in Kinderheime vernach-lässigt, körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht worden sind. Nach BALNDOW (1986) wurde bei 90% der untersuchten Mädchen in Heimen von sexuellen Übergriffen in ihren Herkunftsfamilien berichtet.
6.4.2. Gelebtes Leben –biographische Daten
1 1984 Geburt in X- Stadt /Kurpfalz, unehelich -Mutter: psychisch krank, Akademikerin; -unehelicher Stiefbruder (+1 Jahr)
1. Lbj.
2 1984 leibliche Vater (mit afrikanischer Herkunft, studierte auf dersel-ben Uni wie die Mutter des B.) verlässt die Familie kurz nach der Geburt
1. Lbj.
3 1985 Inobhutnahme durch das Jugendamt wegen seelischer und kör-perlicher Vernachlässigung, Biograph wird für 6 Monate in ei-ner Kinderabteilung eines Uni-Klinik behandelt Das zuständige Jugendamt übernimmt die Vormundschaft für Hrn. Noller
2. Lbj.
4 1985 Vermittlung in eine Pflegefamilie, von dort erfolgt der Umzug in ein ortsnahes SOS- Kinderdorf
2-10. Lbj.
5 1994 Aufnahme in einem Kinderheim, 400 Km entfernt vom Her-kunftsort
10. Lbj
6 1996 - Der ein Jahr ältere Stiefbruder schießt Biograph mit einem Luftgewehr in den Hals
12. Lbj.
7 1998-99 Wechsel von Realschule (9. Klasse) in die Hauptschule, B. erwirbt immer wieder eine Waffe, B. hat verstärkte Zwangs-gedanken, in der Schule einen Amoklauf durchzuführen
14.-15.
8 1998 - erster, fortan regelmäßiger THC- und Alkoholkonsum 14. Lbj. 9 2000 stat. Wohngruppe und Regelschulbesuch
B. hört auf, im Verein, Fußball zu spielen 16. Lbj
10 2001 Hauptschulabschluss mit der Note: 2,0 -Wechsel auf 2-jährige kaufmännische Realschule
17. Lbj
11 2002-04 Ambulant Betreutes Jugendwohnen B. erwirbt eine Waffe, nimmt sie mit in die Schule, kommt immer wieder an den Punkt, sich selbst zu erschießen oder Lehrer oder Mitschüler
16-20. Lbj.
12 2002 Schulverweigerung, dennoch Abschluss der Mittleren Reife, mit Note: 3,6 Biograph bekommt eine gesetzliche Betreuerin bestellt
18. Lbj
13 2002-03 für ¾ J.
B. ist als Helfer vom Hausmeister beschäftigt, wohnt weiterhin im Betreuten Jugendwohnen; die erste Freundin wechselt in WfbM, ins Arbeitstraining
19.-20. Lbj.
15 2003 - Kündigung aus einem stat. Wohnheim, B. zeigt exzessiven Drogenkonsum, - sowie sexuelle Enthemmung, und greift Be-treuungspersonal an
21. Lbj.
16 2004-05 Wechsel in Rehaeinrichtung nach Stuttgart; medizinische und berufliche Reha beschäftigt als Metallarbeiter, Praktika in ex-terne Betriebe, B. bekommt Lehrstellenplatz, erneuter Drogen-rückfall
22.-23. Lbj.
17 2005-06 9 Mon.
B. wird in eigener Mietwohnung, ambulant betreut, B. fährt 2 x zur Mutter
22. Lbj.
283
18 3 Mo. 2006
B. wird in psychiatrische Klinik untergebracht 22. Lbj.
19 2006-2010 2 J. 9 Mon
B. kommt in ein psychiatrisches Pflegeheim, nach § 1906 BGB geschlossen geführt; Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB wird vom Betreu-ungsgericht angeordnet
22.-26. Lbj.
20 2011-13 UBG nach 1906 BGB im Wohnheim in X Stadt; Die Mutter versucht mehrfach ihren Sohn nach Westfalen zu ho-len
26.-29. Lbj.
21 12/2012 Stiefbruder suizidiert sich, fährt mit Auto gegen einen Baum, B. wird zur Beerdigungsfeier für 2 Tage begleitet
28. Lbj.
22. 12/2013-07/2016
B. wird wegen fremdaggressiven Verhalten gegenüber Mitarbei-terin gekündigt, in ein Psychiatrisches Pflegeheim vermittelt, mit Adrogur (testosteronhemmenden Medikament) behandelt B. flüchtet immer wieder aus dem Heim,
30.-33. Lbj
23. seit 05/ 2016
geplant, B. in ein offenes Heim zu verlegen, B. drängt wieder, zur Mutter zu ziehen, die psychotisch ist
33. Lbj
Tabelle 6: Biographische Daten zur Falldarstellung 4.
6.4.2.1. Erste Hypothesenbildung zum gelebten Leben
„Jedenfalls stand der da mit einem Gewehr und hat auf mich gezielt und hat gesagte äh, sag mir irgendwie, wer du bist und so? Ich kann es dir nicht nicht sagen und dann hat er gesagt, dann nimm das Gewehr runter und ich habe gesagt zuerst mal, nee lass mal (…) dann hab ich sie runter genommen und dann hat er gesagt, lege sie da hin! Dann hab ich gesagt, des mach ich irgendwie jetzt nicht. Und dann bumm bumm hats gemacht (10 Sec Pause)..im Spiegel hab ich dann das Blut gesehen.“ Hr. Noller (Interview 1, S. 13, Zeile 485-506)
Der Biograph wird in eine unsicher-diffuse Familiensituation hineingeboren. Die zu-nächst alleinerziehende und finanziell unterversorgte Mutter lebte bis zur Geburt mit ihrem, um ein Jahr älteren Sohn zusammen, bis sie auf einen Kommilitonen und den baldigen biologischen Vater des Biographen trifft. Die offenkundig bereits längere Zeit zuvor, mit dem Status chronisch psychisch kranke ausgestatte Mutter, lernte als Studierende der Geisteswissenschaften, auf einer süddeutschen Universität, den Va-ter, mit afrikanischer Herkunft, kennen. Wenige Monate nach der Geburt lässt er die beiden Kinder und die Mutter als Alleinerziehende von nunmehr zwei Kleinkindern zurück und begibt sich vollständig aus dem Gesichtsfeld des Biographen. Die Sehn-sucht, den Vater kennenzulernen, lebt bis heute beim Biographen, mit diffusen Um-setzungsvorstellungen aufrecht, der „mal nach Berlin reisen wolle, um dort zu su-chen, …ich weiß aber gar nicht, wo der dort lebt (….) und ob überhaupt (…) noch. Der heißt doch noch so, vielleicht hat er geheiratet, oder?“ 461
Hr. Noller erfährt in den folgenden ersten Monaten in einem völlig überforderten und zunehmend vermüllten Haushalt weder grundlegende Bindungserfahrungen, noch eine basale Bedürfnisbefriedigung. Die Mutter bricht das Studium ab und baut ein, stark nach außen hin abgeschottetes Familiensystem auf, das Kontakte und Einfluss abzuwehren versucht. Schließlich wird der Biograph in einem stark abgemagerten
461 Forschungstagebuch. Masanz, K.: Eintrag aus einem Gespräch am 21.12.2013 mit Hrn. Noller (Falldar-stellung 4), der an dem Tag darum bat, ihn nicht nach einem aktuellen massiven Übergriff zu kündigen. Hierbei erwähnt er die Option, sich auf die Suche nach seinem Vater nach Berlin zu begeben, um bei ihm zu wohnen.
284
und retardierten Entwicklungszustand durch das Jugendamt angetroffen, die durch ausbleibende amtsärztliche Kontrolluntersuchungen der Kinder auf den Plan traten und auf den Haushalt einer unbehandelt psychosekranken Mutter aufmerksam wer-den, die ihre Söhne ganz für sich beansprucht und beschützen will. Das Jugendamt prüft, ob das Kindeswohl gefährdet sei und es kam schließlich im Laufe der weiteren Wochen zu einer Inobhutnahme der Kinder.
Es ist davon auszugehen, dass im Zuge einer langanhaltenden, nicht mediziert, vor sich dahin schwelenden, immer wieder exazerbierten Schizophrenie, die Mutter ein nach außen hin stark abgeschottetes Familiensystem entwickelte, das sie wie eine Löwin, mit der Folge von sozialem Rückzug, kategorialer Segregation und einer selbstveranlassten Exklusion, zu verteidigen versucht. Die Außenwelt wurde durch die Mutter als Droh- und Angstkulisse gerade unter Einbeziehung der Kinder, aufge-fasst. Es galt, sich gegen äußere Einflussnahme, Behörden und Ämter zu wehren und massiven Widerstand zu leisten.
Aus den ärztlichen Berichten und dem Bericht der ehemaligen SOS-Kinderdorfeltern von einer ausgeprägten körperlichen (untergewichtig, Hautausschläge, aus-drucklo-ses, ernstes Gesicht) als auch seelischen Vernachlässigung (passiv, ängstlich, auffäl-lig im Kontakt, Sozialverhalten) der beiden Kinder aus, so dass der Biograph zunächst für 9 Monate in der zuständigen Universitätsklinik untersucht, versorgt und behandelt werden musste. Die psychotische Symptomatik des Biographen, wie auch das Ver-halten der Mutter in ihren eigenen Krankheitsepisoden lässt Mutmaßungen aufkom-men, dass der Biograph zudem missbräuchliche Erfahrungen erlebt haben könnte. Der Biograph erlebte wechselnde Erzieher, Mitbewohner. Er musste sich jeden Tag im Heim, in einer jungen-dominierten Lebenswelt, behaupten, Hierarchien mussten bestätigt oder verteidigt oder neue ausgelotet werden, Im Falle des Biographen ist auch auf einen spezifischen Geschlechterunterschied hinzuweisen, so dass männliche Jugendliche stärker zu externalisierten Störungen und Symptomen, wie z. B. Aggres-sion, delinquente Handlungen und Mädchen eher zu internalisierten Problemen, wie z. B. depressive, ängstliche Symptome, selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen etc. neigen, so eine große Feldstudie von KJELSBERG & NYGREN (2004)462. Die Folgen des Handelns können auch als isolierte Traumatisierungen interpretiert wer-den, so neigen Männer eher zu Hyperarousal (Übererregung, mangelnde Affektinto-leranz, Angst, nicht schlafen zu können), gereizter Stimmung, Substanzmissbrauch und aggressiven Handlungen, wohingegen Mädchen eher zu Dissoziationen und de-pressiven Symptomen neigen, so die ergänzende Studie von HUBER (2003)463.
Die frühzeitige Heimunterbringung und Entfernung aus der Herkunftsfamilie, und einer lebenslangen fremdbestimmten Institutionalisierung, vom 2.-18. Lebensjahr durchgehend in zwei stationären Jugendheimen, führte zu einem Erleben, von gering ausgeprägter Selbstwirksamkeit und Fremdbestimmtheit. Der Biograph suchte immer wieder den Weg, sich mittels Drogen lebendig zu fühlen, sich damit zu spüren, selbst zu medizieren, bei bedrohlichen Erregungszuständen zu beruhigen oder sich mit Hilfe von Suchtkonsum kräftiger und energiegeladen zu erleben. Der Biograph verfügt
462 Kjelsberg, E. Nygren, P. (2004): The Prevalence of emotional and behavioral Problems in institutionalized Childcare Clients. Nordic Journal of Psychiatry, 58 (4), 319-325. 463 Huber, M. (2003): Trauma und die Folgen. Trauma und Traumabehandlung. Teil 1. Paderborn. Junfermann
285
über eine gering ausgeprägte Selbstlenkung und Bewusstsein für Entscheidungen, die auf einer gründlichen Prüfung von Willen und Wollen beruhen, um Folgen und Aus-wirkungen des eigenen Handelns nach einer Risikobewertung abzuschätzen und ent-sprechend zu beeinflussen.
Weitere Versuche eines strukturierten und abgewogenen Zusammenführens von Mutter und Biograph über die SOS-Kinderdorfeltern und dem Jugendamt wurde im-mer wieder von der Mutter selbst kolportiert, boykottiert und sabotiert. Die Mutter will ihren Einfluss auf den Biographen geltend machen, sie will ihn zu sich holen, da sie alleine nicht leben kann. Dieses Bestreben wächst um ein Vielfaches an, als ihr älterer Sohn durch einen Suizid verstirbt. Sie kämpft bis zur Volljährigkeit des Bio-graphen um die Anerkennung des Sorgerechts, mit dem Ziel eine Rückkehr erneut einzuleiten. Das Jugendamt als Vormund entscheidet nach dem Motto „Mehr dessel-ben“ mit einer räumlichen Trennung von mehr als 400 km und der Verlegung des Biographen nach Süddeutschland in ein weiteres stationäres Kinder- und Jugend-heim, um den manipulativen Einfluss der Mutter einzugrenzen und Einhalt zu gebie-ten. Die räumliche Barriere dient vorwiegend zur Strukturierung von Nähe und Dis-tanz innerhalb der Symbiose von Mutter und Sohn.
Das einschlägige Ereignis prägt den Biographen ein Leben lang, als er mit 12 Jahren vom Bruder mit einem Luftgewehr in den Hals geschossen wurde. Aus dem Moment der erlebten Machtlosigkeit und einem willkürlichen Ausgeliefertsein gegenüber sei-nem älteren Bruder, der den Biographen als direkten Konkurrenten identifiziert hat, entwickelte Hr. Noller von da eine große Faszination für Waffen und den Besitz von Waffen. Befördert und befeuert durch die Attraktivität dieses Feldes, konsumiert der Biographen ab dem 14. Lebensjahr Drogen und erlebt immer wieder exzessive Alko-holräusche. Er erwirbt sich eine Waffe im Milieu und entwickelt massive Amokphan-tasien in der Schule, im weiteren Verlauf auch Suizidgedanken, aber auch erweiterte Suizidgedanken. Mit der Schusswaffe im Schulranzen in der 7.-8. Klasse verliert sich der Biograph in Allmachtphantasien, Racheszenarien und erlebt sich als potentiell selbstwirksamer und mächtiger Vollstrecker, der bei den tagtäglichen Hänseleien o-der der Kritik und bei schlechten Schulleistungen, die vom Lehrkörper attestiert wer-den, zu fixen und dann zwanghaften Gedanken fortentwickelt werden, den Lehrer oder einzelne Schüler zu richten und zu bestrafen.
Der Einfluss der psychisch kranken Mutter ist ein bestimmendes Thema und stellt eine dominierende Problemstellung für den Biographen und die Erziehungseinrich-tungen dar, die über Jahre versuchten, das offensichtlich pathologisch symbiotische Band zwischen Mutter und Biographen zu kappen bzw. den Sohne vor den Einflüssen der Mutter zu schützen, die immer wieder, entgegen der Absprachen versucht, Kon-takt mit ihrem Sohn aufnahm, um ihn zu sich zu holen.
Die ausreichende Nähe und angemessene Distanz zur Mutter wird über die Jahre durchgehend durch Dritte, durch das Gericht, die Polizei, Institutionen, das Jugend-amt, später dann durch die gesetzliche Betreuerin für den Biographen definiert. Diese Steuerung wurde durch eine ausreichend räumliche Entfernung (vom 12.-18. Lebens-jahr), später sogar durch einen vorgegebenen Aufenthaltsort in einer geschlossenen-geschützten Institution, (vom 22.-33. Lebensjahr), die keinen oder nur begleiteten Zugang gewährte, strukturiert.
286
Durch einen Ortswechsel wird eine Akzentuierung im Rahmen einer spezifischen, differenzierten beruflichen Rehabilitation eingeleitet. Das Feld der beruflichen Qua-lifikation und Ausbildung, im Anschluss an den Schulabschluss, wird dem Biogra-phen als einen aussichtreichen Handlungshorizont aufgebahrt. Hr. Noller kann sich im ersten Jahr so stabilisieren, dass er unmittelbar vor der Ausbildung im Bereich der Lagerlogistik stand. Nach kurzer Zeit kommt es auch in der Rehabilitationseinrich-tung zu einer Regression in alt bekanntes subkulturelles Verhalten, dem sich Hrn. Noller gegenüber weder widersetzen noch distanzieren kann, so nimmt er wieder Kontakt auf zum großstädtischen Milieu und versorgt sich und andere mit Drogen, verstößt gegen die Haus- und Therapieregeln und wird fristlos gekündigt. Es erfolgt nun die Einleitung von maximal freiheitsentziehenden Maßnahmen. Der Biograph wird per Unterbringungsbeschluss, in Kombination mit einem Einwilligungsvorbe-halt in ein psychiatrisches Pflegeheim, dezentral im Wald gelegen, aus dem Einzug des Milieus entfernt und vom 22.-26. Lebensjahr dort grundversorgt. Hr. Noller sta-bilisiert sich in dem hochstrukturierten Rahmen und es kommt auf Wunsch der Be-treuerin zu einer Rückverlegung in die Großstadt, und einen Wechseln des Einrich-tungstyps, mit dem Ziel einer intensiven Auseinandersetzung im Bereich Behandlung und Auseinandersetzung mit der psychiatrischen Grunderkrankung und der Suchtab-hängigkeit, sowie einer gezielten Förderung und Training durch tagesstrukturierende Angebote in einem Heim der Eingliederungshilfe. Dort kann sich der Biograph 2 ½ Jahre behaupten. Bereits im ersten Heimjahr kam es zum völlig überraschenden Sui-zid des Bruders, und einer Konfrontation im Zuge der Beerdigungsfeierlichkeit mit der Mutter. Hr. Noll wurde für das Wochenende in das Heimatdorf begleitet.
Von dem Zeitpunkt an entwickelte der Biograph eine massive Verschlechterung, und teilweise massiv entgrenztes Verhalten. Hr. Noller wird nun dauerhaft im geschlossen Bereich, ohne Ausgang, betreut. Er verstößt permanent gegen Haus- und Therapiere-geln, konsumiert Drogen, dealt, greift enthemmt Betreuungspersonal an, entweicht bei jeder Gelegenheit über den Notknopf, den er einschlägt. Nach erfolgter fristloser Kündigung wurde der Biograph erneut in ein dezentrales psychiatrisches Pflegeheim verlegt. Die geographische Lage ist so, dass ein Zugang zum Milieu unmöglich für den Biographen wird. Dort hält sich der Biograph drei Jahre auf und beginnt erneut sich so zu verhalten, dass die Heimleiterin und die gesetzlichen Betreuerin einen Wechsel in eine andere Einrichtung thematisieren.
6.4.3. Erzähltes Leben -Text- und thematische Feldanalyse-
„Ja überlegt habe ich mirs (…) ich hab mir auch überlegt, ob ich mir eine Kugel in den Kopf schieße oder ob ich mal nen Schuss abgeben soll, aber da hab ich gedacht, das wär nicht so gut.“
von Herr Noller
In der Eingangssequenz gab es für einen Moment Zweifel und Unsicherheit, ob der Übereinkunft und der beidseitigen Vereinbarung darüber, was in den biographischen Interviews thematisiert und besprochen werden soll, als der Interviewer zu einer freien Narration über die Lebens- und Familiengeschichte aufforderte und der Bio-graph nur mit einem „Mmmh, ok.“ lapidar antwortete.
287
Der Biograph präsentierte zu Beginn seinen biographischen Verlauf im Stakkato und vermittelte dabei eine große Erfahrung und Übung darin, im Zuge eines von z. B. Gutachtern, Ärzten, Psychologen aufgeforderten Rapports befragt zu werden. Der Biograph kondensiert seine ersten 18 Lebensjahre auf binnen weniger als 50 Zeilen zusammen. Er erwähnte den jeweiligen Statuswechsel mit chronologischen Angaben des Lebensalters in folgender Abfolge. Geburt, Kinderklinik (3 Jahre), erstes Kinder-heim, zweites Kinderheim 2 (bis 16. Lebensjahr), Betreutes Jugendwohnen (bis zum 18. Lebensjahr), dann Rehaeinrichtung 22. Lebensjahr, eigene Wohnung mit ambu-lanter Betreuung (9 Monate), seitdem im Heim und wieder Heim, bis heute (30. Le-bensjahr).464
Lediglich die Zeit bis zum 2. Lebensjahr und eine kurze Episode von neun Monaten, zwischen der Kündigung aus der Rehabilitationseinrichtung und einer langen Klinik-behandlung (22. Lebensjahr), die in einen Heimvertag mündete, stellen für den Bio-graphen Zeiten dar, in denen er außerhalb einer institutionellen Struktur gelebt hat. Der Biograph eröffnete direkt im Anschluss an die im Zeitraffer rekonstruierte Be-richterstattung das Themenfeld, das gleichzeitig als richtungsweisendes Lebens-script, in der Textsorte Narration, interpretiert werden kann. Hierbei werden dem Bi-ographen zwei Handlungshorizonte optional angeboten: Beruflichen Qualifikation, Ausbildung oder Etikettierung Krank-Sein in der Psychiatrie? Der Biograph berich-tete im szenischen Präsens den Schlüsseldialog mit seiner Mutter, die ihn in der eige-nen Wohnung aufsuchte und die entscheidende Frage: Entweder Beruf oder Psychi-atrie?
„Dann kam meine Mutter (..) (schnauft tief) hat gemeint: Geh entweder in Beruf oder ins Hospital! (laut, autoritär und in gekünstelter Frauenstimme). Dann geh ich halt ins (..) hab ich gesagt, ich geh ins Hospital, ich geh ins Hospital, ich hab ich gedacht (…) dann geh ich mal für zwei Wochen hin und gucke mir an, wies da so ist? Und meine Mutter hat dann gesagt: Gut und Punkt! Naja und dann war meine Woh-nung irgendwie weg, weil ich so starke Medikamente, Haldol oder so was und dann äh konnte ich den Wohnungsschlüssel nicht mehr richtig (macht eine Handbewe-gung als schließe er mit einem Schlüssel eine Türe auf) (...) dann war die Wohnung plötzlich weg!“465
Der Biograph präsentierte sich als jemand, der es gewohnt ist, dass Dritte über ihn verfügen, der sich trotz der erfüllten Zugangsvoraussetzungen für eine berufliche Qualifizierung, als selbstwirksame und aktive Entscheidung, die ihm vertraute fremd-bestimmte institutionelle Strukturierung, in einem regressiv-passiven Sinne begibt. Die Willensbekundung und Entscheidung der Mutter gegenüber, in die Psychiatrie zu gehen, assoziiert der Biograph mit der passiven Rolle eines unbeteiligten Zuschau-ers, der nur so unverbindlich mal reinschauen und schnuppern will, als führe er eine teilnehmende beobachtende Feldstudie in einer psychiatrischen Klinik durch, in der er sich mit den Prozessabläufen und den Alltag beschäftigen wolle.
464 Falldarstellung Nr. 4. Interview: 1. S. 1-2. Zeile: 5-50. 465 Falldarstellung Nr. 4. Interview 1. S. 2-3. Zeile: 54-80.
288
Die Kündigung des Mietvertrags und Auflösung des eigenen Wohnraums sieht der Biograph einzig im Kontext der Medikamenteneinnahme und den bei ihm resultie-renden Nebenwirkengen, die seine feinmotorischen Fähigkeiten derart beeinflussen, dass er nicht mehr in der Lage war, seine Wohnungstüre jemals aufzuschließen zu können. Somit rechtfertigt er die Rückgabe der Wohnungen und des Schlüssels, den er zurück in die Hände der Mutter begibt, die in einem metaphorischen Sinne über die „Schlüsselgewalt“ seines Selbstwerdungs- und Autonomisierungsprozesses“ ver-fügt und ihn wieder an sich bindet.
Als nächstes Feld eröffnet der Biograph als besonderes Ereignis den Abschnitt Kind-heit, mit der er einzig gute Erinnerungen und Momente verknüpfte, da er damals un-beschwert, inmitten einer Gemeinschaft mit anderen Buben draußen im Hof oder auf dem Bolzplatz spielen durfte und im Besonderen freien Ausgang genoss, ganz im Gegensatz zu den freiheitsentziehende Einschränkungen und Maßnahmen dem 22. Lebensjahr bis zum Zeitpunkt der Interviews im 30. bzw. 31. Lebensjahr. „Besonders gut ..fand ich meine Kindheit, (….) da war viel freundschaftlich, keine besonderen Verpflichtungen, ich konnte praktisch immer rausgehen.“466
Ganz im Gegensatz dazu bedauerte der Biograph, dass er nie bei seiner Mutter leben konnte. Er bewertete dieses Ereignis, auf Nachfrage hin, als „egal Ereignis“ „Wollen sie gute oder egal Ereignisse?“ Es kommt der Eindruck auf, dass er von Glück spricht, sich nicht erinnern zu können oder zu wollen. Der Biograph präsentiert sich so, als verfüge er nicht mehr über viele Erinnerungen. Die Erinnerungslücken, Aus-lassungen stehen auch im Zusammenhang mit einem sehr frühen, jahrelangen und polytoxikoman-schädlichen Drogenmissbrauch, mit traumainduzierten Dissoziatio-nen und eine dauerhaft florid-schizophrenen Krankheitsverlauf, der auch mit neuro-leptischer Kombinationstherapie nur begrenzt beeinflusst werden konnte. „…im Kin-derheim, da hab erinnere ich mich, da war so ein Waldgebiet….im Wald hab ich gespielt, in der Zeit ähm (vor dem 12 Lebensjahr) habe er nicht geraucht und keine Drogen genommen!..ja da gabs halt auch schlechte Ereignisse, immer Probleme und so, ähm, (hebt die Faust) so die haben mich verprügelt, immer geprügelt ähm und (lange Pause) gequält, ich wurde auch immer gequält oder so!“467
Der Biograph präsentierte sich schon als Kind als Wunderling, Außenseiter, der die Einsamkeit und Ruhe des Waldes, die Zurückgezogenheit, dem Kontakt mit den an-deren Kindern vorzog.
Ein weiteres Feld, das der Biograph gleich zu Beginn in der Textsorte Narration of-fenlegte, ist das Feld des Bruders, „der Andere“ und die jahrelangen Misshandlungen durch ihn, die dann im 12. Lebensjahr in einer lebensbedrohlichen Schussverletzung gipfelte.
B: (Zeigt unvermittelt eine große Narbe am Hals) „Der andere, hat mich halt in Hals geschossen mit so nem Luftgewehr, und äh seitdem äh bin ich seitdem bin ich ein bisschen äh hab ich mich ein bisschen vielleiht ein bisschen verändert oder so ein bisschen halt. (zeigt nochmals Narbe am Hals) Sieht man das?“ I: „Haja, Jesaas
466 Falldarstellung Nr. 4. Interview 1. S. 3. Zeile: 96-103. 467 Falldarstellung 4. Interview 1. S. 5-6. Zeile: 161-198.
289
Marianne und Michael…ja seh` ich! Ist die groß, (..) laut und (..) deutlich!“ (schmun-zelt)468
Der Biograph rekonstruierte die Schussszene wie ein Theaterstück in seinem Zimmer. Er zeigte genau, wie die Umgebung ausgestattet war, wo eine Hecke stand, wo die Dosen standen, auf die sie zuvor noch geschossen hatten und wo sich die Mutter im Hintergrund mit einem Mann in Hörweite getroffen hatte. Er zeigte, wo er im Garten stand und von wo sein Bruder abfeuerte. Er berichtete den genauen Wortlaut bzw., was er zu seinem Bruder gesagt hat: „Ich habe immer wieder gesagt, okay, okay okay (redet beruhigend, langsam, betont beschwichtigend, hebt und senkt dabei die Hände). Leg jetzt langsam dein Luftgewehr ab. Siehst du, ich habe meins abgelegt. Schau. Leg deines auch ab. Langsam. Jetzt! leg es ab! Dann gings plötzlich schnell. Mein Fehler war, dass ich nicht wegelaufen bin, ich bin halt so dagestanden und habe. (Hände-hoch-Haltung eingenommen) 469
In der Präsentation des Biographen kristallisiert sich die dauerhafte Konkurrenzsitu-ation gegenüber dem älteren Bruder als prägende Beziehungsgestaltung hervor. Wäh-rend der Biograph die Schulkarriere bis zur Realschule und wieder zurück auf die Hauptschule durchläuft, letztendlich mit der Mittleren Reife absolviert, steigt der Bruder über die Realschule aufs Gymnasium ein, wird jedoch zurück auf die Real-schule gestuft und schließt ebenso, wie der Biograph, mit der Mittleren Reife ab. Trotz der guten Noten entschieden die Erzieher und die Lehrer, das müsse reichen für den Biographen.470
Die Veränderungen, die der Biograph ansprach, beschrieb er unmittelbar im nächsten thematischen Feld in Verbindung mit konkreten Auswirkungen auf die Schulleistun-gen, die sich in den folgenden zwei Schuljahren rapide verschlechterten. Der Bio-graph führte ergänzend fort, dass er zur selben Zeit mit dem Kiffen und Trinken an-gefangen habe, grundsätzlich kein Interesse mehr hatte, nicht mehr gelernt habe. Dann kam es zu einer bewusst willentlichen Entscheidung. „ ….von nun, ab jetzt bist du kein 2er Schüler, (auf der Realschule) sondern es wäre gut, wenn du jetzt äh auch ein schlechte Schüler wärst. Ich war ja ähm, dass ich so äh ich hab da nicht viel darüber nachgedacht, dann bin ich auf die Hauptschule(…) war ich ich wieder da (.) hat ich dann gute Nieten äh Noten wieder.“471
Ja, ähm äh ich ab angefangen zu kiffen und zu trinken, ich (fragend) der 8. Klasse (13 Jahre) ja, und hab halt äh irgendwie weil ich auch äh da war ich halt ein bisschen abgelenkt und ich war eh (…) ich war eh schon so äh aber ich hab ich hab damals nicht allzu viel zu tun gehabt äh doch schon, schon ja, ich bin halt fauler geworden hab nicht mehr äh also nicht mehr so viel gelernt hab halt meine Hausaufgaben nicht gemacht (..) aber zum Unterricht bin ich äh immer gegangen, (..) eigentlich? Ähm, da war ich auch abgelenkt durch die, durch die anderen Leute, die halt immer Faxen gemacht haben!472
468 Falldarstellung 4. Interview 1. S. 4. Zeile: 112-118. 469 Falldarstellung 4. Interview 1, S. 4. Zeile: 125-131. 470 vgl. Falldarstellung 4. Interview. 1. S. 6-7, Zeile: 199-227. 471 Falldarstellung 4 Interview 1. S.8. Zeile: 274-280. 472 Falldarstellung 4 Interview 1. S.7-10. Zeile: 228-336.
290
Der Biograph präsentierte sich in dem weiteren Feld so, als führe er einen inneren Dialog zwischen zwei Personen, die bemüht sind, eine Erklärung und Rechtfertigung für seine nachlassenden Schulleistungen und Veränderungen im Sozialverhalten zu liefern. Im Gesamten schreibt der Biograph seiner direkten Umwelt zu, ursächlich für sein eigens Unvermögen verantwortlich zu sein. Nach dem Motto „Ich würde ja schon wollen, wenn man mich doch nur ließe“, manövriert sich der Biograph selbst in Situationen, die er aushält, erträgt, über sich ergehen lässt oder er vermeidet gezielt, willentlich Situationen, in denen er auf eine Herausforderung und Auseinanderset-zung stößt. Mit der Auswahl dieser Handlungshorizonte bleibt er stets unterhalb des Niveaus verhaftet, dass er eigentlich aufgrund seiner Fähigkeiten und Ressourcen be-wältigen könnte.
So verharrt der Biograph, wie in der Eingangssequenz, hervorgehoben, auch in die-sem thematischen Feld innerhalb einer dichotomischen Handlungsoption, sich ent-weder für den Beruf oder für die Psychiatrie zu entscheiden, sich entweder für die schulische Qualifikation zu engagieren oder sich der Lebenswelt der Drogen und des Alkoholkonsum hinzugeben, entweder auf die Gegenwart Bezug zu nehmen oder sein Denken, Fühlen und Handeln in einen zukunftsorientierten Bezug zu setzen, sich für Stagnation oder für Entwicklung zu entscheiden, sich den Herausforderung des All-tags zu stellen oder sich im Schongang einer dauerhaften Unterforderung hinzugeben.
Der Biograph akzentuiert ein weiteres Ereignis, in dem er seinen Wunsch nach einer leiblichen Veränderung und der Ahnung zum Ausdruck bringt, sich in seinem Körper nicht mehr wohl zu fühlen, da er sich darin vielmehr nicht stimmig erlebt.
Als Indiz für den Biographen ,,ab dem Zeitpunkt (auch nach der Schussverletzung) hab ich mich verändert. .ich weiß nicht mehr genau wo und wann das war…irgend-wann mal hab ich mir hier (kommt ganz nah zum Interviewer und zeigt seine Brauen und die Narben) Augenbrauen raus gemacht, ähm mit Tesafilm, hab ich, ja ich weiß glaub ich, wann das war, in der Realschule. Da war so ein Mädchen, die hat so aufgemalte Dinger gehabt (zeigt mit beiden Händen auf seine Augenbrauen und kommt erneut ganz dicht an den Interviewer ran) und da hab ich mir gedacht ja das mach ich auch (…) ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, da bin ich heim-gegangen, hab mir Tesa draufgemacht ja dann bin ich halt äh von daher gibst noch diese Narben ja, seitdem bin ich habe ich mir gedacht, äh mir gehts nicht so gut und …(…..) dann hab ich nicht mehr an die Tafel gesehen, ähm nicht mehr getraut in Unterricht zu gehen, da hab ich Ängste gehabt, das was passiert, irgendwie mit der Psycho oder so.“473
Der Biograph verhielt sich sowohl im Heim als auch in der Schulklasse sonderbar, abweichend, passiv, teilnahmslos, auffällig. So wird von den Mitschülern als Außen-seiter erlebt und wahrgenommen. Der Biograph erlebte durchdringend ein Gefühl der Scham, der Angst und Unsicherheit, das sich auf seine Suche nach der eigenen leib-lichen und geschlechtlichen Identität bezieht. Er erfährt vielerorts Häme und Hänse-leien durch die Kinder des Heims, aber auch durch die Mitschüler, die sich lustig und lächerlich über den Biographen machten. Vor diesem Hintergrund kommt es in der Selbstpräsentation des Biographen zu umfangreichen Auslassungen und Lücken im
473 Falldarstellung 4 Interview 1. S. 10-11. Zeile: 340-372.
291
erzählten Leben während der Heim- und der Schulzeit. Es fehlen vollständig Erleb-nisse, erinnerte Geschichten oder Anekdoten mit Lehrern, Mitschülern oder mit Er-ziehern oder mit anderen Heimkindern. Der Biograph erlebte schließlich als kausaler Auslöser für das dauerhaft expandierende Angstgefühl die Schussverletzung durch den Bruder, die er in der Folge mit Kiffen und Alkohol selbst zu behandeln beabsich-tigte. Der Wunsch nach einer körperlichen Veränderung oder auszusehen wie ein Mädchen, ist seinem grundlegenden Identitätskonflikt geschuldet, nach dem sich der Biograph bis heute die Frage stellt, wer er denn eigentlich sei?
„Super! Wie soll ich das alles alleine machen, ich war jahrelang, jeden Tag alleine im Heim, da waren nur Kinder, die haben mich abgezogen und so. (….) auch die neuen Freuden, neue Klamotten, oder neue Trikots und so von Liverpool, hat ich eins, die hab ich an sie verloren.“474
Die Angst davor, dass ihm selbst etwas passieren könnte, wurde im Biographen im-mer größer und erwuchs zu einer paranoiden Symptomatik. Der Biograph stellte fest, ohne Rückhalt und in völliger Einsamkeit, ohnmächtig seiner Umwelt gegenüber aus-geliefert zu sein. Er sehnte sich nach Schutz und erlebte, ausgelöst durch das lebend-bedrohliche Ereignis beim Spielen mit dem Bruder, eine zunehmend anwachsende Faszination, wenngleich auch in Form einer ambivalenten Attraktivität, gegen über Waffen.
“So einen richtigen Revolver in der Schule, ja was war da noch. äh nen Revolver in die Hand gelegt und gleich wieder weg gelegt…ich wollt einen in der Schule, wo ich allein in der Klasse war.475
Der Biograph fühlte sich bedroht, er fühlte sich dem Klassenverband ausgeliefert. In ihm kamen zerstörerische Rachegefühle gegenüber den Schülern und Lehrern auf, sich für all die Jahren der Demütigung, des Gequält-Werdens und der fehlenden Ach-tung, Anerkennung und Fremdbestimmung zu rächen. Er kam an den Punkt, die Schüler, die ihn ausgrenzten und sich über ihn belustigten, zu töten oder sich selbst im Anschluss zu töten. Der Biograph erlangte durch den Besitz des Revolvers in sei-ner Schultasche ein Gefühl der Macht, der Allmacht, die es ihm nun möglich machte, wann immer er es wollte, auch umzusetzen in der Lage wäre.
Der Biograph sah weitere Einsatzmöglichkeiten durch den Revolverbesitz geöffnet. So dachte er z.B. daran, einen Überfall zu planen, um viel Geld zu verdienen. Die Gewaltphantasien wuchsen in der Gedankenwelt des Biographen immer mächtiger und bestimmender an, so dass der Biographen selbst zwischen Wirklichkeit und Er-lebten und einer trügerischen Vorstellung kaum zu differenzieren wusste.
„Ja überlegt habe ich mirs (…) ich hab mir auch überlegt, ob ich mir eine Kugel in den Kopf schieße oder ob ich mal nen Schuss abgeben soll, aber da hab ich gedacht, das wär nicht so gut..ähm ich hab auch immer gedacht, dass andere mich erschießen wollten z. B. an der Tankstelle saß ein Gangster im Auto und ich hab gedacht, was mach ich jetzt,(.…)als ich von der Disco heimgelaufen bin, hat einer mit einer Knarre
474 Falldarstellung 4, Interview 1, S. 15, Zeile: 502-514. 475 Falldarstellung 4, Interview 1. S. 11. Zeile 374-394.
292
auf mich gezielt und dann bin ich auch irgendwie auch hab ich mir gedacht ähm vielleicht so, ich weiß aber gar nicht, äh ob das die Realität war oder nicht? 476
Innerhalb der Peers konnte sich der Biograph zu keinen Zeitpunkt bis hin zum Auszug aus dem Jugendheim behaupten. Als 19-Jähriger orientierte er sich an 16-Jährigen, die den Biographen nur in ihrer Mitte duldeten, da er durch sein Alter Zugang zu Alkoholika hatte, die er nach genauer Bestellung im Supermarkt für die Clique ein-kaufte. Der Biograph sieht sich auch gegenüber den Jüngeren, die in der Überzahl waren, schutzlos ausgeliefert. Die erhoffte Anerkennung und Akzeptanz wurde ihm auch hier versagt.
Die anschließende Orientierung in der Rehaeinrichtung unter den Klienten, in den geschlossenen Einrichtungen wählte der Biograph nach einem bekannten Muster seine Interaktionspartner aus. Er orientierte sich im Umgang an den Schwächsten und den besonders schwerkranken, suchtkranken Mitbewohnern und Mitpatienten. Er wählte sie durch sein eigens Selbstbild, das er in sich führt, aus.
Die anschließende Thematik, die berufliche Qualifikation, die chronologisch zu er-warten wäre, wird zum wiederholten Male übersprungen und es schließt sich statt-dessen direkt das Feld Psychiatrie und des weiteren Aufenthaltsortes an das Ende des Kinderheims an. Der Biograph wird vor die Wahl gestellt, nach Köln oder Stuttgart zu ziehen, um dort eine Reha für psychisch kranke Menschen anzutreten. Mit beiden Regionen verbindet der Biograph keine Berührungspunkte.
Die Entscheidung über den zukünftigen Aufenthaltsort fiel durch die zuständige Ju-gend- und Heimerzieherin, die zunächst den Biographen in eine Tagesklinik in der umliegende Region von Stuttgart überweist. Dort konnte der Biograph die Wartezeit, in der Fortsetzung, in einem hoch strukturierten Rahmen bis zur Aufnahme überbrü-cken.
„Da war ein Sozialarbeiter (äh) dabei (äh) ich (ähm) der meinte ich soll mal so in ne Rehaeinrichtung nach Stuttgart, ähm ob ich jetzt nach Stuttgart will oder nach Köln oder wohin ich denn will hat er mich gefragt, dann hab ich gesagt äh ich weiß nicht genau wohin, vielleicht Stuttgart, vielleicht Köln, weiß nicht und dann hat er mich halt hie hier nach Stuttgart gefahren dann äh hab ich mit nem Psycho-Arzt gespro-chen, einen Monat später bin ich eingezogen und arbeite hier in der Montage.477
Der Biograph präsentierte sich in der Folge fokussiert auf das Feld des Kiffens und des Konsums anderer illegaler Drogen, wie z. B. Subutex, das als Heroinsubstitut von einer Schwerpunktpraxis für Suchtmedizin verordnet wird. Der Biograph hob die Wirkung im Drogenrausch hervor, die er als befreiend erlebt, mit dem er sich leichter, angstfrei und entspannt vorkommt. Er habe abschalten könnten. Er hob hervor, dass er jeden Tag, seit er 14, 15 ist, gekifft habe.
476 Falldarstellung 4., Interview 1. S. 12-13. Zeile 407-440. 477 Falldarstellung 4 Interview 1, S. 16-17, Zeile: 569-588.
293
Hier schließt sich auch die Frage an, wie der Biograph den täglichen Konsum mit seinem geringen Taschengeld, das er als Jugendlicher erhält, finanziert?478 Über die subkulturellen Handlungen, Deals, Tauchbörsen und Währungseinheiten und die Zu-gangswege zu Drogen verliert der Biograph kein Wort.
Über die berufliche Reha berichtet der Biograph, dass „diese äh äh ja die war, gut. Ich ich äh habe ein bisschen äh jeden Tag aufgestanden um 8 Uhr halb acht ich bin nicht der Fleißigste gewesen, fünf vor halb acht aufgestanden dann mit nem Bus ge-fahren in die Arbeit ähm äh (3.0) dann bin ich bis vier Uhr gearbeitet.“
Den strukturellen Rahmen handelt der Biographen in 4 Zeilen kurz ab, ohne sich in-haltlich über die Arbeit, die Aufträge oder die Vermittlungen in externe Praktika, vorbereitende Maßnahmen hin zu einer Ausbildungsstelle bleiben unerwähnt.
Biograph fügte wieder eine lange Textsequenz für ihn bedeutsamer und Freizeitbe-schäftigung von Zeile: 649-693 S. 19-20, in der er ausschließlich vom Kiffen berich-tet, wo und mit wem er kifft und vom Kiffen mit Alkoholkonsum.
Kurz vor dem Antritt einer in Aussicht gestellten Lehrstelle wird Hr. Noller wegen mehrfacher Verstöße, Bong Rauchen, Alkohol konsumieren oder wegen Dealens fristlos aus der Rehaeinrichtung gekündigt. In der nun folgenden kurzen Episoden von 9 Monaten im Betreuten Wohnen, verlagert der Biograph plötzlich unerwartet die Thematik weg von der Alltagswelt der Drogen hin zu seinem persönlichen Ziel einer körperlichen Umgestaltung. Dort beginnt der Biograph jeden Tag für 2-3 Stun-den mit dem Hanteltraining und mit Liegestützen (300 pro Tag), um gezielt Muskel aufzubauen. Angeregt durch einen Film, in dem der Hauptdarsteller als schmächtiger Typ plötzlich ganz viele Muskeln hatte, den er mal gesehen habe, so habe er sich selbst in der Zeit vorgenommen, diese Veränderungen bei sich nachzuahmen.
Auf die Gegenwart bezogen stellte der Biograph fest, dass er jetzt, wo er in einer geschlossenen Einrichtung leben müsse, kein Muskeltraining mehr einhalte.
B: „nah aber jetzt ists nicht mehr so richtig wichtig für mich I: Warum ist es nicht mehr wichtig? B: „Weil äh weil ähm, ich halt ich weiß nicht wie soll ich sagen wie solls ich erklären, ich brauch jetzt was im Kopf irgendwie, ich hab halt äh muss ein bisschen mehr klar kommen mit meinem ganzen Leben..des gehört jetzt nicht mehr mal des hier (zeigt rechten Bizeps) und des hier dazu (zeigt linken Bizeps, kommt ganz nah an den Interviewer) sondern meinen Kopf, hab ich äh vernachlässigt…“479
Insbesondere bei Häftlingen im Strafvollzug, denen häufig nichts anderes als Frei-zeitbeschäftigung übrig bleibt, als Gewichte zu stemmen oder aber typischerweise bei Patienten des Maßregelvollzugs, die häufige und regelmäßige Sportangebote als Pflichtprogramm anbieten, stellt der Fokus auf den körperlichen Muskelaufbau und
478 Nach §§ 34, 35, 35a Abs. 2 Nr. 4 und 41 SGB VIII zur Festsetzung der monatlichen Barbeträge für Ju-gendliche in stationären Einrichtungen erhält ein 14-Jähriger: 38,20€, ein 15-Jähriger: 48,-€, ein 16-Jähriger: 56,70€ und ein 17- Jähriger: 70,90€. Stand 1.1.2014 479 Falldarstellung 4., Interview 1. S. 21. Zeile: 720-730.
294
die Zurschaustellung des Körperbaus, das Posen des Körpers eine bedeutsame Selbst-präsentation dar, der sowohl als Schutz und Abschreckung der anderen gegenüber als auch als identitätsstiftende Freizeitbeschäftigung unter den Männern dient.
Der Biograph präsentiert sich einerseits selbst als starke, disziplinierte und willens-starke Person, die aber andererseits nicht das, was er z. B. seinem Bruder sagen wollte, auch mitteilen konnte. B: „Weil mein Kopf mir nicht mehr gehorchte. Der hat einfach nicht mitgemacht ….aber dass er sich hat umgebracht hat hat.“
Wieder kommt es in dem folgenden Themenfeld zu einem langen Bericht und einer Passage (S. 21-22, Zeile: 749- 804), in der der Biograph ausschließlich von Drogen berichtet, von seinem zwischenzeitlichen Heroinkonsum, der Wirkung, den Preisen auf dem Markt im Milieu usw. B: „Da wollte ich z. B. voll lachen voll, einfach herz-haft lachen aber ich habe mich nicht getraut, da hab ichs unterdrückt, (ähm) kurze Zeit später war ich (ähm) im Hospital. Dort ging es weiter mit Drogen, Speed, He-roin, Kokain, jetzt nehm` ich Lyrika, Speed ist z.B. auch cool. Ja, des stimuliert so für den glücks ähm macht einen glücklich für einen Tag.“
Der Biograph präsentiert sich als Experte für Drogen, der schon alle Drogen auspro-biert hat, um deren Wirkungen weiß, der die Marktpreise kennt und je nach Befind-lichkeit, gezielt bestimmte Drogen mit gewünschten Wirkungen zu konsumieren be-reit ist.
Der Biograph präsentiert sich als jemand, der gehindert ist, seine Gedanken auszu-drücken, z. B. seinem Bruder gegenüber oder der seine Gefühle, seine Befindlichkeit, z. B. ein herzhaftes Lachen, nicht zum Ausdruck bringen kann.
Hr. Noller bleibt bei der Selbstpräsentation in der Chronologie der Einrichtungs-matrix; nach der Klinik folgte das geschlossene Pflegheim, dann der Übergang vom eigenen Wohnraum in die Psychiatrie und wieder in ein psychiatrisches Pflegeheim. Er berichtete über das Themenfeld „Waffe“ und über die Zustände in dem geschlos-senen Pflegeheim.
B: „…dort hat mir wieder jemand ne Knarre gezeigt, da hab ich mir wieder überlegt, ob ich mir in den Kopf schieße oder andere ähm“480 Der Biograph setzte seinen Be-richt fort, alle zwei Wochen bekam er gegen seinen Willen eine Spritze, immer sei er in 2-Bettzimmern untergebracht gewesen, er sei nie allein gewesen. Fremde kamen in sein Zimmer, es gab keine Privatsphäre, ständig kam jemand ins Zimmer, ständig hat mir einer Drogen gegeben, ich habe alles Geld in Drogen statt in Kleidungen in-vestiert. etc, und hatte dann zur Folge nichts, keinen Tabak mehr. Der Biograph war ständiger Gewalt ausgesetzt und zeigte an der Stelle eine weitere Narbe an der Schläfe („da kam der rein, da hab ich halt so ne Narbe (zeigt erneut den Interviewer seine Narbe geht ganz nah heran) jetzt hab ich noch so eine Narbe„481 „Seit der Realschule musste ich immer schnorren, weil ich den Tabak immer an andere abgeben musste und überall ist das so, seit ich (ähm) seit ich seit ich den ich hatte.“482
480 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 24, Zeile: 825-829. 481 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 25, Zeile: 845-852 482 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 25, Zeile:860-862.
295
Der Biograph wechselte immer wieder den Tempus, von der Vergangenheit in die Gegenwart, hin zu den aktuellen Zeiten des Biographen …“jetzt hoff ich halt für die Zukunft, dass ich vielleicht in ner eigenen Wohnung wohnen kann, dass ich meine Rente bekomme, wenn nicht, dann na ja irgendwas, das Leben muss weitergehen.“ (Pause 9 sec.)
Über die Bedeutung des Vaters innerhalb der Familiengeschichte hat der Biograph bisher noch nichts gesagt. Der Interviewer lenkte nach einer langen Pause (15 sec.) eines atmosphärisch aufgeladenen Schweigens, den Fokus auf den Vater. „Und ihr Vater?“ Der Biograph begann plötzlich in der Pause sein Nachtischkasten zu sortie-ren, gerade so, als wolle er mit der Erzählung seiner Lebensgeschichte nun enden.
Der Biograph war nun unmittelbar, auf das Feld angesprochen, konzentriert und auf-merksam und kehrte wieder in den Gesprächsfluss zurück. „Der ist weggegangen!“ Er berichtete, dass er mit einer anderen Frau weggezogen sei und eine Familie grün-dete. Er lebe in ihm nur in den Erinnerungen und durch einzelne Fotos. „Der hat mit mir geredet, aber ich war ein kleines Kind und habe keine Erinnerungen mehr (…) der wollte auch nichts mehr von mir wissen.“ (…) Der hat mit mir geredet. Ich habe etwas Blödes gesagt, ich bin ein blödes Kind! Von dem er nichts wissen will…er wollte mit seiner Freundin zusammenleben, und nichts von mir wissen, ähm ich war drei Jahre, hat Mutter gesagt, er hat mir eine Bundeswehrjacke geschenkt (....) ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, dass er nicht von mir wissen will, ob er sich so verhält und nichts von mir wissen will!“ (Schweigen über 20 Sekunden) 483
Der Biograph berichtete weiter, dass er weder über den Vater oder seine Verwandt-schaft etwas wisse, noch über seinen Aufenthaltsort. Er vermute ihn in Berlin. „Ich habe nur eine Großtante, Fr. N. liegt aber im Sterben. Die ist schon 92 oder so.“ Der Biograph konnte auch auf Nachfragen keine Auskünfte, keine Daten, Strukturen (Na-men, Wohnorte), Geschichten oder Anekdoten (Familienfeiern oder Treffen) zu sei-ner Familie oder Verwandtschaft wiedergeben. „Ich erinnere mich lediglich an einen Besuch vor fünf Jahren. Doch war ich viel zu bekifft gewesen, ich war da ganz schüchtern und desinteressiert aufgetreten, außerdem hab ich meine Mutter seit fünf Jahren nicht besuchen dürfen!484“
Der Biograph berichtete im Anschluss überraschend und plötzlich ohne diese fol-gende Erzählung in eine zeitlichen Struktur zu verankern von einer Begegnung, als er zuletzt seine Mutter „dort oben besuchte, dann bin ich durch die Dörfer gelaufen (Pause 6 sec.) wie in einem Film, der abläuft, dann hab ich festgestellt, dass ich nicht so klug bin, äh um irgendwie ein Business zu machen, oder so äh da waren auch Leute, die cool aussahen und aus mir was machen wollten. Aber irgendwie (….) Ich wollte nur kiffen, keine Lust dazu oder nicht einmal das wollt ich machen, nicht ein-mal des, ich konnte mich dafür nicht begeistern. Ich weiß auch nicht, ob das je der Fall war? Interviewer: „War das real oder ein Traum? Für was haben Sie denn jemals Begeisterung, Freude empfunden?
483 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 25 Zeile: 961-1038 484 Falldarstellung 4, Interview 1, S. 26, Zeile: 900-908
296
„Das weiß ich gar nicht, eigentlich! (…) Für Skateboard fahren, sehr gerne habe ich Fußball als Kind gespeilt, oder eine Holzhütte im Wald gebaut Das war dann al-les“!485
Im 2. Interview, gibt der Biograph für die frühzeitige Inobhutnahme der Kinder, die durch das Jugendamt erfolgte als Erklärung an: „…da die Mutter ähm es hieß, sie wäre psychisch krank, hat Schizophrenie oder so, Mutter wollte aber die Kinder ha-ben (…) damals musste das so sein, aber inzwischen (20 Sec Pause.)
Auf die Frage hin, ob der Biograph noch über weitere Erinnerungen zur Vergangen-heit verfüge, äußerte er …Meine Vergangenheit interessiert mich fast gar nicht mehr, die Zukunft ist viele wichtiger„ (Int. 2, S. 2-3 Z: 58-61) Nach längerer Erinnerungs-pause und Raucherpause, die 25 Minuten anhielt, reproduzierte der Biograph fol-gende Erinnerungen über seine Jugendzeit und den Übergang als er damit konfron-tiert wurde, er sei psychisch krank (….) im Heim.
Der Biograph präsentierte die Erinnerungen im szenischen Präsens, bei der Narration verzieht er angeekelt oder entsprechend schmerzverzerrt sein Gesicht, gerade so, als erlebe er gegenwärtig die Gewalt erneut.
„Bisschen Disco, bisschen depressiv, alles ein bisschen kompliziert geworden für mich,, Freunde haben sich nicht um mich gekümmert, sich nicht interessierte (schnauf laut auf) alle waren gegen mich gewalttätig, Gewalt war um mich herum, die Russen haben gesagt: Gib mir deinen Alkohol, die Türken haben gesagt -Los, mach des, mach des! Dann mein Bruder auch (..) ich habe gedacht, (verzieht sein Gesicht zu einem schmerzverzerrten Ausdruck und wird sehr laut) Ich komme da nicht mehr raus, ich war jahrelang in psychischer Verfassung, genau unten ähm ich bin sterbenskrank, und ich kann meine Lage nicht verändern.“486
Direkt nach der Erzählung bricht die dicht aufgeladene Gesprächssituation bei Hrn. Noller ab und er entspannte sich wieder als er von seinen Hoffnungen berichtete, die er mit dem Umzug nach Stuttgart assoziierte.
Er erlebte den Übergang vom Jugendheim nach Stuttgart so. ..die Attraktion, die Fas-zination der Großstadt als junger Mensch war groß, „weil dort ist viel los, ich kann direkt viel Geld verdienen, Party machen, Alkohol, Drogen, chillen… hab gedacht, dort kümmert sich keiner um mich, ich könnte mich freier bewegen, ich könnte dort alles so machen, was ich will, ich verdiene scheiß viel Geld und beantrage dann Rente und so“ 487.
Er berichtete anknüpfend ausführlich eine Szene zu den urbanen Verführungen, am Beispiel eines Mitbewohners im Heim, der es, so resultierte der Biograph, nur auf sein Einzelzimmer abgesehen hatte. „Komm (süßlich-verführerisch Stimme), wir trinken einen! Dein Zimmer will ich haben (tiefe veränderte Stimme)!“ Dann habe ich aus dem Fenster gekotzt, war jeden Tag eine Wodkaflasche, aber der hat mich
485 Falldarstellung 4, Interview 1, S. 28-29. Zeile: 994-1010. 486 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 3-5, Zeile: 104-158. 487 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 6-7, Zeile: 205-253.
297
versorgt, der hat es darauf angesetzt (wieder in sirenengleich-verlockender Stimm-lage) ein schönes Zimmer mit TV und Telefon und Kühlschrank!“ 488
Als Erklärung, warum der Biograph in ein geschlossenes Heim musste, präsentierte er überraschende Motive und Zuschreibungen: „Die Mutter habe ja die Wohnung in Stuttgart aufgekündigt, deshalb musste er in die Klinik“. Der Suizidversuch mit einer Überdosis Heroin, die er sich auf dem Weg zur Mutter einverleibte und dann tagelang durch Düsseldorf umherirrte bis er von der Polizei nach Stuttgart überführt wurde, ist beim Biograph nur als bruchstückhaftes Puzzle memoriert.489
Der Biograph thematisierte in der Folge, angeregt durch das Thema Suizidversuch, wieder die Bedeutung und das Verhältnis zum Bruder, vor allem die Schlüsselsitua-tion, in der er von ihm angeschossen wurde.
Der Biograph unternimmt Versuche, das unkontrollierte Handeln seines Bruders zu rechtfertigen und zu erklären. „Ich habe vorher (kurze Zeit vor den Schüssen) schon ne komische Stimmung erlebt, als ob sich etwas anbahnt, ich soll mich vom Acker machen (sagte eine Stimme zu ihm selbst), mein Bruder war schon aggressiv und zornig, zuvor haben wir Psycho angeschaut und meine Mutter hatte Herrenbesuch. Ich habe die Filme gut verkraftet, mein Bruder nicht so, ich hab also ähm Schuld an der Sache, vielleicht hab ich ne abfällige Bemerkung gemacht über ihren Freund. Nach dem Schusswechsel wurde der Kontakt zur Mutter verboten.
Die Situation erzählte und reinszenierte Hr. Noller wie in einem Theaterstück mit verstellten Stimmen und genauer Anordnung in seinem Wimmer und zeigt, wo er und wo der Bruder stand: …Er hat auf mich so gezielt und gesagt: (tiefe Stimme) Los, sag mir was los ist, wer du bist? Nimm jetzt die Waffe runter! Leg sie da (deutet Platz an) hin! Ich habe dann gesagt: Ich kann es dir aber nicht sagen! Des mach ich jetzt nicht so!“ Dann hat es Bumm (2 Sec.) Bumm hats gemacht (wirft sich zurück und greift sich an den Hals). Ich bin dann in die Wohnung und hab mich im Spiegel, das ganze Blut am Hals gesehen (10 Sec ) Wachkoma im Krankenhaus bin dann (….) operiert worden und so.490“
Der Interviewer fragt, ob er den weiterhin ein komisches Gefühl seinem Bruder ge-genüber habe?
B: „Wo habe ich ein Gefühl?..achso ja, ich bin nicht mehr so frei in meiner Körper-haltung, ich vertraue den Menschen nicht sehr. Mein Bruder ist unberechenbar, ein ganz anderer Typ. Der Biograph präsentierte ein Beispiel der willkürlichen Gewalt, die er seinem Bruder gegenüber ausgesetzt war. „Der Bruder hat mich ihn sein sein Zimmer befohlen ah, nach dem ich dann niederknien musste, hab hat hat er mir voll mit der Faust (ballt seine rechte Faust und zeigt sie nach vorne) ins Gesicht geschla-gen. Hä! Da war ich empört! Das macht man doch net!“
Der Biograph erklärte kurz darauf verständnisvoll: „ Mein Bruder konnte ein paar Sachen nicht. Gefühle deuten und wahrnehmen und so, er konnte im Gegensatz zu
488 Falldarstellung 4. Interview 2, S. 8-9. Zeile: 284-338. 489 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 9-19, Zeile: 360-410. 490 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 11-14, Zeile: 440-525.
298
mir sagen, was ihm nicht passt, aber was in ihm drin losgeht, konnt er nicht ausdrü-cken. Ich habe ihm immer gesagt, er müsse da dran arbeiten, da was machen! Das war nicht schlau. Er war auch Epileptiker. (10 Sec.) Er hat immer eine drauf gesetzt. Als ich die Kaufmann-Schule besucht habe, hat er studiert, ähm als ich zur Mutter ziehen wollte, hat er das dann gleich gemacht und für mich war kein Platz mehr.“ Eine weitere Szene assoziierte der Biograph: „Bevor er sich umgebracht hat, hat, hat gab es eine Szene in meinem Kopf. Ich war in meinem Zimmer und er hat gesagt. Komm zu mir! Komm jetzt her! Jetzt mach dies und jetzt mach das. Er wollte mich zu einem Wunder auffordern, dass ich eines vollbringe. Aber ich hab nicht so fleißig daran gearbeitet“. 491 I: Wollten Sie ihn heilen? B: Was heißt hier heilen! (lautstark) Ja auch! Ich lebe ich sehe mich nicht als krank. Er wollte mein Betreuer werden, er hat für mich gesprochene, er (Stimme wird ganz leise) stand mir eigentlich im Weg! In der Disco hat er mich beschützt, vor den, die mich bedroht haben, dann wenn Frauen nichts von mir wollten ….mein Bruder hat das geregelt. Er hat mich bedroht, wie ein Fremder, blockiert (5 Sec.) ich wollte leben frei sein, er war ein Jahr und neun Monate älter ..ich hab sein Verhalten nie nachvollziehen können.492“
Ich habe Tics im Kopf gehabt (Zwangsgedanken für einen Amoklauf), mich optisch verändert, nicht mehr so normal ausgesehen, bisschen ungepflegt ich bemitleidete mich, weiß nicht wie?493
Körperliche Veränderungen ,,warum ich mit Tesafilm mir Augenbrauen rausgezogen habe, direkt nach dem Kickboxtraining habe ich eine Frau gesehen, die da (zeigt ei-gene Brauen) rasieren zupfen, lass ich mir aufmalen, irgendwie reinbrennen, das will ich mir machen…das war aber mein Hauptproblem. Ich hab mein Hirn gesehen, als wäre es erst grün dann grau dann hat es wehgetan. Ich dachte immer schläft doch mein Leben ein, es wird schon noch gut ausgehen mir ging es aber jahrhundertelang komisch.494“
Zu Stärken.. (lange Pause 20 Sec.) ich fange mal mit Schwächen an..bin mir nicht sicher über meine Fähigkeiten, Stärken (…) dass ich halt so außergewöhnlich bin, nicht so bin wie die anderen, meistens zu viel ein bisschen wie ich mich verhalte ..dass ich nicht so Menschlichkeit beweisen kann. Aber wehre ich mich da draußen? Dass ich keine krummen Dinge drehe, nicht so frei bin, (…) ich denke dass am Ende alles gut wird. Mit 50 oder 60!495
Der Biograph schließt mit einem erinnerten und von der Mutter überlieferten Bericht über die letzte Begegnung mit dem Vater ab, als er drei Jahre alt war. Der Vater habe ihm eine Bundeswehrjacke hinterlassen, -er trage ja bis heute „ ausschließlich Army-Look, wenn er ausgehe. Ich glaube er lebt in Berlin..Irgendwann werd ich mal dorthin fahren, ich war noch nie in Berlin. 496“
491 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 14-17, Zeile: 552-642. 492 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 18-19, Zeile: 662-736. 493 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 21, Zeile: 815-827. 494 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 22-23, Zeile: 828-873. 495 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 23-25, Zeile: 889-980. 496 Falldarstellung 4, Interview 2, S. 27-28, Zeile: 1034-1039.
299
6.4.3.1. Hypothesenbildung zum erzählten Leben
Die gesundheitliche Verfassung in den beiden Interviews hat sich grundlegend unter-schieden. Während der Biograph sich beim ersten Interview angespannt, unkon-zentriert und fahrig präsentierte, zeigte sich Hr. Noller beim zweiten Interview in einer stabilen und aufgeschlossenen Verfassung. Er zog sich extra für das Interview ein Jackett an. Durch eine testosteronabsenkende Behandlung hatte Hr. Noller ein akne- und abszessfreies Gesicht bekommen. Er trug eine neue Brille und übernahm gekonnt die Rolle des Gastgebers.
Der Biograph erlebt sich in einer Dauerschleife aus Fremdbestimmung, in der er hin und her geschupst wurde und in der er orts- und personenunabhängig, die Rolle des Opfers einnimmt.
Im Zuge einer Fremdattribuierung weist er die Schuld und Verantwortung immer wieder auf andere. Er selbst wolle ja nicht, aber er könne sich ja nicht wehren! Auf die negativen Erlebnisse, die finanziellen und gesundheitlichen Schäden, die materi-ellen Ausbeutungen, die Gewalt, die Kündigungen aus Einrichtungen, die beendeten Freundschaften und häufig wechselnden Beziehungsabbrüche scheint der Biograph keinen Einfluss zu haben.
Der Biograph befindet sich seit seinem 2. Lebensjahr in Heimen und Institutionen und ist somit durch seine, innerhalb der Heimkarriere angeeigneten, Unterbringungs-artefakte geprägt. Sowohl chronifiziertes institutionszentriertes, subkulturelles Ver-halten, als auch ein, nach außen hin möglichst unauffälliges Verhalten des Unterle-bens, um den Sanktionen und Konsequenzen zu entgehen, charakterisiert und durchdringt die Selbstpräsentation des Biographen. Der Begriff des Unterlebens ist ein Begriff, der aus dem Zusammenhang der totalen Institutionen entliehen ist. Dort entwickelt sich ein Unterleben als eine Form der sekundären Anpassung, unter kal-kulierter Nichteinhaltung von Regeln in der total normierten Anstalt zu überleben und Freiräume und Ressourcen zu gewinnen.497 Auf der anderen Seite kann es auch für die Stabilität von Institutionen funktional sein, diese Nichteinhaltung zu dulden.
Nach STIERLIN beschreibt der Biograph einen in der Familie überwiegend erlebten Ausstoßungsmodus (hierbei kommt es zu einer durchgängigen Vernachlässigung und Zurückweisung des Kindes) wie auch einen erlebten Bindungsmodus, der von einer elterlichen Interaktion mit dem Kind ausgeht, die durch ein starres Festhalten im el-terlichen Gesichtskreis geprägt ist und typischerweise einen emotionalen Einschluss und symbiotischen Verbleib innerhalb des Familienghettos zur Folge hat.��
Die selbstverständliche Anspruchshaltung des Biographen auf eine auskömmliche Versorgung durch den Staat wird an vier Stellen der Interviews erwähnt. Er geht da-von aus, dass er für das schwere und lange Leid, das er ertragen habe, zu entschädigen sei. Er erwarte eine Wiedergutmachung (Rente, Wohnung, ohne gesetzliche und in-stitutionelle Betreuung) und dafür, dass ihm fremdbestimmt ein Platz außerhalb der
497 Goffman, E. (1974): a.a.O. Asyle
300
Familie zugewiesen wurde, dass er ortsunabhängig Gewalt erlebte. Die rentenversi-cherungsrechtlichen Voraussetzungen ignorierte der Biograph standhaft, da es sich hier um einen besonders schweren Fall handle.
Der Biograph verbindet mit dem Umzug vom Land in die Großstadt die Hoffnung und das Ziel, sich endgültig dem Gesichtsfeld der Sozialen Arbeit, der gesetzlichen Betreuung und der Psychiatrie zu entfliehen. Er hoffte auf ein Leben in Anonymität, wo sich eh niemand um ihn kümmern wird und er grenzenlos und bedürfnisorientiert alles machen könne, was er wolle, ohne dabei ein Regelwerk zu beachten. Ein Leben im Rausch.
Der Bruder, der nach der Heimkarriere zur Mutter zog, erlebte im Gegensatz zum Biographen einen Delegationsmodus,, d.h. er wird an der langen Leine im Sinne STIERLINS gelassen, dennoch kann auch er sich nicht weiter ablösen und erkrankt durch ein Nicht-Erwachsen-Werden-Können an einer schweren psychischen Erkran-kung, konsumiert Drogen, zeigt Impulskontrolldurchbrüche, durch und anlässlich der Interaktion mit der Mutter, die ihn rundum zu versorgen und ein stationäres Heim zu ersetzen versucht. Der Bruder muss in regelmäßigen Abständen in die Psychiatrie und wird dort auch gerichtlich untergebracht. Die ambivalente Beziehung zum Bru-der, der beschützt, der blockiert, der bedroht und willkürlich gewalttätig ist und sei-nen Frust und Zorn sadistisch am Biographen auslässt, wird erst durch den Suizid aufgelöst und als Befreiung empfunden.
Der Biograph bezieht sowohl den Weggang des Vaters, (Wäre ich nur nicht da!), den Suizid des Bruders (Hätte ich mich mehr angestrengt, ich hätte ihn heilen können!) stets auf sich. Im Anderen betrachtet der Biograph stets den Verführer, dem er willen- und widerstandslos ausgeliefert sei. Im Selbstbild und in der Selbstüberzeugung bleibt er wie folgt verhaftet: Ich bin nichts und darf auch nicht sein! Empfindungen und emotionales Binnenerleben kann der Biograph nicht wahrnehmen, identifizieren und aussprechen. Lediglich im Rauschzustand bekommt er Zugang zu seiner emoti-onalen Lebenswelt, die er jedoch mit unrealistischen, unkontrollierten und grotesken Entwürfen artikuliert. Er spricht dann von einer Familiengründung, von einer eigenen Wohnung, vom Führerschein und einem Ort, an dem er in Ruhe gelassen wird. In diesen Phasen kann der Biograph auch sein schwelendes Identitätsdilemma themati-sieren und danach fragen, was ihn ausmache und wer er eigentlich sei? Er äußert dann den Wunsch nach einer plastischen Veränderung im Gesicht und einer grundlegenden körperlichen Modifikation.
Der Biograph zeigt sich einerseits einfühlsam und empathisch gegenüber anderen, z. B. gegenüber dem Bruder und beschreibt detailliert die mögliche Motivlage, den Frust und die Grenzen seiner Person. Andererseits gelingt ihm, auf sich selbst bezo-gen, keine bzw. kaum eine menschliche Gefühlsreaktion wahrzunehmen. Er gibt vor, es mangele ihm grundsätzlich an Menschlichkeit, so bleibt sowohl seine Stimmungs- und Gefühlslage, als auch seine Gedankenwelt oder seine Vorhaben zu geplanten Handlungsabfolgen für die Umwelt diffus und inkongruent.
301
6.4.4. Fallspezifische Interpretation und Rekonstruktion der Fallgeschichte
Sobald sich der Biograph innerhalb des Familienkreises aufhält, erfährt er eine Aus-stoßung, hingegen für die gesamte Zeit der institutionellen Aufenthalte, die absicht-lich weit weg und geschützt vor dem Einzug der Mutter ausgewählt wurde, erlebte der Biograph hingegen einen Bindungsmodus und eine nicht nachlassende, aufdring-liche Manipulation der Mutter, die ihren Sohn aus den Fängen der Institutionen zu befreien versucht.
In den Narrationen kommt es immer wieder zu einem Wechsel von Traum, Erlebtem, Fiktion und Irrealem. Andere, Dritte, geben fremdbestimmt dem Biographen vor, wo und wie er zu leben hat und welche Hilfen den Behandlungsrahmen definieren. Ich will von alledem nichts, was ich aber will, bleibt im Verborgenen, im Ungewissen, im Unbekannten.
Durch die frühzeitige Heimunterbringung entwickelten sich beim Biographen starke Ängste vor dem Leben, vor anderen, vor Veränderungen. Sie begleiten ihn und halten sein Identitätsdilemma nach wie vor aufrecht.
Pubertätsängste können als allgemeine Lebensängste beschrieben werden. So muss und will der Jugendliche weg vom Alten, ohne dabei das Neue zu kennen. Die Fragen „Wer bin ich?“, „Wer war ich?“ und „Wer will ich sein?“, bestimmen bewusst und unbewusst das eigene Denken, Wollen und Handeln sowie sicherlich die zentrale Frage, werde ich die Person, die ich mir vorstelle zu sein, auch erleben?
Beim Biographen ist auf der Grundlage des vorangegangen Exkurses, der einen Zu-sammenhang zwischen kleinkindlicher Heimunterbringung und die weitere gesund-heitliche Entwicklung nachweist, davon auszugehen, dass durch frühe lebensbedroh-liche Mangel- und Unterversorgungserfahrungen, durch traumatisierende Bindungs-erfahrungen bereits grundsätzliche Auswirkungen auf die gesundheitlichen Stabilität, die Widerstandskraft und das seelische Befinden und Erleben, zu erwarten waren.
Der Biograph zeichnet sich durch Ängste vor Neuem und vor Veränderungen aus. Er zeigt Kontaktängste, soziale Auffälligkeiten und verhindert im Gespräch den Blick-kontakt. Er trägt seine Interessen nur in einer bedrängenden und fordernden, teils dro-henden Präsentation vor. Im Zuge einer paranoiden Selbstüberzeugung, die davon ausgeht, andere wollen mir eh nur Schaden zufügen und ich kann somit niemanden vertrauen, hält er erfolgreich seine Mitmenschen auf Abstand und vermeidet somit Erfahrungen von Nähe und Intimität.
Initialisiert durch das Schlüsselerlebnis mit dem Bruder, bewahrt sich der Biograph eine hohe Faszination für Waffen. Er entwickelte dabei Zwangsgedanken, sich final vor der Schullasse zu erschießen oder im Zuge eines Amoklaufs, den er sich immer wieder vorstellt, wahllos Mitschüler und einzelne Lehrer zu erschießen. Der Besitz einer Waffe, die er in der Schultasche über Jahre mit sich führte, vermittelte dem Biographen Sicherheit und Schutz. Bei den Shooterspielen erlebte sich der Biograph als selbstwirksamer Dirigent des virtuellen Raumes und als machtvoller Vollstrecker, der über Leben und Tod, über Bestrafung und Rache verfügt und unter Umständen auch Gnade walten lassen kann.
302
Der Biograph präsentiert sich gerade bei den Feldern im szenischen Präsens, die sich mit den kategorialen Fragestellungen JASPERS auseinandersetzen: Ich bin, ich weiß nicht wer? Ich komme, ich weiß nicht wohin? Der Biograph stellt sich grundlegend die Frage nach der eigenen persönlichen aber auch sexuellen Identität und Prägung. Er stellt sich dauerhaft die Frage nach der Zielsetzung seines Daseins und der Aus-richtung seines Lebens. Der Bruder fragt den Biographen, so das Erinnerte, kurz be-vor er auf ihn schießt: „Los, sag mir wer du bist?“ Der Biograph findet darauf keine Antwort und keine Worte und wird im selben Moment mit zwei Schüssen niederge-streckt. Die Mutter stellte eine entscheidende Frage, nachdem sich der Biograph zum wiederholten Male eine Überdosis setzte und aus einer Einrichtung gekündigt wurde: „Wähle aus, Ausbildung oder Psychiatrie?“ Die Bedeutung, die hinter diesen Kate-gorien steckt, lautet: Du hast jetzt die freie Wahl und Willen. Wähle bewusst eine der beiden Optionen aus. Entweder du sprichst dich für eine Ausbildung aus (die Ausbil-dungsfähigkeit wurde wenige Wochen zuvor attestiert) und somit fallen deine Hand-lungsabsichten und dein Wollen zugunsten einer beruflichen und persönlichen Ent-wicklung und Autonomie aus oder du entscheidest dich für die Regression und den Stillstand, in einem schleichenden Selbstschädigungsprozess zu verharren und den bisherigen bekannten Institutionalisierungsprozess fortzusetzen. In der Folge muss der Biograph damit rechnen, seinen Verantwortungsrahmen und die optionale Ent-scheidungsvielfalt weiterhin symbiotisch in die Hände Dritter zu übergeben. Schließ-lich war auch die Sequenz indexikalisch aufgeladen, in der der Biograph ein Gespräch mit einem Mitbewohner des Heims reinszenierte, der es auf sein Einzelappartement abgesehen hatte. Sirenengleich lockte der Mitbewohner den Biographen, der sich bei jeder Versuchung, die in der Heimgemeinschaft passiert, bekanntermaßen nicht ab-grenzen kann, mit Alkohol und Drogen, die er ihm nicht selbstlos zur Verfügung stellte. Dem Mitbewohner und dem Biographen ist klar, wenn getrunken, konsumiert und randaliert wird, folgt eine fristlose Kündigung und der Ausschluss aus der Ein-richtung. „Komm! Ich will deine Wohnung, trink und konsumiere!“ Der Biograph hätte auch in diesem Entscheidungsmoment die Wahl gehabt, wählte aber die unmit-telbare Bedürfnisbefriedigung und den Rauschzustand und nimmt die Rolle ein, in der er sich bestätigt sieht, dass ihn seine Mitmenschen ausnutzen und deren Interessen auf seine Kosten befrieden. Dabei steht er ihnen ohne ein Zeichen des Widerstands und ohne dabei seine Identität und Grenzen zu akzentuieren, schwach und ausgelie-fert gegenüber.
Da die sprachliche Ausdrucksfähigkeit nicht ausreicht, rekonstruierte der Biograph die bedeutsamen Szenen wie in einem Theaterstück, mit verstellten Stimmen und Re-gieanweisungen.
Um einen wirksamen Einfluss auf das Wollen, das Denken und Handeln des Biogra-phen zu nehmen, übernehmen Dritte (Gericht, Betreuer, professionell Helfende etc.) diese Aufgabe, und übernehmen die Kontrollinstanz, die die wiederkehrende Eigen- oder drogeninduzierte Fremdgefährdung innerhalb ihres Gesichtsfeldes beobachtet, prüft, bewertet und entsprechende Maßnahmen und Interventionen ergreift, um Ge-fahren für den Biographen abzuwenden.
303
Eine grundlegende Verunsicherung, ob der Frage nach der Identität, ist beim Bio-graph soweit ausgeprägt, dass er sich auf eine hormonbeeinflussende Medikation ein-lässt. Er blickt im Verlauf seiner Heimkarriere auf ein frühes psychotisches Erleben und Wahrnehmen zurück. Er hört Stimmen, die ihm imperativ vorgeben, dass er sich z. B. die Augenbrauen entfernen oder eine Waffe mit sich führen soll, dass er Kör-perteile nicht als zu sich zugehörig erlebt. Der Biograph nimmt Stimmen und Kör-pererleben wahr, die vorgeben, sein Körper sei weder vollständig, noch befinde er sich sicher im richtigen Körper und Geschlecht. Er erkennt sich an manchen Tagen im Spiegel nicht mehr selbst, sondern sieht sich darin nur als Fratze abgebildet. Im Zuge eines coenesthetischen Empfindens, erlebt er sich in einem fragmentierten Kör-per bzw. Leib, der deformiert, unvollständig oder missgestaltet sei.
Der Biograph fordert eine körperliche Modifikation ein. Er sehnt sich, von einem untergewichtigen männlichen Körper aus, nach einem weiblich-androgynen Gesicht mit der Statur eines Muskelprotzes. Er strebt danach, so aussehen, wie einzelne Per-sonen, die er als Muster in einem Film (z. B. Hulk) sieht oder im zufällig im Fitness-studio erlebt hat.
Der Biograph artikuliert eine hohe Anziehungskraft in das Milieu hinein, in dem Dro-gen, Waffen, Subkultur, Gewalt, Methoden der Einschüchterung, der Manipulation, der Aggressivität, der Kriminalität und in dem die fortlaufende Demonstration und Selbstvergewisserung von Macht, hierarchischer Stellung und Einflussnahme bedeut-same und bestimmende Felder in der sozialen Interkation darstellen.
6.4.5. Typenbeschreibung und Typenbildung
Der Biograph in der Falldarstellung Nr. 4 stellt den Typ D dar, der negativ-abhängige Identitäts-Typ, der selbst in stationären und hochstrukturierten Settings nur schwer zu halten und zu behandeln ist. Er leistet großen offenen oder passiv-indirekten Wi-derstand gegenüber dem Betreuungspersonal. Er präsentiert sich mal enthemmt, mal angepasst, mal zurückgezogen, mal eigen- dann fremdaggressiv, er verstößt immer wieder gegen Hausregeln, Therapie- und Behandlungsvereinbarungen. Aufgrund der erlebten Bindungserfahrungen (fragmentierte Herkunftsfamilie, Heimkarriere, wech-selnden Bezugspersonen), lässt er sich weder innerhalb der Einrichtungen noch au-ßerhalb auf Beziehungen, Freundschaften ein. Kontakte die er pflegt, haben einen überwiegend subkulturellen Charakter von Nutzen und Kosten, von Versorgung und Profit, nach dem Grundsatz „quid pro quo“. Der Identitäts-Typ entweicht, flieht aus den Einrichtungen, um sich Geld zu beschaffen, Drogen zu konsumieren oder konsu-miert außerhalb aber auch innerhalb der Einrichtungen in einem polytoxikomanen Sinne Drogen, Alkohol. Er versucht sich mit anderen Mitbewohnern gegen die Be-treuungskräfte zu solidarisieren, mit ihnen zu entweichen, sie mit Drogen und ande-ren Gütern (Waffen etc.) zu versorgen.
Im gesamten Betreuungsverlauf ist beim Identitätstyp von einer negativen prognosti-schen Entwicklung auszugehen. Das bedeutet, wenn er das Plateau eines hochstruk-turierten Settings erreicht hat, haftet er dieser Betreuungsform an und transinstitutio-nalisiert nur noch in Richtung Straf- oder Maßregelvollzug oder er landet in der Wohnungslosenhilfe, in deren Lebenswelt er sich nicht behaupten kann. Den profes-
304
sionellen Helfern bleibt meist nur noch übrig, einen weiter strukturierenden, begren-zenden, kontrollierenden Umgang abzuleiten, und Gefahr für den Identitätstyp für andere abzuwenden, einzudämmen. Der Typ C verharrt in hoch strukturierten Ein-richtungen (z.B. psychiatrischen Klinik, Straf- oder Maßregelvollzug, geschlossene Einrichtungen, Suchteinrichtungen), die er immer wieder aus disziplinarischen Grün-den zu wechseln hat. Das kriminelle Milieu und die Drogenwelt üben eine große At-traktion auf den Biographen aus, im Sinne aus einer weitgehend fremdbestimmten Lebenswelt in eine Welt zu wechseln, die keine Regeln oder Restriktionen als die von ihm selbst definierten und die er selbst anerkennt.
305
7. Kapitel
����������������������� ���
7.1. Vorgehen bei der Heimaktenrecherche und der Kontaktgestaltung
Im Sommer 2011 habe ich zur Vorbereitung in Einrichtung1 hospitiert, um danach selbst in der Funktion eines Heimleiters für einen Träger ein Wohnheim mit 26 Plätze nach § 1906 BGB gemeinsam mit einem Kollegen, der für den zweiten Kooperati-onsträger verantwortlich war, aufzubauen. Innerhalb von drei Monaten erfolgte die Personalakquise von nahezu 20 Mitarbeitenden. In den weiteren drei Monaten wur-den die Bewohnerplätze belegt. Die Einrichtungsleiterin der Einrichtung1 stand be-ratend für die Dauer der Aufbauphase von Einrichtung2 als Einrichtungscoach zur Verfügung. Zu den Mitarbeitenden zählte auch eine Kollegin, die dann zwei Jahre später die Einrichtung3 mit 16 Plätzen eröffnen sollte. In Einrichtung2 habe ich mich von Anfang an mit der statistischen Erfassung der Daten der Bewohner beschäftigt, diese aktualisiert und in unterschiedlichen Kontexten, wie z.B. in Fachgremien, bei Tagungen und im Steuerungsgremien des GPV Stuttgart, sowie in der Hilfeplankon-ferenz (HPK) in Stuttgart vorgestellt. Mit den Einrichtungsleitungen von Einrich-tung1 und 3 nahm ich frühzeitig Kontakt auf, berichtete von meinem Vorhaben, eine sozialstatistische Erhebung für den Bereich der geschlossenen Versorgung in Stutt-gart durchzuführen. Beide Einrichtungsleitungen waren auf meine Anfrage hin bereit, einen standardisierten Fragebogen auszufüllen, bzw. die bisher für ihre jeweilige Ein-richtung gesammelten Daten, die ihnen vorlagen, zur Verfügung zu stellen.
7.1.1. Einführung zur quantitativen Studie der Gruppe der TSSP
Am Beispiel der Patientengruppe der TSSP, die durch eine quantitative Heimakten-recherche in der Versorgungsregion Stuttgart im Zeitraum 1.1.2005 - 31.7. 2013 be-schrieben und charakterisiert wird, ist der Gegenstand dieser Teilarbeit zu definieren. Es geht hierbei darum, möglichst detaillierte Daten zu generieren, die sich mit der Beschreibung des Personenkreises beschäftigen, aber auch Hinweise auf den bisheri-gen institutionellen Werdegang und Hilfebedarf liefern, sowie Aussagen anbieten, wohin die Klientel verlegt wird und mit welcher Verweildauer zu rechnen ist. Die Datenbestände sind in den drei Einrichtungen unterschiedlich ausgestattet und bisher nicht standardisiert erhoben. Eine Zielsetzung dieser ersten Vollerhebung könnte auch eine einheitliche, standardisierte sozialstatistische Datenerhebung und eine ge-meinsame Statistik der geschlossenen Einrichtungen der Versorgungsregion Stuttgart sein, aber auch als Modell für die konkret geplanten Einrichtungen nach § 1906 BGB in den angrenzenden Landkreisen ein.
306
Schaubild 6: Geschlossene Heimplätze im GPV Stuttgart von 2002-2018
� �������������������������������� �������!��!" �� �#��$�!��%&!��'
(��� )���������*���
)���������+�����������
)���������������
)���������������������������������������
���� ��������� � � �� ��
���� ������������������ ���
� ������� ��
���� ������ � �� ��
���� ����� !��"# $%�&#��'&��
� �� ��
�Quelle: Masanz, K.: Vortrag am 16.5.2013 in Freiburg i.B.: Bericht aus der Praxis am Beispiel einer Einrichtung der Eingliederungshilfe für Menschen, die wegen Eigengefährdung nach § 1906 BGB untergebracht sind; (Folie 2).
Erklärung des Schaubildes 6: Im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Stuttgart498 hat die Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. 2002 erstmals eine Ein-richtung für 16 Menschen auf der gesetzlichen Grundlage nach 1906 BGB gegrün-det.499 Nach 10 Jahren Heimbetrieb sind 29 der seit 2002 45 aufgenommenen Bewoh-nerinnen und Bewohner ins ambulant betreute Wohnen, drei sind in ein offenes Wohnheim und vier Personen sind zurück in ihre Primärfamilie entlassen worden. Für neun konnte keine Lösung gefunden und umgesetzt werden.
Schaubild 7:
+��,��#��������������������� ���������������������������� �������!��!"!��%
�
( �))���*#$#'+,�- ���������# # . /�0�)&����
498 In der GRDrs 302/2005 vom 7.6.2005 ist der GPV in Stuttgart und die Zusammenarbeit mit der Stadt Stuttgart, die Strukturen, die Aufgabenstellung und die Zusammensetzung definiert und beschrieben. 499 vgl. Ayena; D (2011): Backrezept für ein geschlossenes Wohnheim; In: Kerbe 2/2011; S. 22-24.
307
Erklärung des Schaubildes 7:
Im Zeitraum von 2002 bis 2010 ist der GPV Stuttgart mit 16 Plätzen für Menschen mit einem Unterbringungsbeschluss nach § 1906 BGB ausgekommen bzw. vom Be-darf her gesättigt gewesen. Der fachliche Widerstand aus der Sozialpsychiatrie selbst, wie auch von Seiten des Kostenträgers, war hoch und für die Dauer der Aufbauphase virulent und kontrovers. Im Gegensatz dazu begrüßten die psychiatrischen Kliniken das Angebot, den Ausbau der geschlossenen Plätze, wie auch die Möglichkeit, eigene Patienten, für die ein entsprechender Beschluss vorlag, zeitnah in Stuttgart unterbrin-gen zu können und nicht nach weit außerhalb vermitteln zu müssen. Es gab allerdings unterschiedlichste Erwartungshaltungen ob der Behandlungsmöglichkeiten, die eine geschlossene Einrichtung aus der Sicht der Kliniken vorzuhalten und durchzusetzen habe, wie z. B. Maßnahmen des Zimmereinschlusses oder des Fixierens im Bett etc. Erst nach einer Erhebung der Sozial- und Gesundheitsplanung der Stadt Stuttgart kam es zu einer aktualisierten Bedarfsschätzung von etwa 50-80 Plätzen insbesondere für junge psychisch kranke Stuttgarter, die mit Unterbringungsbeschlüssen in Hessen, im Schwarzwald oder im Schwäbisch-Fränkischen Wald in psychiatrischen Pflegehei-men betreut wurden. Der politische und sozialadministrative Wille forderte 2010 eine weitere Einrichtung. So entstand Einrichtung 2 mit 26 Plätzen und zwei Jahre später Einrichtung 3 mit weiteren 16 Plätzen. 2018 sind weitere 13 Plätze geplant, die Bau-genehmigung für diese Einrichtung wurde im August 2016 erteilt.
Im Folgenden wird die Anzahl der Bewohner, die im Zeitraum vom 1.1.2005 - 1.7.2013 in den drei Einrichtungen, Einrichtung 1-3, betreut wurden, zum Stichtag 1.7.2013 im Zuge eines soziostatistischen Samples zu unterschiedlichen Merkmalen dargestellt, beschrieben und interpretiert.
308
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
Plä
tze
gesa
mt (
Soll)
16
26
16
58
Anz
ahl d
er A
uf-
nahm
en/R
etou
r 57
/5
42/2
19
/0
118
Auf
nahm
erat
e p.
m.
0,5
2 2,
7 1,
7
Tab
elle
7:
Anz
ahl d
er B
ewoh
neri
nnen
im E
rheb
ungs
zeitr
aum
vom
01.
01.2
005-
01.0
7.20
13 in
dre
i Ein
rich
tung
en n
ach
§ 19
06 im
GP
V S
tutt
gart
309
Diskussion Tabelle 7:
Einrichtung1 wurde 2002 mit 16 Plätzen eröffnet, 2011 folgte nach einer aktualisier-ten Bedarfserhebung durch die kommunale Sozial- und Gesundheitsplanung der Stadt, die Etablierung von Einrichtung2 mit 26 Plätzen. Anfang 2013 erweiterte schließlich Einrichtung3 das Platzangebot für 16 weitere Bewohner. 5 der nach einer durchschnittlichen Verweildauer von 3,6 Jahren entlassenen Bewohner von Einrich-tung1 sind erneut wieder aufgenommen worden. In Einrichtung2 gab es im Untersu-chungszeitraum 2 sogenannte Wiederaufnahmen. In Einrichtung3 kam es aufgrund der kurzen Einrichtungsgeschichte von 7 Monaten noch zu keiner Wiederauf-nahme.500
Im Sommer 2011 wurde, wie angesprochen, der stationäre Bedarf für chronisch psy-chisch kranke und suchtkranke Menschen mit einem richterlichen Beschluss nach § 1906 ff BGB durch die Sozialplanung der Stadt Stuttgart mit ungefähr 50-80 Plätzen erhoben und definiert. Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Einrichtung 2 wurde noch von 65 Klientinnen ausgegangen, die fernab ihrer Heimatgemeinde in psychiatrische Pflegeinrichtungen versorgt und betreut wurden und denen der GPV Stuttgart ein Platzangebot unterbreiten wollte.
Im Jahr 2013 gab es allein im GPV Stuttgart ein Platzangebot von 58 Plätzen für Klienten, die nach § 1906 BGB, innerhalb der Eingliederungshilfe, aufgrund eigen-gefährdenden Verhaltens stationär geschlossen untergebracht werden konnten. Zum Zeitpunkt der Erhebung hat Einrichtung1, in einem Zeitraum von 103 Monaten 57 Bewohnerinnen und Bewohner aufgenommen. Das entspricht einer Aufnahmerate von 0,55 Bewohner/ per month). Einrichtung2 hat innerhalb des Erhebungszeitraums von 21 Monate 42 Aufnahmen (2/ p.m.), bei somit 16 Auszügen aufzuweisen. Ein-richtung3 hatte bei 2,71 Aufnahmen/ p. m. äquivalent 3 Auszüge zu verzeichnen.
Sowohl wiederkehrende Impulse, den Leistungsbaustein der geschlossenen Versor-gung zu etablieren, das jahrelange kontinuierliche Bestreben der Trägervertreter des GPV, als auch der offenkundige Wunsch kommunalpolitischer Initiativen haben dazu geführt, dass die Sozialverwaltung der Kommune eine Selbstverpflichtung und einen Anspruch als Kostenträger interpretierte, nämlich, diejenigen Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger, die bisher fernab ihrer Herkunfts- und Heimatgemeinde geschlossen ver-sorgt wurden, die Möglichkeit einer Rückkehr nach Stuttgart, in neu geschaffene und erweiterte Versorgungsangebote, zu ermöglichen. Die Klientel wurde bisher in psy-chiatrische Pflegeeinrichtung, auf der gesetzlichen Grundlage der Hilfe zur Pflege nach dem elften Sozialgesetzbuch (SGB XI), versorgt. Die Einrichtungen befinden sich überwiegend in privater Trägerschaft. Die Klientel bewohnt in den dezentral, im
500 Erwähnenswert ist, dass es in Baden-Württemberg, neben den drei Einrichtungen in Stuttgart, zum Zeit-punkt der Erhebung, lediglich ein geschlossenes Kleinwohnheim (10 Plätze) in Reutlingen gab. 2014 wurde im Landkreis Heidenheim, in Kooperation und in unmittelbarer Nachbarschaft der Psychiatrischen Fachklinik, ein weiteres Wohnheim mit 18 geschlossenen Plätzen eröffnet. In den von Stuttgart aus benachbarten Land-kreisen Ludwigsburg ist für 2017 ein Heim mit 18 Heimplätzen, im Landkreis Esslingen eines mit 16 Heim-plätzen in konkreter Planung. Der Landkreis Rems-Murr wägt im Zuge sozialpolitischer Rahmenbedingungen eine Einrichtung mit 8-10 Heimplatzen ab. Es gab z. Z. der Untersuchung lediglich planerische, konzeptionelle und architektonische Vorbereitungen, die sich mit den unterschiedlichen Bauvorhaben einer geschlossenen Einrichtung auch im Landkreis Böblingen auseinandersetzten.
310
ländlichen Raum verorteten Pflegeeinrichtungen meist gemeinsam mit pflegebedürf-tigen, älteren, demenzkranken oder mit geistig und körperlich behinderten Menschen Mehrbettzimmer. Sie teilen sich mit mehreren Bewohnern ein Bad, eine Toilette. Es besteht zwischen Personal und Bewohnern eine Kultur des Duzens, die Bewohner besitzen keinen eigenen Zimmerschlüssel. Der Betreuungsschwerpunkt liegt auf ei-ner medikamentösen Behandlung, einer Strukturierung der Tageszeit durch Essen, Kaffee trinken und Rauchen und einer täglichen Taschengeldauszahlung. Es gibt Ein-richtungen, in denen einmal pro Monat ein Friseur allen Männern denselben Kurz-haarschnitt verpasst. Es gibt Einrichtungen, die ihren Bewohnern zu jeder vollen Stunde eine Zigarette gewähren. Es gibt Einrichtungen, in denen das Pflegepersonal unangepasstes oder non-konformes, aufbegehrendes Verhalten der Bewohner mit dem Entzug von Zigaretten, Essen und Taschengeld sanktioniert. Es gibt Einrichtun-gen, die trotz der geringen personellen Ressourcenausstattung jedoch auch kreative und ideenreiche Beschäftigungen und Aufgaben für die Bewohner ermöglichen, die eine individuelle Hilfeplanung und einen respektvollen Umgangston pflegen.
Durch die ländlich-dezentrale Lage der Einrichtungen gibt es häufig keine Einkaufs-möglichkeiten. So werden z.B. einmal pro Woche (meist samstags) manche Bewoh-ner mit einem Einrichtungsbus in die nahe gelegene Kreisstadt zum Einkaufen be-gleitet. 501
Interpretation der Daten aus Tabelle 7
Die drei Einrichtungen befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung vom 01.01.2005-31.07.2013 in unterschiedlichen Arbeits- und Entwicklungsstadien. Während die Einrichtung1, in 2005 schon auf ein 3-jähriges Bestehen zurückschauen konnte, durchlief sie bereits eine Etablierungsphase, die durch eine konstante Teamzusam-mensetzung und einen routinierten Heimalltag gekennzeichnet war. Wesentliche und bedeutsame Arbeits- und Prozessabläufe waren zum Erhebungszeitraum entwickelt, und fest etabliert. Hingegen beeinflussen die häufigen Aufnahmen in der Aufbau-phase einer Einrichtung die Arbeitsweise, die Hausatmosphäre und die Stimmung in der Einrichtung. Einrichtung2 befand sich zum Zeitpunkt der Umfrage sowohl in ei-ner Aufbau- und Orientierungshase, als auch in einem Teamfindungsprozess. Bei ei-ner Fluktuation von knapp 30 % der Mitarbeitenden im ersten Betriebsjahr, wie in der Projektarbeit typischerweise zu erwarten war, musste sich noch eine stabile Teamzusammensetzung finden. Standardisierte Arbeitsabläufe des Tages und der Woche, standardisierte Schlüsselprozesse, wie z. B. die Dienstplanung, der Ablauf von Team- und Fallbesprechungen, das Aufnahme- und Entlassungsmanagement, die Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden, Dokumentationsstandards, Hilfeplanung,
501 Die Beschreibungen über die Tages- und Wochenstruktur in den einzelnen psychiatrischen Pflegeheimen, über den Umgang zwischen z. B. der Einrichtungsleitung oder dem Pflegepersonal und den Bewohnerinnen und Bewohnern, über die Möglichkeiten, Privatsphäre in den Zimmern und der Einrichtung zu wahren, wie z. B. persönlichen Wertgegenstände abzuschließen, sowie über die Sanktionen und Strafen habe ich in Einzel- und Gruppengesprächen (meist in der Gesprächsrunde zur Diagnoseübergreifenden Psychoedukation JENSEN und SARDRE-CHIRAZI) von den betroffenen Bewohnern erfahren. Die Erzählungen waren mit einem Gefühl von Scham, Machtlosigkeit, Willkür und Ausgeliefert-Sein über durch einen teilweise respekt- und würdelosen Umgang charakterisiert. Es gab hingegen auch viele sehr gute und positive Erfahrungen, über die berichtet wurden, von Einrichtungen, die sich engagiert um ihre Bewohnerinnen kümmern, die individuelle Hilfen auf der Grundlage der personellen und strukturellen Ausstattung ermöglichen, sowie kreative Beschäftigungsan-gebote entwickeln, eingebettet in einem familiär-persönlichen und respektvollen Umgangsstil.
311
betriebswirtschaftliches Controlling, Konzeption und Ablauf von Gruppenangeboten mussten im Rahmen einer Vorplanungszeit von knapp drei Monaten entwickelt wer-den. Als erste trägerübergreifende Einrichtung wirk(t)en in Einrichtung2 Gesetzmä-ßigkeiten von Projektarbeit, die durch eine kürzere Halbwertszeit von aufkommenden Themen, Teamvereinbarungen und teamdynamische Prozesse gekennzeichnet war.
Einrichtung3 war hingegen mit einer längeren Planungszeit von einem Jahr und einer konzeptionellen Abstimmung von geschlossener Versorgung auf die architektonische Umsetzung und Aufteilung, Anordnung und Ausstattung der Räumlichkeiten einer Einrichtung beschäftigt. Schon vor der Eröffnung standen Bewohner, die die Voraus-setzungen für eine Aufnahme erfüllten, bereit und wurden dann von Kliniken oder anderen Einrichtungen in einer moderaten zeitlichen Frequenz aufgenommen. Im ers-ten Jahr gibt es eine betriebswirtschaftlich, definierte Belegungserfordernis, von 2-3 Aufnahmen pro Monat zu bewältigen, um nach etwa 6-9 Monaten eine Vollbelegung der Einrichtung zu erreichen. Diese Vorgabe erfüllte Einrichtung2 projektbedingt in 3 Monaten (bei 10 Aufnahmen im ersten Betriebsmonat); Einrichtung3 erzielte bin-nen 5 Monaten eine Vollbelegung des Hauses und Einrichtung1 in etwa ½ Jahr.
Wie es sich in Einrichtung 1 gezeigt hat, vergehen mindestens 3-5 Jahre, bis sich ein stabiles Team, bestehend aus 75 % Stammpersonal, das langfristig in der Einrichtung beschäftigt bleibt und etwa 1/4 des Personals, das für kurze Zeit (1-2 Jahre) dem Team zugehörig bleibt, entwickelt. Zudem ist die Anzahl der arbeitssuchenden Fach-pflegekräfte (Kranken-, Heilerziehungs- oder Altenpflege) gering. Hinzu kommt, dass diese eher eine Tätigkeit in der Klinik oder in offenen Heimen als in geschlos-senen Einrichtungen bevorzugen.
Langfristig zeichnet sich in den geschlossenen Einrichtungen der Eingliederungshilfe eine Aufnahmerate von 0,5 p.m. ab, also alle 2 Monate wird ein Bewohner aufge-nommen. Sowohl Einrichtung2, die z.Z. der Erhebung zum 31.7.2013 nach 19 Mo-naten Laufzeit bei 2 Aufnahmen/p.m. als auch Einrichtung3, die bei 2,7 p.m. inner-halb von 7 Monaten Betriebszeit liegt, nähern sich prospektiv im Laufe der weiteren Betriebsjahre an eine durchschnittlichen Aufnahmerate von 0,5 pro Monat an.
312
������
����
� �
����
��-�#�
����
)����
E
inri
chtu
ng 1
E
inri
chtu
ng 2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
Dur
chsc
hnitt
in
Ja
hren
(m
ännl
ich/
wei
blic
h)
36
(k. A
.)
39
(36/
43)
41
(43/
40)
38,6
20-3
5 J.
: „D
ie J
unge
n“
21
19
6 46
36-5
0 J.
: „M
ittle
res
Alte
r“
26
12
7 45
51-6
5 J.
: „R
eife
s A
lter
“ 10
11
6
27
57
42
19
11
8
Tab
elle
8:
Alte
r, A
lters
vert
eilu
ng u
nd A
lters
grup
pen
Zu
Alt
ersg
rupp
en:
•
In E
inri
chtu
ng1
wir
d be
i de
r A
lter
skla
sse
„Die
Jun
gen“
vom
20.
-35.
Leb
ensj
ahr
eine
wei
tere
Dif
fere
nzie
rung
vor
geno
mm
en:
18.-
20 L
bj.:
1; 2
1-25
Lbj
.: 7;
26-
30 L
bj.:
4; 3
1-35
Lbj
. : 9
. In
der
Ein
rich
tung
2 gi
bt e
s in
der
Alte
rsgr
uppe
vom
18.
-20
Lbj
.: 0;
21
.-25
. Lbj
.: 6;
26.
-30.
Lbj
: 9 u
nd 3
1.-3
5. L
bj: 4
. In
Ein
rich
tung
3 be
im 1
8.-2
0. L
bj :1
; 26.
-30.
Lbj
: 2: 3
1.-3
5.L
bj: 3
. •
In d
er A
lters
klas
se d
es „
Mit
tler
en A
lter
s“,
vom
36.
-50.
Lbj
. is
t di
e V
erte
ilun
g au
f di
e E
inri
chtu
ng1:
36.
- 40
. L
bj.:
8; 4
1.-
45.
Lbj
.: 9;
46.
- 50
. Lbj
.: 9.
In
Ein
rich
tung
2: 3
6. -
40.
Lbj
: 4; 4
1. -
45.
Lbj
.: 4;
46.
- 5
0 L
bj.:
4. I
n E
inri
chtu
ng3:
36.
-40.
Lbj
: 2; 4
1.-
45. L
bj.:
5.
•
In d
er A
lter
skla
sse
des
„R
eife
n A
lters
“ v
om 5
1.-6
5. L
bj.:
In E
inri
chtu
ng1:
51.
Lbj
.-55
.Lbj
.:3;
56.L
bj.-
60.
Lbj
.:2,
61.L
bj.-
56.
Lbj
.:5.I
n E
inri
chtu
ng 2
: 51.
- 5
5. L
bj: 9
; 56.
- 6
0. L
bj.:
2; 6
1. -
65.
Lbj
.: 0.
Ein
rich
tung
3: 5
1. -
55.
Lbj
.: 5,
56.
-60.
Lbj
.: 1,
61.
- 6
5.
Lbj
.: 0
313
Diskussion der Tabelle 8:
Bei der Ermittlung des Altersschnitts zum Zeitpunkt der Stichtagserhebung vom 31.7.2013 ergibt sich im arithmetischen Mittel ein Lebensalter von 38,6 Jahren in den drei teilnehmenden Einrichtungen, bezogen auf den Zeitpunkt der Aufnahme. Da Einrichtung1 bei der Geschlechterdifferenzierung keine Angaben macht, ist in der Tendenz davon auszugehen, dass die Männer ungefähr 36 Jahre, die Frauen hingegen im Schnitt eher 42 Jahre sind.
Hervorzuheben sind die unterschiedlichen Gewichtungen und Verteilungen der defi-nierten Altersklassen auf die drei Einrichtungen im GPV Stuttgart mit gleichem Leis-tungstyp.
„Die Jungen“: stellen die Altersgruppe vom 18.-20. Lebensjahr, vom 21.-25. Lebens-jahr und vom 26.-30. Lebensjahr sowie vom 31.-35. Lebensjahr dar.
Das „Mittlere Alter“ umfasst folgende Altersgruppen: 36.-40. Jahr; 41.-45. Jahr und das 46.-50. Jahr. Das „Reife Alter“ umfasst hingegen das 51.-55. Jahr; das 56.-60. Jahr und das 61.-65. Lebensjahr. In Einrichtung1 gibt es besonders in der Altersklasse des „Mittleren Alters“, von 36-50 Jahren, bei einem Wert von 45,6% eine Häufung im Verhältnis zur Gesamtzahl. In Einrichtung2 gibt es bei den „Jungen“ von 18-35 Jahren eine Konzentration bei 45,2 %, während in Einrichtung 3 eine heterogene Ver-teilung der Aufnahmen auf alle drei Altersgruppen zu je 1/3 ausfällt.
Interpretation der Daten aus Tabelle 8:
Es liegt die Frage zugrunde, ob die Verteilung der Altersgruppen auf die drei Ein-richtungen zufällig eingetreten ist oder ob es bekannte Einflussgrößen gibt, die zu einer Fokussierung und spezifischen Gewichtung der Bewohnerstruktur in Einrich-tung 1 z.B. bei der Gruppe des „Mittleres Alters“ und in Einrichtung2 bei der Gruppe der „Jungen“ geführt haben? Beim Aufnahmeprozedere erfolgt grundsätzlich eine Vorstellung in der Hilfeplankonferenz (HPK), in der alle Träger des Wohnens, der Kliniken, der Rehabilitation, sowie die Kostenträgervertreter zusammenkommen und in der die Heimleitungen von den Einrichtungen 1-3 einen festen Sitz in der HPK haben. Die Heimleitung von Einrichtung2, so die Hypothese, hat sich, ob des persön-lichen Faibles, für die Gruppe der „jungen Wilden“, eher für eine Aufnahme der Al-tersgruppe der „Jungen“ ausgesprochen. Ein weiterer Einfluss könnte der Alters-schnitt des Betreuungspersonals in Einrichtung2 sein, der zum Stichtag, bei knapp unter 30 Jahren lag, während in Einrichtung1 und Einrichtung 3 ein Großteil der Mit-arbeitenden zwischen 40-55 Jahren ist. Der Zugang, die Referentialität und Nachvoll-ziehbarkeit der Alltags- und Lebenswelten der Altersgruppe der „Jungen“ ergab im Zuge einer sukzessiven Personalbesetzung und Einstellung in Einrichtung2 eine kon-zentriertere Aufnahme von jungen Bewohnern, als es in den beiden anderen Einrich-tungen2+ 3 der Fall war. Den Konsum von Drogen in der Einrichtung zu vermeiden, und den Weg der Drogen in die Einrichtung und den Transport aus der Einrichtung heraus zu unterbinden, sowie den Binnenvertrieb von Drogen und die missbräuchli-che Einnahme von Medikamenten zur Selbstbehandlung und Selbststimulation oder als subkulturelles Zahlungsmittel aufzudecken und Alternativen aufzuzeigen, ist ein singuläres, spezifisches Betreuungsthema von Einrichtung2.
314
Die Altersgruppe „Die Jungen“ ist sowohl durch frühe und schwerwiegende Bin-dungsstörungen als auch durch familiäre und sozioökonomisch bedingte Hemmnisse, stark vorbelastet. Der erforderliche Einsatz von pädagogisch-erzieherischen Metho-den und Inhalte, um Nachreifungsprozesse zu bahnen und zu ebnen, steht in einem Widerspruch zum professionellen Selbstverständnis und Umgang zwischen Helfer und Klient innerhalb der Eingliederungshilfe. Dieser Anspruch von pädagogischen Inhalten oder Zielvereinbarungen spielt gerade bei der Gruppe des „Mittleren Alters“ und „Reifen Alters“ keine bzw. eine geringe Rolle.
Zu den spezifischen Betreuungsinhalten der Gruppe „Die Jungen“ gehören unregel-mäßige Atemalkoholkontrollen, Multi-Drogenscreenings, Taschen- und Zimmerkon-trollen sowie soziale Kontrollen. Im Schnitt werden in der Hilfeplankonferenz des GPV Stuttgart seit 2011 zwei Falleingaben für einen Platz nach § 1906 BGB inner-halb der Eingliederungshilfe vorgestellt.
315
�����������
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
män
nlic
h/R
etou
r 30
/3
24/1
10
/0
64 (
54,2
%)
wei
blic
h/ R
etou
r 27
/0
18/1
9/
0 54
(45
,8%
)
gesa
mt
57
42
19
118
Tab
elle
9:
Ges
chle
cht u
nd G
esch
lech
terv
erte
ilung
Dis
kuss
ion
der
Tab
elle
9:
Die
Ges
chle
chte
rver
teil
ung
liegt
in
alle
n dr
ei E
inri
chtu
ngen
bei
54,
2% M
änne
rn u
nd 4
5,8%
Fra
uen.
Die
s en
tspr
icht
auc
h de
r G
e-sc
hlec
hter
vert
eilu
ng i
n of
fene
n st
atio
näre
n E
inri
chtu
ngen
der
Ein
glie
deru
ngsh
ilfe,
woh
inge
gen
sich
sow
ohl
bei
den
Lei
stun
gsba
u-st
eine
n de
s A
mbu
lant
Bet
reut
en W
ohne
ns,
als
auch
bei
den
Soz
ialp
sych
iatr
isch
en D
iens
ten
oder
in
der
ambu
lant
en S
ozio
ther
apie
da
s V
erhä
ltnis
auf
55-
59 %
Fra
uen
und
41-4
5 %
Män
ner
belä
uft,
so d
ie A
ussa
gen
der
Jahr
esst
atis
tiken
der
let
zten
Jah
re d
er L
IGA
de
r fr
eien
Woh
lfah
rtsp
fleg
e in
Bad
en-W
ürtt
embe
rg.
316
Interpretation der Daten aus Tabelle 9:
In Einrichtung2 gehören 2/3 aller männlichen Bewohner der Altersgruppe „Die Jun-gen“ an; bei ihnen liegen ergänzend zur psychiatrischen Grunderkrankung eine Suchterkrankung, sowie eine forensische Vorbehandlung oder eine strafrechtliche Verurteilung vor, die sie im Haftvollzug abgegolten haben. Der geringe Überhang bei den Männern hängt möglicherweise damit zusammen, dass diese im Schnitt früher erkranken und somit auch bedeutsame sozialisatorische Kompetenzen und kulturelle Grundtechniken nicht so umfänglich erwerben wie die Gruppe der Frauen, die im Schnitt später erkranken und zum Zeitpunkt der Ersterkrankung schon über die erfor-derlichen Fertigkeiten und Kompetenzen verfügen und somit auch eher in der Lage sind, diese wieder abzurufen.
Die genderspezifische Rollenzuschreibung und Einbindung in z. B. haushaltsprakti-sche oder erzieherische Aufgaben und Kenntniserwerb ist in diesen Bereichen auch gesellschaftlich bedingt und geprägt. Somit verfügen i.d.R. die Frauen eher über eine abgeschlossene Schulausbildung wie auch eine abgeschlossene Berufsausbildung als die männliche Bewohnergruppe. Bei der Altersgruppe „Die Jungen“ (männlich) kann von einem Einfrieren der Sozialisation der psychischen, sozialen wie auch emotiona-len Reifung gesprochen werden, was eine weitere Entwicklung und Ausdifferenzie-rung nur erschwert möglich macht. Die Einstellung und Haltung zu einer positiven und empfänglichen Hilfeannahmebereitschaft ist bei der Gruppe der Frauen eher ent-wickelt und ausgeprägt und im Sinne einer sowohl gesellschaftlich-familiären Rol-lenzuschreibung als auch einer genderspezifischen Prägung erlernt und erworben, als das bei der Gruppe der Männer der Fall ist. Das bedeutet, dass in schweren, auch in eigen- oder fremdgefährdenden psychiatrischen Krisen die Männer eher von Dritten bzw. außenstehenden Entscheidungsträgern über den weiteren Aufenthaltsort und den medizinische Behandlungsrahmen und Inhalt fremdbestimmt werden, als das bei Frauen der Fall ist502. Frauen nutzen und rufen prozentual eher ambulante Beratungs- und Wohnangebote innerhalb der Eingliederungshilfe ab, wohingegen Männer sich eher in stationären Einrichtungen oder in einem gesetzlich verpflichtenden Wohn- und Betreuungsrahmen befinden, in Kombination mit Sicherheits- und Bewährungs-auflagen.503
Auf der Grundlage von genderspezifischen Verhalten greifen Männer bei zwischen-menschlichen Konfliktsituationen und alltagspraktischen Problemstellungen eher auf eine körperlich-konfrontative Auseinandersetzung und Reaktionsmuster zurück, so-wohl innerhalb der Familie, als auch im öffentlichen Raum (z.B. durch Sachbeschä-digung), die allesamt eher institutionell durch Polizei, Ordnungsamt oder Gericht sanktioniert und beantwortet werden, als das bei Frauen der Fall ist.
502 Hinweise geben hier die Geschlechterverteilung im Strafvollzug (94% Männer zu 6% Frauen), im Maßre-gelvollzug (96% zu 4 % Frauen) sowie bei den Unterbringungen in einer psychiatrischen Klinik nach dem jeweiligen Landes-Psych KG oder dem Unterbringungsgesetz einzelner Bundesländer, wie z.B. Hessen, Bay-ern und Baden-Württemberg. 503 Statistik der Stadt Stuttgart zur Eingliederungshilfe im GPV Stuttgart. 2014
317
.�������
����
��
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
ledi
g (m
./w.)
49
(29
/20)
33
(x/
x)
17 (
x/x)
99
(83
,9%
)
gesc
hied
en (
m./w
) 5
(1/4
) 7
(1/6
) 2
(0/2
) 14
(11
,8%
)
Ver
heir
atet
(m
./w.)
3
(0/3
) 2
(0/2
) 0
5 (4
,2%
)
Ver
wit
wet
(m
./w.)
0
0 0
0
Sons
tige
(m
./w.)
0
0 0
0
Ges
amt
57
42
19
118
Tab
elle
10:
Fam
ilien
stan
d
Dis
kuss
ion
der
Tab
elle
10:
Inne
rhal
b de
s E
rheb
ungs
zeitr
aum
s si
nd 8
3% d
er B
ewoh
neri
nnen
der
dre
i Ein
rich
tung
en (
Anz
ahl:
99 (
83,9
%)
ledi
g, 1
4 (1
1,8
%)
sind
ge
schi
eden
, dav
on s
ind
es im
Ver
hältn
is 1
0 Fr
auen
zu
4 M
änne
rn u
nd 4
,2 %
(A
nzah
l: 5,
alle
s Fr
auen
) si
nd v
erhe
irat
et. I
nner
halb
der
dr
ei E
inri
chtu
ngen
fäl
lt di
e A
nzah
l der
ledi
gen
Bew
ohne
r be
i Ein
rich
tung
2 m
it 7
8,6
% a
m n
iedr
igst
en, b
ei E
inri
chtu
ng3
mit
89,
5%
am h
öchs
ten
aus,
woh
inge
gen
in E
inri
chtu
ng1
mit
86%
fas
t der
Mitt
elw
ert v
on 8
3,9%
err
eich
t wir
d.
Inte
rpre
tati
on d
er D
aten
aus
Tab
elle
10:
Der
frü
he B
egin
n de
r G
rund
erkr
anku
ng b
ei d
en M
änne
rn h
at m
assi
ve A
usw
irku
ngen
auf
die
Ent
steh
ung
und
den
Erh
alt v
on P
artn
er-
scha
ften
und
auf
ein
sex
uell-
inti
mes
Leb
en. D
er W
unsc
h, d
as B
edür
fnis
und
die
Seh
nsuc
ht n
ach
eine
r
318
Partnerschaft sind insbesondere bei der Gruppe „Der Jungen“ sehr hoch und werden im täglichen Kontakt häufig geäußert. Die Gruppe des „Reifen Alters“ hat sich im Laufe einer i.d.R. langen Krankheitsphase von dem illusionären Wunschbild einer Partnerschaft allmählich verabschiedet und gibt vor, dass sie mit sich selbst und ihrer Umwelt ausreichend beschäftigt und gefordert sei. Zudem wollen sie nicht auch noch ihrem Partner oder ihrer Partnerin zur Last fallen, die dann direkt die Auswirkungen der Krankheit und deren Folgen miterlebt. Ohnehin verlange ein partnerschaftliches Leben einen Raum von Intimität, Rückzug und Autonomie, der in einem geschlosse-nen Wohnheim nicht gegeben sei. Es gibt insbesondere unter den Männern eine große Gruppe der Jungen, die sagt, dass sie noch über keine oder nur marginale Erfahrungen im partnerschaftlichen Leben verfüge und in der aktuellen Lebenssituation gar keine Vorstellungen darüber habe, wie sie eine Frau oder einen Mann kennenlernen könn-ten. Die Gruppe der jungen Frauen hingegen steht allesamt in laufenden Partnerschaf-ten und hat mit dem geschiedenen oder verheirateten Partner, auch für die Behand-lungsdauer im geschlossenen Wohnheim, Kontakt. Die Dauer der Begegnung und Gestaltung des Treffens mit dem Partner in der Einrichtung oder im Zuge der Aus-gangsvereinbarungen außerhalb nimmt eine große Bedeutung ein und stellt gleich-zeitig einen großen Konfliktherd in der Betreuungsarbeit dar. Über das, in totalen Institutionen, immer wieder beobachtete subkulturelle Phänomen, wie das z. B. in Psychiatrien504, Maßregelvollzug, Haftanstalten, Wohn- und Erziehungsheimen oder beim Militär schon berichtet wurde, von wechselnden sexuellen Kontakten unter den Bewohnern innerhalb der Einrichtungen einerseits zur schnellen Bedürfnisbefriedi-gung, andererseits als Zahlungsmittel für Drogen, Schutz, Nikotin, Kleidung505 wird aus allen drei Einrichtungen berichtet.
Der Beginn einer schweren psychischen Erkrankung bei der Gruppe der TSSP, die insbesondere bei der Altersgruppe, „der Jungen“ durch einen starken und abwech-selnd-experimentellen Konsum von Drogen induziert wurde, ist in einem kausalen Zusammenhang mit einer tiefgreifenden Bindungsstörung und Beziehungsstörung zu sehen, wie das BRISCH beschrieben hat. Bei dieser Gruppe bleiben die sexuelle Reife oder die partnerschaftlichen Erfahrungen innerhalb der Erfahrungswerte der freund-schaftlich-kumpelhaften Gemeinschaft bzw. innerhalb der Peer-Group stecken und können sich somit nicht vollständig, oder wenn nur retardiert aus- und weiterentwi-ckeln.
Auffällig ist, dass 14 der 12 geschiedenen BewohnerInnen Frauen sind und einen Anteil von 86% im Verhältnis zu 14% (2) geschiedenen Männern ausmachen. Beide geschiedene Männer hingegen sind angesichts der Prävalenzwerte zu einem relativ späten Lebenszeitpunkt erstmals an einer schizophrenen Psychose erkrankt. Sie ha-ben die Phase der Ausbildung und einer beruflichen Etablierung vollziehen können. Sie haben beide Kinder und sind mehr als 15 Jahre sozialversicherungspflichtig be-schäftigt gewesen. Die Geschiedenen haben krankheitsbedingt, bzw. durch den Ein-fluss einer psychotischen Erkrankung im Rahmen eines andauernd paranoid, wahn-haft-angespannten bis hin zu fremdaggressiven Verhaltens die Familie und Ehefrau
504 vgl. Fengler C. und Fengler T. (1994): Alltag in der Anstalt. Psychiatrie Verlag. Bonn 505 So herrscht ein reger Handel von Markenkleidung, für eingeschmuggelte oder zwischen-gehandelten Dro-gen, gehortete Medikamente (wie z.B. der Stimmungsstabilisator Lyrica) oder für Geld gegen Sex als Zah-lungsmittel beglichen
319
zu der Entscheidung manövriert, aus Schutz vor sich selbst und den Kindern sowie zur Abwendung von weiteren beruflichen, finanziellen und gesundheitlichen Schä-den, die Trennung und schließlich die Scheidung anzustreben und umzusetzen.
Fünf der Verheirateten, allesamt Frauen, haben auch während der geschlossen Unter-bringung Kontakt und Besuch von ihren Ehemännern. Das für die partnerschaftliche Dyade nach außen und innen gerichtete formale Ehebündnis scheint in einem positi-ven Sinne auch den besonderen Belastungen für eine Ehe Stand zu halten, wenn es bei einem Ehepartner zu einer längeren und schweren Krankheit kommt, wenn es zu einer längeren Abwesenheit vom Haushalt durch Hospitalisierung in einem Kranken-haus oder in einer sozialen Einrichtung, auch gegen den Willen der Ehepartnerin, kommt. Die Ehepaare haben im Vorfeld schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass die Ehefrau wegen einer psychiatrischen Krankheit, auch gegen ihren Willen, behan-delt werden musste. Die loyale und innige Verbundenheit dieser Paare ist häufig durch ein symbiotisches Band konstituiert. In der transaktionsanalytischen Interpre-tation nach BERNE wird von einer Symbiose 2. Ordnung gesprochen, die von einer Weiterentwicklung des Ich-Instanzenmodels von FREUD ausgeht. Solche zweifels-frei pathologischen, symbiotischen Beziehungen umschließen und begrenzen diese drei Ich-Instanzen auf eine Person, die nur zusammen gefügt, funktionstüchtig ist und überleben kann. Wird sie jedoch von außen erschüttert, bedroht oder gar getrennt, könnte es zu einem emotionalen Ausnahme- und Notzustand, einer psychosozialen oder letztendlich psychiatrischen Krise kommen, in der häufig der Partner mit auto- oder fremdaggressiver Gewalt droht, wenn die Symbiose aufgelöst oder getrennt wer-den oder gefährdet sein sollte. Die Gefahr und das Risiko einer gewalttätigen Eska-lation steigt bei einem suchtmittelabhängigen Partner mit einer pathologischen Sym-biose an, da durch die zugrunde liegende Bindungslosigkeit und Bindungsstörung ein existenziell und lebensbedrohlicher Zustand entsteht, der die Überzeugung und Wahrnehmung entstehen lässt, ohne die Partnerin sei kein Weiterleben oder keine Koexistenz möglich. Somit schlussfolgert der Partner, dass ihm die emotionale Le-bensgrundlage entzogen wurde, was die eigene Zerstörung bzw. Tötung oder gar ein erweiterten Suizid zur Folge haben kann.
320
/��
�����
�����������
������
���
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
eige
ner
Woh
nrau
m (
Eig
entu
m)
6 (2
) 10
(0)
8
(0)
24 (
20,3
%)
Ver
sorg
ung
durc
h P
rim
ärfa
mili
e 10
5
1 16
(13
,5%
)
ohne
fes
ten
Woh
nsit
z (z
.B. S
ozia
lhot
el)
3
0 0
3 (2
,5%
)
in §
67 S
GB
XII
Ein
rich
tung
6
4 1
11 (
9,3%
)
im A
BW
nac
h §5
3 SG
B X
II
7 5
6 18
(15
,2%
)
offe
nes
Woh
nhei
m
9 4
0 13
(11
,0%
)
psyc
hiat
risc
hes
Pfl
egeh
eim
15
14
3
31 (
26,3
%)
fore
nsis
che
Psy
chia
trie
1
0 0
1 (0
,85%
)
Ges
amt
57
42
19
118
Tab
elle
11:
Woh
nver
hältn
isse
z.Z
. der
Auf
nahm
e
Dis
kuss
ion
der
Dat
en a
us T
abel
le 1
1:
Im e
rhob
enen
Zei
trau
m w
ohnt
en 2
4 (2
0,3%
) de
r B
ewoh
neri
nnen
unm
ittel
bar
vor
der
Auf
nahm
e in
ein
em g
esch
loss
enen
Woh
nhei
m
im e
igen
en W
ohnr
aum
, zu
r M
iete
ode
r in
ein
er E
igen
tum
swoh
nung
. W
eite
re 1
6 (1
3,5%
) w
urde
n ku
rz v
or d
er A
ufna
hme
von
der
Prim
ärfa
mil
ie v
erso
rgt,
i.d.R
. au
ch f
inan
ziel
l un
d m
ater
iell
unte
rstü
tzt.
Die
se G
rupp
e be
woh
nte
dann
mei
st n
och
oder
wie
der
ihr
ehem
alig
es J
ugen
dzim
mer
. D
as b
edeu
tet,
dass
1/3
der
Bew
ohne
rinn
en z
uvor
ohn
e st
atio
näre
Hilf
e au
sgek
omm
en s
ind
und
eine
n gr
oßen
Spr
ung
von
eine
m p
riva
t-fa
mil
iär-
inti
men
Set
ting
in e
inen
hoc
h st
rukt
urie
rten
-ins
titu
tiona
lisie
rten
-ver
öffe
ntlic
hten
und
sta
-tio
näre
n B
etre
uung
srah
men
vol
lzog
en h
aben
. Fü
r si
e w
ar j
edoc
h in
der
Reg
el e
in g
eset
zlic
her
Bet
reue
r be
stel
lt, s
ie b
efan
den
sich
m
inde
sten
s in
Kon
takt
mit
ein
em
321
niedergelassenen Psychiater oder standen i. d. R. direkt oder indirekt mit dem Sozi-alpsychiatrischen Dienst oder dem Allgemeinen Sozialdienst in Kontakt. Oft wende-ten sich die Eltern über einen langen Zeitraum hinweg wegen der Probleme des psy-chischen kranken Kindes an Beratungs- und Betreuungsstellen. Es kam bei dieser Gruppe durchschnittlich in der Zeit vor der Aufnahme zu mindestens 3 stationären Klinikaufenthalten.
11 (9,3%) der Bewohner lebten zuvor in unsicheren Wohnverhältnissen, in sogenann-ten Sozialhotels mit einfachster Möblierung oder in Einrichtungen der Wohnungs-notfallhilfe. 31 (26,3%) der Bewohner, die in § 1906er-Einrichtungen aufgenommen werden, wurden kurz vor dem Einzug in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, vor-wiegend im ABW (15,3%) oder in stationären (offenen) Wohnheimen (11%) betreut, behandelt und versorgt. 31 (26,3%) der Bewohner waren hingegen unmittelbar vor der Aufnahme in geschlossenen, sogenannten psychiatrischen Pflegeheimen nach § 61 ff SGB XII, mehrere Autostunden entfernt von der Herkunfts- und Heimatge-meinde der Bewohner in dezentral-ländlich gelegenen Naherholungsgebieten veror-tet sind.506 Lediglich 1 (0,85%) Bewohner befand sich unmittelbar vor der Aufnahme im Maßregelvollzug.
Interpretation der Daten aus Tabelle 11:
Die Anteil an Bewohner, die zuvor entweder im eigenen Wohnraum oder noch bzw. wieder507 bei der Primärfamilie wohnten und finanziell und materiell versorgt wur-den, fällt mit 1/3 (33,8%) unerwartet hoch aus. In dieser Phase der Hilfebedürftigkeit ist offensichtlich kein tragender und gelingender Kontakt mit einer ambulanten Be-ratungs- oder Behandlungsstelle zustande gekommen. In dieser Phase hat sie keine der bekannten Unterstützungsleistungen für chronisch psychisch kranke Menschen erreicht bzw. ist wirksam angenommen worden. Aus den Berichten und Erfahrungen der gesetzlichen Betreuer und der Eltern der Kinder, die in geschlossen Heimen auf-genommen wurden, geht hervor, dass es in den psychiatrischen Krisen mindestens zum wiederholten Male zu eigengefährdendem Verhalten und Handlungen gekom-men sei. So kam es z.B. zu lebensbedrohlichen Situationen infolge einer Unter- oder Mangelversorgung durch zu wenig Flüssigkeit oder Nahrungsaufnahme oder durch eine Flüssigkeitsaufnahme von mehr als 10 l täglich. Es kam zu „Spaziergängen“ auf der Autobahn, in Zugtunnels oder auf Brücken. Es kam zu unterschiedlichsten Sui-zidversuchen, zu massivem und willkürlichem Drogenkonsum, die allesamt in eine akut notwendige Unterbringung mit zeitnahem Behandlungsbedarf in einer Pflicht-versorgungsklinik gemündet haben. Letztendlich, so die Erfahrung der Eltern, der Angehörigen und der gesetzliche Betreuer, wurde von i.d.R. (ober)ärztlicher Seite aus eine Unterbringung nach § 1906 BGB empfohlen. Alternativen oder andere Ver-sorgungsoptionen wurden häufig nicht diskutiert oder in Erwägung gezogen. Mit dem psychiatrischen Gutachten wird i.d.R. die psychiatrische Klinik selbst vom zuständi-gen Amtsgericht beauftragt. Viele Gutachten bestätigen und beziehen sich in ihrer
506 Murrhardter-, Mainhardter-, Welzheimer-, Oden- oder im Schwarzwald 507 Von den 33,8 % der Bewohner, die im Zuge der Ausbildung bzw. des Studiums das elterliche Familienhaus als sicheres Nest verlassen haben, jedoch nach dem Scheitern des ersten Ablösungs- und Autonomisierungs-prozesses wieder zurückgekehrt sind, suchten diese wieder emotionale Sicherheit, Schutz und materielle Ver-sorgung im elterlichen Haus.
322
Problemstellung, Prognose und Diagnostik auf bereits in der Klinik erhobene Anam-nesen und Einschätzungen. Es bleibt in jedem individuellen Fall die Frage zu prüfen, wie intensiv und umfangreich es bei jedem einzelnen zu Kontakt- und Beziehungs-angeboten zwischen aufsuchender und nachgehender psychiatrischer Hilfen gekom-men ist? Werden diese Hilfen von den Eltern, der Familie unterstützt oder aus Scham und Angst abgelehnt oder boykottiert? Häufig sind die gesetzlichen Betreuer und die niedergelassenen Fachärzte oder die Hausärzte die einzigen professionellen Kon-takte, sowohl für den erkrankten Sohn oder Tochter selbst, als auch für die Angehö-rigen, die aus Angst vor Stigmatisierung und Scham professionelle Hilfen ablehnen.
Um im Zuge der DRGs und den Vorgaben der Krankenkassen kürzere Verweildauern anzustreben, werden Patienten, die in psychiatrischen Stationen auf eine Verlegung in eine geeignete Einrichtung warten, in der ein Unterbringungsbeschluss nach § 1906 BGB umgesetzt werden kann, bevorzugt in psychiatrische Pflegeheime508 ver-legt, die unter privater Trägerschaft stehen.
508 Die bestenfalls interimsweise Verlegung der Patienten in psychiatrische Pflegeinrichtungen kann häufig über Monate andauern.
323
����
��0���������
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
För
ders
chul
e K
eine
Ang
abe
4 0
4 (6
,5%
)
Hau
ptsc
hula
bsch
luss
k
. A.
23
10
33 (
54,0
%)
Mit
tler
e R
eife
k
. A.
3 3
6 (9
,8%
)
Abi
tur/
Fac
hhoc
hsch
ul-
reif
e k
. A
10
3 13
(21
,3%
)
kein
Sch
ulab
schl
uss
k. A
. 2
3 5
(8,2
%)
gesa
mt
k. A
. 42
19
61
Tab
elle
12:
Sch
ulis
che
Qua
lifik
atio
n un
d B
ildun
gsab
schl
uss�
Dis
kuss
ion
der
Dat
en in
Tab
elle
12:
Bei
den
in d
er T
abel
le a
ufge
führ
ten
Wer
ten
könn
en n
ur d
ie Z
ahle
n vo
n E
inri
chtu
ng2
und
3 be
rück
sich
tigt
wer
den,
da
Ein
rich
tung
1 ke
ine
Ang
aben
hie
rzu
erho
ben
hat.
54%
(33)
der
Bew
ohne
rinn
en s
chlo
ssen
mit
dem
Hau
ptsc
hula
bsch
luss
, 9,8
% (6
) mit
der M
ittle
ren
Rei
fe u
nd 1
3 (2
1,3%
) m
it de
r F
achh
ochs
chul
reif
e od
er m
it de
r al
lgem
eine
n H
ochs
chul
reif
e ab
. 4
(6,5
%)
habe
n di
e Fö
rder
schu
le
(ehe
mal
s S
onde
rsch
ule)
abs
olvi
ert u
nd 5
(8,
2%)
habe
n di
e Sc
hule
abg
ebro
chen
.
Bei
der
Akt
enre
cher
che
in E
inri
chtu
ng2
erga
b si
ch b
ei d
en B
ewoh
nern
, die
ein
en H
aupt
schu
labs
chlu
ss e
rwor
ben
habe
n, e
ine
durc
h-sc
hnitt
liche
Abs
chlu
ssno
te v
on 3
,5-
4,0.
324
Nach der bundesdeutschen Statistik (statista 2015 mit Stand: 2013) haben 34,7 % der Bevölkerung die Hauptschule absolviert, 22,3% die Realschule und 27,9 % die Fach-hochschulreife oder Abitur erreicht. Im Vergleich hierzu fällt vor allem die hohe Quote der Personen mit einer Fachhochschul- oder Hochschulreife ähnlich wie bei der Untersuchungsgruppe auf, nämlich 21,3%.
In Baden-Württemberg schließen von den Schülern mit Migrationshintergrund 35,7% mit dem Abitur oder der Fachhochschulreife, 31,5 % mit der Mittleren Reife und 26,3 % mit dem Hauptschulabschluss ab.509
Interpretation der Daten aus Tabelle 12:
Bereits ein Großteil, insbesondere die männlichen Bewohner, die einen Hauptschul-abschluss bestanden haben, ist im Verlauf der Schulzeit von einer höheren Schule abgegangen. Bei den 4 Förderschülern, die alle den Schulbesuch verweigert haben, konnte nicht rekonstruiert werden, ob sie die Schule auch bis zur letzten Klasse be-sucht haben. Bei denjenigen, die später zum ersten Mal erkrankt sind, das waren über-wiegend Frauen, (Ersterkrankung bei Frauen im Schnitt: 25.- 35. Lbj.) hat die Krank-heit den Lernprozess bezüglich der Konzentration, Aufmerksamkeit, sowie Erlernen und Speichern von Informationen nicht beeinträchtigt, sodass diese einen höheren Bildungsabschluss erreichen konnten, wohingegen die Jungen mit 15-25 Jahre bereits in der Prodromalphase beeinflusst waren, sie versuchten häufiger, sich mit Drogen und Alkohol selbst zu medizieren, mit der Absicht, einer Verstärkung der Symptome entgegenzuwirken, dabei forcierten sie jedoch gleichzeitig einen Prozess des sozialen Rückzugs und der Isolation.
509 Quelle Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Mikrozensus 2010
325
���1��0
��������
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
abge
schl
osse
ne L
ehre
k.
Ang
abe
10
8 18
(29
,5%
)
abge
schl
osse
nes
Stud
ium
k.
A.
5 0
5 (8
,2%
)
abge
broc
hene
Leh
re
k. A
. 5
1 6
(9,8
%)
abge
broc
hene
s St
udiu
m
k. A
. 3
2 5
(8,2
%)
kein
e B
eruf
saus
bild
ung
k. A
. 19
8
26 (
42,6
%)
Ges
amt
k. A
. 42
19
61
Tab
elle
13:
Ber
uflic
hes
Aus
bild
ungs
nive
au
Dis
kuss
ion
der
Dat
en a
us T
abel
le 1
3:
Bei
die
sem
Ite
m k
onnt
en n
ur D
aten
in E
inri
chtu
ng2
und
3 er
hobe
n w
erde
n. 1
8 (2
9,5%
) B
ewoh
ner
habe
n ei
ne L
ehre
, 5 d
er 6
1 (8
,2%
) ei
n St
udiu
m a
bsol
vier
t. 6
habe
n ei
ne o
der
meh
rere
Leh
ren
ange
fang
en, j
edoc
h ab
gebr
oche
n. 5
(8,
2%)
habe
n ei
n St
udiu
m b
egon
nen
und
wie
der a
bgeb
roch
en. U
nter
den
5 e
hem
als
Stud
iere
nden
sin
d 4
Frau
en u
nd 1
män
nlic
her B
ewoh
ner.
26
Bew
ohne
r der
61
(42,
6%)
habe
n ke
inen
ber
uflic
hen
Abs
chlu
ss e
rrei
chen
kön
nen.
Insg
esam
t bet
rach
tet,
habe
n 37
(60,
6%) d
er B
ewoh
neri
nnen
kei
ne q
ualif
izie
rte
Ber
ufsa
usbi
ldun
g ab
gesc
hlos
sen,
woh
inge
gen
ledi
glic
h 24
(39,
4%) d
er B
ewoh
ner
entw
eder
ein
en L
ehra
bsch
luss
ode
r ein
en s
taat
lich
aner
kann
ten
Stud
iena
bsch
luss
erz
iele
n ko
nnte
n.
In E
inri
chtu
ng2
ist d
ie A
nzah
l der
Bew
ohne
rinn
en o
hne
Aus
bild
ung
mit
26
(64,
%)
noch
höh
er a
ls d
er D
urch
schn
itt.
326
Interpretation der Daten aus Tabelle 13:
Gerade die Bewohnerinnen, die zur Altersklasse „Mittleres Alter“ und zum „Reifen Alter“ gehören, konnten eine abgeschlossene Berufsausbildung aufweisen, wohinge-gen die die Gruppe „Die Jungen“ fast ausschließlich auf keinen Ausbildungsab-schluss zurückgreifen konnte bzw. 5 von ihnen den Schulbesuch vorzeitig abbrachen und verweigerten. 27 gehörten zu der Altersklasse „der Jungen“. 6 gehörten ebenso zur Altersklasse „der Jungen“ und haben 1-3 Lehrjahre absolviert, doch nach wenigen Monaten, bestenfalls im 2. Ausbildungsjahr aufgegeben. In diesen Fällen hat jeweils die Berufsschule wegen häufiger Abwesenheit oder der Ausbildungsbetreib wegen hoher Fehlzeiten oder sozialer Auffälligkeiten den Ausbildungsvertrag vorzeitig auf-gelöst.
Von den 13 Bewohnerinnen mit Abitur haben nur 5 ein Studium begonnen und in der Folge auch abgeschlossen. Hier haben bei 5 die nicht vollzogene Ablösung und Au-tonomisierung vom Elternhaus, die erste Wohnung, das erste Mal weg von Zuhause und in eine andere Stadt ziehen, zu einer psychischen, i.d.R. psychotischen Erkran-kung geführt. Es ist dann zur Rückkehr in die Kernfamilie gekommen, die sich dann um das erkrankte erwachsene Kind kümmerte, das wieder ins Jugendzimmer einzog. 3 Bewohner sind bereits in der Oberstufe erkrankt, konnten dennoch die Abiturprü-fung, wenngleich mit Leistungseinbußen, noch erfolgreich ablegen.
Die 18 Bewohner mit abgeschlossener Lehre gehören weitgehend zur Altersgruppe des „Mittleren Alters“ und zum „Reifen Alter“. Das bedeutet, diese Gruppen wurden erst zu einem späteren Zeitpunkt krank und konnten noch in der dafür vorgesehenen Entwicklungsphase die erforderlichen beruflichen Anforderungen erfüllen. Insbeson-dere die Gruppe der Frauen des „Mittleren Alters“ hat auch in ihrem Beruf sozialver-sicherungspflichtig gearbeitet und bezog zum Zeitpunkt der Aufnahme eine EU- oder BU-Rente, die bei der Berechnung der stationären Betreuungskosten angerechnet wird.
327
-������
����
�����
�#��������
����
������
�
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
deut
sch
(BR
D;
ehem
als
DD
R)
38
15
15
68 (
57,5
%)
poln
. rum
än. u
ngar
. tsc
hech
. 3
9 3
15 (
12,7
%)
Tür
kisc
h 1
4 0
5 (4
,2%
)
GU
S-St
aate
n 3
5 0
8 (6
,7%
)
EX
-Jug
osla
wie
n 2
6 0
8 (6
,7%
)
ital
. gri
ech.
spa
n. p
ortu
g.
6 3
1 10
(8,
4%)
sons
tige
(de
taill
iert
) 1
(fin
n.)
1 (i
ran.
) 1
(eri
tr.)
1 (ä
thio
p.)
1 (t
hai.)
5
(4,2
%)
Ges
amt
57
42
19
118
Tab
elle
14:
Mig
ratio
n
328
Diskussion der Daten aus Tabelle 14: (Begriffsklärung zur Migration)510:
In allen drei Einrichtungen umfasst die Gruppe der Bewohner mit deutscher Staats-angehörigkeit 68 (57,6%). 15 Personen stammen aus den ehemaligen Ostblock-Län-dern (wie z. B. Rumänien, Slowenien, Polen, Ungarn, Tschechei) und bilden die größte Gruppe mit Migration. Hierbei handelt es sich überwiegend um deutschstäm-mige Familien, die bereits eine Außenseiterposition in ihrer Heimat und später nach der Um- oder Aussiedlung nach Deutschland erlebt und erfahren haben.
Auffallend ist die hohe Quote von 64,3 % Bewohner mit Migration in Einrichtung 2. Im Vergleich dazu beträgt in Stuttgart die Migrationsquote 39 % unter den Einwoh-nern. Diese Quote liegt hingegen in Einrichtung 1 bei 31,6% und in Einrichtung 3 sogar nur bei 21 % liegt.
Im Vergleich dazu beträgt die Migrationsquote der Bevölkerung bei 604.000 Ein-wohnern in der Landeshauptstadt Stuttgart bei durchschnittlich 39 % in der gesamten Stadt. Im ältesten Stadtteil Stuttgarts, Bad Cannstatt, beträgt sie hingegen 45 %.
Nur 5 (4,2%) der Bewohnerinnen kommen aus der Türkei, 10 (8,2%) der Bewohne-rinnen stammen aus den bekannten Gastarbeiterländern, aus denen in den 60er und 70er Jahren viele Menschen aus z.B. Italien, Spanien, Griechenland oder Portugal nach Deutschland gekommen sind.
Einzelne kommen aus Finnland, einer aus Thailand und eine aus dem Iran. Ein Be-wohner kommt aus Eritrea, einer aus Äthiopien. Beide haben den Bürgerkrieg, der von 1974 bis Mai 1991 andauerte, erlebt und sind mit ihren Familien nach Europa geflohen.
Interpretation der Daten aus Tabelle 14:
Transkulturelle psychiatrische Aspekte und Besonderheiten spielen in der Behand-lung und Betreuung von psychisch erkrankten Menschen und in der Rollendefinition des Therapeuten/Arztes und der Betroffenen/Patienten eine große Rolle. Die Rolle des Behandlers, der Umgang mit dem Betroffenen und das Krankheitsverstehen ist im Kontext des Volksglaubens, aber auch unter der Einbindung und Bedeutung der christlichen Glaubensgemeinschaft und des islamischen Glaubens zu verstehen und erfordert eine sprachliche und kulturelle Übersetzungsleitung.
So ist damit zu rechnen, dass z.B. schwere psychische Erkrankung gleichzeitig eine schwerwiegende religiöse Verunsicherung bedeuten kann.
Die Gruppe der Bewohner (n=8), die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, ge-hören allesamt in der Altersklasse zur Gruppe der Jungen. Sie haben als Kinder die Schrecken, Kriegswirren und Verlusterfahrungen des Balkankonfliktes in den Jahren
510 Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn 1. die Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder 2. der Geburtsort der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte oder 3. der Ge-burtsort mindestens eines Elternteiles der Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutsch-land liegt sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte.
329
von 1991-2001 miterlebt.511 Sie waren Zeugen von Erschießungen, Folter, von struk-tureller, körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt. Sie sind allesamt davon aus-gegangen, nur für eine bestimmte Übergangszeit im Exil auf ihre Rückkehr zu war-ten.
Die Gruppe der Bewohnerinnen, die i.d.R. in den 80er Jahren mit ihren Familien aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, setzten sich mit dem Spannungsfeld zweier unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Sprachen auseinander. Sie waren mit der Identifikation mit ihren heimatlichen Werten beschäftigt und bemühten sich um Annäherung, Anpassung und Integration in die etablierte Gesellschaft. Trotz und gerade wegen der Beibehaltung der traditionellen Familiensysteme, der Rollenzuord-nungen und Aufgabenstellungen vollzogen sie transgenerativ einen kräftezehrenden Assimilationsprozess.
Die Gruppe der Bewohnerinnen (8), die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90er Jahren mit ihren Familien aus den sognannten GUS-Staaten, der Gemein-schaft Unabhängiger Staaten, wie z.B. Ukraine, Kasachstan und Russland u.a. über-siedelten, wurden zum einen als „Deutsche“ über Jahrzehnte bereits in ihrem Ge-burtsland diskriminiert und zum anderen in der Fortsetzung als sogenannte „Russlanddeutsche“ auch in der Bundesrepublik als Eindringlinge und Außenseiter behandelt. Sie wurden zudem in ihrem eigenen Herkunftsland in ihren beruflichen, schulischen und ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt und eingeengt. Dasselbe fand in abgeschwächter Form in der BRD statt. Dort stellte die Gruppe mit eingangs artikulierten Ansprüchen und Anforderungen an die etablierte Gesellschaft fest, dass sie auch hier nur „Die Russen“ bleiben, deren berufliche Qualifikationen nicht oder nur teilweise anerkannt werden und die ihren Wohnraum in bestimmten Siedlungen oder Straßenzügen in hoher Konzentration zugewiesen bekamen. Sie blieben trotz ihrer deutschen kulturellen Prägung unter ihresgleichen, die über Gene-rationen hinweg von den Großeltern an die weitergehende Generation weitergereicht wurde. Sie nahmen sowohl in ihrem Heimatland als auch in ihrer neuen Heimat die Rolle der Fremden, der Ausgeschlossenen an. Der kulturelle und identitätsstiftende Spagat ist den 8 Bewohnern der Erhebung, die aus den GUS-Staaten über- und aus-gesiedelt waren, nicht bzw. fragmentiert gelungen.
Sowohl die Bewohnerinnen der Russlanddeutschen als auch die Bewohner mit türki-schem Migrationshintergrund waren ähnlichen Hindernissen, Hemmnissen und Bar-rieren ausgesetzt.
Die Qualität und die Methodik der Anpassungsleistungen sowohl der türkischen als auch der russlanddeutschen Pioniergeneration in der Rolle der Außenseiterposition als ehemals angeworbene Arbeitskräfte bzw. als Spätaussiedler auf der Suche nach wirtschaftlicher Sicherheit und einer endgültigen Heimat, waren der Schlüssel des Gelingens. Beide Bewohnergruppen, die zur Gruppe „der Jungen“ gehören, befinden sich in der Nachkommensgeneration. Für sie galt die zentrale Herausforderung, wie
511 Als Jugoslawienkriege, auch Balkankonflikt genannt, wird eine Serie von Kriegen auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien ausgetragen, die mit der Auflösung und dem Zerfall des Staates verbunden waren. Es handelte sich um den sogenannten 10-Tage-Krieg in Slowenien (1991), den Kroatienkrieg von 1991–1995, den Bosnienkrieg von 1992–1995, den kroatisch-bosnischen Krieg im Rahmen des Bosnienkriegs, den Kosovo-krieg 1999 und den sogenannten Albanischen Aufstand in Mazedonien 2001.
330
es Ihnen gelingt, sich mit der Außenseiterposition ihrer Eltern und ihrer eigenen Po-sition umzugehen. Durch veränderte Bildungsoptionen, durch den erworbenen Bil-dungsgrad und Spracherwerb haben sie einen anderen Zugang zur etablierten Gesell-schaft finden müssen. Wie gelingend begibt sich der einzelne Bewohner der Gruppe der Nachkommensgeneration bei gleichzeitigem Erhalt der identitätsstiftenden Merk-male in die etablierte Gesellschaft?
Trotz einer völlig unterschiedlichen Kultur ist es der Pioniergeneration gelungen, die als Arbeitskräfte in Fabriken bei DAIMLER, BOSCH, PORSCHE und MAHLE be-schäftigt waren, einen autonomen Lebensstandard und eine wirtschaftliche Sicherung der Familie zu erzielen. Die 5 türkischen Bewohnerinnen haben allesamt bereits in-nerhalb der Kernfamilie eine Außenseiterrolle eingenommen, weil sie den ihnen zu-gedachten Rollenzuschreibungen nicht entsprachen oder anzueignen bereit waren. So wurde z. B. eine türkische Frau bereits mit 16 Jahren zwangsweise in der Türkei mit einem älteren Mann verheiratet. Sie wechselte hierfür die deutsche für die türkische Staatsangehörigkeit ein. Drei weitere türkische Bewohner waren bereits in kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung, konsumierten als Jugendliche Drogen, wur-den von sogenannten Hodschas behandelt. Psychiatrische oder psychosoziale Hilfen lehnten die Familien auch für ihre erkrankten Kinder kategorisch ab. Diese wurden jedoch immer wieder per Unterbringungsbeschluss in die psychiatrische Klinik we-gen sowohl eigen- als auch fremdaggressiven Handlungen gegenüber ihren Familien-angehörigen als auch gegenüber Professionellen, die von außen in die Familie eintra-ten, eingewiesen.
331
2����#
����
���2���
�"��
���(�
����
���1�
��������
�����
��������
���������
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
unvo
llstä
ndig
e P
rim
ärfa
mili
e k.
A.
13 (
31%
) 0
13
Kon
takt
e m
it K
inde
r- u
nd J
ugen
dhilf
e k.
A.
11 (
26,2
%)
2 (1
0,5%
) 13
in K
inde
r- u
nd J
ugen
dpsy
chia
trie
na
ch §
35 a
SG
B V
k.
A.
6 (1
4,3%
) 2
(10,
5%)
8
Tab
elle
15:
Kon
takt
e m
it K
inde
r- u
nd J
ugen
dhil
fe in
der
Vor
gesc
hich
te
Dis
kuss
ion
der
Dat
en a
us T
abel
le 1
5:
Die
Ang
aben
der
dre
i Ein
rich
tung
en s
ind
hier
unv
olls
tänd
ig. D
iese
Tab
elle
gib
t led
igli
ch H
inw
eise
übe
r A
uffä
lligk
eite
n, d
ie b
erei
ts
im K
inde
r- u
nd J
ugen
dalte
r vo
rlag
en.
Die
Hin
wei
se s
telle
n je
doch
kei
nen
Zus
amm
enha
ng h
er u
nd l
asse
n au
ch k
eine
Abl
eitu
ngen
da
hing
ehen
d zu
, da
ss B
ewoh
ner,
bei
den
en e
ine
frag
men
tiert
e (b
roke
n ho
me)
Fam
ilien
situ
atio
n zu
grun
de l
ag o
der
die
in s
olch
en
schw
er v
orbe
last
eten
fam
iliä
ren
Mili
eus
und
Atm
osph
ären
auf
gew
achs
en s
ind,
spä
ter
eine
sch
wer
e ps
ychi
sche
Erk
rank
ung
entw
i-ck
eln
und
es i
n de
r Fo
lge
zu e
iner
Ins
titut
iona
lisie
rung
in
gesc
hlos
sene
n E
inri
chtu
ngen
kom
mt.
Die
Alte
rsgr
uppe
„D
ie J
unge
n“ i
n de
n E
inri
chtu
ngen
2 u
nd 3
wei
sen
jedo
ch a
llesa
mt E
rfah
rung
en d
urch
Auf
enth
alte
in K
inde
r- u
nd J
ugen
dhei
men
auf
. Ein
Tei
l „D
er
Jung
en“
war
ber
eits
weg
en d
er I
ndik
atio
n Sc
hulp
hobi
e, w
egen
agg
ress
iven
ode
r au
ffäl
ligen
Ver
halt
en i
n de
r Sc
hule
ode
r w
egen
E
ssst
örun
g in
kin
der-
und
juge
ndps
ychi
atri
sche
r B
ehan
dlun
g. S
ie k
amen
alle
sam
t frü
hzei
tig
mit
dem
Mili
eu a
uf d
er S
traß
e un
d m
it
Dro
gen
und
Alk
ohol
kons
um in
Kon
takt
. In
Ein
rich
tung
3 is
t auf
fälli
g un
d er
wäh
nens
wer
t, w
ie h
och
die
Anz
ahl d
er u
nvol
lstä
ndig
en
Prim
ärfa
mil
ien
von
fast
ein
em D
ritte
l (a
uf n
= 4
2) l
iegt
. H
ier
ist
die
Kon
stel
lati
on d
urch
gehe
nd s
o, d
ass
die
Mut
ter
die
alle
inig
e B
ezug
sper
son
blei
bt (
Fal
l 3+
4) u
nd d
er V
ater
sic
h au
s un
ters
chie
dlic
hen
Grü
nden
dem
Ges
icht
sfel
d de
r Fa
mili
e zu
ein
em f
rühe
n Z
eitp
unkt
ent
zoge
n (F
all 2
, 3, u
nd 4
) ha
t bzw
. end
gülti
g ve
rsch
wun
den
oder
ver
stor
ben
ist.
332
Interpretation der Daten aus Tabelle 15:
Die Anzahl der unvollständigen Herkunftsfamilien der Bewohner in Einrichtung 2 fällt mit 31% überraschend hoch aus und bedeutet durchgehend einen frühen Verlust oder Verschwinden i.d.R. des Vaters, durch Trennung, Scheidung, Krankheit, Tod oder Gefängnis. Insbesondere für die Identitätsbildung und Ich-Entwicklung der männlichen Bewohner wirkt dieses Merkmal und Ereignis einflussreich und bedeut-sam in die biographische Entwicklung ein. Häufig ist es infolge einer chronischen Suchterkrankung eines Elternteils oder einer psychischen Erkrankung zu einer Tren-nung oder Ausschluss aus der Familie mit vielfältigen Folgen für die übrigen Fami-lienmitglieder gekommen. Der Anteil von 26,2 % an Bewohnern in Einrichtung 2, die bereits als Kind oder Heranwachsende Hilfe und Kontakt mit dem Feld der Kin-der- und Jugendhilfe hatten, ist ein Hinweis für eine frühzeitige problematische Ent-wicklung, für familiäre oder schulische Auffälligkeiten. Diese Gruppe ist weitgehend identisch mit der Altersklasse „Die Jungen“, die Hilfen und Maßnahmen, die durch das Jugendamt empfohlen, eingeleitet und umgesetzt wurde, erhalten haben. Hierzu zählten fortlaufendes Abwägen und Prüfung von Kindeswohlgefährdung durch Haus-besuche in der Familie, eine Inobhutnahme aufgrund konkreter Indizien für eine Kin-deswohlgefährdung, stationäre Heimunterbringungen, ambulante Hilfen, eine Ver-mittlung in Pflege- oder Adoptivfamilien, die Etablierung von sozialpädagogischer Familienhilfe oder weitere individuelle wie auch gruppenbezogener Hilfen, wie z.B. soziales Gruppentraining oder Antiaggressionstraining. Bei etwa der Hälfte der Be-wohner, die zum Feld Kinder- und Jugendhilfe Kontakt hatte, kam es zudem zu sta-tionären Aufnahmen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie auch zu langfristigen kinder- und jugendpsychotherapeutischen Behandlungen. Diese Hilfen sind i.d.R. durch den Kinderarzt, den schulpsychologischen Dienst, den Klassen- oder Vertrau-enslehrer initialisiert worden. In Einzelfällen kam es auch dazu, dass sich Bewohner als Kind und Jugendliche von sich aus beim Jugendamt um eine Herausnahme aus der Familie gebeten haben. Indikatoren für Hilfestellungen und Maßnahmen sind: Auffälliges Sozial- oder Lernverhalten im Kindergarten oder in der Schule; Symp-tome von Schulphobie, Schulschwänzen, andere motorische, sprachliche, kognitive oder soziale Entwicklungsstörungen oder Verzögerungen; insbesondere aggressiv-abweichendes, sexualisiertes, selbstverletzendes oder abwesendes Verhalten.
333
2����#
����
�����
�/��
����
����1����
��1��
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
§ 67
er W
ohnh
eim
6
13
1 20
(17
,0%
)
Not
unte
rkun
ft/S
ozia
l-ho
tel
3 16
0
19 (
16,1
%)
auf
der
Stra
ße/ o
fW
0 2
0 2
(1,7
%)
gesa
mt
57
42
19
118
Tab
elle
16:
Erf
ahru
ngen
mit
den
Feld
ern
der
Woh
nung
snot
fall
hilf
e(M
ehrf
achn
ennu
ng m
öglic
h)�
Dis
kuss
ion
der
Dat
en a
us T
abel
le 1
6:
Ann
ähre
nd e
in V
iert
el d
er B
ewoh
neri
nnen
bef
and
sich
im V
erla
uf ih
rer
Psyc
hiat
riek
arri
ere
in K
onta
kt m
it F
achb
erat
ungs
stel
len
der
Woh
nung
snot
fallh
ilfe
und
wur
den
von
dort
in
z. B
. sta
tionä
re o
der
teils
tatio
näre
Ein
rich
tung
en d
er W
ohnu
ngsn
otfa
llhilf
e, z
. B. i
n N
otun
terk
ünft
e, N
acht
asyl
e, W
inte
rqua
rtie
re o
der i
n so
gena
nnte
Soz
ialh
otel
s m
it ei
nfac
hste
r Aus
stat
tung
ver
mitt
elt.
Unt
er d
er O
ptio
n ei
ner
Meh
rfac
hnen
nung
bef
ande
n si
ch 2
0 (1
7%)
der
118
Prob
ande
n in
teils
tatio
näre
Ein
rich
tung
en n
ach
§ 67
SG
B X
II. 1
9 (1
6,1%
) ha
ben
scho
n in
Soz
ialh
otel
s od
er N
otun
terk
ünft
e, N
acht
asyl
e et
c. g
ewoh
nt. 2
(1,
7 %
) ha
ben
soga
r sc
hon
auf
der
Stra
ße g
eleb
t un
d „m
acht
en P
latte
“. A
uffa
llend
ist d
ie V
erte
ilung
auf
die
dre
i Ein
rich
tung
en. I
n E
inri
chtu
ng2
betr
ägt d
ie Z
ahl d
er B
ewoh
ner,
die
sch
on
in u
nsic
here
n U
nter
künf
ten
gew
ohnt
hab
en 1
6 (3
8,1
%)
und
ist
5 x
so h
och
wie
in
Ein
rich
tung
1. H
inge
gen
in E
inri
chtu
ng3
gibt
es
ledi
glic
h 1
von
19 B
ewoh
nern
, der
in e
iner
Ein
rich
tung
der
Woh
nung
snot
fallh
ilfe
gew
ohnt
hat
.
334
Inte
rpre
tati
on d
er D
aten
aus
Tab
elle
16:
Ent
spre
chen
d de
r St
udie
n vo
n R
EK
ER
et
al51
2 , d
ie s
ich
mit
der
Bes
chre
ibun
g de
s Pe
rson
enkr
eise
s an
der
Sch
nitts
telle
der
Arb
eits
-fe
lder
der
Psy
chia
trie
und
Soz
ialp
sych
iatr
ie u
nd d
er W
ohnu
ngsn
otfa
llhilf
e be
schä
ftig
en, i
st d
ie G
rupp
e de
r Pe
rson
en, d
ie s
ich
bevo
r-zu
gt i
nner
halb
der
nac
h §
67 S
GB
XII
fin
anzi
erte
n H
ilfe
n be
weg
en u
nd d
as M
ilieu
der
Woh
nung
snot
fallh
ilfe
dem
der
Psy
chia
trie
bz
w. d
er E
ingl
iede
rung
shilf
e vo
rzie
hen,
bei
etw
a 1/
3 - 1
/4. D
iese
Gru
ppe
vers
ucht
sic
h m
ögli
chst
lang
e un
d be
harr
lich
dem
Ges
icht
s-fe
ld d
er P
sych
iatr
ie z
u en
tzie
hen.
Sie
ist
häu
fig
med
izin
isch
unb
ehan
delt
und
wir
d au
fgru
nd d
es m
etho
disc
hen
Ans
atze
s de
r W
oh-
nung
snot
fallh
ilfe
in e
inem
nie
ders
chw
ellig
en, a
lltag
spra
ktis
chen
, gru
ndve
rsor
gend
en S
inne
mit
getr
agen
und
beg
leit
et.
512
Vgl
. Rek
er, T
. Eik
elm
ann,
B. F
olke
rts
H. (
1997
): P
räva
lenz
psy
chis
cher
Stö
rung
en u
nd V
erla
uf d
er s
ozia
len
Inte
grat
ion
bei w
ohnu
ngsl
osen
Män
nern
. Ges
undh
eits
wes
en
59. A
. S.:7
9-82
. vg
l. R
eker
, T. E
ikel
man
n, B
. (19
97):
Woh
nung
slos
igke
it, p
sych
isch
e E
rkra
nkun
gen
und
psyc
hiat
risc
her
Ver
sorg
ungs
beda
rf. I
n: D
t. Ä
rzte
blat
t 94.
Hef
t 21.
S.:1
439-
1441
.
335
2����#
����
�����
����
����
� �3��������
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
Kon
takt
mit
SpD
I/ G
PZ
47
(82
,5%
) 38
(90
,5%
) 3
(15,
8%)
88 (
74,6
%)
AB
W
k. A
. 17
(40
,5%
) 6
(31,
6%)
23 (
19,5
%)
offe
nes
Woh
nhei
m
k. A
. 9
(21,
4%)
4 (2
1,0%
) 13
(11
%)
RP
K/m
ediz
in-b
eruf
liche
Reh
a k.
A.
4 (9
,5%
) 0
4 (3
,4%
)
Zuv
or g
esch
loss
enes
Woh
n-
heim
nac
h §5
3 SG
B X
XII
k.
A.
2 (4
,8%
) 4
(21,
0%)
6 (5
%)
Sons
tige
k.
A.
0 1
1
Ges
amt
57
42
19
118
Tab
elle
17:
im V
orfe
ld m
it E
inri
chtu
ngen
inne
rhal
b de
s G
PV
(Meh
rfac
hnen
nung
mög
lich)�
�
336
Diskussion der Daten in Tabelle 17:
Bereits im Vorfeld vor der Aufnahme in einem der drei geschlossenen Einrichtungen befanden sich 88 (74,6%) Bewohnerinnen in Betreuung durch den Sozialpsychiatri-schen Dienst und haben dort Angebote der Tagesstätte (wie z.B. Mittagessen, freiwil-lige Geldverwaltung) oder stundenweise Mitarbeit im Arbeitsprojekt oder fachärztli-che Hilfe durch die PIA abgerufen. Hierbei handelt es sich nicht um einmalige sondern um sogenannten langfristige Betreuungskontakte, die durch den SpDi erfolgt sind.513 Einrichtung1 liefert hierzu lediglich zur Rubrik Kontakte mit dem Sozialpsy-chiatrischen Dienste bzw. mit dem Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) Anga-ben.
In Einrichtung2 waren 17 (40,5%) der Bewohnerinnen bereits zuvor im ambulant betreuten Wohnen, in Einrichtung3 waren es immerhin noch 31,6%. Die Anzahl der Bewohner, die hingegen zuvor in offenen stationären Heimen gewohnt haben, beträgt in Einrichtung2 und 3: 21 %. 2 Bewohner aus Einrichtung2 waren bereits zuvor in einem anderen geschlossenen Wohnheim der Eingliederungshilfe gewesen, in Ein-richtung3 waren es 4. In Einrichtung2 waren 4 (9,5%) der ausschließlich männlichen Bewohner zuvor in einer RPK Einrichtung und durch liefen zunächst eine von der Krankenkasse finanzierte klinische Belastungserprobung, dann eine medizinische und anschließend eine berufliche Rehabilitionsphase, die insgesamt 2-3 Jahre andau-erte. Ein Bewohner aus Einrichtung3 hatte lediglich über einen früheren Werkstatt-platz im Arbeitsbereich Kontakt mit dem GPZ.
Interpretation der Daten aus Tabelle 17:
Ein Großteil der Bewohnerinnen ist den Versorgungsangeboten des Gemeindepsy-chiatrischen Verbundes Stuttgart schon bekannt. Überraschend ist auch die Tatsache, dass bereits 40 (ein Drittel) Bewohnerinnen in hochschwelligen und eher schwerer zugänglichen Maßnahmen der Eingliederungshilfe auf der Grundlage einer umfas-senden Hilfeplanung durch ein Gespräch mit dem Kostenträger der Maßnahme und eines IBRPs, der mindestens 2-4 Termine sowie ein Termin bei einem Facharzt i.d.R. der PIA erfordert, der für die Antragstellung den ärztlichen HB-Bogen erstellt. So waren 23 Bewohnerinnen (19,5%) im ABW und 13 (11 %) Bewohnerinnen vormals in offenen stationären Heimen.
Wesentlich erscheint hier ein selbstreflektorisches Hinterfragen und Prüfen, warum es den regional zuständigen Sozialpsychiatrischen Diensten mit Pflichtversorgungs-auftrag nicht gelingt, die Klienten, die später zu Bewohner einer geschlossenen Ein-richtung werden, ausreichend zu erreichen und zu versorgen? Warum gelingt es ihnen nicht, eine ansteigende und fortlaufende Verschlechterung des gesundheitlichen Sta-tus quos, der ein eigengefährdendes Verhalten beschreibt, zu vermeiden? Warum ge-lingt es den jeweiligen Heimen und den stadtteilbezogenen Fachdiensten des ABW nicht, einen Entwicklungsprozess der Klientel in eine geschlossene Versorgung zu vermeiden und abzuwenden?
513 Kurzfristige Betreuungen bedeuten bis zu vier Kontakten im Jahr. Langfristige Betreuungen sind fünf und mehr Kontakte/ p.a.
337
Hier sind mutmaßlich drei Aspekte zu nennen, die hypothetisch eine Erklärung hier-für liefern könnten. Zum einen gab es nicht nur in Stuttgart sondern in Baden-Würt-temberg im Zeitraum von 1995-2014 nachweislich eine deutliche Steigerung der Fall-zahlen in den Sozialpsychiatrischen Diensten, wie aus den Jahresstatistiken der Sozialpsychiatrischen Dienste in Baden-Württemberg, die von der LIGA der Freien Wohlfahrtsverbände erhoben wurde, zu ersehen ist. Während 1995 noch von 40-55 langfristigen Klientenkontakte pro Vollzeitfachkraft ausgegangen wurde, stieg diese Zahl 2014 auf 143 Betreuungen pro Vollzeit-Fachkraft (VK), bei langfristigen Kon-takten von 80 pro VK an. Der Stellenschlüssel beträgt aktuell 1:23.000 Einwohner in Stuttgart, während der Stellenschlüssel in den benachbarten Landkreisen und den ur-banen Versorgungsgebieten aktuell 1:50.000 Einwohner beträgt. Das bedeutet weiter, dass sich hypothetisch das methodische Vorgehen im Selbstver-ständnis einer nachgehenden und aufsuchenden Sozialarbeit (assertive communty tre-atment) innerhalb des SpDis verändert hat. Das bedeutet, dass zu wenig zeitliche Res-sourcen für einen gemeinwesenorientierte Ansatz zur Verfügung stehen, d.h., sich nämlich immer wieder um eine Kontaktaufnahme mit den Nachbarn, dem Vermieter oder Hausmeister zu bemühen. Während es noch vor 10 Jahren zu intensiven und häufigen Kontaktanbahnungsversuchen und es somit eher zu einem persönlichen Kontakt gekommen ist, wird heute nach z.B. 1-2 Kontaktversuchen eine mögliche Anbahnung mit einem Klienten, der sich wahnbedingt abschottet, der sich aus Angst sozial isoliert, frühzeitig beendet. Zudem kommt es durch einen erhöhten Kosten- und Belegungsdruck durch die Krankenkassen in den psychiatrischen Kliniken zwangsläufig zu kürzeren und diagnosespezifisch vorgegebenen Krankenhausver-weilzeiten und somit zu früheren Entlassungen. Diese Entlassungen sind durch ver-änderte Interpretationen und Novellierungen der maßgeblichen Gesetzesgrundlagen motiviert. Eine geschlossene psychiatrische Klinikbehandlung, Fixierungen, Zwangsmedikation und andere Zwangsmaßnahmen sind zunehmend durch enge rechtliche Handlungsspielräume gekennzeichnet. Die Bedeutung und der Einfluss des Beschwerdemanagements, einer erhöhten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und ein wirksameres Einmischen der inzwischen etablierte Erfahrenen-Verbände und der der Angehörigenverbände (APK) tragen ebenso zu einer Veränderung der Behandlungs-maßnahmen bei, die Transparenz, Personenzentrierung und eine Verhältnismäßigkeit einfordern. So kommt es zu Entlassungen, in denen einzelne Patienten, die sich in einer instabilen Verfassung befinden, wieder in ihr häusliches Umfeld zurückkehren.
In akuten psychiatrischen Krisen ist der Weg vom häuslichen Umfeld per Zwangsun-terbringung in eine Klinik durch eine über Jahre veränderte Interpretation des UBG nach Baden-Württemberg bzw. eines Psych KG verzögert, vorsichtiger, und langwie-riger. Das hat zur Folge, dass es bei wenigen Patienten, die sich über einen langen und schleichenden Verlauf selbst gefährden und die dann in eine Klink aufgenommen werden, in einem desolaten, mangelernährten, hygienisch bedenklichen Status-quo befinden. Die Klinik beklagt sich über ein sehr spätes Aktiv-werden der Mitarbeiten-den des GPV und nimmt in diesen Fällen einen häufig langwierigen und schwierigen Behandlungsverlauf in Kauf. Neben der schlechten gesundheitlichen Situation gehen auch psychosoziale Defizite und Mängel einher, wie z. B. Überschuldung, keine Mit-gliedschaft in der Krankenkasse, das Mietverhältnis ist bedroht, Brandspuren, Schim-mel, verdorbene Lebensmittel, Müll und Ungeziefer in der Wohnung, das monatli-chen Einkommen bzw. der Lebensunterhalt ist gefährdet usw. Für die Klinik könnte
338
das bedeuten, dass sie auf Teilen der Behandlungskosten sitzen bleibt, dass sie sich, im Falle einer Auflösung des Wohnraums, auf langwierige Wartezeiten auf ein Platz-angebt von nachbetreuenden Einrichtungen einstellen muss. Es liegt nahe, dass aus Sicht der Klinik die Einrichtung mit den kürzesten Wartezeiten favorisiert wird. Das sind dann auch private psychiatrische Pflegeheime. Genau an dem Punkt sind der GPV und seine Strukturen und Angebote gefragt, sich konkurrenz- und wettbewerbs-fähig auszugestalten. Entscheidungen zur Aufenthaltsbestimmung oder Gesundheits-fürsorge werden in kürzeren Diskussionsprozessen unter Auslassung möglicher Be-treuungsalternativen und Versorgungsoptionen getroffen. Häufig werden diese Entscheidungen während der akuten Klinikbehandlung, ohne dem Beisein der be-kannten koordinierenden Bezugspersonen getroffen, die mit dem Patienten bereits über Angebote der Gemeindepsychiatrie in Kontakt standen und ergänzende Ein-schätzungen und Bewertungen beitragen könnte. Die fachärztliche Empfehlungen der pflichtversorgenden Klinik, nämlich eine UBG nach § 1906 BGB zu beantragen, wird von der ärztlichen Hierarchie auf die Hierarchie des Sozialdienstes gehievt, von dort geht die i.d.R. oberärztlichen Empfehlung und langfristige Behandlungslösung an den gesetzlichen Betreuer weiter, der häufig die einzige Kontaktperson überhaupt ist. Teilweise wird auch eine gesetzliche Betreuung während der akuten Klinikbehand-lung angeregt und bestellt und im gleichen Atemzug eine Unterbringung in einer ge-schlossenen Einrichtung nahegelegt. Alternative Wohn- und Behandlungsoptionen, Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Leben des Patienten außerhalb der Klinik, Fragen nach den Ressourcen und die Entwicklung unkonventioneller Betreuungs-konstellationen werden häufig nicht berücksichtigt oder in Erwägung gezogen. Die Ausrichtung einer medizinisch-biologischen Behandlung mit entsprechenden Psychopharmaka stellt die vorherrschende und dominierende Orientierung im Fall-verstehen des Patienten dar. Der Einfluss und die Bedeutung von sozialpsychiatrisch geprägtem Fallverstehen würde den Kliniken eine bereichernde und antagonistische Rolle zukommen.
339
���
����
�������
������������
�������������
�� �� ���
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
G
esam
t/11
8
Fre
mda
ggre
ssiv
es V
erha
lten
k.
A.
24 (
57,1
%)
k. A
. 24
(20
,3%
)
Stra
fvol
lzug
4
(7,0
%)
10 (
23,8
%)
4 (2
1,0%
) 18
(15
,3%
)
Maß
rege
lvol
lzug
1
(1,7
%)
6 (1
4,3%
) 4
(21,
0%)
11 (
9,3%
)
Ges
amt
%4
5!
��
��'
Tab
elle
18:
Maß
rege
lvol
lzug
/ Str
afvo
llzug
in d
er V
orge
schi
chte
Dis
kuss
ion
der
Dat
en in
Tab
elle
18:
Bei
der
Kat
egor
ie s
oll d
er A
ntei
l an
Bew
ohne
r er
mitt
elt w
erde
n, d
er z
um e
inen
im V
erla
uf ih
rer
Patie
nten
karr
iere
im S
traf
vollz
ug z
u ei
ner
Frei
heits
stra
fe v
erur
teilt
wur
den
und
der
Ant
eil a
n B
ewoh
ner,
bei
den
en, a
uf d
er G
rund
lage
von
ver
min
dert
er S
chul
dfäh
igke
it
(§ 2
1 St
GB
) od
er v
on S
chul
dunf
ähig
keit
(nac
h §
20 S
tGB
), d
ie M
aßre
gel u
nd s
omit
die
Unt
erbr
ingu
ng i
n ei
ner
fore
nsis
chen
Fac
h-kl
inik
nac
h §
63 S
tGB
ang
eord
net w
ird.
FR
AN
K51
4 ge
ht v
on 9
,6 D
elik
ten
aus,
die
der
Pat
ient
des
Maß
rege
lvol
lzug
s zu
vor
bega
ngen
ha
t, be
vor
er m
it de
r M
aßre
gel
veru
rtei
lt w
ird.
In
der
Erh
ebun
gsze
it bi
s 31
.7.2
013
galt
noch
das
UB
G n
ach
Bad
en-W
ürtte
mbe
rg,
ledi
glic
h E
inri
chtu
ng2
konn
te h
ierz
u au
fgru
nd u
mfa
ngre
iche
Dat
en u
nd E
rheb
ungs
mat
eria
l A
ngab
en m
ache
n un
d ge
ht v
on 2
4 B
e-w
ohne
r (5
7,1
%)
aus,
die
weg
en f
rem
dgef
ährd
ende
n V
erha
ltens
zw
angs
wei
se in
ein
er p
sych
iatr
isch
en K
lini
k un
terg
ebra
cht w
urde
n.
514
Fran
k, U
.; K
onra
d, M
. (20
12):
Kön
nen
fore
nsis
che
Kli
ente
n im
Gem
eind
epsy
chia
tris
chen
Ver
bund
ver
sorg
t wer
den?
In:
Ker
be. 0
3/20
10. S
.: 39
-42
340
Interpretation der Daten aus Tabelle 18:
Bei der ausschlaggebenden Indikation für einen richterlichen Beschluss nach § 1906 BGB, eine Person in einer dafür geeigneten Einrichtung geschlossen unterzubringen und zu betreuen, wird ausschließlich von eigengefährdenden Verhalten ausgegangen. Das bedeutet, der Erkrankte manövriert sich krankheitsbedingt in eine Mangelsitua-tion oder begibt sich durch das nicht mehr zur Wirklichkeit abgrenzen können von Stimmen-Hören in lebensgefährliche Situation, z. B. sich auf einer Brücke, einem Hochhaus oder auf einer Autobahn aufhalten.
Über die Hälfte der Bewohner in Einrichtung2 hat in ihrer Vorgeschichte neben ei-gen- auch fremdgefährdendes Verhalten gezeigt. Die Frage, die sich aufdrängt, lautet, ist die Zuweisung in eine geschlossene Einrichtung oder in eine psychiatrische Klinik willkürlich oder von der singulären Einschätzung des Gutachters, eines Richters oder in der Übernahme der Empfehlung eines Gutachters für alle weiteren Stellen abhän-gig? Die Frage, die sich weiter aufdrängt, lautet, ob es ein fairer, transparenter, un-parteiischer und neutraler Entscheidungsprozess ist, wenn die fachärztlichen Gutach-ter aus der pflichtversorgenden Klinik stammen, in die der Erkrankte in Krisen eingewiesen wird oder ob es nicht neutraler und sinnvoller wäre, unabhängige und neutrale Gutachter außerhalb des GPV zu beauftragen?
Kommen die professionellen Helfer erst dann zu der Einschätzung und Empfehlung für eine Unterbringung nach § 1906 BGB, wenn der Patient mehrfach und wiederholt in einem gesundheitsgefährdenden Status Quo aufgenommen wird? Bei fremdgefähr-denden Verhalten stellt sich die Frage, wann der Haftrichter und die Staatsanwalt-schaft eine Anzeige vor Gericht zulässt, wie die Schwere der Tat, die Umstände und das Bedrohungspotential bewertet und interpretiert wird.
Es stellt sich grundlegend die Frage, welche Entscheidungskette und welche Kriterien bei jeder einzelnen Person mit Fremdgefährdung zur Maßregel führt und welche in den Strafvollzug?
341
������#��#
����
���
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
Alk
ohol
9
(15,
6%)
14 (
33,3
%)
7 (3
6,8%
) 30
(25
,4%
)
TH
C
3 (5
,3%
) 20
(47
,6%
) 5
(26,
3%)
28 (
23,7
%)
Mor
phiu
m (
Her
oin,
Sub
utex
,..)
0 12
(28
,6%
) 1
13
(11
,0%
)
Kok
ain,
Ext
asy,
Met
aphe
tam
ine
0 4
(7,7
%)
0 4
(3,4
%)
Pol
ytox
ikom
aner
Kon
sum
0
13 (
31,0
%)
2
26 (
22,0
%)
war
in S
ubst
itut
ions
prog
ram
m
0 5
(12,
0%)
1
6 (5
,0%
)
z.Z
. in
Subs
titu
tion
spro
gram
m
0 1
1
2
Tab
elle
19:
Suc
hter
kran
kung
en in
der
Vor
gesc
hich
te/M
ehrf
achn
ennu
ngen
342
Diskussion der Daten in Tabelle 19:
Zu diesem Item gaben alle drei Einrichtungen eine suchtanamnestische Auskunft. 30 (25,4%) der 118 Bewohner konsumierten vor der Aufnahme regelmäßig Alkohol mit riskantem oder hochriskantem Konsumverhalten. In Einrichtung2 konsumierten 20 von 42 THC, das i.d.R. durch Rauchen konsumiert wurde. 12 konsumierten Drogen aus der Gruppe der Morphine und bevorzugten den Konsum durch Injektionen. 4 konsumierten in Einrichtung2 über die Nase oder per Injektionen Kokain, Speed oder Methylamphetamin. 28 (23,7%) der Bewohner konsumierten in allen 3 Einrichtungen regelmäßig bis vor der Aufnahme THC.
Während 9 (15,8%) Bewohner vor dem Einzug in Einrichtung1 überwiegend Alkohol und weniger illegale Drogen konsumierten, waren dort nur 3 Personen (5,3%) von illegalen Drogen abhängig, so konsumierten hingegen in Einrichtung3 36,8% der Be-wohner genauso Alkohol wie auch THC 26,3% und bildeten somit eine Bewoh-nerstruktur ab, die einen doppeldiagnostischen Behandlungs- und Betreuungsansatz benötigt.
Der Anteil von 5 (12%) Bewohner, die ehemals im Substitutionsprogramm behandelt wurden, sowie von 13 (31%) Bewohnerinnen, die vormals politoxikomanen Konsum ausübten, lassen in der Einrichtung 2 zwei Ableitungen zu. Zum einen handelt es sich bei den 5 Bewohnern, im Zuge der Möglichkeit der Mehrfachnennung, identisch um die Gruppe mit polytoxikomanen Konsum. Zum anderen stellt die Atmosphäre, der Umgang mit den Bewohnerinnen im Betreuungsalltag und schließlich der Umgang und die Betreuungserfordernisse bezüglich des Themas Sucht in der Einrichtung2 ei-nen wesentlichen Teil der Arbeit im Unterschied zu den beiden Einrichtungen1 und 3 dar.
Interpretation der Daten aus Tabelle 19:
Im Vergleich zu der Klientel, die sich typischerweise in Einrichtungen der Einglie-derungshilfe befindet, handelt es sich bei dem Personenkreis in Einrichtung2 um ei-nen inhomogenen und suchtstoffgeprägten und suchtstofffixierten Personenkreis. Die Angehörigen dieser Gruppe mit vormals polytoxikomanen Konsum versucht auch während der geschlossenen Unterbringung an Drogen, Alkohol oder Tabletten zu her-anzukommen. Diese Gruppe ist besonders schwer zu einem komplianten oder gar adhärenten Verhalten zu bringen. Diese Gruppe gehört zu denen, die die Ausgangs-zeiten nicht einhalten, unter Drogen oder Alkoholeinfluss zurückkehren. Diese Gruppe verschafft sich über den Notknopf Ausgang, hat jederzeit die Möglichkeit, die Einrichtung zu verlassen und wird dann über die Kriminalpolizei oder den Kri-minaldauerdienst gefahndet und zurückbegleitet. Diese Gruppe benötigt ein hohes Maß an Kontrollen, wie z. B. Atemalkoholkontrolle, Urinschnelltests und Zimmer-kontrollen. Dealer aus dem Milieu versuchen Kontakt mit dieser Gruppe aufzuneh-men. Es werden tote Briefkästen eingerichtet, wie z. B. alte Fahrräder mit einem Ver-steck an einem Verkehrsschild angeschlossen oder es werden Verstecke in unmittelbarer Umgebung der Einrichtung mit einzelnen Bewohnern vereinbart, so wurden beispielsweise Briefchen mit Tesafilm hinter einem Heizkörper des Foyers
343
angeklebt. Andere Mitbewohner mit freiem Ausgang werden als sogenannte Versor-ger eingespannt, bei einer bestimmten Person in der Stadt Drogen abzuholen, um sie in der Einrichtung zu übergeben usw.
Der Umgang mit der Gruppe der Bewohnerinnen, die flankierend zur psychiatrischen Grunderkrankung eine schwere Suchterkrankung haben, stellt die Mitarbeitenden vor konzeptionelle (Netz und Angebot der regionalen Suchkrankenhilfe kennen, passende Suchthilfeangebote kennen und nutzen) und methodische Herausforderungen (sucht-therapeutische Zusatzqualifikationen, Fortbildungen zum Thema Sucht, konfrontati-ver Umgang mit der Klientel, Suchtgruppen im Haus und extern, Kontrollen, Psycho-edukation mit dem Schwerpunkt Sucht und Konsum usw.).
344
6���
�������
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
Schi
zoph
rene
Psy
chos
e IC
D 1
0 F
.20-
20,5
46
(80
,7%
) 31
(73
,8%
) 13
(68
,4%
) 90
(76
,3%
)
Aff
ekti
ve P
sych
ose
ICD
10
F.4
0-
4 (7
,0%
) 3
(7,1
%)
2 (1
0,5%
) 9
(7,6
%)
Per
sönl
ichk
eits
stör
unge
n IC
D 1
0 F
.60-
63
7 (1
2,3%
) 8
(19,
0%)
4 (2
1,0%
) 19
(16,
1%)
gesa
mt
57
42
19
118
Tab
elle
20:
Dia
gnos
en n
ach
ICD
10
F 51
5
E
inri
chtu
ng 1
Ein
rich
tung
2
E
inri
chtu
ng 3
ge
sam
t
Kom
bini
ert
mit
ein
er i
ntel
lekt
uelle
n M
inde
rbeg
a-bu
ng
k. A
. 7
(16,
7%)
2
9 (7
,6%
)
Kom
bini
ert
mit
ein
er S
ucht
erkr
anku
ng
k. A
. 19
(45
,2%
) 10
(52
,6%
) 29
(24
,6%
)
Kom
bini
ert
mit
beh
andl
ungs
bedü
rfti
gen
som
ati-
sche
n E
rkra
nkun
gen
10 (
17,5
%)
21 (
50,0
%)
8 (4
2,1%
) 39
(33
,0%
)
Kör
perl
iche
Beh
inde
rung
inf
olge
ein
es S
uizi
dver
-su
chs
(G
ehbe
hind
erun
g, b
leib
ende
Sch
ädig
ung
des
Wir
bel-
Bec
kenb
erei
chs)
k. A
. 4
(9,5
%)
1
5 (4
,2%
)
gesa
mt
57
42
19
118
Tab
elle
20.
1 C
omor
bidi
tät (
mit
Meh
rfac
hnen
nung
)
515
Inte
rnat
iona
l Sta
tist
ical
Cla
ssif
icat
ion
of D
isea
ses
and
Rel
ated
Hea
lth P
robl
ems
(IC
D 1
0) u
nd D
iagn
ostic
and
Sta
tistic
al M
anua
l of
Men
tal D
isor
ders
(D
SM 5
)
345
Interpretation der Daten aus Tabelle 20:
Der Großteil der Bewohner hat eine schizophrene Erkrankung (68,4% - 73,8% - 80,7%). Der Anteil der Bewohner mit einer Persönlichkeitsstörung ist in Einrich-tung2 und 3 mit 19-21% gegenüber der Einrichtung1 deutlich höher. Bei dieser Gruppe wird ein besonders hohes Maß an Selbstreflexion und therapeutischer Kom- petenz verlangt. Die Gruppe der affektiven Psychosen ist hingegen mit 7,6% gering vertreten. Menschen mit depressiven Störungen oder affektiven Psychosen sind in-nerhalb der sozialpsychiatrischen Versorgung so gut betreut und behandelt, dass sie eine eher untergeordnete Rolle in der geschlossenen Versorgung des GPV Stuttgarts spielen. Bei der Betrachtung der komorbiden Störungen waren Mehrfachnennungen möglich. Hier fällt auf, dass die Gruppe mit Suchterkrankungen in geschlossenen Einrichtungen mit 24,6% eine große Gruppe darstellt. 33%, also ein Drittel aller Be-wohner, werden neben der psychiatrischen Grunderkrankung auch wegen einer be-handlungsbedürftig körperlichen Erkrankung behandelt.
Diskussion der Daten aus Tabelle 20.1:
Psychiatrische Grunderkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis sind mit 76,3 % (Anzahl: 90) in allen drei Einrichtungen am häufigsten diagnostiziert. Inner-halb der drei Einrichtungen ist die Verteilung der Klienten mit dieser Diagnostik in Einrichtung1 bei 80,7 % am häufigsten, in Einrichtung3 mit 68,4 % am niedrigsten verbreitet. In Einrichtung2 wird mit 73,8% annähernd der Durchschnittswert von 76,3% erreicht. Die Anzahl an Bewohner mit Persönlichkeitsstörung beläuft sich insgesamt in allen Einrichtungen auf 16,1% (19). In Einrichtung3 sind diese Diagnosen mit 21 % am häufigsten, in Einrichtung2 bei 19 % am zweithäufigsten und in Einrichtung1 ist der Anteil von Bewohner mit Störungen aus den Gruppen F 60-63 mit 7 (12,3%) am niedrigsten. Zur Gruppe der Persönlichkeitsstörungen zählen die Untergruppen vom narzisstischen, schizoiden, zwanghaften und histrionischen, paranoiden, dependen-ten, ängstlich-selbst unsicheren, schizotypischen und dissozialen Typus und vom Borderline-Typ. Bei den erfassten Diagnosen handelt es sich bei 1/3 um Bewohne-rinnen mit einer Persönlichkeitsstörung vom dissozialen und bei 2/3 vom Borderline-Typ. Zu den affektiven Psychosen gehören sowohl bipolare als auch monopolare Psy-chose, in denen die Betroffenen entweder im schnellen Wechsel von manischen in depressive Episoden (Typ rapid cycling) geraten und die Betroffenen weitgehend in manisch-angetriebenen und ruhelosen Phasen verharren, in denen trotz pharmakolo-gischer Behandlungsversuche scheinbar keine Besserung und somit auch keine Lin-derung eintritt. Bei der Verteilung dieser Diagnosen in den drei Einrichtungen kommt es zu einer sehr ähnlichen Aufteilung der drei Diagnosegruppen, nämlich in schizo-phrene Psychosen 68-80%, in affektive Psychosen 7-10% und Persönlichkeitsstörun-gen 12-21%. Zusätzlich zur psychiatrischen Grunderkrankung wurden sogenannte komorbide, also flankierende und ergänzende Krankheiten erfasst, die behandlungs-bedürftig sind und großen Einfluss auf das psychische Befinden einnehmen. 7 (16, %) der 42 Bewohnerinnen in Einrichtung 2 haben neben der i.d.R. schizophrenen Psychose intellektuelle Minderbegabung. In Einrichtung 2 sind 19 (45,2%) der Be-wohnerinnen zudem von einer Suchterkrankung betroffen, in Einrichtung 3 sind es sogar 52,6% oder 10 von 19 Bewohnerinnen, die hier erhoben wurden.
346
Grü
nde
für
Ent
lass
unge
n
(Meh
rfac
hnen
nung
) E
inri
chtu
ng 1
E
inri
chtu
ng 2
E
inri
chtu
ng 3
G
esam
t
unge
plan
te A
uszü
ge, §
190
6 en
det-
Bew
oh-
ner
will
aus
zieh
en -
Ein
rich
tung
hat
and
ere
Nac
hsor
gevo
rste
llun
g
k. A
ngab
e 1
3 (3
,4%
)
Anz
ahl d
er E
ntla
ssun
gen(
gesa
mt)
41
17
4
62
K
ündi
gung
weg
en Ü
berg
riff
e, B
tM-V
er-
stoß
, Pfl
egeb
edar
f, s
. Lei
stun
gsau
ssch
lüss
e
9 (1
5,8%
) 2
(4,8
%)
1 (5
,2%
) 12
(1
0,2%
)
Ver
mitt
lung
ins
stat
ionä
re W
ohne
n 3
1 0
4 V
erm
ittlu
ng in
s A
BW
-AW
G
25
(43,
9 %
) (A
BW
in
tern
da
von
10)
6 (1
4,3%
) 0
31
SpD
i/ G
PZ
4
2 0
6 P
sych
iatr
. Pfl
egee
inri
chtu
ng
- 1
0 1
67er
Ein
rich
tung
-
2 1
3 Z
urüc
k zu
r Fa
mili
e 4
1 3
8 ve
rsto
rben
-
1 1
2 Su
izid
-
0 0
0
Tab
elle
21:
Ent
lass
unge
n un
d N
achs
orge
347
Diskussion der Daten in Tabelle 21:
Die drei Einrichtungen haben 62 Bewohner aus dem geschlossenen Heimbereich ent-lassen bzw. versucht, nach Ablauf eines gültigen Unterbringungsbeschlusses eine ge-eignete Anschlussbetreuung zu vermitteln, auf die sich der Bewohner, der gesetzliche Betreuer und die Einrichtung verständigen und die sie miteinander aushandeln konn-ten. In der Zeit von 1.1.2005-31.7.2013 wurden in Einrichtung1 in einer realen Heim-betriebszeit von 8 Jahren und 7 Monaten (103 Monaten) 41 Bewohner entlassen, d.h. 0,4 Bewohner pro Monat oder 2 Bewohner in 4 Monaten. In Einrichtung2 wurden vom 1.10.2011 bis 31.7.2013 innerhalb von 1 Jahr und 5 Monaten (22 Monaten) 0,8 Bewohner per month 8 (4 Bewohner in 5 Monaten) entlassen. In Einrichtung3 wurden 4 Bewohner innerhalb von 7 Monaten aus der Einrichtung entlassen. Während es in Einrichtung1 auch möglich ist, dass Bewohner ohne Unterbringungsbeschluss beglei-tet werden, werden in Einrichtung2 ausschließlich Bewohner mit einem rechtskräfti-gen Unterbringungsbeschluss betreut und behandelt.
Nur in 4 Fällen berichten Einrichtung2 und 3, dass es zwischen der Einrichtung und dem Bewohner nicht zu einer einvernehmlichen und auf einem Kompromiss basie-renden und gütlichen Einigung bezogen auf eine zukünftige Wohnperspektive ge-kommen ist. In diesen Fällen konnte die Einrichtung gegenüber dem Bewohner die große Kluft und Diskrepanz zwischen Eigenbild und Fremdbild nicht nachvollzieh-bar und überzeugend genug vermitteln.
Die Zahl der Kündigungen von 9 Bewohnern innerhalb einer Zeitspanne von 8 ½ Jahren fällt, angesichts der hoch differenzierten und anspruchsvollen Klientel mit multiplen Suchtmittelabhängigkeiten, Erfahrungen aus dem Straf- und Maßregevoll-zug und einem milieuangepassten Verhaltensrepertoire der Phasen ohne festen Wohnsitz als sehr gering aus. Hierbei ist davon auszugehen, dass auf der vertragli-chen Grundlage der in den Heimbereichen bestehenden Leistungsausschlüsse i.d.R. über eine lange Zeit geprüft und ausprobiert wurde, den Bewohner in der Einrichtung zu halten oder mit Hilfe von klinikstationären Kriseninterventionen wieder einen Weg zurück in die Einrichtung zu bahnen. In Einzelfällen ging dem Anlass für eine Kündigung massive und schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten voraus, die sich als körperliche oder sexuelle Gewalt gegenüber Dritten präsentierte. Geschlossene Heimversorgung innerhalb der Eingliederungshilfe wird aus Sicht der Klinik oder des Kostenträgers als letzte Maßnahme und als letztes Mittel der Betreuung und Behand-lung gesehen. Hier ist aber entgegenzuhalten, dass deeskalierend-sanktionierende oder verhaltensregulierende Behandlungsmöglichkeiten auf der Grundlage von frei-heitsentziehenden Maßnahmen, wie z. B. ein befristeter Zimmereinschluss, Fixierun-gen oder ärztliche Zwangsmedikationen und Behandlungen nicht vorgesehen und auch konzeptionell nicht beabsichtigt sind.
Überraschend fällt auf, dass nur 4 der 62 ausgezogenen Bewohner in stationäre Heime und 31, also 50 % aller Entlassenen, ins ABW vermittelt werden. Dabei han-delt es sich häufig um diskursive und lange im Voraus ausgehandelte Kompromiss-lösungen, da sich Bewohner häufig deutlich gegen eine Fortsetzung in einem offenen Heim aussprechen und eine fortgesetzte Einschränkung ihrer Autonomie und Frei-heiten befürchten. Erschwerend kommt hinzu, dass innerhalb des GPV Stuttgarts lange Wartezeiten auf einen Heimplatz bestehen, so dass häufig nur eine ambulante
348
Betreuung in einem Trägerwohnraum mit flankierenden SGB V Leistungen (z.B. Me-dikamentenvergabe), PNG516 und PEG517 Leistungen alternativlos übrig bleibt. In Einzelfällen ist auch eine Vermittlung in den § 67-er Bereich oder in ein Sozialhotel mit niederschwelliger sozialpsychiatrischer Begleitung zeitlich befristet sinnvoll und angezeigt.
8 Bewohner wurden im Erhebungszeitraum wieder zurück in die Herkunftsfamilie entlassen und stimmten flankierender Unterstützung durch den zuständigen Sozial-psychiatrischen Dienst, durch Angehörigenberatung und durch einen ambulanten Pflegedienst zu. Im Verhältnis zum Lebensmittelpunkt, wurden 24 Bewohner direkt aus ihrer Herkunftsfamilie aufgenommen und somit nur ein Drittel dieser Bewohner-zahl wieder dorthin zurück entlassen, jedoch mit professioneller Hilfe.
2 Bewohner sind im Verlauf der Erhebungszeit verstorben, 1 Bewohner ist an einem langjährigen Krebsleiden, ein weiterer Bewohner ist ebenfalls an einer schwerwie-genden somatischen Erkrankung verstorben. Im Erhebungszeitraum kam es zu kei-nem erfolgreich-vollzogenen Suizid, dafür wurde eine Vielzahl an schwerwiegenden autoaggressiven Handlungen, die unbehandelt zum Tod geführt hätten, vermieden, unterbunden oder rechtzeitig notärztliche Hilfe herbeigerufen. 3 Bewohner, die sich von Anfang an massiv gegen das hochstrukturierte Setting zur Wehr gesetzt haben, sind in Wohneinrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe mit ambulanter sozialpsychiat-rischer Begleitung vermittelt worden.
Interpretation der Daten aus Tabelle 21:
Geschlossene Heimversorgung stellt keinen Aufbewahrungsort und keine Sackgasse sozialpsychiatrischer Behandlung und Betreuung für die aufgenommene Bewohner-gruppe dar. In geschlossenen Einrichtungen werden differenzierte, tagesstrukturie-rende, soziotherapeutische, psychoedukative und psychotherapeutisch-psychiatrische Angebote vorgehalten. Durch Angehörigenberatungen und eine biographische The-matisierung und Auseinandersetzung kommt es zu einer Entwicklung der Selbstbe-stimmung und eine Entwicklung dahingehend, mit der Freiheit verantwortlich und gesundheitsförderlich umzugehen.
Die Idee der Selbstbestimmung, so BIERI (2014), wird noch komplexer, wenn es demnach nicht mehr nur um die Unabhängigkeit den Anderen gegenüber geht, son-dern vielmehr um die Fähigkeit, über sich selbst zu bestimmen. Es geht also in der Auseinandersetzung mit dem Feld Selbstbestimmung weniger darum, über das eigene Leben Regie zu führen, indem man sich gegen die „Tyrannei der Außenwelt“ wehrt.518 Dieses Selbstverständnis und die Introjekte tragen i.d.R. die Bewohner zum Zeitpunkt der Aufnahme in sich und sehen sich gegängelt, bevormundet oder gar willkürlich bestraft oder behandelt. Erst nach einer sensiblen Phase der Auseinander-setzung mit der Lebens-, der Familien- und der Krankengeschichte, die durch Ver-trauens-, Beziehungs- und Bindungsarbeit charakterisiert ist, kann eine erweiterte
516 PNG Pflegeneuausrichtungsgesetz: Hier können z.B. ab 30.10.2012 bzw. ab 1.1.2013 über einen integrier-ten Pflegedienst eines Sozialpsychiatrischen Wohnverbundes Kassenleistungen nach dem § 38 SGB XI im häuslichen Umfeld abgerechnet werden. 517 PEG Pflegergänzungsleitungen, vgl. § 45 b XI 518 a.a.O. Bieri, P. (2013): S.: 9.
349
Sicht und Interpretation, können neue Erkenntnisse gegenüber einem hochstruktu-rierten Betreuungs- und Wohnrahmen möglich werden. Im sozialpsychiatrischen Ar-beitsfeld können z. B. psychiatrisch-forensische Institutionen, geschlossene Heime, gesetzliche Betreuungen, Geldverwaltung oder Bewährungsauflagen stellvertretend als „Tyrannei der Außenwelt“ erlebt werden. Im Diskurs über Selbstbestimmung geht es vielmehr darum, in einem erweiterten Sinne, Subjekt seines Lebens zu werden, indem der Bewohner Einfluss auf seine Innenwelt nimmt. Konkret bedeutet das, auf die Dimensionen des Denkens, Wollens und Erlebens, aus denen heraus sich die Handlungen ergeben, Einfluss zu nehmen. Im Gegensatz dazu kann es auch dazu kommen, den eigenen Willen als Leben wahrzunehmen, das einem nur zustößt und von dessen Erleben der Mensch wehrlos überwältigt wird, so dass, statt von einem Subjekt nur von einem Schauplatz des Erlebens, so BIERI, die Rede sein kann.519 In diesem Erleben läuft der Mensch Gefahr, seine persönliche Identität nicht in seine Lebensgeschichte einbetten zu können. Er erlebt vielmehr einen Prozess des Fremd-werdens der eigenen Identität und Biographie, wie RIEMANN (1984) beschrieben hat. Der Schlüssel der Behandlung und Betreuung in der geschlossenen Heimversor-gung liegt genau darin, einen Prozess des Sich- Erkennens-und-Sich-Auseinanderset-zens zu initialisieren, der einen Weg ebnet hin zu einer integrierten Identität, sodass die vergangenen und gegenwärtigen Geschehnisse, Ereignisse, nach und nach in die eigene Lebensgeschichte integriert und somit als identitätsstiftenden Prozess einge-bettet werden können, der die Erfahrung widergibt, dass durch das eigne Denken, Wollen und Erleben Einfluss auf das gegenwärtige und zukünftige Handeln genom-men werden kann.
Die Bewohner, die nach ihrer Entlassung wieder zurück in die Herkunftsfamilie ge-zogen sind, haben schon vor der Aufnahme ein enges Beziehungsband gelebt oder sie näherten sich durch revitalisierende Angehörigenberatung wieder an ihre Her-kunftsfamilie an. Bei den übrigen zwei Drittel, die eine Rückkehr ausschlossen oder ablehnten, veränderte sich die Zielsetzung hin zu einer endgültigen Ablösung aus der Herkunftsfamilie. Diese Gruppe möchte auf eigenen Beinen stehen, sie möchte einen eigenen Haushalt führen, z. B. im ABW oder sie will bewusst Abstand von ihrer Fa-milie halten. Das ist die Gruppe von Bewohnern, die im Verlauf des Heimaufenthal-tes einen Nachreifungsprozess vollzogen hat.
519 vgl. a.a.O. Bieri. S.: 11.
350
)�1��������������
Aufenthaltsdauer in Monaten
Anzahl der Bewohner
1-6 9
7-12 5
12-24 13
24-36 6
36-48 5
48-60 3
72 1
42
Tabelle: 22: Aufenthaltsdauer in einer geschlossenen Einrichtung (Einrichtung1) nach § 1906 BGB
Diskussion der Tabelle 22:
Das Kriterium der Aufenthaltsdauer kann aufgrund der langen Laufzeit des Heimbe-triebs am besten anhand Einrichtung1 beschrieben und interpretiert werden. Inner-halb des Erhebungszeitrahmens von 8 Jahren und 7 Monaten, wurden insgesamt 42 Bewohner entlassen. Es gibt eine Gruppe von 14 Bewohnern, die nur für die Dauer von 12 Monaten in der Einrichtung waren. In dieser kurzen Zeit kam es entweder zu einer schnellen Beendigung und Kündigung des Heimvertrags oder aber es wurde nach einer schnellen gesundheitlichen Stabilisierung eine Rückkehr in die Herkunfts-familie eingeleitet oder es kam zur Vermittlung in das innerhalb des Heims integrierte ambulant betreute Wohnen, das durch gesplittete Stellen von Personal, das auch im stationären Bereich arbeitet, angeboten wird. Die Gruppe mit einer mittelfristigen Verweildauer von 1-4 Jahren stellt mit 24 Bewohnern, die größte Gruppe dar. Hier ist es i. d. R. zu 2-3 Verlängerungen des Unterbringungsbeschlusses per Antrag durch den gesetzlichen Betreuer gekommen. Die Gruppe, die langfristig, im Sinne von Be-heimatung und Stabilisierung über 4-6 Jahre, stellt mit 4 Bewohner eine Minderheit dar, die i.d.R. keinen rechtskräftigen Unterbringungsbeschuss benötigt, dafür lang-fristig einen hochstrukturierten und beschützenden Betreuungsrahmen. Diese Gruppe möchte auf freiwilliger Basis in der Einrichtung betreut werden. Versuche, sie in an-dere Einrichtungstypen zu vermitteln scheitern oder werden abgelehnt. Bei dieser Gruppe kommen meist noch behandlungsbedürftige körperliche Erkrankungen oder notwendige pflegerische Unterstützungsleistungen hinzu.
351
Interpretation der Tabelle 22:
Es ist davon auszugehen, dass nur eine bestimmte Klientel mit einem rechtskräftigen Unterbringungsbeschluss auch für das geschlossene Wohnangebot mit einem hoch strukturierten Betreuungsrahmen geeignet ist und davon profitieren kann. Es kommt bei einem Teil der aufgenommenen Bewohner bereits kurz nach der Aufnahme zu einer Eskalation und somit zu einer wegweisenden Entscheidung ob des weiteren Bleibens oder Gehens. Die größte Gruppe, die im Verlauf der ersten 12 Monate mo-tiviert und überzeugt werden kann, sich konstruktiv und kooperativ mit der neuen Lebenssituation auseinanderzusetzen, kann von der Struktur, den Angeboten, der ge-samten sozialpsychiatrisch ausgerichteten Konzeption und Haltung profitieren. Sie nutzen die Heimaufnahme, um sich zu stabilisieren und um weitere Perspektiven zu entwickeln. Die Gruppe, die langfristig, also 4 Jahre und mehr im Heim betreut wird, sucht nach einer Beheimatung und ist auch auf lange Sicht nicht in der Lage, sich auf eine geringere Unterstützungsleistung einzulassen. Hierbei handelt es sich um schwer chronifiziert psychisch kranke Bewohner mit weiteren comorbiden Störungen. Es handelt sich häufig „non-adapter“, um Bewohner, die selbst unter neuroleptischer Behandlung dauerhaft produktive Krankheitssymptome wahrnehmen und in ihrem Alltag und in ihrer Lebensführung beeinträchtigt sind.
Im nun folgenden Teil D, 9. Kapitel, wird am Beispiel der sozialpsychiatrischen Ver-sorgungsregion Stuttgart, auf die spezifischen Versorgungsstrukturen des Gemeinde-psychiatrischen Verbundes Stuttgart, sowie auf die Aufgaben des Steuerungsgremi-ums und des Trägerverbundes als wesentliche Organisationseinheiten des GPV Stuttgarts eingegangen.
Eine weitere Vertiefung und Fokussierung auf die Gruppe der TSSP erfolgt am Bei-spiel einer bereits in 2008 generierten Datenbank, die im Verlauf einer Sozialhotel-betreuung für wohnungslose und psychisch kranke/ auffällige Menschen in einer Not-unterkunft (n=87) in einem Zeitraum von 01/2005 - 30.6.2008 erstellt wurde. In diesem Zusammenhang wird die Bewohnergruppe des Sozialhotels im Allgemeinen sowie daraus identifizierte und destillierte Subgruppen beschrieben, die die Kriterien der TSSP erfüllen und sich vorzugsweise in der Wohnungsnotfallhilfe aufhalten.
Die in 2008 erstellte Datenbank von MASANZ & SCHÜLE wurde auf der Suche nach der Gruppe der TSSP, durch die Erstellung von Kreuz- oder Kontingenztabellen, die die Merkmale „wohnungslos“ und „psychisch krank“, oder die Altersklasse „Die Jungen“ und „psychisch krank“, oder das Merkmal Transinstitutionalisierung durch die Felder Sozialer Arbeit und ein weiteres Merkmal, neu erstellt, beschrieben und interpretiert.
352
C: Regionale Versorgung der TSSP im GPV-Stuttgart
8. Kapitel
8.1. Regionale Versorgung der Gruppe der TSSP am Bspl. des GPV Stuttgart
Die anfänglichen Erfahrungen ab 1982 in der Pionier- und Modelphase der Sozial-psychiatrischen Dienste in Stuttgart, die sich ab 1986 über die gesamten Stadtteile erstreckten, gingen von kleinen, autonomen und flexiblen Teams aus, die sich dadurch auszeichneten, dass sie konkrete, rasche, nachgehende und aufsuchende all-tags- und lebensweltorientierte Hilfestellungen für einen großzügig gefassten Perso-nenkreis chronisch psychisch kranker Menschen und deren Angehörige anboten. Ein Großteil der Gruppe der TSSP ist den sozialpsychiatrischen Einrichtungen des GPV bekannt. Ein Teil dieser Gruppe lehnt die Hilfen und Angebote der Psychiatrie kate-gorisch ab und versucht, einen großen Bogen um diesen Versorgungsbereich zu be-schreiten. Stattdessen suchen sie die niederschwelligen und beratungsfreien Wohn- und Versorgungsangebote innerhalb der Wohnungsnotfallhilfe. Sie bevorzugen Not-unterkünfte, die Straße, Sozialhotelplätze oder den teilstationären Bereich der 67-er Hilfen. Die Krankheitsdynamik und spezifische biographische Prägungen (Fremdbe-stimmung, Fremd-Werden der eigenen Biographie etc.) und andere stigmatisierenden Einflüsse führen (Armut, Behinderung etc.) i.d.R. zu einer langsamen Verelendung und Verschlechterung der gesamten Lebenssituation und des gesundheitlichen Status quo, durch z. B. fehlende Medikamenteneinnahme, selbstschädigendes Verhalten etc. Drehtürpsychiatrie, forensische oder strafrechtliche Folgen sowie eine Zuführung in ein geschlossenes Wohnheim sind häufig die Folgen. Sozialpsychiatrische Hilfen kommen mit der jungen Klientel nur schwer zurecht oder gar nicht in Kontakt, die auf Umgangsregeln, Vereinbarungen oder Absprachen weitgehend verzichten bzw. sie nicht einhalten können oder wollen. Macht- und hilflos kommt es dann nach vie-len Hospitalisierungen, zu einer gesetzlichen Betreuung, angeregt durch den Klinik-sozialdienst, der dadurch die gefährliche Dynamik zu unterbrechen oder zu verzögern beabsichtigt. So kam es bis 2011 zu einer Vielzahl von Vermittlungen und Verlegun-gen der Gruppe der TSSP in dezentral gelegene psychiatrische Pflegeheime. Erst mit der Etablierung und dem Aufbau der zweiten (2011) und dritten Einrichtung (2013) konnte die Gruppe der jungen psychisch kranken und suchtkranken mit einem Unter-bringungsbeschluss überwiegend nach Stuttgart zurückgeholt werden. Im Gegensatz zu geschlossenen Heimen, die im Rahmen der Hilfe zur Pflege finanziert und sozial-rechtlich verankert sind, gehen geschlossene Heime der Eingliederungshilfe von qua-litätsgesicherten Betreuungs- und Behandlungsstandards aus, sie verfügen über grö-ßere personelle, finanzielle und sachliche Ressourcen. Standards zur Vernetzung, Transparenz und Kooperation sowie zum Beschwerdemanagement sind signifikante Merkmale für einen geschlossenen Heimaufenthalt nach § 53 SGB XII, der durch interne und externe Heimbeiräte, durch die Heimaufsicht, durch den Kostenträger, sowie durch eine enge Einbindung der gesetzlichen Betreuer und der Angehörigen im alltäglichen Fokus der Qualitätskontrolle und Prüfung steht.
353
8.2. Eingliederungshilfe als Maßnahme für die Gruppe der TSSP
In dem teilweise sehr kontrovers und emotional geführten Diskurs zur Notwendig-keit, Wirksamkeit und Existenzberechtigung von „closed psychiatric homes“ ist zu berichten, dass in der BRD große Unterschiede in den verschiedenen Versorgungsre-gionen, in den historischen Trägerentwicklungen, in der Vernetzungsbereitschaft und Fähigkeit, in der Träger(re)präsentation sowie in der Angebotspalette und den quali-tativ-quantitativen Differenzierungsraden an sozialpsychiatrischen Versorgungsbau-steinen bestehen. Es gibt z.B. Regionen, die einerseits vorgeben, keine geschlossenen Heimplätze zu benötigen, andererseits wird bei genauer Recherche evident, dass das schwierige Klientel mit Beschluss durch einen Prozess der Um-Etikettierung des Per-sonenkreises in psychiatrische Pflegeeinrichtungen, die häufig in privater Träger-schaft stehen, an dem System der Eingliederungshilfe vorbei und in gemeindeferne Regionen, nach dem Motto, „aus den Augen aus dem Sinn“ transinstitutionalisiert werden. So gibt es einen Transfer des Personenkreises von Süden nach Norden, z.B. von Baden-Württemberg/Bayern nach Brandenburg oder von Osten nach Westen, von Berlin nach Hessen oder vom Norden nach Thüringen usw. Aussagekräftige Un-tersuchungen, die valide Daten liefern, gibt es nur für einzelne regionale Versor-gungsgebiete, wie z.B. für Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern. Dies hängt mit der Verknüpfung zwischen der Hilfe zur Pflege nach SGB XI mit der Eingliederungshilfe (SGB XII) sowie mit dem state-of-art der gemeindepsychiatri-schen Strukturen zusammen, die bestenfalls in einem GPV geordnet und geregelt werden.
Nach CREFELD520 (2012) gibt es den Personenkreis mit diesen defizitären Fähigkei-ten der Selbstsorge schon lange, bei dem jedoch durch eine regelmäßige Haushalts-hilfe Heimeinweisungen abgewendet und vermieden werden könnten. Doch nicht ausreichende gerichtliche, finanzielle und personelle Ressourcen bei den gemeinde-psychiatrischen Diensten führen mittlerweile dazu, sich in einem nicht ausreichenden Maße um diese Klientel kümmern zu können. CREFELD stellt zudem fehlende fach-liche Qualifikationsnormen für gesetzliche Betreuer fest, die einen weiteren Teil dazu beitragen könnten, auf ein zeitaufwendiges Hilfeplanverfahren zugunsten einer Heimunterbringung zu verzichten.
Die Anpassung an Hausordnungen, der Verlust an Selbstbestimmung und autonomer Tagesgestaltung, der Verlust eines noch meist tragfähigen sozialen Netzwerkes z.B. in der Nachbarschaft oder innerhalb des Gemeinwesens durch nichtprofessionellen Hilfen, so CREFELD, führt zwangsläufig dazu, dass durch eine subkulturelle Anpas-sung an die stationären Reglements sowohl ein breitgefächertes Hospitalisierungs-verhalten droht als auch Unterbringungsartefakte initialisiert und entwickelt werden. Die Sozialpsychiatrischen Träger in Stuttgart haben sich lange Zeit in der Auseinan-der-setzung mit stationären Hilfen gewunden und gewehrt, in der ideologischen Überzeugung, dass alle psychisch kranken Menschen ambulant oder im eigenen Wohnraum gemeinwesenorientiert versorgt werden können und Heimplätze grund-sätzlich in der Logik BASSAGLIAS per se mit einem Scheitern assoziiert, und nega-
520 Crefeld, W.: Debatte Pro & Contra: Geschlossene psychiatrische Wohnheime. In: Psychiatrische Praxis 2012, 39: S. 4-6.
354
tiv bewertet werden. So ist bis heute auch das ungleich hohe Verhältnis von ambu-lanten Plätzen gegenüber stationären Plätzen zu interpretieren. Die Anerkennung der eigenen professionellen und strukturellen Grenzen sowie die Einsicht, dass eine Viel-zahl von Klienten die Grenzen der Sozialpsychiatrie gesprengt haben und plötzlich aus ihrem Gesichtsfeld verschwunden sind, führte zu einer zaghaften aber stetigen Auseinandersetzung mit dem Thema geschlossene Versorgung, die inzwischen als gleichberechtigter und etablierte Baustein des GPV Stuttgart anerkannt ist.
8.3. Strukturen, Angebote und Aufgaben am Beispiel des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Stuttgart
Erläuterung zum Schaubild 8521:
Der Gemeindepsychiatrischer Verbund Stuttgart ist ein regionaler Zusammenschluss von trägerübergreifenden Anbietern psychiatrischer Hilfeleistungen, der sich für die Förderung von komplexen und bedarfsgerechten Hilfen für psychisch kranke Men-schen durch verbindliche und einzelfallbezogene Kooperation, unabhängig von der Art, Schwere oder Dauer der Erkrankung im Zuge einer regionalen Versorgungsver-pflichtung engagiert.522
Der Gemeindepsychiatrische Verbund Stuttgart ist in vier zentralen Gremien organi-siert, die mit unterschiedlichen Aufgaben und Mitgliedern betraut und besetzt sind. Diese Gremien sind das Steuerungsgremium, der Trägerverbund, die Hilfeplankon-ferenz (HPK) und die Beschwerdestelle. Die Aufgaben der Hilfeplankonferenz und 521 Vgl. Masanz, K (2009): S.: 105 ff 522 vgl. Obert, K. (2006): Forum gegenseitigen Lernens, In: Kerbe 3/2006; S. 35-36.
355
der Beschwerdestellen523 sind hinlänglich bekannt. Die der beiden anderen zentralen Gremien können folgendermaßen beschrieben werden: Das Steuerungsgremium dis-kutiert bzw. formuliert die Zielsetzungen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes in Bezug auf die Strukturen und die Weiterentwicklung der bestehenden Versor-gungsangebote, die Strukturen der Kooperation, die Weiterentwicklung der Hilfe-plankonferenz, die Erarbeitung und Definition von Qualitäts- und Gütekriterien für die Aufnahme und Zugehörigkeit in den Gemeindepsychiatrischen Verbund sowie die Festlegung der Moderation und Koordination der Hilfeplankonferenz. Im Steue-rungsgremium, das unter der Federführung der Sozialplanung der Stadt steht, sind sowohl Vertreter der Landeshauptstadt Stuttgart, der Angehörigen, der Betroffenen und der Bürgerhelfer als auch Trägervertreter der Versorgungseinrichtungen und der Sozialleistungsträger (Sozialhilfeträger, Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), Krankenkassen, Rentenversicherungsträger) und schließlich der Vorstand der Ärzteschaft Stuttgarts ständige Mitglieder. Zu den Aufgaben des Steuerungsgre-miums gehören die Verbesserung der Versorgung der betroffenen Bürger und die op-timale, d.h. effektive und effiziente Steuerung der Ressourcen zu initiieren. 524
Der Trägerverbund schließt die Trägervertreter aller psychiatrischen Versorgungs-einrichtungen in der Landeshauptstadt Stuttgart ein. Zu seinen Aufgaben gehört, die Vorschläge des Steuerungsgremiums unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Ressourcen und strukturellen Rahmenbedingungen umzusetzen und mögliche Syner-gien zwischen den Trägern abzustimmen und neue und besser angepasste Organisa-tionsstrukturen der psychiatrischen Versorgung zu planen und konzeptionell auf den Weg zu bringen. Er steht zur fachlichen Beratung für den Stadtkreis zur Verfügung und ist für die Erstellung eines Jahresberichts verantwortlich, der die Entwicklung der psychiatrischen Versorgung in der Region sowie die Kooperation mit nicht-pro-fessionellen Organisationen dokumentiert und statistisch erfasst. Ferner hat er die un-terschiedlichen Trägervorhaben abzustimmen. Der Trägerverbund definiert sich als verbindliches Gremium zur Regelung der Verfahrensweisen.
Erwähnenswert ist noch die personelle Entwicklung im Gemeindepsychiatrischen Verbund in Stuttgart. 1982 begann die Verwirklichung der aus der Psychiatriereform entliehenen sozialpsychiatrischen Leitlinien mit lediglich 9 Mitarbeiterinnen im Rah-men des Modellprogrammes der Sozialpsychiatrischen Dienste für ganz Stuttgart. In-zwischen umfassen die sozialpsychiatrischen Versorgungsbausteine innerhalb des Verbundes in Stuttgart ca. 210 Mitarbeitende.525
Die Expertenkommission der Bundesregierung forderte bereits 1988 zur Reform der psychiatrischen Versorgung den Gemeindepsychiatrischen Verbund. In Stuttgart wurde er 2004 ins Leben gerufen und konstituiert, wie auch sukzessive Gemeinde-psychiatrische Verbünde in anderen Regionen Baden-Württembergs (z. B. in Reutlin-gen, im Bodenseekreis oder in Ravensburg) auf der Grundlage von Kooperationsver-einbarungen und Absprachen zwischen der Stadt, den Leistungsträgern und den
523 www.ibb-pychiatrie-stuttgart.de; Informations-, Beratungs-, und Beschwerdestelle (IBB) Psychiatrie Stuttgart 524 vgl. Obert, K (2007): Referat am 11.10.07 der LAG Freie Wohlfahrtspflege NRW: Chancen und Risiken der Umsteuerung. S.: 7 ff. 525 vgl. Obert (2007). S.: 10.
356
Kostenträgern eingeführt wurden. Die oben angeführten Gemeindepsychiatrischen Verbünde sind allesamt Mitglieder des Vereins der Bundesarbeitsgemeinschaft Ge-meindepsychiatrische Verbünde e.V., der am 29.3.2006 in Kassel gegründet wurde. Zu den Aufgaben des Vereins gehört die Weiterentwicklung der Verbünde vor Ort und der Aufbau eines bundesweiten fachpolitischen Forums, um die Gemeindepsy-chiatrischen Verbünde zu stärken und zu etablieren.526
Wie sieht nun die Gremienstruktur des GPV in Stuttgart aus? Wie stehen diese zuei-nander? Wie sind die städtischen Ausschüsse und Kostenträger innerhalb des Ge-meindepsychiatrischen Verbundes beteiligt?
Erläuterung des Schaubildes 9:
Die Gremienstruktur ist zum einen durch die drei städtischen Ausschüsse (den Sozial- und Gesundheitsausschuss, den Krankenhausauschuss und den Gemeinderat) sowie durch die zentralen Strukturgebilde des Gemeindepsychiatrischen Verbundes und der vier Kostenträger (der Stadt Stuttgart, dem Rentenversicherungsträger, dem Land Ba-den-Württemberg, den Krankenkassen, aber auch den Berufsgenossenschaften) cha-rakterisiert und abgebildet. Die Kostenträger, die in allen Gremien und Fachausschüs-sen sitzen und an Entscheidungen beteiligt sind, sind durch die Stadt Stuttgart, bzw. die Abteilung des Sozialamtes, die Krankenkassen sowie die Rentenversicherungs-träger vertreten. Das Land ist ebenso zu einem Teil an der Finanzierung der Einrich-tungen beteiligt.
526 vgl. www.bag-gpv.de. Download am 21.8.2013
357
8.4. Gremienstrukturen des GPV Stuttgart �1!�&$2"�� $$2"3$$���
�
-�$��'��1�����
� �
GPV mit Kooperationsvereinbarungen 7��1������������������������������#������8�!&!��%9�
�
358
Erläuterungen zu Schaubild 10527:
Das Fundament des Hauses des Gemeindepsychiatrischen Verbundes fußt auf einem durch die Gemeinderatsdrucksache (GRDrs302/2005) verbindlich definierten Be-schluss, an dessen Entwicklung sowohl die für die psychiatrische Versorgung bedeut-samen städtischen Ausschüsse, wie der Krankenhausausschuss, der Sozial- und Ge-sundheitsausschuss, der z. B. auch mit einem festen Sitz für einen Vertreters der Erfahrenen-Initiative und des Stuttgarter Bürgerkreises ausgestattet ist, als auch der Gemeinderat beteiligt waren und noch immer sind. Es wird Wert darauf gelegt, dass alle maßgeblichen Vertreter der Kostenträger im Zuge des Steuerungsgremiums in die regionale Versorgung, Planung und Koordination integriert werden. Projektgrup-pen werden für eine zeitlich begrenzte Dauer vom Steuerungsgremium mit aktuellen Themen beauftragt, wie z.B. der Weiterentwicklung der Gerontopsychiatrischen Dienste oder der Integrierten Versorgung in Stuttgart.
Im anvisierten Wunschbild von OBERT kann gemeindenahe, sozialpsychiatrische Arbeit mit und für alle psychisch kranken Bürger eines Gemeinwesens erfolgreich sein, wenn medizinisch-psychiatrische Behandlung und sozialpädagogisch-sozialar-beiterische Betreuung und Begleitung gleichberechtigt Hand in Hand gehen, ohne dass eine Disziplin über die alleinige Definitions- und Handlungsmacht verfügt. 528 Das erwähnte Kontinuen beschreibt auf der einen Seite den Grundsatz, dass das In-dividuum im Zentrum des Handeln steht (Wahrung und Achtung von Respekt und Würde gegenüber den Betroffenen) auf der anderen Seite setzt der Ansatz auch ein kontinuierliches und engmaschiges Einbeziehen des sozial-familiären Umfeldes des Betroffenen und der professionellen Einrichtungen voraus. Hierbei sind die Identifi-kation von Ressourcen bei den Betroffenen sowie bei den beteiligten Akteuren die Vernetzung und Koordination der Zusammenarbeit von leitenden Handlungsprinzi-pien zu steuern. Während THIERSCH und OBERT unter Bezug auf die Alltags- und Lebensweltthe-orie eher die strukturelle Beschaffenheit und die bedeutsamen Wirkfaktoren der Ad-ressaten identifizieren, beschreiben, deuten und analysieren, legt HONNETH den Fo-kus auf den im Menschen stattfindenden innerpsychischen und emotionalen Prozess, der im extremen Fall, die Klientel der TSSP, in einen Zustand von Nicht-Entfrem-dung oder eben Entfremdung, die krank macht oder traumatisiert, manövriert. Die Folgen können Vorurteile, negative Zuschreibungen und Etikettierungen, gruppen-bezogene Menschenfeindlichkeit sein, die zu einer örtlichen Marginalisierung und sozialen Stigmatisierung führen, indem die Person zum Ausgestoßenen, zum Über-flüssigen deklariert wird und ihren Ort des Verbleibs in Wohngegenden mit einem niedrigen soziökonomischen Belastungsrad zugewiesen bekommt oder eben in insti-tutionellen Settings, wo der professionelle sozialpädagogisch/ sozialarbeiterische Handlungsauftrag die Integration, Teilhabe und Rehabilitation in die Gesellschaft umfasst, die sich jedoch trotzdem um Abgrenzung und Exklusion bemühen. In der ambulanten Versorgung kam es in den letzten Jahren zu einer Arbeitsverdich-tung, die personell nicht kompensiert wurde. Hatte z.B. in Stuttgart 1995 noch ein
527 Vgl. Masanz, K (2009) a.a.O. S.: 109 ff 528 Vgl. a.a.O.; Obert; S. 315.
359
100 % SpDi Mitarbeitender die Fallverantwortung für 40-50 Klienten, so schnellte diese Fallzahl binnen 10 Jahren auf 90-110 Klienten hoch. Ähnliche Entwicklungen sind im Jugendamt, der Bewährungshilfe der Fall, alles Dienste, die mit hoheitlichen Aufgaben ausgestattet sind. Welche langfristigen Auswirkungen diese Arbeitsver-dichtung, z. B. diese Veränderungen des methodischen Arbeitsansatzes und die nach-lassende Intensität eines aufsuchenden sowie eines netzwerkorientierten Ansatzes hat, ist noch nicht abzusehen. Welche Einflüsse und Auswirkungen die schnelle An-häufung von Fallzahlen für einen höheren Bedarf im stationären offenen aber auch im geschlossenen Wohnen haben wird, ist offen. Es gibt aber Hypothesen, die auf einen veränderten Bedarf im Zusammenhang einer qualitativ-regionalen Grund- und Pflichtversorgung, die zunehmend dem Diktat der Krankenkassen unterliegt, hinwei-sen.
Entsprechend dieser Entwicklung wurde in Anlehnung an das Hotel Plus Konzept 529 des DRK in Köln auch in Stuttgart ein zunehmender Bedarf für eine spezifische Kli-entel entdeckt und beschrieben, die über die konventionellen sozialpsychiatrischen Angebote, Zugänge und Wege nicht erreicht oder nur unzureichend erreicht wurden. So ist über die Aktion Mensch ein auf 3 ½ Jahre angelegtes Projekt finanziert und ins Leben gerufen worden. Das Projekt bestand aus einem Straßensozialarbeitsprojekt und einer Sozialhotelbetreuung in Stuttgart -Bad Cannstatt-. Im Verlauf der Projekt-arbeit wurden im ersten Sozialhotel Stuttgarts mit einer niederschwelligen sozialpsy-chiatrischen Begleitung eine spezifische Gruppe wahrgenommen und beschrieben, die viele ähnliche aber auch identische Merkmale mit der Gruppe der TSSP aufwie-sen. In der Folge wird auf eine bereits angelegte Datenbank Bezug genommen, die hierzu überarbeitet und gezielt bezüglich der Suche der Gruppe der TSSP ausgewertet wurde.
8.5. Versorgung der Gruppe der TSSP in einer Hotel-Plus- Einrichtung
8.5.1. Ergebnisse eines sozialstatistisches Samples einer Hotel-Plus-Einrichtung in Stuttgart
Aus einer Sozialhotelstatistik530 können weitere Hinweise auf die Identifikation der Merkmale für die Gruppe der TSSP abgeleitet werden, die für den Zeitraum 01/2005 - 30.6.2008 bei N=87 Personen in der Sozialhotelbetreuung in einem Sozialhotel in Stuttgart erhoben wurde. In diesem Zeitraum wurden gezielt wohnungslose Men-schen, die ohne festen Wohnsitz waren oder sich in unsicheren Wohnverhältnissen (z. B. in Haft, in der Psychiatrie oder in Notunterkünften, bei Bekannten) aufhielten oder über die Straßensozialarbeit oder das „MedMobil“ betreut und behandelt wur-den, in ein einfaches möbliertes Hotelzimmer aufgenommen.
529 Konzept Hotel Plus: vgl. www.drk-koeln.de 530 Masanz, K. Schüle I. (2008): Abschlussbericht Projekt „Aktion Mensch“ Sozialhotelbetreuung und Stra-ßensozialarbeit Bad Cannstatt. S.: 19-31; 59-64 http://www.caritas.Stuttgart.de/aspe_shared/form/download.asp?nr=218514&form_typ=115&a-cid=0BAD35AFCF0D46D2B3944A8D763F07C19C8&ag_id=378
360
Die Auswertung des sozialstatistischen Samples ergab folgende Ergebnisse: Unter den 87 erhobenen Personen waren 67 Männer (77%) und 20 Frauen (22,9%). 51 Per-sonen waren ledig, 10 verheiratet, 2 verwitwet und 9 geschieden.
In der Altersgruppe der 18-25 Jährigen gab es 5 Hotelbewohner, in der Kategorie der 26-35 Jährigen 24; in der Kategorie 36-45 Lebensjahre 18, bei den 46-50 Jährigen 15, in der Kategorie der 51-60 Jährigen 21 und in der Kategorie der 61-75 Jährigen 4 Hotelbewohner.
Bei den 87 sind 31 (35,6%) psychisch krank, 9 (10,4%) von den insgesamt 87 Hotel-bewohnerinnen befinden sich 10 in allgemeinärztlicher Behandlung, 2 (2,3%) in fachärztlicher Behandlung. Bei 13 Hotelbewohnern liegt eine schizophrene Psychose vor, bei 2 eine affektive Psychose, bei einer Bewohnerin eine Borderline-Persönlich-keitsstörung, bei 4 eine depressive Erkrankung, bei zwei Männern eine Persönlich-keitsstörung, beim einen vom dissozialen, beim anderen vom narzisstischen Typ. Bei 9 Bewohnern lagen unterschiedliche Verhaltensauffälligkeiten wie z. B. autoaggres-sive Handlungen, Hospitalismus, Mutismus oder ein Verwahrlosungssyndrom vor. Eine Person verweigerte sich über Monate hinweg zu duschen, eine Frau ernährte sich ausschließlich von Abfällen, eine Frau trug Kleidung bis sie sich auflöste, ein Mann schrieb mit seinem Blut Botschaften an die Zimmerwand usw.
Zu den weiteren psychosozialen Problemlagen gehören Überschuldung, fehlender Krankenversicherungsschutz, ein Ausschluss von ärztlicher Versorgung durch ge-ringe finanzielle Mittel, da Rezepte oder Praxisgebühren in der Zeit von 2005-2009 noch gesetzlich vorgeschrieben) nicht bezahlt waren und konnten. So entstand als konzeptionelle Konsequenz die Entwicklung und Etablierung eines Med-Mobils in Stuttgart, wie sie in Berlin, Köln, Frankfurt und Hamburg schon angeboten werden, um barrierefreie, niederschwellige, kostenfreie ärztliche und gesundheitspflegerische Versorgung an den Orten anzubieten, die von den Menschen, die wohnungslos sind, als Treffpunkt akzeptiert werden oder die ihnen zugewiesen wurden, wie z. B. in Parks, an Bahnhöfen, vor Tagesstätten für Wohnungslose oder vor Einrichtungen, usw. Hier werden ein vernachlässigter Zahnstatus, diverse Wundarten, Ausschläge, Pilzerkrankungen, Verletzungen nach Stürzen oder Auseinandersetzungen, aber auch internistische, urologische und gynäkologische Indikationen für eine Weiterbehand-lung festgestellt.
Von den erhobenen 87 Hotelbewohnerinnen befanden sich zuvor 22 (25%) im Haft-vollzug oder im Maßregelvollzug.
361
8.5.2. Abhängigkeitserkrankungen
Tabelle 23: Anteil der Personen mit Abhängigkeitserkrankung bei einer Stichprobe von n=87 in einem Sozialhotel: 55, 17 %
Erläuterung:
Zum Zeitpunkt der Aufnahme der wohnungslosen Personen im Erhebungszeitraum von 1.1.2005-30.06.2008 waren von den 87 Personen, die in dem Sozialhotel gelebt haben, 31 alkoholabhängig (28 Männer und 3 Frauen), illegale Drogen i.d.R. Canna-bis, Marihuana oder synthetische Drogen konsumierten 9 Männer und 2 Frauen. 3 der Männer und 2 der Frauen übten eine polytoxikomanen Konsum aus, 1 Mann litt an Spielsucht und 5 Männer sowie 2 Frauen haben hierzu keine genauen Angaben ma-chen wollen. Betrachtet man Verhalten im Kontakt körperliche Symptome, gab es für die Gruppe der 7 Personen, die keine Angaben machen wollten, Hinweise auf eine offensichtliche Suchtmittelabängigkeit. Es bleibt eine Dunkelziffer von Befragten, die aus Scham, Verdrängung oder Negation, sich nicht eingestand, z.Z. der Befragung suchtkrank zu sein.
362
8.5.3. Psychische Erkrankung
Tabelle 24: Anteil der psychisch kranken Personen bei einer Stichprobe von n=87 in einem Sozialhotel in Stuttgart: 32,2%
Erläuterungen:
Von den 34 psychisch kranken Personen, die auf der Grundlage ihrer Wohnungslo-sigkeit einen Platz im Sozialhotel bekommen haben, haben 20 eine psychotische Er-krankung (13 x Männer und 7 x Frauen), 9 eine Persönlichkeitsstörung, darunter 4 Mal vom emotional-instabilen oder sogenannten Borderline-Typ, in der Verteilung 2 x Frauen 2x Männer. 5x Männer mit einer Persönlichkeitsstörung vom narzisstischen Typ, weitere 4 Männer geben eine depressive Erkrankung an, die mit Hilfe einer hochriskanten Menge an Alkohol versuchten, ihre Stimmung zu regulieren.
1 Person wusste nicht genau, wohin sie sich einordnen sollte. Hier lag mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Mischform aus Persönlichkeitsstörung mit einem leicht kränkbaren Reaktionsverhalten und einer Beeinträchtigung im Antrieb vor, sowie eine geschilderte grundlose Traurigkeit, die in Episoden aufkam und Hinweise für eine depressive Grunderkrankung lieferte.
Tabelle 25: Anteil der Personen mit psychischer Erkrankung an der Stichprobe (n=87) zum Zeitpunkt der Aufnahme im Sozialhotel: 39%
363
Erläuterungen:
34 Personen (26 Männer von 67 und 8 Frauen von insgesamt 20) weisen zum Zeit-punkt der Aufnahme im Sozialhotel eine psychische Erkrankung auf. Bezogen auf den Anteil der Frauen und der Männer, die im Erhebungszeitraum begleitet wurden, ergibt das einen Wert von 40% Anteil an psychisch kranken Frauen und 38,8% an psychisch kranken Männern, die als wohnungslose Menschen in einem Sozialhotel aufgenommen wurden. 49 der Bewohnerinnen gaben im Zuge einer Selbstbeschrei-bung an, keine psychische Erkrankung zu haben. 4 der Befragten entschieden sich zwar für die Option -keine Angaben-. Im Verlauf der Hotelbetreuung wurde gerade von den Personen in Einzelgesprächen jedoch von früheren Aufnahmen in der Psy-chiatrie, von hausärztlichen Behandlungen mit Neuroleptika oder von langanhalten-den schweren Burnout-Syndromen und depressiven Phasen berichtet, die länger als 6 Monate anhielten und schließlich zu Arbeits- und Wohnungslosigkeit, sozialem und finanziellem Abstieg, zu körperlichen und psychosomatischen Symptomen geführt haben.
8.5.4. Fachärztliche Behandlung der Gruppe der TSSP
Tabelle 26: Anteil der Personen mit psychischer Erkrankung, die sich in (fach)ärztliche Behandlung begeben, zum Stichtag (Aufnahmetag) in ein Sozialhotel:
Erläuterung:
Von den insgesamt 34 psychisch erkrankten Personen und den 4 Personen, die zu-mindest deutliche Hinweise auf eine Erkrankung liefern, befinden sich 16 in ärztli-cher Behandlung, wobei sich hier fast die Hälfte (7) der Personen in hausärztlicher Behandlung befindet und der Hausarzt die psychopharmakologische Behandlung übernimmt. 20 Personen befinden sich nicht in ärztlicher Behandlung, lehnen diese entschieden und deutlich ab, da sie z. B. durch Zwangsmaßnahmen, wie z. B. Fixie-rungen, Zwangsmedikation, Kontaktsperre, Zimmereinschluss, geschlossene Unter-bringung etc. in der Psychiatrie traumatisiert sind bzw. schlechte Erfahrungen mit den psychiatrischen Versorgungsangeboten der Gemeindepsychiatrie gemacht ha-ben. Diese Gruppe zieht es vor, sich mit Alkohol oder illegalen Drogen selbst zu medizieren. Eine Person, die auch psychisch krank ist, hat hierzu keine Angabe ge-macht. Im Verlauf der Betreuungszeit wurde bei weiteren 15 Personen eine fachärzt-liche Behandlung erreicht, durch aufsuchende Hausbesuche im Hotel oder Begleitun-gen zur Psychiatrischen Institutsambulanz.
364
8.5.5. Komorbidtität
Tabelle 27: Anteil an Komorbidität der Stichprobe, die wohnungslos (n=87), psychisch krank (n2:34) und sucht-krank (n3=48) sind
Erläuterungen:
6 Personen erfüllen das Kriterium, wohnungslos, psychisch krank und alkoholabhän-gig zu sein. 6 weitere Personen konsumieren illegale Drogen und 2 Personen konsu-mieren neben ihrer psychischen Grunderkrankung in hochriskanter Dosierung Alko-hol, THC, Kokain, LSD, Amphetamine und andere Drogen. 18 gaben an, neben der psychischen Erkrankung keine Suchtmittel zu konsumieren und zeigen somit kein suchtmittelabhängiges Verhalten an. 2 Personen haben keine Angaben gemacht, er-wähnten jedoch unter der Rubrik Ergänzungen, dass sie nicht dauerhaft, sondern le-diglich phasenweise illegale Drogen oder Alkohol, dafür in hochriskant-gefährlicher Menge konsumieren würden.531
WESSEL & WESTERMANN führen bei Alkoholerkrankungen als begleitende Er-krankungen psychische und psychiatrische Probleme an, wie z.B. Delirium tremens, Alkoholhalluzinosen, pathologische Eifersucht, Depressionen, Angsterkrankungen, erhöhtes Suizidrisiko, Suizidhandlungen, körperliche Krampfanfälle, Polyneuropa-thie, Hirnatrophien, Lebererkrankungen, Pankreatitis, Magen- und Darmerkrankun-gen sowie Herz- und Kreislauferkrankungen und Unfälle im Haushalt, im Straßen-verkehr oder am Arbeitsplatz.532
531 Definition nach KRAUS & Augustin (2001), die auf der Grundlage einer Studie von n=8139 Probanden von hochriskant-gefährlich Konsummuster ausgehen bei mehr als 60g Reinalkohol pro Tag, von riskantem Konsummuster bei 30-60 Reinalkohol bei Männern (das sind z.B. 3 x 0,2l Bier oder 3x 0,1 l Wein und ent-spricht 30 g Reinalkhol, ausgehen, wohingegen der Wert bei den Frauen 20-40g entspricht und bei 2x 0,2l Bier oder 2 x 0,1l Wein bereits 20 g Reinalkohol entspricht. 532Wessel, T. Westermann, H. (2002): Problematischer Alkoholkonsum. Entstehungsdynamik und Ansätze für ein psychoedukatives Schulungsprogramm. Lambertus Verlag. Freiburg i. B., S. 51-70.
365
D: Ergebnisse und Zusammenfassung
„Der Mensch hat stets eine Vergangenheit hinter sich. Was dem Leibe geschah, jede Krankheit hinterlässt Spuren. Was der Seele geschah, d.h. was bewusst wurde, was getan und gedacht wurde, ist als Erinnerung ein Grund für das Folgende. Wir sind jederzeit das Ergebnis unserer bis dahin erfahrenen Geschichte. Und zwar ist der Mensch in keinem Augenblick ohne Vorgeschichte, er ist niemals Anfang vom Gan-zen, weder objektiv für die biologische Betrachtung, die seine Vorgeschichte bis in die Vererbungszusammenhänge verfolgt, noch subjektiv für sein Bewusstsein: vom ersten Akt seines Selbstbewusstseins an ist ihm ein vorher, so wie wir ihm, leiblich und durch Erinnerungen, er ist getragen und gefesselt von seiner Vergangenheit, auch der vergessenen. Was er wird, ist durch diese Vergangenheit bestimmt, aber auch durch die Weise, wie er sie verarbeitet.“ 533
9. Kapitel
„Wenn Menschen durch Institutionen nicht gedemütigt werden, kann von einer an-ständigen Gesellschaft die Rede sein. Demütigung und Kränkung eines Menschen durch Institutionen kann schleichend beginnen und verschiedene Grade entwickeln.“
Avishai Margalit
9.1. Zielsetzungen � Die unterschiedlichen Methoden, der Wissenstransfer, sowie die Spezifikationen in
der jeweiligen Arbeit mit der Klientel sind in den jeweils beteiligten Disziplinen und Arbeitsfeldern wenig bekannt. (Beschreibung des Personenkreises innerhalb einer Versorgungsregion, die durch einen GPV strukturiert ist)
� Wie ist die Gruppe der Trans-Sektoralen-Systemprüfer charakterisiert? (Tabelle 8-11, 14, 20+20.1)
Soziodemographischen Merkmale (Geschlechterverteilung, Alter, Altersgruppen, Fa-milienstand, Migrationshintergrund, transkulturelle Bedeutung, bestehende Kontakte mit der Kinder- und Jugendhilfe, der Wohnungslosenhilfe und der Suchtkrankenhilfe, mit dem Straf- und Maßregelvollzug)
� Was ist über den Schulabschluss/ Bildungsstand bzw. dem Ausbildungsniveau der Gruppe der TSSP zu sagen? (Tabelle 12 +13)
� Mit welchen unterschiedlichen Feldern Sozialer Arbeit hatte diese Gruppe bis zur Auf-nahme in eines der drei geschlossenen Einrichtungen Kontakt? Warum waren die vor-hergehendenden Hilfen nicht erfolgreich bzw. konnten nicht wirksam genutzt werden? (Tabelle 15-18)
� Ist die Klientel, die auf die 3 Einrichtungen innerhalb einer Versorgungsregion verteilt ist, eine homogene Gruppe? Welche Unterschiede, welche Merkmale, welche Ge-meinsamkeiten und welche Häufungen gibt es? (Tabelle 12-14)
533 Vgl. a.a.O. Jaspers, K., Seite: 583.
366
� Die generierten Erkenntnisse der biographischen Fallrekonstruktionen und des sozial-statistischen Samples ergänzen sich und liefern konzentrierte Angaben über die Ge-staltung der Hilfen, der Interventionen und der Behandlung. (Schaubild 11, 12, 13)
9.2. Ergebnisdarstellung der biographischen Rekonstruktion
9.2.1. Gemeinsame Merkmale und Kategorien der vier ausgewählten Biographen
„Die Erinnerung ist ein beständiger Fluss, weil das Bewusstseinsleben ein beständi-ger Fluss ist, und nicht nur Glied an Glied in der Kette sich fügt. Vielmehr wirkt jedes Neue zurück auf das Alte, seine vorwärtsgebende Intention erfüllt sich und bestimmt sich dabei, das gibt der Reproduktion eine bestimmte Färbung.“534
- Die Biographen durchleb(t)en und erleb(t)en als Kinder, schwere individuelle, fa-miliäre, transgenerative, nationale oder kollektive Krisen: Eine Biographin kommt als Bürgerkriegsflüchtling nach Deutschland, ein Biograph flieht von Ost- nach West-deutschland, eine Biographin kommt als Russlanddeutsche nach der Auflösung der Sowjetunion in ein Flüchtlingsheim der BRD, ein Biograph durchwandert als Kind und Jugendlicher einer schwer psychisch kranken Mutter, aus einer sich auflösenden Familie, Kliniken und Kinderheime.
- Die Biographen haben Entwurzelung, Flucht, den Verlust der Heimat, aus politi-schen, aus ökonomischen, aus beruflichen, aus existentiellen Gründen (Vernachläs-sigung) erlebt.
- Die Bindung zur Mutter/Vater wird bei den Biographen ersetzt durch das Jugend-amt, durch eine Hausmutter, Heimmutter, durch Heimleiter, durch institutionelle Be-zugspersonen außerhalb der Herkunftsfamilie.
- Die Biographen sind aus Schulen, Einrichtungen, Kliniken, Therapieeinrichtungen oder Beratungsstellen verwiesen worden, weil sie Hausregeln, Therapieregeln, Um-gangsregeln nicht eingehalten oder immer wieder verletzt haben. Die Biographen können nur begrenzt Einfluss auf ihr Verhalten, ihr Handeln nehmen. Ihnen fehlen soziale, zwischenmenschliche Kompetenzen und Fertigkeiten, sowie die Fähigkeit sich in andere Menschen oder in andere Perspektiven hineinzuversetzen (Empathie-fähigkeit).
- Die Bedeutung einer fehlenden, unerreichbaren oder verlorenen Vaterfigur nimmt bei allen vier Biographen eine besondere Rolle ein: Bei Hrn. Noller handelt es sich um eine lebenslange Phantasiefigur, die an einem unbekannter Wohnort, vermutlich Berlin, lebt. Fr. Satic verliert ihren Vater im Bürgerkrieg, sie ist aber noch immer in „geistiger“ Verbindung und akzeptiert nur ihren Vater als einzige Autorität. Bei Fr. Brandt ist der biologische Vater unbekannt, ihr Adoptivvater stirbt an einer Überdosis Heroin in der Badewanne, ihre dritte Vaterfigur verschwindet ebenso plötzlich und endgültig. Bei Hrn. Grün ist der Vater, der seinen sportlichen Ehrgeiz auf den Sohn projiziert, emotional für lange Zeit nicht erreichbar.
534 Husserl, E. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. 1892-1917 herausgegeben von Rudolfs Boehr. Den Haag. Nijhoff. 1976. Gesammelte Werke. Band 10. S. 412.
367
- Die Beschreibungen der Partner bei den Biographinnen fällt folgendermaßen aus: „Er ist der, mein Retter! Er ist göttlich! Er ist die oberste Instanz. Er ist ein Wunder-mensch.“ Der Partner bekommt omnipotente Etikettierungen und Eigenschaften zu-geschrieben und erfährt so eine größtmögliche Idealisierung. Ohne Partnerschaft empfinden sich die Biographinnen als unvollständig. Nur durch den Partner ist ein weitgehend autonomes Leben, zumindest ein institutionsfernes Leben möglich. Die männlichen Biographen hingegen kommen weitgehend ohne romantische Beziehung aus, sie geben dieser wenig Bedeutung und Raum in den Interviews. Sie erwähnen sie nicht, lassen dieses Feld aus. Beide Biographen, die sich jedoch nach einer Part-nerschaft sehnen und diese vermissen, berichten außerhalb der Interviews, in Einzel-gesprächen, über den negativen Einfluss und die Nebenwirkungen von Neuroleptika auf das gesamte Sexualleben.
- Die Biographen haben initialisierende, traumatisierende Lebensereignisse erlebt, die die Sicherheit im Leben, die Bindung gegenüber Bezugspersonen nachhaltig be-schädigt haben. Bei Hrn. Noller wird das eigene Leben durch den Stiefbruder bedroht, der auf ihn schießt oder durch die Mutter, die ihn als Kleinkind nicht ausreichend versorgen kann und er in einem mangelernährten Zustand in eine Kinderklink in Ob-hut genommen werden muss. Hr. Grün erfährt eine existentielle Flucht aus seiner Heimat und befindet sich inmitten eines einflussreichen, schwerwiegenden transge-nerativen Familientraumas, das durch den KZ-Aufenthalt, durch Heirats-, und Be-rufsverbot des jüdischen Großvaters mütterlicherseits angestoßen und sich durch die Berufs- und Ausreiseverbote der Eltern und die Aufenthalte in Gefängnisse der Staatssicherheit fortgesetzt worden ist.
- Bei den Biographen liegen fragmentierte Herkunftsfamilien, bzw. sich auflösende oder bereits aufgelöste Primär- und Sekundärfamilien vor, die durch Gewalt, Miss-brauch, institutionelle Kontakte mit Polizei, Jugendamt, Justiz, durch psychische Er-krankungen der Bezugsperson oder durch dominierende Suchterkrankungen oder schwere somatische Krankheiten in der Familie geprägt sind.
- Die Biographen erleben innerhalb der Familie Gewalt, seelischen oder sexuellen Missbrauch. Sie suchen und finden außerhalb des familiären Gesichtsfelds Anerken-nung in Gangs, im Milieu. Sie suchen sich willkürliche Opfer auf der Straße oder unter den Peers aus. Sie üben im Alltag körperliche Gewalt aus oder leben diese in Gedanken, in der Phantasie aus, bis dahin, sogar Waffen zu kaufen, und sich einen Amoklauf, eine Selbsttötung oder eine Tötung einzelner Mitschüler oder des Lehr-körpers, in einem fixierten Sinne, zu imaginieren.
- Die Biographen verwenden die freie Zeit, mit Kiffen, mit übermäßigem Alkohol-konsum, um das Erleben der gegenwärtigen Zeit zu verkürzen. Alles dreht sich ums Kiffen, um Drogenbeschaffung, sie erzählen sich gegenseitig ihre Rauschgeschich-ten.
- Die Biographen erleben ein frühes Einsetzen einer Medikalisierung, somit eine Be-einträchtigung der Wahrnehmung, des Erlebens, Denkens und Fühlens. Sie erleben einen stetig aber fortschreitenden Prozess eines Auseinanderdriftens der Selbst- und Fremdwahrnehmung: Sie nehmen ihre Umwelt als komisch, unwirklich, seltsam, un-stimmig, skurril, mit verzögerter, gehemmter, blockierter und nicht nachvollziehbarer
368
Wahrnehmung auf. Im Gegensatz dazu können die Biographen die Einschätzung, die Rückmeldungen, das Erleben und Wirken der Mitmenschen nicht oder nur einge-schränkt verstehen, auf sich beziehen und integrieren.
- Die Biographen präsentieren frühzeitig Symptome von Schul-, und Leistungsver-weigerung, die Schule stellt im selben Maße eine Regelbeschulung in Frage. Die Bi-ographen zeigen starke Beeinträchtigungen der Konzentration, der Ausdauer, der kognitiven Merkfähigkeit. Sie träumen sich im Unterricht weg oder fallen dauerhaft durch störendes Verhalten auf. Sie nehmen im Klassenverbund eine Außenseiterstel-lung ein, werden gehänselt oder zum Opfer der Klasse. Sie erfahren Cypermobbing, körperliche Gewalt in Pausen, auf der Schultoilette, nach der Schule und auf dem Heimweg. Sie haben Angst vor ihren Mitschülern oder sie werden umgekehrt selbst zu starken und aktiven „Täter“ gegenüber anderen Mitschülern. Die Biographen er-reichen ihre schulische Qualifikation weit unterhalb ihrer intellektuellen Fähigkeiten. Sie haben während der Schulzeit Kontakt mit Beratungslehrern, dem schulpsycholo-gischen Dienst, mit dem Jugendamt. Die Indikationen für eine Behandlung durch den Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie lau-ten: Schulphobie, Ängste, Zwangsstörungen, Schulverweigerung, Verhaltensstörung oder Störung des Sozialverhaltens.
- Die Biographen erleben sich selbst in ihrer Umwelt frühzeitig als fremd, nicht da-zugehörig, sie nehmen sich in der Welt als nichtkohärent wahr.
- Die Biographen berichten von Gewaltphantasien, sie konsumieren häufig PC-Spiele von der Kategorie Shooterspiele; Waffen und Messer, die sie auch in der Schule bei sich führen, üben eine hohe Faszination aus.
- Die ersten biographischen Erinnerungen treten bei den Biographen spät ein (vgl. Auslassungen) und werden idealisiert und positiv präsentiert. Die ersten Erinnerun-gen sind versteckt, verschüttet, sie wurden verdrängt, sublimiert, sie bleiben aus Scham unerwähnt. Auf der Grundlage eines kategorialen Verbots oder Geheimnisses in der Familie wird darüber geschwiegen, sie sind schmerzhaft und bleiben deshalb unerwähnt. Die ersten Erinnerungen der Biographen sind durch eine Mixtur aus Re-alität, Wirklichkeit versus Fiktion, Wunsch und Erdachtes charakterisiert: Die Bio-graphen berichten von einem paradiesischen Leben, in dem Fr. Brandt Herzkirschen aus Omas Garten naschen durfte, so viel sie wollte. Fr. Satic berichtete, ihr erging es wie einer Prinzessin, sie bekam 1000 Geschenke und war der Augapfel ihres Vaters. Hr. Noller sprach davon, erlöst worden zu sein und in einem Hof des Kinderheims, der asphaltiert war, unbedarft Fußball spielen zu können. Hr. Grün erzählt, wie er ab der 3. Klasse Freunde und Anschluss gefunden hat, …„ab da (hüstelt) darf berichtet werden.“
- Die Biographen sprechen und wählen eine Person aus, die sie erlösen, heilen oder retten wird. Der tote Vater, der mit Fr. Satic in Kontakt steht. Die inzwischen demente Oma bei Fr. Brandt „..für mich is es (….) wenn die Oma nicht mehr da ist, wie wenn ich nicht mehr am Leben wäre“. Die schizophrene Mutter bei Hrn. Noller, die nach ihren Sohn verlangt und der unerreichbare Vater bei Hrn. Grün.
369
- Die Biographen haben Erfahrungen von willkürlicher, sexueller, seelischer, körper-licher Gewalt und Missbrauch durch den Großvater, den Vater, den Adoptivvater, den Freund der Mutter oder der Mutter erlebt.
- Die Biographen erlebten frühen Missbrauch und Konsum von Alkohol, Nikotin, Drogen und PC Spielen.
- Die Biographen beschäftigen sich zentral mit der Frage der eigenen Identität, so-wohl mit der geschlechtlichen Identität, wie das bei Fr. Brandt als „girl-boy“ der Fall ist, als auch mit der Frage nach der kulturellen Identität bei Fr. Satic oder bei Hrn. Noller mit der Frage, wer er denn überhaupt sei?
- Im Verlauf der psychiatrischen Erkrankung und der häufigen Klinikbehandlungen wurde bei den Biographen eine Vielzahl an unterschiedlichen Diagnosen erstellt, die wiederum unterschiedlichste Medikamentenbehandlungen zur Folge hatten.
- Die Biographen beschreiben gegenüber ihrer Herkunftsfamilie starke und ambiva-lente Pendelbewegungen, die sich zum einen weit und endgültig weg von der Familie orientieren und zum anderen sich dann wieder zurück in den Schoß der Eltern oder eines Elternteils bewegen.
- Die Biographinnen weisen frühe Partnerschaften nach. Fr. Satic ist mit 13 Jahren für sieben Jahre mit ihrem ersten Freund zusammen. Fr. Brandt ist mit 15 Jahren mit ihrem ersten Partner zusammen, mit dem sie sich verlobt und fest entschlossen beab-sichtigt, ihn zu heiraten und zusammenzuziehen. Für die Biographinnen nehmen ihre Partner auch eine zentral beschützende Funktion ein. Dasselbe berichten sie dann nach dem Verlust oder Trennung des Partners über die Funktion des Personals der Klinken, der Einrichtungen und Institutionen, die dann Schutz und Sicherheit anbie-ten.
- Die Biographen haben vor ihrer Volljährigkeit Suizidgedanken gehabt, Suizidver-suche unternommen, z. B. bei Hrn. Grün (Fall 1) durch eine Tablettenüberdosis, oder durch eine Drogenüberdosis, bei Fr. Brandt (Fall 2) durch einen Sprung aus dem Fenster oder durch sich selbst anzünden oder bei Fr. Satic (Fall 3) durch Alkohol-missbrauch und durch ein grundsätzlich missbräuchliches Verhalten, das ein weiteres 3. Aneurysma auslösen könnte oder durch eine Heroinüberdosis oder durch erwor-bene Waffen, mit denen Hr. Noller (Fall 4) einen erweiterten Suizid, einen Suizid oder einen Amoklauf in Schule in Erwägung zieht.
- Bei den Biographen ist die Mutter jeweils psychisch vorbelastet, krank oder schwer traumatisiert. Bei Fall 1 ist die Mutter durch die Inhaftierungen und Verhöre der Staatssicherheit traumatisiert, bei Fall 2 ist die Mutter alkoholkrank und gewalttätig, bei Fall 3 leidet die kriegstraumatisierte Mutter an einer Angststörung und Depression und die Mutter von Hrn. Noller ist unbehandelt psychosekrank.
- Das Krankheitsverständnis und die daraus resultierende Hilfeannahmebereitschaft bei den Biographen können wie folgt beschrieben werden. Sie sind der Einschätzung, keine Hilfe zu benötigen, da sie dadurch nur bevormundet und entmündigt werden. Man wolle sich nicht ständig von anderen sagen lassen, was man tun solle. Das Selbstverständnis von Krankheit beschreibt Fr. Satic so, dass sie davon ausgehe, gar
370
nicht psychisch krank zu sein, sondern vielmehr vom Teufel verflucht und das könne nicht mit Medikamenten sondern durch nur ein heilendes Wasserritual eines Hod-schas behandelt werden. Medikamente beeinflussen das eigene Befinden nicht oder nur in einem sehr geringen Umfang. Die Vorstellungen zur geeigneten Behandlung beschränken sich auf, „wenn ihr mich in Ruhe lasst, dann brauche ich keine Hilfe“ bis hin zu „Ich bin eigentlich nicht wirklich psychisch krank, das kommt nur von außen!“ oder „Ich kann mich heilen, habe Heilerfahrungen, verfüge über magische Kräfte“. Die Biographen sind der Überzeugung, wenn sie nur eine Partnerin oder Partner finden würden, eine Wohnung zugeteilt bekämen und Sozialhilfe bezögen, kämen sie ohne Unterstützung oder mit minimaler Hilfestellung im Leben aus.
- Die Biographen erleben eine körperliche Entfremdung infolge der Langzeitein-nahme von hochpotenten Psychopharmaka und neuroleptischer Depotinjektion. Im Fall 1 erfährt Hr. Grün eine Phase von selbstgefährdender Mangelernährung bis hin zu einer adipösen Gewichtszunahme und Schwankungen des Körpergewichts um 51 Kg, von Minimum: 72 Kg bis hin zu Maximum: 121 kg. Fr. Brandt, im 2. Fall, leidet zu Beginn der Krankheit unter Bulimie, anschließend an Magersucht. Sie wird in Kri-senzeiten immer wieder mit Sonden zwangsernährt. Sie versucht der Zunahme in-folge der der notwendigen Medikamenteneinnahme gezielt durch ihr radikales Ess-verhalten entgegenzuwirken. Im Fall 3 wird Fr. Satic mit einer schlanken Figur im Heim aufgenommen und entwickelt im weiteren Verkauf eine stark adipöse Gestalt, mit einem stark aufgeblähten Unterbach und Bartwuchs. Hr. Noller hingegen, im Fall 4, zeigt ein dauerhaftes Untergewicht, mit einer Tendenz zur Magersucht bei einem BMI von zwischen 17,5-18.
- Die Biographen befinden sich ab Krankheitsbeginn überwiegend in stationären Ein-richtungen, in Kliniken, im Maßregelvollzug, in geschlossenen oder offenen Heimen oder in psychiatrischen Pflegeheimen. Die Einrichtungsmatrix in Schaubild 11 gibt hierzu weitere Auskünfte. Der Biograph im Fall 1 befindet sich lediglich 12 Monate, dann eine weitere kurze Phase im ambulant betreuten Wohnen und wird in diese Zeit von seinen Eltern vollversorgt; außerdem wohnt er für wenige Wochen in einem So-zialhotel mit SpDI Betreuung bevor für ihn die Maßregel angeordnet wird. Die Bio-graphin im Fall 2 lebte in einer Phase für 12 Monate und in einer weiteren Episode für 9 Monate, jeweils mit ihrem Partner in einer Trägerwohnung des Ambulant Be-treuten Wohnens zusammen. Die Biographin im Fall 3 erlebt drei Phasen des Ambu-lant Betreuten Wohnens. Einmal direkt nach einem geschlossenen Heimaufenthalt im Zuge einer intensiven ambulanten Wohnunterstützung in einer Trägerwohngemein-schaft für drei Monate, dann erneut nach einem geschlossenen Heimaufenthalt für 11 Monate und der Biograph im Fall 4 wird seit Krankheitsbeginn lediglich für eine kurze Zeit von fünf Monaten im eigenen Wohnraum ambulant begleitet.
371
9.2.
2. C
hro
no
log
isch
e E
inri
chtu
ng
s-M
atri
x d
er 4
Fal
ldar
stel
lun
gen
Sc
haub
ild 1
1
0-18
. Lbj
.
18-
27.
Lbj
.
28-
33. L
bj.
Fal
l 1 H
r. G
rün
Fal
l 2 F
r. B
rand
t F
all 3
Fr.
Sat
ic
Fal
l 3 H
r. N
olle
r Ju
gend
amt,
ASD
K
inde
rhei
m
Flüc
htlin
gshe
ime
Kin
derk
linik
SO
S K
inde
rdor
f H
aupt
schu
le
Förd
ersc
hule
bis
7
Kin
derh
eim
Pf
lege
fam
ilie
B
eruf
ssch
ule
Flüc
htlin
gshe
im
Förd
ersc
hule
bis
8.K
l H
aupt
schu
le, M
R
Poli
zei,
Sozi
alst
unde
n, J
u-ge
ndst
rafe
K
lein
es K
inde
rhei
m f
ür
Jung
en
Kin
der-
, und
Jug
endp
sy-
chot
hera
peut
in
Kin
der-
, und
Jug
endh
eim
Such
tber
atun
g T
hera
peut
isch
es K
inde
r-he
im
Kin
der-
, und
Jug
endp
sy-
chia
trie
W
fB u
nd B
etre
utes
Ju-
gend
woh
nen
SpD
i K
inde
r-,
und
Juge
ndps
y-ch
iatr
ie
Woh
nung
slos
enhi
lfe-
ei
nric
htun
g R
PK E
inri
chtu
ng
Maß
rege
lvol
lzug
, 4
Jahr
e B
ewäh
rung
Sp
ezie
lle p
sych
iatr
isch
e Fa
chkl
inik
S
ozia
lhot
el +
SpD
I A
llge
mei
ne P
sych
iatr
ie
und
ofW
RPK
, med
izin
isch
e un
d be
rufl
iche
Fr
auen
haus
E
rwac
hsen
-Psy
chia
trie
, of
w
Suc
htm
ediz
in
AB
W im
eig
enen
Woh
n-ra
um
Klin
ik, o
fw
Ges
chlo
ssen
es p
sych
iatr
i-sc
hes
Pfle
gehe
im
AB
W
SpD
I O
ffen
e K
linik
, ofw
G
esch
loss
enes
Woh
nhei
m
Psyc
hiat
risc
hes
Pfle
ge-
heim
ges
chlo
ssen
, dez
ent-
ral
Sozi
alho
tel-
SpD
i St
atio
näre
s,
offe
nes
Woh
nhei
m
Frau
ensp
ezif
isch
es A
BW
in
Woh
ngru
ppe
Ges
chlo
ssen
es H
eim
(E
in-
glie
deru
ngsh
ilfe)
und
Su
chtb
erat
ung
372
Ges
chlo
ssen
es W
ohnh
eim
§
1906
BG
B
Reh
aein
rich
tung
für
psy
-ch
isch
Kra
nke,
K
linik
Ges
chlo
ssen
es W
ohnh
eim
G
esch
loss
enes
psy
chia
tri-
sche
s P
fleg
ehei
m, d
ezen
t-ra
l
2. M
al M
aßre
gel,
ausg
e-se
tzt
auf
4 Ja
hre
Bew
ähru
ng
Ges
chlo
ssen
es W
ohnh
eim
O
ffen
es W
ohnh
eim
G
esch
loss
enes
Woh
nhei
m
mit
off
enem
Hei
mbe
reic
h
Off
enes
Woh
nhei
m
AB
W-P
aarw
ohne
n A
BW
, int
ensi
v im
Ein
-ze
lwoh
nrau
m, 2
Um
-zü
ge
AB
W E
inze
lapp
arte
men
t G
esch
loss
enes
Woh
nhei
m
Ein
glie
deru
ngsh
ilfe
Ges
chlo
ssen
es W
ohnh
eim
E
ingl
iede
rung
shilf
e
Erk
läru
ngen
: AS
D: A
llge
mei
ner
Sozi
aler
Die
nst (
bei K
inde
swoh
lgef
ährd
ung)
; SpD
I: S
ozia
lpsy
chia
tris
cher
Die
nst:
hohe
itlic
he
Auf
gabe
n m
it r
egio
nale
r P
flic
htve
rsor
gung
; AB
W: A
mbu
lant
bet
reut
es W
ohne
n; o
fW: o
hne
fest
en W
ohns
itz; M
R: M
ittle
re R
eife
, R
PK
: Reh
abili
tatio
n fü
r ps
ychi
sch
Kra
nke
373
Erläuterung zum Schaubild 11:
Die vier Falldarstellungen der Biographen werden in der vorliegenden Einrichtungs-matrix entsprechend in drei Alters- bzw. Entwicklungsphasen eingeteilt. Die erste Phase (hellgrau) umfasst die Lebensspanne von der Geburt bis zur Volljährigkeit, insgesamt 18 Jahre, die zweite Phase definiert die biographische Zeitspanne vom 18. Lebensjahr bis zur Aufnahme in einer geschlossenen Einrichtung und berücksichtigt die Transinstitutionalisierung der Biographen, die in den folgenden 7-10 Jahren durch unterschiedliche Einrichtungstypen und Felder der Sozialen Arbeit gewandert sind. Die dritte Phase beschreibt die institutionelle Entwicklung der Biographen ab der Aufnahme in einer geschlossenen Einrichtung bis zum Zeitpunkt des Stichtags: 31.7.2016. Die Biographen durchlaufen entsprechend ihrer biographischen Entwick-lung und ihres Lebensalters die bekannten Felder der Sozialer Arbeit und haben chro-nologisch mit folgenden unterschiedlichen Einrichtungstypen und Institutionen Kon-takt:
0-18. Lebensjahr:
1a. Schulbehörde, Vertrauenslehrer, schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Ju-gendhilfe, Jugendgerichtshilfe;
1b. Kinder-, und Jugendpsychotherapie, Kinder-, und Jugendpsychiatrie;
18-25./30. Lebensjahr
2a. Klinische Erwachsenen-Psychiatrie/Polizeibehörden, Justiz, Gericht, Straf- oder Maßregelvollzug,
2b. Im schnellen Wechsel unterschiedliche gemeindepsychiatrischen Institutionen (SpDi, Tagesstätte, ABW, stationäres Wohnen),
Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe (ohne festen Wohnsitz), aufsuchende Stra-ßensozialarbeit, Medizinisches Mobil, Sozialhotel, Notunterkunft, Fachberatungen der Wohnungslosenhilfe und der Suchtkrankenhilfe.
Kontakte mit dem Amt für öffentliche Ordnung, das eine psychiatrische Unterbrin-gung bei Fremd- oder Eigengefährdung prüft.
25.-35. Lebensjahr
3. a Auf der Grundlage einer Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung nach § 1906 BGB erfolgt dann die Aufnahme in eine psychiatrische Klinik. Von dort die Verlegung in ein psychiatrisches Pflegeheim außerhalb des GPV Stuttgart oder eine Verlegung in ein geschlossenes Wohnheim der Eingliederungshilfe innerhalb des GPV-Stuttgarts.
3b. Von der geschlossen Unterbringung kommt es nach einer Stabilisierung zu einer Vermittlung in ein offenes Wohnheim (Falldarstellung 1 und 3) oder in das Ambulant Betreute Wohnen (Falldarstellung 2 und 3). Bei der Biographin der Falldarstellung 2
374
kam es nach wenigen Monaten im ABW zur Rückkehr in ein geschlossenes Wohn-heim mit einer gerichtlichen Unterbringung. Bei der Falldarstellung 3 zum dritten Mal nach zwei Versuchen im ABW und einem Versuch in einem offenen Wohnheim.
3c. Beim Biograph 1 kam es nach einer weiteren Stabilisierung innerhalb des offenen Heims zu einer Vermittlung ins Ambulant Betreute Wohnen. Eine vierjährige gericht-liche Bewährungsauflage trägt zudem zu einer starken Vorstrukturierung und einer konsequenten psychosozialen Einflussnahme bei.
9.3. Ergebnisdarstellung des sozialstatistischen Samples - Die Altersgruppe „Die Jungen“ vom 20.-35. Lbj., umfasst in der Vollerhebung mit 39% von der Gesamtpopulation, die in den geschlossenen Einrichtungennach § 1906 BGB innerhalb der Eingliederungshilfe im GPV-Stuttgart, im Erhebungszeitraum von 5 Jahren, betreut und versorgt wurden, eine überraschend große Anzahl.
- Aus der Datenbank (Sozialhotelstatistik, n=87), die 2008 im Feld der Wohnungs-notfallhilfe erstellt wurde, stellt die Gruppe „Die Jungen“ vom 18.-25. Lbj. und vom 25.-35. Lbj. mit 33,3% eine ebenso hohe Anzahl an der insgesamt erhobenen Popu-lation dar.
- in der Erhebung werden 54 % Männer und 45 % Frauen gezählt. 2/3 der männlichen Bewohner gehören zur Altersgruppe „Die Jungen“. Die „jungen männlichen Bewoh-ner“ sind sowohl innerhalb der Familie, in der Schule als auch im öffentlichen Raum auffälliger als vergleichsweise die jungen Frauen, die über sozial anpassungsfähigere und lebenspraktischere Fähigkeiten als ihre Geschlechtsgenossen verfügen. Gerade in der Herkunftsfamilie, im öffentlichen Raum oder zuvor in Institutionen der Ju-gendhilfe, der Wohnungsnotfallhilfe, der Suchthilfe oder der Psychiatrie stoßen die jungen Männer schneller und folgenschwerer aufgrund der eher körperlich-konfron-tativen und kompromissarmen Lösungsstrategien an die Grenzen der jeweiligen Haus-, Umgangs- oder Behandlungsreglements als das bei den jungen Frauen der Fall ist.
- Die Gruppe „Die Jungen“ weist eher eine flankierende Suchtabhängigkeit auf, als die Gruppe „Das mittlere Alter“ oder „Das reife Alter“, da sie dadurch versuchen, u.a. ihre tiefgreifende Bindungsstörungen, selbst zu behandeln oder sich damit selbst zu stimulieren beabsichtigen, um einen entspannt-angstfreien Gefühlszustand herzu-stellen.
- Die Gruppe „Die Jungen“ wurde bereits zu einem sehr frühen biographischen Zeit-punkt durch fragmentierte, unvollständige oder bereits sich auflösende sozialisatori-sche Familienkonstellationen, mit unterschiedlichsten Ursachen, geprägt.
- 83,9 % der 118 erhobenen Bewohner ist ledig, 4,2 % verheiratet (alles Frauen) die Gruppe der jungen-weiblichen Bewohner weisen alle langjähren Partnerschaften auf, während ihre männlichen Altersgenossen aufgrund ihrer schwerwiegenden Bin-dungs- und Beziehungsstörungen über keine oder nur marginale sexuell-intime Er-fahrungen (eher autosexuell) verfügen.
375
- Die jungen Männer erlebten innerhalb der Transinstitutionalisierung, in einer eher männerdominierten Bewohnerwelt, nur wenige zur Verfügung stehende weibliche Intimpartner. Sie befanden sich über weite Strecken in Institutionen, in denen es zu-dem fehlende Rückzugsorte und Optionen gab, in denen intimes Leben möglich ge-wesen wäre. Frauen suchten sich im Laufe ihrer institutionellen Karrieren eher Män-ner, die ihnen im Gegenzug Sicherheit (körperlicher Schutz), emotionaler Rückhalt, finanzielle Grundversorgung und Wohnrauem anbieten konnten.
- 1/3 der TSSP Klientel befand sich vor der Aufnahme in ein geschlossenes Heim im eigenen Wohnraum (überwiegend Frauen) oder sie wurde in der Primärfamilie ver-sorgt und betreut (überwiegend junge Männer).
- 1/4 der TSSP befand sich bereits in gemeindepsychiatrischen Einrichtungen, war dort bekannt und konnten aber nicht ausreichend versorgt, erreicht und von einer complianten Behandlung gewonnen bzw. davon überzeugt werden.
-11,8 % der Bewohner befanden sich vor der Aufnahme in § 67er Einrichtungen, um sich dem Gesichtsfeld der Psychiatrie zu entziehen.
- 26,3 % befanden sich zuvor häufig für längere Zeit in entfernt gelegene psychiatri-sche Pflegeheime, weil kein Platz im GPV angeboten werden konnte, weil die Klini-ken eine schnelle Lösung benötigten oder weil die Pflegeheime schnell und unbüro-kratisch aufnehmen.
- Im Gegensatz zu den jungen Frauen, die im Schnitt eher zwischen dem 25.- 35. Lbj. erkrankt sind, haben die früh einsetzenden Krankheitssymptome bei den jungen Män-nern erheblich den Lernprozess bezüglich der Konzentration, der Aufmerksamkeit, sowie beim Speichern und Wiederabrufen von Informationen beeinträchtigt, sodass diese in der Folge Bildungsabschlusse erreicht oder berufliche Qualifikationen (meh-rere Lehrabbrüche) abgeschlossen haben, die unterhalb ihrer Möglichkeiten waren.
- Die Bewohner mit abgeschlossener Lehre gehören weitgehend zur Altersgruppe des „Mittleren Alters“ und zum „Reifen Alter“. Diese Gruppen wurden erst zu einem späteren Zeitpunkt krank und konnten noch berufliche Erfahrungen sammeln. Insbe-sondere die Gruppe der Frauen des „Mittleren Alters“ hat auch in ihrem Beruf sozi-alversicherungspflichtig gearbeitet und bezog zum Zeitpunkt der Heimaufnahme eine EU- oder BU-Rente, wohingegen die Gruppe „Die Jungen“ ausschließlich von Sozi-alhilfe oder Kindergeld z.Z. der Heimaufnahme lebten.
%�Transkulturelle psychiatrische Aspekte und Besonderheiten spielen in der Behand-lung und Betreuung von psychisch erkrankten Menschen eine bedeutsame Rolle. Ins-besondere die Gruppe der TSSP stammt zu einem hohen Anteil aus dem Balkan-kriegsgebieten, aus den GUS Ländern oder als Siebenbürgen aus Rumänien, Ungarn, oder der Türkei und weiteren südeuropäischen Mittelmeerstaaten (Italien, Griechen-land etc.)
- Es ist davon auszugehen, dass z. B. schwerwiegende psychische Erkrankung zu ei-nem frühen biographischen Zeitpunkt, neben einer existentiellen Infragestellung der eigene Identität sowie der soziokulturellen Herkunft, gleichzeitig eine schwerwie-gende religiöse Verunsicherung bedeuten kann.
376
- Die Gruppe der Bewohner, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, gehören allesamt in die Altersgruppe „Die Jungen“. Sie haben als Kinder die Schrecken und Verlusterfahrungen des Balkankonfliktes in den Jahren von 1991-2001 miterlebt. (Falldarstellung 3)
- Die Gruppe der Bewohnerinnen, die i.d.R. in den 80er Jahren mit ihren Familien aus der Türkei (aber auch Italien, Griechenland, Spanien und Portugal) nach Deutsch-land gekommen sind, setzten sich mit dem Spannungsfeld zweier unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Sprachen auseinander. Sie waren mit der Identifikation ih-rer heimatlichen Werte beschäftigt und bemühten sich innerhalb eines kräftezehren-den Assimilationsprozess um Anpassung und Integration. (Falldarstellung 5+6; beide unveröffentlicht).
- Die Gruppe der Bewohnerinnen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90er Jahren mit ihren Familien aus den sognannten GUS-Staaten übersiedelten, wurden als „Deutsche“ bereits in ihrem Geburtsland diskriminiert und erfuhren in der Fortsetzung als sogenannte „Russlanddeutsche“ auch in der Bundesrepublik eine Au-ßenseiterrolle. Der kulturelle und identitätsstift-ende Spagat ist einigen, die aus den GUS-Staaten übersiedelten, nicht bzw. nur fragmentiert oder erheblich beschädigt gelungen. (Falldarstellung 2)
- Beide Bewohnergruppen, die zur Gruppe „der Jungen“ gehören, befinden sich in der Nachkommensgeneration. Die zentrale Herausforderung lautete, wie gelingt es, sich mit der Außenseiterposition ihrer Eltern und ihrer eigenen Position umzugehen. Durch veränderte Bildungsoptionen, durch den erworbenen Bildungsgrad und Spracherwerb haben sie einen anderen Zugang zur etablierten Gesellschaft finden müssen. Es fällt noch auf, dass sich die Geschwister oder Stiefgeschwister der Bio-graphen über den Bildungserwerb etablieren und stabilisieren konnten. (Fall 1, Fall 3 und Fall 4, in Fall 2 sind es die beiden Cousinen der Biographin)
- Die zentrale Frage lautet: Wie gelingend begibt sich der einzelne Bewohner der Gruppe der Nachkommensgeneration bei gleichzeitigem Erhalt der identitätsstiften-den Merkmale in die etablierte Gesellschaft?
- Die Anzahl der unvollständigen Herkunftsfamilien der Bewohner, z. B. in Einrich-tung2 mit 31%, fällt überraschend hoch aus und bedeutet durchgehend einen frühen Verlust oder Verschwinden i.d.R. des Vaters, durch Trennung, Scheidung, chronische Krankheiten (psychische oder Suchterkrankung) Tod oder Gefängnis. Insbesondere für die Identitätsbildung und Ich-Entwicklung der männlichen Bewohner wirkt dieses Merkmal und Ereignis einflussreich und bedeutsam in die biographische Entwicklung ein.
- Der Anteil von 26,2 % an Bewohnern, z. B. in Einrichtung2, die bereits als Heran-wachsende Hilfe und Kontakt mit dem Feld der Kinder- und Jugendhilfe hatten, ist ein Hinweis für eine frühzeitige problematische Entwicklung, für familiäre oder schu-lische Auffälligkeiten. Diese Gruppe ist weitgehend identisch mit der Altersklasse „Die Jungen“, die Hilfen und Maßnahmen durch das Jugendamt erhalten haben. Bei etwa der Hälfte der Bewohner, die zum Feld Kinder- und Jugendhilfe Kontakt hatte, kam es zudem zu stationären Aufnahmen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie
377
auch zu langfristigen kinder- und jugendpsychotherapeutischen Behandlungen. In Einzelfällen kam es auch dazu, dass sich Bewohner als Jugendliche von sich aus beim Jugendamt um eine Herausnahme aus der Familie gebeten haben.
- Annährend ein Viertel der Bewohnerinnen befand sich im Verlauf ihrer Psychiat-riekarriere in Kontakt mit der Wohnungsnotfallhilfe und wurde in z. B. stationäre oder teilstationäre Einrichtungen, z. B. in Notunterkünfte, Nachtasyle oder in soge-nannte Sozialhotels mit einfachster Ausstattung vermittelt.
- Die Gruppe der TSSP zählt zu denjenigen, die sich bevorzugt innerhalb der nach § 67 SGB XII finanzierten Hilfen aufhält und das Milieu der Wohnungsnotfallhilfe dem der Psychiatrie vorzieht. Diese Gruppe versucht sich möglichst lange und beharrlich dem Gesichtsfeld der Psychiatrie zu entziehen. Sie ist häufig unbehandelt und wird aufgrund des methodischen Ansatzes der Wohnungsnotfallhilfe in einem nieder-schwelligen grundversorgenden Sinne ohne Mitwirkungspflicht begleitet.
- Im Mittel befanden sich etwa 36% der Bewohnerinnen zuvor im ambulant betreuten Wohnen. Die Anzahl der Bewohner, die zuvor in offenen stationären Heimen betreut und gewohnt haben, beträgt immerhin 21 %. 2 Bewohner aus Einrichtung2 und 3 aus Einrichtung 3 waren bereits zuvor in einem anderen geschlossenen Wohnheim der Eingliederungshilfe gewesen.
- In Einrichtung 2 waren 4 (9,5%) der ausschließlich männlichen Bewohner zuvor in einer RPK Einrichtung und bewiesen dabei eine bereits präsentierte hohe Mitwir-kungskompetenz in einen psychiatrisch-rehabilitativen Behandlungsplan.
- Nur ein sehr geringer Bewohneranteil verzeichnete Vorerfahrungen im Straf- oder Maßregelvollzug und stellte somit eine geringe Gefahr für die Allgemeinheit dar. In der Erhebungszeit bis 31.7.2013 war noch das UBG nach Baden-Württemberg wirk-sam. In Einrichtung2 konnte hierzu aufgrund eines umfangreichen Datenmaterials Angaben generiert werden, die von 24 Bewohnern (57,1 %) ausgehen, die zuvor we-gen fremdgefährdenden Verhaltens zwangsweise in einer psychiatrischen Klinik un-tergebracht wurden.
- 25,4% der 118 Bewohner konsumierten vor der Aufnahme regelmäßig Alkohol mit riskantem oder hochriskantem Konsumverhalten. In Einrichtung2 konsumierten 20 von 42 THC, 12 konsumierten Drogen aus der Gruppe der Morphine. 4 konsumierten in Einrichtung2 über die Nase oder per Injektionen Kokain, Speed oder Methyl-amphetamin. 28 (23,7%) der Bewohner konsumierten in allen 3 Einrichtungen regel-mäßig bis vor der Aufnahme THC. Bei der Altersgruppe „Die Jungen“ hingegen kon-sumierten im Vorfeld über 3/4 der Bewohner illegale Drogen.
- Bei dem größten Teil der Bewohner wurde eine schizophrene Erkrankung (68,4% - 73,8% - 80,7%), im Mittel 74,3% diagnostiziert. Der Anteil der Bewohner mit einer Persönlichkeitsstörung liegt bei etwa 20%. Die Gruppe der affektiven Psychosen ist mit 7,6% gering vertreten. Menschen mit depressiven Störungen oder affektiven Psy-chosen werden innerhalb der sozialpsychiatrischen Versorgung und der pharmakolo-gischen Behandlung gut behandelt, dass sie eine eher untergeordnete Rolle in der geschlossenen Heimunterbringung ausmachen.
378
- Bei den komorbiden Störungen stellt die Gruppe mit Suchterkrankungen in den drei geschlossenen Einrichtungen mit 24,6% eine verhältnismäßig große Gruppe dar. 33%, also ein Drittel aller Bewohner, werden neben der psychiatrischen Grunder-krankung auch wegen einer behandlungsbedürftig körperlichen Erkrankung behan-delt.
- Die drei Einrichtungen haben 62 Bewohner aus dem geschlossenen Heimbereich entlassen und dabei versucht, eine geeignete Anschlussbetreuung zu vermitteln, auf die sich die Beteiligten verständigen konnten.
- Im Erhebungszeitraum wurden in Einrichtung1 in einer Heimbetriebszeit von 8 Jah-ren und 7 Monaten (103 Monaten) 41 Bewohner entlassen, d.h. 0,4 Bewohner pro Monat, bzw. 2 Bewohner in 4 Monaten.
- In Einrichtung2 wurden innerhalb von 1 Jahr und 5 Monaten 0,8 Bewohner/per month 8 (4 Bewohner in 5 Monaten) entlassen, in Einrichtung3 wurden 4 Bewohner innerhalb von 7 Monaten aus der Einrichtung entlassen.
- Einrichtung2 und 3 berichten nur in 4 Fällen, dass es zwischen der Einrichtung und dem Bewohner nicht zu einer einvernehmlichen und gütlichen Einigung bezogen auf eine zukünftige Wohnperspektive gekommen ist.
- Die Zahl der Kündigungen von 9 Bewohnern innerhalb einer Zeitspanne von 8 ½ Jahren fällt, angesichts der hoch differenzierten und schwierigen Klientel sehr gering aus. Hierbei ist davon auszugehen, dass auf der vertraglichen Grundlage der Leis-tungsausschlüsse i.d.R. über eine lange Zeit geprüft und ausprobiert wurde, den Be-wohner in der Einrichtung zu halten.
- In Einzelfällen ging bei einer fristlosen Kündigung i.d.R. eine schwerwiegende Ver-haltensauffälligkeit (körperliche oder sexuelle Gewalt gegenüber Dritten) voraus.
- nur 4 der 62 entlassenen Bewohner sind in stationäre Heime und 31, also 50 % aller Entlassenen, ins ABW vermittelt worden.
- 8 Bewohner wurden im Erhebungszeitraum wieder zurück in die Herkunftsfamilie entlassen und ließen ambulante sozialpsychiatrische Hilfen zu. Von den 24 Bewoh-nern, die direkt aus ihrer Herkunftsfamilie in die geschlossene Heimversorgung un-tergebracht wurden, ist nur ein Drittel dieser Bewohnerzahl wieder dorthin zurück entlassen, jedoch mit professioneller Hilfe. Ein notwendiger Ablöseprozess vom El-ternhaus stellte einen wesentlichen Grund für eine alternative Konstellation der An-schlussbetreuung dar.
- 2 Bewohner sind im Verlauf der Erhebungszeit verstorben, 2 Bewohner sind an einem langjährigen Krebsleiden, bzw. an einer schwerwiegenden somatischen Er-krankung verstorben. Im Erhebungszeitraum kam es zu keinem erfolgreich-vollzoge-nen Suizid, dafür wurde eine Vielzahl an schwerwiegenden autoaggressiven Hand-lungen, die unbehandelt zum Tod geführt hätten, vermieden. 3 Bewohner, die sich von Anfang an massiv gegen die Unterbringung Widerstand geleistet haben, sind in Wohneinrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe mit ambulanter sozialpsychiatrischer Begleitung vermittelt worden.
379
- Geschlossene Heimunterbringung ist nur für etwa 1/3 der untersuchten Gruppe eine geeignete Maßnahme. 1/3 der Bewohner kann für einen langen Zeitraum des Aufent-halts weder Sinn noch Chance nachvollziehen und erlebt die geschlossene Unterbrin-gung als Bestrafung und Sanktion. Sie erfahren dadurch weitere Traumatisierungen und benötigen i.d.R. mehrere Jahre (3-4) der Unterbringungen, um an ihren Einstel-lungen und ihrem Hilfeannahmebereitschaft, an ihren Compliance bzw. Adhärenz grundlegend etwas zu verändern. Ein weiteres Drittel kann von der geschlossenen Unterbringung grundsätzlich nicht profitieren. Sie präsentieren auch mit psychophar-makologischer Behandlung dauerhaft produktive Symptome; sie konsumieren bei je-der Gelegenheit Drogen; sie verschaffen sich Ausgang, halten sich an keine Haus- und Behandlungsregeln und müssen immer wieder gefahndet werden.
- Die Gruppe der TSSP kann sowohl in der geschlossenen Heimversorgung der Ein-gliederungshilfe als auch im Maßregevollzug durch einen initialisierten Nachrei-fungsprozess wirksam profitieren. Innerhalb eines hochstrukturierten Settings wirken verbindliche und zuverlässige pädagogische Interventionen, wiederkehrende Kon-trollen, darin wirken Psychoedukation, Revitalisierung der Angehörigenarbeit, darin wirken alltagsorientiert lebenspraktische Unterstützung und Training, sowie eine durchgehende Strukturierung der Zeit, des Tages, des Wohnraums und der sozialen Beziehungen innerhalb und außerhalb.
9.4. Spezifische Merkmale am Beispiel der Falldarstellungen
380
1.
Hr.
Grü
n 2.
Fr.
Bra
ndt
3. F
r. S
atic
4.
Hr.
Nol
ler
-Int
ervi
ewst
atus
, -Z
eit
zwis
chen
In
terv
iew
1+2
-1. +
2.:
2012
-3
Mon
-1
. und
2.:
201
3 5
Mon
ate
-1. u
nd 2
.: 2
013+
2015
-2
,3 J
ahre
-1
. un
d 2.
: 20
13 u
nd 2
014
-1
Jah
r
-Alt
er z
.Z. d
es
Inte
rvie
ws
-Ers
terk
rank
ung
-30
J./
-a
b 15
L
bj.:
Pro
drom
alsy
mpt
ome,
18
. Lbj
. Ers
terk
rank
ung
26 J
. -1
5. L
bj. K
inde
r- u
nd J
ugen
dpsy
chi-
atri
e
-27,
-1
4 L
bj. K
inde
r- u
nd J
ugen
dpsy
-ch
iatr
ie
-28
Lbj
. -1
7. L
bj. E
rste
rkra
nkun
g
Mer
kmal
e na
ch S
tudi
e Sy
stem
spre
nger
Del
inqu
enz,
Dro
gen
Sui
zida
lität
und
Impu
lsiv
ität
, Sel
bst-
verl
etzu
ngen
, B
eläs
tigu
ng
und
Impu
lsiv
ität
un
d D
elin
quen
z, M
anip
ulat
ion,
P
artn
er
aus
Mil
ieu,
F
rem
dag-
gres
sivi
tät A
lkoh
olab
usus
Del
inqu
enz,
D
roge
nkon
sum
, U
nang
e-pa
ssth
eit,
sexu
elle
Dev
ianz
, Waf
fen
-Her
kunf
t,
-sta
dt/u
rban
-lä
ndlic
h au
fge-
wac
hsen
-DD
R: 0
-6. J
., vo
r der
Wen
de a
usge
-re
ist,
-Gro
ßsta
dt
-UD
SSR
-
von
0-8
auf
dem
Lan
d in
Rus
slan
d -B
osni
en
-bis
8 L
bj. I
n K
lein
stad
t -B
unde
srep
ublik
Deu
tsch
land
-
in K
lein
stad
t bis
2. L
bj, d
ann
Dor
f,
-Sta
tus
als
Kin
d E
inze
lkin
d, 2
Sti
efge
schw
iste
r, a
u-ße
rehe
lich
A
dopt
ivki
nd, E
inze
lkin
d, e
heli
ch
1 jü
nger
e S
chw
este
r (-
2 ),
eh
elic
h 1
älte
rer
Stie
fbru
der
(Sui
zid
2012
, un
ehe-
lich
-P
rim
ärfa
mili
e,
-Kon
fess
ion
-Bild
ung
gut
bürg
erli
ch,
hohe
s B
ildu
ngsn
i-ve
au, j
üdis
ch-p
rote
stan
tisch
gep
rägt
A
dopt
ivva
ter
mit
2 L
bj. s
uizi
dier
t, w
ar h
eroi
nabh
ängi
g; B
. ist
kon
ver-
tier
t: v
on o
rtho
dox
zu p
rote
st. G
lau-
ben
Aka
dem
iker
fam
ilie
m
usli
mis
ch
hohe
r B
ildu
ngss
tand
, stu
dier
t, ko
nfes
sion
slos
Elt
ern
-Mut
ter:
Aka
dem
iker
in, w
ar a
ls
„Pol
itis
che“
in H
aft;
-V
ater
: „B
ahne
r“ u
nd I
CE
Flo
tten
- L
eite
r
-Mut
ter:
Ver
käuf
erin
, Gro
ßmut
ter=
B
ezug
sper
son,
aus
wir
tsch
aftl
iche
n G
ründ
en in
BR
D g
ezog
en
-lei
blic
he E
ltern
: unb
ekan
nt
-Mut
ter
psyc
hisc
h kr
ank;
-V
ater
: Kri
eg a
ls F
r. K
6. L
bj
war
, ist
im K
rieg
auf
Min
e ge
-tr
eten
-Mut
ter
ist p
sych
osek
rank
, -V
ater
: A
kade
mik
er/N
orda
frik
a in
D.,
Ort
is
t unb
ekan
nt
Fam
ilien
typu
s na
ch H
ILD
EN
-B
RA
ND
Ges
chlo
ssen
nac
h A
ußen
; Is
olat
ions
typ
und
Kri
sent
yp: b
e-di
ngt g
ute
Pro
gnos
e
Isol
atio
nsty
p, n
ur M
utte
r un
d G
roß-
mut
ter,
in d
er E
inri
chtu
ng
Wid
ersp
rüch
lich
Inn
en-
Auß
en
Kri
sent
yp, v
iele
Fre
undi
nnen
V
eröf
fent
lich
t:
Isol
atio
nsty
p;
Kri
sent
yp:
ungü
nstig
e P
rogn
ose
Bez
ug z
um J
u-ge
ndam
t M
it 1
6. E
lter
n ge
hen
auf
Juge
ndam
t zu
, wol
len
Soh
n in
sta
t. W
ohng
rupp
e E
ntzu
g de
s S
orge
rech
ts d
er M
utte
r,
12 L
bj.
Vor
mun
dsch
aft d
urch
Jug
enda
mt
-sta
t. Ju
gend
heim
e,
-Jug
endp
sych
othe
rape
ut
-Kin
der-
und
Jug
endp
sych
iatr
ie
Inob
hutn
ahm
e m
it 3
. Lbj
und
Ver
mit
tlun
g in
Pfl
egef
amil
ie,
dann
Kin
derh
eim
e, S
OS
K
inde
rdor
f, V
orm
unds
chaf
t
Schu
lbild
ung
Bio
grap
h H
aupt
schu
le, A
bsch
luss
7.
Kla
sse,
abg
ebro
chen
F
örde
rsch
ule,
S
chul
verw
eige
-ru
ng, 8
. Kla
sse
abge
broc
hen
Hau
ptsc
hule
, dan
n R
eals
chul
e, A
bsch
luss
H
aupt
. B
egab
unge
n T
T-T
alen
t, M
usik
, „P
ower
Pak
et“,
spo
rtli
ch,
-Net
zwer
keri
n, te
lefo
nier
t, ak
tiv
via
SM
S, t
wit
ter,
wha
tsup
-h
andw
erkl
iche
Beg
abun
g
Ber
ufsa
us-
bild
ung
Leh
re 2
. Ja
hr a
bgeb
roch
en,
insg
e-sa
mt 2
Leh
rbet
rieb
e -P
rakt
ikum
Kin
derp
fleg
erin
-k
eine
-k
eine
W
fB, P
rakt
ika,
sta
nd k
urz
vor
Leh
raus
bil-
dung
W
ohnu
ngs-
S
ozia
lhot
el, w
urde
2x
gerä
umt
67er
Fra
uenh
aus,
Not
unte
rkun
ft
Soz
ialh
otel
, 67e
r E
inri
chtu
ngen
S
ozia
lhot
el
Scha
ubild
12:
Mer
kmal
e un
d K
ateg
orie
n de
r vi
er B
iogr
aphe
n
381
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
lose
nhilf
e ab
gele
hnt
Gem
eind
e-
psyc
hiat
rie
S
pDI,
A
BW
, W
ohnh
eim
, R
PK
, K
ündi
gung
w
egen
G
ewal
t, S
ucht
, D
eale
n, S
traf
tate
n
Woh
nhei
me,
weg
en S
uizd
iver
- su
chen
gek
ündi
gt
SpD
I,
Woh
nhei
me,
w
egen
F
rem
dagg
ress
ion
gekü
ndig
t W
ohnh
eim
e w
egen
Suc
ht/s
exue
ller
Ent
-he
mm
ung
gek
ündi
gt
Dro
gen
TH
C, E
xtas
y, A
lkoh
ol, N
ikot
in
Alk
ohol
abus
us, T
HC
Mis
sbra
uch,
N
ikot
in
-Alk
ohol
mis
sbra
uch,
Tra
nqui
li-
zer,
Nik
otin
A
lkoh
ol, T
HC
, Her
oin,
Kok
ain,
Nik
otin
Psy
chia
tris
che
Dia
gnos
e -h
ebep
hren
e P
sych
ose,
-d
isso
zial
e P
ersö
nlic
hkei
tsst
örun
g -B
orde
rlin
e- P
ersö
nlic
hkei
tsst
örun
g
-Par
anoi
de P
sych
ose
-Zw
angs
stör
ung
-em
otio
nal-
inst
abil
e P
ersö
nlic
h-ke
itss
töru
ng
-Min
derb
egab
ung
-dro
geni
nduz
iert
e P
sych
ose
-Pol
ytox
ikom
anie
Som
atis
che
Di-
agno
se
- H
erzf
ehle
r, A
nore
xie,
Bul
imie
A
neur
ysm
a S
ehfe
hler
, Sch
luck
besc
hwer
den,
Sti
mm
-bä
nder
verl
etzu
ng d
urch
Sch
ussv
erle
t-zu
ng, A
nore
xie
Stra
fvol
lzug
–
Maß
rege
l 19
06
-4 ½
Jah
re §
63
StG
B, +
2 Ja
hre
Be-
wäh
rung
-2
Jah
re §
190
6 B
GB
-s
tatt
ern
eute
§ 6
3 S
tGB
, ers
atz-
wei
se, 3
Jah
re B
ewäh
rung
/ Sic
her-
heit
sauf
lage
n
3 pl
us 4
Jah
re §
1906
BG
B
-Fre
und
für
8 Ja
hre
in H
aft,-
So-
zial
stun
den,
3 J
. x §
190
6 1
Jahr
§ 1
906
und
9 M
onat
e §
1906
und
2 J
ahre
§ 1
906
BG
B
-für
3 ½
J. §
190
6 au
f de
m L
and,
-f
ür 2
1/2
Jahr
e §
1906
in d
er S
tadt
, -w
eite
re 2
Jah
re §
190
6 au
f de
m L
and,
-
Soz
ials
tund
en, -
Str
afbe
fehl
e
Mis
sbra
uchs
er-
fahr
unge
n -
-als
Kle
inki
nd
-ern
eut i
n de
r G
rund
schu
le
-dur
ch d
en G
roßv
ater
-mit
6 J
. du
rch
serb
isch
e So
lda-
ten
-Ver
dach
t in
nerh
alb
der
Ker
nfam
ilie
Bes
onde
rhei
ten
-8-1
4 L
bj. L
eist
ungs
spor
tler,
plö
tzli
-ch
e V
erw
eige
rung
in d
er S
chul
e -d
urch
sex
. Mis
sbra
uch
trau
mat
i-si
ert,
-meh
rere
sch
wer
e Su
izid
vers
uche
(h
at s
ich
ange
zünd
et, a
us d
em F
ens-
ter,
str
angu
liert
) ab
er a
uch
frem
dag-
gres
siv
-bür
gerk
rieg
stra
umat
isie
rt,
-war
in M
ädch
enga
ng
-2x
Ane
urys
ma
-Sta
lkin
g ge
genü
ber
Arz
t
-ab
3 L
bj.
in P
fleg
efam
ilie
, K
inde
r- u
nd
Juge
ndhe
im,
-mit
12
J. s
chie
ßt S
tief
brud
er H
rn.
F m
it
Luf
tgew
ehr
in H
als,
Ein
wil
ligu
ngsv
orbe
-ha
lt
Selb
stpr
äsen
- ta
tion
Ic
h kö
nnte
, wen
n ic
h w
ollt
e.
Ich
setz
e m
ich
kein
en H
erau
sfor
de-
rung
en a
us, s
onst
dro
he ic
h zu
ver
-sa
gen!
Ich
bin
Sch
uld
am T
od m
eine
s V
er-
lobt
en.
Ich
darf
nic
ht s
ein!
Mei
n V
ater
war
der
ein
zige
M
ensc
h, d
er m
ir e
twas
sag
en
durf
te!
Ich
akze
ptie
re k
eine
Au-
tori
täte
n ne
ben
ihm
.
Ich
wei
ß ni
cht,
was
ich
wil
l. Ic
h w
eiß
nich
t, w
ohin
ich
gehö
re.
Fun
ktio
n de
r In
-st
itut
ion
-Ü
bern
imm
t ste
llve
rtre
tend
für
die
E
lter
n ei
nen
Aut
onom
isie
rung
s-,
und
Abl
ösun
gspr
ozes
s hi
n zu
ein
er E
rwac
hsen
entw
ickl
ung
-Ver
hind
ert
die
Sel
bstt
ötun
g, d
urch
24
h P
räse
nz,
hoch
str
uktu
rier
t un
d ho
ch i
nten
siv,
mit
Vit
alko
ntro
llen,
ku
rze
und
häuf
ige
Kri
seni
nter
ven-
tion
en m
üsse
n fr
emdb
esti
mm
t ei
n-ge
leit
et w
erde
n
-Reg
ulie
rt N
ähe
und
Dis
tanz
zu
r M
utte
r -s
truk
turi
ert R
aum
, Zei
t und
so-
zial
e K
onta
kte
-sch
ützt
vor
-Ers
etzt
Fam
ilie
volls
tänd
ig, F
unkt
ion
des
Zie
hvat
ers;
-r
eduz
iert
bzw
. ver
mei
det Z
ugan
g zu
D
roge
n;
-däm
mt s
exue
lle E
nthe
mm
ung/
Übe
rgri
ffe
ei
n
382
Scha
ubild
13:
Spe
zifi
sche
Mer
kmal
e zu
r St
rukt
ur d
er F
amili
e un
d de
r Id
enti
tät
Mer
kmal
e de
r F
amili
en
Hr.
Grü
n F
r. B
rand
t F
r. S
atic
H
r. N
olle
r B
ezug
sper
sone
n vo
n 0
- 10
Lbj
. In
DD
R, d
ann
ab 6
L
bj. B
RD
V
ater
und
Mut
ter
Rus
slan
ddeu
tsch
e,
0-4
Kin
derh
eim
su
chtk
rank
e A
dopt
ivel
tern
, dan
n G
roß-
mut
ter
Rus
slan
ddeu
tsch
e A
dopt
ivm
utte
r un
d he
-ro
inab
h A
dopt
ivva
ter,
der
sic
h su
izid
iert
Bür
gerk
rieg
sflü
chtli
ng B
osni
en,
0-6.
Lbj
da
nn F
luch
t nac
h St
uttg
art,
M
utte
r, S
chw
este
r
In P
fleg
efam
ilie,
SO
S K
inde
r-do
rf, H
eim
e,
biol
og. V
ater
war
stu
dent
isch
e L
iebe
an
der
Uni
,
Eth
nisc
h-ku
ltur
elle
Ide
n-ti
tät
von
der
DD
R in
die
B
RD
, kon
fess
ions
los,
sp
ielt
kein
e R
olle
als
Rus
sin
zu R
ussl
andd
euts
chen
, kat
ho-
lisch
, kon
vert
iert
zum
eva
ngel
isch
e K
irch
e B
osni
sch-
mus
limis
ch
alle
iner
zieh
ende
n M
utte
r, ü
ber-
ford
ert,
psyc
hose
kran
k (w
ahn-
haft
)
Jasp
ersc
he K
ateg
orie
n
Ich
geh,
ich
wei
ß ni
cht
woh
in?
Ic
h ko
mm
e, ic
h w
eiß
nich
t woh
er!
Ich
ster
be, i
ch w
eiß
nich
t wan
n?
Ich
bin,
ich
wei
ß ni
cht w
er?
Ich
kom
me,
ich
wei
ß ni
cht w
o-hi
n?
Ich
bin,
ich
wei
ß ni
cht w
er?
Ich
kom
me,
ich
wei
ß ni
cht w
o-hi
n? I
ch g
eh, i
ch w
eiß
nich
t w
ohin
? B
iogr
aphi
e-im
man
ente
W
iede
rhol
ung,
iden
täts
-st
ifte
nde
Mer
kmal
e
Prot
esta
nt. H
andw
er-
kerf
amili
e vo
m L
and
(Vat
erse
ite)
trif
ft a
uf
jüdi
sche
Aka
dem
iker
-fa
mili
e, (
Mut
ter)
G
roßs
tadt
, M
utte
r in
H
aft a
ls P
oliti
sche
V
ater
Ber
ufsv
erbo
t G
roßv
ater
als
jüdi
-sc
hen
Aka
dem
iker
im
KZ
, Hei
rats
verb
ot
beru
flic
he Q
ualif
ika-
tion
Eig
ene
deut
sche
Ide
ntitä
t ver
berg
en, v
er-
heim
liche
n, le
ugne
n -i
n D
. die
rus
sisc
he H
erku
nft w
ird
unau
f-fä
llig
gele
bt, S
prac
he, w
estli
che
Kle
idun
g,
etc.
Such
t sic
h im
mer
wie
der
gew
alt-
tä
tige
Part
ner
aus
oder
Fre
unde
, di
e si
ch s
chäd
igen
B
iogr
aihe
en is
gen
aeu
soe
wie
ir
hen
Mut
ter
taus
nette
, die
se
Tra
ueee
g w
ird
leeb
nsan
e de
-te
haer
te u
nd f
ürht
so
zu e
ien
grud
neeg
den
Klu
ft z
wic
hen
Mit
erud
Tch
etr
Bin
dung
slos
igke
it w
iede
rhei
lt si
ch
Mut
ter:
weg
, Vat
er: u
nbek
annt
Pf
lege
fam
ilie
weg
V
orm
und
Wec
hsel
nde
Bez
ugsp
erso
nen
Auf
gabe
in d
er F
amili
e,
Bed
eutu
ng S
ymbo
lik d
er
Kra
nkhe
it
Kra
nk a
ls K
itt e
iner
dr
ohen
den
Tre
nnun
g de
r E
ltern
nac
h ps
y-ch
osom
at. K
ind
nach
M
enuc
hin
Abl
ösun
g ge
lingt
du
rch
Schi
zoph
reni
e
Kra
nk a
ls V
erar
beitu
ng v
on M
issb
rauc
h,
sich
sch
uldi
g fü
hlen
, sic
h se
lbst
mas
siv
verl
etze
n au
toag
gres
sive
Han
dlun
gen:
nic
hts
esse
n,
trin
ken,
Sch
nittv
erle
tzun
gen
zufü
gen,
sc
harf
e G
egen
stän
de s
chlu
cken
kran
k zu
r R
egul
atio
n ex
trem
er
Err
egun
g
Kra
nk w
eil k
eine
Ide
ntitä
t, ge
-ri
ng E
r- Ic
h A
ntei
le
383
Scha
ubild
14:
Bio
grap
hisc
he V
erlä
ufe
der
vier
Bio
grap
hen
auf
eine
r Z
eita
chse
- un
d ei
ner
Leb
ense
reig
nisa
chse
:���
���;�4%�
2"$��53
��6�7�'$�#"����8�&�9&'�����%�� �6�7�'$�#
"���
:%�2"$���*
#��#'���6�7�'$���&�'&$$�,�!&��!&��;&����
&���#<"�'�;�'�=�
7 ���#'�7&$�> )&��������)�7��"#7�'
�
A. F
all 1
:Hr.
Grü
n (o
-Lin
ie):
B. F
all 2
: Fr.
Bra
ndt (
Dre
ieck
)
C. F
all 3
: Fr.
Sat
ic (
+ L
inie
)
D. F
all 4
: Hr.
Nol
ler
(x-L
inie
)
384
Erläuterung zum Schaubild 14:
In Fall 1, handelt es sich um den unstet-entwicklungsfähigen-Oszillations-Typ, Typ A, der in seiner Biographie vom 15.-30. Lebensjahr wiederkehrend eine Einrich-tungsentwicklung beschreibt, in der er oszillierend von hoch strukturierten, kontrol-lierenden und fremdbestimmenden Einrichtungen, wie z.B. der Maßregel- oder Straf-vollzug, wie geschlossen-beschützende Einrichtungen der Pflege oder der Ein-gliederungshilfe, geschlossene Stationen einer psychiatrischen Klinik, in weniger strukturierende Einrichtungen und selbstverantwortlicheren Unterstützungskonstel-lationen, wie z.B. in offene Wohnheim, Rehabilitationseinrichtungen oder in ambu-lant Betreutes Wohnen wandern lässt. Wesentliche Einflussfaktoren beim Typ Ab stellt zum einen der stabilisierende und stützende Halt und Kontakt durch die Her-kunftsfamilie und anderer Bezugspersonen und zum anderen das Lebensalter dar, d.h. je älter der Biograph wird, desto mehr kommt es zu einer sukzessiven Entfaltung, sich mit der/n vorliegenden Krankheit(en), mit dem bisherigen widerständischen, un-angepassten Verhalten auseinanderzusetzen. Es findet eine Entwicklung statt, in der durch unterschiedliche, sich ergänzende Behandlungsangebote und das Mit-, und Einwirken der Familie, zu einer Neuausrichtungen und willentlichen Entscheidung kommt, aus den weiteren und verbleibenden Lebensjahren noch etwas zu schaffen, das außerhalb institutioneller Strukturen erfahrbar ist. Dieses wegweisende Moment umfasst auch eine Bilanzierung, des bisher gelebten Lebens und eine Einsicht und Feststellung, dass man in den letzten 10-15 Jahren nichts erreicht habe, nichts nach-weisen könne oder Entwicklungen stattgefunden hätten. Bei diesem Lebensresümee des Vergangenen kann es auch zu einem suizidalen Beschluss kommen, auf den in der Behandlung einzugehen ist. Beim Typ A ist im Gesamten von einer bedingt po-sitiven Prognose auszugehen. Er wird sich in einem ambulanten Setting langfristig ausreichend stabilisieren können und angemessen und konstruktiv die erforderliche Hilfe und Unterstützung annehmen können.
Beim Typ B, wie in der Falldarstellung der Biograhin, Fr. Brandt vorgestellt, wird der konstant-kritische Plateau Typ beschrieben. Aufgrund schwerer Erkrankungen o-der kindeswohlgefährdende, psychosozialer Indikation (Suchterkrankung, psychi-schen Erkrankungen, Suizidversuchen, bekannte häusliche Gewalt, Missbrauch, vi-tale Unter- oder Mangelversorgung etc.) kommt es zu einer frühen Herausnahme aus der Herkunftsfamilie zum Schutz des Kindes. Die Biographin ist direkt nach der Ge-burt in staatliche Obhut übergeben worden. Es kommt zu weiteren Vermittlungen, Verlegungen und Wechseln durch Pflege-, Adoptiv- oder Gastfamilien oder inner-halb Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Im Fall von Fr. Brandt kommt es sogar zu einem Verkauf als Ware an Adoptiveltern mit ungünstigen Aufnahmebedingun-gen, die die Indikation der Suchterkrankung der Herkunftseltern hin zum Identischen bestätigen. Die bereits etablierten negativen Bindungserfahrungen werden verstärkt. Wohlwollende und stabilisierende Bezugspersonen im elterlichen Umfeld wirken entlastend und positiv auf die Entwicklung der Biographin ein. Innerhalb des chaoti-schen, unsicheren und bedrohlichen Familiensystems erlebt die Biographin in einem sich fortsetzenden Sinne immer wieder Verluste, Tod, Gewalt in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen, existentielle Erfahrungen sowie Traumatisierungen. Ab-hängig vom Grad der individuellen Resilienz, der Coping-Strategien, der Ressourcen und Kompetenzen, sich selbst zu steuern, zu beeinflussen oder zu beruhigen, kommt
385
es auf der Handlungsebene zu unterschiedlichen Ausprägungen von Selbstverletzun-gen, Essstörungen, Impulsivität und Fremdaggressivität und extremer Manipulation von Mitarbeitenden und Mitbewohnern. Phasenweiser Alkoholabusus oder Drogen-missbrauch stellt für den Typ B ein weiteres spezifisches Verhaltensrepertoire dar, um sich auf der emotionalen Ebene zu regulieren, selbstwirksam zu steuern und zu stabilisieren.
Der Biographietyp wünscht sich größtmögliche Intimität, er reguliert Distanz und Nähe über Abwertung, Kränkungen, die Offenbarungen von Geheimnissen und erlebt sich in diesen Momenten als selbstwirksam machtvoll in einem selbstgelebten Leben. Er vergewissert sich dann dem Belastungsgrad der gegenwärtigen Beziehungen und prüft, in wie fern bzw. ob es sich lohnt, darin zu investieren oder es vorzuziehen, sich besser gleich an neue Bezugspersonen zu orientieren.
Gerade der weibliche Biographietyp B verfügt häufig, über sehr frühe romantisch-partnerschaftliche Erfahrungen, in denen der Partner zur Projektfläche mit übergro-ßen Erwartungen stilisiert wurde. Der Partner erfüllt zudem eine Schutzfunktion, ent-sprechend fällt die Partnerwahl aus, nämlich gewalt- und drogenerfahrene oder kri-minell-deviante Partner mit Haft- und Milieuerfahrung.
Die Einrichtungsmatrix präsentiert für den Typ B eine hohe Dynamik sowie eine schnell Transinstitutionalisierung durch alle Felder der Sozialen Arbeit. Selbst auf leichte Veränderungen im direkten Umfeld reagiert dieser Typ, der über Vorahnungs-talente verfügt, hoch sensibel. Der eigentliche Kontakt und die Kontaktfrequenz zur Familie, zu Freunden oder Bekannten werden i.d.R. über institutionelle, gerichtliche oder polizeiliche Strukturen vorgegeben, da der Biographietyp über das richtige Maß nichts weiß. Eine 24- Stunden Betreuung ist erforderlich, flankierend sollten regel-mäßige Vitalkontrollen und engen Kontrollen der Nahrungs- und Flüssigkeitsauf-nahme, des Körpergewichts, Drogenscreenings und Atemalkoholkontrollen oder Ta-schen- und Zimmerkontrollen nach spitzen oder scharfen Gegenständen, die der Biograph gegen sich richtet und richten könnte, durchgeführt werden.
Für kurze, evtl. monatelange Intervalle, gelingt es den Biographen von diesem Typ durch einen Zusammenschluss eines Partner/Partnerin, sich auch innerhalb von am-bulanten oder teilstationären Hilfen einen weitgehend autonomen, aber fragilen, Rei-fegrad zu behaupten. Im Gesamten sind fortlaufende Gefährdungsanalysen und Risi-kobeurteilungen notwendig. Beim prognostischen Verlauf, der von einem konstant hohen stationär beschützenden Rahmen ausgeht, kommt es zu einem negativen Kas-kadenverlauf, in dem Selbstschädigung abgewendet werden soll und maximale Ma-nipulationsversuche von Mitarbeitenden und Bewohnern zu erwarten sind.
In dauerhaften, kurzintervalligen Krisenintervention kann das chronisch suizidale Verhalten eingegrenzt werden. Die Interventionen, die durchgeführt werden, sollten bestenfalls den schnellsten Weg in die Klinik finden und anschließend sollte ebenso eine zügige Rückverlegung in den Wohnbereich mit den Beteiligten eingeleitet und vereinbart werden.
Beim Typ C: strukturlos-fragmentierte Bindungs-Typ, der sich selbst kaum organi-sieren, sich nur in stationären-hoch strukturierten Settings stabilisieren kann und von
386
dort wiederkehrend den Versuch unternimmt und anstrebt, in weniger strukturierte Wohn- und Beschäftigungsangebote zu wechseln. Der Typ C zeichnet sich dadurch aus, dass er spezifische, erhebliche Beeinträchtigungen in der Strukturierung der Zeit, also des Tagesablaufs, seiner freien Zeit, der gesamten Woche, in der Strukturierung des Wohnraums und in der Strukturierung der sozialen Kontakte und Beziehungen innerhalb der Institution aber auch außerhalb präsentiert. Der Bindungstyp benötigt Dritte, den gesetzlichen Betreuer, das Gericht, die Polizei oder professionelle Helfer, die ein für ihn angemessene Nähe und Distanz mit anderen Personen aushandeln, ausloteten und definieren. Die Aufgabe und Funktion der Dritten ist es, ihn u. U. davor zu schützt, zu begrenzen, und Kontakte vor zu strukturieren. Typischerweise konzentriert und fokussiert sich der Bindungstyp auf eine Person, die zur exklusiven Projektionsfläche seiner Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen und Möglichkeiten wird. Der Bindungstyp leidet darunter, nicht zu wissen, was er will, wohin er gehört, er verharrt mal ambivalent mal paralysierend in einem sozio-kulturellen oder ethno-religiösen Zugehörigkeitsdilemma, hat kaum eine Vorstellung davon, was er Zukünf-tig erreichen will, so dass es auch realistisch, erreichbar erscheint. Er leidet unter der lebenslangen Medikalisierung und der körperlich-leiblichen und emotionale Auswir-kungen. Er erlebt sich nur mit ausgewählten Personen als eine ganze und in sich ab-geschlossene Identität und Persönlichkeit, alleine glaubt er nicht existieren und zu bestehen zu können.
Typ D: negativ-abhängige Identitäts-Typ ist selbst in stationären und hochstruktu-rierten Settings nur schwer zu halten und zu behandeln ist. Er leistet großen offenen oder versteckt-passiv-indirekten Widerstand gegenüber dem Betreuungspersonal, er präsentiert sich mal enthemmt, mal angepasst, mal zurückgezogen, mal eigen- dann fremdaggressiv. Er verstößt immer wieder gegen Hausregeln, Therapie- und Behand-lungsvereinbarungen. Aufgrund der erlebten Bindungserfahrungen (fragmentierte Herkunftsfamilie, Heimkarriere), lässt er sich weder innerhalb der Einrichtungen noch außerhalb auf Beziehungen, Freundschaften ein. Kontakte die er pflegt, haben einen überwiegend subkulturellen Charakter von Nutzen und Kosten, von Versor-gung und Profit, von „quid pro quo“. Der Identitäts-Typ entweicht, flieht aus den Einrichtungen, um Geld zu beschaffen, Drogen zu konsumieren oder er konsumiert außerhalb aber auch innerhalb der Einrichtungen in einem polytoxikomanen Sinne Drogen, Alkohol, er versucht sich mit anderen Mitbewohnern zu solidarisieren, mit ihnen zu entweichen, sie mit Drogen und anderen Gütern (Waffen etc.) zu versorgen.
Im gesamten Betreuungsverlauf ist beim Identitätstyp von einer negativen prognosti-schen Entwicklung auszugehen. Das bedeutet, wenn er das Plateau eines hochstruk-turierten Settings erreicht hat, haftet er dieser Betreuungsform an und transinstitutio-nalisiert nur noch in Richtung Straf- oder Maßregelvollzug oder er landet auf Straße, wo er sich nicht behaupten kann. Den professionellen Helfern bleibt meist nur noch übrig, eine weiter strukturierende, begrenzende, kontrollierenden Umgang abzulei-ten, um Gefahr für den Bindungstyp und für den Identitätstyp abzuwenden bzw. ein-zugrenzen. Er verharrt in hochstrukturierten Einrichtungen, die er immer wieder aus disziplinarischen Gründen zu wechseln hat. Das kriminelle Milieu und die Drogen-welt üben eine große Attraktion auf den Identitätstyp aus, im Sinne aus einer weitge-henden fremdstrukturierten Lebenswelt in eine Welt zu wechseln, die keine Regeln oder Restriktionen als die von ihm selbst definierten und anerkannten.
387
9.5. Handlungsempfehlungen in der Versorgung der Gruppe der Trans-Sektoralen Systemprüferinnen
„Ich komme, ich weiß nicht woher? Ich bin, ich weiß nicht wer? Ich sterb`, ich weiß nicht wann Ich geh, ich weiß nicht wohin. Mich wundert`s, dass ich fröhlich bin“
(Mittelalterlicher Vers, unbekannter Verfasser)
Die Gruppe der Trans-Sektoralen-Systemprüfenden ist eine, settingspezifisch be-trachtet, Patienten- bzw. Bewohnergruppe in der (sozial)psychiatrischen Versorgung, der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege, die quantitativ in den letzten zehn Jahren an Diskussionsraum und Bedeutung zugenommen hat. Dies hängt zum einen mit der Entwicklung der Sozialpsychiatrie, mit einer Bewusstwerdung, zum anderen mit der Differenzierung und Ausgestaltung der sozialpsychiatrischen Behandlungs-angebote und mit dem (wieder)entdeckten Anspruch an einer gemeindenahen psychi-atrischen Versorgung zusammen. Diese Gruppe weist viele Gemeinsamkeiten und kategoriale Eigenschaften auf, gleichzeitig ist sie durch eine hohe Heterogenität und eine durch sämtliche Felder der sozialen Arbeit durchdringende Bandbreite in den Charakteristika und Eigenschaften gekennzeichnet.
Für den zu intergierenden Patientenkreis der TSSP können auf der beruflichen Kompetenzebene der professionellen Helfer, auf der Patientenebene und der regionalen Ebene, sowie auf der Ebene des Leistungserbringers folgende signifikante und sinnvolle Ergebnisparameter im Rahmen einer gelingenden geschlossenen Heimversorgung in der Eingliederungshilfe abgeleitet werden:
1. Gelingt der Übergang (Gestaltung des Übergangs, Abbruch- bzw. Übergangsrate nach 1, 2-5 Jahren nach der Aufhebung des Unterbringungsbeschlusses?) sowohl von der aufnehmenden Einrichtung/Primärfamilie in die geschlossene Heimver-sorgung als auch der Übergang nach der Heimunterbringung in die nachsorgende Einrichtung? Sind hierzu alle erforderlichen Informationen eingeholt und ausge-tauscht worden, alle Vorbereitungen geebnet? Sind die Einrichtungen, die bei der Nachsorge beteiligt sind, über die Behandlung informiert, mit dem individuellen Umgang vertraut? Sind die Bereiche Arbeit und Beschäftigung, Wohnen, Facharzt, Hausarzt, Selbsthilfegruppe, Suchthilfe, nicht-professionellen Hilfen, Zuständig-keiten der Sozialverwaltung geklärt? Ist das Team befähigt, sich der Betreuung zu stellen, sie anzunehmen?
2. Gelingt die Integration in Tagesstruktur oder Beschäftigung im Haus oder extern (Beschäftigungsrate, Fehltage, Gründe für das Fehlen?) unter Berücksichtigung der Kooperation und Vernetzung auf dem 2. und 3. Arbeitsmarkt? Hier sind flexibel arbeitende, individuell denkende und kreativ gestaltende Ergotherapeuten und Arbeitserzieher gefragt.
3. Selbst- aber auch fremdgefährdendes Verhalten (Gefährdungsrate) Schulungsrate von Deeskalationstraining bei Mitarbeitende��� Ausbildung von Multiplikatoren,
388
perpetuierende Risikobeurteilung in Fallbesprechungen, in der Fallsupervision durchführen, unter aktiver Beteiligung der Patienten/ Bewohner/ Klienten.
4. Psychiatrische Krisenintervention im Verlauf der Unterbringung in den pflichtversorgenden psychiatrischen Kliniken (Abbruch- und Einweisungsrate).
5. Einhaltung bzw. Verletzungsrate der definierten Haus- und Behandlungsverein-barungen. (Fahndungsrate) Wie ist der Umgang/Auseinandersetzung/Reflexionsgrad in der Institution zum Thema: Ethik und Zwangsbehandlung, Gewalt, Macht-missbrauch, Demütigung durch die Institution? Wie ist der Grad der Auseinander-setzung und mit der inneren Haltung sowie mit dem professionellen Selbstverständnis von Sozialer Arbeit beim einzelnen Mitarbeitenden und im Team im geschlossenen Zwangskontext?
6. Psychische Symptome Schwere. Qualifikationsrate zu Krankheitslehre, zu Behandlungsmethoden, zu methodischen Kompetenzen der Sozialen Arbeit, zur pharmakologischen Medikamentenbehandlung, zum Umgang mit schwierigen, herausfordernden Klienten oder zur Gesprächsführung?
7. Suizidalität und Suizidrate der TSSP Klientel. Umgang mit psychiatrischer Krisen und suizidalen Krisen, 1. Hilfekursrate, Kompetenz mit Suizidalität, feste Ansprechpartner/Standards zur Auf- und Nachbearbeitung bei eigen- oder fremd-gefährdenden Ereignissen für Mitarbeitende und Bewohner,
8. Fortlaufende Ermutigung, Anerkennung und Lob, Zuspruch für die Mit-arbeitenden, sowie selbstreflektierende Bearbeitung bei kritischen Ereignissen, Momente und Kontakten durch Vorgesetzte, die sichtbar, präsent und erreichbar in der Betreuungsarbeit sein müssen.
9. Somatische Morbidität (chronische Krankheiten, wie z.B. Hepatitis, zahnärztlich-internistische Versorgung etc.). Kompetenzrate in der Behandlung von medizinischen Hilfsmittel (z.B. Sauerstoffgerät, Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessung, Alkomat, etc.) oder bei pflegerischen Tätigkeiten.
10. Perspektivenentwicklung für den zukünftigen Wohnraum nach Ablauf der geschlossenen UBG. Kenntnisse der GPV-Strukturen, der Angebote, über die Zugänge, die Voraussetzungen.
11. Gelingt eine positive Einflussnahme durch Einbeziehung und einer Revi-talisierung der Angehörigenarbeit im geschlossenen Heim und auch im Anschluss? Gesprächs- und Moderationskompetenzen in der Angehörigenarbeit, Kenntnis um den trialogischen Austausch, Teilnahme an Psychoseseminare.
12. Gelingt ein Entschuldungsprozess, eine Abnahme der Schulden, ein gelingendes und ökonomisches Umgangs- verhalten mit dem aktuellen und zukünftigen finanziellen Einkommen? Schuldnerberatungskompetenzen, sowie sozialhilfe-rechtliches Know-How, Kenntnisse um die Ansprüche, die geltend gemacht werden können.
13. Übertragbarkeitsrate von veränderten Verhaltens- mustern, die intramural (Hospitalisierungsverhalten) gelernt wurden und die in eine extramurale
389
Lebenswirklichkeit zu übertragen sind. (Enthospitalisierungsrate, welches konkrete Verhalten, das in der Alltags- und Lebenswelt, bzw. außerhalb von stationären oder geschlossenen Settings keinen Sinn macht, kann verändert, reduziert, ganz aufgegeben werden?) Identifikation von Hospitalisierungsverhalten, wie gelingt der Bezugsperson eine Einflussnahme, mit dem Bewohner, auf die Selbstfürsorge, um einen Autonomieprozess zu initialisieren? Wie kann in Abstimmung ein positiver Einfluss auf das Wollen, das Fühlen, Denken und Handeln des Bewohners gelingen?
14. Subjektive Zufriedenheit mit der geschlossenen Versorgung durch Bewohner und Mitarbeitenden- Befragung, durch Verbesserungsmanagement.
15. Gelingt es innerhalb der Versorgungsregion den Hilfebedarf der TSSP Klientel zu decken, der häufig nicht bei der Wohnraumpflege, der Körperhygiene, der Wäschepflege, sondern vielmehr in der Strukturierung von Zeit und Raum, in der Begleitung und Reflexion der sozialen Welt, der inneren Welt, der Motivation, der Gedankenwelt, der emotionalen Welt oder mit einem angemessenen Umgang von Frust, Wut und Enttäuschung verortet ist? (positive Selbstbestimmungsrate). Wie gelingt Transparenz des Tuns und Handelns im geschlossenen Heim? Durch intensive Heimbeiratsarbeit, durch externe und interne Besetzung, durch ein gewünschtes und lebendiges Beschwerdemanagement, durch externe Besucher/ Hospitation/ Kosten-träger, Betreuer, denen die Arbeit und das Vorgehen vorgestellt wird, durch einen Qualitätszirkel, durch ein sich einbinden in bestehende gemeindepsychiatrische Gremien und durch aktive Verbandsarbeit etc.
16. Praktische und theoretische Kompetenzrate (Schulungsrate) Wissen zu und über geschlossene Versorgung. Anzahl der Mitarbeitenden mit z.B. therapeutischen Zusatzqualifikationen (systemische Zusatzausbildungen, in Gesprächs-psychotherapie, Verhaltenstherapie, Transaktionsanalyse etc.), Hospitationsrate in anderen geschlossenen Heimen oder Einrichtungen/ Klinken der Region etc.
17. Abstimmungs- und Bekanntheitsrate zu Erwartungen, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Grenzen der Beteiligten/ Stakeholder: Kenntnisse der Strukturen, der Zugänge, der Angebote und der Binnenlogik von Gemeinde-psychiatrie, klinische Psychiatrie und Suchtmedizin in der Versorgungsregion
18. Ausstattungsrate von strukturellen Versorgungsstandards einer Versorgungs-region (Pflichtversorgung, als GPV organsiert, mit einer HPK ausgestattet, Hilfeplanung erfolgt mit Hilfe eines personenzentrierten IBRP/ ITP etc., die Heimleitungen der geschlossenen Einrichtungen haben einen festen Sitz in der HPK, Kooperationsstandards mit Fallmanagement/Kostenträger usw.)
19. Teamkompetenz und Fähigkeiten, verbindlicher, respektvoller und wertschätzen-der Umgang, Anwendung von Humor im Umgang, Ehrlichkeit und Echtheit als tief verankerte Haltung, Begegnung auf Augenhöhe, soweit das im geschlossenen Setting möglich ist
20. Besondere Kompetenzen im Bereich Hygiene (Schulungsrate) sind erforderlich� besonderen Wert und Schwerpunkt sollte auf die Qualität des Essens und das gesamte Feld der Hauswirtschaft in der Einrichtung gelegt werden!
390
21. Angebot und Etablierung von Psychoedukativer Gruppenarbeit zur Aufklärung, Information und Austausch der Erkrankung, zum Umgang mit den Symptomen, Nebenwirkungen, zu einem gesundheitsfördernden Lebensstil, zu einem indivi-duellen Krisenprophylaxeplan, zu einer selbstwirksamen Einflussnahme auf die Erkrankung, sowie zu grundlegenden Themen der Spiritualität, der Religionen oder zu ethische Fragestellungen.
22. Fortlaufende ethische Diskurse und Fallbesprechungen unter Einbeziehung der Bewohner bzw. Etablierung von regelmäßigen und dokumentierten ethische Fallbesprechungen und von „reflecting team“ nach dem Vorbild, wie MASANZ und MENZLER-FRÖHLICH berichten (2016).535
23. Mitarbeitende benötigen Kompetenz und Fähigkeiten in der Kontaktgestaltung, der Beziehungsarbeit, in der Kooperationsarbeit, in der Steuerung der beteiligten Hilfen untern den beteiligten Diensten. Mitarbeitende benötigen Coachingangebote, Supervision, selbstreflexive Gesprächsangebote, sie benötigen Rückhalt und Unterstützung durch Vorgesetzte. MA sollen eine ernsthafte Personalentwicklung erfahren, sie sollen motiviert werden, sich gezielt mit Themen beschäftigen: zum Umgang mit Gewalt, zur Machtlosigkeit, sie sollen sich mit den Grenzen und ihrem Wirken ihres Tuns auseinandersetzen. Sie benötigen einen langen Atem, sie brauchen Begleitung, Zuspruch und Ermutigung. Sie sollen auf ihre Gesundheit achten. Das ist die Aufgabe und Verantwortung von Führungs- und Leitungspersonen!
24. Die Arbeit in der geschlossenen Heimversorgung sollte mit einer Prämie honoriert und anerkannt werden!
25. Die qualifiziertesten Mitarbeitenden eines Trägers sollten für die Arbeit im geschlossenen Setting beworben und gewonnen werden, es sollten Anreize geschaffen werden. Im Bereich Arbeitszeit, flexible Arbeitszeitkonten, strukturierte Vorzüge (Mitarbeiterpflege) durch den Arbeitgeber geschaffen werden.
535 Vgl. a.a.O. Masanz, K./Menzler-Fröhlich, K-H (2016); S.:17
391
E: Anhang
Quellen- und Literaturverzeichnis
Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. GS 4. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt:1998
Ahrens E./Strüber E./Volpers R. (1989): Lebensgeschichte von Prostituierte. In: Rosenthal, Gabriele (Hg.): Interpretative Sozialforschung. Beltz Juventa. Wein-heim/München, S. 62-80
Aktion Psychisch Kranke (Hg.) Personenzentrierte Hilfen im gemeindepsychiatri-schen Verbund. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2006
Alanen, Yrjö: Schizophrenie. Entstehung, Erscheinungsformen und bedürfnisange-paßte Behandlung. Klett-Cotta. Stuttgart: 1977
Allert, Tilmann: Die Familie. Fallstudien zur Unverwüstlichkeit einer Lebensform. Walter de Gruyter. Berlin. New York: 1998
Amering, Michaela/Schmolke, Margit: Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2007
Armbruster, Jürgen/Rein, Gabriele: Systemische Praxis in der Gemeindepsychiat-rie. In: Ritscher, Wolf (Hg.): Soziale Arbeit: systemisch. Vandenhoeck & Rup-recht. Göttingen: 2007; S. 148-169
Ayena, Doris: Backrezept für ein geschlossenes Wohnheim. In: Kerbe (2011) 2. Quartal, S. 22-24
Bargfrede, Hartmut: Enthospitalisierung forensisch-psychiatrischer Langzeitpati-enten. 1. Aufl. Psychiatrie Verlag. Bonn: 1999
Baudrillard, Jean: Die Konsumgesellschaft. Springer VS. Heidelberg: 1970
Baudrillard, Jean: Das perfekte Verbrechen. Mattthes & Seitz. München: 1996
Bauer, Patricia: Die politische Entgrenzung von Innerer und Äußerer Sicherheit nach dem 11.9. 2001. In: Elsbergen, Gisbert van (Hg.) Wachen, kontrollieren, patrouillieren. Kustodialisierung der inneren Sicherheit. VS Verlag. Wiesbaden: 2004; S. 49-76
Bauman, Zygmunt: Flüchtige Zeiten. Leben in der Ungewissheit. Edition Suhr-kamp, Hamburg: 2008
Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Surkamp. Frankfurt/M.: 1986
van Berkel, Rik/Roche, Maurice: Activation Policies as Reflexive Social Policies. In: Moller Hornemann, Ivar (Hg.): Active Social Policies in the European Union. Bristol (Policy Press): 2002, S. 207
392
Bettge, Susanne: Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Charakterisierung, Klassifizierung und Operationalisierung. Disser-tation. Berlin: 2004
Bielesch, Jürgen/Masanz, Klaus/Obert, Klaus: Aus dem Maßregelvollzug in die Gemeinde. In: Soziale Psychiatrie (2016) 03/2016, S. 16-18
Bieri, Peter: Wie wollen wir leben? 3. Aufl. dtv. München: 2014
Blankenburg, Wolfgang: Der Versagenszustand bei latent Schizophrenen. In: Deut-sche Medizinische Wochenzeitschrift. (1986) 93, S. 67-71
Bodenmüller, Martina/Piepel, Georg: Streetwork und Überlebenshilfen. Beltz. Weinheim: 2003
Bogner, Artur: Macht und die Genese sozialer Gruppen. In: Sociologus (2003) Heft 23 (2), S. 177
Bogner, Artur/ Rosenthal, Gabriele: Introduction: Ethnicity, Biography and Op-tions of Belongings. In: Rosenthal, G /Bogner A. (Hg.): Ethnicity, Belonging and Biography. Ethnographical and biographical Perspectives. LIT-Verlag. New Brunswick: 2009
Böhnisch, Lothar: Sozialpsychiatrie der Lebensalter. Eine Einführung. 4. überarb. Aufl. Beltz. Weinheim-München: 2005
Bohnsack, Ralf: Rekonstruktive Sozialforschung. 8. Aufl. Budrich Verlag. Opladen: 2010
Böker-Scharnholz, Mechthild: Hilfen wie aus einer Hand. Die personenzentrierte und sozialräumliche Integration von Suchthilfe, Wohnungslosenhilfe und Psychi-atrie. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2009
Bommes, Michael/Scherr, Albert: Soziale Arbeit als Hilfe zur Exklusionsvermei-dung, Inklusionsvermittlung und/ oder Exklusionsverwaltung. In: Neue Praxis (1996), 26, S. 107-120
Borbe, Raoul: Fachtagung des Diakonischen Werks Württemberg in Hohenwart bei Pforzheim. 1.-2.10. 2013. Vortrag: Umgang mit den Schwierigsten
Borbé, Raoul/ Flammer, E/Borbe, S/Müller, T: Sozialpsychiatrische Forschung. Ent-wicklung über die letzten 10 Jahre im Spiegel deutschsprachiger Zeitschriften. In: Psychiatrische Praxis (2009) 36, S. 362-367
Bowlby, John: Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendungen der Bin-dungstheorie. Reinhardt. München: 2008
Brisch, Karl-Heinz (Hg.): Bindung und Sucht. Klett-Cotta. Stuttgart: 2013
Bude, Heinz: „Die Überflüssigen“-Ein Gespräch zwischen Baecker, Dirk/Bude, Heinz/ Honneth, Axel/ Wiesenthal, W.: Exklusion. Suhrkamp. 1. Aufl. Frankfurt/ M.: 2008, S. 31ff.
393
Bude, Heinz: Die Erinnerung. In: König, Helmut./ Kohlstuck, Michael./ Wöll, An-dreas (Hr.): Vergangenheitsbewältigung am Ende des 20. Jh. Leviathan. In: Zeit-schrift für Sozialwissenschaften. (1998) Sonderheft 18. Opladen/Wiesbaden, S. 71-74
Calic, Marie-Janine: Krieg und Frieden in Bosnien-Hercegovina. Suhrkamp. Frank-furt/M.: 1996��
Castel, Robert: Die Stärkung des Sozialen. Leben im neuen Wohlfahrtsstaat. Verlag. Hamburg: 2005
Cil, Nevim: Topographie des Außenseiters. Schriftenreihe Politik und Kultur. Verlag Hans Schiler. Birkach: 2007
Ciompi, Luc: Affektlogik. Klett-Cotta. Stuttgart: 1979
Crefeld, Wolf: Debatte: Pro & Contra: Geschlossene psychiatrische Wohnheime. In: Psychiatrische Praxis (2012) 39, S. 4-6
Dahlmann, Dittmar: Die Deportation der deutschen Bevölkerung in Rußland und der Sowjetunion. 1915 - 1941. Ein Vergleich. In: Gestrich, Andreas/ Hirschfeld, Gerhard et al. (Hg.): Ausweisung und Deportation. Franz Steiner. Stuttgart: 1999. S. 104
Düwell, Marcus: Handbuch der Ethik. Metzler. Stuttgart: 2002
Ehrenberg, Alain: Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Ge-genwart. Campus. Frankfurt/ M.: 2004
Eisenmann, Barbara: Erzählen in der Therapie. Westdeutscher Verlag. Opladen: 1995
Elias, Norbert: Notizen zum Lebenslauf. In: Ders. Über sich selbst. Frankfurt/M.: 1990, S. 161
Erhart, M: Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey: Risiken und Ressourcen für die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bundesgesundheits-blatt (2008) 50, S. 800-809
Esser, Hartmut: Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 2: Die Konstruktion der Gesellschaft. Campus. Frankfurt/M./New York: 2000
Evans-Pritchard, Edward Ewan: Whitchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford University Press. London: 1937
Fengler, Christa/Fengler, Thomas: Alltag in der Anstalt. Psychiatrie Verlag. Bonn: 1994
Finzen, Asmus: Psychose und Stigma. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2001
394
Fischer, Wolfram (2008): Fallrekonstruktionen und Intervention. In: Giebeler, Cornelia/Fischer, Wolfram/ Goblirsch/M������������� ngrid/Riemann, Gerhart (Hg.): Fallverstehen und Fallstudien. Band 1, 2. Aufl. Verlag Barbara Budrich. Opladen: 2008, S. 22-32
Fischer-Rosenthal, Wolfram: Biographische Methoden in der Soziologie. In: Flick, Uwe (Hg.): Qualitative Forschung, S. Fischer. Frankfurt: 1993, S. 253
Fischer-Rosenthal, Wolfram: Strukturale Analyse biographischer Texte. In: Bräh-ler, E./Adler, C.(Hg.) Quantitative Einzelfallanalyse und qualitative Verfahren. Psychosozial-Verlag. Reihe Forschungen. Gießen: 1996, S. 147-209
Fischer-Rosenthal, Wolfram (1999): Melancholie der Identität und dezentrierte bi-ographische Selbstbeschreibung. Anmerkung zu einem langen Abschied aus der selbstverschuldeten Zentriertheit des Subjekts. In: Bios 12, (1999), S. 143-168
Fischer-Rosenthal, Wolfram: Biographie und Leiblichkeit. In: Alheit, Peter/ Dau-sien, Bettina/Fischer-Rosenthal, Wolfram/Keil, Annelie (Hg.): Biographie und Leib. 2. Aufl. Psychosozial-Verlag. Gießen: 2002, S. 16-43
Fischer-Rosenthal, Wolfram/ Rosenthal, Gabriele: Analyse narrativ-biographi-scher Interviews. In: Flick, Uwe et al (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlt. 5 Aufl. Rowohlt. Reinbeck: 2007, S. 460ff.
Fischer-Rosenthal, Wolfram/Rosenthal, Gabriele: Narrationsanalyse biographi-scher Selbstpräsentation. In: Hitzler, Ronald/Honer, Anne (Hg.): Sozialwissen-schaftliche Hermeneutik. Leske und Budrich: Opladen: 2007, S. 153ff.
Flick, Uwe: Triangulation. Methodologie und Anwendung. Budrich. Opladen: 2001
Fortunato, Gian-Carlo: Belastungsfaktoren und Bewältigungsstrategien junger Er-wachsener mit komplexer Problematik während der Wohnungslosigkeit. Mas-terthesis. HS RheinMain. Wiesbaden: 2012, S. 106-112
Frank, Udo/Konrad, Michael: Können forensische Klienten im Gemeindepsychiat-rischen Verbund versorgt werden? In: Kerbe (2010) 03, S. 39-42
Fraser, Nancy/Honneth, Axel (Hg.): Umverteilung oder Anerkennung? Suhrkamp. Frankfurt/M.: 2003
Freese, Roland: Ambulante Versorgung von psychisch kranken Straftätern im Maß-regel- und Justizvollzug-Analysen, Entwicklungen, Impulse. In: Recht & Psychi-atrie (2003) 29. Jg. 4. Vierteljahr, S. 52ff.
Frehe, Horst: Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. Vierteljahresheft zur Förderung von Sozial-, Jugend- und Gesundheitslehre (2006) o. J. H 4, S. 80-89
Freidson, Eliot: Berufs- und wissenssoziologische Durchleuchtung einer Profession. Enke. Stuttgart: 1979. S. 177
395
Freyberger, Hans-Jürgen et al; Ulrich, Ines, Dudeck, Manuela, & Steinhart, Ing-mar: Woran scheitert die Integration in das psychiatrische Versorgungssystem? In: Sozialpsychiatrische Information (2004) 2, S. 16-21
Frick U./Frick, H. (2008): Basisdaten stationärer psychiatrischer Behandlung. Ver-tiefungsstudie „Heavy User“. Literaturanalyse (Obsan Forschungsprotokoll 5), Neuchâtel. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium. 2008. Download: http://www.obsan.Admin. ch /bfs/obsan/de/index/01/02.Document.105425.pdf
Fritz, Gerd: Historische Semantik. 2. Aufl. J.B. Metzler Stuttgart: 2006
George, Carol/Kaplan, Nancy: The Attachment Interview for Adults. Berkley, Uni-versity of California 1985. (unveröffentlichtes Manuskript)
Glatzel, Jürgen/Huber, Gerd: Zur Phänomenologie eines Typs endogener, juvenil-asthenischer Versagenssyndrome. In: Psychiatrica Clinica. Basel: 1986. 1, S. 15-31
Goblirsch, Martina: Wie entstehen Lebensgeschichten? Ein interdisziplinärer Zu-gang zu Fallrekonstruktionen In: Fallverstehen und Fallstudien. Interdisziplinäre Beiträge zur rekonstruktiven Sozialforschung. Band 1. 2. Aufl. Budrich. Opladen: 2008, S. 53-66
Goblirsch, Martina: Biographien verhaltensschwieriger Jugendlicher und ihrer Mütter. VS Verlag. Wiesbaden: 2010
Goffman, Erving: Asylums. Essays on the Social Situations of Mental Patients. 1. Auflage. Suhrkamp. Frankfurt/M.: 1973
Goffman, Erving: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. 22. Auflage. Suhrkamp Verlag. Frankfurt/ Main: 2014, S. 170
Grossmann, Karin/Grossmann, Klaus F.: Bindungen. Das Gefüge psychischer Si-cherheit. 5. Aufl. Klett-Cotta. Stuttgart: 2012
Grunwald, Klaus/Thiersch, Hans (2014): Lebensweltorientierung. Enzyklopädie Erziehungswissenschaften Online; ISSN 2191-8325, Fachgebiet/Unterüberschrift: Soziale Arbeit, Grundbegriffe. Schröder Wolfgang/ Schweppe, Cornelia (Hg.). Beltz. Juventa. Weinheim und Basel: 2014. DOI 10.3262/EEO 14140320, S. 4-6
Gurwitsch, Aron: Das Bewußtseinsfeld. De Gruyter. Berlin. New York: 1979
Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1-2. Verlag. Frankfurt: 1981
Häfner, Heinz: Onset an early Course of Schizophrenia. In: Häfner, H et al. Search for the Causes of Schizophrenia. Vol. III. Springer Verlag. Berlin: 1995, S. 43-66
Häfner, Heinz: Das Rätsel der Schizophrenie. Eine Krankheit wird enträtselt. C.H. Beck. München: 2000
396
Häfner, Heinz (2001):Titel. In: APK Band 27. 2001. S. 96ff. www.psychiat-rie.de/dgsp/soltauer-initiative/ Download vom 25.10.2016;
Hambrecht, Martin: Debatte: Pro & Contra: Es gibt keine „schwierigen Patienten. In: Psychiatrische Praxis (2010) Heft 37, S. 56-58
Heimann, Eduard: Soziale Theorie des Kapitalismus. Theorie der Sozialpolitik. 1. Aufl. Suhrkamp. Frankfurt/ M.: 1980
Heinrichs, Harald/Grunenberg, Heiko: Klimawandel und Gesellschaften. VS Ver-lag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden: 2009
Heitmeyer, Wilhelm/Zick, Andreas: Studie des Instituts für interdisziplinäre Kon-flikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld: Gruppenbezogene Men-schenfeindlichkeit in Deutschland. Eine 10-jährige Langzeituntersuchung mit ei-ner jährlichen Bevölkerungsumfrage zur Abwertung und Ausgrenzung von schwachen Gruppen. Suhrkamp. Berlin: 2012, S. 8-9
Heitmeyer, Wilhelm: Kontrollverluste und Bedrohungsgefühle. In: Frankfurter Rundschau vom 6.5.2000 und vom 8.5.2000
Hermsen, Thomas/Roos, Klaus/Zinkl, Karin: Forschung an/mit Fachhochschulen unter besonderer Berücksichtigung einer Effizienzuntersuchung in der Kinder- und Jugendhilfe. Paper presented at the Mainzer Werkstattgespräche. Mainz: 2004
Hildenbrand, Bruno/ Jahn, W.: „Gemeinsames Erzählen“ und Prozess der Wirk-lichkeitskonstruktion in familiengeschichtlichen Gesprächen. In: Zeitschrift für Soziologie (1988) 15, S. 203-217
Hildenbrand, Bruno: Alltag als Therapie. Ablöseprozesse Schizophrener in der psy-chiatrischen Übergangseinrichtung. Huber. Bern und Stuttgart: 1991
Honneth, Axel: Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie. Reclam. Stuttgart: 2000
Honneth, Axel: Umverteilung als Anerkennung. Eine Erwiderung auf Nancy Fraser. In: Fraser, N. Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Suhrkamp. Frankfurt/M.: 2003, S. 200
Honneth, Axel: Aspekte der Individualisierung. In: Honneth, Axel: Desintegration. Bruchstücke einer soziologischen Zeitdiagnose. Frankfurt/M.: 1994, S. 20-29.
Honneth, Axel: Kampf der Anerkennung. Suhrkamp. 2. Auflage. Frankfurt/M.: 1998
Holtmannspötter, Heinrich: Obdachlos und psychisch krank. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2002
397
Huber, Michaela: Trauma und die Folgen. Trauma und Traumabehandlung. Teil 1. Junfermann. Paderborn: 2003
Hudson, Christopher G.: Socioeconomic status and mental illness: Tests of social Causation and Selection Hypotheses. In: American Journal of Orthopsychiatry. (2005).Vol 75 No.1, 3, S. 18ff.
Hüther, Gerald: Auswirkungen traumatischer Erfahrungen im Kindesalter auf die Hirnentwicklung. In: Brisch, Karl Heinz und Hellbrügge Thomas (Hg.): Bindung und Trauma. 5. Aufl. Klett-Cotta. Stuttgart: 2015. S. 94-104
Hüther, Gerald: The Central Adaption Syndrome. Psychosocial stress as a trigger for adaptive modifications of brain structure and brain function. In: Neurobiology (1996), S. 569-612
Husserl, Edmund: Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins. 1892-1917. Herausgegeben von Rudolfs Boehr. Gesammelte Werke. Band 10. Den Haag. Nijhoff: 1976, S. 412
Ingenhorst, Heinz: Die Russlanddeutschen. Campus Forschung. Frankfurt/M. New York:1997
Jäger, T./ Rezo, J.: Zur sozialen Struktur der bosnischen Kriegsflüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland. Studie von Pro Asyl. Frankfurt/M.: 2000
Jahoda, Marie/Lazarsfeld, Paul F./Zeisel, Hans: Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch. 1. Auflage. Suhrkamp. Frankfurt/M. und Leipzig: 1975
Jaspers, Karl: Einführung in die Philosophie. Piper. München: 1943
Jaspers, Karl: Allgemeine Psychopathologie, 5. Auflage. Springer Verlag. Heidel-berg: 1948
Jurzcyk, Karin/Rerrich, Maria: Die Arbeit des Alltags. Lambertus Verlag. Frei-burg: 1993
Kambartel, Friedrich: Arbeit und Praxis. In: Honneth, Axel (Hg.): Pathologien des Sozialen. Fischer. Frankfurt/M.: 1994, S. 123-139
Karawanskij, Susanne (Hg.) et al: Antidiskriminierungspädagogik: Konzept und Methoden für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen. Verlag für Sozialwissenschaf-ten. Wiesbaden: 2010, S. 258
Kardorf, Ernst von: Zur Diskriminierung psychisch kranker Menschen. In: Hamel, U./Scherr, A. (Hg.): Diskriminierung. Grundlagen und Forschungsergebnisse. 1. Aufl. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden: 2010, S. 279-306
Kastl, Jörg Michael: Vortrag bei der DGSP Landesverband Baden-Württemberg am 5.2.2014 in Stuttgart: Ganz normal psychisch krank? Inklusion, Integration und die Sozialpsychiatrie: 2014
398
Kernberg, Otto: Narzissmus, Aggressionen und Selbstzerstörung. Fortschritte in der Diagnose und Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen. Klett-Cotta. Stutt-gart: 2005
Kellinghaus, Christoph: Wohnungslos und psychisch krank: Eine Problemgruppe zwischen den Systemen. LIT Verlag. Münster. Hamburg. London: 2000
Kjelsberg, Ellen/Nygren, Pär: The Prevalence of emotional and behavioral prob-lems in institutionalized childcare clients. Nordic Journal of Psychiatry (2004) 58 (4), 319-325.
Kipphardt, Heinar: März., 14. Aufl. Rororo. Hamburg: 2001
Kleve, Heiko: Die soziale Arbeit ohne Eigenschaften. Verlag. Freiburg i.B.:2000
Klinger, Cornelia: Ungleichheit in den Verhältnissen von Klasse, Rasse und Ge-schlecht. In: Knapp, Gudrun-Axeli/Wetterer, Angelika (Hg.): Achsen der Diffe-renz. Gesellschaftstheorie und feministische Kritik II. Verlag Westfälisches Dampfboot. Münster: 2003, S.14-48
Knapp, Gudrun-Axeli/Sauer, Birgit: Achsen der Ungleichheit. Zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ethnizität. Verlag. Frankfurt/M: 2007
Knuf, Andreas/Osterfeld, Margarete/Steibert, Ulrich: Selbstbefähigung fördern. Empowerment und psychiatrische Arbeit, 5. überarb. Aufl. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2007
Kowalewski, Roland/Mutschler, Jochen/Peter, Franziska: Behandlungseinrich-tungen für Abhängige. In: Rössler W, Kawohl W (Hg.): Sozialpsychiatrie. Band 2. Kohlhammer. Stuttgart: 2013, S. 202-213
Koller, Edeltraud/Reisinger, Ferdinand/Rosenberger, Michael (Hg.): Wegsper-ren oder einschließen? Die Praxis der Freiheitsstrafe zwischen Inklusion und Ex-klusion. Peter Lang Verlag. Frankfurt/M.: 2010, S. 185ff.
Krisor, Mathias: Wege zur gewaltfreien Psychiatrie. Das Herner Modell. Psychiatrie Verlag. Bonn: 1992
Kronauer, Martin: Exklusion. 2. aktuelle und erweiterte Aufl. Campus. Frank-furt/M.: 2010
Krumm, Silvia/Becker, Thomas: Versorgung psychisch Kranker zwischen Stigma und Intervention. In: Gaebel, Wolfgang/Möller, Hans-Jürgen/Rössler, Wulf (Hg): Stigma -Diskriminierung - Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker. Kohlhammer. Stuttgart: 2004, S. 179-195
Kummer, Carina/Masanz, Klaus: Nachsorge von ehemals forensisch-psychiatri-schen Patienten nach § 63 StGB in Baden-Württemberg am Beispiel des Gemein-depsychiatrischen Verbundes in Stuttgart. Masterthesis. HS Wiesbaden: 2009, S. 90-102
399
Kunstmann, Wilfried/Becker, Hinnerk/Völlm, Birgit: Erhebung psychiatrischer Krankheitsprävalenz unter wohnungslosen Menschen. In: wohnungslos, (1998) Heft 3, S. 107
Kürsat-Ahlers/Elcin: Stigmatisierung, Diskriminierung und ethische Schichtung. In: Grise, Hartmut M. et al. (Hg): Was ist eigentlich das Problem am „Ausländer-problem“? Über die soziale Durchschlagskraft ideologischer Konstrukte. Frank-furt/M. London: 2002, S. 50
Lamnek, Siegfried: Qualitative Sozialforschung. 4. überarb. Aufl. Juventa. Wein-heim: 2005, S.184
Layons-Ruth, Karlen/Block, Deborah (1996): The disturbed caregiving system. Relations among childhood trauma, maternal caregiving, and infant affect and at-tachment. In: Infant Mental Health Journal, 17, 3, S. 257-275
Leibfried, Stephan/Leisering, Lutz et al.: Zeit der Armut. Lebensläufe im Sozial-staat. Frankfurt/M.: 1995
Lempp, Reinhart: Die seelische Behinderung bei Kindern und Jugendlichen als Auf-gabe der Jugendhilfe. 4. Aufl. Boorberg. Stuttgart: 2006
Lennertz, Ilka: Trauma und Bindung bei Flüchtlingskindern. Vandenhoeck & Rup-recht. Göttingen: 2011
Leune, Jost: Versorgung abhängigkeitsranker Menschen in Deutschland. In: Jahr-buch Sucht. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. (DHS) (Eds.) Pabst. Lengerich: 2012, S. 193-208
London; Jack.: König Alkohol. 22. Aufl. dtv. München:1979
Lorenzer Alfred/Thomä, Helmut (1965): Über die zweiphasige Symptomentwick-lung bei traumatischen Verläufen. In: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen (1965) 18. Jg, Heft Nr. 11, S. 674-684
Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Suhrkamp, Frankfurt/M.: 1994
Lutz, Helma/Wenning, Norbert: Differenzen über Differenz- Einführung in die De-batte. In: Dies. (Hg.): Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungs-wissenschaft. Verlag. Opladen: 2001, S. 11–24.
Machleidt, Wielant (Hg.): Psychiatrie im Kulturvergleich. Verlag für Wissenschaf-ten und Bildung. Berlin: 1997
Machleidt, Wielant: Die 12 Sonnenberger Leitlinien zur psychiatrisch-psychothera-peutischen Versorgung von Migrantinnen in Deutschland. In: Nervenarzt (2002) 72 S. 1208-1209
Mannheim, Karl: Problem der Generation. In: Eckert, C./Lindemann, H. (Hg.): Son-derabdruck aus Kölner Vierteljahresheft für Soziologie. 7. Jg. 2. H. München:1928
400
Marg, Oskar: Resilienz von Haushalten gegenüber extremen Ereignissen. Springer VS. Wiesbaden: 2016
Margalit, Avishai: The Decent Society oder übersetzt Goldblum, N: Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung. Suhrkamp Verlag. Frankfurt/M.:1996
Masanz, Klaus: Falldarstellung (von Hrn. A.) zur Betreuung eines ehemals foren-sisch-psychiatrischen Patienten. In: Kerbe. Forum für Sozialpsychiatrie. 19. Jg. (2002) Nr. 01, S. 17-18
Masanz, Klaus/Schüle, Iris: Abschlussbericht Projekt „Aktion Mensch“ Sozialho-telbetreuung und Straßensozialarbeit:2008
Masanz, Klaus: Krisenintervention bei wohnungslosen, psychisch kranken Men-schen. In: wohnungslos (2008) 50. Jg. 3. Quartal, S. 106-110
Masanz, Klaus/Baur, Jürgen: Vortrag Fachtagung des CBP e.V. mit dem Thema -Die geschlossene Unterbringung im Spannungsfeld zwischen dem Recht auf Er-krankung und dem Recht auf Fürsorge-: Praxis eines geschlossenen Wohnheims, 15.-16.5.2013 in Freiburg i. B.
Masanz, Klaus/Menzler-Fröhlich, Karl-Heinz: Ideen für eine sozialpsychiatrische Praxis der Ermutigung. In: KERBE (2016) 4. Quartal, S. 14-17
Metzler, Heidrun/Wacker, Elisabeth: Behinderung. In: Otto, H. U./Thiersch, Hans (Hg.): Handbuch der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. 2. Auflage. Luchterhand. Neu-wied: 2001, S. 130 ff.
Mohr, Katrin: Vortrag „Grundeinkommen und soziale Inklusion“ auf Konferenz „Grundeinkommen- in Freiheit tätig sein“ in Wien: vom 7.-9.10.2005
Munsch, Chantal: Adressatinnenorientierung als verlässliche und ganzheitliche Un-terstützung in schwierigen Lebenslagen. In: Peters, Friedhelm/Koch, Josef (Hg.): Integrierte erzieherische Hilfen. Juventa. Weinheim: 2004, S. 219-246
Müller, Burckhart: Sozialpädagogisches�Können. 7. Aufl. Lambertus Verlag. Frei-burg i. B.: 2012�
Müller-Isberner, Rüdiger (2004): Therapie im psychiatrischen MRV (§ 63 StGB). In: Venzlaff, Ulrich/ Foerster, Klaus (Hg). Psychiatrische Begutachtung. 4.Aufl. Urban & Fischer. München: 2004, S. 417-435
Nagel, Ulrich/Dietz Gerhard-Uhland: Statuspassagen. In: Otto, Hans-Uwe/Thiersch, Hans (Hg.): Handbuch Sozialarbeit- Sozialpädagogik. 2. Auflage. Luchterhand. Neuwied und Kriftel: 2001, S. 1828
Neckel, Sighard/Dröge, Kai : Die Verdienste und ihr Preis: Leistung in der Markt-gesellschaft. In: Honneth, A.: Befreiung aus der Mündigkeit. Paradoxien des ge-genwärtigen Kapitalismus. Campus. Frankfurt/ M.: 2002, S. 94
Nedopil, Norbert: Prognosen in der forensischen Psychiatrie. Ein Handbuch für die Praxis. 3. Aufl. Papst Science Publishers. Lengerich: 2006, S. 147
401
Nedopil, Norbert: Vortrag: Prognosen in der Forensischen Psychiatrie. am 17.11.2012 am 3. Tag der Tagung „Rechtspsychologie“ in Bonn
Neun, H./Dümpelmann, M. (1989): Depersonalisation. In: Hirsch, M.: Der eigene Körper als Objekt. Zur Psychodynamik selbstdestruktiven Körperagierens. Sprin-ger. Heidelberg: 1989, S. 33-76
Ninck-Gbeassor, Dorothee/ Schär Sell, Heidi/ Signer, David/ Werteli, Elena: Überlebenskunst in Übergangswelten: Ethnopsychologische Betreuung von Asyl-suchenden. Reimer. Berlin: 1999, S. 21
Nouvertné, Klaus/Wessel, Theo/Zechert, Christian (Hg.): Neue Perspektiven. Ob-dachlos und psychisch krank. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2002, S. 168-170
Obert, Klaus: Alltags- und lebensweltorientierte Ansätze als Grundlage sozialpsy-chiatrischen Handelns. 1. Aufl. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2001, S. 53-85
Obert, Klaus: Forum gegenseitigen Lernens, In: Kerbe (2006), 3/2006, S. 35-36
Obert, Klaus: Referat am 11.10.2007 der LAG Freie Wohlfahrtspflege NRW: Chan-cen und Risiken der Umsteuerung
Obert, Klaus: Alltags- und lebensweltorientiertes Handeln. In: Grunwald, Klaus/Thiersch, Hans (Hg.): Praxis lebensweltorientierter sozialer Fragen. 2. Auf-lage. Juventa-Verlag. Weinheim und München: 2008, S. 305-316
Oelerich, G./Schaarschuch, Andreas: Der Nutzen Sozialer Arbeit. In: Schaar-schuch, Andreas: Soziale Dienstleistungen aus Nutzersicht. Zum Gebrauchswert Sozialer Arbeit. Reinhardt Verlag. München: 2005, S. 9-23
Ohno, Taiichi: Das Toyota Produktionssystem. Campus. Frankfurt/M.:1993
Peukert, Reinhard: Soziokulturelle Aspekte. Sozioökonomischer Status und psychi-sche Erkrankung. MAPS HS RheinMain/HS Fulda. GP1: 2007
Peukert, Reinhard: MAPS - GP1 - Geschichte der Psychiatrie - Die 2. Reformphase (Gemeindepsychiatrie) www.ibrp-online.de. Download vom 25.10.2016
Peukert, Reinhard: Skript für MAPS GP 1. Grundlagen. Sozioökonomischer Status: Soziostrukturelle Aspekte. Sozioökonomischer Status und psychische Erkran-kung. Wiesbaden: 2008
Perreng, Martina: Schutz vor Benachteiligungen aufgrund von Vorurteilen. Allge-meines Gleichbehandlungsgesetz tritt endlich in Kraft. In: Soziale Sicherheit. Zeit-schrift für Arbeit und Soziales. (2006) 1. Jg., H.8/9, S. 296-303
Plessner, Henning: Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalis-mus. Suhrkamp. Frankfurt/M.: 2002
Plössl, Irmgard/Hammer, Matthias: ZERA-Zusammenhang zwischen Erkrankung und Rehabilitation und Arbeit. 6. überarb. Aufl. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2013
402
Bourdieu, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht.VSA-Verlag. Ham-burg:1997
Priebe, Stefan et al.: Reinstitutionalisation in mental health care: comparison of data on service provision from six European countries. BMJ (2005) 330 (87483), S. 123-126
Rauschenbach, Brigitte: Erbschaft aus Vergessenheit. In: Dies. (Hg): Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. Zur Psychoanalyse deutscher Wenden. Böhlau Ver-lag. Berlin: 1992, S. 26-55
Rätz, Regina/Völter, Bettina (2015): Wörterbuch Rekonstruktive Soziale Arbeit, Barbara Budrich. Opladen: 2015, S. 253-269
Reker, Thomas: Wohnungslosigkeit, psychischer und psychiatrischer Versorgungs-bedarf, In: Deutsches Ärzteblatt (1997) 94 Heft 21, S. 1439-1441
Riemann, Gerhard: Das Fremdwerden der eigenen Biographie. Wilhelm Fink Ver-lag. München: 1987, S. 381ff.
Rosa, Hartmut: Resonanz. Suhrkamp. Berlin. 2016
Rosa, Hartmut: Rasender Stillstand. Die beschleunigte Gesellschaft: Hörbeitrag in SWR 2 Aula am 9.3.2014
Rosenthal, Gabriele: Die erzählte Lebensgeschichte als historisch-soziale Realität. Methodologische Implikationen für die Analyse biographischer Texte. In: Berliner Geschichtswerkstatt: Alltagsstruktur, Subjektivität und Geschichte. Westfälisches Dampfboot. Münster: 1994; S.135-138. Download am 14.5.2013
Rosenthal, Gabriele: Leben mit der soldatischen Vergangenheit in zwei Weltkrie-gen. Ein Mann blendet seine Kriegserlebnisse aus. In: Bios 1 (1988) 2, S. 162
Rosenthal, Gabriele: Wie erzählen Menschen ihre Lebensgeschichte? Forschungs-bericht des Lehrprojekts Biographie. Fakultät für Soziologie: Uni Bielefeld: 1989
Rosenthal, Gabriele (1993): Erzählbarkeit, biographische Notwendigkeit und sozi-ale Funktion von Kriegserzählungen zur Frage: Was wird gerne und leicht erzählt. In: Hartewig, Karin (Hg.): Der lange Schatten. Widerspruchsvolle Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit aus der Mitte Europas. Bios, München: 1993, Sonderheft, S. 5-24
Rosenthal, Gabriele et al.: Der Holocaust im Leben von drei Generationen. Arbeits-bericht für die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Unv. MA Kassel. Berlin. Tel- Aviv: 1994
Rosenthal, Gabriele: Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. (u.a.) Campus Verlag. Frankfurt/M.: 1995
403
Rosenthal, Gabriele: Die Biographie im Kontext der Familien und Gesellschaftsge-schichte. In: Völter, Bettina/Dausien, Bettina/Lutz, Helma/ Rosenthal, Gabriele (Hg.): Biographieforschung im Diskurs. 2. Auflage. VS-Verlag. Wiesbaden: 2009, S. 51
Rosenthal, Gabriele/Stephan, Viola: Gegenwärtige Probleme der Zugehörigkeit und ihre historische Bedingtheit. In: Rosenthal, Gabriele/Stephan, Viola/ Raden-bach, N.: Brüchige Zugehörigkeit. Wie sich Familien von Russlanddeutschen ihre Geschichte erzählen von. Campus Verlag. Frankfurt/M.: 2011, S. 16-17
Ruf, Petra: Teilhabeplanung als gemeindepsychiatrischen Kernprozess. In: Gromann. Petra (Hg.): Mit professioneller Hilfeplanung zu einer individuellen am-bulanten Versorgung. Fuldaer Schriften zur Gemeindepsychiatrie. Band 2, Psychi-atrie Verlag. Bonn: 2012, S. 15ff.
Sack, Fritz: Der interaktionstheoretische Ansatz. In: Bolte, K M (Hg.); DGS. Mate-rialien aus der soziologischen Forschung. Verhandlungen des 18. Deutschen Sozi-ologentages vom 28.9.-1.10.1976 in Bielefeld. Luchterhand. Darmstadt: 1976, S. 676-682
Sadowski, Harald : Die Ich - Funktionen und die Funktion des Suchtmittels. In: Psy-chose und Sucht. Sadowski, Harald/Niestrat, Frieder (Hg.). Psychiatrie-Verlag. Bonn: 2010, S. 62-71
Schaarschuch, Andreas/Flösser, Gaby, Otto, Hans-Ulrich: (2001): Dienstleis-tung. In: Otto, Hans-Ulrich/ Thiersch, Hans (Hg): Handbuch der Sozialarbeit/So-zialpädagogik. Aufl. Neuwied. Luchterhand: 2001, S. 272
Schanda, Hans: Problem bei der Versorgung psychisch kranker Rechtsbrecher - Ein Problem der Allgemeinpsychiatrie. In: Psychiatrische Praxis (2000) Nr. 27, S. 73
Schmid, Marc: Psychische Gesundheit von Heimkindern. Juventa Verlag. Wein-heim und München: 2007, S. 17
Schmidt-Semisch, Henning: Risiko. In: Bröckling, Ulrich/Krasmann, Susanne/Lemke, Thomas. (Hg.): Glossar der Gegenwart. Suhrkamp. Frankfurt a.M.: 2004, S. 222
Schmitt-Rodermund, Eva: Zur Geschichte der Deutschen in den Ländern des ehe-maligen Ostblocks. In: Silbereisen, Rainer/Lantermann, Ernst-Dietrich/ Schmitt-Rodermund, Eva (Hg.): Aussiedler in Deutschland. Verlag. Opladen: 1999, S. 55 ff.
Schulze Steinmann, Lisa: Junge psychisch Kranke - die „new chronics“ der Sozial-psychiatrie? In: Schulze Steinmann, Lisa et al.: Die Zukunft sozialpsychiatrisch- er Heime. Bonn: 2003, S. 8ff.
Schütze, Fritz: Zur Hervorlockung und Analyse von Erzählungen thematisch rele-vanter Geschichten im Rahmen soziologischer Feldforschung. In: Arbeitskreis Bielefelder Soziologen (Hg.) Kommunikative Sozialforschung. Fink. München: 1976, S. 224 ff.
404
Schütze, Fritz (1983): Prozessstrukturen des Lebenslaufs. In: Matthes, Joachim/ Pfeifenberger, Arno/ Stosberger, Manfred (Hg.): Biographe in handlungswissen-schaftlicher Perspektive. Nürnberg: 1983, S. 67-156
Schütze, Fritz: Biographieforschung und narrative Interviews. In: Neue Praxis (1983) 13. Jg. Heft 3, S. 283-293
Schütze, Fritz: Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens. In: Kohli, M./Robert, G. (Hg.): Methoden der Biographie- und Lebenslaufforschung. Suhrkamp. Frankfurt/a.M.: 1984, S. 97ff.
Schütze, Fritz: Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien. 1. Studienbrief der Fern-Universität Hagen: 1987, S. 211
Schütz, Alfred (1971): Einige Grundbegriffe der Phänomenologie. In: Gesammelte Aufsätze. Band 1. den Haag. Nijoff.
Seifert, Dieter/Leygraf, Norbert: Die Entwicklung des psychiatrischen Maßregel-vollzugs in Nordrhein-Westfalen. In: Psychiatrische Praxis (1997) 24, S. 237-244
Siegler, Beate Finis: Ökonomik sozialer Arbeit. Lambertus. Freiburg i.B.:2009, S. 11
Sprondel, Walter M.: Experte und Laie zur Entwicklung von Typenbegriffen in der Wissenssoziologie. In: Sprondel, Walter M./Grathoff, Richard (Hg.) Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften. Stuttgart: 1979, S. 140- ff.
Spangler, Gottfried/Zimmermann, Peter (Hg.): Die Bindungstheorie. Grundlagen-forschung und Anwendung. Klett-Cotta. Stuttgart: 1995
von Spiegel, Hiltrud: Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. 4. Auflage. Reinhard. München/ Basel: 2011, S. 26-27
Staub-Bernasconi, Silvia: Soziale Arbeit und soziale Probleme. In: Thole, Werner (Hg.): Grundriss Sozialer Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Leske und Budrich. Opladen: 2002, S. 245-258
Staub-Bernasconi, Silvia: Theoriebildung in der Sozialarbeit. Stand und Zukunfts-perspektiven einer handlungswissenschaftlichen Disziplin. Ein Plädoyer für einen integrierten Pluralismus. In: Schweizer Zeitung für Soziale Arbeit (2006), Heft 1., S. 10-36
Steele, Howard/ Steele, Miriam/Fonagy, Peter.: Infants sensitivity to manipula-tions of material touch during face to face interactions. In: Social Development (1996) 5, S. 41-55
Stierlin, Helm: Eltern und Kinder. Das Drama von Trennung und Versöhnung im Jugendalter. Suhrkamp. Ort: 1980
Strauss, Anselm.: Spiegel und Masken. Die Suche nach der Identität. Suhrkamp. Frankfurt/M.: 1968, S. 115
405
Sluzki, Carlos E.: Psychologische Phasen der Migration und ihre Auswirkungen. In: Hegemann, Thomas/ Salman, Ramazan (Hg.): Handbuch Transkulturelle Psychi-atrie. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2010, S. 108-123
Szasz, Thomas: Geisteskrankheit - ein moderner Mythos. Grundlagen einer Theorie des persönlichen Verhaltens. Carl Auer Verlag. Heidelberg: 2013, S. 182
von Thadden, Elisabeth (2014): Bin das wirklich ich? In: ZEIT. 34 vom 14.08.2014, S. 29
Thiersch, Hans & Grunwald, Klaus (Hg.): Praxis lebensweltorientierter Sozialer Arbeit. 2. Aufl. Juventa Verlag. Weinheim und München: 2008, S. 13.
Thiersch, Hans: Verstehen oder Kolonialisieren. Verstehen als Widerstand. In: Mül-ler, Siegfried/Otto, Hans-Ulrich (Hg.): Grundprobleme sozialpädagogischen Han-delns und Forschens. 2. Auf. Bielefeld: 1986, S. 122-123
Thiersch, Hans (Hg.)/Grunwald, Klaus (2008): Praxis lebensweltorientierte Sozi-ale Arbeit. 2. Aufl. Juventa Verlag. Weinheim und München: 2008, S. 32-35
Thiersch, Hans: Im Interview vom 5.5.2014 (Frage 1/ 10) zum Thema Lebenswelt-orientierter Ansatz in der Sozialen Arbeit durch Hanspeter Utz an der Hochschule für Soziale Arbeit. Wallis/Schweiz. Lehrvideo auf youtube.de
Trabert, Gerhard: Sozialmedizinische Forschung zum Thema: Wohnungslosigkeit und Gesundheit. In: wohnungslos. Aktuelles aus Theorie und Praxis zur Armut und Wohnungslosigkeit (2002) 1/02, Bielefeld, S. 15-18
Bettina, Völter: Rekonstruktive Soziale Arbeit - Ein Konzept zur Entwicklung von Forschung, beruflicher Praxis und professioneller Selbstreflexion, In: Regina, Rätz/Bettina, Völter:Wörterbuch Rekonstruktive Soziale Arbeit. Barbara Budrich. Opladen: 2015, S. 253-269
Volkan, Varnik. D.: Das Versagen der Diplomatie. Zur Psychoanalyse nationaler, ethnischer und religiöser Konflikte. Psychosozialer Verlag. Gießen: 1999, S. 90
Voswinkel, Thomas: Bewunderung ohne Würdigung? Paradoxien der Anerkennung doppelt subjektivierter Arbeit. In: Honneth, Axel (Hg.): Befreiung aus der Mün-digkeit. Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus. Campus. Frankfurt/ M.: 2002, S. 65
Weinmann, Stefan/Becker, Thomas et al.: Akutbehandlungen im häuslichen Um-feld. Systematische Übersicht und Implementierungsstand in Deutschland. In: Psychiatrische Praxis (2011), 38, S. 114-122
Wessel, Theo/Westerman, Heiko (2002): Problematischer Alkoholkonsum. Entste-hungsdynamik und Ansätze für ein psychoedukatives Schulungsprogramm. Lam-bertus Verlag. Freiburg i. B.: 2002, S. 51-70�
Wulff, Ernst: Der sozialpsychiatrische Krankheitsbegriff. In: Pfäfflin, Friedemann et al. (Hg.): Der Mensch in der Psychiatrie. Springer. Berlin und Heidelberg: 1988, S. 33
406
Wunder, Michael (2011): Fürsorglicher Zwang - eine ethische Herausforderung in der diakonischen Praxis. Verlag. Ort: 2011, S. 3
Wunder, Michael: Inklusion-Eine Frage der Kultur. In: Wittig-Koppe, Holger (Hg.): Teilhabe in Zeiten verschärfter Ausgrenzung. Paranus Verlag. Neumünster: 2010; S.: 22ff.
Wuensch, S.: Hasch macht lasch, aber alles kann gut werden oder Gefühle, die ver-nichten, suchen Opiate, die es richten. In: Sadowski, Harald/Niestrat, Frieder (Hg): Psychose und Sucht. Psychiatrie Verlag. Bonn: 2010, S. 184-195
Schaubilderverzeichnis
Schaubild 1: Bedürfnishierarchie als handlungsleitender Umgang mit der Gruppe der TSSP (S. 64)
Schaubild 2: Grundhaltungen und methodischer Handlungsansatz im Umgang mit der Gruppe der TSSP (S. 66)
Schaubild 3: Dimensionen von Nutzen personenbezogener Dienstleistungen am Beispiel der Gruppe der TSSP in geschlossenen Einrichtungen (S. 107) Schaubild 4.: Versorgungsziele in der Betreuung und Begleitung von chronisch psychisch kranken Menschen nach Nouvertné (S. 110)
Schaubild 5: Maßregelvollzug in Baden-Württemberg: Suchtkranke Patienten nach § 64 StGB und psychisch kranke Patienten nach § 63 StGB jeweils zum Stichtag 31.12. der Jahre 2000 - 2012 (S. 120)
Schaubild 6: Geschlossene Heimplätze im GPV Stuttgart von 2002-2018 (S. 306)
Schaubild 7: Graphische Darstellung zur Entwicklung der Plätze nach § 1906 BGB von 2002-15` (S. 306)
Schaubild 8: Strukturen, Angebote und Aufgaben am Beispiel des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Stuttgart (S. 354)
Schaubild 9: Strukturen des GPV Stuttgart (S. 356)
Schaubild 10: Gremienstrukturen des GPV Stuttgart (S. 357)
Schaubild 11: Chronologische Einrichtungs-Matrix der 4 Falldarstellungen (S. 371-372)
Schaubild 12: Merkmale und Kategorien der vier Biographen (S. 380-381)
Schaubild 13: Spezifische Merkmale zur Struktur der Familie und der Identität (S. 382)
Schaubild 14: Biographische Verläufe der vier Biographen auf einer Zeit- und einer Lebensereignisachse (S. 383)
407
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Untergebrachte in Deutschland im Maßregelvollzug, Strafgefangene, Patienten der All-gemeinpsychiatrie. Bis 1990: Alte Bundesländer einschließlich Berlin-West. Ab 1995: Deutsch-land. In: Konrad, N. (2014): Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Wiesbaden. S.: 22 (S. 118)
Tabelle 2: Biographische Merkmale des Samplings (S. 174)
Tabelle 3: Biographische Daten zur Falldarstellung Nr. 1 (S. 178-179)
Tabelle 4: Biographische Daten zur Falldarstellung Nr. 2 (S. 220-221)
Tabelle 5: Biographische Daten zur Falldarstellung Nr. 3. (S. 251-253)
Tabelle 6: Biographische Daten zur Falldarstellung Nr. 4. (S. 282-283)
Tabelle 7: Anzahl der Bewohnerinnen im Erhebungszeitraum vom 01.01. 2005- 01.07.2013 in drei Einrichtungen nach § 1906 im GPV Stuttgart (S. 308)
Tabelle 8: Alter, Verteilung und Altersgruppen (S. 312)
Tabelle 9: Geschlecht, Geschlechterverteilung (S. 315)
Tabelle 10: Familienstand (S. 317)
Tabelle 11: Wohnverhältnisse z.Z. der Aufnahme (S. 320)
Tabelle 12: Schulische Qualifikation und Bildungsabschluss (S. 323)
Tabelle 13: Berufliches Ausbildungsniveau (S. 325)
Tabelle 14: Migration (S. 327)
Tabelle 15: Kontakte mit Kinder- und Jugendhilfe (S. 331)
Tabelle 16: Erfahrungen mit dem Feld der Wohnungsnotfallhilfe (S. 333)
Tabelle 17: Erfahrungen mit der Gemeindepsychiatrie (S. 335)
Tabelle 18: Maßregelvollzug/ Strafvollzug in der Vorgeschichte (S. 339)
Tabelle 19: Suchterkrankungen in der Vorgeschichte (S. 341)
Tabelle 20: Diagnosen nach ICD 10 (S. 344)
Tabelle 20.1: Comorbidität (mit Mehrfachnennung) (S. 344)
Tabelle 21: Entlassungen und Nachsorge (S. 346)
Tabelle 22: Aufenthaltsdauer in einer geschlossenen Einrichtung (S. 350)
Tabelle 23: Anteil der Personen mit Abhängigkeitserkrankung bei einer Stichprobe von n=87 in einem Sozialhotel (S. 361)
Tabelle 24: Anteil der psychisch kranken bei der Stichprobe (n=87) in einem Sozialhotel in Stuttgart (S. 362)
Tabelle 25: Anteil der Personen mit psychischen Erkrankungen an der Stichprobe z.Z. der Aufnahme (S. 362)
408
Tabelle 26: Anteil der psychisch kranken Personen, die sich in (fach)- ärztliche Behandlung begeben zum Stichtag (Aufnahmetag) in einem Sozialhotel (S. 363)
Tabelle 27: Anteil der Komorbidität der Stichprobe der wohungslos, psychisch kranken und suchtranken Personen in einem Sozialhotel (S. 364)
Abkürzungen
AK: Arbeitskreis ANS: autonomes Nervensystem ASD: Allgemeiner Sozialdienst B.: Biograph BAG: Bundesarbeitsgemeinschaft BGB: Bürgerliches Gesetzbuch BHD: BruderhausDiakonie BRK: Behindertenrechtskonvention BRK: Behindertenrechtskonvention BRD: Bundesrepublik Deutschland BtMG: Betäubungsmittelgesetz BtMG: Betäubungsmittelgesetz DDR: Deutsche Demokratische Republik EU-, BU-Rente: Erwerbs-Berufsunfähigkeitsrente Eva: Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. FPA: Forensisch-Psychiatrische Institutsambulanz GG: Grundgesetz GPV: Gemeindepsychiatrischer Verbund GPZ: Gemeindepsychiatrisches Zentrum HB Bogen: ärztlicher Hilfebedarfsbogen nach HEIDURUN METZLER HPK: Hilfeplankonferenz IBRP: Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan ICD 10 GM: International Classifikations of Desease, German Modifikation ITP: Integrierter Teilhabeplan JVA: Justizvollzugsanstalt KM: Kilometer KZ: Konzentrationslager LG: Landgericht M: Meter MR: Mittlere Reife MRV: Maßregelvollzug NS: Natonalsozialismus ofW: ohne festen Wohnsitz PEG: Pflegeergänzungsleistungen PIA: Psychiatrische Institutsambulanz Psych KG: Psychisch Krankengesetz zur Prüfung der Unterbringung bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung PNG: Pflegeneuausrichtungsgesetz RPK: Rehabilitation für psychisch Kranke RRSS: Rudolf Sophien Stift SED: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands SGB: Sozialgesetzbuch SpDI: Sozialpsychiatrischer Dienst StGB: Strafgesetzbuch THC: (Cannabis) Tetrahydrocannabol UN: United Nations u.U.: unter Umständen VK: Vollkostenstelle ZfP: Zentrum für Psychiatrie
409
Transkriptionszeichen
. kurzes Absetzen
(5) Pause, in vollen Sekunden
nei:n Dehnung
((lachend)) Kommentar zur Transkription
Nein betont
NEIN laut
NEIN sehr laut
manch- Abbruch
`eher nicht` leise
( ) undeutlichen Passage, Länge der Klammer entspricht etwa Dauer der Äußerung
//hmm// Rezeptionssignal
Ja das war#das Ende# gleichzeitiges Sprechen ab „das“ #wie war#
(….) Auslassungen
Klaus Masanz
»Und ich steh immer draußen, vor der Türe!« Exklusionsprozesse und biographische Strukturierung von jungen, psychisch kranken, suchtkranken und wohnungslosen Menschen
Biographie – Interaktion – Gesellschaft 14
kasseluniversity
press
Die Arbeit setzt sich auf der Basis einer sowohl teilstandardisierten quali-tativen, als auch biographisch-narrativen Untersuchung, mit dem Verste-hen und Herausfordern für eine Gruppe auseinander, die in der Arbeit als Transsektorale-Systemprüfende definiert wird. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe mit multiplen Exklusionserfahrungen, die sowohl durch komplexe biographische Beeinträchtigungen als auch durch signifi-kante institutionelle Erfahrungen geprägt und charakterisiert wird. Die Felder Sozialer Arbeit, die sich im Zuge ihrer Funktionen und der darin verorteten Aufgabenstellungen der Inklusionsvermittlung, der Exklusions-verwaltung und Exklusionsvermeidung im Besonderen um diese Klientel engagieren und bemühen, erfahren durch sie gerade in der professio-nellen Selbstreflexion und Identität, wie auch in der Grundhaltung, eine Herausforderung. Durch diese Gruppe werden strukturelle Barrieren und erschwerende Zugänge entlarvt, durch sie werden qualitative Mängel und Schwachstellen unter und zwischen den unterschiedlichen Versor-gungssystemen evident. Aus diesen Erkenntnissen werden, im Sinne von »best-practice«, 25 qualitätssichernde Handlungsstandards und Ergeb-nisparameter entwickelt, die innerhalb einer Versorgungsregion fortlau-fend zu prüfen, zu bewerten und gegebenenfalls zu etablieren sind.
Kla
us
Ma
san
z„U
nd
ich
ste
h im
me
r d
rau
ßen
, vo
r d
er
Türe
!“
14
9 783737 602709
ISBN 978-3-7376-0270-9