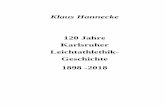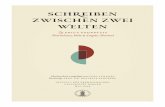Gesten und simulierte Form: Zu Klaus Ospalds Klavierquartett (1994) und el sol no nos recuerde für...
-
Upload
uni-wuerzburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Gesten und simulierte Form: Zu Klaus Ospalds Klavierquartett (1994) und el sol no nos recuerde für...
Oliver Wiener
Gesten und simulierte
Form
Zu Klaus Ospalds
«Klavierquartett» (1994)
und
«el sol no nos recuerde»
für zwei Gitarren (1996)
Beiträge, Meinungen
und Analysen
zur neuen Musik
frBgmen Beiträge. Meinungen und Analysen zur neuen Musik
'lerausgegeben von Stefan Fricke
Heft 24
..... OIIr. 3esloll on1 _..", Fonn : zu Klaus Ospalds "KKavierquartett' (1994) .nl.el sa1 no nos ,..,._. ü zwei Gianen (1996) I orwer Wiener.SaDidBI Pa. 19911 IFfl9lllll : H :!4)
IS8N :Hli727-0t1-2
ISSN 0949-5282
ISBN 3-89727-041-2
C 1998 by PFAU-Vertag, Saarbrücken C der Notenbeispiele: Breitkopf & Härtel, Wiesbaden Alle Rechte vorbehalten. Zur Förderung des wissenschaftlichen Diskurses nennt der Verlag auf Anfrage die Adresse des Autors.
Umschlaggestaltung: Hans Husel Gesamtherstellung: Nauwieser Copier & Offset GmbH, Saarbrücken Printed in Germany
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder über den Verlag.
PFAU-Vertag. Postfach 102314, D 66023 Saarbrücken
Burleske, Tempus vorax
en face lepire jusqu'il ce qu'il fasse rire
Samuel Beckett, Mirlitonnades
des Abgrunds.
es reicht zu sagen: Abgrund und Satire
Jacques Derrida, Die Wahrheit in der Malerei
Wer Francisco de Goyas Saturn (1819-23)111 betrachtet, steht auf der Kippe zwischen Erschrecken und Lachen. Dieses Mischgefühl, das wie eine Art ätzender Substanz den Abgrund zwischen zwei gegensätzlichen Gefühlen eher vertieft, statt sie zu binden, ist jenem effektiven Erschrecken entgegengesetzt, das ein Gefühl existentieller Sicherheit einleitet, wenn einem die Sprache einer Vernunft (oder eines Glaubens) zu einer Abschätzung der eigenen Position vor dem Abschreckenden verholfen hat. Wäre man sich seiner Position vor dem Erschreckenden sicher, bestünde die Möglichkeit, es zum ästhetischen Reiz zu maskieren, eine Haltung, auf der sich allemal eine Analytik des Erhabenen aufbauen läßt.121 Goyas Saturn gibt jedoch keinen Ansatzpunkt, von dem aus eine Distanz aufzubauen wäre, man ist .im Bild", wird in es hineingezogen, das Bild ist unauratisch. Es ist kein Naturereignis dargestellt, abgebildet oder nachgeahmt, zu dem man in kontemplative Distanz treten könnte, die Szene ist in der entsetzlichen Bewegung gebannt, in der Satum das letzte seiner Kinder zerreißt und frißt. Man blickt in keinen Raum, wird als Betrachter in keine Perspektive einbezogen, es existiert keine Perspektive, kein Haus, kein .oikos", keine Innenwelt, mithin auch keine Außenwelt, nur dunkle Fläche, Oberfläche ohne Grenze, kein Boden, Nichts. Das Bild ist im eigentlichen Sinne des Wortes absurd.131 Einziges .Subjekt" ist die Bewegung des Verschlingens, tempus vorax, von Wahnsinn gezwungen, die eigene Existenzgrundlage aufbrauchend und vernichtend.141 Es bliebe die Möglichkeit, über Darstellungsmodi zu lachen, etwa über die maskenhafte Verzerrung von Saturns Gesicht. Sieht man aber, daß die Augen im Gesicht des Wahnsinnigen die Schwärze des Hintergrunds verdoppeln, daß einen durch Saturns Augen dieses schwarze Nichts der Bildoberfläche anschaut, in das die Bewegung eingebettet ist, hält sich das Vergnügen über groteske Momente in Grenzen, und der kurze Fluchtweg eines beschönigenden Humors entpuppt sich als Sackgasse. Vielleicht besteht der einzige Beitrag einer Vernunft nur im unerklärlichen Licht, jenem spotlight, das die Szene sichtbar macht: Licht, das den zerrissenen Körper des Kindes makaber beleuchtet; Licht, das schwach auf Haut und Haaren von Saturn liegenbleibt; Licht, das in den aufgerissenen Augen reflektiert wird. Licht ermöglicht als Versinnbildlichung, als Kunstgriff und Jargon der Vernunft die kurze Schau des Wahnsinnigen. Zwischen dem erschrockenen Betrachter und dem Wahnsinnigen entsteht das Gegenteil rettender Distanz und der unangenehmen schlaglichtartigen Nähe. Man könnte diese kurze Beleuchtung als jene Geste auffassen, die Wahnsinn vom "Nicht-Wahnsinn" separiert, die Geste, die jene Zäsur zum Ausdruck bringt, .die die Distanz zwischen Vernunft und Nicht-Vernunft herstellt".151 Diese
3
hergestellte Distanz nennt Michel Foucault .Leere", den nicht mehr aufgenommenen Dialog, der in manchem an das Schweigen erinnert, in dessen "unmöglichem Raum" Antonin Artaud das unheimliche Pendel der NeNenwaage schwingen läßt.(s) Das Eindringen von "Wahnsinn" in Kunst (wie es auch immer beschaffen sein mag) hat einen Anteil an diesem nicht stattfindenden Dialog zwischen Wahnsinn und Gesellschaft. Dort, wo das Kunstwerk keine heteronomen moralischen Codes ansetzt, um den Wahnsinnigen als Gespött zu diffamieren, bleibt im Verhältnis zwischen Phänomen und .Darstellung" ein unauflösbarer Rest, der jenem ambivalenten Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Vernunft und einer von ihr codifizierten Nicht-Vernunft ähnelt. Da die dünne Schicht zum Irrationalen stets zu brechen droht, ist auch das .Werk", das immer wieder als Produkt autonomer oder heteronomerratioapostrophiert wurde, gefährdet oder wird negiert.
Ich möchte hier aber nicht auf eine werknegierende Konzeption von Kunst zu sprechen kommen (allerdings auch nicht auf eine vom Dienst am Werk vereinnahmte, mimetische Variante des Wahnsinns). Es geht um den Kulminationspunkt einer Vorstellung von "verkehrter Weit", dem Eindringen des "Anderen", das mit dem Gestus der Burleske vielleicht noch zu bewältigen ist. Sprachlich ist dieses Andere, von dem etwa Artauds Theater seine Grausamkeit bezieht, noch faßbar in verbalen Leerstellen, die das Grausame markieren. Wir reden beispielsweise vom Menschenfresser. Die Komplementarität der Vorstellungen eines grauenvollen Anderen mit der Raison einer Gesellschaft, der man sich in ihr lebend nicht entziehen kann, findet die Kurzformel in jener Gedichtzeile von Konrad Bayer, die Klaus Ospald im 111. Satz seines Klavierquartetts (1994)m - Burleske überschrieben - als glossierenden Kommentar beigefügt hat: - "der fresser mensch, auch menschenfresser".(a) Daß die Zeile aus dem Gedicht Bayers in der Partitur steht, wenn auch in eckigen Klammem- als Kommentar, dereinen unmittelbaren Bezug infragestellt -, gibt Anlaß, über das Verhältnis dieser Zeile zur Musik zu spekulieren. Es liegt auf der Hand, daß es zu einer .Darstellung" des Menschenfressers mit musikalischen .Mitteln" nicht kommt. Musik kann hier kein Medium sein. Wie auch sollte Musik, die Instrumenten zugedacht ist und durch diese zum Klingen gebracht wird, die eine lange soziokulturelle Tradition mit sich schleppen, einen Menschenfresser simulieren? Es wäre entweder unmöglich oder albern. Wenngleich Spuren eines mimetischen Gestus'(9) sich finden ließen- etwa in den Spielanweisungen: "derb" (111.7), .wüsr (111.31) oder .feroce assai" (IV.55)(10l -,so liegt doch die Qualität der Musik, die da erklingt, nicht in ihrer potentiellen Bildlichkeil begründet, sondern in einer suggestiven innermusikalischen Prozessualität, z.B. dem Prozeß der Tempogestaltung, der auf abstrakter Ebene eine Brücke zum Schrecken schlägt, der von der Vorstellung des Menschenfressers ausgeht. Die Anmutung, der Menschenfresser hätte .unmittelbar" etwas mit dem rohen Gestus der Musik zu tun, wäre auch insofern prekär, als der Verlauf der drei Mittelsätze einer zunehmenden Temposteigerung bis zum Presto des IV. Satzes (der .in fliegender Hast" endet [IV.57]), zugleich den Charakter des sich Überhetzenden trägt: Die Musik ist nicht in der Lage, den Gestus des "Täters" (Menschenfresser) zu trennen von dem des .Opfers" (dessen, der gehetzt wird). Wenn überhaupt in den drei Mittelsätzen etwas .dargestellt" wird, dann ist es verschlingende Zeit, deren Bewegung der des Gayaschen Satum ähnelt: ein rasender Chronos. Eine permanent sich steigernde Bewegung dieser Art endet nicht (bzw. endet für uns nur dort, wo wir sie nicht mehr als Bewegung wahrnehmen
4
können). Dementsprechend zielt der Tempoprozeß der drei Sätze auch nicht auf einen Schlußpunkt, sondern mündet in ein fade-out des IV. Satzes (IV.57-86: .,al niente''), ein Verschwinden, mit dem eine Zusammenziehung des Tonraums in einen engen, clusterartigen Bereich innerhalb der Kleinterz ais1-cis2 (IV.84-86, Cello) korreliert. Ospald zieht hier einen verbindenden Faden zum Beginn des I. Satzes , dem Ausgangspunkt des Werkes. Hier gerinnt das rasende, .Nicht zu Nichts bringendeu(11 ) Tempogeschehen der Mittelsätze zur Kurzform eines Schreis, der im .Nichts" einer Pause verhallt (vgl. Abbildung 1 ). Wiederum ein über dem Pausentakt notiertes Zitat Konrad Bayers bringt eine sprachlich absurde .Zeitklage", die in ihrer subtilen Kippbewegung zwischen banalem Stoßseufzer und poetisch-phonetischem Artefakt den Beginn des Werkes charakterisiert -schwankend auf dem dünnen Grat von Schmerzschrei und Parodie desselben: .. - herr je und we du liebe zeit... ~12)
Abbildung 1: Klaus Ospald, Klavierquartett, ~ 1-3
61 ~~. ~f 'l f.\ : ~jt,o4..C .... J.. .t.;~.{.J .. r '
'a.L.
31' ~te~~ !<~~ !~
Die drei mittleren Sätze des fünfsätzigen Klavierquartetts (für Klarinette, Posaune, Cello und Klavier) bilden eine pausenlos verbundene Folge, der eine einheitliche gestische Konzeption musikalischer Zeitgestaltung zugrundeliegt Vergleichbar der Geste der Bewegung in Goyas Saturn, handelt es sich um die Geste der Beschleunigung. Da der erste und fünfte Satz auf einer
5
anderen ,Gestimmtheitu(13l basieren, stellen sich die Fragen, von denen diese Abhandlung ausging: Wie kommt Bewegung und Beschleunigung zum Ausdruck, d.h. wie sind Rhythmus und Satz organisiert? Worin besteht die Eigentümlichkeit der .. Sätze", auch im Hinblick auf eine übergreifende Konzeption? Welche Arten von Konhärenz bestehen innerhalb der Sätze und zwischen ihnen?
Tempo-Prozeß
Satz 111, die Burleske, reagiert auf die Triobesetzung des II. Satzes, zu der die Posaunenstimme nur an wenigen Stellen hinzutritt. Dieser II. Satz gliedert sich in drei Abschnitte, die in der Partitur als Strophen bezeichnet sind. Bereits die Längenzunahme der Strophen weist auf eine ,abstrakte" Verwendung des Begriffs Strophe. Keine strophische Gliederung ist hier gemeint, sondern drei in einen Prozeß eingebundene Abschnitte, die- da sie in jeweils eigener Weise auf den Eintritt der Burleske vorbereiten - als formal parataktische Gebilde, als .strophisch" bezeichnet werden können.<141
Da die Posaune im II. Satz weitgehend ausgespart wird, gewinnt ihr Einsatz am Beginn der Burleske Signifikanz. Die Posaunenstimme erhält eine solistische Funktion, die unter anderem zu jenem merkwOrdigen Eindruck von .burlesker" Lächerlichkeit beiträgt, der aus der Widersprüchlichkeit zwischen zyklischer Rückbezüglichkeil und der unpassend in die Länge gezogenen Verwendung instrumentalen ,Effekts" vermeintlich unterhaltender Arrangements, dem Posaunenglissando, entsteht. Zwei Stilebenen prallen aufeinander: Einerseits stellt das vierteltönige Glissando (vgl. Abbildung 2b) einen Bezug zum ersten Takt der Komposition her, bindet also den Anfang der Burleske- ähnlich ihrem Schluß- zyklisch ins Werk ein. Andererseits desavouiert die .unterhahencle" lachende Glissandofloskel den vermeintlich hohen Anspruch des integral gestalteten Satzzyklus. Daß es sich hier selbstverständlich nicht um eine gestische Neuprägung, sondern um einen Topos neuer Musik handelt, mag man aus dem kurzen Posaunenzitat aus Edgard Vareses Ameriques (1918-22) ersehen (vgl. Abbildung 2a)'15l. Bemerkenswert ist, daß Ospald den Topos als bereits formalisiertes Moment übernimmt, wodurch die gestische Anlage eine seltsame autoreferentielle Wendung nimmt: Das lächerliche Klischee macht sich über sich lächerlich. Es stellt sich die Frage, wer hier lacht.'16l Im Gegensatz zur Vorstellung des erhabenen innerlich geschlossenen, autonomen Werkes fühlt man sich an einen Humor erinnert, der in der Definition Jean Pauls als .umgekehrt Erhabenes" zu begreifen ist.<17l
Abbildung 2a: Edgard Varese, Ameriques
6
Abbildung 2b: Klaus Ospald, Klavierquartett
<f>(l/4-Ton-Glissandi)
IIIR iP II fJ f' qf'
Gleichzeitig markiert der Einsatz der Posaune als partielles Soloinstrument der Burleske einen Umschlag der notierten Taktart, der im folgenden eine kontinuierliche Beschleunigung ermöglicht Die Grundbewegung des II. Satzes (vorwiegend Sechzehntel- und Zweiunddreißigstelwertel wird durch die .etwas bretter" vorgetragenen Achtel des dritten Satzes abgelöst
Abbildung 3: Synopse zum Tempoprozeß des mittleren Satzverbandes; Auflistung der wesentlichen rhythmischen Werte und Gruppen
li
strophe 1 strophe 2
strophe 3
J~J
BewegLmgSprofil Grund- punktuale bewegung Werte
}}) }}}} 3
})
CD T.8 rr n m = T.1! rr 1
i [hD--;~---~ml; ~- 3 T.41 Jb I IV I J ~ J ~te=mä=re=,=dBZWI=.sch==en=bi=.n=äre=E=in=he=it=en~
4:3
mn.rm Presto T.1 l T.48 n T.57
3
m ~
m 'in fiagende! Hast'
7
8
Sechzehntelwerte treten in den ersten sieben Takten zuerst nur in den rhythmisch komplementär einsetzenden Begleitstimmen auf- das Klavier pausiert. Ab 111.8 etabliert die Cellostimme eine durchgehende Sechzehntelbewegung und anschließend, zusammen mit dem wiedereinsetzenden Klavier, eine notierte Temposteigerung zu Sechzehntelquintolen (111.11-19). Innerhalb der Burleske wird mit Takt 111.20 die Quintolenbewegung als neuer Bewegungsmodus übernommen, ein nahezu unmerklicher Übergang, der einzig durch eine auffahrende Figur von Klavier, Klarinette und Cello akzentuiert wird. Der Übergang zum IV. Satz (Presto) vollzieht sich deutlicher, da sich erst im letzten Takt der Burleske die triolische Bewegung abzeichnet, die die Rhythmik des V. Satzes dominiert. Neben diesen ternären Sechzehntelgruppen treten vereinzelt binäre auf, die gegen Ende des Presto-Satzes (IV.48ff) wiederum triolisiert werden, und die .fliegende Hast" des Schlußabschnitts, basierend auf ternären Einheiten (IV.57ff), ist wohl als Übernahme dieser Triolen zu verstehen.
Abbildung 4: IV.46-48 (.in fliegender Hast")
Demnach läßt sich die Beschleunigung des Tempos innerhalb des mittleren Satzverbandes als .gerichteter" linearer Prozeß verstehen, der auf der rhythmischen Organisationsebene realisiert wird. Dies heißt jedoch nicht, daß auch alle anderen Momente des "Satzes" sich konform verhalten müßten; noch bedeutet die Tatsache, daß eine rhythmische Organisationebene als .Gegenstand" untersucht werden kann, daß sich andere Momente im Rahmen einer Deskription in gleicher Offensichtlichkeit vergegenwärtigen ließen. Freilich finden die Temposteigerungen immer an formalen Schnittstellen statt. Dies allein ist aber kein Kriterium formaler Gestaltung, denn die an der Partitur ablasbaren Einschnitte sagen wenig über die gesamte Konstitution eines Satzes und seiner .Partien" aus. Unter dem Vorbehalt, daß die begriffliche Separation von .Form und Inhalt" illusorisch bleibt, solange der Materialbegriff ungeklärt ist, kann man - nur approximativ und vorläufig - sagen, daß hier .Form" aus prozessualer Veränderung des "Inhalts" entsteht.
Zwar kann ein Komplex wie die drei Strophßn, die den II. Satz bilden, als Folge von drei Ab· schnitten beschrieben werden, die durch bestimmte Merkmale differenziert sind -womit jedoch nichts über ihren Zusammenhang ausgesagt ist, der nicht allein aus einer Analogie oder Parallelität erwächst. Vielmehr lassen sich verschiedene prozessuale Elemente ausmachen, deren terminologische Unvereinbarkeit auf den ersten Blick etwas verwirrend erscheinen mag (und ein wenig an die .chinesische Enzyklopädie" erinnert, die Jorge Luis Borges zitiert).!18l
1. Über die kompliziereren inneren rhythmischen Qualitäten der zweiten Strophe hinweg konstituiert sich in der dritten Strophe ein einheitlicher rhythmischer Typus. Es scheint hier ein Zusammenhang mit der größeren Satzdichte der dritten Strophe zu bestehen. Die weniger geordnete, .löchrige" rhythmische Oberfläche der zweiten Strophe dient quasi als .Bindeglied" zwischen erster und dritter Strophe.
2. Das am Ende der zweiten Strophe induzierte Phänomen der .Stagnation" wird in der dritten Strophe wiederaufgegriffen. Hier kommt nach einer .Stagnation" der rhythmische Fluß wieder in Gang.
3. Aus dem weitgehend .heterophon" angelegten Satz der ersten Strophe entstehen in der zweiten Strophe melodische Unien, die unisono geführt sind.
4. Die Konstitution melodischer Unien in der zweiten Strophe hat eine .Aufsplitterung" des Satzes in unisono geführte Teilstücke und .frei" geführte Stimmen zur Folge. ln der dritten Strophe wird eine von heterophonen Verknüpfungen weitgehend freie Stimmführung etabliert. Man .kann also von einem Prozeß zunehmender Emanzipation der Stimmen aus dem engen heterophonen Netz der ersten Strophe sprechen.
ad 1. Der Satz der ersten Strophe orientiert sich an einem kontinuierlichen komplementärrhythmisch resultierenden Zweiunddreißigstelfluß. Nur kleine diskontinuierliche Einschübe, triolische .Ausbeulungen", unterbrechen punktuell dieses Fließen. Gegen Ende der Strophe (11.18-20) bildet sich kurzfristig zwischen Cello und Klarinette Uniritmico-Stimmführung heraus, die vom neuen rhythmischen Erscheinungsbild der zweiten Strophe aufgefangen wird. Hier wird das gleichmäßige Fließen in Zweiunddreißigsteln zugunsten einer detaillierteren Ausprägung individueller rhythmischer Einhenen in den Stimmen aufgegeben (z. B. Quintolen und Triolen; vgl Abbildung 5). Zum Eindruck dieser individuierenden Tendenz
9
der Stimmführung trägt auch das Unisono (Klarinette und Cello; vgl. ad 3) und die mixturartige Oktavierung der Klavierstimme bei. ln der dritten Strophe bewegen sich die Stimmen weitgehend "frei", allerdings auf der Basis einer durchgehenden Zweiunddreißigstelbewegung, die in mehreren Stimmen aufrechterhalten wird und nicht primär aus Komplementarität resultiert. Dieser Prozeß wird durch Elemente des folgenden formalen Prozesses unterbrochen.
Abbildung 5: 11.20-22, Übergang von Strophe 1 zu 2
unirilrnico rhythmische 'Individuation'
ad 2. Als "stagnation" bezeichne ich ein energiegeladenes Innehalten, das erstmals am Ende der zweiten Strophe in Erscheinung tritt: Die Klavierstimme wird zurückgenommen, und ein Unisono von Klarinette und Cello dehnt sich - am dynamischen Kulminationspunkt (II und .tutta Ia forzaj- in extrem lange Dauernwerte (11.39-41). Auf die Stagnation reagiert ein schneller Einsatz der dritten Strophe. Daß diese Stagnation mit anschließender "Entladung" am Ende der zweiten Strophe in der dritten in den Verlauf integriert wird, ist ein Merkmal formaler Prozessualität: Der Übergang, der von Strophe 1 auf 2 nur schwach ausgeprägt war, und von Strophe 2 auf 3 pointiert wurde, wird endlich in die Partie (Strophe 3) selbst integriert (11.53-61 ), d.h. ein induziertes Merkmal formaler Separation wird Teil der Partie. Da im ersten Fall die "Stagnation" in einer Art Überstrapazierung der melodischen Unie (11.39-41), im zweiten Fall in einer Reduktion des Tonraumes auf eine dusterartige Ballung (11.53-60) oder aber in harmonischer Bewegungslosigkeit bei gleichmäßiger rhythmischer Strukturierung (11.61) besteht, scheint sie, sieht man von der IIDynamik ab, nicht auf einen bestimmten Parameter (Tonhöhe, Rhythmus, Artikulation) festgelegt.
ad 3. Das im Verlauf von Strophe 2 ausgebildete Unisono kann im Sinne der "Individuation" der Stimmen als Transformation der heterophonen Gebilde der ersten Strophe interpretiert werden (vgl. Abbildung 6a). Heterophone Verknüpfungspunkte zwischen den Stimmen gibt
10
es in der zweiten Strophe nur andeutungsweise, z.B. bei 11.27-28 (vgl. Abbildung 6b). Hier "umspielt" die Klavierstimme das Teilunisono von Klarinette und Cello (übereinstimmende Noten fett hervorgehoben), anschließend lösen sich beide Stimmen wieder voneinander. Diese (durch unisone Stimmführung) hervorstechenden melodischen Linien spielen in allen fünf Sätzen eine differente Rolle: Im ersten Satz tritt ein Unisono als kontrastierender eigenständiger "Charakter'' auf ("cantabile e calmo", 1.59ff).lm zweiten Satzentwickelt sich das Unisono aus der Gesamtbewegung heraus. Vor Eintritt des Presto koordiniert ein Unisono von Cello und Baßklarinette den Satz (111.33-41). Nach einer "Stagnation" des Presto-Satzes (IV.32-34) wird die Energie des ,Ausbruchs" in einem massiven Unisono der drei Melodieinstrumente gebündelt (IV.40-45). Der V. Satz greift anfangs den "calmo"· Typus des I. Satzes wieder auf (V, Beginn -ohne Taktzählung), und mündet in ein pathetisches Unisono (V.3-19: Klar., Pos., Vlc.), das auf IV.40-45 rekurriert. Da hier allerdings die den Presto-Satz charakterisierende- hastige Klavierbegleitung entfällt, erscheint das Unisono in neuer Beleuchtung.
Abbildung 6: a) Heterophoner Satz (II. 121.), b) Teilheterophonie und Unisono (11.27-29)
a klar.
b pfte.
heterophone Verknüpfung: übelienstimmende Noten
ad 4. Die zweite Strophe ist also einerseits mit der Ausbildung eines Unisono aus der Heterophonie in einen Prozeß zunehmender Individuation der Stimmen innerhalb des II. Satzes
11
eingebunden und hat andererseits an einem satzübergreifenden Charakteristikum des Werks, der unterschiedlichen "Ausleuchtung" der unisonen Satztechnik, teil. Dieses Charakteristikum läßt sich nicht uneingeschränkt als Prozeß beschreiben, da in der Verteilung dieser oder vergleichbarer Satztechniken ein assoziatives Moment prävalent wird, das als Modus der Diskontinuität den Typus einer kontinuierlichen prozessualen Anlage durchschneidet.
Exkurs: "Geste"
.. .Ia lAie le calma dlsant ce ne M que dans Ia l~le
Beckett, mirlitonnades
Wer bei der Beschreibung neuer Musik den Begriff der .Geste" verwendet, macht sich verdächtig, mit einer verbalen Floskel musikalische Floskeln künstlich aufwerten zu wollen, wird doch jede Bewegung, die irgend .unmittelbar" körperlich erscheint, verlegen als gestisch bezeichnet. Daß gestische .Unmittelbarkeit" möglich wäre, scheint illusionär. Die Verwendung des Begriffs .Geste" lehnt sich im folgenden an Viiern Flussers Essay Gesten (1991) an, in dessen Einleitung Geste definiert wird als .eine Bewegung des Körpers oder eines mit ihm verbundenen Werkzeugs für die es keine zufriedenstellende kausale Erklärung gibt".<19> Um dem Spezimen der Geste näherzukommen, muß man ihre .Bedeutung" kennenlernen-dies aber nicht auf linear-kausalem, positivistischem Wege (wie die Kommunikationsforschung etwa). Wenngleich Flussers phänomenologischer Ansatz sich lediglich auf die .Lebewelt", weniger aufs "Artefakt" erstreckt, erscheint es möglich, ihn auf auf musikalische Kompositionen zu übertragen: Die Geste verlangt einen bestimmten artifiziellen Raum (.Gestimmtheit"), um sich mit Bedeutung aufladen zu können, die innerhalb dieses Raumes gültig ist, und dieser Raum wäre im singulären werkeigenen Diskurs zu suchen: ln Ospalds Ma quell'anno Ia primavera stentava a farsi avanti (1987) für Flöte, zwei Klarinetten, Saxophon, Viola, Cello, Klavier und Schlagzeug beispielsweise tritt die Vorstellung der Unearitätin den Vordergrund, und zwar weniger eine Unearität der Stimmführung als vielmehr die der fonnalen Anlage. Von Beginn an bewegt sich die Komposition stringent zur Entropie und zum Bruch hin, dem Beginn von Satz II (Gigue. To play in the old style ... ), basierend auf einem Satz Alexander Mitscherlichs, der vom Ensemble gesprochen wird: .Es gibt kaum eine Zerstörung, die menschliche Phantasie sich ausdenken könnte, die nicht immer und immer wieder vollbracht worden wäre. Es ist das Normale.'l{2o> Kurz vor dem Umschlagspunkt gerät der Satz in die Aporie angehaHener repetitiver Muster, die sich als knappe Formeln und mehrtaktige Haltetöne zuvor bereits im dichten Satz angedeutet hatten. Diese Formeln treten nun aus ihrem vormaligen Zusammenhang, .aus dem Satz" heraus und etablieren eine aporetische Starre. ln der Folge dieses .ekstatischen" Zustands kippt das Stück in einen gestischen .Innenraum": eine unheimliche sprechende Mundhöhle, von innen betrachtet. Das Wort tritt in den musikalischen Satz ein und wird sozusagen noch in dem Moment erwischt, in dem es vor dem Aussprechen Formung erfährt . • Das Wort hat sich irgendwo im Kopf knapp vor der komplizierten Bewegung der Sprachorgane
12
geformt. Und dort also wäre die Geste des Sprechens zu suchen" (Fiusser).(211 Das letzte Drittel der Komposition verlängert, dehnt die Geste des Sprechens in einer atomisierten und strukturell musikalisierten "Sprache". Man kann dies als musikalisierte, ins Werk umgesetzte Geste des Sprechens auffassen. Eine interpretatorische Fixierung der "Gestimmtheit" gestaltet sich beim textlosen Werk bzw. einem Werk, in dem kein Text musikalisiert wird, schwieriger- hält doch der Text für den Interpreten einen vermeintlich sicheren semantischen Ausgangspunkt bereit. Im Fall der drei Mittelsätze des Klavierquartetts habe ich versucht, die steuernde Geste gleichfalls über einen Text - die Gedichtzeile "der fresser mensch, auch menschenfresser"- als rastlose Bewegung des verschlingenden Chronos zu begreifen: Der Raum, in dem die Geste - hier die Geste hastiger Bewegung - sich artikuliert, wäre im Verlauf der drei Mittelsätze wiederum "linear" zu nennen, genauer: infinit beschleunigend. Der Satzverband weist mehrere kleinstufige Umschlagspunkte auf, nicht aber das .Umkippen", das die formale Konzeption von Ma que/1' anno ... definiert.
Da der Anfangsgestus des Klavierquartetts bestimmte Momente des integralen formalen Aufrisses antezipiert, ist eine kurze Beschreibung erforderlich (hierzu Abbildung 7 und z.T. Abbildung 1). Man hört einen schreiartigen Ausbruch aus dem engen intervallischen Tonraum der kleinen Terz, die Terz wird mikrointervallisch nach innen und außen vergebeult An der Tonraumstrukturierung des I. Satzes läßt sich zeigen, daß der Gestus des Heraustretens aus einem enggespannten Rahmen eine wichtige Rolle spielt. Angesichts der sensiblen Reaktion der folgenden Takte wäre es kurzsichtig, die Anfangstakte isoliert zu betrachten. Nur zusammen mit dem ersten Takt wird das Spezifische der Aufstellungzweier Tongruppen (cis-es-a und b-fis-a [1.3-4]) innerhalb einer angespannten gestischen Anlage verständlich (als merkwürdig verschobene rückläufige Bewegung, wie weiter unten ausführlich beschrieben wird). Die beiden Klavierakkorde (1.3 und 5) realisieren eine "eingrenzende" Geste: Sie deuten einen .Beginn" und einen vorläufigen "Abschluß" der Bewegung an, indem erster und zweiter Klavierakkord durch verschiedene Elemente .vermittelt" sind (Elemente der Identität: gleiches Instrument, gleiche Lage, gleiche Artikulation). Die Andeutung bleibt vage und spannungsreich, denn diese .Eingrenzung" durch die Position der Klavierakkorde deckt sich nicht mit der Setzung und Wiederaufnahme des e2 durch die Klarinette (1.1 und 5). Man kann angesichts dieser verschobenen .Raster" den Eindruck erhalten, daß die eingrenzende Geste der Klavierakkorde die Wiederaufnahme des Tones e2 in der Klarinettenstimme paraphrasiert oder kommentiert. Im Mittelpunkt der ganzen Anlage steht also keine bloße Repräsentation einer konstruktiven Ordnung- Rückbezüglichkeil als solche: z.B. Symmetrie-, sondern eine schwer bemeßbare, mehrfach gebrochene .reaktive" Relation zwischen einer konstruktiven Anordnung und ihrer Repräsentation. Es handelt sich bei der rückläufigen Geste dieser ersten Takte also keineswegs um etwas .Unmittelbares". Vielmehr bedarf das gestische Spiel der Reaktionen einer zugrundliegenden "Gestimmtheit", aus der heraus sich die Geste artikuliert.
13
Abbildung 7: 1.1-5, vereinfachte strukturelle Darstellung
schematische Darstellung des Tonhöhenverlaufs T. 1-6 (vereinfacht)
T.1/2 T. 3-5
plte pfte
lagenferner Ton:
ldarinette 0 ' ' ' <' 'eingeblendete' ', ', Tongruppen , '
', G/K ,/ klavierakkorde sfl ---'--''".--...:.'-' ____ _. { sff
lg~tl} ,, ~
Man könnte .Geste" als Sammelbegriff für distinkte Bewegungsqualitäten des musikalischen Satzes verwenden. Die Zeit· bzw. Dauernordnung seriell organisierter Musik hat, wenngleich tendenziell mit der Rationalisierung der Parameter ein homogener oder kontinuierlicher musikalischer .Raum" geschaffen wird, keine Objektivierung oder Neutralisierung der einzelnen musikalischen GestaH zur Folge. Der Beginn von Karlheinz Stockhausens Zeitmaßen (1957) etwa basiert auf der Kontrastierung langer mit extrem kurzen Tondauern und der Zusammenstellung unterschiedlicher Bewegungstypen, sprich: die Konstruktion zeitigt nicht bedingungslos eine musikalische Gestalt, vielmehr wird zwischen Konstruktion und Imagination einer musikalischen Gestalt vermittelt. Die hörbaren Qualitäten konkreter Gestalten sind keineswegs durch Integrität der Konstruktion verbürgt: Der Beginn der Zeitmaße ist in seiner Gegenüberstellung langer und kurzer Werte .spannend" gesetzt. Wenngleich konstruktive Prinzipien serieller Musik beim heutigen Komponieren keine primäre Rolle mehr spielen, sind doch Residuen, nämlich .Gesten" ihres musikalischen Satzes nach wie vor prävalent. So erhält beispielsweise die erste Strophe (11.1-20) von Ospalds Klavierquartett eine ähnliche distinkte Qualität, die aus der Kombination langer
14
gehaltener Posaunentöne mit den homogenen kleingliedrigen Bewegungseinheiten des Satzes resultiert (II. 7-8, 11-13). Durch den Eintritt der langen Tondauern lädt sich die schnelle Bewegung der kurzen rtlythmischen Werte auf, die Geschwindigkeit ihrer Bewegung emält ein Pendant in der Statik der eingeschobenen Posaunentöne, sie vertiefen kontrastiv den Gestus der schnellen Bewegung. Neben der simultanen gibt es auch die leichterfaßbare sukzessive Kontrastierung.lm I. Satz tritt ab 1.42 ein durch pulsierende binäre Zweiunddreißigstel gekennzeichneter Bewegungstypus ein, der anschließend quintolisiert wird (1.46-48). Die Beschleunigung findet vorerst als kleinschrittiger Übergang statt, wird aber anschließend nochmals aufgegriffen, indem die Zweiunddreißigstel-Bewegung .etwas schneller" (1.50) nach der Unterbrechung durch einen langen gehaltenen Klarinettenton (1.49) wieder einsetzt. Erst der Kontrast des langen unterbrechenden Tones verdeutlicht- als Bruch der Bewegungskontinuität- die zunächst fast unmerklich vollzogene Beschleunigung im Bereich der rhythmischen Minimalwerte.
Abb. 8: 1.4211., rhythmisches Profil (melodische Linien angedeutet). Die Anordnung der Systeme entspricht der Partitur (Baßklarinette, Violoncello., Pianoforte)
~=ca.132
15
ln den Raster der Repetitionen (hier mit kleinen Notenköpfen gekennzeichnet) schleichen sich Linien mit zunehmend längeren Dauernwerten ein. Es erfolgt eine geschwinde Folge reaktiver Übernahmen in den Stimmen: Den Ansatz linearer Bildungen in der Klarinette nimmt in 1.45 das Cello auf, das Klavier imitiert in 1.46 die Zweiunddreißiglei-Linie der Klarinette und beschleunigt sie zu Quintolen, die wiederum von der Klarinettenstimme aufgenommen und anschließend von der Posaune in die repetitive Schicht integriert werden. Während die Quintolisierung zunehmend die repetitive Schicht erlaßt, steigern sich die Dauerwerte der Klarinettenlinie, die schließlich den unterbrechenden Spitzenton (e2) erreicht. Der Prozeß 1.42-49 häuft kleine diskontinuierliche Einheiten (Klarinette 1.44), bis eine Schicht des Satzes ausfällt, d.h. der vorerst stabile Satz wird .subversiv" transformiert. An dieser Geste der Subversion beteiligen sich alle Stimmen in einem sehr feingliedrigen Geflecht von Reaktionen.
Fluß (1 ): Assoziationen I Brücken
Der II. Satz beginnt mit einem Klang, der im letzten Abschnitt des I. Satzes über eine längere Strecke ausgebreitet war (g-es 1-a1: l.n -79, 82, 84, 89f.; 11.1 ). Man könnte von einem vorbereiteten Anschluß sprechen, zumal der II. Satz das Anfangstempo ()l = 88) wieder aufnimmt. Den Satzanschluß jedoch als Teilstück einer .Entwicklung" zu deuten, wäre übertrieben, denn der Prozeß bewegt sich keinem finalen (zu entwickelnden) Ergebnis entgegen.(22l Es scheint angemessener, von Assoziativität zu sprechen. Im Gegensatz zu den drei mittleren Sätzen ist der gestische Raum des I. Satzes uneindeutiger, nicht von Linearität bestimmt, sondern von einem Spiel der Rückbezüglichkeiten, einer Uneindeutigkeit der Richtung. Dieser permanente ungerichtete Regreß bestimmt nicht nur den Aufriß des Satzes im Ganzen, sondern gerade auch die Charakteristik des Details: zum einen die schwierige Bestimmbarkeil von Tempo und Metrum, zum anderen die durch mikrochromatische Abweichungen verunklarte lntervallik. Im Verlauf dieses .richtungslosen" Satzes werden assoziative Verbindungslinien gezogen, und umrißhafte .Brücken" zu den anderen Sätzen deuten sich an. Der Anschlußklang g-es 1-a 1 beispielsweise läßt sich als Teilmoment eines solchen assoziativen Konnexes umschreiben. Beruft man sich auf die Spielanweisungen als Umschreibung der .Geste", so wird das Spektrum ihres Raumes etwa im Umkreis der ersten elf Takte abgesteckt: 1.1 "feroce"; 1.3 .etwas schneller"; 1.7 .verhalten, ruhig fließend"; 1.11 "calmo". Auf die wilde Anfangsgeste folgt ein geringfügig höherer Tempolevel, von dem aus allmählich .Ruhe" erreicht wird. Der energische Beginn wird von stufenweise hergestellter Ruhe aufgefangen. Während der erste Teil des Satzes diesen Ablauf in mehreren kleinen Abstufungen vollzieht, nimmt der zweite Teil härtere Konturen an. Nach dem Einbruch eines schnelleren Tempos ab 1.42, das mit 1.50 und 1.53 noch gesteigert wird, tritt diesmal der .. calmo"-Charakter kontrastiv ein (1.59), anschließend wird das Tempo in einem "lontano" bezeichneten Schlußabschnitt (1.74-91) nochmals zurückgenommen ()l = 76). Der Kontrast betrifft sowohl das Tempo, als auch die Satzfaktur (Tonraum, innere Rhythmik, Viel- oder Geringstimmigkeit). Es bietet sich an, den Verlauf des Satzes als zweimaliges Auffangen einer energiegeladenen Geste zu umschreiben. Vergleichen wir den Beginn der beiden Partien, die die energiegeladene Geste
16
auffangen (1.311. Und 1.59ff.). Takt 1.59 formuliert prägnant zwei dreitönige sets123) aus, die in 1.3-4 angedeutet waren: es-1-a; fis-a-b.
Abbildung 9: 1.59 (cantabile e calmo, Tempo 1): sets G und K.
{.'\
) I
Diesets bilden sich aus Kombinationen (1) einer großen Terz und einer großen Sekunde (Umfang: Tritonus) einerseits; (2) einer kleinen Terz und einer kleinen Sekunde (Umfang: große Terz) andererseits. Da diese dreitönigen sets, die in allen perrnutativen Varianten auftreten können, den Kern der folgenden analytischen Betrachtungen bilden, möchte ich sie mit den Kürzeln G (=1) und K (=2) bezeichnen. Im dritten Takt des Satzes werden G und K kaum markant exponiert als vielmehr nur angedeutet. Man könnte (in Anlehnung an die Beschreibung des ersten Taktes) wiederum von einer .Ausbeulung" sprechen, einer Ausbeulung des Klavierakkords auf dem ersten Schlag von 1.3 (vgl. nochmals Abbildung 7): Diesets G (Pos I Klar: cis-es-a) und K (Pos und Vc: fis-a-b) schieben sich in den Raum, der vom Klavierakkord aufgerissen wurde, man könnte auch sagen, sie werden eingeblendet; jedoch nur momentan und kurz, denn der Ton a 1 wird noch in 1.4 von der Posaune zum as1 gebeugt, und fis1 vom Cello in 1.5 zu gis1 gezogen, während die Klarinette mit der erneuten Ansteu~rung des e2 auf den ersten Takt zurückverweistinnerhalb des Rahmens für den oben als rückläufig beschriebenen Gestus der ersten fünf Takte- die beiden verwandten Klavierakkorde und die Wiederaufnahme des e1 in der Klarinette- treten die beiden setskurz in Erscheinung. Demset-verlassendenglissando von fis1 zu gis1 (Vc.) kommt dabei große Bedeutung zu, da dieses gis1 in den folgenden 15 Takten die tragende Rolle spielen wird (vgl. hierzu auch Abbildung 18).
Da die Sukzession der Töne im set keine erkennbare übergreifende Ordnung ausbildet, ist es sinnvoll, bei der allgemeinen Formulierung G und K als Kombination einer großen Terz mit einer großen Sekunde (G) und einer kleinen Terz mit kleiner Sekunde (K) zu bleiben und keine unnötig verkomplizierende Spezifizierung ihrer Permutationsvarianten vorzunehmen. Es sei betont, daß diese Eingrenzung auf zwei exemplarische sets keinem notwendigen Verhalten des analytischen Kommentars gegenüber Ospalds Quartett entspringt. Derart allgemein gelaBte Tonbeziehungen können, wollte man sie als intendiertes Konstruktionsmerkmal verkaufen, natürlich leicht als pseudoanalytische Mogelpackung entlarvt werden. Auch handelt es sich um kein Komponieren mit .. geringstmöglichen Regeln".124) Es geht hier nicht darum zu zeigen, daß Ospald .,systematisch"
17
mit Tongruppen oder festgelegtensetsarbeitet-dies ist nicht der Fall. Vielmehr dient die Diskretion zwischen set G und K als heuristisches Modell, mit dem sich allgemeine Merkmale der melodischen Linienbildung ansatzweise eingrenzen lassen. Tatsächlich sind die melodischen Linien allem Anschein nach "intuitiv" gesetzt, schriftliche Improvisationen oder Arabesken freier kompositorischer Imagination. Die Assoziativität des inventiven Prozesses erlaubt es, innerhalb eines Werkes- und auch darüber hinaus- sich in viele Richtungen zu bewegen .• Es ist bisweilen schwierig, die Identität der einzelnen Stücke noch zu erkennen, weil die Melodie immer weiter wuchert" (Ospald). (25) Versuchen wir also dieses Wuchern mithilfe der zwei sets zu beschreiben -wobei wir uns vorläufig auf Satz II, zweite Strophe als Paradigma beschränken wollen. Der erste unison geführte Melodiesplitter, der in der zweiten Strophe hervortritt (11.2311., vgl. Abbildung 10a), bildet sich aus zwei sets G, die zueinander in einem Umkehrungsverhältnis stehen: b-fis-e; gis-cd. Da set G Ausschnitt der Ganztonskala ist, kann die Kombination von G-sets zur kurzfristigen Ausbildung eines ganztOnigen Milieus führen (wie es hier in 11.23f. der Fall ist). Die assoziative Melodiewucherung ist an kein Reglement gebunden- bei 11.3511. (Abbildung 10c) versagt das Beschreibungsmodell z.B. weitgehend). Die dreitOnigen Elemente können nahezu beliebig ineinandergreifen. So konstituiert sich bei 11.2711 (vgl. Abbildung 10b) ein zweimaliger Aufstieg der melodischen Linie aus K-sets (11.27: a-fis-b; 11.29-30: cis-c-a; ähnliche Stellen: 11.36, 11.38, II. 52, 11.53) - eine notwendige Regelleitet sich hieraus aber nicht ab. Das .Milieu" der sets gibt dem assoziativen Wuchern der Melodie ein bestimmtes Gepräge, das sich nur allgemein umreißen läßt, beispielsweise durch Konstatierungen, daß etwa Großterzen, große Sexten oder große Nonen Bevorzugung finden. Was die Bewegungsrichtung der melodischen Linien angeht, läßt sich ebenfalls keine Verallgemeinerung vornehmen. Von Melodiespitter 1.2711. kann man etwa schließen-vergleicht man andere Melodiebildungen -,daß Aufwärtsbewegung überwiegt und Abwärtsbewegung meist sprunghaft bewältigt wird, was dem melodischen Aufriß insgesamt einen energischen Drang verleiht, der zu schnell erreichten Extremlagen tendiert (Kulminationspunkten oder stagnierenden Partien).
Abbildung 10a: 11.2311., Klarinette und Violoncello
L__ G _j L__ G __j
L.....- [Ganztorvnlieu) ----l
Abbildung 10b: 11.2711.
~f L__ K_j L__G_j LK_j
L_G__j LG_j L_K_j
18
LG_j LK_j LG.J LG.J
L[Ganztonmnteu)...J
Betrachtet man den Bau einer Einzelstimme näher, wird klar, weshalb analytische Werkzeuge, die zur Herausarbeitung von formalem Zusammenhang geschaffen sind, weitgehend versagen. Die Klarinettenstimme aus der zweiten Strophe beispielsweise bildet keine~ei direkte Wiederholungen oder Analogien aus, vielmehr dominiert eine Art varietas-Prinzip (vgl. Abbildung 11 ). Um dieses Stück .musikalischer Prosa" einer Zergliederung zugänglich zu machen, wird die Linie in verschiedene Melodiefragmente aufgeteilt, die mit eingerahmten Ziffern (1-7) bezeichnet werden. Wenngleich der Melodieve~auf nicht einzig von der Position seiner relativen Spitzentöne aus erklärt werden kann, ist eine kurze Vergegenwärtigung ihrer Organisation als Annäherung nicht ohne Nutzen. ln diesem Melodieabschnitt prägt sich generell eine Tendenz zur Höhe aus (Spitzenton am Ende), zugleich sind die Dauern der hohen Töne gegen Ende- jener Partie, die obem als .Stagnation" bezeichnet wurde- am längsten. Vergleicht man die Dauern der Spitzentöne, so zeigt sich zwar keine sofort einleuchtende Regelmäßigkeit, doch kann konstatiert werden, daß die langen Dauern am Ende nicht kontinuie~ich (additiv) erreicht werden, sondern sprunghaft; ein Faktum, das mit der ebenfalls diskontinuie~ichen Verteilung der Spitzentöne korreliert; ferner daß kein Dauernwert unter den Spitzentönen mehr als zweimal Verwendung findet (vgl. Abbildung 12).
Abbildung 12: melodische .Spitzentöne" (Klarinette II, Strophe~; Werte in Zweiunddreißigsteln: 6,6,4,4,5,2,8, 7,<7,5,3, 7, 12, 17,>36
:o•r
Während alle restlichen Tondauern bis 1.31 den Wert einer Achtel nicht übersteigen, dehnen sich die Werte bis 1.41 geringfügig. Bis auf die herausspringenden Werte am Ende der Strophe werden Dauernwerte insgesamt in ähnlicher Länge gehalten, so daß sich ein elastisches rhythmisches .Netz" ergibt, das die improvisatorisch anmutende Einzelstimme auffängt. Die rhythmische Elastizität ve~eiht der assoziativen Melodiebildung Spielraum und eine gewisse Kontinuität, die wiederum durch bestimmte .Ereignisse" (z.B. Wegfall oder völlige Vereinheitlichung der rhythmischen Schicht) effektiv gestört werden kann. Der Satz ist jederzeit zu einer kleinen reaktiven Transformation in der Lage. Doch genügt diese allgemeine Charakterisierung als Analyse der Linie nicht, zumal ihre kleineren inneren Korrespondenzen ein Moment der Kohärenz darstellen. Beispielsweise wird dreimal, jeweils am Ende der Melodiefragmente 1, 3 und 7, die gleiche aufsteigende Intervallkonstellation (gebildet auf sei G) verwendet (vgl. Abbildung 13). Auch an weniger signifikanten Positionen können Varianten dieser aufsteigenden Konstellation vorkommen. Es gibt in diesen wenigen Takten ein umfangreiches Spiel der Ähnlichkeiten derartiger melodischer Splitter, deren Auflistung hier aber nicht fortgesetzt werden muß. Es genüge das Beispiel in Abbildung 13: Auch hier läßt sich die allmähliche diskontinuie~iche Erweiterung des Tonraums zur Höhe hin ablesen, die auch bei der Synopse der Spitzentöne zu konstatieren war.
20
Abbildung 13: diastematischidentische (aufsteigende) Linienfragmente
Um dem Spiel der Ähnlichkeiten, das solche auf den ersten Blick verworrenen melodischen Linien durchzieht, genauer nachzugehen, ist ein vierter Ansatz nötig. Neben den bisher besprochenen Momenten der Tongruppenorganisation, der Spitzentondisposition und der Identität intervallischer Gruppierungen bleibt noch die Verteilung der Töne in ihrer konkreten Lage zu untersuchen und zwar im Hinblick auf die .innere" Beschaffenheit der Melodiefragmente 1-7 einerseits und verbindende Konstanten zwischen ihnen andererseits. Die einzelnen Melodiepartien weisen häufig kleine Rückgriffe auf bestimmte fixe Tonhöhen oder Tongruppen auf, also innere Referenzen, die im Moment ihres Erklingens melodische Abgeschlossenheil suggerieren -ohne daß die Melodie de facto .in sich geschlossen" sein müßte. Obwohl keine wörtliche Wiederholung vorkommt, simuliert die Geste des Rekurrierens eine Form von .Geschlossenheit". Daneben gibt es konstante Tonorte, die von jeweils zwei nebeneinanderstehenden Partien verwendet werden. Zu Beginn der Strophe sind dies vorwiegend tieflagige Töne (vgl. Abbildung 14a): Partie 1 und 2 sind durch Verwendung der jeweils tiefsten Töne e und gis miteinander verbunden. Beim Übergang von Partie 2 auf 3 sind die Lagen dieser .Konstanten" bereits höhergelegt (Abbildung 14b). An dem in Abbildung 14c wiedergegebenen Schema wird deutlich, daß die .Konstanten" sich -konform zur generellen Aufwärtsbewegung der Melodie- räumlich aufwärts verlagern. Die Charaklerisierung .Wuchern" allein genügt nicht, um dieses subtile Tongeflecht der Melodiebildungen zu beschreiben. Unter der phantastischen varietas des Satzes können Schichten verschiedener ineinandergreifender konstruktiver Verfahren freigelegt werden, die direkle melodische Korrespondenzen substituieren und Geschlossenheit der Melodiebildung simulieren: Anstelle von .Motiven" tritt ein System distikler sets, statt korrespondierender Melodiebestandteile sorgen konstante Tonorte für kurzfristige Momente von Kohärenz- ein riskant ausbalanciertes Netz stabiler und instabiler Momente.
21
Abbildung 14a: Abschnitt 1 zu 2. Gliederung in drei Systemen (von oben nach unten): 1. Referenzen innerhalb eines Abschnittes; 2. Tonhöhen ohne Referenz; 3 .• Konstanten", d.h. Verbindende Tonhöhen zum nächsten Abschnitt
1\ LI I I I I 2
«) . L
"' ... . 1\
«)- #17' ___/~
Abbildung 14b: Abschnitt 2 zu 3; geringfügige Höherlegung der .Konstanten"
,..2 3 I ~J ~J I I ~J --
«)
" 8"'-J;.-· ~ ..
., .... . fl -- ----- -------------- ---- ---
t!lrlf" - - !iY - -
Abbildung 14c: Abschnitt 4 zu 5; Anreicherung des mittleren und hohen Tonraums mit konstanten Tonhöhen
1'>4 5
1\ --«) , .. __________________ _J .. ______ II-<t_ ______ J"" .. -----------11·
22
Ergänzend sei noch die Ausbildung dreitöniger sets in der Satzvertikale angedeutet. ln 1.35-39 bildet G ein stabiles Feld aus (vgl. Abbildung 16): Die drei Töne (g-des1-a1) liegen als gleichmäßiges repetitives Muster aus Sechzehntel-Sextolen in der Cellostimme, ein Klangband, das von der Klavierstimme umspielt wird. Diese Umspielung setzt sich aus einer größeren Menge sehr eng kombinierter G- und K-sets zusammen. Über dem kontinuiertichen Hintergrund hervortretend, vermittelt die dritte, melodisch orientierte Schicht von Posaune und Klarinette zwischen der Statik des Cellos und der instabilen Bewegung des Klaviers. Der Rückbezug der Posaune auf das erste Auftreten des set K (1.3-4: b-fis 1-a 1) wird evident- vor allem durch das Glissando zwischen fis und a (Abbildung 15):
Abbildung 15: 1.36f. (Posaune), set Kin der Position von 1.3
Eingeleitet wird dieses Glissando durch ein ähnliches der Klarinette zwischen d2 und gis2, womit zwischen Klarinette und Posaune eine ähnliche Situation entsteht wie in 1.3 (dort: Glissando der Klarinette zwischen es2 und a2; dann Posaunenglissando fis1-a1). Die Klarinette, die mit einem set G (1.35-36: f1-g-des1) die Partie einleitet, bildet mit dem einsetzenden b der Posaune ein K-set (1.36: des1-d2-b) und setzt mit dem Glissando ein set G darüber (b-<J2-gis2). ln 1.37 bricht das Klangband des Cello ab, während die Klarinettenstimme im Rahmen eines K-sets (1.37: gis2-f1-e2)
den Spitzenton c3 erreicht, der mit dem a2 der Posaune und dem hinzukommenden gis2 (yc /Pfte) ein weiteres set K bildet (1.38). Durch ein weiteres, nur kurz berührtes set K (a1-f1-fis) wird die Partie abgeschlossen. Das hiermit erreichte fis der Klarinette verbindendet das Ende der Partie mit dem nächsten Feld (1.41 ), das auf einem set G unter dem übernommenenfisbasiert (fis-C-82).
Abbildung 16: 1.35-39, vereinfachte Darstellung (Synopse der sets)
1.35-39)
23
"Oberfläche" aus stabilen und instabilen Momenten
Goyas Satum steht am Beginn einer Moderne der Malerei, die die Mittel der Mimesis subvertiert oder konsequent negiert. So findet man etwa keine hierarchische funktionale Abstufung von "Vordergrund" und "Hintergrund" mehr. Nach Gilles Deleuze(26l wird die Differenz zwischen Figur und "Hintergrund" selbst thematisiert: Die Schwärze des Hintergrunds bricht durch die Augen Satums, teils löst die Figur sich umrißhaft aus der unheimlichen Bewegung des Hintergrunds, teils wird sie von der Schwärze geschluckt. Die Figur wird potentielle Formung amorphen Hintergrunds. Läßt sich gemalte Oberfläche und die "Oberfläche" von Musik vergleichen, oder kann man auch hier von einer Thematisierung der Differenz sprechen? ln der Anlage von 1.1-5 aus Ospalds Klavierquartettzeichnet sich eine Behandlung des Tonraumes ab, die im ganzen ersten Teil des I. Satzes (1.1-41, vgl. Synopse Abbildung 18) beibehalten wird: Es gibt eine stabile enge Mittellage, einen "Hintergrund", der durch die melOdischen Zeichnungen der Klarinette nur andeutungsweise einen "Um riß" erhält. Von diesem "Hintergrund", der durch sein differenziertes, flimmerndes Erscheinungsbild zum eigentlichen Attraktionsmoment dieser 41 Takte wird, heben sich lagenferne Töne ab, so in Takt 3 das c4 des Klaviers. Die extraterritoriale Position des einzelnen Tones deutet die grundsätzliche Separation der Baßlage an, die erst ab 1.8 (Klavier) - wiederum mit einem c (C,)- in den Satz eingreift. Erst nach 1.41 wird die Lücke zwischen den beiden bisherigen Lagen (große und kleine Oktave) geschlossen. Die schockartige Verdichtung und Auffüllung des Tonraumes ab 1.42 kann als Geste des "Ausbrechens" umschrieben werden: der stabile, nahezu unbewegliche Tonraum der ersten 41 Takte bildet eine gleichmäßige Schicht, aus der der Satz, verbunden mit einer impulsiveren Rhythmik "ausbricht": Alle Zweiunddreißigstel-Positionen des Taktes, die vorher potentiell und beliebig nutzbar waren, werden jetzt zu repetitiven Impulsen. Ein Vergleich der komplementärrhythmischen Anlage zweier beliebig gewählter Abschnitte mag dies verdeutlichen:
Abbildung 17a: 1.7-9: diskontinuierliche (selektive) Impulsstruktur
ifp if if
I~ 0'' bll'blW I§ D 0''-D bl{tl 1 ~ mlb/Pct L_5__j
Abbildung 17b: I. 45-47: gleichmäßige Impulsfolge und Oszillation
5 5 5 5
I~~~~~~ ~~~~~5D5D1 Ab 1.41 "bricht man ins Eis ein", auf dem man eine Weile gegangen ist. Unter der dünnen, unregelmäßige rhythmischen Schicht der ersten 40 Takte nimmt man latente Bewegungen (kleinere
24
>=elder rhythmischer Kontinuität) und Umrisse eines imaginären Fundaments (vereinzelte Baßtö-1€) wahr. Doch nicht allein die Enge des Tonraums selbst und dessen rhythmisch diskontinuierliche Artikulation strukturieren die ersten 40 Takte, vor allem ist hier das Netz kleiner Rückbezüglichkeilen beteiligt, die das Verhältnis von musikalischem Vorder- und Hintergrund als Vexierspiel der Virtualitäten aufscheinen lassen. Set G wird in 1.3 kurz hervorgehoben, wenn die Klari-1€tte gegenüber dem synchronen Einsatz aller Instrumente im ersten Takt kurz als Soloinstrument ·n Erscheinung tritt. Bereits der Einsatz von set K nimmt das solistisch hervortretende Glissando der Klarinette durch zwei sukzessive tiefer gesetzte Glissandi im Ensemble auf. Nicht zufällig korreliert mit dieser Absorbierung der Sologeste durch die Aktivität des Ensemble die desintegrierende Beugung des set K zum Ton gis1 (1.4-5). Der kurze Vordergrundeffekt des Solo wird in einen Hintergrund eingebunden, von ihm absorbiert oder geschluckt. Dieser Hintergrund wird in I. 7-21 durch den zentralen Ton gis1 - teils in Verbindung mit den Tönen a und dis-prävalent; aus ihm hervor tritt die Klarinette, jedoch nur als schemenhaftes Solo: ln 1.8 beispielsweise mit einem deutlichen Rückbezug auf 1.3 - beidemale wird a2 glissandierend angesteuert.
Abbildung 18: vereinfachte Darstellung der Tonhöhenorganisation 1.1-41
Takt 1·2 3-5 e2
6-21 22·33 34-35 36-39 40-41 --------------- ......... -----------
" -- ' ~- --- ---~ .. - -- '
~~~ ~ h/d .......... '
T/ ... ' - ... ... : ~
~~\ K
. . •j . t .
_______ ! ~ '
" --- , .......... ' '
~
I~ ll il' .
~~~·~-j j,'-. #~ ' :!: ' '
~~ -... : .. "
. I ~~"'
• l ' v~ ' ' ' ,., .... . I gis-a- isl . ' '
. ·~ ...~-. . ' .
tf ~
L •• Jt • II • . . . ~
' . ' ~ . ~ I= ' ' '
" 111 ' ' ' • 111:;',, :!: h- . . ~ ~ \~· py" : ' ' l>j
# i,bb..e~ ' ' a1/A2 .
' . . . c4/C1 \- ,_- 3• = .. . \=. •• . T
•• .
Baßlage ' ......... '
25
Anhand der vereinfachten synoptischen Darstellung (die nur von 1.1-41 reicht) sei vor allem eines hervorgehoben: Der Satz rekurriert immer wieder auf bestimmte stabile Tonhöhen: b, cis\ a1 und vor allem e2 (immer wieder Klarinette). An diesem Raster orientiert sich der Verlauf über weite Strecken, d.h. das Netz der Rückbezüglichkeilen basiert auf einer stabile grobmaschigen ,.Absicherung" durch konstante Tonhöhen. Ein ähnliches Verfahren ließe sich auch am ersten Teil von Ospalds Komposition ... und die Erd ist kalt (1992-98) für zwei Klaviere und Kammerensemble aufweisen. Diese Rekurrenz auf konstante Tonhöhen generiert einen Formdiskurs, den ich als ,labyrinthisch" bezeichnet habe, um ihn von linearen Prozessen wie Satz 11-IV des Klavierquartetts, Satz I II-VI des Klaviertrios (1994) oder dem I. Satz von Ma que/1 anno ... abzugrenzen.(271 Bei der Konstruktion des Tonraums wirken also Momente der Stabilität und der Instabilität ineinander. Ähnliches ließ sich bei der Gestaltung der rhythmischen Oberfläche und der Melodiebildung konstatieren.
Fluß (2): umrisshafte aporetische Form
Die ,Gestimmtheit", also der nach Flusser terminologisch so unscharf faßbare .. Raum", in dessen Grenzen sich die Geste ereignet, wurde hier bisher nur im werkimmanenten Zirkel gesucht. Es ist Zeit, diesen aufzubrechen und die Frage zu stellen, ob sich eine Geste aus den hypertextuellen(281
Qualitäten eines Werkes. heraus artikulieren kann. Der spröde Titel ,Klavierquartett" provoziert eine solche Fragestellung, da ein architextueller Konnex zur Gattung Kammermusik hergestellt wird, und der Autor via Titel einen potentiellen .. Gattungsvertrag-<291 mit dem Rezipienten schließt. Versucht man, den mittleren Satzverband nach einer traditionellen Formphysiognomik abzutasten, assoziiert man im Laufe eines ersten Beschreibungsprozessesangesichts des schnellen Tempos und des bruchstückhaft burlesken Charakters, der sich hier zu manifestieren scheint, leicht das Idiom ,Scherzo". Man fühlt sich durch den Tempoprozeß etwa an strettaorientierte Scherzi von Gustav Mahler erinnert. Ohne jedoch diesen Eindruck, den ich etwas hochtrabend als Idiom bezeichnet habe, sofort an allen möglichen Punkten der Partitur erhärten oder ihn- was vorraussetzte, Musik sei eine .. Sprache" (woran man durchaus zweifeln kann) - in den vermeintlich handhabbaren Begriff der ,Vokabel" führen zu wollen, sollte man überprüfen, ob ältere formale Diskurse und de~enige Ospalds zur Deckung zu bringen sind; ob die Frage nach einer aus mehreren Teilen zusammengesetzten musikalischen Form überhaupt in einer Reihe sinnvoller Fragen steht, die man an das Stück stellen kann. Wenngleich der Nebentext der Partitur keine Beziehung expliziert, möchte ich einer konkreten Assoziation nachgehen, die sich beim Hören eingestellt hat. Der heuristische Ansatz ist folgender: Ich versuche den IV. Satz aus Ospalds Klavierquartett als hypertextuelle Transformation des Allegro misterioso der Lyrischen Suite (1926) von Alban Berg zu begreifen.
Seide Sätze schließen nicht. sondern .. verschwinden", mit dem Unterschied, daß Bergs Satz in seinen leisen, enggesetzten Beginn zurückläuft - in einer Art Geste der Rücknahme, als sollte gesagt werden: ,das Gewesene war nicht"-, während Ospalds Presto zwar ebenfalls mit einem
26
=1egreß auf Anfangspositionen "verschwindet", dies jedoch mit wesentlich geringerer Eindeutig~eit. Sein Schluß weist auf den engen Kleinterzrahmen des Werkbeginns, gleichzeitig wird dieser =!ückbezug durch eine Wiederaufnahme der .burlesken" Posaunenglissandi induziert. Beide Schlußgestaltungen greifen auf setzende Positionen im Werk zurück: Berg läßt den Satzanfang <'"ebsgängig zurücklaufen; Ospald bringt die Merkmalezweier Satzanfänge (1. und II.) zur Überla;:Jerung. Das Verfahren einer Rückläufigkeit en bloc, wie man es bei Berg vorfindet, definiert den '::>m~alen Teil selbst als eine intergrale Entität des Werkes, wodurch eine -wenn auch sehr t'Elrtracke- Form von "Reprise" möglich wird. Die reflektierende Rückkopplung des kompositorischen Verfahrens zu einer Formvorstellung in Teilen (etwa .AB A") apostrophiert einerseits die M'>rtliche Rückläufigkeit als bewußtes produktives ,Mißverständnis' der Re-prise (also der Wiederaufnahme), andererseits stellt die nackte Technik wörtlicher Rückläufigkeit die Entität eines '::>m~alen Abschnitts infrage, da mithin ja der ganze Teil der Komposition Rückleitung, also .Übergang" wird. Technik und Form gehefl ein dialektisches Verhältnis ein, das die Form als =>räsentationsrahmen einer identifizierbaren musikalischen Gestalt subvertiert und die Technik der JOreflektierten Stellung eines autochthonen Mechanismus enthebt. Dieses dialektische Verhältnis entsteht aber nur dann, wenn die problematisierten Kategorien oder Kontrollmuster- hier also die Jeterminanten "Technik" und "Form"- noch greifbar sind, um ihren Status gegenseitig .angreifen" zu können. Form zeigt sich also, und das gerade in der Ausformulierung längerer Abschnitte, wie sehr auch ihr Status als integraler "Abschnitt" von innen, durch ein .inneres Geschehen" an~riflen sein mag, sie wird aber auch greifbar an Zäsuren. Es scheint sich eine gewisse Zwangsäufigkeit einer "psychologischen" Formung dahinter zu verbergen, daß Bergs wesentliche Zäsur, 'lämlich die zum Trio, als Ereignis inszeniert wird, das einen Bruch markiert, sei dieser nun .Einbruch" oder "Ausbruch". Berg kennzeichnet ihn in der Spielanweisung .ausbrechend" und in ::ler esoterischen Bezeichnung • Trio estatico". Wenn hier der Satz, in der Sprache psychologisch :jualisierender Metaphern, .außer sich" ist, muß zuvor allem Anschein nach die musikalische Annäherung an einen .inneren" Seelenmechnismus stattgefunden haben. Da die künstliche Eingrenzung der Interpretation eines aus der Partitur hervorgehenden formalen Problems über ::len kurzen Weg semantischer Zuweisungen aus einem außermusikalischen, vorzugsweise :;.iographischen Bereich hier aber m.E. nicht weiterführt,(ao) möchte ich vom Erklärungsmuster der .,psychologischen" Form keinen weiteren Gebrauch machen. Es mag genügen, daß der musikasche Text von Bergs Trio einen innermusikalischen "Ausbruch" kontrastiv zu den einrahmenden Scherzoteilen aufscheinen läßt: Der Ambitus des Satzes wie auch der melodischen Schritte weitet sich genauso explosiv wie die rhytmische Artikulation, die sich nun, gegensätzlich zur gleitenden 'lletrischen Verfassung der Rahmenteile, an emphatischen Schwerpunkten, an überakzentuierten AAlenten ausrichtet. Über den Augenblick des Bruchs hinaus, der schon im Auftakt zum Trio estatico den neuen Tonfall kenntlich macht, bildet dieses Repertoire kontrativ unterschiedener artikulatorischer Möglichkeiten eine Matrix, auf der sich ein geschlossener Formteil von innen 1eraus bilden kann.
27
Abbildung 19a: Ospald, Klavierquartett, IV.27ff.
Abbildung 19b: Berg, Lyrische Suite, II "Allegro misterioso", Takt 69ft.
Trio estatico (sempre f possibile)
J = J = 150 (Holbe<TUt=75l
r--'~-,~~~'~ ~ f ........... '
,,~
' ,. c-'-:?- ~- ·- d;!:: ·-
~
f.....!!.... ~,- ~,- ~~~ ~_&
,.-,~
~ ... -;;- ·-~· .-'!'" --!!~ ff~
~I' q•,
q~ ' I': ' ~
PP -- ff (ltrt;o) q'o' '
qo' r '
~J------:-
~
---~· ~
'
Es reicht nun nicht zu sagen, daß sich bei Ospald "Ähnliches" findet, sondern man muß auf einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Gestaltung von "Form" hinweisen. Ähnlich wie bei Berg bewegt sich der Satz bei Ospald einige Takte vor dem "Ausbruch" (Auftakt zu IV.28) in eine tiefere Lage, in der sich relativ enge schnelle Figurationen durchkreuzen. Der Bruch, auch hier markiert durch eine sprechende Spielanweisung ("platzend") vollzieht sich ebenfalls auftaktig und evoziert auf den Abtakt einen rhythmisch emphatisch repetierten Klavierakkord. Dieser Rhythmus wiederholt sich noch im selben Takt, freilich auf mehrere Instrumente aufgesplittert und dadurch ziemlich verwischt und kaum mehr kenntlich- anders also als bei Berg, der den wiederholten Rhythmus mit einer sequenzartigen melodischen Anlage verknüpft. Wenn wir uns die Eulenspiegelei einer anachronistischen Bezeichnung leisten wollen, handelte es sich hier um einen "amphibrachytischen" Rhythmus. Die in unterschiedlichen Werten konkretisierte musikalische
28
rlSetzung dieses rhythmischen Modells möchte ich verkürzend in einem Schema (Abbildung 20) z:..sammenstellen. Es lassen sich weitere .Elemente" aus Bergs ekstatischem Trio in Ospalds .,:..atzendem" Moment wiedererkennen; es mag genügen, hier etwa die wogende Aufwärts- und ~sbewegung anzuführen, bei Berg in Violine 2 und Bratsche, bei Ospald auf die Instrumente <:arinette, Cello und Klavier verteilt (IV.29-30). Daß jedoch der Bergsehe Satz nicht als zitier'ahiges und -fertiges Modell herangezogen wird, sondern daß sich allein die Geste des Aus:rechens in ihren verschiedenen Facetten in der Gestaltung des Ospaldschen Satzes vage und ~ahezu verwischt abzeichnet, deutet auf eine unterschiedliche Konzeption hin, die sich nicht ohne l(Jitterung des Sachverhalts zur Deckung bringen läßt. Es darf nicht übersehen werden, daß die Disposition der .satzelemente" bei Berg auf die Entwicklung eines Formabschnitts zielt, der sich e~ndeutig auf die pathetische Melodieführung der Primgeige konzentriert (ausgezeichnet durch Schönbergs Bezeichnung der .Hauptstimme"); und daß demgegenüber der Satz Ospalds sich Ediglich als Grundanlage einer Geste des Ausbrechens bedient, die bestimmte ausschlaggebende physiognomische Merkmale dieses Ausbruchs, wie er bei Berg ausformuliert ist, zu mptieren scheint. Die Merkmale dieser Elemente sind gleichsam in die Oberfläche der Ospaldschen Musik .eingegraben", werden aber gleichzeitig mit einer anderen .Schraffur" verbunden, Jen Trillern in den verschiedenen Instrumenten, die ab IV.31 bereits vom gesamten Satz Besitz ergreifen. Das FeldausgehaltenerTriller (IV.32-34) ist das auf schnellstmöglichem Weg erreichte Jmkippen des vorher bewegten Satzes in eine Aporie der Bewegung. Die ausbrechende oder :JIIatzende Geste hat sozusagen ihre eigene, sie unterbindende Aporie induziert.
Abbildung 20
Ich führe diese Beispiele an, weil sie einen Paradigmenwechsel der Formauffassung umreißen. Bei Ospald ist der Moment des Bruchs wichtig, der Schnitt selbst. Dieser zieht jedoch nicht unbedingt eine grundlegende Neuformation des Materials nach sich, die einen neuen Formabschnitt konstituieren würde, der in einer "architektonischen" oder irgend großflächig proportionalen Relation zu anderen Formabschnitten zu stehen käme. Von einer gegliederten Form sind Gesten geblieben, die Eckpositionen von Formabschnitten bezeichnen, während die Abschnitte selbst weitgehend kleingliedrigen Prozessen unterworfen sind, die aber nicht in eine kontinuierliche Entwicklung eingebunden werden, sondern in aporetische Positionen geraten, aus denen nur weitere Brüche der Satzfaktur, Fortsetzungen und erneute Wiederaufnahmen von Gewesenem 'ühren. Ein sensibles System von Verweisungen an verschiedene gestische Positionen des Satzes ist hier an die Stelle eines Satzes gerückt, der eine externe Formbildung "verwirklicht", in
29
welchem Verhältnis auch immer die einzelnen materialen Einheiten zum übergreifenden Formdiskurs stehen mögen, ob affirmativ oder subversiv. An die Stelle der gefäßhaften Form ist eine fließende, transformative Formbildung getreten.
Desintegration. Seitenblick auf e/ so/ no nos recuerde ... (1996)
Die zweite Art (das Gesetz zu stürzen) besteht im Humor, das heißt, in einer Kunst der Folgen und Abstiege, der Schwebe und des Falls ... Die Wiederholung ist Sache des Humors und der Ironie; sie ist ihrer Natur nach Überschreitung, Ausnahme
Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung" I
Die Formbildung bei Ospald läßt sich also einigermaßen sinnvoll über nur im Nachvollzug ihrer digressiven Funktionen beschreiben. Bei einer solchen Gestaltung stehen gestische Qualitäten im Vordergrund, die eine traditionelle an .flächenhaften" Abschnitten orientierte Formbildung zwar einerseits unterlaufen, sie aber andererseits simulieren. Man könnte, um einen halbwegs griffigen Ausdruck in die Diskussion zu bringen, hier von .. simulierter" Form sprechen. So bildet Ospalds scherzoartiges Presto eben kein Trio aus, sondern simuliert die Situation eines Trioeintritts. Hier ergäbe sich die Möglichkeit, einen Anschluß an das Theorem der "Beobachtung zweiter lnstanz•(S2l zu suchen, das nach Niklas Luhmann ein Kunstwerk als zum Kunstdiskurs gehörig auszeichnet. Ospalds ... e/ so/ no nos recuerde (1996) für zwei Gitarren kann als "Lektüre" der Gattung Scherzo interpretiert werden. Nicht nur die großformale Einteilung in drei Sätze, die vordergründig ein altemierendes Temposchema suggeriert (schnell-langsam-schnell), sondern auch Binnenabteilungen und Brüche erinnern an Scherzo-Trio-Bildungen. Im wesentlichen beruht der Kontrast der Abschnitte auf einer Differenz in der musikalischen Zeitgestaltung, die man etwa mit Pierre Boulez' komplementären Begriffen "temps Iisse" und "temps strie" eingrenzen könnte.(331
Daß sich hier freilich einige Zwischenstufen finden, die man mit Begriffen wie "Puls und Gleiten, Überlagerung, Rückung"(341 etc. differenzieren könnte, soll hier nicht zur Diskussion stehen.
Der 111. und letzte Satz (furioso. so schnell wie möglich) des Gitarrenduos macht sich im Kern jene krebsgängige Spiegelsymmetrie zunutze, die am Misterioso-Salz von Bergs Lyrischer Suite akzentuiert wurde: Es handelt sich bei Ospalds Duo um die Takte 246-260, die von Takt 265-277 mit geringfügigen Abweichungen krebsgängig wiederaufgenommen werden. Daß hier allerdings die großformale Entsprechung selbst, also die Konstitution einer Form durch rückläufige Wiederholung eines Formteils nicht der Zweck der Anlage ist, wird klar, wenn man die "Physiognomie" der ganzen Anlage untersucht. Im Gegensatz zum Beginn des furioso-Satzes bildet der krebsgängige Komplex keine eindeutige Linienführung mehr aus. Er ist Folge eines Demontageprozesses der "Figur",(351 die das furiosomarkant einleitet (Abbildung 21 a). Signifikantes Merkmal dieser Figur ist weniger ihre plane Rhythmisierung als vielmehr die exakte Folge auf- und abwärtsgerichteter Bewegung (schematisch: ++I- I+ +I+ I- -I- I+). Konsequenterweise setzen die
30
Nach einer Digression, die den transformativen Prozeß der Figur unterbricht (Takt 243-245) setzt der angesprochene krebsgängige Abschnitt ein, der mit einer der Figur angenäherten Gestalt beginnt. Wurde die Figur bisher vorwiegend rhythmisch zerdehnt, so erfolgt nun die Desintegration ihrer signifikanten Bewegungsrichtung durch nicht mehr sinnfällig auf die Anfangsgestalt beziehbare Verkettungen von Auf- und Abwärtsbewegungen.
Abbildung 21e
Da der desintegrative Prozeß hier abgeschlossen ist, gibt es keinen merklichen Attraktionspunkt des Satzes mehr. Übriggeblieben ist die manische Bewegung, die wie am Ende des V. Satzes im Klavierquartett und am Ende des Klaviertrios nur durch ein .fade-out" oder durch einen Bruch beende! werden könnte (wie dies mit plötzlicher Ausblendung der kontinuierlichen Bewegungsschicht ab Takt 281 geschieht). Die Krebsgängigkeil der Passage von Takt 246-277 ist nur möglich vor dem Hintergrund einer zunehmenden Beraubung des Satzes von signifikanten Merkmalen. Auch diese Formbildung kann aporetisch genannt werden, da der prozessual relativ schnell erreichte Zustand über eine längere Strecke in einer in sich kreisenden, leerlaufenden Bewegung aufrechterhalten wird, also in einer Aporie verharrt. Es könnten mehrere an diesem Prozeß beteiligte Satzschichten angeführt werden, die übrigens nicht auf einer homogenen Deskriptionsebene liegen, sondern ein analytisches Modell erforderten, das mit inhomogenen Begriffen umgehen kann: Zu beachten wäre die Gestaltung der Heterophonie (einschließlich des Sonderfalles des Unisono), akkordischer Satz, die Lage mikrochromatischer Linien, fixe Tonhöhen in Baßlage und innerhalb der mikrochromatischen Linien, die Dichte der Repetitionen und schließlich die Stellung der Figur innerhalb dieses Netzes. Es würde sich empfehlen, diese Schichten in einer analytischen Partitur auseinanderzunehmen, um ihre gestische Interaktion zu verdeutlichen.
Die beschriebenen Prozesse verlaufen weder hier noch im Klavierquartett "morphisch".(36l Ohne daß sie der manchmal didaktischen Deutlichkeit der Prozesse in bestimmten Kompositionen beispielsweise György Ligetis bedürften, sind sie wahrnehmbar, nicht zuletzt wegen der virtuosen Behandlung des Instrumentariums, die nie Selbstzweck wird. Die Eigenschaften der Instrumente und ihre Befragung bilden eine materiale Matrix der Komposition. Einem Hörer, dem an konzentrierter Wahrnehmung- nicht aus narzißtischer Lust am hypertroph Komplizierten, aber auch nicht aufgrundeiner vermeintlich meditativen Versenkung in Banalitäten- gelegen ist, wird die scharfe Artikulation von Klaus Ospalds Musik entgegenkommen. Er wird auch die pathetisch-zynische Ironie zwischen den Tönen schätzen - und eine Weile versuchen nachzuvollziehen, welche Veränderungen sich auf jener Kippe zwischen Erschrecken und Lachen ereignen können.
32
J...t.al1 Berg: Lyrische Suite für Streichquartett, Universal Edition, Wien-London o. J. (Philharmonia Partituren 173) .
.1,.1e von Klaus Ospald angeführten Werke sind bei Breitkopf und Härtel, Wiesbaden, verlegt.
ANneltungen
Sall.ln verschlingt eines seiner Kinder, Fresko, auf Leinwand übertragen, Madrid, Museo del Prado.
tterzu Paul de Man: Phänomenalität und Materialität bei Kant, in: ders.: Die Ideologie des Ästhetischen, hrsg. von Chrisloph Menke, aus dem Amerikanischen übersetzt von Jürgen Blasius, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 23ff.
,Bodenlos" ist die ursprüngliche Bedeutung Wortes .absunf, bodenlos im Sinn von .ohne Wurzel'. Vilem Flussernennt BUnen (gepflückt und in eine Vase gestel~) auf dem Frühstückstisch .Beispiele absurden Lebens'. Vgl. den Beginn seiner Autobiographie Bodenlos, Düsseldorf: BÖIImann 1992, S. 9.
Vrj. hierzu Massimo Cacciaris Essay Der Tod der Zeit, in: ders.: Zeit ohne Kronos. Essays, hrsg. und übersetzt von Reinhard Kacianka, Klagenfurt: Ritter 1986, S. 15-26.
~ Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft: eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, übersetzt von Ulrich Köppen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1973, S. 7.
OspaJd ließ sich u.a. von Texten Artauds 1982 zur Komposition von D'Autres Chanterontfür Sopran, Kammerensemble llld Per1wssion anregen.
Meine Studie bezieht sich auf die Fassung des Klavierquartetts von 1994. Der Komponist hat inzwischen eine revidierte Fassung (1997) vorgelegt, deren Änderungen indes nicht so drastisch ausgefallen sind, daß die Analyse in irgend einem Punkt sachlich unverständlich würde.
Aus dem Chanson und schießen pfei/ um pfeif, in: Konrad Bayer. SAmtliehe Werlce, hrsg. von Gerhard Rühm, Bd. I, Stuttgart: Clett-Kotta 1985, S. 85.
Auf den Begriff der musikalischen Mimesis kann hier nicht eingegangen werden. Weiterführend etwa Albrecht Riethmüller. Die Musik als Abbild der Realität. Zur dialektischen Widersp/ege/ungstheorie in der Ästhetik, Wiesbaden: Sleiner 1976 (= Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 15), passim.
• Taktangaben werden im fotgenden immer nach Sätzen (römische Zahl mit Punkt) und Takten (arabische Zahl nach dem Punkt) zitiert.
•• MassimoCacciari, DerTodder Zeit, S.16.
• L Konrad Bayer. Werlee I, S. 39.
·1 Vilem Ausser: Gesten. Versuch einer Phänomenologie, Frankfurt am Main: Ascher 1994, S. 7-18.
• 4. Ähnliches gilt für die Bezeichnung Gigue, die der II. Satz aus Klaus Ospalds kammermusikalischem Werk Ma quell' anno Ia primavera stentava a farsi avanti (1989) erhalten hat. Es handeil sich hier ebenfalls nicht um eine formale Übernahme eines Typus des Suitensatzes, sondern um einen Tempocharakter: Ähnlich den Strophen im Kla· vierqualfett stünde die Prozessualität des musikalischen Satzes einem geschlossenen Formtypus im Weg. Vielmehr kann die Bezeichnung Gigue als Hinweis sowohl auf einen Charaktertypus, als auch auf ein inspiratives Moment des Kompositionsprozesses genommen werden. Die Auseinandersetzung mit dem geschichtlichen Typus (Gigue oder Strophe) kann als Abstraktionsprozeß eines Objekts verstanden werden, das in den Werkdiskurs eindringt, nicht aber als Ausdruck obligatorisch aufgefaßter Kompositionstradition.
• 5. Edgard Varese: Ameriques, rev. and ed. by Chou Wen.Chung, New York: Goifranc 1973, Studienziffer 27.
• 6. Die Frage, was an dieser Posaunenstelle eigentlich grotesk wirkt, ist nicht uninteressant (und schwer zu beantworten). Es dürfte sich hier um die Ausformung der Groteske handeln, die Gabriele Beinhorn unter dem Stichwort .Instrumentale Effekte' angesprochen hat; vgl. Das Groteske in der Musik: Amold Schönbergs .Pierrot lunaire', Pfaffenweiler: Genlaurus 1989 (= Musikwissenschaftliche Studien 11 ), S. 37ff. Man kann aber nicht vorbehaltlos sagen, daß das
33
Glissando als instrumentaler Effekt der Musik für Posaune hier als ClicM .entlarvt" würde. Ein • Verfremdungseffekr liegt hier nicht vor, die Musik entbehrt vollkommen der didaktischen Absicht; vgl. hierzu Jürgen Engelhardt: Gestus und Verfremdung. Studien zum Musiktheater bei Strawinsky und Brecht/Weil/, München- Salzburg: Katzbichler 1984 (= Berliner musikwissenschaftliche Studien 24). Die hohe Lage, die Kürze der Artikulation, die Reihung zu einer linearen verzerrten Tonfolge entkontextualisieren das Glissando einerseits. Andererseits wirkt die Partie .nachahmend'- im Sinne einer Imitation der menschlichen Stimme. Sie erinnert allerdings an keine idealisierte vox humana, sondern an die überschnappende Stimme eines Wahnsinnigen.
17. Jean Paul: Vorschule der Ästhetik, in: ders.: Sämtliche Welke, hrsg. von Norbert Miller, München: Hanser 1963, Abt. I, Bd. 5, S. 125 (§ 32).
18. Jorge Luis Borges: EI idioma analitico de John Wilkins, in: ders.: Obras completas, Bd. 2, Buenos Aires: Emece 1983, S. 86: .La Belleza figura en Ia categoria decimosexta; es un pez vivfparo, oblongo. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de conocimientos benevolos. En sus remotas paginas esta escrito que los animales se dividen en A) pertenecientes al Emperador, B) embalsamados, C) amaestrados, D) lechones, E) sirenas, F) fabulosos, G) perros sue~os. H) incluidos en esta clasificaci6n, I) que se agitan como locos, J) innumerables, K) dibujados con un pincel finfsmo de pelo de camello, L) etcetera, M) que clcaban de romper el jarr6n, N) que de lejos parecen moscas.' Diese Passage ist u.a. zitiert an prominenter Stelle bei Michel Foucault: Les mots et /es choses. Une archeologie des sciences humaines. Paris: Gallimard 1966, S. 7.
19. Viiern Ausser. Gesten, S. 8.
20. Alexander Mitschertich: Gesammelte Schriften, Bd. VI, hrsg. von Herber! Wiegandt, Frankfurt am Main: Suhrf<amp 1983, S. 155.
21. Viiern Ausser. Gesten, S. 41.
22. Einerain .Entwicklungsgedanken" orientierten Fonn widerspricht, daß man den vorangestellten ("exponierten") ersten Tald als .Keimzelle" ("Senfkorf" I .Unnotiv" I .Formel") nur unter Anwendung interpretatorischer Gewalt deuten kann (z.B. wenn man die .Ausbeulung" des Terzintervalls als konstruktiv essentielle .Exposition" der Glissandi auffaßte, die das klangliche Erscheinungsbild des ersten Satzes prägen. Dies hieße allerdings, ein allgemeines Merf<mal der ,.Kiangsprache" eines Stückes (ein .Omamenr? I ein .Parergon"?), nur weil es ein solches vorstellt, zur Essenz der Konstruktion erklären zu wollen).
23. Zoo\ Begriff .ordered sets• vgl. Allan Forle: The Structure of Atonal Music, New Haven- London: Yale University Press 1973. Ich bediene mich hier des set-Begriffs nur in einem minimierten Oefinitionsfeld, nämlich zur Bezeichnung charakteristischer lntervallkonstellation, bezogen auf den Oktavrahmen. Das eigentliche Ziel der set-Methode, eine umfassende Analyse der .pitch classes", liegt hingegen nicht mehr im Rahmen meiner Studie.
24. U. a. erläutert in lannis Xenakis: Formalized Music. Thought and Mathemaücs in Music, (Revised Edition) Stuyvesant, New YO!k: Pendragon 1992. Darüber, ob die Kenntnis der mathematischen Grundlagen für eine adäquate Rezeption notwendig ist, kann man kontroverser Meinung sein. Vgl. etwa: Peter Böttinger. Zeitgestaffung. Die kompositorische Bewältigung rllythmischer und formaler Probleme im Welk von /annis Xenakis, in: /annis Xenakis, hrsg. von HeinzKiaus Metzger und Rainer Riehn, München: edition text + kritik 1987 (=Musik-Konzepte, Heft 54155), S. 43; dagegen: Randolph Eicher!: /annis Xenakis und die mathematische Grundlagenforschung, Saarbrücken: Pfau 1994 (= fragmen 5), S. 3 u. 36.
25. Klaus Ospald in einem Gespräch mit dem Verfasser am 2. Juli 1997. Es erf<lären sich aus diesem nicht allein auf das Einzelwelk bezogenen Kompositionsprozeß auch frappante Ähnlichkeiten zwischen dem Klavierquartett und dem Klaviertrio Ospalds.
26. GiHes Oeleuze: Differenz und Wiederllolung, aus dem Französischen von Joseph Vogl, München: Fink 1992, S. 50 (.Die Differenz an sich selbsr).
27. Oliver Wiener. Notizen zur Kammermusik Klaus Ospa/ds, in: Programmheft zum Porträtkonzert Klaus Ospald am 29.1.1996, Radio Bremen, S. 3-5 u. 101. Dieser Text, ebenso meine Anmerkungen zu Klaus Ospald, in: Up to Date (lnfohefl des Vertags Breitkopf und Härte!) 411996, S. 2f, wurden ohne Absprache redaldioneil entstellt, weshalb ich nur bedingt als Autor für diese Texte verantwortlich zeichnen kann.
34
_ _ Zu den Begriffen Hypertext, Hypotext und Architext vgl. Gerard Genette: Palimpseste. Die Uteratur auf zweiter Stufe, aus dem Französischen von Wolfram Bayer und Dieter Hornig, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, insb. S. 9-18.
_ _ .Gattungsvertrag' oder .-pakt': Ein Begriff, mit dem Philippe Lejeunes Arbeiten über die Autobiographie operieren. Vgl. dessen Studie: Der autobiographische Pakt, aus dem Französischen von Wolfram Bayer und Dieter Hornig, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994, insb. S. 13-51.
;: Hier tun sich weitere, z.T. am Werkbegriff gebildete Problemfelder auf, deren Eingrenzung mindestens genauso schwierig oder methodisch prekär ist wie eine .rein technische' Analyse.
:- Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung, S. 20.
::2 Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995. Die meines Wissens einzige kritische Reaktion auf die Luhmannsche Theorie von musikwissenschaftlicher Seite - wenngleich sie eine m.E. vorschnelle Demontage ist- sei hier angegeben: Ulrich Tadday: Systemtheorie und Musik. Luhmanns Variante der Autonomieästhetik, in: Musik & Ästheffk 1 (1997), S. 13-34.
:>3. Pierre Boulez: Penser le musique aujourd'hui. Le nouvel espace sonore, Paris: Gallimard 1963, S. 99f.
34. Vgl. Böttinger: Zeitgestaltung, S. 43-70.
:>5. Der Begriff .Figur" wird hier in Anlehnung an Brian Femeyhough verwendet, der weniger auf die identilikatorischen Momente einer .Figur" als auf ihre transformativen Qualitäten abhebt. Vgl. dessen Lecture II Tempo della Figura, Übersetzung von Claus-Steffen Mahnkopf, in: MusikTexte 36 (Oktober 1990), S. 27-30.
36. Vgl. Hermann Sabbe, György Ugeti. Studien zurkompositorischen Phänomenologie, hrsg. v. Heinz-Kiaus Metzger und Rainer Riehn (=Musik-Konzepte 53), München: edition text + kritik 1987, v. a. das Kapitel .Prozeß-Typologie', S. 35ft.
35
Beiträge, Meinungen
und Analysen
zur neuen Musik
tragmen hrsg. von Siefan Fricke ISSN 0949·5282
1 I Edgard Vartse: •Offrandes" 21 Adomo und die Musik im •Doktor Faustus» 31 Morton Feldman: ocUntitled Composition» 41 Glaclnto Scelsl: ocQuattro pezzi per orchestra ciascuno su una nota
sola» 51 lannls Xenakls und die mathematische Grundlagenforschung 61 Jörg Herchet: ocKomposition für Oboe, Englisch Hom, Posaune, Schlag-
zeug, Klavier, Viola, Violoncello und Kontrabaß,. 7 I Carmen Marla Clrnecl: "Trojtza für 15 Spieler" 81 Krzysztof Pendereckl: •Anaklasis» 91 lvan Wyschnegradsky: ocEtude sur le Carre magique sonore"
10 I Federlco Mompou: «Canci6n», Raff R. Ollertz: •Toy Tö», Cerlos Saura: ocCrfa Cuervos», F..-..rlc Chopln: «Preludes»
111 Morton Feldman: •The Viola ln My Ufe (3)» 121 Joonas Kokkonen 131 Davld Tudor/John Cage «Variations II» 141 György Kurhlig: Kompositionswerkstatt 151 Maurlclo Kagel: «Finale» und "···· den 24. xii. 1931» 161 Stefan Wolpe: •Piece in Two Parts for Flute and Piano» 171 hespos: ccduma» 181 Josquln Despraz/Bruno Maderna: «Magnificat quarti toni». 19 I hans-joachlm hespos 20 I Sandor Verass: ocMemento» 21 I Ernstalbrecht Stlebler 22 I Cage und Messlaen 231 Wemer Helder: ccD.E. Memorial. (Duke Ellington zum Gedenken) für
Posaune solo» 241 Klaus Ospald: •Klavierquartett» und •Gitarrenduo» 25 I György Kurtag: «A kis csava" op. 15b 261 Wolfgang Rlhm/Wolfgang Korb: Ein Gespräch
PFAU-Verlag • Postfach 102314 • D 66023 Saarbrücken • FonFax 0681 373471