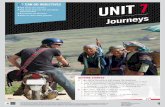\"Im Niemandsland: Dragomane und jóvenes de lenguas in der spanischen Botschaft von...
Transcript of \"Im Niemandsland: Dragomane und jóvenes de lenguas in der spanischen Botschaft von...
Ingrid Cáceres-Würsig
Im Niemandsland: Dragomane und „jóvenesde lenguas“ in der spanischen Botschaft vonKonstantinopel
Abstract: In 1782 Spain and the Ottoman Empire signed the first peace and tradetreaty, which led to the establishment of the first Spanish embassy in Constanti-nople. The author of the accord was Juan de Bouligny, a Spanish merchant ofFrench origin. The negotiations by Bouligny proved to be protracted and difficult.Among other things, communication with the Ottoman authorities was a majorobstacle, as they only dealt with foreign powers via so-called “dragomans”,namely certified interpreters with special privileges. This prompted Boulignysoon afterwards to hire foreign interpreters, even though they had traditionallybeen treated with suspicion of being unfaithful. This paper will examine andexplain the living conditions of the Spanish dragomans and their role in theinternational diplomacy of that period.
Keywords: Dragomane, Dolmetscher, spanische Diplomatie, Loyalität, Identität
DOI 10.1515/les-2014-0013
1 Einleitung
Die Sprachvermittlung zwischen Kulturen ist seit jeher eine Art der Kommunika-tion, die demMenschen eigen ist und deshalb einen wichtigen Teil unserer Gesell-schaft bildet. Ihr Ursprung liegt vorwiegend imHandel und im Krieg, aus dem sichdann weitere komplexere Beziehungen zwischen Völkern entwickeln, die wir als„internationale Beziehungen“ bezeichnen und die sich über andere Bereiche er-streckenwiedie Politik, die Kultur oder dieWissenschaft. Schonder lateinischeBe-griff „interpres“ (Dolmetscher) deutet auf die kaufmännische Herkunft der Sprach-vermittlung. „Interpres“ kann aus dem Begriff „inter partes“, d. h. „zwischen denParteien“ oder auch aus „inter-pretium“, „zwischen zwei Werten“ abgeleitet wer-den. Egal welche Version man vorzieht, wird auf die Rolle der Sprachmittler imGeschäft angespielt. Der Dolmetscher fungiert also in der Mitte bzw. an der Grenze
Ingrid Cáceres-Würsig: c/Trinidad, 3, 28801 Alcalá de Henares, Spanien,E
˗ Mail: [email protected]
Lebende Sprachen 2014; 59(2): 343–357
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
und ist geteilt zwischen zwei Parteien. Er muss vermitteln können, ein fähigerRedner sein und neutral im Mittelfeld bleiben, denn er gehört zu keiner Partei.
Ein Ort, wo sich im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Dolmetscher angesie-delt hatten, war Konstantinopel, der limes zwischen Osten und Westen oder Treff-punkt der Welt. Konstantinopel war nämlich seit dem 15. Jahrhundert der wich-tigste Handelsknoten zwischen den europäischen Mächten und dem Osten.Dolmetscher waren für den interkulturellen Handel unentbehrlich. Jene Dolmet-scher, die auf Sprachmittlung zwischen Westen und Osten spezialisiert waren,wurden „Dragomane“ genannt. Wie niemand anders verkörperten sie die Schnitt-stelle verschiedener Kulturen. Sie arbeiteten an der Grenze, einem zwiespältigenund unbekannten Gebiet ohne Machthaber, also in einem Niemandsland. DieEinstellung von loyalen Dolmetschern wurde für alle europäischen Mächte eineder wichtigsten diplomatischen Herausforderungen. Am Beispiel der spanischenBotschaft in Konstantinopel am Ende des 18. Jahrhunderts werde ich im Nach-folgenden die komplexe Aktivität der Dolmetscher als Teil der diplomatischenTätigkeit zu erklären versuchen.
2 Juan de Bouligny y Paret: der erste spanischeBotschafter in Konstantinopel
1778, nach Jahrhunderten der Konfrontation, hielt es das aufgeklärte Spanienunter Karl III., angeregt durch den Grafen von Floridablanca, für notwendig,Frieden mit der Hohen Pforte des Osmanischen Reiches zu schließen. Der spa-nische Monarch strebte eine Normalisierung der Beziehungen zum OsmanischenReich an, die es ihm erlauben würde, ohne Zwischenhändler mit den Osmanen imMittelmeerraum Geschäfte zu machen und die spanischen Flotten und Häfen vorÜbergriffen der Nordafrikaner zu schützen (Tabakoĝlu 2008:344). Konstantinopelwar das Zentrum der Levante, der wichtigsten Handelsregion, deren Routen dieMittelmeerküste mit den Ländern des Mittleren Ostens verbanden. Grund genugfür viele europäische Mächte, hier ansässig und vertreten zu sein.
Für diese schwierige Mission wählte man Juan de Bouligny y Paret aus,Sohn eines Franzosen und einer Spanierin, der sich in Alicante als Händlerniedergelassen hatte. Sein Beruf bot einen guten Vorwand, die geschäftlicheReise nach Konstantinopel zu rechtfertigen, die er 1779 antrat.1 So begannen
344 Ingrid Cáceres-Würsig
1 Alle Ausgaben für die Reise wurden von der spanischen Krone gezahlt. Bouligny erhieltEmpfehlungsschreiben für Venedig und Konstantinopel, insbesondere für den Kapitän Baxá
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
lange und schwerfällige Verhandlungen zwischen Bouligny und den osma-nischen Verwaltungsbehörden, die entgegen aller Abmachungen Spanien fürein Bündnis gegen Russland gewinnen wollten, welches durch seine Expansiondie osmanischen Grenzen bedrohte. Schließlich unterzeichnete man im Septem-ber 1782 den Tratado de Paz y Comercio, das Friedens- und Handelsabkommen,zusammen mit einem Neutralitätspakt, in dem die Türken zusicherten, FeindeSpaniens nicht zu unterstützen. Das Abkommen erlaubte auch dem spanischenMonarchen, Konsulate in den osmanischen Häfen zu errichten. Ferner regeltees, dass sowohl der Minister als auch seine Mitarbeiter (Konsuln, Dolmetscherund sonstige Angestellte) über die gleichen Rechte und Privilegien verfügenwürden wie die anderer Mächte, das heißt, sie würden alle Dekrete des Sultans,die sogenannten „firmanes“, erhalten und bekämen das „berat“ (ein Privileg,mit dem die ausländischen Minister nicht der Herrschaft des Sultans unterwor-fen waren, was auch die Befreiung von Steuern beinhaltete). Außerdem wurdedas Recht der ansässigen spanischen Händler und Vasallen vor der HohenPforte versichert, dass ihnen im Streitfall ein spanischer Dragoman zur Seitestehen müsse.
3 Die Einrichtung der spanischen Botschaft:Schwierigkeiten und Notwendigkeiten
Nach der Unterzeichnung des Abkommens konnte sich Bouligny in Konstantino-pel als „Gesandter und bevollmächtigter Minister seiner Königlichen Majestät“niederlassen. Das Ministerium von Bouligny wuchs schnell, und unter seinerLeitung wurde der spanische Handel gefördert, man unterstützte die Einrichtungvon spanischen Konsulaten in der Levante und pflegte eine Diplomatie, die aufNeutralität beruhte. Trotz alledem sah sich seine Mission ständig Hindernissenausgesetzt: Bouligny stand einer unbekannten Kultur gegenüber, die der spa-nischen vollkommen fremd war, er musste das Problem der Kommunikation mitden Türken lösen und die Pest und die häufigen Brände in Konstantinopelfürchten.2
Im Niemandsland: Dragomane und „jóvenes de lenguas“ 345
Hassan, beschützt durch Spanien, als er vor dem Bey von Algerien floh, der großen Einfluss in derRegion hatte. Vgl. AHN, Estado, leg. 3444–3. Familienakte von Juan de Bouligny.2 Konstantinopel war gefürchet wegen der Brände, die aufgrund des Holzes der Häuser aus-brachen, sowie wegen der Pest, die die Stadt häufig heimsuchte, bedingt durch die Mengeausländischer Seeleute, die Krankheitenmit sich trugen.
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
Um die Schwierigkeiten von Bouligny zu verstehen, ist es notwendig, kurzden Aufbau der osmanischen Gesellschaft zu erklären. Seit dem 16. Jahrhunderthatte es eine Migrationsbewegung von Händlern in die Levanteregion gegeben,insbesondere nach Konstantinopel, dem Knotenpunkt für Geschäfte zwischenEuropa, Asien und Afrika. Das osmanische Volk wurde zu einer multikulturellenund mehrsprachigen Gesellschaft, in der die Gemeinschaft der Muslime dieStaatsgewalt ausübte. Dazu existierten auch andere religiöse Gruppen, Gruppenanderer Sprachen und anderer Traditionen, wie die der „Griechen“, orthodoxeChristen, die alle Untertanen griechischer, rumänischer, serbischer und alba-nischer Herkunft umfassten. Weiterhin gab es auch die „Armenier“, monophysiti-sche Christen, die „sephardischen Juden“ überwiegend spanischer Herkunft undschließlich auch die sogenannten „Lateiner“ (katholische Levantiner, die dieNachkommenschaft von venezianischen, genuesischen und zyprischen Kaufleu-ten bildeten). Neben Türkisch, der offiziellen Amtssprache, verständigte man sichüber weite Teile auch auf Arabisch, ebenso wie auf Armenisch, Griechisch undItalienisch, sowie mittels einiger slawischer Sprachen und Persisch. (Groot 2005;vgl. auch Masters 2001).
Alle ausländischen Mächte bedurften eines diplomatischen Netzes für dieBeziehungen und Verhandlungen mit der Verwaltungsbehörde des Sultans (Mas-ters 2001:70–71). Die Menge der Sprachen, derer man sich bediente, sowie derUmfang an benötigter Übersetzung und direkter Sprachmittlung im Gesprächließen die Gestalt des Dragomans3 aufkommen. Die Aufgabe des Dragomansbestand darin, in geschäftlichen und diplomatischen Aufeinandertreffen undÜbergaben zwischen den europäischen Ländern und der Levante zu vermitteln,was nicht nur eine ausgezeichnete Kenntnis des Türkischen, des Arabischen undder verbreitetsten europäischen Sprachen (Französisch und Italienisch) voraus-setzte, sondern auch außerordentliche Verhandlungsfähigkeiten verlangte. Au-ßerdem besaßen sie ein breites Wissen über die Kultur und Wirtschaft der isla-mischen Länder, was wiederum Kenntnisse in der Buchhaltung mit einschloss,die notwendig waren, da das Geschäft auf Verhandlungen beruhte.
Schon im 16. Jahrhundert griffen die westlichen Mächte, die vor der HohenPforte vertreten waren – Venedig, Frankreich, die Niederlande und England –fast immer auf die ortsansässigen Dragomane zurück, die in der Regel sephar-dische Juden oder katholische Lateiner waren. Es waren die Gruppen, die ausihrer Familientradition heraus oftmals schon Erfahrungen im Handel gesammelt
346 Ingrid Cáceres-Würsig
3 Dragoman ist die türkische Variante des arabischen Begriffs „trujamán“, der sich seinerseitsaus dem Aramäischen „meturquemán“ ableitet. Der „meturquemán“ war der Sprachmittler, derdie Predigten in den Synagogen aus dem Hebräischen ins Aramäische (der Volkssprache) wieder-gab.
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
hatten und dazu neigten, sich mit den Ausländern zu vermischen, sodass sie einemehrsprachige Kultur pflegten. Diese Juden und Lateiner (auch bekannt unterder allgemeinen Bezeichnung „francos“) spezialisierten sich auf die Vermittlungim Handel und in der Diplomatie. Sie wussten die natürliche Spannung, diezwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen bestand, für sich aus-zunutzen, denn sie waren frei von der Angst, die das unbekannte Andere her-vorrief. Dank ihrer breiten Kenntnis des Fremden war es den „francos“ möglich,Vorurteile zu überwinden und den unwirtlichen Ort, die Grenze, sich zu eigen zumachen. Die europäischen Botschafter mussten diesen Personen vollkommenvertrauen, da auf ihnen der ganze Erfolg oder Misserfolg der Handels- undDiplomatiemissionen ruhte. Die Tätigkeit der Dragomane erreichte größere Kom-plexität im 17. und 18. Jahrhundert, als sich weitere europäische Mächte inKonstantinopel vertreten ließen: die Habsburgermonarchie, Russland, Preußen,Spanien und Dänemark.
Die lokalen Dragomane waren nichtislamische Untertanen des Sultans, diein ihrer Eigenschaft als Angestellte einer ausländischen Botschaft seinenSchutz genossen und das Recht auf ein „berat“, das oben erwähnte Privileghatten. Die Tatsache, dass die Dragomane sowohl im Dienste der osmanischenals auch der europäischen Interessen standen (einige wurden gewissermaßenzu Doppelagenten), weckte schnell Misstrauen. Da sie sich nicht zur isla-mischen Religion bekannten, konnten sie sich nicht vollständig in die osma-nische Gesellschaft integrieren. Man hielt sie für verwestlicht, weshalb sie inWirklichkeit nicht so einfach ein „berat“ bekamen. Die osmanischen Beamtenbetrachteten sie mit Argwohn und legten ihnen für die Erteilung eines Patentseine Menge Hindernisse in den Weg, sodass die Dolmetscher sie bestechenmussten, um die begehrte Lizenz zu erhalten. Die Dragomane, insbesonderedie katholischen Lateiner, wurden auch gezwungen für das „berat“ ihre Kon-fession aufzugeben.
Im Gegensatz dazu glaubten die europäischen Botschaften, in den Drago-manen übermäßige orientalische Charakterzüge und Eigenheiten zu erkennen.Dass sie Bestechung betrieben, ihren Glauben ablegten und für verschiedeneBotschaften arbeiteten, setzte sie ungeheuren Verdächtigungen aus. Deshalbbegannen die westlichen Mächte Dolmetscher in ihren eigenen Kaderschmiedenauszubilden, das heißt, sie schickten Kinder oder Jugendliche aus ihrem eige-nen Land in die Levante, damit sie dort in situ die örtlichen Sprachen unddiplomatischen Regeln lernten. Man erhoffte sich davon, den späteren Drago-manen von klein auf die nötige Loyalität zur Krone oder Obrigkeit, die sie in derZukunft vertreten würden, anzuerziehen. In Frankreich waren diese Jugend-lichen die „jeunes de langues“, in Venedig nannte man sie „giovani di lingua“,in Österreich die „Sprachknaben“ und für die Spanier waren sie die „jóvenes de
Im Niemandsland: Dragomane und „jóvenes de lenguas“ 347
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
lenguas“. Am meisten verbreitet war die französische Bezeichnung „jeunes delangues“.4
Nichtsdestotrotz war die Ausbildung der eigenen Dolmetscher eine langwie-rige und komplizierte Sache, die (wie im Falle von Frankreich und Österreich) zurBildung von Schulen führte und die verschiedenen Modellen folgen konnte. Esgab jene Bildungsmodelle, die das Lernen im Ausgangsland unterstützen. Anderebevorzugten die Ausbildung im Ausland in der Botschaft selbst. Zum Schluss gabes auch gemischte Bildungssysteme.
Schauen wir uns im Folgenden das Beispiel der spanischen Botschaft an. Fürden zweckmäßigen Aufbau musste die Botschaft von Bouligny zwangsläufig eineigenes Team von Dragomanen anstellen. Zudem war es erforderlich, ein Bot-schaftsgebäude im Stadtviertel Pera, im höher gelegenen Konstantinopel, zuerwerben,wo die Luft sauberer war undwo sich der ausländische Kern befand. Aufdiese Weise versuchte man, der gefürchteten Pest und den häufigen Bränden zuentgehen. Die Tatsache, dass die Europäer ähnliche Werte, Sprachen und diplo-matische Praktiken teilten, veranlasste sie, sich am selben Ort niederzulassen undsich gegenseitig Unterstützung zukommen zulassen. Der Sultan verfügte unteranderem, dass die ausländischen Botschaften von sechs Janitscharen bewachtwerden sollten, was eine beträchtliche Mehrausgabe bedeutete. Ferner musstenausländische Botschaften die türkische Buchhaltung führen, die „tain“ genanntwurde. Außerdem war es noch notwendig, über zwei Boote zu verfügen, mit de-nen man die Kanäle befuhr: ein großes zu offiziellen Kontakten mit der Ho-hen Pforte und ein kleineres, das geheimen und unbekannten Treffen diente, dieauf dem Kanal stattfanden. In Übereinstimmung mit den im Archiv eingesehe-nen Dokumenten, zählte die spanische Botschaft ungefähr 25 Angestellte (AHN,Estado:3444-3). Alle diese Details geben uns eine Vorstellung von der Einzigartig-keit und die Komplexität der ausländischen Botschaften in Konstantinopel.
4 Der Kulturschock und das Osmanenbild derspanischen Diplomaten
Über den Kulturschock Boulignys und seiner zwei ältesten Söhne, José Elidoround Juan Ventura, die ihm in der Botschaft halfen (insbesondere ersterer), besit-zen wir interessante Zeugnisse aus dem umfassenden Schriftwechsel Boulignys
348 Ingrid Cáceres-Würsig
4 Vgl. Cáceres-Würsig, Ingrid (2012): “The jeunes de langues in the eighteenth century: Spain’sfirst diplomatic interpreters on the Europeanmodel.” Interpreting, 14 / 2, 127–143.
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
mit dem spanischen Hof, der im Archivo Histórico Nacional (Historisches Natio-nalarchiv) in Madrid aufbewahrt wird. Keiner der Boulignys zeichnet ein positivesBild, weder von den osmanischen Autoritäten noch von deren Gesellschaft. Ineinem Brief von Juan de Bouligny an den spanischen Außenminister Graf vonFloridablanca, in dem über die Notwendigkeiten beim Aufbau der spanischenBotschaft berichtet wird, äußert dieser die Einschätzung, dass Konstantinopel imUnterschied zu anderen Höfen insofern ungewöhnlich sei, als dass es hier be-sonderer Vorsichtsmaßnahmen bedürfe.5 Seiner Meinung nach seien die Osma-nen nur motiviert, wenn es um einen finanziellen Vorteil für sie gehe, weshalb esständige kleine Bestechungen erfordere, um die Hilfe der Untertanen des Sultanszu bekommen. Er kritisiert die Türken auch wegen ihrer Oberflächlichkeit, denn
… solo juzgan materialmente un Ministro Estrangero [por lo que] debe observar ciertoexterior y Grandeza sin la qual no se le considera en nada ni se le distingue del común desus nacionales, el Fausto y brillantez es lo que solo le acredita acerca de esta nación y no sucarácter como en las demás Cortes.
… sie beurteilen einen ausländischen Minister dem Aussehen nach [weshalb] man sehr aufdas Äußere und die Würde achten muss, ohne die letztere sie niemanden respektieren, nochvon der Allgemeinheit seiner Landesgenossen unterscheiden. Der Prunk und der Glanz sinddas, was Ansehen verleiht in dieser Nation, nicht wie an den anderen Höfen der Charakter.
Ganz ähnlich ist auch die Ansicht seines Sohnes José Eliodoro, des Sekretärs desMinisteriums, der einen sehr interessanten Bericht über das politische System derOsmanen verfasste (AHN, Estado: leg. 4723).6 Um einen Eindruck von der Ableh-nung der osmanischen Regierung gegenüber den Spaniern zu bekommen, reichtes aus, einen Blick ins vierte Kapitel des genannten Berichts zu werfen, das denTitel „Von der Haltung, mit denen die Ministerien der Hohen Pforte den Aus-ländern begegnen, und dem persönlichen Umgang“ trägt. In ihm warnt EliodoroBouligny vor der Gewalttätigkeit der Türken, ihrer Verachtung gegenüber denausländischen Ministern, ihrem übermäßigen Stolz, der es dem Sultan versage,den ausländischen Ministern direkte Audienzen zu gewähren, ihrer Prahlerei,ihrem korrupten Charakter, ihrem übermäßigen Gefallen am Geld, dem Glanz undPrunk ihres „gekünstelten und verworrenen Kabinetts“.
Der zweite Sohn Boulignys, Juan Ventura, schreibt auch einen Bericht überden Handel in Konstantinopel und in der Levante (28. Juli 1785, Estado: leg. 4755).Die Kritik richtet sich in diesem Fall eher gegen die Juden, Armenier und Grie-
Im Niemandsland: Dragomane und „jóvenes de lenguas“ 349
5 Estado, leg. 4761. Brief von Bouligny an Floridablanca vom 10. Juli 1783.6 Der Bericht ist folgendermaßen betitelt: Observaciones sobre el sistema Político de la PuertaOttomana respecto al trato que observa con las demás Cortes. con otras particularidades relativas almismo asunto. Er enthält 6 Kapitel. 15. Mai 1786.
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
chen. Er erklärt, dass die armenischen und griechischen Handelshäuser für dieeuropäischen Mächte arbeiteten, um deren Schutz zu erhalten und somit diesteuerlichen Vorzüge des „berats“ zu genießen. Aufgrund der Unterschiedlichkeitder Gebräuche und der Angst vor der Pest handelten die Ausländer nicht direktmit den Türken. So waren es die Juden, die das Verkaufsmonopol für Handels-waren innehatten, denn der Kauf und Verkauf vollzog sich unter ihrer Vermitt-lung, dank eines weiten Netzes in der ganzen Levante. Die Zölle waren auch inder Hand der Juden, indem sie die Gebühren einnahmen.
Insgesamt erschien die osmanische Kultur in den Augen der Spanier (undauch der restlichen Europäer) prahlerisch, oberflächlich, überheblich, verdorben,verworren und durch ihre Gebräuche bestimmt, sowie – verglichen mit der spa-nischen Mentalität – viel zu sehr aufs Geld fixiert. Man hielt die Gesellschaft fürnicht zivilisiert. Als Bouligny ankam, warnten ihn die anderen Botschafter schonvor den Dragomanen und dem schwierigen Umgang mit den Osmanen, wie es ausdem Briefwechsel hervorgeht. Damit war bereits ein negatives Bild von denOsmanen verbreitet, und die Familie Bouligny bekräftigte dieses Bild mit ihrenBerichten, die sie nach Madrid sandte.
5 Die Anstellung der Dolmetscher und der„jóvenes de lenguas“: das Dilemma zwischenBerufserfahrung und Loyalität
Wie bereits vorweggenommen, war die Anstellung von Dolmetschern unerläss-lich für jedes ausländische Ministerium in Konstantinopel. Es gibt auch Zeugnissein der Korrespondenz Boulignys, die Aussagen zur Wichtigkeit der Dragomanetreffen. Bouligny hält den Dolmetscher für „den wichtigsten Untergebenen einesjeden Ministers an jenem Hofe“ (AMAE, Personal: exp. 087621). In einem anderenBrief an den Grafen von Floridablanca hebt er einmal mehr das Gewicht und denEinfluss der Dragomane hervor:
El segundo objeto que merece la atención de un Ministro (…) es el establecimiento de losDragomanes por ser los conductos por donde pasan de precisión todos los negocios de laMision: No se podrán jamás tomar demasiadas medidas para formar este establecimientocon la solidez que se requiere para que resuelven los fines tendientes a que los Dragomanessalgan abiles y celantes al servicio de la misión. Un Ministro estrangero, si no es en los casosurgentes no trata jamás directamente con este Ministerio y en estos mismos casos siempre seve obligado a valerse de un Dragoman.7
350 Ingrid Cáceres-Würsig
7 Bouligny an Floridablanca, 10. Juli. AHN, Estado, leg. 4761.
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
Der zweite Gegenstand, der die Aufmerksamkeit eines Ministers verdient (…) ist die Auf-stellung der Dragomane, denn sie sind es, über die notwendigerweise alle Geschäfte einerMission laufen: Man wird niemals zu viele Maßnahmen ergreifen können, um diese Einrich-tung mit der Hartnäckigkeit aufzubauen, derer es bedarf, um das angestrebte Ziel, dassnämlich fähige und vertrauliche Dragomane zum Dienste der Mission hervorgehen, zuverwirklichen. Ein ausländischer Minister hat niemals direkte Beziehungen zu diesemMinisterium, es sei denn in dringenden Angelegenheiten, und in eben diesen Fällen sieht ersich gezwungen, auf einen Dragoman zurückzugreifen.8
Am Anfang musste Bouligny die Dienste ausländischer Dragomane sowie nichtislamischer Türken und Italiener in Anspruch nehmen. Im Konkreten zählte diespanische Botschaft drei Dragomane: einen „dragomán de la Puerta“ (Dragomander Pforte), der in allen Angelegenheiten als außenstehender Mittelsmann zwi-schen der Botschaft und den Ministern der Hohen Pforte auftrat. Für diesenPosten wurde Giacomo Talamas, ein Dragoman, der vorher für Frankreich imHeiligen Land (Jerusalem) diente, eingestellt. Der zweite Dragoman, der „drago-mán de Palacio“ (Dragoman am Palast) war der Beauftragte für botschaftsinterneFragen und derjenige, der alle Übersetzungen überprüfte. Hierbei handelte essich um Cosme Comides Carboñano,9 einen Türken armenischer Herkunft miteinem hispanisierten Namen, der schon als erster Dragoman in der Gesandtschaftvon Neapel gearbeitet hatte.10 Das Fachgebiet des dritten Dragomans war das desZolls und der Marine und wurde Francisco Talamas, dem Sohn des schon er-wähnten Giacomo Talamas, anvertraut. Gleichwohl wird kein Dragoman erwähnt,der an den Gerichten teilnahm, wie es eigentlich üblich war (Jurado Aceituno2002:231–233).
Bouligny war sich der Tatsache bewusst, dass die gesamte Kommunikationmit der Hohen Pforte in den Händen von Ausländern lag, weshalb er in mehrerenBriefen an Floridablanca die Entsendung von „jóvenes de lenguas“, dem Beispielanderer Mächte (Venedig, Frankreich und Österreich) folgend, ersuchte. In sei-nem Schriftverkehr mit Floridablanca wies er auf die Schwierigkeit hin, Spanierzu finden, die mit der türkischen Gesellschaft vertraut seien:
No se puede dudar que los Jovenes nacionales llenarían con mas eficacia y mayor celo losdeberes de su encargo, pero hay el inconveniente de que estos dificilmente se puedenacostumbrar al trato singular de estos Turcos, en lugar que a los de este Pahiz el dicho tratoles viene natural y les es mas fácil el introducirse en las lenguas orientales. Las demás
Im Niemandsland: Dragomane und „jóvenes de lenguas“ 351
8 Bouligny an Floridablanca, 10. Juli 1783. AHN, Estado, leg. 4761.9 Für die philologische Arbeit von Comidas, vgl. Artikel von Jurado.10 Er kam nach Konstantinopel mit einer Empfehlung dank eines Abkommens zwischen Neapel/Sizilien und der Türkei, der von Karl VII, König von Neapel/Sizilien (der spätere Karl III vonSpanien), unterzeichnet wordenwar.
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
Misiones establezidas se proveen de Dragomanes para su servicio, con el establecimiento deJovenes de Lenguas naturales y del pahiz. (…) Es menester observar que hayan hecho susestudios, a lo menos que sean buenos gramáticos y buenos retoricos, y si han estudiado lafilosophia tanto mejor.11
Man kann nicht daran zweifeln, dass die nationalen jóvenes den Pflichten ihrer Arbeit mitmehr Leistung und größerem Eifer nachgehen würden, leider gibt es das Hindernis, dass siesich nur schwer an den besonderen Umgang mit diesen Türken gewöhnen können, imGegensatz dazu kommt es denjenigen aus diesem Land als natürlich vor und macht es ihneneinfacher, in die orientalischen Sprachen einzudringen. Die anderen aufgenommenen Mis-sionen verfügen über Dragomane zu ihrem Dienste, mit der Aufnahme von „jeunes delangues“, die ursprünglich auch aus dem Land sind. (…) Es ist zu beachten, dass sie ihrStudium abgeschlossen haben, oder wenigstens gute Grammatiker und Rhetoriker sind, undwenn sie auch noch Philosophie studiert haben, umso besser.12
In dem schon erwähnten Bericht von José Eliodoro über das politische System derOsmanen werden auch die Eigenschaften beschrieben, die ein Dolmetscher insich vereinen sollte und man betont hier die Notwendigkeit, nationale Dolmet-scher auszubilden. Die Empfehlungen, die Eliodoro gibt, sind die folgenden:– Die Minister sollten Türkischkenntnisse haben, um zu überprüfen, ob die
Dolmetscher getreu übersetzen, sie selbst sollten eingreifen, wenn ihnen dieÜbersetzung eines Wortes falsch erscheint.
– Die Dolmetscher müssen sich in den Geist der Rede hineinversetzen, einegute Sprachfähigkeit und perfekte Kenntnisse des Türkischen, Arabischen,Persischen, Italienischen und Französischen vorweisen. Sie sollten scharf-sinnig sein und die jeweiligen politischen Interessen kennen.
José Eliodoro hält es für sehr schwer, Dragomane zu finden, die alle dieseEigenschaften besitzen, weshalb es unerlässlich sei, Schulen für die Ausbildungvon Dolmetschern zu schaffen. Er übt Kritik an den örtlichen Dragomanen, denn:
… son naturales del Imperio Ottomano protectos de las respectivas Cortes pero educados enestos países y con familias, de manera que además de la veneración natural por el Sultan sueducación es correspondiente a su nacimiento servil y oprimido; es natural que personas deeste origen soliciten igualmente la benevolencia de los Turcos que siempre les miran comoRayás13 y les tratan en consecuencia, por eso no llenan a menudo, con verdadero zelofirmeza y consequencia los deberes de su empleo, solicitando dadivas para los Ministros dela Puerta y sacrificando en un lanze critico los intereses de su Corte por no comprometer supersona o bienes. Sera siempre acertada política de las Cortes extranjeras de emplear
352 Ingrid Cáceres-Würsig
11 AHN, Estado. Leg. 4761, Bouligny an Floridablanca, 10. Juli 1783.12 AHN, Estado. Leg. 4761, Bouligny an Floridablanca, 10. Juli 1783.13 Arabischer Begriff, der für „Untertan“ steht.
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
nacionales, que por ley de naturaleza de origen y costumbres se empeñaran con todo zelo alservicio de su patria sin reparar en la seguridad de sus familias protegidas por la clemenciadel soberano.14
… sie haben ihre Wurzeln im Osmanischen Reich, sind geschützt durch die jeweiligen Höfeund wurden in eben diesen Ländern und mit diesen Familien erzogen, sodass zu dernatürlichen Ehrfurcht vor dem Sultan eine Erziehung hinzukommt, die zu ihrer kriecherischunterwürfigen Natur passt. Es ist normal, dass ebenso Menschen dieser Herkunft das Wohl-wollen der Türken suchen, welche sie immer als „Rayás“ [Untertanen] ansehen und siedementsprechend behandeln, deshalb erfüllen sie oftmals nicht die Pflichten ihrer Funktionmit der richtigen zielstrebigen Hartnäckigkeit und Konsequenz, stattdessen erbitten sie fürdie Minister der Hohen Pforte Gaben und opfern die Interessen ihrer Höfe in fragwürdigerWeise, nur um ihre Person und ihr Vermögen nicht zu gefährden. Es wird die richtige Politikfür die ausländischen Höfe sein, Angehörige des eigenen Landes anzustellen, die bedingtdurch das Naturgesetz der Herkunft und der Gebräuche ihren ganzen Eifer für den vaterlän-dischen Dienst aufbringen, ohne Rücksicht nehmen zu müssen auf die Sicherheit derFamilien, die dank der Nachsicht des Monarchen geschützt sind.15
Als Ergebnis der ständigen Gesuche Boulignys ernennt der Graf von Floridablan-ca am 29. März 1784 José Martínez de Hevia zum Gehilfen des Sekretariats dertürkischen Gesandtschaft mit dem Auftrag „sich selbst in aller Perfektion in dertürkischen und französischen Sprache zu unterrichten, auf dass er sie versteheund in gewählter Ausdrucksweise auch spreche und schreibe.“ (AHN, Estado: leg.3427). Bei dieser Ernennung kommen auch Informationen zur Sprache, die dieBeziehung zwischen den „jóvenes“ und ihren Vorgesetzten betreffen: die „jóve-nes“ sind völlig vom Botschafter abhängig, leben in seinem Haus und essen amselben Tisch mit ihm. Sie erhalten einen Lohn von 60 „reales de vellón“ (spa-nische Münze) und eine „Überfahrtshilfe“ (das heißt Geld, um die Reise zumachen). Hevia besorgt man eine Überfahrt mit dem Schiff, das von Cádizabfährt. Ihm wird versichert, dass er auf dem Schiff genauso eine Behandlungerfährt wie die Frau und die Familie des Botschafters. Schließlich verpflichtet sichder Botschafter, den König über die Fortschritte der „jóvenes“ zu informieren.
Kurz nach seiner Ankunft in Konstantinopel starb Martínez de Hevia im Altervon 25 Jahren an der Pest. Der nächste „joven de lenguas“, der zur spanischenBotschaft in Konstantinopel entsandt wurde, war Juan Montengón. Er wurde imApril 1785 ernannt, also ein Jahr nach Hevias Bestellung. Montengón erwies sichals nicht besonders talentiert für den Erwerb des Türkischen und Griechischen,dennoch hielt ihn Bouligny trotzdem für nützlich, um den Schriftverkehr mit denspanischen Vizekonsuln, die von ihm abhängig waren, zu pflegen, sodass Mon-
Im Niemandsland: Dragomane und „jóvenes de lenguas“ 353
14 AHN, Estado, leg. 4723, “Observaciones políticas de José Eliodoro”.15 AHN, Estado, leg. 4723, “Observaciones políticas de José Eliodoro”.
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
tengón weiterhin im Sekretariat der Botschaft angestellt wurde (AMAE, Personal:exp. 08761). Im Juni 1792 wurde er wegen Krankheit nach Spanien zurück-gesandt.
Von den Konflikten, die zwischen den örtlichen Dragomanen und den Minis-tern auftraten, besitzen wir ein Beispiel aus der spanischen Botschaft: Der schonerwähnte Dragoman Talamas trat 1787 zurück, ohne Bouligny die Gründe seinerEntscheidung zu erklären, die er als privat bezeichnete und die nur den spa-nischen Hof etwas angingen. In Wirklichkeit schickte er einen Brief auf Italienischan Floridablanca, in dem er die ihm widerfahrene Behandlung durch die Spanierin der Botschaft beklagte. Die Gründe, die er hier anführte, waren der Mangel anAnerkennung für seine Arbeit, Verachtung und Demütigungen.16 Als Boulignydavon erfuhr, ließ er Talamas verfolgen und beschuldigte ihn, mit anderenPalästen zu verkehren, Βestechungen angenommen und die spanischen Interes-sen nicht angemessen vor der Hohen Pforte vertreten, sondern sich auf ihre Seitegestellt zu haben.17 Man entzog daraufhin Talamas das „berat“ und verbot ihm,sich vor der Hohen Pforte als Vertreter des spanischen Botschafters zu präsentie-ren. Kurze Zeit später wurde er ersetzt durch einen anderen Dragoman italie-nischer Herkunft, Henrique Giuliani, den Bouligny als „jung, aber frei und auseiner anerkannten Franco-Familie, guter Erziehung und angenehmen Beneh-mens“18 beschrieb. Es ist hervorzuheben, dass der spanische Minister keine Ver-geltungsmaßnahmen gegen den Sohn von Talamas ergriff, der weiterhin seineArbeitsstelle als Dragoman für die Zölle behielt.
Aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit ausländischen Dragomanenversuchte Bouligny eine spanische Schule für „jóvenes de lenguas“ in Konstanti-nopel zu gründen, in Anlehnung an die Bildungsstätten von Frankreich und derk.u.k. Monarchie, aber sein Ersuchen war nicht fruchtbar. Das Projekt einereigenen Dolmetscherschule schien in Augen der spanischen Krone wahrschein-lich zu teuer, da man dazu ein Gebäude brauchte, Lehrer zahlen und die Auf-enthaltsausgaben der Knaben bzw. Jugendlichen in Konstantinopel bestreitenmusste.19 Der Mangel an Sprachexperten in orientalischen Sprachen wird auchoffenbar, als Miguel Casiri, der wichtigste spanische Arabist und Übersetzer derspanischen Verwaltung, in Madrid stirbt. Um seinen Posten zu besetzen, mussteder Minister Floridablanca die Hilfe Boulignys ersuchen. So kam nach Madrid einPriester aus Aleppo, der in Konstantinopel als Dolmetscher tätig war, namens
354 Ingrid Cáceres-Würsig
16 AHN, Estado, leg. 4742. Talamas an Floridablanca, 15. Oktober 1787.17 AHN, Estado, leg. 4742. Bouligny an Floridablanca, 1. März 1788 und Bouligny an Florid-ablanca, 16. Oktober 1787.18 AHN, Estado, leg. 4742, Bouligny an Floridablanca, 16. Oktober 1787.19 Vgl. Cáceres-Würsig, Ingrid (2012): “Op. cit.”, 127–143.
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
Elias Scidiac. Scidiac hatte im Jesuitenkolleg Propaganda Fide in Rom studiert,was immerhin seine katholische Konfession garantierte. Der spanischen Verwal-tung war es also noch nicht gelungen den nötigen Übersetzer-Nachwuchs imBereich der orientalischen Sprachen auszubilden, da wieder auf einen Ausländerzurückgegriffen wurde.
Die Fortschritte im Bereich der Professionalisierung der spanischen Diploma-tie, einschließlich der Bildung von Übersetzern und Dolmetschern, wurden durchden Feldzug Napoleons auf der Iberischen Halbinsel 1808 unterbrochen. Spanienversank in ein Chaos, der alle Bereiche der Gesellschaft betraf, insbesondere dieVerwaltung. Durch eine Verordnung des neuen französischen Königs José Bona-parte konnten die spanischen Beamten ihre Stellen behalten, aber viele patrioti-sche Angestellte emigrierten oder schlossen sich der Junta Suprema Central inSevilla an, um gegen die Franzosen zu kämpfen.
6 Schlussfolgerungen
Wie wir gesehen haben, waren die Dragomane die Schlüsselfiguren in der Diplo-matie zwischen dem Osten und dem Westen. Alle vor der Hohen Pforte ansässi-gen europäischen Mächte hatten Schwierigkeiten damit, fähige Dolmetscher zufinden, die gleichzeitig hinsichtlich der politischen Interessen auch loyal waren.Den sephardischen Dragomanen vertraute man nicht wegen ihrer Religion, denlateinischen nicht wegen ihres Dienstes für verschiedene europäische Häuser. Esgab viele Geheimnisse, die ein Dragoman bewahren konnte, und sein Einflusswar zudem nicht zu unterschätzen. Den Osmanen waren sie auch verdächtigwegen der westlichen Gebräuche, die sie pflegten, wegen der nichtislamischenReligionen, zu denen sie sich bekannten und wegen der übermäßigen Ver-mischung mit den Ausländern. Weder die Europäer noch die Osmanen trautenihrer Unparteilichkeit, denn zu welchem Land und zu welcher Krone gehörtensie? Wem galt ihre Loyalität?
Zweifelsohne profitierten viele von der Situation, indem sie als Doppelagen-ten und Nutznießer der begehrten „berats“ wichtige wirtschaftliche Interessenvertraten, während sich andere jedoch sicherlich nur ihrem Beruf als Mittlerverpflichtet fühlten. Ihre vielfältigen Wurzeln machte sie zu Heimatlosen, derenZufluchtsort ihr Beruf war. Sie wussten, dass sie im Niemandsland waren. Ausihnen gingen ganze Geschlechter und Familien von Dolmetschern hervor, denendie Fähigkeit zur Vermittlung und Verhandlung, die sprachlichen Kompetenzenund das kulturelle Gemenge praktisch vererbt wurden. Es ist nicht verwunderlich,dass diese Dragomanen-Familien mit großer Selbstverständlichkeit die europäi-schen „jeunes de langues“ aufnahmen. Diese kamen nach oft langen und zwi-
Im Niemandsland: Dragomane und „jóvenes de lenguas“ 355
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
schenfallreichen Reisen in sehr jungem Alter nach Konstantinopel, sie hatten sichvon ihren Familien trennen müssen und waren nun Entwurzelte, die ihrer trauri-gen Sehnsucht in einer fremden Kultur ausgesetzt waren. Sie hatten Angst vor derPest und vor den Bränden. In den Dragomanen, die ihnen Türkisch und Arabischbeibrachten, fanden sie die nötige Verbindung zu der Kultur, die sie sich zu eigenmachen sollten. So war es nicht selten, dass die europäischen „jeunes de langu-es“ die Töchter von Dragomanen heirateten, mit welchen sie im Türkischunter-richt in Kontakt kamen. José Eliodoro Bouligny beispielsweise heiratete TeresaTimoni, die Tochter des Dragomans der russischen Botschaft. Es bleibt festzustel-len, dass es einigen „jeunes de langues“ nicht gelang, derartige sprachlicheFähigkeiten zu entwickeln (wie Juan Montengón), andere starben (wie Martínezde Hevia), andere wiederum hielten es in der fremden Kultur nicht mehr aus undbaten darum, wieder in die Heimat entlassen zu werden. Einigen wurde anderer-seits vorgehalten, sich zu sehr der osmanischen Kultur anzupassen.
All das zeigt, dass es für die europäischen Mächte eine mühsame Aufgabewar, Dolmetscher zu finden, die einerseits Loyalität zur Krone bewiesen und überdie berufsnotwendigen Eigenschaften verfügten. Die École des langues orientalesvivantes in Paris oder die Kaiser-königliche Akademie für Orientalische Sprachen inWien entstanden als Reaktion auf diesen Mangel an fähigen Personen undwidmeten sich der Ausbildung künftiger Dolmetscher. Kurzzeitig beabsichtigteauch Spanien eine solche Schule für die Ausbildung von Dolmetschern zu schaf-fen, machte es dann aber doch nicht. Man folgte vielmehr dem venezianischenModell, den Nachwuchs in demselben Wohnort des Botschafters unter der Auf-sicht eines türkisch-arabischen Lehrers auszubilden, was eine sehr viel güns-tigere und weniger komplizierte Lösung war als die Gründung einer Schule –allerdings ohne jeden Zweifel auch eine weniger effektiver.
Danksagung: Mein herzlicher Dank geht an Tobias Borchert für die Hilfe bei derÜbersetzung dieses Aufsatzes ins Deutsche.
Literaturverzeichnis
PrimärliteraturArchivo Histórico Nacional (AHN)
Estado
Leg. 3427, expediente personal de José Martínez de Hevia.Leg. 3444, expediente familiar de Juan Bouligny.
356 Ingrid Cáceres-Würsig
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM
Leg. 4723 Bouligny. Encargado de Negocios en Constantinopla y Parma.Leg. 4742 Bouligny. Encargado de Negocios en Constantinopla y Parma.Leg. 4755 Bouligny. Encargado de Negocios en Constantinopla y Parma.Leg. 4761 Bouligny. Encargado de Negocios en Constantinopla y Parma.
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAAEE)
Personal
Expediente 087621, Lorenzo Mabily y Bouligny.
Artículos de Paz y Comercio ajustados con la Puerta Otomana en Constantinopla a 14 deSeptiembre de 1782 por el Ministro Plenipotenciario de S.M. El Sr. D. Juan de Bouligny y el de lamisma Puerta El Haggy Seid Muhamad Baxá, Gran Visir, en virtud de los plenos-poderes que secomunicaron y cangearon recíprocamente: Cuyos Artículos fueron ratificados por el Rei NuestroSeñor en 24 de Diciembre de 1782, y por la Puerta en 24 de Abril de 1783. Imprenta Real, 1783
Sekundärliteratur
Badorrey Martín, Beatriz (1999): Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores (1714–1808).Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Cáceres-Würsig, Ingrid (2012): “The jeunes de langues in the eighteenth century: Spain’s firstdiplomatic interpreters on the European model.” Interpreting, 14/2, 127–143.
Groot, Alexander H. de (2005): “Die Dragomane 1700–1869. Zum Verlust ihrer interkulturellenFunktion.“ Kurz, Marlene/Scheutz, Martin/Vocelka, Karl/Winkelbauer, Thomas (2005)(Hrsg.): Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie. Akten des InternationalenKongresses zum 150-jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor-schung, Wien, 22.–25. September 2004. Wien/München: Oldenbourg Verlag (Mitteilungendes Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Ergänzungsband 48), 473–490.
Jurado Aceituno, Antonio (2002): “El dragomán como filólogo: algunos ejemplos.” Asuero, PabloMartín (2002) (Hrsg.): España-Turquía. Del enfrentamiento al análisis mutuo. Actas de las IJornadas de Historia organizadas por el Instituto Cervantes de Estambul en la Universidaddel Bósforo los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Estambul: Editorial Isis, 229–252.
Masters, Bruce (2001): Christians and the Jews in the Ottoman Arab World. The Roots of Secta-rianism. Cambridge University Press.
Ozanam, Didier (1998): Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle. Introduction et répertoirebiographique (1700–1808). Madrid-Bordeaux: Casa de Velázquez. Maison de Pays Ibéri-ques.
Tabakoğlu, Hüseyin Serdar (2008): “The impact of the French revolution on the Ottoman-Spanishrelations”. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature andHistory of Turkish or Turkic, 3/1, 335–354.
Im Niemandsland: Dragomane und „jóvenes de lenguas“ 357
Authenticated | [email protected] author's copyDownload Date | 10/21/14 10:15 PM

















![Ana Verde Casanova: "Europäische Kolonien und ihre Kulturen: Iberoamerika und die Philippinen" [aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt und redigiert], in: Köpcke, Wulf & Bernd](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631b7dca93f371de1900fac3/ana-verde-casanova-europaeische-kolonien-und-ihre-kulturen-iberoamerika-und-die.jpg)