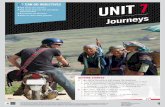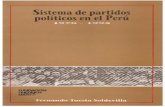Kleine Sprachen: Färöisch, Isländisch, Nordfriesisch 1995
-
Upload
uni-hamburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Kleine Sprachen: Färöisch, Isländisch, Nordfriesisch 1995
Studia N ordica International Contributions to Scandinavian Studies/ Internationale Beiträge zur Skandit1avistik
Editor: Ernst Häkon Jahr
1. Kurt Braunmüller: Beiträge zur skandinavistischen Linguistik. 1995.
Kurt Braunmüller
Kurt BraulUllüller
BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTISCHEN LINGUISTIK
a) NOVUS FORLAG - OSLO 1995
senschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Bereich 11, Berlin (DDR), März 1977 (interne Publikation). (1978): "Ways of morphologizing phonological rules". Historical morphology ijacek Fisiak, ed. 1980), Den Haag, Paris: Mouton,443-462.
MORPHOLOGISCHE UNDURCHSICHTIGKEIT
EIN CHARAKTERISTIKUM KLEINER SPRACHEN
o. EINLEITENDE VORBEMERKUNGEN*
0.1 Wer im Laufe der Jahre verschiedene Fremdsprachen gelernt oder zu lernen versucht hat, dem ist wahrscheinlich mit der Zeit aufgefallen, daß manche Sprachen relativ leicht, andere hingegen ziemlich schwierig und mühsam zu erlernen sind. Besonders deutlich treten einem diese Schwierigkeiten bei der Aneignung der Morphologie entgegen.
Die Ausspracheregeln können zugegebenermaßen auch recht kompliziert sein (wie etwa beim Färöischen, um gleich ein Beispiel zu nennen). Nur, man bewältigt selbst schwierige phonetische und phonologische Regeln in viel kürzerer Zeit ("Vorlesekompetenz"), als dies der Fall ist, bis man eine etwas komplexere Morphologie immer richtig analysiert oder gar automatisiert beherrscht.
Auf der Suche nach den Gründen, warum die Morphologie mancher Sprachen so schwierig anzueignen ist, stößt man - zumindest im Bereich der germanischen Sprachen (und um diese soll es im folgenden nur gehen) - auf das Phänomen der sog. kleinen und isolierten Sprachen bzw. Sprachgemeinschaften. Es liegt nahe, einen (kausalen?) Zusammenhang zu vermuten zwischen der morphologischen Komplexität und der weitgehend isoliert und damit ungestört verlaufenen Entwicklung dieser kleinen Sprachen.
Im Bereich der germanischen Sprachen wollen wir die folgenden Sprachen als kleine und isolierte Sprachen einstufen: das Isländische, das Färöische und die nordfriesischen Sprachen/ Dialekte.
53
Das Westfriesische (in der Niederlanden) zählt nicht mehr dazu, da enge Kontakte zum Niederländischen bestehen. Diese reichen von gelegentlichen Interferenzen bis hin zu Mischsprachenformen.
Von Restsprachen und Sprachinseln, etwa des Deutschen in Norditalien, sei hier einmal abgesehen.
0.2 Es ist eine seit langem bekannte Tatsache, daß sich die Morphologie, und ganz besonders die F I e x ion s m 0 r p h 0
log i e, in einem ständigen Wechsel- und Spannungsverhältnis zur Phonologie befindet. Deshalb wird unsere Untersuchung als erstes von den phonologischen Ursachen auszugehen haben, die bewirkten, daß die betreffende Morphologie so komplex und damit kompliziert geworden ist.
Am Ausgangspunkt unserer Überlegungen stehen die folgenden Mutmaßungen:
(a) In kleinen und isolierten Sprachgemeinschaften wird das Wirken der phonologischen Regeln nur wenig durch morphologische Ausgleichstendenzen, d. h. paradigmatische Analogie, eingedämmt und damit kompensiert, weil sich die Kontakte mit Sprechern anderer Sprachen nicht in der eigenen, sondern in einer Fremdsprache abspielen. Somit kann sich die eigene Sprache ungestört von äußeren Kontakteinflüssen entwickeln und ihre (bes. flexivischen) Eigenheiten weitgehend bewahren.
Dazu Beispiele: Die Kontakte mit den Nordfriesen verlaufen für einen Deutschsprachigen fast ausnahmslos über das Hoch- bzw. (früher eher) das Niederdeutsche und nicht über das Friesische. Eine vergleichbare Kontaktfunktion übt das Dänische in bezug auf das Färöische und (zusammen mit dem Englischen) in bezug auf das Isländische aus.
(b) Eben weil diese kleinen Sprachgemeinschaften nicht nur isoliert, sondern auch weitgehend homogen sind, greifen auch keine strengen normierenden Regelungen, wie z. B. hochsprachliche Normierungen oder (zumindest früher nicht) sprachpflegerische Bemühungen, in die spontanen phonologischen Prozesse ein. Dies hat zur Folge, daß phonologische Veränderungen so lange uneingeschränkt vonstatten gehen können, wie die Kommunikation nicht ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt wird. Aus der Perspektive der Morphologie gesehen, heißt dies, daß bestimmte morphologische Komplexitäten und Undurchsichtigkeiten hingenommen werden können, wenn die dabei involvierten phonologischen Regeln (wie Umlaute, Brechungen, Palatalisierungen oder Entsonorisierung) noch produktiv sind und damit als motiviert gelten können.
54
(c) Daraus folgt u. a., daß in solchen kleinen Sprachgemeinschaften morphologische Irregularitäten (Undurchsichtigkeiten, die bis zum Suppletivwesen gehen können, aber auch durch Lautwandel entstandene Homonymien und Dubletten) nicht in dem Maße ein Problem beim Spracherwerb darstellen, wie dies besonders beim Zweitsprachenerwerb der Fall ist. Oder anders herum formuliert, nur wer diese kleinen und morphologisch bisweilen komplizert konstruierten Sprachen als Fremdsprache lernt, hat damit Mühe, weil er die Motivation der zugrundeliegenden phonologischen Regeln nur schwer nachvollziehen und entsprechend automatisieren kann.
(Wohlgemerkt, es handelt sich hierbei nicht um die allgemeinen Schwierigkeiten beim Erlernen einer Fremdsprache. Es liegen schon in der Tat morphologisch komplexe bis hochkomplexe Strukturen vor.)
1. "WILDWUCHS" IM PHONOLOGISCHEN BEREICH: GEFAHREN FÜR DIE PARADIGMATIK
1.0 In allen germanischen Sprachen sind im Bereich der Morphologie deutliche Auswirkungen von phonologischen Regeln wie Umlaut, Ablaut oder Brechung zu beobachten. Dies überrascht nicht, wenn man die Tatsache in Rechnung stellt, daß alle germanischen Sprachen flektierend bis stark flektierend sind oder es wie das Englische - einmal waren. Denn es gehört mit zur Definition des flektierenden Sprachtyps, daß lautliche Veränderungen im Stammbildungselement und vor allem in den Suffixen die phonologische Struktur der Wurzelmorpheme, ihres Vokalismus wie Konsonantismus, mehr oder minder stark erfassen können. Das wohl bekannteste Beispiel dürfte die regressive (Fern-)Assimilation des i-Umlauts in den germanischen Sprachen sein.
Im folgenden soll nun der Versuch unternommen werden, eine Bestandsaufnahme der phonologischen Prozesse zu machen, die in den drei zu untersuchenden Sprachen und Sprachgruppen, Isländisch, Färöisch bzw. Nordfriesisch, die Morphologie beeinflussen. Es wird zu zeigen sein, daß nicht selten mehrere (d. h. 3 oder 4) Regeln zugleich auf ein Paradigma einwirken. Die Konsequenzen davon sind morphologische Undurchsichtigkeit, ja in Extremfällen sogar Suppletivwesen. Kurz: Je mehr phonologische Regeln gleichzeitig wirken, desto undurchsichtiger wird das Para
55
I digma (sofern dieser Entwicklung nicht durch analogischen Ausgleich Einhalt geboten wird).
1.1 Bestandsaufnahme wichtiger phonologischer Prozesse im Inselnordischen und Nordfriesischen
1.1.0 Entsprechend dem Untersuchungsziel werden im folgenden anhand von illustrativen Einzelbeispielen nur die lautlichen Entwicklungen berücksichtigt, die sich - synchron gesehen - als morphophonemische Alternanzen auswirken.
1.1.1 Im Inselnordischen (d. h. Isländischen und Färöischen) bewirken der i- und der u-Umlaut im Bereich der Nominalflexion, daß sich der Stammvokal eines Lexems gleich mehrfach ändern kann (vgI. (1) und (2) vs. (3»:
isI. (1) mgnn 'Männer' Nom.PI. (a > e / _ i) (2) miinnum 'Männern' Dat.PI. (a> Q/ö / _ u) (3) manna 'Männer' Gen.PI. ohne Umlaut.
Die sog. altnordische Brechung von e kann darüber hinaus noch eine weitere Art der Vokalmodulation (nämlich fallende Diphthonge) hervorrufen, sofern der Wurzelvokal ein eist (4):
isI. (4) a. fiß.raar 'Fjords' Gen.Sg. (e > ja / _ a) b.fjQraur 'Fjord' Nom.Sg. (e > jQ/jö / _ u) (vgI. altnord. flQrOr < urnord. *fe.reJHR < germ. *fer]:mz ).
Der durch die sog. Brechung entstandene Halbvokal j kann nun seinerseits einen unmittelbar vorangehenden velaren Konsonanten (g, k) palatalisieren (gj: isI. [j/gj/gj], fär. (J] bzw. kj: isI. [kj], fär. [tIJ). Eine morphologische Alternanz entsteht jedoch durch diese Kontaktassimilation diesmal nicht, da das e des Wurzelvokals schon eine Palatalisierung nach sich zieht (vgI. (5».
fär. (5) a. gjD.rdi (oder gji!.rOi) (J-] '(er) machte' b. ger (J-] '(er) macht'.
56
Gefährlich für die Einheitlichkeit und das Wiedererkennen eines paradigmatischen Zusammenhangs ist in gleicher Weise auch der Verlust von Konsonanten, sei es durch Assimilation oder durch Wegfall/Schwund.
Während die Assimilationen meist leicht als solche erkennbar sind und eher die etymologischen Zusammenhänge zu den anderen germanischen Sprachen/Dialekten verdunkeln (vgI. (6a) vs. (6b», so kann der Verlust von zwei verschiedenen Konsonanten im Inlaut, nämlich von g und 0, in einigen Fällen zu Homophonien führen (wie in (7». Nicht wenige Homophonien entstehen auch dadurch, daß g bzw. 0 ersatzlos wegfallen (vgI. die Beispiele unter (8».
(6) a. engI. word, ndI. woord, dt. Wort vs. b. isI. oro ['~rd], fär. oro ['o:r]1
(7) fär. ['Sti:jl] = Nom.Sg. : a. stigi 'Stiege';b. stiQi 'Amboß' ['sti:ja] = Gen.Sg. : a. stiga ; b. stiQja ['sti:jar] = Nom./Akk.PI.: a. stigar ; b. stiQjar
(Das j in den Beispielen unter (7) ist jeweils erst sekundär aufgrund einer Hiatusfüllung für geschwundenes intervokalisches g und 0 entstanden, sofern es nicht Teil des Stamms ist, wie bei stiOWstiOiJIr.)
fär. (8) a. verfl!;z 'werden' und vera 'sein': ['ve:ra] b. tiQ'Zeit' und ti 'diesem; denn': ['tG)Y]
Mißlich für das Wiedererkennen der entsprechenden Basislexeme sind nicht nur die Homonyme, die durch inlautenden (8a) oder auslautenden (8b) Schwund von 0 (oder g) entstanden sind, sondern auch die Fälle, bei denen ein kompensatorisch eingeschobener Hiatusfüller für ausgefallenes 0 oder g (d. h. ein /j/ oder /v/, je nach vokalischer Umgebung) mit einem Konsonanten in einem anderen Wurzelmorphem zusammenfällt, wie in (9) bis (11):
fär. (9) (hon) ve12ur '(sie) webt' } (10) vegur 'Weg' ['ve:YG)r] (11) veQur 'Wetter'
«10) und (11) mit Hiatusfüller/v/)
57
I Für das Färöische spielt des weiteren noch die sog. Schärfung des Vokals vor g eine Rolle, sofern dadurch Alternanzen mit Formen ohne Schärfung hervorgerufen werden. Im Beispiel (12) kommt dann noch eine Entsonorisierung von v zu /f/ hinzu, sofern dieses im Auslaut steht.
fär. (12) brugv Nom.Sg. 'Brücke' [bn..gf] vs. brfr Nom./Akk.Pl. 'Brücken' [brGlYr] - in der
analogisierten Pluralform: brYgyir [brlgYrr]
Schließlich dürfen auch nicht die morphophonologischen Alternanzen vergessen werden, die durch die sog. konsonantische Diphthongierung von nn und 11 (aus urnord. -nR bzw. -IR) resultieren:
(13)isl. einn Nom.Sg.mask. 'ein' ['ei~]
eins Nom.Sg.mask. 'eines' ['eins] etc.
(14) heill - heilli (Kornp.) - heilastur (Superl.) 'gesund' ['hei~] - ['hei~h] ['hei:las~yr]
Beispiele für solche, z. T. komplizierten morphophonemischen Alternanzen sind durchaus typisch und repräsentativ für große Teile der Flexionsmorphologie des Färöischen und, in etwas geringerem Maße, auch für die des Isländischen.
1.1.2 Aber auch im Nordfriesischen 2 haben phonologische Prozesse stattgefunden, die zwar weniger drastische, aber durchaus vergleichbare morphologische Konsequenzen gezeitigt haben.
Da ist zunächst die Entsonorisierung und/oder Spirantisierung von v bzw. g sowie die Tenuisierung von bund d zu nennen (vgl. (15) u. (16)).
Fer./Öömr.(15) a. briaj- briaIQ 'Brief(e)' b. wom3 - woger 'Wand/Wände'
(16) a. skafl- skelz 'Schiff(e)' b. sloot - sIööd 'Schloß/Schlösser'
Diese Regeln allein schaffen jedoch nur wenige morphophonemische Alternanzen, die zudem hin noch transparent bleiben. In dieser Hinsicht sind sie mit der mhd./nhd. Auslautverhärtung vergleichbar. Erst wenn mehrere Regeln bei der Singular-PluralBildung zugleich anzuwenden sind, wird es komplizierter. Dabei kann es dann durchaus vorkommen, daß die Singularform nur noch wenig mit der korrespondierenden Pluralform gemein hat (vgl. z. B. (19)).
Moor. (17) schäfl- schääIQe 'Schrank/Schränke' (18) pIQjJ- pIouwe 'Pflug/Pflüge' (18') pIouJ piOUille (19) schill,[- schuur 'Ss:huh(e)' (19') schmJi schuUI
Sölr. (20) stair staiQer (etym.) 'Stätte(n)'
Wollte man (17) im Sinne der generativen Transformationsgrammatik von einer zugrunde liegenden Form ableiten, müßte diese Grundform /~:Jb-/ sein, von der dann durch Tenuisierung der Singular /~:JP#/, durch Spirantisierung und Vokallängung plus eSuffigierung der Plural /~5v~/ abzuleiten wäre. In (18) käme zur Entsonorisierung bei der Singularform auch noch ein qualitativer Wechsel im Vokalismus hinzu, um die Pluralform zu erhalten.
Bei (19) und (20) helfen jedoch auch (rekonstruierbare) morphophonemische Regeln nicht mehr weiter, weil sich fund r bzw. rund 0 - synchron jedenfalls nicht - aus einer zugrundeliegenden Form ableiten lassen.
Die Singularformen (18'/19') stellen die heute üblicheren Formen dar. In (18') kommt es sogar zu einer morphologischen Vereinfachung.
(20) wird erst dann verständlich, wenn man auf sprachgeschichtliches Wissen zurückgreift. Die diesbezügliche phonologische Regel lautet (stark vereinfacht):
D-Dentale (Lenis oder Spiranten) werden unter bestimmten Bedingungen zu s, 1oder r. (Zu r nur im Söl'ring u. im Wiedingharder Friesischen.)
58 59
I (20) staiiJ- als zugrundeliegende Form anzusetzen, verbietet sich jedoch bei einer streng synchronen Sprachbeschreibung. Welche Form man gar für (19) anzunehmen hätte, ist schwer zu sagen. De facto haben wir es nämlich bereits mit zwei Lexemen zu tun, die nur noch den anJautenden Konsonanten /§/ gemeinsam haben. Synchron gesehen könnte man deshalb bei (19) beinahe schon von Suppletivformen reden.
Eine Konsequenz aus der oben angeführten Dentalregel für die Morphologie des Nordfriesischen besteht darin, daß auf diese Weise etliche Homonymenpaare entstehen. Formen mit altem, d. h. germanischem r (21a) sind dann nicht mehr von solchen mit neuem r (21b) zu unterscheiden.
Sölr. (21) a. baar} 'ertragen' (vgl. germ. *ber,an 'tragen' ohne Dentalregel)
b. baar.i 'baden' (mit Dentalregel)
Gleichzeitig damit entsteht noch eine Isoglosse zu den anderen nordfriesischen Dialekten:
Fer./Öömr. (21) b.' baa2.e 'baden' . Moor. b." bdd2.e -"
Störend für die morphologis9le Einheitlicl;lkeit innerhalb einer Wortfamilie ist es auch, werul..··die besagt~.»entalregel nicht alle Lexeme erfaßt und. somit Alternanzen bei der Wortbildung entstehen (vgl. (22». • "~J} ....
Sölr. (22) a. kluafler 'Kleider' vs. b. höm kluar.i 'sich kleiden'
Auf die anderen phonologischen Prozesse, die außer den genannten noch die morphologische Transparenz stören und die in Einzelfällen auch die etymologischen Zusammenhänge verdunkeln, gehen wir in Kap. 2 ausführlich ein.
1.2 Die Konsequenzen für die Flexionsmorphologie
Aus dem bisher Ausgeführten läßt sich als erstes Ergebnis ableiten, daß je mehr phonologische Prozesse bei der Bildung einer morphologischen Opposition wie z. B. 'Singular - Plural' zugleich beteiligt sind oder je mehr phonologische Regeln auf ein Flexionsparadigma insgesamt einwirken, desto stärker bzw. vielfältiger ist die morphophonemische Alternanz.
1.2.1 Die wenigsten Alternanzen im Nominalbereich haben wir in den Sprachen ohne Kasusflexion, hier also bei den nordfriesischen Mundarten. Dies bedeutet jedoch ni ch t, daß deshalb die morphologischen Unterschiede etwa zwischen der Singular- und der Pluralform beim Substantiv, dem attributiven und dem prädikativen Adjektiv oder - wenn wir uns den Verbalbereich ansehen - zwischen den verschiedenen Tempusformen bei den sog. unregelmäßigen Verben nur von geringfügiger Natur sind. Ausschlaggebend für den Grad der morphophonemischen Alternanz ist vielmehr die Anzahl der Regeln, die an der Bildung einer morphologischen Distinktion jeweils beteiligt sind.
Dazu ein paar Beispiele, die verschiedene Komplexitätsgrade repräsentieren.
1. Stufe: Beteiligung von 1 phonologischen Regel
Moor. (23) a. plou!- plouwe 'Pflug/Pflüge' kiiJ- kiiwe 'langweilig' (präd. - attr.)
Entsonorisierung (von /v/) b. huuch - huuge 'hoch' (präd. - attr.)
Spirantisierung (von / g/) , Öömr. (24) beskriiw [-i:cu] - beskriiwang [-vaJ]] 'beschreiben-Beschreibung' (Wortbildung)
Vokalisierung (von Iv/) ~:
60 61
I 2. Stufe: Beteiligung von 2 phonologischen Regeln Soweit die Beispiele, bei denen es darum ging, die formalen Unter
schiede zwischen z we i flektierten Formen eines zugrundeliegenMoor. (25) a. ää~e - "t 'essen - ißt' -j den Lexems durch meist mehrfache Regelanwendungen zu beschrei
Dentalregel + Vokalalternanz ben. Fer./Öömr. b. skoot - skQiiding 'Graben - Gräben' Im Gegensatz zum Inselnordischen (s. u. 1.2.2) treten in den
Tenuisierung (von Id/) + Vokalalternanz nordfriesischen Dialekten keine weiteren morphophonemischen Moor. c. greewe - grQYj/grQjf.'graben - grub' 1 Alternanzen auf, selbst wenn noch (vereinzelte) Reste an Kasusfle
Ablaut + Entsononsierung (von Iv I) xion anzutreffen sind (vgI. (30». Dasselbe gilt schon für die NomiMoor. a. iir* - iß.rst 'eher - ehest' (*: außerdem noch nalflexion im Altfriesischen: deildi 'Tag' vs. degar 'Tage' (s. SteIler
homophon mit iir = 'ehe' u. 'Jahr') 1928,36). Vokalwechsel + Brechung (von zugrundeliegendem le/)4 (30) 'Tag' (Sg.) 'Tage' (PI.)
Hallig. (26) skuwe - skQj1 'schieben - schiebt' Öömr. - Moor. ~ Öömr. - Moor.I Entsonorisierung/Kontaktassimilation (von Iv I) N [daiJ [däil N [daarJ [deegeJ + Vokalwechsel G (dais-) (däis-) G
D am daiem am däiem6 D 3. Stufe: Beteiligung von 3 (oder mehr) phonologischen Regeln A [daiJ [däi] A [daarJ [deegeJ
Moor. (27) a. iiiiß.e - in 'essen - gegessen' Als zugrundeliegende Form ist somit Idag- I anzusetzen, nicht Vokalwechsels + Dentalregel + Schwund (von It/) zuletzt, weil die davon abgeleiteten Verben (wie daage 'tagen') (vgI. afries. etalita - *eten/*iten) bzw. Verbverbindungen ebenfalls daag- aufweisen.
b. goue - gQ4j 'gut' (attr. - präd.) Schwund (von Id/) + Diphthongierungl 1.2.2 Im Isländischen und in noch etwas höherem Maße im FäröiVokalkürzung + Mouillierung (von Id/) schen häufen sich gerade im Nominalbereich die morphophone(vgI. afries. gode - god) + Umlaut mischen Alternanzen, weil diese Sprachen noch voll in 4 Kasus
Sölr. (28) a. Dai - D!1ßg.en - (Aagi)daar 'Tag - Tage - 8 Tage (Woche)' flektieren. Neben den allerdings nur theoretisch möglichen 8 verVokalisierung (von Ig/) + Vokallängung + schiedenen Flexionsendungen entstehen infolge von Umlauten Schwund (von I g/) und anderen Assimilationsprozessen bis zu maximal 4 verschie(vgI. Moor.: däi -d~e: Vokalisierung (von Ig/) + dene Realisierungen des zugrunde liegenden lexikalischen Vokallängung + spont. Palatalisierung a > e) Morphems, also des Stammes. Einfache Fälle ohne Stammalter
b. fQ - fiJ1g. 'bekommen - bekam' (vgI. germ. *fanxan) nanz (wie (31» sind zwar im Isländischen nicht selten, jedoch Schwund (von lxi) + Kontraktion (fürfo) + untypisch. Bei dem nachfolgenden Paradigma (31) treten außerAblaut + Despirantisierung (von [y] zu [g] dem nur 4 verschiedene Flexionsendungen auf (-0, -ar, -a und (mindestens» (Ähnlich kompliziert: Moor. -um), weshalb wir hier von der 1. und damit einfachsten Stufe fuunj/fouen - füng) morphophonemischer Komplexität reden wollen:
Hallig. (29) liige - jQmt 'lügen -lügt' Vokalwechsel + Schwund (von 11/) + Kontaktassimilation (bei Ixt/).
62 63
I isI. (31) vel ['vje: 1] 'Maschine'
Sg. N vel PI. N velar G velar G vela D vel D velum A vel A velar
=1. Stufe der Komplexität: k ein e Stammalternanz; 4 Flexionsendungen
Charakteristischer für hochflektierende Sprachen wie Isländisch und Färöisch sind jedoch eher die Wörter, bei denen eine hohe Stammalternanz mit einer hohen Anzahl von Flexionsendungen zusammentrifft. In (32a/b) isI./fär. cer 'Mutterschaf' steigt die Komplexität gegenüber (31) an (2 bzw. 3 verschiedene Realisierungen des Stamms) bei gleichbleibend relativ niedriger Anzahl an verschiedenen Flexionsendungen (nämlich 4 bzw. 3).7
IsI. fjöraur 'Fjord' (33) und fär. dagur 'Tag' (34) repräsentieren demgegenüber das Maximum, was an morphophonemischer Alternanz im Nominalbereich des Inselnordischen möglich ist, nämlich bis zu 4 verschiedene Stämme bei 7 verschiedenen Endungen.
2. Stufe der Komplexität: 2 Stämme; 4 Flexionsendungen
isI. (32) a. cer 'Mutterschaf'
Sg. N cer ['ai: r] PI. N cer ['ai: r] G cer ['ai:r] G aa ['au: a] D a ['au:] D am ['au: m] A a ['au:] A cer ['ai: r]
3. Stufe der Komplexität: 3 Stämme; 3 Flexionsendungen
fär. (32) b. aer 'Mutterschaf'8
Sg.N cer ['earl PI. N cer ['earl G aer ['earl G aa ['~+a]
D aer ['earl D 6m ['~un]
A aer ['Ear] A aer ['earl
64
4. Stufe der Komplexität: 3 Stämme; 7 Flexionsendungen
isI. (33) fjöraur ['fjerovr] 'Fjord'
Sg. N fjöraur N firOir G fjaraar G fjaraa D firm D fjöraum A fjöro A firOi
(ja/jö durch Brechungen von e; i durch UL von e)
5. Stufe der Komplexität: 4 Stämme; 7 Flexionsendungen
fär. (34) dagur 'Tag'
Sg. N dagur ['deaYGlr] PI. N dagar ['de~ar]
G dags ['daks] G daga ['de~a]
D degi ['de:jl] D degum ['de:vGln] A dag ['dea_] A dagar ['de~ar]
Bei dem letzten Beispiel treffen die verschiedensten phonologischen Prozesse aufeinander: Neben den Umlauten in degi und degum und der silbenstrukturbedingten Vokalkürzung von a in dags wirkt sich hier die paradigmenzerstörende Rolle der verschiedenen Realisierungen für g deutlich aus. Da es im Färöischen auslautend nach Vokal immer und inlautend in vielen Fällen schwindet, treten an seine Stelle 0 und/oder die Hiatusfüller / v / bzw. /j/, je nach vokalischer Umgebung. Ohne Hilfe der orthographischen Form, die fast altnordisch ist, wären die jeweiligen Ausspracheformen wohl kaum mehr als phonologisch bedingte Varianten ein und desselben Lexems wiederzuerkennen (vgI. dazu auch Werner 1975).
Auf andere Beispiele, bei denen im Paradigma mal Schärfung, mal keine Schärfung auftritt (so bei brugv/kugv - brum/kum 'Brücke/Kuh' Nom.Sg. vs. Dat.Pl., sk6gvur - sk6s 'Schuh' Nom./Gen.Sg. oder sk6g/sk6gur/sk6gvur 'Wald' in verschiedenen Varianten), desgleichen auf Fälle, bei denen Varianten durch fehlende oder vorhandene Hiatusfüllung zu beobachten sind (wie bei tidz 'Ente' oder
65
I sega/(Gen.Sg.) segu 'Geschichte'), können wir hier nicht weiter eingehen, sondern sie nur erwähnen.
Doch nicht nur im Nominal-, sondern auch im Verbalbereich stößt man nicht selten auf Fälle extremer Allomorphik.
Wiederum lassen sich anhand der verschiedenen Formen (hier z. B.) des (Indikativ) Präsens mehrere Stufen hinsichtlich der Komplexität der Allomorphe des Stamms ermitteln. Sie reichen von einfachen Beispielen ohne Alternanz (35), über solche mit z. T. mehrfachem Umlaut vs. ohne Umlaut (36/37) bis hin zu Verben, bei denen sich zusätzlich zum Vokalwechsel noch eine Veränderung im Konsonantismus, sei es anlautend (39) oder stammauslautend (40) hinzugesellt. Im Färöischen allein gibt es dann noch Verben mit und ohne 'geschärftem' Stammvokal (38).
1. Stufe der Komplexität: kein e Stammalternanz
isI. (35) nema 'lernen' (Inf. u. 3.P.Pl.)
hann nemur (3.P.Sg.) vionemum (1.P.Pl.) pionemio (2.P.PI.)
2. Stufe der Komplexität: 2 Stammalternanzen (beide im Vokalismus)
isl. (36) bj60a 'bieten' (Inf. u. 3.P.PI.)
hann byaur (3.P.Sg.) (Monophthongierung/Umviobj6aum (1.P.PI.) laut von germ. *eu > f) Piobj60io (2.P.PI.)
3. Stufe der Komplexität: 3 Stammalternanzen (alle 3 im Vokalismus)
isI. (37) falla 'fallen' (Inf. u. 3.P.PI.)
hannfellur (3.P.Sg.) (i und u-Umlaut von a) vio föllum (1.P.PI.) pio fallio (2.P.Pl.)
4. Stufe der Komplexität: 4 l.Jzutalternanzen9 (2 im Vokalismus, 2 im Konsonantismus)
fär. (38) siggja 'sehen' (Inf. u. PI.)
hann srer (3.P.Sg.) ['sear] (0-Konsonant) vit sfggja (1.P.PI.) ['SCi)J: a]
fär. (39) geva 'geben' (Inf. u. PI.)
hanngav (3.P.Sg.) ['geav] vit geva (1.P.PI.) ['Je: va]
5. Stufe der Komplexität: 5l.Jzutalternanzell 0 (2 im Vokalismus, 3 im Konsonantismus)
isl. (40) eiga 'besitzen' (Inf. u. 3.P.Pl.) (dito mega 'dürfen')
pu att (2.P.Sg.) ['auh~]
hanna (3.P.Sg.) ['au:] (Präteritopräsens ohne vio eigum (1.P.Pl.) ['ei:yvm] Ablaut) pio eigio (2.P.PI.) ['ei:jld] (g: [y, j] vs. 0)
2. DUBLETIEN, HOMOPHONIEN UND VERLORENGEGANGENE ETYMOLOGISCHE ZUSAMMENHÄNGE
Morphologische Undurchsichtigkeiten können auf mehrerlei Arten zustande kommen.
(A) Die eine Art, die bei den von uns untersuchten Sprachen am häufigsten auftritt, ist - wie eben gezeigt - die, daß infolge von vielen gleichzeitig zusammenwirkenden phonologischen Prozessen eine hohe morphophonemische Alternanz entsteht, die jedoch n ich t (sofort) durch analogische Ausgleichstendenzen wieder beseitigt wird.
(B) Eine andere Möglichkeit - dieses Mal nun nicht in Zusammenhang mit der Flexivik - besteht darin, daß neue lautliche Entwick
66 67
I lungen Platz greifen, die sich aber erst allmählich bei allen Sprechern durchzusetzen beginnen. So kommt es wie in (41) zu Dubl e t te n, die eine ganze Zeitlang im Sprachgebrauch verschiedener Generationen nebeneinander existieren. Die morphologische Undurchs~chtigkeit besteht darin, daß solange diese Übergangsperiode währt, es zu einem bestimmten lexikalischen Inhalt gleich zwei verschiedene Ausdrücke gibt, die als (lediglich generationsbedingte) Varianten eines Lexems erkannt werden wollen.
Sölr. (41) a. liiQ dö 'leid tun' (ältere Form) b. lür. dö (neuere Form; mit
Dentalregel) (dito: KaiQ.em/Kairem für den ON Keiturn)
Bisweilen konkurrieren auch gleich zwei phonologische Neuerungen als Dubletten miteinander, wobei die Ausgangsform bereits verschwunden sein kann:
Öömr. (42) a. bialen 'beide' (D-Dental zu I bzw. 5 aus älterem*bia~n;vgl. dt. beide und däne bade)
b. bias.en
Bei der Herausbildung des Färöischen aus dem Altwestnordischen kam es in einem vergleichbaren Fall sogar zu einer morphologischfunktionalen Differenzierung. Altnord. P wurde bis auf eine Ausnahme10 in den färöischen Mundarten im Anlaut als t realisiert. Lediglich das Pin den Pronomina und bei einigen Deiktika hat sich einheitlich zu h entwickelt und ist so mit dem h zusammengefallen, das bereits in den anderen Deiktika wie her 'hier' und einigen Personalpronomina wie hann 'er' vorhanden war. Phonologische Varianten haben sich damit nach funktionalen Gesichtspunkten (h bei den Deiktika u. ä.) aufgeteilt (vgl. ausführlich dazu Braunmüller 1980) .
Selbst wenn sich nun die eine lautliche Entwicklung (wie hier im Nordfriesischen: D-Dental zu 5,1 oder r) in allen Fällen konsequent durchgesetzt hat, ist damit noch keinesfalls sichergestellt, daß es mit den morphologischen Problemen jetzt ein Ende hat. Es kann nämlich dabei, wie dies bei der sog. Dentalregel der Fall ist, zu
68
i.i
einem (positionsabhängigen) Zusammenfall von zwei Phonemen kommen (im Söl'ring von altem r mit neuern, nicht anlautendem r), wodurch nicht wenige Homophonien entstehen.
(C) Diese weitere Art, wie morphologische Probleme zustande kommen können, bereitet (unbewußt) sowohl den Muttersprachlern wie denjenigen, die diese Sprache eventuell als Fremdsprache lernen wollen, Schwierigkeiten beim Identifizieren des zugrundeliegenden Lexems. Rein synchron gesehen könnte man eine solche morphologische Undurchsichtigkeit schlagwortartig als "PseudoPolysemie" bezeichnen, da die Anzahl der Bedeutungen bestimmter Ausdrücke infolge von Homonymien mit anderen Lexemen zugenommen hat. Ohne eine verstärkte Einbeziehung z. T. sogar des weiteren Kontextes wird es schwierig, auf Anhieb das zugrundeliegende Lexem und damit die richtige Lesart zu erkennen.
Ziemlich hoch scheint diese Zunahme an Homonymien durch Lautwandel gerade im Söl'ring zu sein. Einige Beispiele (hier nur: D-Dental über 0 zu r =Zusammenfall mit altem r):
Sölr. (43) a. baari 'baden' (neu) b. baari 'ertragen'
(44) a. Hur 'Hu!' (neu) b.hur 'wo?'
(45) a. IUr. 'leiden' (neu) b. liir 'lehren; lernen'
(Weitere Beispiele: durch g-Schwund: riin 'Regen/regnen' riin 'rein'; des weiteren durch Entrundung: ern (vgl. däne örn) 'empfindlich' - Ern 'Biene/Imme'.)
Ohne allzu schwere Folgen für die Morphologie dürfte hingegen der zur Zeit sich vollziehende völlige Zusammenfall von l'/n' (für germ. -Id/-nd) mit I/n sein, da nur relativ wenige Minimalpaare davon betroffen sind und der phonetische Unterschied seit jeher gering war (s. (46) u. (47», vergleichbar etwa mit den Minimalpaaren im Dänischen bei Wörtern mit und ohne Stoßton/sted (/1/), wie z. B. hun 'sie' ohne und hund 'Hund' mit sted /1/.
69
I Sölr. (46) a. Jil' 'Geld'
b. JiI 'Aal' (47) a. Sen' 'Sünde'
b. Sen 'Sonne'
Im Öömrang ist darüber hinaus noch eine andere, ebenfalls positionsabhängige Variante der Dentalregel zu verzeichnen, nämlich anlautendes ehemaliges germ. *p- wird zu s-. Die Zahl der Homophonien ist gering (vgl. (48».
Öömr. (48) a. ~aag 'Dach' (neu) b. ~aag 'Sache'
Was jedoch das Wiedererkennen der zugrundeliegenden Lexeme erschwert, ist der gleich mehrfache lautliche Zusammenfall von diesem "Dentalregel"- s (wie in (48a» mit (2.) altem s (48b) und (3.) einem ebenfalls neuen "Palatalregel"-s, das aus einer Palatalisierung von germ. k hervorgegangen ist (vgl. ~edel für Kessel und ~ark
für Kirche))l Wer Öömrang als Zweitsprache lernen wollte, müßte schon einiges an sprachhistorischen Kenntnissen aufwenden, um (a) ~arkensiiner auf Anhieb als etymologische Entsprechung zu Kirchendiener zu identifizieren (s 1. < k-; 2. < *'P-/d-).
(D) Morphologische Undurchsichtigkeit kann schließlich und endlich auch dadurch hervorgerufen werden, daß durch spätere Entlehnung eines etymologisch identischen Lexems die Zusammengehörigkeit zur selben Wurzel verdunkelt (49) oder daß sie fast nicht zu erkennen ist (50).
Sölr. (49) a. Peq2.er / Peql.ernööt 'Pfeffer' / 'Pfeffernuß' b. PeelQerröt 'Meerrettich' (wörtl.
'Pfefferwurzel'; vgl. däne peberrod: ['pEY~IS'-])
Öömr. (50) a. ~eenk 'denken' vs. b. denkmool 'I2enkmal'
70
In (50) war zum Zeitpunkt der Entlehnung aus dem Deutschen die s-Regel nicht oder nicht mehr wirksam.
3 . GRADE DER MORPHOLOGISCHEN UNDURCHSICHTIGKEIT
Es ist nicht gerade einfach, einen perzeptionellen Begriff wie den der 'Undurchsichtigkeit' mit linguistischen Beschreibungsmethoden zu operationalisieren und damit objektivierbar zu machen. Es lassen sich jedoch die in Kap. 1.2 ermittelten Stufen der bei der Formenbildung auftretenden Anzahl an phonologischen Prozessen bzw. die Stufen der Komplexität im Verhältnis von Stämmen und Endungen als brauchbare Grundlage"verwenden, da die Zahl der bei der Ableitung auftretenden Regeln in den meisten Fällen eindeutig festzustellen ist. Dasselbe gilt in entsprechender Weise für die Veränderungen im Vokalismus und Konsonantismus von Stämmen. Dennoch reichen diese Kriterien als Bewertungsmaßstab allein noch nicht aus, um den vielen Abstufungen zwischen 'völlig durchsichtig' und 'nicht mehr durchsichtig' gerecht zu werden. Aus diesem Grund müssen noch andere, insbesondere rein morphologische Kriterien hinzutreten, will man einen hinreichend präzisen wie aussagekräftigen Gradmesser aufstellen.
3.1 Als Musterbeispiel, wie eine solche Gradierung aussehen könnte, wählen wir die PI uralbild ung bei den Substan tiv e n. Der Bereich der Einwirkung von phonologischen Regeln, die bei der Pluralbildung auftreten, reicht von 0 bis 3, sofern die Pluralbildung noch durchsichtig oder als Ableitung aus dem Singular erkennbar ist.
Um der gesamten Flexion der inselnordischen Sprachen mit ihren 2 x 4 Kasusformen gerecht zu werden, müßte man von einer solchen eindimensionalen Skala wie bei der (reinen) Pluralbildung abgehen. Hier würde besser eine Gradierung der verschiedenen Quotienten passen, die sich aus der Anzahl der phonologischen und morphologischen Veränderungen zwischen der am einfachsten und der am aufwendigsten zu bildenden Form ergeben. Je höher dann dieser Quotient ist, desto breiter ist das Spektrum der morphologischen Alternanz. Ein hoher Quotient dürfte gleichzeitig auch mit einer geringen morphologischen Transparenz korrelieren, da ein weiter
71
I. Abstand zwischen der einfachsten und der komplexesten Kasusform auf ein hohes Maß an morphologischer Verschiedenheit zurückgeht. (Diese Auswertung soll jedoch einer späteren Untersuchung vorbehalten bleiben.)
Da die Anzahl der bei der Pluralbildung abgelaufenen phonologischen Prozesse, wie vorher ausgeführt, noch keine hinreichend differenzierten Ergebnisse liefert, ist es sinnvoll, die folgenden beiden morphologischen Kriterien als Beschreibungsmerkmale hinzuzunehmen: Zum einen das Merkmal 'segmentierbar', zum anderen 'das Merkmal'ikonisch'.
Mit [+ segmentierbar] wollen wir alle die Plurale versehen, bei denen sich eine auch bei anderen Substantiven auftretende Endung klar als Pluralsuffix ausmachen und somit auch segmentieren läßt. Beispielsweise: dt. Hund-e oder eng!. ball-s 'Bälle'; nicht hingegen dt. Väter oder gar eng!. mice 'Mäuse'.
Unter einer nach ikonischen Gesichtspunkten gebildeten morphologischen Form wird in der neueren Morphologietheorie eine Ausdrucksform verstanden, die in geeigneter Weise eine bestimmte Eigenschaft des durch sie repräsentierten Inhalts auch ausdrucksseitig widerspiegelt. Sie kann daher als motiviert oder teilmotiviert gelten.
Als klassische Fälle im lexikalischen Bereich werden schon seit alters her die Onomatopoetika angesehen. Relativ neu ist hingegen, daß man auch im grammatisch-flexivischen Bereich nach solchen ikonischen Entsprechungen formal-konstruktiver Art sucht. Diesmal allerdings auf einer abstrakten Ebene. Zu den einfachsten Fällen gehört u. a. die Pluralbildung bei den Substantiven. (Weiterführende Darstellungen und Literaturhinweise .~. B. im Bd. 2, H. 1/2 der Zeitschrift für Semiotik 1980 oder in meinem Uberblicksartikel s. Braunmüller 1982.)
Eine Pluralkonstruktion gilt dann als [+ ikonisch], wenn - stark vereinfacht formuliert - die Pluralform ausdrucksseitig mehr Elemente aufweist als die entsprechende Singularform, gemäß der ikonischen Abbildungsregel: "Was inhaltlich mehr ist (die Vielzahl also), muß auch ausdrucksseitig durch ein Mehr an Elementen repräsentiert werden." Beispiele: dt. Häuser ist im Vergleich zum Singular Haus ikonisch gebildet, (die) Messer, (die) Käse als Pluralformen hingegen nicht, da sich die Vielzahl der durch diese
72
Wörter vertretenen Gegenstände ausdrucksseitig nicht widerspiegelt.
Bei den nachfolgenden 6 Graden an morphologischer Durchsichtigkeit stellen die letzten 3 Stufen bereits Grade der Undurchsichtigkeit dar:
1. voll durchsichtig 2. gut durchsichtig 3. noch durchsichtig 4. schwach durchsichtig 5. weitgehend undurchsichtig 6. völlig undurchsichtig.
3.2 Durchsichtigkeitsgrade bei der Pluralbildung:
Hinweise: Bei den voll flektierenden Sprachen wie Isländisch und Färöisch werden nur die Nominativ-Plurale berücksichtigt.
Hinsichtlich der Anzahl der angewandten phonologischen Regeln wird davon ausgegangen, daß die Singular- wie die Pluralform beide von einer zugrundeliegenden Form abgeleitet werden. Da es sich jedoch nicht um eine Liste der Komplexität der Pluralbildungen handelt, sondern um eine Hierarchie der Durchsichtigkeitsgrade, werden alle Unterschiede zur Singularform mitgezählt. Dies bedeutet, daß die Auslautverhärtung oder die Entsonorisierung wie auch die morphologische Markierung des Nominativ-Singular im Inselnordischen als Unterschiede zur entsprechenden Pluralform mitgewertet werden, obwohl sie eigentlich nichts mit der Pluralbildung zu tun haben.
1. Grad: völlig durchsichtig: es erfolgt keine Anwendung einer phonologischen Regel
(a) optimal: mi t Pluralzeichen [+ segmentierbar] PIuralbildung [+ ikonisch]:
dt. Stein-e (auch Fw wie Kino-s); engl. stone-s; Öömr. stian-er; isl. vel-ar 'Maschinen', fär. huro-ar 'Türen'.
(Sonderfall: fär. gent I ur 'Mädchen' (zum Sg. gent Ia mit Nom.Sg.- Markierung»
73
(b) nicht-optimal: ohne Pluralzeichen: 0 Pluralbildung [ - ikonisch]:
dt. Messer, Mädchen; isl./fär. bes. Neutra wie bora 'Tische', aber auch Fem. wie (nur isl.) kft 'Kühe' oder rer 'Mutterschafe'.
(Sonderfall: mit Pluralzeichen [+ segmentierbar], aber Pluralbildung [ - ikonisch]; nur im Inselnordischen mit Nom.-Sg.- Markierung.
isl. hest-ar 'Pferde' (zu hest-ur), fär. bat-ar 'Boote' (zu bat-ur»
2. Grad: gut durchsichtig: Anwendung von 1 phonologischen Regel
(a) optimal: mi t Pluralzeichen [± segmentierbar] PIuralbildung [+ ikonisch]:
dt. [+ segm.]: Hund-e (zu/hunt/), [- segm.]: Bücher (zu Buch); engl. [- segm.]: children 'Kinder' (zu /tfaild/); Moor. [+ segm.]: plouw-e 'Pflüge' (zu plouj); fär. [- segm.]: bekur 'Bücher' (zu b6k); isl. [- segm.]: axlir
'Achseln' (zu öxl).
(b) nicht-optimal: ohne Pluralzeichen: 0 Pluralbildung [ - ikonisch]:
dt. Väter, Vögel; engl. geese 'Gänse' (zu goose); fär. mys 'Mäuse' (zu mus), isl./fär. börn 'Kinder' (zu barn)
(Sonderfall: mit Pluralzeichen [+ segmentierbar] Pluralbildung [ - ikonisch]:
isl. halt-ir'Arten' (zu hatt-ur mit Nom.-Sg.-Markierung), dito: firiJ-ir 'Fjorde' (zu jjöriJ-ur»
3. Grad: noch durchsichtig: Anwendung von 2 phonologischen Regeln
(a) optimal: mi t Pluralzeichen [ - segmentierbar] PIuralbildung [+ ikonisch]:
74
engl. brethren '(Kloster-)Brüder' (zu brother); Moor. tweege 'Zweige' (zu twich); Fer./Öömr. skööding 'Gräben' (zu skoot); Sölr. pluuger 'Pflüge' (zu ploch); isl. verslanir 'Geschäfte' (zu verslun).
(b) nicht-optimal: mit / 0 h n e Pluralzeichen [± segmentierbar], Pluralbildung [- ikonisch]:
4. Grad: schwach durchsichtig: Anwendung von 3 phonologischen Regeln
(a) optimal: mi t Pluralzeichen [- segmentierbar] Pluralbildung [+ ikonisch]:
Moor. deege 'Tage' (zu däi).
(b) nicht-optimal: mi t Pluralzeichen [- segmentierbar] Pluralbildung [- ikonisch]:
Öömr. (Aagi-)daar '(8) Tage' (zu däi).
5. Grad: weitgehend undurchsichtig: k ein e Anwendung von synchronen phonologischen Regeln möglich
(a) mi t Pluralzeichen [ - segmentierbar] (weil keine allg. Pluralbildung [+ ikonisch] üblichen
Pluralsuffixe!)
Moor. stääse 'Stätten' (zu stää), Sölr. staii1er (dito) (zu stair) Hallig. sküüre 'Schuhe' (zu skööj), Sölr. skuur (dito) (zu skoch) Moor.fddse 'Fässer' (zufdt), Sölr. kin 'Kühe' (zu kü).
(b) mi t Pluralzeichen [ - segmentierbar] (weil keine allg. Pluralbildung [ - ikonisch] üblichen
Pluralsuffixe! )
Fer. skur 'Schuhe' (zu skuch), Moor. schuur (dito) (zu schouf/schöij)
75
6. Grad: völlig undurchsichtig: k ein e Anwendung von phonologischen Regeln möglich
Pluralzeichen [+ segmentierbar] Pluralbildung [ - ikonisch]:
Hallig. kii 'Kühe' (zu ku), Moor. kee (dito) (zu kü),*(Öömr. temer-lidj 'Zimmerleute' (zu temer-maan» Suppletivbildung! isl. menn 'Männer' (zu macJur) (dito: fär.).
*(dito: dt. Zimmer-leute, ndl. timmer-Iui (zu timmer-man»
Aus dieser Hierarchie der Grade an morphologischer Durchsichtigkeit lassen sich mindestens diese drei Schlüsse ziehen:
(1) Große (germanische) Sprachen ohne oder ohne vollständige Kasusflexion wie Englisch (aber auch Niederländisch und die skandinavischen Sprachen des Festlandes) bzw. Deutsch haben meist völlig bis gut durchsichtige Pluralformen (der Grade 1 u. 2), wobei der Anteil an nicht-ikonischen/nicht-optimal kodierten Formen im Deutschen sicher höher ist als etwa im Englischen. Bisweilen mögen noch vereinzelte (Rest-)Bildungen des 3. Grades zu finden sein, wie engI. brethren. Der 5. und 6. Grad kommt allenfalls bei Suppletivformen vor (dt. Zimmerleute, ndl. timmerluiJ.
(2) Kleine (germanische) Sprachen ohne Kasusflexion wie die nordfriesischen Sprachen/Dialekte bilden ihre Plurale in allen Durchsichtigkeitsgraden. Die Mehrzahl der Pluralformen bleibt jedoch gut durchschaubar.
(3) Kleine (germanische) Sprachen mit vollständiger Kasusflexion wie die inselnordischen Sprachen können anhand einer solchen eindimensionalen Hierarchie nur sehr unzureichend gemessen werden, weil in ihr nur die Opposition 'Nominativ-Singular vs. Nominativ-Plural' erfaßt wird. (Hier bedarf es des oben angedeuteten Meßverfahrens mit Quotienten.) So viel läßt sich jedoch schon absehen, daß es im Färöischen und Isländischen nicht wenige Oppositionen der 2. und 3. Durchsichtigkeitsstufe gibt. Die morphologische Undurchsichtigkeit nimmt aber mit der Häufung von solchen Oppositionen (Gen.Sg. vs. Gen.PI. etc.) drastisch zu.
Für das Nordfriesische im Vergleich zum Deutschen oder Englischen bedeuten diese Ergebnisse, daß dessen Plurale des
76
öfteren um ein bis zwei Grade schwieriger zu bilden bzw. komplizierter zu analysieren sind. Im Inselnordischen steigt darüber hinaus die Komplexität und damit die potentielle morphologische Undurchsichtigkeit infolge der 3 weiteren Kasusoppositionen im Vergleich zum Nordfriesischen nochmals deutlich an.
4. SCHLUSSBEMERKUNGEN
Kleine Sprachen galten seit längerem als eine Fundgrube für phonologische und morphologische Kuriositäten. Es hat auch nicht an ersten Erklärungsversuchen gefehlt, warum dies so ist:
"Es ist - vermute ich - ganz allgemein ein Kennzeichen kleinerer, isolierter Sprachgemeinschaften, dass sie lange komplizierte Regelsysteme bewahren; grossräumige Sprachkontakte und damit verbundene Interferenzen fördern dagegen die Analogien, wie sie ja auch von Kindern und Ausländern gerne gemacht werden." (so Werner 1975, 791)
Aufgrund unserer Analysen, dürfte nun etwas klarer geworden sein, wie in verschiedenen kleinen Sprachen w e Iche F 0 r m e n von morphologischen Komplexitäten entstehen. Erstmals wurde gezeigt, wie man morphophonologische Alternanzen und morphologische Undurchsichtigkeiten messen und hierarchisch darstellen kann. Suppletivwesen durch Lautwandel stellt jedoch im Gegensatz zu Werner (1977)12 - auch in solchen Sprachen eher den seltenen Sonderfall dar. M. E. sollte man bei kleinen und isolierten Sprachgemeinschaften besser von 'morphologischer Undurchsichtigkeit' reden, weil diese für solche Sprachen/ Dialekte recht häufig und damit charakteristisch ist. Eine Voraussetzung dafür, daß sich diese Undurchsichtigkeiten als stabil und relativ resistent gegenüber Analogisierungstendenzen erweisen, ist sicher darin zu sehen, daß es sich - pointiert formuliert - um Sprachen handelt, die nicht als Zweitsprachen von Fremden gelernt werden und die an einer größeren überregionalen Kommunikation nicht teilhaben. Kurz - und anders gewendet: Die morphologische Analogie ist der Preis für überregionale Verständlichkeit und für die Zugänglichkeit einer Sprache.
77
ANMERKUNGEN:
,. Herrn Dr. Ommo Wilts (Nordfriesische Wörterbuchstelle, Universität Kiel) und ganz besonders Herrn Prof. Dr. Dietrich Hofmann (Nordisches Institut, Universität Kiel) möchte ich dafür danken, daß sie die nordfriesischen Beispiele durchgesehen und ggf. berichtigt haben. Herrn Prof. Dr. Björn Hagström (Amamagnreanisches Institut, Universität Kopenhagen) habe ich für einige Berichtigungen und Anregungen hinsichtlich der Beispiele aus dem Färöischen zu danken.
Dieser Aufsatz geht auf eine Gastvorlesung zurück, die ich am 25.4.1984 an der Universität Kopenhagen auf Einladung von Frau Prof. Dr. Inger Ejskjrer unter dem Titel: "Morfologisk intransparens et karakteristikum for sma sprog" gehalten habe.
1. Die nordfriesischen Mundarten haben teils die (nordgermanische) Assimilation von germ. l! vor u (sC? Söl'ring: uurt oder Mooring: uurd), teils aber auch nicht (wie Fering/Oömrang: wurd oder Halunder Friesisch: wür).
2. Zu de~. inselfriesischen Mundarten zählen Söl'ring (Sylt). Fering (Föhr), Oömrang (Amrum) und das Halunder Friesische (Helgoland), während das FestIandsfriesische (z. B. Mooring) außer den Mundarten an der Westküste Schleswig-Holsteins noch das Halligfriesische umfaßt.
3. Es handelt sich - zumindest bei der Aussprache älterer Leute - nur um eine Spirantisierung (/g/ > /r/). Eine Weiterentwicklung zu (/Xl) ist jedoch im Gange (dito: huuch 'hoch' u. unter (3a) in Abschn. 3.2.: ploch 'Pflug').
4. Afries. er (Positiv) - erra/arra (Komparativ) - erost, -est, -ist: erst/ar(i)st (Superlativ) (nach Steller 1928, 49, Anm. 1). Die Mooringer Brechungsform jarst dürfte auf die Form *erst zurückgehen.
5. Ablaut kann es bei einem starken Verb der 5. Klasse nicht sein, da das Partizip Perfekt den Vokal der Hochstufe des Infinitivs hat. Dies ist noch ganz klar im Altfriesischen zu erkennen: eta - *eten.
6. 'Am Tage/tagsüber'. Ob die Endung -ern aus der inzwischen verschwundenen Form für den Dativ Plural (afries.) degern (s. Steller 1928, 36f.) oder aus sonst einer analogischen Übertragung stammt, ist schwer auszumachen.
7. Entscheidend für den Komplexitätsgrad ist die Anzahl der Stammalternanzen. Wenn deren Anzahl relativ hoch ist, wirkt sich das Vorhandensein von gerade nur wenigen verschiedenen Flexionsendungen - wie hier bei (32b) von nur 3 - verstärkend negativ im Hinblick auf das Wiedererkennen einer bestimmten Flexionsform aus.
8. Der mögliche Einwand, daß besonders bei (32b) Wurzel/Stamm und Flexionsendung derart miteinander verschmolzen sind (vgl. bes. den
78
Dat.PI. 6rn), so daß eine Trennung in Stamm und Endung kaum mehr möglich sei, ist zwar vom Standpunkt der historischen Grammatik durchaus berechtigt. Nur spielt er bei dieser synchronen Analyse keine Rolle, da man diese beiden Paradigmen (Sg./Pl.) in 3 Stämme [ea, 0, ~u] sowie in 3 Flexionsendungen [-r, -a, -n] segmentieren und als solche klassifizieren kann. Um beim Dat.PI. [-n] dennoch eine größtmögliche Übereinstimmung mit den anderen Dat.PI. auf -um [-G>n] und auch mit der historischen Grammatik zu erzielen, wird man das [-n] in 6rn als positionsbedingtes Allomorph vor einem u anzusehen haben, bei dem das u wegfällt, um einen Hiatus zu vermeiden.
9. Hier und bei Stufe 5 ist nicht mehr von Stamm-, sondern von Lau t alternanzen die Rede. Diese Feinanalyse auf der phonologischen Ebene wird m. E. den auftretenden Veränderungen wesentlich besser gerecht, als wenn man nur pauschal (auf der morphologischen Ebene) von zwei Stammalternanzen reden würde. Dies zeigt sich deutlich bei einem phonologischen Vergleich zwischen (36) und z. B. (39): ['btd-] - ['bjQy:d-] vs. ['gggv] - ['~va].
10. VgI. h6sdagur 'Donnerstag' neben t6rsdagur zu altnord. *p6rs-dagr. 11. Das gesamte Nordgermanische mit Ausnahme des heutigen Reichs
dänischen palatalisiert ebenfalls: isl./fär. kirkia [tf-], schwed. kJLrka [~(~-/f /tf- ...)]: dito Englisch: dlurch [tf-]·
12. "Viel Suppletivwesen scheint ein Merkmal isolierter Sprachgemeinschaften zu sein"; (Wemer 1977, 281, Anm. 12).
LITERATURVERZEICHNIS
BRAUNMÜLLER, Kurt (1980): "Bifurcating changes in morphology": the case of demonstrative pronouns in West Nordic". The Nordic languages and modem linguistics (4). Proceedings of the Fourth International Conference of Nordic and General Linguistics in Oslo 1980 (Even Hovdhaugen, ed.). Oslo etc.: Universitetsforlaget, 223-232. (1982): "Wie arbiträr sind Zeichen in natürlichen Sprachen?". Germanistische Mitteilungen (Brüssel) 16,27-43.
GANTZEL, Anna/WILTS, Ommo (eds.) (1978): Sölring fuar sölring Skuulen. Friesisches Schulwörterbuch (...) mit einer Formenlehre. Keitum: Söl'ring Foriining.
JACOBSEN, M.A./MATRAS, Chr. (1961): Faroysk-donsk orddab6k. Frerask-dansk ordbog. 2. Auf!. T6rshavn: Faroya Frooskaparfelag.
79
JÖRGENSEN, V. Tams (ed.) (21981): Snaak FriiskL Interfriisk Leksikon. Bredstedt: Nordfriisk Instituut (1. Aufl. 1977) .
- (ed.) (1978): Frasch-Tjüsch-Dänsch Uurdebök. Bredstedt: Nordfriisk Instituut (2. Aufl.) .
KRESS, Bruno (1982): Isländische Grammatik. Leipzig: VEB Enzyklopädie/München: Hueber.
LORENZEN, Jens (ed.) (1977): Deutsch-Halligfriesisch. Ein Wörterbuch. Bredstedt: Nordfriisk Instituut.
SCHMIDT, Hermann (ed.) (1969): Wörterbuch der Sylterfriesisehen Sprache. (Söl'ring Uurterbok). Keitum: Söl'ring Foriining.
STELLER: Walther (1928): Abriß der altfriesischen Grammatik mit Berücksichtigung der westgermanischen Dialekte (...). Halle/ S.: Niemeyer.
WERNER, Otmar (1975): "Flexion und Morphophonemik im Färöischen", The Nordic languages and modem linguistics 2. Proceedings of the Second International Conference of Nordic and General Linguistics, University of Umeä, June 14-19, 1973 (Karl-Hampus Dahlstedt, ed.). Stockholm. Almqvist & Wiksell, 774-791. (1977): "Suppletivwesen durch Lautwandel", Akten der 2. Salzburger Frühlingstagung für Linguistik. Tübingen: Narr, 269-283.
WILTS, Ommo (ed.) (1982a): Tjiisk-Fering Wurdenbuk. Grundwortschatz Deutsch-Friesisch (Westerlandföhrer Mundart). Bredstedt: Nordfriisk Instituut. 2. Aufl. (1982b): Tjiisk-Öömrang Wurdenbuk. Grundwortschatz Deutsch - Friesisch (Amrumer Mundart). Norddorf: FotoQuedens/Bredstedt: Nordfriisk Instituut.
KOMPLEXE FLEXIONSSYSTEME - (K)EIN
PROBLEM FÜR DIE N ATÜRLICHKEITSTHEORIE?1
ZUSAMMENFASSUNG
Nach einer kurzen Übersicht über die wesentlichen Grundlagen der morphologischen Natürlichkeitstheorie wird der Bereich in typologischer und grammatischer Hinsicht näher untersucht, der bislang von dieser Theorie nur sehr unzureichend erfaßt wurde, nämlich die hochflektierenden Sprachen. Es wird gezeigt, daß sich die herkömmliche Natürlichkeitstheorie am besten für agglutinierende Sprachen eignet und eine Übertragung auf flektierende Sprachen zu problematischen Ergebnissen führt, die allenfalls durch Filterfunktionen wie 'einzelsprachliche Natürlichkeit/Normalität' behoben werden können. Entscheidend ist die Feststellung, daß bei weitem nicht alle Flexive in (hoch)flektierenden Sprachen ikonische Relationen abbilden. Im wesentlichen können im Bereich der Nominalflexion nur 'Vielheit' (Kasus im Plural) sowie 'Possession' (Genitive) auf diese Weise abgebildet werden. Alle anderen Kasus sind nur als morphologische Akzidentien im Zusammenspiel mit der Syntax zu sehen. Als wichtig für die Perzeption hochkomplexer Flexionsmuster erweist sich die Fähigkeit zur Gestaltwahrnehmung, wie sie KONRAD LORENZ für andere Zusammenhänge erforscht und begründet hat. Den Anschluß bildet die Anwendung dieser modifizierten Theorie auf die nordgermanischen Sprachen Isländisch und Färöisch. Es zeigt sich, daß diese Sprachen - zumindest bei der Nominalflexion - im Lichte einer derart modifizierten Natürlichkeitstheorie weit weniger aus dem Rahmen fallen, als dies bislang angenommen werden mußte.
81
Seip, Didrik Arup (1924): Dm vilkärene for nedertyskens innflytelse pä nordisk. In: Festskrift tillägnad Hugo Pipping pä hans sextioärsdagen den 5 november 1924. Helsinki 1924, S. 472477.
Thomason, Sarah Grey/Kaufman, Terrence (1988): Language contact, creolization, and genetic linguistics. Berkeleyetc. 1988.
Ureland, Sture (1987): Einleitung. In: P. Sture Ureland (Hrsg.): Sprachkontakt in der Hanse. Aspekte des Sprachausgleichs im Dstsee- und Nordseeraum. Tübingen 1987, S. VII-XXXVlll.
Warter, Per (1993): MANAL. Automatische Lemmatisierung zur Computersimulation des Sprachkontakts. In: Braunmüller/ Diercks (Hrsg.) (1993), S. 195-230.
Weinreich, Unel (1953): Languages in contact: findings and problems. New York 1953. [Dt. Übersetzung: Sprachen in Kontakt. Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung. München 1977.
Wessen, Elias (1954): Dm det tyska inflytandet pä svenskt spräk under medeltiden. (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk spräkvärd, 12). Stockholm 31967. [Reprint aus: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 5 (1929) 265-280.]
Winge, Vibeke (1992): Dänische Deutsche - deutsche Dänen. Geschichte der deutschen Sprache in Dänemark 1300 - 1800 mit einem Ausblick auf das 19. Jahrhundert. Heidelberg 1992.
COPYRIGHT
Den folgenden Verlagen sei für die freundliche Genehmigung zum Wiederabdruck folgender Beiträge gedankt:
"Zur Phonotaktik des Schwedischen: Prinzipien und Tendenzen". Skandinavistik 10, 1980, S. 29 - 60 [J. J. Augustin, Glückstadt
[(Deutschland)].
"Morphologische Undurchsichtigkeit - ein Charakteristikum kleiner Sprachen". Kopenhagener Beiträge zur Germanistischen Linguistik 22, 1984, S. 48 - 68 [Institut for germansk Filologi, K0benhavns Universitet, C. A. Reitzels Forlag, Kopenhagen (Däne
mark)].
"Komplexe Flexionssysteme - (k)ein Problem für die Natürlichkeitstheorie?" Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 43, 1990, S. 625 - 635 [Akademie Verlag
GmbH, Berlin (Deutschland)].
"Kontrastive Pragmatik und interkulturelle Kommunikation". 10. Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik, 22.-29. September 1991 am Weißenhäuser Strand (Bernhard Glienke / Edith Marold, Hg.). Frankfurt/M. etc.: Peter Lang 1993, S. 316 - 330 (Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik, hgg. von Heiko Uecker, Bd. 32) [Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main
(Deutschland)].
"Mittelalterliche Sprachanalysen: Einige Anmerkungen aus heutiger Sicht". Gennanic Dialects: Linguistic and Philological Investigations (herausgegeben von Bela Brogyanyi und Thomas Krömmelbein). John BenjaminS Publishing Company. Amsterdam/Phila
323