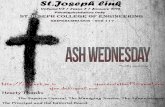'Haltestellen der Globalisierung'. Monumente und Medien im Bildtransfer von Joseph Beuys
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 'Haltestellen der Globalisierung'. Monumente und Medien im Bildtransfer von Joseph Beuys
Martina Baleva, Ingeborg Reichle, Oliver Lerone Schultz (Hg.)
Image Match Visueller Transfer, >Imagescapes<
und Intervisualität
in globalen Bildkulturen
Wilhelm Fink
berlin-brandenoorg· AKADEMIE DER WISSENSCHAmN
Eine Publikation der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Bildkulturen
Gedruckt mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin und des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.
Die Herausgeber danken den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Christoph Markschies, Peter Deuflhard und Jochen Brüning.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe, und der Übersetzung vorbehalten. Dies betrifft auch die
Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente,
Filme, Bänder, Platten und andere Medien, soweit es nicht§§ 53 und 54 UrhG ausdrücklich gestatten.
Umschlagabbildung: Mit freundlicher Genehmigung durch Gabriel S. Moses, aus der Vorderseite der Graphie Novel Spunk, ©Gabriel S. Moses und Archiv
der Jugendkulturen e. V. Einbandgestaltung: Claudia Hecke! (Berlin)
Satz: Druckerei Paul GmbH & Co KG (Lindau) Lektorat: Helmut Hillger (Hamburg), Petra Weigel (Jena)
© 2012 Wilhelm Fink Verlag, München
(Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Internet: www.fink.de
ISBN 978-3-7705-5165-1
INHALT
1 MARTINA BALEVA, INGEBORG REICHLE, ÜLIVER LERONE 5CHULTZ
IMAGE MATCH: neue Indizes einer globalen Bildtheorie
THEORIE-RAHMEN
2 NICHOLAS MIRZOEFF
Die multiple Sicht. Diaspora und visuelle Kultur .
3 PATRIZIA FACCIOLI
Globalisierung als visuelles Phänomen
GESCHICHTS-EINSÄTZE
4 FRIEDERIKE WEIS
5
Maryam - Maria. Bilder aus dem Marienleben aus einer
Mer'ät al-Qods-Handschrift des Moghulhofes ...... .
MARTINA BALEVA
Das Imperium schlägt zurück. Bilderschlachten und
Bilderfronten im Russisch-Osmanischen Krieg 1877-1878
6 PRIYANKA BASU
Die >Anfänge< der Kunst und die Kunst der Naturvölker:
Kunstwissenschaft um 1900 . . . . . . . . . . . . . . . .
7 INGEBORG REICHLE
Vom Ursprung der Bilder und den Anfängen der Kunst.
Zur Logik des interkulturellen Bildvergleichs um 1900 ..
9
27
45
63
87
109
131
MEDIEN-TRANSFERS
8 MICHAELA NICHOLE RASS Mangas: Bildtransfer von West nach Ost und zurück . 153
FARBTAFELN
9 MARKUS RAUTZENBERG Inhabiting Pictures. Possessive Bildlichkeit und die >Pest der Phantasmen< ........... . 177
10 NICOLE E. STÖCKLMAYR Move(ns). Zum Bildtransfer in der Architektur . 193
11 ULF JENSEN >Haltestellen der Globalisierung<. Monumente und Medien im Bildtransfer von Joseph Beuys . . . . . . . . . . . . . . 213
VISUAL EXCERPTS: a graphic novel portfolio
by GABRIELS. MOSES
GEGENWARTS-VISIONEN
12 JÖRG PROBST
Digitale Spiritualität. Das Logo der Love-Parade und die Ideengeschichte der Globalisierung . . . . . . . .
13 IL-TSCHUNG LIM Operative Bilder der Weltgesellschaft. Visuelle Schemata als Globalisierungsmedien am Beispiel von Kunst- und Finanzmärkten . . . . . . . . . . . . .
TRANSFER-ANGEBOTE
14 JACOB BIRKEN Weltenfresser: Eklektizismus als Bildpolitik .
235
255
275
15 GABRIEL S. MOSES The Con-sequential Narrative. Comicsand the unwritten stories of the modern media platform
16 ANNA VALENTINE ULLRICH Bildtransfers als transkriptive Prozesse:
295
ein Beschreibungsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
AUTOREN UND QUELLEN
Bildnachweise . . . . . . 327
Autorinnen und Autoren 331
11
>Haltestellen der Globalisierung< Monumente und Medien im Bildtransfer von Joseph Beuys
ULF JENSEN
Ein beeindruckendes Verständnis globaler Kommunikationsprozesse zeigte bereits der Künstler Joseph Beuys (1921-1986). Er verfolgte die Entwicklung der Technologien aufmerksam, nicht zuletzt deshalb, weil er als Funker bereits mit ihnen vertraut war, als sie noch der militärischen Nutzung vorbehalten waren. Parallel zur Informationswissenschaft, die sich an Problemen der Funktechnik entwickelte, entwarf er ein eigenes Sender-Empfänger-Modell und machte damit die aufkommende Debatte um Medialität zu seiner Sache. Als Bildhauer entwickelte er einen Bildbegriff, der sich von einer alleinigen Ausrichtung auf den Visus abwendete und auf vormoderne und archaische Bildpraktiken rekurriert. Beide Aspekte treten in den Begriffen >Medien< und >Monumenten< gegenüber, auf deren Differenz Beuys bestand. Ausgehend von der Raumplastik »Straßenbahnhaltestelle« werden die Beziehungen zwischen beiden Begriffen entwickelt.
Die Position von Joseph Beuys zu Fragen des Bildtransfers führt zurück in die Jahrzehnte, auf deren Bildpraktiken heutige globale und elektronische Bildtransfers strukturell aufbauen. Das CEuvre eines Bildhauers im Zusammenhang mit dieser Problematik heranzuziehen, mag zunächst verwundern. Für die bildende Kunst bestand ein wichtiger Impuls in der Reibung mit jenen Bildtechnologien, die in den 1960er und 1970er Jahren ihre verbreiterte Anwendung fanden. Die künstlerischen Positionen dieser Zeit nahmen viele Argumente vorweg, die in den folgenden Jahrzehnten im akademischen Diskurs weitergeführt wurden. Beuys entwickelte bereits früh einen Bildbegriff, der die Grenzen des Kunstbetriebes durchbrach oder, seiner eigenen Terminologie nach, >erweiterte<. Dabei stieß er selbstverständlich auch auf Bildformen unterschiedlicher technischer Medien und setzte sich mit Film, Fernsehen und Video, also mit reproduzierbaren und auf heute relevante Weise transferierbaren Bildern auseinander.
Bereits seine Tätigkeit während des Zweiten Weltkrieges als Funker bei der Luftwaffe machte den jungen Beuys mit der Technologie der Nachrichtenvermittlung vertraut, auf der die heutige Informationstechnologie aufbaut. Während seines Studiums der Bildhauerei nach dem Krieg setzte er sich mit dem Filmbild auseinander. Zudem lebte er seit seinem ersten Fernsehinterview 1963 gleichsam in Symbiose mit den publizistischen Medien, deren Bildformate er durch seinen unverwechselbaren Habitus und eine ständige Auskunftsbereit-
214 ULF JENSEN
schaft pflegte.1 Seine künstlerischen Aktionen wurden zunächst vom Fernsehen, dann auch von künstlerischen Filmemachern aufgenommen und von zahlreichen Fotografen dokumentiert. Auch hier entwickelte sich ein Miteinander, das darin gipfelte, dass der Künstler die Projektion der Aktionsfilme in den Ablauf späterer Aktionen integrierte und auf diese Weise technische Bildmedien mit seiner um Körperlichkeit und Prozesshaftigkeit erweiterten bildhauerischen Arbeit konfrontierte. 1977 hatte Beuys die documenta 6 neben anderen Künstlern mit einer neunminütigen Rede eröffnet, die weltweit über Satellitenfernsehen ausgestrahlt wurde. 2 In der Aktion »Global-Art-Fusion« wanderte 1985 eine Zeichnung von Beuys über Fernkopierer nach New York, von dort nach Tokio und schließlich nach Wien. 3
Die Beispiele lassen erkennen, dass Beuys keine Scheu gegenüber technischen Bildmedien empfand und das Potenzial globaler Kommunikationsmittel als Chance begriff.4 Er vermied jedoch, Filme, Fotografien oder Tonaufnahmen als eigene künstlerische Ausdrucksmittel anzuwenden. Wo immer technische Medien im CEuvre des Künstlers vorkommen, sind sie stets durch Bearbeitungen oder Umwidmungen als Materie, als Plastik vorgeführt. So lässt sich an Beuys' CEuvre ein Bildbegriff entwickeln, in dem sich Plastik und Medienbilder polar gegenüberstehen und gleichzeitig bedingen. Im Rückgriff auf zwei im Plural verwendete Begriffe, die einer zeitgenössischen Quelle entnommen sind,5
sollen mit >Monumenten< und >Medien< im Folgenden die beiden Pole bestimmt und das Verhältnis beider Begriffe zueinander entwickelt werden. 6
1. Straßenbahnhaltestelle
Im Herbst 1975 wurde Joseph Beuys eingeladen, für die Biennale in Venedig im folgenden Jahr den Hauptraum des Deutschen Pavillons zu gestalten.7 Nachdem er das seit einigen Jahren ungenutzte Gebäude auf dem Lido besucht hatte,
Siehe Eugen Blume: Joseph Beuys in Film und Video -Anmerkungen zum Aufbau eines audiovisuellen Archivs. In: Inge Lorenz (Hg.): Joseph Beuys Symposium Kranenburg 1995, Basel 1996, S. 211-225; hier S. 224.
2 Siehe Wulf Herzogenrath: Mehr als Malerei. Vom Bauhaus zur Video-Skulptur, Regensburg 1994, s. 287 f.
3 Uwe Schneede: Joseph Beuys. Die Aktionen, Ostfildern-Ruit 1994, S. 386. 4 Siehe Christopher Phillips: Arena: Das Chaos des Namenlosen. In: Joseph Beuys - Arena.
Wo wäre ich hingekommen, wenn ich intelligent gewesen wäre, New York u. a. 1994, S. 52-62; hier S. 53.
5 Johann Heinrich Müller (Hg.): Monumente durch Medien ersetzen ... , Wuppertal 1976. 6 Beide Begriffe, sowohl >Monumente< als auch >Medien<, haben in Kultur- und Medienwis
senschaft seither einen umfangreichen Diskurs angeregt. 7 Die Einladung erteilte der Kommissar des Deutschen Pavillons, Klaus Gallwitz. Die Neben
räume sollten Reiner Ruthenbeck und Jochen Gerz bespielen. Siehe Monika Schalten: >Ausgehen muss man ja von dem, was gegenwärtig ist<. Die >Straßenbahnhaltestelle< zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In: Guido de Werd (Hg.): Joseph Beuys. >Straßenbahnhaltestelle<. Ein Monument für die Zukunft, Kleve 2000, S. 26-66; hier S. 26.
. c
Jr '1[~t I~
-.~).;;:_,,
,-~i;~:
HALTESTELLEN DER GLOBALISIERUNG
Abb. 1: Joseph Beuys, Straßenbahnhaltestelle, 1976, Rauminstallation im Deutschen Pavillon auf der 37. Biennale in Venedig, Fotograf: Manfred Tischer, © by www.tischer.org, © VG Bild-Kunst, Bonn 2012.
215
begann er im Frühling in der niederrheinischen Stadt Kleve mit den Vorbereitungen für seine Raumarbeit mit dem Titel »Straßenbahnhaltestelle«. Im Zentrum der Installation stand der Abguss eines Monuments, das sich im Heimatort des Künstlers befindet. Es handelt sich um eine aufgerichtete Kanone und vier halb in die Erde eingegrabene Mörser - Artilleriewaffen aus dem Dreißigjährigen Krieg, die zu einem Friedensmonument umfunktioniert worden waren. Beuys ließ die Einzelteile des Monuments abformen und in Eisenguss nachbilden, um sie dann zusammen mit einer Straßenbahnschiene und einer Kurbelwelle im Pavillon auf dem Lido aufzubauen (Abb. 1). In die Mündung des Kanonenrohrs platzierte er einen menschlichen Kopf, der mit dem Lauf eine Einheit bildet und dessen Gesichtszüge in Anspielung auf die berühmte Figurengruppe Laokoon im Belvedere einen schmerzvollen Augenblick vergegenwärtigen. Im Zuge des Installationsaufbaus veränderte Beuys die Bausubstanz des Pavillons massiv: Er fundamentierte die schweren Gusseisenelemente, senkte die Straßenbahnschiene in den Boden ein und ließ ein 21 Meter tiefes Loch bohren.
216 ULF JENSEN
Von Juli bis Oktober 1976 konnte die »Straßenbahnhaltestelle« in der mittleren Halle des Pavillons besichtigt werden. Seit ihrer Einrichtung im Jahre 1895 handelte es sich bei der Biennale di Venezia um eine internationale Kunstausstellung, die der Tradition von Weltausstellungen folgte. Insofern reiht sie sich unter die Repräsentationsstrategien imperialer Machtansprüche. Das ist insofern von Bedeutung, da die Kolonialreiche die Dynamisierung zu einer globalisierten Wirtschaftsordnung eingeleitet haben. Beuys maß der Auseinandersetzung mit der Architektur und dem Ort, an dem er seine Arbeit installierte, eine große Bedeutung zu. Dies wird deutlich durch die besonders drastischen Mittel, zu denen er griff: Er ließ ein Loch bis hinab zum geologischen Untergrund der Lagune bohren. So sprengte er nicht nur den architektonischen Rahmen des Pavillons, sondern durchbrach zugleich den Grund des Biennalegeländes und die Geschichte der Stadt- die dort in Form von Bauschutt des 1902 eingestürzten Markusturmes als Unterbau diente. Ein über zwanzig Meter langes Gestänge ragte in das Bohrloch hinab und übertrug über eine rechtwinklige Kurbelwelle den Kontakt zum geologischen Grund in den Ausstellungsraum, in dem bereits das zutage geförderte Erdreich und Schuttmaterial als Bestandteil der Installation aufgeschüttet worden waren.
Eine weitere Bedeutungsebene des Werks, die der Künstler wiederholt angesprochen hat, spiegelt sich in der Materialisierung eines persönlichen Erinnerungsbildes.8 Das Monument in Kleve markierte tatsächlich die Straßenbahnhaltestelle »Zum Eisernen Mann«, die der 1921 geborene Beuys in seiner Schulzeit häufig benutzt hatte und die er mit besonderen Erinnerungen verband. 1961 wurde die Bahnstrecke stillgelegt und das Monument seit 1963 mehrmals versetzt. Im Zuge ihrer Realisierung sprach Beuys über die »harte Arbeit der Erinnerung«, die er mit der »Straßenbahnhaltestelle« zur Anschauung bringen wolle.9 Das Verhältnis zur Zeit wird thematisiert, zur persönlichen und auch kollektiven Vergangenheit, das einmal in der Materialisierung und Überführung der eingebrannten Kindheitserinnerung angesprochen wird und sich zum anderen in der Arbeit mit und an der Architektur manifestiert. Der Deutsche Pavillon, vor dem Ersten Weltkrieg errichtet, repräsentierte das Wilhelminische
8 Zu weiteren Sinnebenen des Werks siehe Ulf Jensen: Straßenbahnhaltestelle. In: Marion Ackermann (Hg.): Joseph Beuys. Parallelprozesse, München 2010. »Ich habe erlebt, an dieser Stelle, als kleines Kind, daß man mit Material etwas Ungeheures ausdrücken kann, was für die Welt ganz entscheidend ist, [. „] daß die ganze Welt abhängt von der Konstellation von ein paar Brocken Material.« Beuys im Interview mit Georg Jappe am 27. September 1976. In: Georg Jappe: Beuys packen. Dokumente 1968-1996, Regensburg 1996, S. 211. Siehe Schalten 2000 (wie Anm. 7), S. 55. Guido De Werd: Straßenbahnhaltestelle -Tramstop -Fermata de! Tram. In: Eckhard Schneider (Hg.): Mythos. Joseph Beuys, Matthew Barney, Douglas Gordon, Cy Twombly, Bregenz 2007, S. 29-32.
9 Beuys, zitiert nach Klaus Gallwitz: Stationen der Erinnerung. Joseph Beuys und seine »Straßenbahnhaltestelle«. In: Justus Müller Hofstede, Werner Spies (Hg.): Festschrift für Eduard Trier zum 60. Geburtstag, Berlin 1981, S. 311-327; hier S. 318.
HALTESTELLEN DER GLOBALISIERUNG 217
Kaiserreich, und seit dem Umbau im Jahre 1938, dem sich die Errichtung der Mittelhalle verdankte, überwog ein »kühle[s], rationale[s] Pathos«.10 Doch ist nicht nur die »Straßenbahnhaltestelle« mit persönlichen Erinnerungen besetzt, sondern auch die Räumlichkeit des Pavillons, den Beuys als eine »phantastische Mischung aus Offizierskasino und Flugzeughangar«11 empfand, bezog die Zeit des Nationalsozialismus mit ein, in der er selbst als Soldat verpflichtet war.
Die Straßenbahnschiene, die sich unterhalb der Bodenplatten fortzusetzen schien, und die Bohrung durch die Sedimentschichten spielten auf Verbildlichungspraktiken von Zeitlichkeit an - Bahn, Strang, Schichtung - und umgaben das im Kanonenkörper fixierte Individuum, das gliederlos und unbeweglich auf einem Punkt verharrte. Die klassische Funktion eines Monuments als öffentliches Erinnerungszeichen12 war damit übererfüllt. Neben den unterschiedlichen Zeitebenen und den mit ihnen aufgerufenen Erinnerungsinhalten setzt sich das Monument auch mit der Struktur von Erinnerung auseinander. Durch die Erschließung sichtbarer und unsichtbarer Dimensionen definierte Beuys einen Gedächtnisort. Insofern gewinnt auch der Titel der Arbeit neben seiner lebensweltlichen Bedeutung einen metaphorischen Sinn. Das Monument markiert eine Stelle, einen Haltepunkt im Hier und Jetzt, an dem Erinnerungsarbeit aufgenommen werden kann.
2. >Ablage<
Nach der sich über drei Monate erstreckenden Biennale gelangten die Bestandteile der Installation in das Kröller-Müller Museum bei Otterlo, das die Arbeit erworben hatte. Mit der Überführung des Werks in einen neuen Kontext war die Auseinandersetzung mit der Struktur von Erinnerung, wie sie anhand der Raumarbeit in Venedig möglich gewesen war, keineswegs beendet, vielmehr sicherte ihr Beuys nun eine neue Qualität. Bereits vor der Entstehung des Werks teilte er seine Intention mit, die »Straßenbahnhaltestelle« nur in Venedig als Rauminstallation aufzubauen und sie später in einem Museum »ZU Hauf gelagert«13 in ihren Einzelteilen auszustellen. Daher ordnete er die Elementeineinem strengen Rechteckschema an (Abb. 2) und versachlichte auf diese Weise die Beziehungen der Teile zueinander, die nun »eine Art >Depot-Plastik<« ergaben, so Beuys: »Die >Straßenbahnhaltestelle< ist insofern beendet, als sie erstmal ein Ergebnis dieser Aktion ist, daß ich also gesagt habe, diese Sache wird nur einmal in Venedig aufgerichtet, und dann wird sie abgelegt.«14
10 Gallwitz 1981 (wie Anm. 9), S. 318. 11 Ebd. 12 Siehe Jens Kulenkampff: Notiz über die Begriffe >Monument< und >Lebenswelt<. In: Aleida
Assmann, Dietrich Harth (Hg.): Kultur als Lebenswelt und Monument, Frankfurt am Main 1991, S. 26-33; hier S. 26 f.
13 Handschriftliche Gesprächsnotiz von Willi Bongard vom 11. März 1976. In: Getty Research Institute, Special Collections, Willi Bongard Research Files, Box 155, Polder 3.
14 Beuys in: Wouter Weijers: Abgelegt. Über Joseph Beuys' >Straßenbahnhaltestelle< im Kröller-Müller Museum. In: De Werd 2000 (wie Anm. 7), S. 112-135; hier S. 122.
218 ULF JENSEN
Abb. 2: Joseph Beuys, Straßenbahnhaltestelle, 1976, abgelegter Zustand, Mythos, Kunsthaus Bregenz, 2. Juni bis 9. September 2007, Ausstellungsansicht Foyer, Foto: Markus Tretter, © Joseph Beuys/VBK, Wien 2007, Kunsthaus Bregenz,© VG Bild-Kunst, Bonn 2012.
Hinter dem Vorgang des Ablegens verbarg sich eine bereits seit 1967 praktizierte Ausstellungsstrategie des Künstlers: Kunstmuseen als Orte der Aufbewahrung und Vermittlung seiner Werke schätzte Beuys ausdrücklich. Sie ermöglichten die adäquate Anschauungsarbeit, die notwendig ist, um die Werke zu erschließen. In der musealen Ausstellungspraxis seiner Zeit war jedoch die autonomieästhetische Einstellung nach wie vor aktuell. Kunstwerke wurden auf einer durch Sockel oder Rahmen der alltäglichen Wahrnehmung enthobenen Weise präsentiert; die Aura des Kunstwerks wurde durch eine optische und räumliche Distanz evoziert. Seine Form der >Ablage< im musealen Raum, auf dem Boden und ohne Sockel liegend, an die Wand gelehnt oder in Vitrinen, ähnlich wie in kulturhistorischen Museen, angeordnet, durchbrach die Distanz des Betrachters zu den Werken. Aura sollte sich nun über die Relation zum Betrachter einstellen; sie musste provoziert werden und entstand nur, wenn der Rezeptionsprozess nicht nur als ein visueller, sondern zugleich auch als ein haptischer Vorgang begriffen wurde. Die meisten seiner abgelegten Werke verwendete Beuys zuvor in Aktionen. Damit aktivierte er an ihnen eine Zeitdimension und begriff das Werk als materiellen Ausgangspunkt eines durch geistige Aktivität zu erschließenden Zusammenhanges, eines >Unsichtbaren<, auf das Beuys immer wieder hingewiesen hat. 15
15 Etwa im Interview mit Mario Kramer, 9. Dezember 1984, zitiert nach Mario Kramer: Joseph Beuys. Das Kapital Raum 1970-1977, Heidelberg 1991, S. 11.
HALTESTELLEN DER GLOBALISIERUNG 219
Die horizontal nebeneinander gelegten Eisenelemente der »Straßenbahnhaltestelle«, die Beuys als abgelegt bezeichnete, bewahren demnach die ursprüngliche Aufstellung in Venedig gleichsam als Potenzial in sich auf. Eine neue Installation hätte die alte Form verdrängt, in ihrer Bedeutung geschwächt oder gar vergessen lassen. Abgelegt sind die Einzelteile; aufbewahrt ist an ihnen der weite Bedeutungskreis, der sich in Venedig um sie entfaltet hatte. In Otterlo befindet sich daher ein Monument zweiter Ordnung, das zwar die Konfrontation mit Material und Form der Einzelteile erlaubt, gleichzeitig aber die höhere Zusammenordnung der membra disjecta erzwingt.16
3. Monumente und Medien
Der Beitrag Beuys' für den Deutschen Pavillon als auch die Arbeiten von Reiner Ruthenbeck und Jochen Gerz wurden von einer Publikation begleitet,17 in der zahlreiche Fotografien den aufwendigen Aufbau der Installation, Details der Plastik und einige Gesamtansichten abbildeten. Da die Fotografien erst Anfang Juli entstanden sein konnten, jedoch bereits Mitte Juli im Katalog publiziert vorlagen, gehörte die derart forcierte fotografische Narration offenbar zum Konzept der Präsentation. Den Raumarbeiten von Beuys, Ruthenbeck und Gerz stand daher von Beginn an ein anderes, ein technisches Bildmedium zur Seite, das dann besonders nach ihrem Abbau aktuell bleiben sollte.
In der Publikation wird Beuys mit dem Ausspruch zitiert: »Medien durch Monumente ersetzen«.18 Der Satz ordnete sich dem Thema der Biennale unter, das eine Auseinandersetzung mit »physischer Umwelt« vorgegeben hatte,19
insofern Monumente eine physische Umwelt voraussetzen, während Medien diese negieren. Beide Begriffe, Medium und Monument, gehörten nicht zum Kernvokabular der sogenannten Plastischen Theorie des Künstlers, die er in Vorträgen und Interviews umfangreich erläutert hat. Beuys spielte damit auf den Titel einer Ausstellung an, die von Februar bis März 1976, kurz bevor er seine Installation im April des Jahres zu realisieren begann, vom Kunst- und Museumsverein Wuppertal veranstaltet worden war. Der Titel lautete: »Monumente durch Medien ersetzen ... «. In dieser Ausstellung wurden von Beuys zwei Aktio-
16 Siehe dazu Manuela Göhner: Rhetorische Ästhetik des Gesamtkunstwerks: Joseph Beuys. Ein Beitrag zur Methode der Kunstkritik aus der Sicht der rhetorischen Anthropologie, Oberhausen 2000, S. 164.
17 Klaus Gallwitz: Beuys. Gerz. Ruthenbeck. Biennale 76 Venedig. Deutscher Pavillon, Frankfurt am Main 1976.
18 Ebd., S. 66 f.; siehe Gallwitz 1981 (wie Anm. 9), S. 327. Siehe Franz-Joachim Verspohl: Wirtschaftswert Brusttee - Von Medien und Monumenten. In: Uwe Geese, Harald Kimpel (Hg.): Kunst im Rahmen der Werbung, Marburg 1982, S. 123-131.
19 Scholten 2000 (wie Anm. 7), S. 27.
220 ULF JENSEN
nen »ausgestellt«. 20 Zahlreiche Fotografien, ein Tonband und ein Film hatten die Funktion inne, die Kunstereignisse aus den Jahren 1965 und 1968 zu vergegenwärtigen.
Dem Begleittext zur Ausstellung von Johann Heinrich Müller ist zu entnehmen, dass Fotografien und Filme, abrufbar als »abstraktes, zeitloses Informationsmaterial«, die Aktionskunst als »eine Art Realitätskonserve« vermitteln könnten. Sie seien, wie alle anderen Bildtechniken auch, nur »für einen allgemeinen Informationstransfer herauspräpariert[e]« Medien.21 Das Argument überzeugte in diesem Zusammenhang dank der Tatsache, dass die Aktionen unwiederbringlich der Vergangenheit angehörten und nur durch die Aufzeichnungstechniken, gleichsam als technische Erinnerungsbilder, vermittelt werden konnten. Nun bestand aber der Sinn und Zweck von Aktionskunst nicht nur in den Augen von Beuys gerade in ihrer Vergänglichkeit. Worauf es ankam, war die gemeinsame körperliche Gegenwart von Künstler und Betrachtern. Insofern konnten technische Medien das Aktionsgeschehen aus seiner Sicht nur dokumentieren, um dann allenfalls als Dokumente quellenkritisch untersucht zu werden. Die Differenz von der Teilhabe an der Aktion und der Kenntnis von der Aktion, wie detailliert diese auch ausfallen mochte, war ihm wesentlich. Müller spitzte seinen Standpunkt zu. Die »unmittelbare subjektive Zeugenschaft« eines Zuschauers, der eine Aktion miterlebt, sei auf ein »registrierendes Beobachten beschränkt«, solange er nicht zum Mitmachen aufgefordert würde. Zum einen beschränke sich das »registrierende Beobachten« auf die menschlichen Fernsinne Sehen und Hören. Zum anderen vermochten es die technischen Medien -Foto, Film und Tonband - seiner Auffassung nach, die Beobachterfunktion zu übernehmen und als gleichwertige Stellvertreter für Auge und Ohr zu wirken. Daher könne die Aktion im Nachhinein mithilfe der entsprechenden Geräte vollwertig repräsentiert werden. Die >Realitätskonserve< könne jederzeit geöffnet und der Zugang zu einem vergangenen Ereignis all jenen ermöglicht werden, die selbst persönlich nicht anwesend waren.22 So begründet sich das Motto der Ausstellung, Monumente und damit sowohl die Originale des bürgerlichen Kunstbetriebs als auch die Aktionen der Avantgarde durch Bilder in technischen Medien zu ersetzen. Das Konzept schloss an Praktiken an, die ab 1968 mit der Prospect-Ausstellungsreihe der Kunsthalle Düsseldorf initiiert worden waren.23
20 Siehe Müller 1976 (wie Anm. 5). Es handelte sich um »Handaktion/Eckenaktion«, die Beuys im Rahmen der Aktion »Der Tisch« 1968 in einem Lokal in Düsseldorf durchgeführt hatte, sowie um Fotos der Aktion »und in uns ... unter uns ... landunter«, die im Rahmen des »24 Stunden«-Happenings 1965 in Wuppertal stattgefunden hatte, siehe Schneede 1994 (wie Anm. 3), S. 216, 84-101.
21 Ebd., S. 11. 22 Dieter Mersch: Ästhetischer Augenblick und Gedächtnis der Kunst. Überlegung zum Ver
hältnis von Zeit und Bild. In: Ders. (Hg.): Die Medien der Künste. Beiträge zur Theorie des Darstellens, München 2003, S. 151-176, thematisiert diesen Aspekt auf S. 171-172 anhand von Aktionen Yves Kleins und Nam June Paiks.
23 Siehe Konrad Fischer et al. (Hg.): Prospect 71. Projection, Düsseldorf 1971.
HALTESTELLEN DER GLOBALISIERUNG 221
Ebenfalls im Jahr 1968 war in Düsseldorf McLuhans Buch Understanding Media. The Extensions of Man für den deutschen Markt unter dem Titel Die magischen Kanäle. >Understanding Media< herausgegeben worden. Die Medientheorie des kanadischen Medientheoretikers versprach eine Untersuchung der »in den Techniken ausgeweiteten Menschennatur«.24 Die Ausweitung der menschlichen Sinnesorgane, wie sie McLuhan teils euphorisch, teils kritisch diagnostizierte, brachte die Metapher von einer neuronalen Vernetzung der Menschen mit und durch die weltumspannenden elektronischen Medienkanäle25 ins Spiel. Bereits das Vorwort der deutschen Ausgabe vermerkte, dass sich die Rezeption der facettenreichen Theorie »vor allem auf die elektronischen Kanäle mit ihrer direkten Erreichbarkeit für Auge und Ohr« verkürzt hatte.26
Die Plausibilität eines neuronalen Kurzschlusses mit der Medienapparatur, die im Wuppertaler Ausstellungskonzept anklingt, setzt eine Sonderstellung des audiovisuellen menschlichen Sinnesapparates voraus. Diese folgt einer erkenntnistheoretischen Tradition, welche das Denken allein im Gehirn verortet und den Intellekt zum Leitvermögen der Conditio humana macht. Es begründet auch die Auszeichnung des Gehirns, das Sinnesdaten verarbeitet und damit eine Wirklichkeit erzeugt. Die über Bildinformationen technischer Medien erzeugte Wirklichkeit konnte mit einer unvermittelt physisch erlebten gleichgesetzt werden. Letztendlich generiere nach dieser Auffassung allein das Gehirn aus technisch vermittelten genauso wie aus unmittelbaren Sinneseindrücken ein Bild der Welt.
Beuys konnte der Analogie zwischen technischen Medien und menschlichen Sinnen nicht folgen. 27 Sein künstlerisches Konzept ging vom Zusammenwirken aller menschlichen Sinne aus, die sich neben Sehen und Hören und neben den Nahsinnen wie Tasten, Riechen und Schmecken auf den Temperatursinn, den
24 Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle. >Understanding Media<, Düsseldorf u. a. 1968, S. 11-12. Neben den neuen und neuesten Informationsmedien umfasst das Panorama auch Abhandlungen über Transportmittel, Kleidung, Waffe~, Sport und Geld. Siehe dazu Dieter Mersch: Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Asthetik des Performativen, Frankfurt am Main 2002, S. 74.
25 Die Beschäftigung mit McLuhan lässt sich für Beuys nur indirekt nachweisen. Ihn verband seit 1962 eine lebenslange Künstlerfreundschaft mit dem koreanischen Künstler Nam June Paik, der sich in seinem Werk kritisch mit der Metapher des »elektronisch erweiterten Nervensystems« auseinandergesetzt hat, siehe Andreas Broeckmann: Maschine - PAIK -Medium. Einige Resonanzen zwischen Nam June Paik und Marshall McLuhan. In: Derrick de Kerckhove et al. (Hg.): McLuhan neu lesen. Kritische Analysen zu Medien und Kultur im 21. Jahrhundert, Bielefeld 2008, S. 338-344; hier S. 341.
26 Peter F. Drucker: Vorwort zur deutschen Übersetzung. In: McLuhan 1968 (wie Anm. 24), S. 5-8; hier S. 8.
27 Auch die Theorie McLuhans lässt sich nicht auf eine solche Analogie reduzieren, siehe Oliver Lerone Schultz: McLuhan, Pasteur des Medienzeitalters. Kausalität als Ansteckung - Zur Diagnose der (elektrischen) Medienkultur. In: Miriam Schaub, Nicola Suthor (Hg.): Ansteckung. Zur Körperlichkeit eines ästhetischen Prinzips, München 2004, S. 51-76.
222 ULF JENSEN
Gleichgewichtssinn und einen allgemeinen inneren Sinn erstreckten.28 Der Bildhauer Beuys ging jedoch noch einen Schritt weiter und schloss aus den physiologischen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts, dass auch in der Zukunft noch weitere Sinne aufgefunden werden könnten, mit deren Wirkung, allerdings unbewusst, bereits in der Gegenwart zu rechnen wäre. Das Argument stärkt die Vorstellung von der primären sinnlichen Konfrontation des Betrachters mit dem Werk, dessen Wirkung sich keinesfalls in einem intellektuellen Verständnis erschöpfe. Denn allein die körperliche Gegenwart von Betrachter und Bildwerk ermöglicht das Erlebnis oder die Erfahrung, und damit eine Qualität der Wahrnehmung, die als ganzheitlich beschrieben werden kann.29 Insofern sind die Rauminstallationen im Spätwerk von Beuys die konsequentesten Umsetzungen einer auf die »Einheit der Sinne«30 angelegten Kunst. Er will damit die Voraussetzung für eine »Reaktivierung der Sinne«31 schaffen, die er als ein Korrektiv zu den einseitigen Rationalismen der Modeme und den daraus erwachsenden Entfremdungen begreift.
Seh- und Hörsinn ordnen sich dieser Auffassung nach gleichwertig in die Reihe der anderen Empfindungsorgane ein. Erst im Zusammenspiel mit den anderen körperlichen Empfindungen verdichten sich die Signale aus der Feme - Sehen und Hören sind die beiden Sinnestätigkeiten, die auf Distanz und mit Orientierung im Raum wahrzunehmen erlauben - zu einem vollständigen Eindruck. Der Unterschied zur Sinnesaffizierung durch technische Medien ist offensichtlich: Hier wird nicht nur mit isolierten visuellen und akustischen >Daten< gearbeitet, sondern die Signale sind entsprechend der technischen Möglichkeiten auf ein solches Minimum reduziert, dass das Gehirn des Menschen gerade noch in der Lage ist, die Informationen zu Bildern oder Klängen zu vervollständigen. Der Stroboskopeffekt in der Kinematografie, auf dem die Bewegungsillusion des Filmbildes beruht, steht nicht weniger für die Datenreduktion als der Zeilenaufbau der Halbbilder im Fernsehen. Auch die Perfektion, mit der
28 Einen historischen Überblick zur Rehabilitierung der Sinne gibt der Psychologe Erwin Straus in seiner Schrift von 1936 (1. Auflage) und 1956 (2. Auflage), siehe Erwin Straus: Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, Berlin u. a. 1978, S. 195-418; ähnlich Helmuth Plessner: Anthropologie der Sinne. In: Günter Dux (Hg.): Philosophische Anthropologie, Frankfurt am Main 1970, S. 187-251.
29 In seiner Überblicksdarstellung zur Lebensphilosophie von 1958 stellte Friedrich Bollnow eine Tendenz zu >ganzheitlichen Denkformen< fest und beschrieb damit geisteswissenschaftliche Bestrebungen im Anschluss an Wilhelm Dilthey, siehe Otto Friedrich Bollnow: Die Lebensphilosophie, Berlin u. a. 1958, S.17. In der bisherigen Beuys-Forschung stand der Einfluss der Anthroposophie im Vordergrund, in welcher der Kunstbegriff von Beuys jedoch nicht aufgeht.
30 So der Titel einer Arbeit Plessners aus dem Jahr 1922: Helmuth Plessner: Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Ästhesiologie des Geistes, Bonn 1965.
31 Franz-Joachim Verspohl: Joseph Beuys. Das Kapital Raum 1970-77. Strategien zur Reaktivierung der Sinne, Frankfurt am Main 1987.
HALTESTELLEN DER GLOBALISIERUNG 223
die technischen Bildmedien in den 1970er Jahren bereits weiterentwickelt worden waren, blieb im Vergleich zur ganzheitlichen Schau bloßes reduziertes Datenmaterial, das sich nur dann zu einer überzeugenden Illusion >hochrechnen< lässt, wenn alle übrigen Sinne stillgelegt werden. Die Überlagerung der restlichen Sinne zeigt sich in der Körperhaltung der Rezipienten: Die Illusion nicht nur von Bewegung im Bild, sondern auch von Raum im Sinne der zentralperspektivischen Konstruktion gelingt nur durch eine Stillstellung des Körpers im Kino-, Fernseh- oder Schreibtischsessel. Mit der Bemerkung: »Daß und wie [der Zuschauer] agiert, ist wichtiger als alles das, was aus der Kiste kommt«, bringt Beuys die Haltung ins Spiel.32
Technische Medien, so lässt sich die Position von Beuys paraphrasieren, sind rationalisierte Bildformen, weil sie nur über Augen und Ohren das Gehirn ansprechen und es zum einzigen Organ der Bildwahrnehmung machen. Solche Bilder werden gedacht - da das Gehirn die Daten vervollständigen muss - und nicht in dem umfassenden Sinn angeschaut, wie es Beuys für seine Kunst einforderte. Technische Medien reduzieren den Prozess der Bildbetrachtung auf Tätigkeiten des Kopfes. Raumgreifende Monumente vom Format einer »Straßenbahnhaltestelle« hingegen reaktivieren den gesamten Körper über Form und Material selbst im abgelegten Zustand bereits durch die Tatsache, dass der Betrachter gezwungen ist, den Anschauungsgegenstand zu umschreiten, um ihn sich zu erschließen.
4. Sender /Empfänger
In den 1970er Jahren begriff man die unkanalisierte Sinnesfülle plastischer Kunstwerke als Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit Sinneinheiten, welche die Intensität von Alltagserfahrung weit übersteigt und zu einem multisensuellen Ereignis werden lässt. Das zeichnet Kunstwerke vor Alltagsgegenständen aus, weil sie die Mündigkeit in der Wahrnehmung voraussetzen und zugleich einfordern sowie Urteilsfähigkeit abverlangen und somit zum Urteilen erziehen. Die aufklärerische Position hatte zu Beginn der 1970er Jahre in Westdeutschland besondere Brisanz. Die Abkehr von obrigkeitsstaatlichen Ordnungsprinzipien, in der Kunst modelliert und politisch durch die Studentenbewegung erprobt, wurde in diesen Jahren beispielsweise durch die Bürgerbewegung in die Breite getragen, der sich Beuys teilweise verpflichtet sah. Die Utopie von einem selbstbestimmten Leben, in vorhergehenden Modellen stellvertretend für alle anderen auf den Künstler übertragen, schien den Akteuren nun unter dem Stichwort der Partizipation für alle greifbar. Die damit verbundene Inauguration eines neuen, angemessenen Ordnungsprinzips, das die Verantwortungs-
32 Beuys im Interview mit Wulf Herzogenrath, April 1982, zitiert nach Herzogenrath 1994 (wie Anm. 2), S. 289. Siehe auch Inge Lorenz: Der Blick zurück. Joseph Beuys und das Wesen der Kunst: Zur Genese des Werks und der Bildformen, Münster 1995, S. 26-34.
224 ULF JENSEN
und Urteilsfähigkeit eines jeden Einzelnen auf den souveränen Einsatz seiner Kreativität zurückführte, brachte Beuys mit seinem berühmten Ausspruch auf den Punkt: »Jeder Mensch ist ein Künstler.«33
Kunstwerke, vor allem aber die >auratische< Beziehung zwischen Kunstwerk und Betrachter in der Anschauung, blieben in Galerien und Museen jedoch nur den Spezialisten vorbehalten. Für eine Vermittlung an ein breiteres Publikum waren die technischen Medien unerlässlich. In einer Doppelstrategie verstand Beuys, die Medien als Informationskanal zu nutzen und zugleich in seinem künstlerischen CEuvre auf die unvermittelte plastische Wirksamkeit zu bauen. Er blieb sich stets des Unterschiedes bewusst, dass Medien »Informationsträger« sind, nicht aber die Ereignishaftigkeit im Sinne einer Teilhabe an der Dauer und der Sinnesfülle eines Werks oder einer Aktion übertragen können.34
Die Strategie einer Erweiterung der Kunst forderte demnach auch eine erweiterte Teilhabe an der Kunst, in dem Sinne, dass bis dahin kunstferne Bevölkerungskreise und -schichten angesprochen werden sollten. So setzte Beuys nicht nur seine Professur an der Düsseldorfer Kunsthochschule aufs Spiel, indem er den Numerus clausus ignorierte und allen Studieninteressenten den Zugang zu seinen Veranstaltungen ermöglichte,35 sondern er konfrontierte auch als Redner das Publikum bei jeder Gelegenheit mit seinen Ideen. Diesen >erweiterten< Lehrauftrag symbolisierte Beuys durch den Einsatz von Schultafeln in seinen Kunstaktionen, um Zusammenhänge zeichnend zu demonstrieren und zu diskutieren. Anlässlich einer Aktion im Jahre 197 4 in London, zwei Jahre vor der Entstehung der »Straßenbahnhaltestelle«, zeichnete er ein Schema seiner Vorstellung von der Informationsübertragung.
Die mit »Letter from London« übertitelte Tafel (Abb. 3) enthält zwei schematische Zeichnungen, von denen in diesem Zusammenhang nur von der oberen die Rede sein soll: Ein Kreis ist links und rechts von zwei vertikalen Linien eingefasst, denen auf einer Höhe die Buchstaben T (links) und R (rechts) zugeordnet sind. Das R steht für >Receiver< und wird an der vertikalen Achse gespiegelt, sodass der dynamische Teil des Buchstabens zum T - das für >Transmitter< steht - weist. Etwa auf der Höhe des Durchmessers im Inneren des Kreises korrespondieren die Buchstaben Sund E mit dieser Anordnung. Auch das Eist gespiegelt; eine gestrichelte Linie verbindet beide Buchstaben. Oberhalb des Kreises wölben sich elliptische Schlaufen, die rechts und links mit Pfeilen auf die Senk-
33 Der Ausspruch ist für 1967 belegt, siehe Johannes Stüttgen: Der Ganze Riemen. Der Auftritt von Joseph Beuys als Lehrer - die Chronologie der Ereignisse an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf 1966-1972, Köln 2008, S. 67. Siehe Götz Adriani et al.: Joseph Beuys: Leben und Werk, Köln 1973, S. 169. Siehe Joseph Beuys, Frans Haks: Das Museum. Ein Gespräch über seine Aufgaben, Möglichkeiten, Dimensionen, Wangen im Allgäu 1975, S.19.
34 Siehe Anja Buck: Beuys und die Medien - Werbung für die Soziale Plastik. In: Christoph Schreier, Anja Buck (Hg.): Joseph Beuys. Zeichen aus dem Braunraum - Auflagenobjekte und grafische Serien, Bonn 2005, S. 128-140.
35 Siehe dazu umfassend Stüttgen 2008 (wie Anm. 33).
HALTESTELLEN DER GLOBALISIERUNG 225
Abb. 3: Joseph Beuys, Letter from London, 1977, Multiple, Lithografie auf Bütten, auf Holzplatte aufgezogen, 89 x 118 x 2,1 cm, Fotograf: Maurice Dorren,© VG Bild-Kunst, Bonn 2011.
rechten stoßen. Als ob sie davon angeregt worden wären, nehmen zwei schlauchförmige Gebilde die Bewegung an den Schnittstellen auf und vermitteln den Impuls zum Inneren des Kreises, wo sie sich schließlich überlagern. In der unteren Hälfte des Kreises verläuft eine kräftige Zackenlinie, die einem Kurvenverlauf ähnelt. Mit dem oberen Zackenverlauf dieser Linie korrespondiert eine feinere, die sich teilweise aufspaltet. In den Verlauf von starker und feiner Linie sind Buchstaben eingestellt, die in Kapitalen das Wort >MATERlA< ergeben. Im oberen Halbkreis ist diesem Begriff das Wort >Information< in Schreibschrift gegenübergestellt.
Die Buchstaben sind Abkürzungen eines Kommunikationsmodells, das die beiden Begründer der Informationstheorie Claude E. Shannon ~nd Warr~n Weaver Ende der 1940er Jahre formuliert hatten. In großer Zuversicht auf die Leistungsfähigkeit der Mathematik beanspruchten die Autoren, dass sich alle Vorgänge mathematisch beschreiben lassen, mit dene~ ein »geist~ges. Wesen« [engl. mind] ein anderes beeinflussen kann. Dazu gehorten ausdruckhch auch die Künste.36
36 Claude E. Shannon, Warren Weaver: The Mathematical Theory of Communication, Urbana 1964, s. 3.
226 ULF JENSEN
Die Genese des universal anwendbaren Kommunikationsmodells aus der Funkpraxis hatte Beuys unmittelbar miterleben können. Als Bordfunker kannte Beuys nicht nur den technischen Aufbau der Geräte im Detail, sondern er bediente in Kampfflugzeugen selbst eine Sender-/Empfängereinheit. Über die Frequenzmodulation elektromagnetischer Wellen ließen sich zunächst Morseund Peilsignale übertragen; auch der Sprechfunk war bereits möglich. Die in der Apparatur erprobten Prinzipien der Nachrichtenübermittlung wurden nach dem Krieg mathematisch verallgemeinert und bildeten die Grundlage nachfolgender Informations- und Kommunikationstheorien. Das künstlerische Konzept von Beuys, dass aus Formen und Praktiken Gedanken werden können, fand er in der Transformation einer Figur aus der Funktechnik in die Kommunikationstheorie bestätigt.
Das auf der Tafel skizzierte Schema fokussiert zwei Schwerpunkte: Zum einen betont es die Einheit von Sender, Empfänger und den zwischen ihnen ablaufenden Prozessen, unabhängig davon, wie groß die Entfernung zwischen ihnen ist. Anders als das Shannon/Weaver-Modell betont Beuys die Aktivität beider Pole. Indem er das > E<, das für >Empfänger< steht, an der vertikalen Achse spiegelt, wird deutlich, dass der Prozess nicht nur in eine Richtung verläuft, sondern dass zugleich eine Art Rückkopplung vorausgesetzt wird oder sogar eine Umkehrung der Signalgebung stattfinden kann. Zum anderen verdeutlicht das Schema, dass die Informationsübertragung an ein Zusammenwirken mit der Materie gebunden ist. Stoff und Form lassen sich nur gemeinsam denken, und so lässt sich Informationsübertragung nur im Zusammenhang mit ihrer materiellen Grundlage begreifen. Im Falle der technischen Medien ist das nicht nur die Apparatur, die den für sich genommen unstofflichen Sendevorgang mittels elektromagnetischer Wellen in der Atmosphäre oder mittels Spannungsimpulsen in Kabeln erst ermöglicht. Vollständig ist das Modell erst dann, wenn Quelle und Adressat der Information benannt werden, und dabei handelt es sich, folgt man Beuys, nicht ausschließlich um Menschen.
5. Kunstwerke als Sender
Beuys ist davon überzeugt, dass er nicht nur als Künstler >sendet<, indem er etwa als Lehrer oder Redner auftritt, sondern dass dieser Effekt auch von Kunstwerken ausgehen kann, sobald es jemanden gibt, der in ein aktives Empfängerverhältnis zu ihnen tritt. Mit der »Straßenbahnhaltestelle« vermochte er im Raum des Deutschen Pavillons eine Atmosphäre zu schaffen, die diesen Aktivierungsprozess begünstigt. An der abgelegten Version in Otterlo lässt sich diese Möglichkeit immerhin erschließen. Wenige Wochen nach dem Guss der ursprünglichen Version wurde eine zweite »Straßenbahnhaltestelle« für einen Berliner Sammler angefertigt. Bis auf eine Weiche, die den geraden Schienenstrang ersetzt, stimmen die Elemente überein. Auch die Berliner Gruppe wurde von Beuys >abgelegt<, das heißt horizontal am Boden angeordnet. Insofern steht
HALTESTELLEN DER GLOBALISIERUNG 227
auch die zweite Version in einem Verhältnis zur Rauminstallation in Venedig. Demjenigen, der am Erleben des Monuments interessiert ist und seine Erfahrungen damit machen möchte, steht dafür auch die zweite Version zur Verfügung. So ist es nicht unangebracht, von einer Verdoppelung der >Sendeleistung< zu sprechen.
Die »Straßenbahnhaltestelle« ist die einzige zu zwei abgelegten Versionen verdoppelte Rauminstallation im Werk von Beuys. Das Prinzip der Vervielfältigung wendete Beuys bereits in seinen zahlreichen Multiples an, die zu erschwinglichen Preisen angeboten wurden. >Physische Vehikel< zur >Verbreitung von Ideen< nannte der Künstler diese Auflagenobjekte,37 die ihren Weg in zahlreiche Wohn- und Arbeitszimmer gefunden hatten. Dass die Verbreitung von Ideen durch die Verbreitung von Kleinplastiken besonders fruchtbar wäre, zeugt abermals von der Überzeugung des Künstlers, dass die Auseinandersetzung mit Gestalt und Form das Denken anregt, da die Form des zu Begreifenden bereits Teil des Begriffenen ist.
Die Multiples, im CEuvre von Beuys seit 1965 durchgängig vorhanden, treten in Konkurrenz zu bisherigen Verbreitungsformen von Gedanken. Bücher, die sich im Kontrast zur Formenvielfalt der Multiples als gebundene Papierquader an einer einheitlichen Grundform orientieren, weisen mit ihrer Orthogonalität auf die grammatische Ordnung in ihrem Inneren. Die Schrift gehört zu den Medien, die direkt über die Augen das Gehirn aktivieren, und sie deaktiviert mit dem Vorgang des Lesens die übrigen Sinne. Noch stärker ist jedoch der Kontrast zu dem Kubus, der sich bis Mitte der 1970er Jahre in den meisten Haushalten als Übertragungsinstrument durchgesetzt hatte: dem Fernseher. Auf die massiv ummantelte Kathodenstrahlröhre richtete sich das übrige Mobiliar aus. Auch im ausgeschalteten Zustand ein Statussymbol, ging von dem auf Empfang geschalteten Gerät mit zunehmender Regelmäßigkeit das Signal zu landesweit synchronisierten Familienversammlungen aus. In dem erweiterten Formverständnis von Beuys, der Bild und Betrachter als eine Einheit begreift, ist das Fernsehen eine zuvor nicht dagewesene Bildform der Entmündigung. Mit der Multiplikation eigener Formen suchte er im Rahmen seiner Möglichkeiten mit der globalen Verbreitung der Monitore mitzuhalten.
6. Bildtransfer und Bild->haltestellen<
Der internationale Ruhm von Joseph Beuys führte dazu, dass heute in keiner auf Gegenwartskunst ausgerichteten Sammlung zumindest eine Auswahl an Multiples fehlen darf. So lässt sich die Tafel »Letter from London« unter anderem in Berlin, New York und Tokio finden. Beuys legte schon zu Lebzeiten Wert darauf, seine >Sender< weltweit zu platzieren. Kaum ein anderer Künstler ist neben sei-
37 Jörg Schellmann: Joseph Beuys. Die Multiples, München u. a. 1992, S. 9; siehe Benjamin Dodenhoff: Die Multiples. In: Ackermann 2010 (wie Anm. 8), S. 170.
228 ULF JENSEN
nem Werk zugleich so stark in Medienbildern präsent. Fernsehfilme, Interviews, Aktionsdokumentationen auf Film oder in Fotografien und die Pressefotografie vermitteln ein Bild des Künstlers, das auf eine zu erschließende Bedeutung der Kunstwerke immer wieder befragt wird. Plastiken, die der Autorschaft des Künstlers und seinem CEuvre zugeschrieben werden, befinden sich stets in Begleitung von Medienbildern, die Beuys nicht selbst hervorgebracht hat.
Bilder als Monumente und Bilder technischer Medien erfüllen im CEuvre von Beuys daher unterschiedliche Funktionen. Monumente, vom Format einer »Straßenbahnhaltestelle« bis hin zu Kleinplastiken, ermöglichen die Auseinandersetzung mit dem Objekt in einer Intensität, die einem Erlebnis oder einer Erfahrung nahekommen. Allerdings bleiben sie einer kleinen Zahl von Interessierten vorbehalten, weil der Zugang begrenzt ist. Medienbilder hingegen vermögen immerhin, begrenzte Informationen über Objekte zu übertragen. Sie vermitteln Kenntnis der Existenz, können jedoch nur ein stark reduziertes, durch das Medium vorgegebenes Spektrum an Objekteigenschaften vermitteln. Zwar ist der Zugang über eine massenhafte Verbreitung einfacher, eine Anschauung des Objektes, die sich zu einer Erfahrung verdichten kann, stellt sich aber nicht ein.
Beuys arbeitete mit beiden Modi des Bildbegriffs und setzte sie entsprechend ein. Den skulpturalen Pol pflegte er als Bildhauer, indem er an seinen Werken gerade die haptischen Eigenschaften besonders herausstellte, die sich nicht anders als durch Präsenz vermitteln lassen. Den medialen Pol beeinflusste er, soweit dies möglich war, in dem Bewusstsein, dass die Aufmerksamkeit, durch Medienbilder hervorgerufen, in dem Umfang anders nicht erzeugt werden konnte. Die Abhängigkeit von Objekt und begleitendem Medienbild war den Werbestrategien der Konsumwirtschaft nicht unähnlich.
Für die Diskussion globaler Bilderströme ist diese polare Konfiguration von besonderem Interesse, weil der Eindruck einer unüberschaubaren Vielzahl an Bildern zumeist aus der Betrachtung von Medienbildern erwächst. Ihre eigentümliche Transparenz38 richten Medienbilder immer auf Objekte oder Ereignisse, also auf Monumente mit den beschriebenen Eigenschaften - das schließt nicht aus, dass Medienbilder ihre eigene Apparatur zum Monument erklären können, wie dies die Kunst mit technischen Medien seit den 1960er Jahren praktizierte.
Im Gegensatz zur Vielzahl der Medienbilder ist die Zahl der Monumente, auf die sie sich richten, begrenzt. Bei den wenigsten handelt es sich um Kunstwerke von einem Reflexionsniveau wie die »Straßenbahnhaltestelle«, einer Installation, die neben der atmosphärischen Räumlichkeit auch ihre zeitliche Dauer thematisiert. Viele der monumentalen Pendants zu Medienbildern teilen die Eigenschaft der Vergänglichkeit, mehr noch: Sie erschöpfen sich in Hand-
38 Siehe Hans Belting: Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München 2001, s. 213-239.
HALTESTELLEN DER GLOBALISIERUNG 229
lungsakten, in Aktionen. So ist es nur konsequent, wenn Beuys sein Werk für Venedig als Aktion begreift, von welcher Fotografien Kenntnis vermitteln.39
Inwiefern ein zwischen den Polen >Medien< und >Monument< oszillierender Bildbegriff konkret auf globale Bildtransfers angewendet werden kann, bleibt der Gegenstand weiterer Untersuchungen. Vermutlich steht den ~eltweit abrufbaren Fernseh- und Computerbildern, deren Anzahl aus einer Uberblicksposition Metaphern der Katastrophe weckt, ein >monumentaler< Pol gegenüber. So ist das Onlinevideo ohne den fensterlosen, klimatisierten, in übermannshohen Metallschränken verschraubten Datenserver nicht zu erfassen, genauso wenig wie die Fernsehserie ohne die Fabrikhallen, welche die Studios für ihre Herstellung beherbergen. Diese >Haltestellen der Globalisierung< sind bei einer formalen Analyse von Medienbildern und der Frage nach ihrem Sinn und ihrer Funktion zu berücksichtigen, auch wenn sie transparent bleiben oder im Laufe der Zeit >abgelegt< werden.
39 Siehe Fotodokumentation in Fritz Getlinger: Joseph Beuys und die »Straßenbahnhaltestel
le«, Kleve 2000.