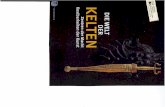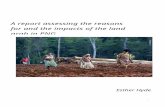Griesheim Grab 400 Die Bügelfibeln der jüngeren Merowingerzeit im Rhein-Main-Gebiet
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Griesheim Grab 400 Die Bügelfibeln der jüngeren Merowingerzeit im Rhein-Main-Gebiet
RELIQUIAE GENTIUM
FESTSCHRIFTFÜR
HORST WOLFGANG BÖHMEZUM
65. GEBURTSTAG
TEIL I
herausgegeben vonClaus Dobiat
Verlag Marie Leidorf GmbH . Rahden/Westf.2005
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Dobiat, Claus (Hrsg.):RELIQUIAE GENTIUM – TEIL I; Festschrift für Horst Wolfgang Böhme zum
65. Geburtstag / hrsg. von Claus Dobiat.
Rahden/Westf.: Leidorf, 2005
(Internationale Archäologie : Studia honoraria ; Bd. 23)
ISBN 3-89646-423-X
Alle Rechte vorbehalten© 2005
Verlag Marie Leidorf GmbHGeschäftsführer: Dr. Bert Wiegel
Stellerloh 65 . D-32369 Rahden/Westf.
Tel: +49/(0)5771/ 9510-74Fax: +49/(0)5771/ 9510-75
E-Mail: [email protected]: http://www.vml.de
ISBN 3-89646-423-XISSN 1433-4194
Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, CD-ROM, DVD, Internet oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages Marie Leidorf GmbH reproduziert werden
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlagentwurf: Claus Dobiat, KirchhainTitelvignette aus: Ludwig Lindenschmit, Altertümer unserer heidnischen Vorzeit 2, Mainz 1870, Heft 12, Taf. 6,4
(Spätantike Riemenzunge aus dem Grabfund von Babenhausen, Kr. Darmstadt-Dieburg)Scans und Bildbearbeitung: Claus Dobiat, Marburg und Volker Hilberg, Schleswig
Satz und Layout: Volker Hilberg und Joachim Schultze, SchleswigRedaktion: Claus Dobiat, Kirchhain; Volker Hilberg, Schleswig; Antje Pöschel, Amöneburg; Joachim Schultze, Schleswig
Druck und Produktion: DSC-Heinz J. Bevermann KG, Fleethweg 1, D-49196 Bad Laer
XXXII, 442 Seiten mit 172 Abbildungen, 6 Karten, 8 Tabellen und 2 Diagrammen
Gedruckt mit Unterstützung von
POSSELT UND ZICKGRAF PROSPEKTIONEN GBRund
WISSENSCHAFTLICHE BAUGRUND-ARCHÄOLOGIE E.V.
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Teil II ist unter dem Titel „Interdisziplinäre Studien zur europäischen Burgenforschung“ bei derDeutschen Burgenvereinigung e.V. in Braubach unter der ISBN 3-927558-24-8 direkt zu beziehen.
195
Griesheim Grab 400
Die Bügelfi beln der jüngeren Merowingerzeit im Rhein-Main-Gebiet
Volker Hilberg
Die Fragestellung: Bemerkungen zum Ende der Bügelfi belbenutzung
In seinem Überblickswerk zu Kunst und Handwerk im frühen Mittelalter stellte Helmut Roth auch vier
bronzene Bügelfi beln von den mittelrheinischen Fundplätzen Bad Kreuznach-Bosenheim, Alsheim,
„Worms“ und Goddelau zusammen, die er zu den spätesten Bügelfi belformen rechnete. Sie seien kurz nach
600 als Einzelstücke entstanden und wurden zu Beginn des 7. Jh. modisch von einzelnen Scheibenfi beln
abgelöst. Diese Bügelfi beln mit Größen zwischen 11 und 14 cm sind charakterisiert durch rechteckige
Kopfplatten mit maskenverzierten Eckelementen zwischen einzeln vernieteten vollplastischen Knöpfen,
ovale Fußplatten mit großen Tierkopffüßen, die zudem in einer „Sicherungsöse“ enden, und eine verderbte
Tierstil-II-Verzierung. „Mit ihnen endet die ca. 150 Jahre währende Geschichte der Bügelfi bel, des wohl
charakteristischsten Utensils der Merowingerzeit überhaupt.“1
Bereits Ludwig Lindenschmit hatte im 19. Jh. mehrfach auf solche großen Bügelfi beln aus Buntmetall-
legierungen aufmerksam gemacht (Abb. 1,1.3.4.6)2, zusammengestellt wurde diese Fibelgruppe erstmals
1934 von Herbert Kühn, der sie als „Fibeln vom Mainzer Typ“ bezeichnete, womit er ihre Herstellung
in der unmittelbaren Umgebung von Mainz betonte3. 1940 konnte Kühn bereits auf 14 Exemplare dieses
Typs verweisen, 1974 waren es immerhin 21 Stück4.
Aufgrund der heterogenen Typenbildung Kühns wurden diese spätesten Bügelfi beln in den vergangenen
Jahren von mehreren Bearbeitern neu diskutiert und auf verschiedene Typen aufgeteilt5. Neben der
Zeitstellung der späten Bügelfi beln6 scheint vor allem ihre Verbreitung bzw. Verwendung in der
merowingischen Frauentracht noch nicht ausreichend geklärt zu sein. Von besonderer Bedeutung für
die Erklärung eines Verschwindens der Bügelfi beln aus der Frauentracht ist die Übernahme einer auf
mediterrane Vorbilder zurückgehenden Einfi beltracht im merowingischen Gebiet seit dem späten 6. Jh.7.
1 H. Roth, Kunst und Handwerk im frühen Mittelalter (Stuttgart 1986) 269 Taf. 30.2 L. Lindenschmit, Über eine besondere Gattung von Gewandnadeln. In: Abbildungen von Mainzer Altertümern (Mainz 1851) Bd. 3, Taf. 2,1.4.6; ders., Die Altertümer unserer heidnischen Vorzeit (Mainz 1858) Bd. 1, Heft 2, Taf. 8,1.3.4.6.3 H. Kühn, Die germanischen Greifenschnallen der Völkerwanderungszeit. IPEK 9, 1934, 77-105 bes. 91f. mit Verbreitung in Abb. 3.4 KÜHN 1940, 346-352 Taf. 109-110 („Typ 47“); KÜHN 1974, 1266-1272 Taf. 331-333 („Typ 47“).5 Insgesamt 10 dieser Fibeln wurden von GÖLDNER 1987, 1. Teil, 197-199 seinem Typ Mainz zugeordnet, seine neue Typendefi nition geht von insgesamt sieben Knöpfen an der Kopfplatte aus. Die anderen Stücke verteilte er auf den Typ Ober-Olm/Nierstein, ebd. 220-222, und mehrere z. T. mit Tierstil verzierte Einzelstücke. – Ausgliederung des sog. Typs Bremen-Mahndorf erstmals durch K. Weidemann in einer Kartierung, ders., Das Land zwischen Elbe- und Wesermündung vom 6.-8. Jh. In: Das Elb-Weser-Dreieck I. Einführende Aufsätze. Führer vor- u. frühgesch. Denkm. 29 (Mainz 1976) 245f. mit Karte.6 Im Folgenden sollen nur die Bügelfi beln des merowingischen Kulturbereiches untersucht werden, andere Fibeltypen in anderen Regionen Europas – wie etwa Rückenknopf-Bügelfi beln in Skandinavien und Friesland oder Fibeln der Typen Trient und Lenzumo, die von der Romanitas im südalpinen Gebiet benutzt wurden – sollen nicht weiter behandelt werden.7 G. Zeller, Zum Wandel der Frauentracht vom 6. zum 7. Jahrhundert in Austrasien. In: G. Kossack/G. Ulbert (Hrsg.), Studien zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie. Festschrift J. Werner (München 1974) Bd. 2, 381-385. – CLAUSS 1987; allgemein RGA VIII (1994) s. v. Fibel und Fibeltracht (M. Martin) 561 erwähnt nur „späte, oft einzeln (und nicht selten Mädchen) ins Grab mitgegebene Bügelfi beln“, betont S. 564, dass die späten Bügelfi beln bei den Langobarden zum Teil „an Größe und Gewicht alles bisher aus der westgermanischen Fibeltracht Bekannte übertreffen“. – Zur jüngermerowingischen Frauentracht zuletzt GRAENERT 2001, 80-92.
197
Nach Alexander Koch vollzog sich durch die Akkulturation an mediterrane Vorbilder eine Übernahme der
mediterran-byzantinischen Fibeltracht im merowingischen Kulturbereich zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten. Im westfränkischen Gebiet wurden am Übergang zur Stufe AM III, also etwa um 560/70, nur noch
vereinzelt Bügelfi beln getragen oder ins Grab mitgegeben, eine Übernahme der Einfi beltracht erfolgte
hier wesentlich früher als in den östlichen merowingischen Gebieten des Rheinlandes, in Süd- und
Südwestdeutschland, „wo man gelegentlich noch um die Mitte des 7. Jahrhunderts Bügelfi beln produzier-
te, trug und ins Grab gab8.“ Ausgehend von dem Fundmaterial des nördlichen Rheinhessen betonte
Gudula Zeller, dass die spätesten Bügelfi beln fast ausschließlich im Mittelrheingebiet und um Mainz
vorkommen, die Herstellung und Verwendung von Bügelfi beln in der jüngeren Merowingerzeit wertete
sie geradezu als Besonderheit dieser Region9. Nach Volker Grünewald hingegen fi nden sich Bügelfi beln
des fortgeschrittenen 7. Jhs. außerhalb des Neuwieder Beckens nur in Ausnahmefällen. Er verweist hierbei
auf Bestattungen wie Freiweinheim Grab 10 in Rheinhessen, Wolfskehlen Grab 2 in Südhessen oder auch
– fälschlicherweise, da nicht ins 7. Jh. gehörend – Heilbronn II Grab 1 im Neckartal10.
Aussagekräftige Neufunde später Bügelfi beln stammen aus mehreren Grabbefunden des Reihengräber-
feldes von Griesheim, Lkr. Darmstadt-Dieburg, einer ländlichen Nekropole auf der rechten Rheinseite,
ca. 25 km Luftlinie von Mainz entfernt. Die späten merowingischen Bügelfi beln sollen im Folgenden
einer erneuten Analyse und Gliederung unterzogen werden. Handelt es sich bei ihnen um Ausnahme-
erscheinungen insoweit, dass in anderen Frauengräbern der untersuchten Gebiete am Mittelrhein um
Andernach bzw. am nördlichen Oberrhein um Mainz (Rhein-Main-Gebiet) am Beginn der jüngeren
Merowingerzeit bereits die moderne, mediterran beeinfl usste Einfi beltracht verwendet wurde? Oder
kann man ein bewusstes Festhalten an der „traditionellen“ Bügelfi bel als Ausdruck eines regionalen
Identitätsbewusstseins im Sinne Eugen Ewigs identifi zieren11?
Griesheim Grab 400 – eine herausragende Bestattung der jüngeren Merowingerzeit
Charakteristik des Gräberfeldes von Griesheim
Zwischen 1971 und 1977 konnte südlich der Stadt Griesheim ein großer Ausschnitt eines Reihengräber-
friedhofes untersucht werden, wobei insgesamt 484-488 Bestattungen in 476 Gräbern sowie vier Pferde-
gräber ausgegraben wurden12. In der Nachbarschaft der Nekropole sind Oberfl ächenfunde von zwei
verschiedenen Siedlungen bekannt, die sowohl spätantikes als auch merowingerzeitliches Fundmaterial
erbracht haben. Weitere frühmittelalterliche Siedlungsstellen mit dendrochronologisch datierten Holz-
brunnen sind im Zentrum Griesheims, ca. 900 m nördlich des Gräberfeldes, belegt. Trotz der Toponymie
8 KOCH 1998, 474; 476; 523-525; Zitat S. 523.9 ZELLER 1992, Teil 1, 118.10 GRÜNEWALD 2001, 57; ders., Reiche Gräber des 7. Jahrhunderts im Neuwieder Becken. In: A. Vogel, Zwischen Kreuz und Schwert. Andernach im 7. Jahrhundert. Andernacher Beitr. 16 (Andernach 2001) 45-60, bes. 57.11 E. Ewig, Volkstum und Volksbewußtsein im Frankenreich des 7. Jahrhunderts [1958]. In: ders., Spätantikes und fränkisches Gallien. Beihefte der Francia 3 (München 1976) Bd. 1, 231-273; vgl. auch F. Cardot, L’espace et le pouvoir. Étude sur l’Austrasie mérovingienne. Histoire ancienne et médiévale 17 (Paris 1987) bes. 181-188, die „l’existence d’un cadre et d’un sentiment austrasiens“ beschreibt.12 Bis heute sind zu diesem großen Gräberfeld erst einige kleine Mitteilungen erschienen, R. Andrae, Griesheim, Kreis Darmstadt-Dieburg. Fränkische Grabfunde. Archäologische Denkmäler in Hessen 1 (Wiesbaden 1977); GÖLDNER/HILBERG 2000. – Die jahrelangen Bemühungen, das Griesheimer Gräberfeld im Rahmen einer Dissertation auszuwerten, scheiterten letztendlich an der eingestellten Restaurierung. Für seine Unterstützung und Hilfe danke ich H. W. Böhme herzlich sowie R. Andrae und K. Knapp in Griesheim und den Mitarbeitern der Hessischen Bodendenkmalpfl ege, H. Göldner und R. Klausmann in Darmstadt, F. Bodis und Kollegen in Wiesbaden. Mein Dank für zahlreiche Angaben zu jüngermerowingerzeitlichem Fundstoff gilt in Mainz D. Quast und B. Heide, in Worms den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des Museums.
198
– einem auf -heim endenden Ortsnamen, dessen Erstglied von ahd. „greoz“ = Sand abgeleitet sein dürfte
– datiert die erste Erwähnung Griesheims in schriftlichen Quellen erst in das Jahr 1165, wobei aus dem
Kontext erschlossen werden kann, dass der König Eigentümer dieses Ortes gewesen ist. Ob andere
Personen in Griesheim begütert gewesen sind, lässt sich nicht feststellen13. Somit wäre es möglich, dass
sich Griesheim bereits im frühen Mittelalter in königlichem Besitz befunden haben kann.
Es wurden zwar ungefähr 500 Bestattungen ausgegraben, aber die Grenzen des Friedhofes konnten nur
im Westen und Osten nachgewiesen werden, im Norden und Süden muss mit weiteren Gräbern gerechnet
werden. Der zentrale Bereich des ausgegrabenen Friedhofareals ist teilweise durch eine Sandgrube zu
Beginn des 20. Jhs. unbeobachtet zerstört worden. Dies ist um so bedauerlicher, da dort der älteste Teil
des Friedhofes liegt, das Bestattungsareal entwickelte sich von dort ohne erkennbaren Bruch nach Osten
und Nordosten. Die Struktur des Gräberfeldes wird seit Beginn der bekannten Belegung in der Stufe AM
II, dem mittleren Drittel des 6. Jhs., dominiert durch zentral gelegene, eventuell überhügelte Bestattungen,
um die sich andere Gräber in einem zumeist ringförmigen Abstand gruppieren. Diese Separierung wird
zudem gegen Ende der jüngeren Merowingerzeit durch die Anlage von Kreisgräben betont14.
Griesheim Grab 400
Im August des Jahres 1977 stieß R. Andrae, damals Leiter der Außenstelle Darmstadt des Hessischen
Landesamtes für Denkmalpfl ege, bei seinen Ausgrabungen im Reihengräberfriedhof bei Griesheim
unter der weiblichen Bestattung 382 in einer Tiefe von 88 cm auf eine weitere Grabgrube. Der Toten
in Grab 382, einer im spätadulten Alter zwischen 30 und 40 Jahren verstorbenen Frau, war ein Messer
beigegeben, weitere Beigaben fanden sich nicht, zudem das Grab im Kopf- und Oberkörperbereich stark
gestört war.
Die tiefere Grabgrube, die die Grabnummer 400 erhielt, erreichte Ausmaße von ca. 2,16 x 1,12 m, Ein-
bauten konnten wie in Grab 382 nicht festgestellt werden (Abb. 2a). In der nördlichen Grabhälfte lag das
Skelett einer Frau senilen Alters von etwa 63-64 Jahren in gestreckter Rückenlage, den Schädel leicht
nach Norden gedreht, beide Arme angewinkelt, wobei die Hände nicht übereinandergelegt, sondern stark
nach außen abgeknickt oder weggeschoben waren. Dieses Grab war nicht beraubt worden und enthielt
eine reiche Grabausstattung der jüngeren Merowingerzeit, die von großer Bedeutung für die Frauentracht
im austrasischen Raum ist.
Auf der Brust der Bestatteten lag eine goldene, mit vier Amethysten verzierte Filigranscheibenfi bel
(Abb. 2,1; 3,1) von 7,3-7,4 cm Durchmesser15, von der ein ca. 45-47 cm langes Gehänge mit bronzenen
13 K. Knapp, Griesheim. Von der steinzeitlichen Siedlung zur lebendigen Stadt (Griesheim 1991) 62f. 67-71; W. Haubrichs, Der Codex Laureshamensis als Quelle frühmittelalterlicher Siedlungsnamen. In: R. Schützeichel (Hrsg.), Ortsname und Urkunde. Frühmittelalterliche Ortsnamenüberlieferung. Münchener Symposium, 10.-12.10.1988. Beitr. Namenforsch. N. F. Beih. 29 (Heidelberg 1990) 144 Anm. 102; STAAB 1975, 239-245 betont die enge Nachbarschaft zwischen königlichem Fiskalbesitz und den Besitzungen privater Eigentümer in dieser Region.14 Hierbei handelt es sich um die Bestattungen 345-346-347, 440/427, 356/408, 361-362, 418/417, 415/409 südlich der modernen Straße, nördlich derselben um die Gräber 127(?), 155, 321/147; Gräber mit Kreisgrabenanlagen: 36, 231/225, 226, 230, 281/272. – Die älteste bekannte Männerbestattung stellt hierbei Grab 440 dar, das in die Stufe AM II datiert werden kann. Neben einer umfangreichen Waffenbeigabe, bestehend aus Ango, Lanze, Spatha und Schild, war der Tote mit einer Feinwaage in einem Etui aus Holz und Leder mit Gewichten sowie einer recht einfachen Eisenschnalle mit stempelverziertem Schilddorn aus Bronze ausgestattet. Vgl. auch H. W. Böhme, Adelsgräber im Frankenreich. Archäologische Zeugnisse zur Herausbildung einer Herrenschicht unter den merowingischen Königen. Jahrb. RGZM 40, 1993, 481-483, irrtümlicherweise wird Grab 440 hier erst in die 1. Hälfte des 7. Jhs. datiert. Die Lage von Grab 321 ist zudem falsch angegeben, ca. 15 m weiter nördlich ist die Bestattung korrekt auf dem Gräberfeldplan eingezeichnet.15 Vgl. die Angaben bei GRAENERT 2001, 154 Kat.Nr. II.29b.
199
Abb. 2. Griesheim Grab 400. a) Befundplan M. 1:20; b) Detailzeichnung des Fibelschmucks, M. 1:5.
200
Abb. 3. Griesheim Grab 400. 1) Goldene Filigranscheibenfi bel; 2) Fibelgehänge; 3) Armring. M. 1:2.
201
Rechteckbeschlägen und verschiedenen Anhängern und Amuletten (Abb. 2,2-4; 3,2) bis in den Beckenbe-
reich hinunterreicht. Von chronologischer Bedeutung ist ein eingehängter subaerater Münzanhänger, ein
Kleinerz aus vergoldetem Kupfer, das nur allgemein in das späte 6. bis in die 1. Hälfte des 7. Jhs. datiert
werden kann16. Hierbei handelt es sich um eine so genannte quasi-imperiale Prägung des südgallisch-
provenzalischen Gebiets, die auf einen in Marseille geprägten byzantinischen Tremissis des zweiten
Typs von Mauricius Tiberius (582-602) zurückgreift (Abb. 3,2)17. Zwischen die rechteckigen Beschläge
sind ferner zwei Amethyst- und eine Kalksteinperle eingehängt. Den Abschluss des Gehänges bildet eine
Tierkopfriemenzunge mit hohler, verschlossener Rückseite (Abb. 2,3; 3,2)18, in deren unteres Ende ein
Rauchtopasanhänger (Abb. 2,4; 3,2) eingehängt ist. Unterhalb der Scheibenfi bel fand sich im Brustbereich
eine große Perlenkette (Abb. 2,5) bestehend aus insgesamt 144 Glas- und 7 Bernsteinperlen, die mit
Stoffresten an der Goldscheibenfi bel angebacken war. Außer kleinen gelben Perlen dominieren mono-
chrome braunrote und braune Perlen von tonnenförmiger bis doppelkonischer Form das Kollier19.
Am linken Unterarm trug die Tote einen bronzenen Armring des Typs Wührer D8 (Abb. 2,6; 3,3)20, der
mit Kreisaugenpunzen und Strichgruppen geometrisch verziert ist. Wenig oberhalb des Beckens, unter
dem linken Unterarm, entdeckte man eine kleine Eisenschnalle (Abb. 2,7). In der Mitte des Beckens lag
eine große bronzene Bügelfi bel (Abb. 2,8) mit der Kopfplatte schräg nach unten. Ca. 4 cm oberhalb ihres
Tierkopffußes, der eine Öse aufwies, fand sich eine kleine Bronzeschnalle (Abb. 2,9), deren Bügel nach
oben Richtung Kopf zeigt und zu der eine Riemenzunge (Abb. 2,10) 3,2 cm weiter nördlich gehört. Die
Bronzeschnalle liegt in Höhe eines durch die Eisenschnalle bezeugten Gürtels.
An beiden Unterschenkeln, vom Knie bis zum Fußgelenk, trug die Tote in Grab 400 jeweils eine mehrteilige
Wadenbindengarnitur aus Bronze (Abb. 2,11), die zu dem Modell III Variante 3 nach G. Clauß gehört,
einem Garniturtypus, der von den in Griesheim bestatteten Damen häufi ger verwendet wurde21. An der
Außenseite des linken Knies lag ein Eisenmesser (Abb. 2,12) in einer mit Bronzenieten beschlagenen
Lederscheide, die mit einer Bronzeöse an ihrem oberen Ende aufgehängt wurde.
16 FMRD V Band 2,1 Darmstadt (1989) 2047,6; H. Schubert in H. Roth/E. Wamers (Hrsg.), Hessen im Frühmittelalter (Sigmaringen 1984) 224 Kat.Nr. 152,25; LfD Hessen Außenstelle Darmstadt, Ortsakte Griesheim, Fundstellenverzeichnis Nr. 10 (Bestimmung Schubert). – Vgl. auch J. F. Fischer, „Nicht alles, was glänzt, ist Gold“. Gefälschte und nachgeahmte Goldmünzen in der Merowingerzeit. Ein Überblick zur Verbreitung und Funktion subaerater Münzen in der „Alamannia“. In: S. Brather/C. Bücker/M. Hoeper (Hrsg.), Archäologie als Sozialgeschichte. Studien zu Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im frühgeschichtlichen Mitteleuropa. Festschrift für Heiko Steuer zum 60. Geburtstag. Intern. Arch. Studia honoraria 9 (Rahden 1999) 173-178 Kat.Nr. 16.17 Grundlegende Typeneinteilung von S. E. Rigold, An imperial coinage in Southern Gaul in the sixth and seventh centuries? Numismatic Chronicle, 6th series, 14, 1954, 93-133; von SCHUBERT (Anm. 16) nicht berücksichtigt. Durch die Korrosion des Kupferkernes ist die Goldplattierung gerade im Bereich der erhabenen Stellen aufgeplatzt und schlecht erhalten, die Legende der Vorder- und Rückseite lässt sich kaum noch erkennen. Die Münzstättenbezeichnung MΛ und die Wertangabe VII sind deutlich zu sehen. Eine genauere Zuordnung zu Rigolds feiner Typeneinteilung ist daher nicht möglich. Zusammenfassend zur quasi-imperialen Prägung Südgalliens Ph. Grierson, The „patrimonium Petri in illis partibus“ and the pseudo-imperial coinage in Frankish Gaul. Rev. Belge de numismatique et de sigillographie 105, 1959, 95-111; Ph. Grierson/M. Blackburn, Medieval European Coinage I. The Early Middle Ages (5th-10th centuries) (Cambridge 1991) 128-131.18 Leider konnte die Riemenzunge bisher nicht geöffnet werden, um festzustellen, ob sich in ihrem Innenraum etwas fi ndet, was auf die Benutzung als Eulogie oder Privatreliquiar schließen lässt. Hierzu zuletzt U. Schellhas, Amulettkapsel und Brustschmuck – Neue Beobachtungen zur rheinhessischen Frauenkleidung des 7. Jahrhunderts. Mainzer Arch. Zeitschr. 1, 1994, bes. 93-97.19 Die Perlen des Griesheimer Gräberfeldes wurden im Rahmen des Projektes „Herstellungstechniken und Herstellungswerkstätten von frühmittelalterlichen Glasperlen aufgrund der farbgebenden Komponenten und Mineralien“ (TU Darmstadt und HU Berlin) durch Christian Matthes in einer Magisterarbeit untersucht. Zu den Perlen von Grab 400 vgl. MATTHES 1998, bes. 69f. und Kap. 10 „Tabellarischer Katalog“.20 B. Wührer, Merowingerzeitlicher Armschmuck aus Metall. Europe médiévale 2 (Montagnac 2000) 68f. Kat.Nr. 219.21 Grundlegend G. Clauß, Strumpfbänder. Ein Beitrag zur Frauentracht des 6. und 7. Jahrunderts n. Chr. Jahrb. RGZM 23/24, 1976/77, bes. 74f. Abb. 7 (mit Verwechslung der Varianten 3 und 4); zuletzt S. Burnell, Die reformierte Kirche von Sissach BL. Mittelalterliche Kirchenbauten und merowingerzeitliche „Stiftergräber“. Archäologie und Museum 38 (Liestal 1998) 145f. – In Griesheim tritt dieser Garniturtypus in den Frauengräbern 155, 196, 205, 288 und 400 auf.
202
Abb. 4. Griesheim, Kr. Darmstadt-Dieburg.a) Bügelfi bel mit Schnalle und Riemenzunge aus Grab 400, M. 1:2.b) Eckelement und vollplastischer Knopf einer Bügelfi bel aus Grab 53, M. 1:2.
Im südlichen Teil der Grube sind von West nach Ost ein zweizeiliger Dreilagenkamm (Abb. 2,13), eine
Röhrenausgusskanne mit Wellenbanddekor auf der Oberwand (Abb. 2,14) sowie mehrere Tierknochen
(Abb. 2,15) einer Speisebeigabe niedergelegt.
203
Die Bügelfi bel von Griesheim Grab 400 und die jüngermerowingischen Bügelfi beln
Die Bügelfi bel aus Griesheim Grab 400
Von überregionaler Bedeutung ist die Fibelausstattung dieses Grabbefundes mit einer großen Filigran-
scheibenfi bel mit Gehänge als Mantelfi bel sowie einer späten hypertrophen Bügelfi bel (Abb. 4a) von
fast 125 g Gewicht mit degeneriertem Tierstil II, Sicherungsöse am Tierkopffuß sowie einer Schnalle mit
zugehöriger Riemenzunge. R. Andrae ließ von dieser Bestattung mehrere Detailzeichnungen anfertigen,
wodurch die Tracht der Toten in Grab 400 minutiös dokumentiert wurde. Durch diesen Griesheimer
Befund ist nun erstmals sicher nachgewiesen, dass die Ösen am Ende des Tierkopffußes zur Befestigung
bzw. zusätzlichen Sicherung der großen und schweren Bügelfi beln dienten.
Um die rechteckige Kopfplatte der Griesheimer Bügelfi bel (Abb. 4a) sind ursprünglich elf profi lierte
Knöpfe mit planer Unterseite auf eisernen Steckachsen einzeln aufgenietet gewesen, heute fehlt ein
Exemplar. Die beiden auf den oberen Ecken befi ndlichen Eckelemente bestehen aus stilisierten Masken
zwischen zwei Knöpfen und waren anscheinend zusätzlich mit der Kopfplatte verlötet. Die Ornamentik
der Kopfplatte ist randlich und in der linken oberen Ecke verwischt und nur undeutlich zu erkennen, was
auf einen unsauberen Guss oder über den Fibelkörper gefl ossenen Lötzinn zurückzuführen sein dürfte.
Auch die Punzverzierung der äußeren Randzone ist kaum zu erkennen, daran schließen ein einfacher
Grat und ein Perlstab an. Das zentrale Feld weist ein depraviertes Tierstil-II-Ornament auf, bestehend aus
einem Tierkopf mit Auge, Ohr und Maul sowie aufgelöstem Körper. Der hohle Bügel ist randlich und auf
dem Mittelsteg mit einfachen Punktpunzen verziert, jede Seite des Mittelstegs ist sechsfach gegliedert
(von außen nach innen: glatt - gekerbt [Perlstab] - glatt - unregelmäßiges Seilband - gekerbt [Perlstab]
- glatt). Der äußere Rand der ovalen Fußplatte ist mit liegenden Andreaskreuzen punzverziert, daran
schließt ein Perlstab zwischen zwei einfachen Graten an. Das zentrale Feld ist ebenfalls mit einer Tierstil-
II-Ornamentik verziert, die jedoch im Unterschied zum Kopfplattenfeld besser ausgestaltet ist. Es handelt
sich um ein hängendes, miteinander symmetrisch verfl ochtenes Tierpaar, deren Körper perlstabgefüllt sind.
Der gewölbte, hohle Tierkopffuß besitzt unregelmäßige Augen und eine arkadenförmige Umrandung, der
Nasensteg trägt eine einfache Kreispunzverzierung. Die Schnauzenpartie wird durch sieben Querrillen
betont. Der untere Abschluss der Fibel wird von einer Öse gebildet, deren innere Weite 1,1 cm beträgt.
Nach dem Guss wurde sie überarbeitet, worauf senkrechte Rillen von einem abgerundeten Werkzeug
auf der Fibelrückseite deuten. Die Rückseite der Kopfplatte besitzt einen mitgegossenen Rahmen, in den
eine eiserne Doppelachskonstruktion eingesetzt ist. Reste einer eisernen Scharnierkonstruktion haben
sich erhalten, wobei das untere, fl achgehämmerte Ende komplett erhalten und in den hohlen Bügel
hineingebogen ist. Die kleine mitgegossene Nadelrast (L. 1,05 cm) ist zur Innenseite deutlich abgenutzt,
wohingegen auf der Vorderseite der Fibel kaum Abnutzungsspuren sichtbar sind. Die Länge der Fibel
beträgt 14,7 cm, die größte Breite der Kopfplatte 7,65 cm22.
Hinweise für eine weitere Bügelfi bel dieses Typs in Griesheim liefert das stark beraubte Frauengrab 53.
In der Grabgrube fanden sich völlig verworfene Skelettreste, die anthropologisch nicht näher bestimmt
werden konnten. Außer einigen Perlen, die heute verschollen sind, einem Riemenzungenpaar aus Bronze
und einer Röhrenausgusskanne, deren Proportionen der Kanne aus Grab 400 sehr gut entsprechen, konnten
noch ein vollplastischer Fibelknopf aus Bronze sowie das maskenverzierte Eckelement von der Kopfplatte
22 Nach GÖLDNER 1987 handelt es sich um seinen Typ IIB:2a. VII:11/n’Ee’/R/8/A/Y.
204
einer bronzenen Bügelfi bel (Abb. 4b) festgestellt werden, das den Eckelementen der Bügelfi bel aus Grab
400 in Form und Größe weitgehend entspricht23.
Bügelfi beln der jüngeren Merowingerzeit – Eine Besonderheit des Rhein-Main-Gebietes und des
Neuwieder Beckens
Eng verwandt mit dieser Griesheimer Fibel ist eine kleine Gruppe von Bügelfi beln, die bisher ausnahmslos
von Nekropolen des Rhein-Main-Gebietes bekannt geworden sind und die als Typ Griesheim bezeichnet
werden sollen. Als kennzeichnende Merkmale können eine Größe von über 10 cm, eine rechteckige Kopf-
und ovale Fußplatte, vollplastische, einzeln angenietete Fibelknöpfe mit Eckelementen sowie eine z. T.
bereits depravierte Tierstil II-Ornamentik bezeichnet werden.
Aus Riedstadt-Goddelau, Kr. Groß-Gerau24, soll als Altfund ein Grabinventar stammen, zu dem außer einer
silber- und messingtauschierten Scheibenfi bel eine bronzene Bügelfi bel von 14,18 cm Länge und noch
130 g Gewicht gehört25. Es handelt sich um die damals größte Bügelfi bel aus Göldners Untersuchungs-
gebiet im mosel- und rheinfränkischen Raum, die er als Einzelstück betrachtete und keinem Typ anschloss.
Aufgrund des Dekors nahm er nach Haseloff ihre Entstehung um 600 an26. Die engzelliges Cloisonné
in Silber- und Messingtausia nachahmende Scheibenfi bel mit Ringwulst des Typs Waltersleben nach R.
Koch deutet auf eine Grablege in der Stufe JM I27. Im Unterschied zur Griesheimer Bügelfi bel lässt sich
die Tierstil II-Ornamentik auf der Kopfplatte der Goddelauer Fibel besser erkennen. Es handelt sich um
zwei miteinander verfl ochtene Tiere mit punktgefülltem Körper, als Konstruktionsprinzip liegt eine Acht
zugrunde28. Die Kopfplatten-Ornamentik der Griesheimer Fibel zeigt hingegen eine weitgehend depravierte
Tierornamentik, hier dürfte nur ein einzelnes liegendes Tier dargestellt sein, dessen Darstellung dem
ausführenden Handwerker augenscheinlich Schwierigkeiten bereitet hat. In zahlreichen Details zeigen
diese beiden Fibeln enge Übereinstimmungen, die auf die Herstellung nach einer gemeinsamen Vorlage
bzw. in einer gemeinsamen Werkstatt deuten dürften. Auch der technische Aufbau des Nadelapparates
ist bei beiden Fibeln gleich: In einen mitgegossenen Rahmen ist eine Doppelspirale eingesetzt, die
untere Achse trägt eine Nadel, die ihre Spannung durch eine einfache Scharnierkonstruktion erhält29.
Der Tierkopffuß der Goddelauer Fibel weist jedoch anders als sein Griesheimer Pendant keine Öse am
unteren Ende auf. Der Fuß ist allerdings beschädigt: Er ist gebrochen, was mit einem ursprünglichen
Vorhandensein einer Öse erklärt werden könnte, und wurde repariert.
Auf der westlichen Rheinseite gegenüber den Fundplätzen Griesheim und Goddelau wurde gegen Ende
des 19. Jhs. in Alsheim, Kr. Alzey-Worms, ein bronzenes Bügelfi belpaar geborgen, das aus einem nicht
23 Einzelne Fibelknöpfe wurden auch in den stark beraubten Griesheimer Gräbern 19/1972 und 431 gefunden, die jedoch keinem bestimmten Fibeltyp zugeordnet werden können.24 Vgl. Fundliste 1, Nr. 4. Anhand des Inventarbuches des Museums Worms lassen sich die widersprüchlichen Fundortangaben nicht klären. Die Angaben „Worms-Schillerstraße“ bzw. „Osthofen“ sind handschriftlich gestrichen und mit „Goddelau“ überschrieben, ohne dass Zeitpunkt, Autor oder Veranlassung dieser Änderung festgehalten sind.25 Gewichte und Maße der einzelnen Fibeln richten sich zumeist nach den Katalogangaben bei GÖLDNER 1987. Gerade bei den Maßangaben ist der Erhaltungszustand der einzelnen Fibeln zu berücksichtigen, da der Nadelapparat fast immer beschädigt ist oder auch vollständig fehlen kann, wie auch das Fehlen einzelner Fibelknöpfe zu einer Verringerung des ursprünglichen Gewichts beigetragen hat.26 GÖLDNER 1987, 1. Teil, 220; HASELOFF 1981, 673.27 Erstmals zusammengestellt von R. Koch, Einheimische Erzeugnisse und Importe des 7. Jahrhunderts aus merowingischen Reihengräbern Württembergisch-Frankens. Veröffentl. Hist. Ver. Heilbronn 25, 1966, 3 Abb. 2,2 Kartierung in Abb. 1. – Zu Ergänzungen siehe unten Anm. 93.28 Vgl. die Zeichnung des Dekors bei GÖLDNER 1987, Teil 1, 220 Abb. 26.29 Museum Worms, Inv.Nr. F1126, eigene Autopsie. Bei der unteren Doppelspirale ist deutlich der Rest eines Scharniers ankorrodiert, vgl. MÖLLER 1987, Taf. 75,4: nicht berücksichtigt bei GÖLDNER 1987 Kat.Nr. 632.
205
dokumentierten Grabbefund stammen dürfte30. Die nahezu identischen Bügelfi beln gehören ebenfalls
zum Typ Griesheim, allerdings weist die Tierstil II-Ornamentik der Kopfplatten eine andere Ausprägung
auf. Göldner vermutete eine Entstehung des Fibelpaares im letzten Viertel des 6. Jhs.31. Der Nadelapparat
dürfte ursprünglich identisch aufgebaut gewesen sein, wies allerdings nur eine Achse auf. Aufgrund
der erhaltenen geringen Nadelreste der einen Fibel könnte sie ursprünglich eine Scharnierkonstruktion
besessen haben32. Während die eine Fibel eine Öse am Tierkopffuß aufweist, besitzt das andere Stück
keine, auch Bruchstellen oder Feilspuren können nicht erkannt werden. Die Fibel mit Öse hat eine Länge
von 11,2 cm und ein erhaltenes Gewicht von 56,2 g, das andere Stück eine Länge von 10,5 cm und ein
Gewicht von noch 56,6 g.
Von einem unbekannten südhessischen Fundort („Starkenburg“) stammt eine bronzene Bügelfi bel von 10,7
cm Länge, die als Variante des Typs Griesheim aufgefasst werden kann33. Ihre Proportionen fallen nicht
so bauchig aus wie die bisher diskutierten Fibeln, vor allem die Fußplatte ist gestreckter. Ihr aufgelöster
Tierstil II lässt sich gut von den Bügelfi beln aus Würzburg-Heidingsfeld in Mainfranken und Gersheim
im Saar-Pfalz-Kreis ableiten34. Sie weist zudem die für Fibeln des Typs Griesheim typische Konstruktion
des Nadelapparates mit durchgehender Doppelachse mit Scharnierkonstruktion auf. Ihr Tierkopffuß besitzt
eine deutliche Übereinstimmung mit der Tierkopfriemenzunge des Fibelgehänges von Griesheim Grab
400 (Abb. 3,2). Gut vergleichbar im äußeren Erscheinungsbild – allerdings mit etwas anderer Ausführung
des depravierten Tierstilornaments und des Tierkopffußes – und in der Konstruktion des Nadelapparates
ist eine bronzene Bügelfi bel von 56 g Gewicht, die als Einzelfund aus Köln stammen soll35.
Die Bügelfi beln von den rheinhessischen Fundplätzen Nierstein (Abb. 1,1) und „Worms“ sowie von
Kaltenwestheim im südwestlichen Thüringen können ebenfalls als Varianten des Typs Griesheim bezeich-
net werden, deren Fußplattenornamentik nunmehr dreifach gegliedert ist36. Die Fibel von Kaltenwestheim
weist zudem aufgrund ihrer Kopfplattenornamentik und der Perldrahtimitationen an den Bügelübergängen
auf einen Zusammenhang mit den größeren Exemplaren von Weidemanns Typ Bremen-Mahndorf hin.
Stilistisch völlig anders ausgebildet ist das Fibelpaar von Waiblingen im Neckartal (Abb. 1,3), dessen
Tierstil II-Ornamentik vollständig durch Flechtbänder ersetzt ist37. Die Rückseiten weisen mit einem
erhöhten Rand und einer Doppelspirale den gleichen technischen Aufbau auf, bei einer Fibel ist zudem
der Rest einer Scharnierkonstruktion erhalten38.
Eine weitere Variante des Typs Griesheim stellt eine 13,9 cm große Fibel von Bad Kreuznach-Bosenheim
dar, deren stark depravierte Tierstil-Ornamentik mit der Tierstil II-Fibel von Mülhofen im Neuwieder
Becken verwandt ist39. Sie besitzt wiederum eine Öse am Tierkopffuß und weist auf der Rückseite eine
in den erhabenen Rahmen eingesetzte Achse mit Scharnierresten der Nadel auf. Ihr erhaltenes Gewicht
erreicht noch 124 g.
30 Fundliste 1, Nr. 1. Ein Grabkontext lässt sich anhand des Wormser Inventarbuches ebenfalls nicht wahrscheinlich machen. Weitere Angaben zur Fundstelle bei KÜHN 1974, 139f.31 GÖLDNER 1987, 1. Teil, 223, aufgrund der Entstehung von Stil II in der zweiten Hälfte des 6. Jhs. nach Haseloff.32 Vgl. ebenso GÖLDNER 1987 Kat.Nr. 6; ebd. Teil 1, 223.33 Fundliste 1, Nr. 9.34 HASELOFF 1981, 654-661.35 Fundliste 1, Nr. 7; bei diesem Stück ist jedoch von der Nadel und ihrer Konstruktion nichts mehr erhalten.36 Fundliste 1, Nr. 6, 8, 11. – Zu dieser Variante dürfte auch ein Fibelbruchstück von unbekanntem Fundort gehören, KÜHN 1974, 1121 Nr. 12 Taf. 308/31,12 („Bayern“, Typ von Soest); GÖLDNER 1987, 2. Teil, 124 Kat. Nr. 600; 1. Teil, 222 (Typ Ober-Olm/Nierstein, Variante B).37 Fundliste 1, Nr. 10.38 Diese Auskunft verdanke ich freundlicherweise Herrn Dieter Quast, der für mich die Nadelkonstruktion beider Fibeln in Stuttgart überprüft hat.39 Fundliste 1, Nr. 5; vgl. GÖLDNER 1987, Teil 1, 225f. – Zur Ornamentik siehe HASELOFF 1981, 650-654.
206
Abb. 5. Verbreitung jüngermerowingischer Bügelfi beln mit rechteckiger Kopfplatte (Nachweise in Fundliste 1).
Bei diesen späten Bügelfi beln ist eine Regionalisierung in der Herstellung deutlich auszumachen. Die
bekannten Belege stammen von nahe beieinander liegenden Fundplätzen des Rhein-Main-Gebietes
(Abb. 6,1). Sehr deutlich sichtbar wird diese lokale Verbreitung bei einem weiteren Bügelfi beltypus, der
als homogene Untergruppe aus Kühns Typ von Soest ausgegliedert werden kann und als Typ Wolfskehlen
bezeichnet werden soll (Abb. 8)40. Fibeln dieser Form stammen bisher nur von den benachbarten bzw.
nicht weit auseinander liegenden Nekropolen von Griesheim (Abb. 7) und Riedstadt-Wolfskehlen in der
hessischen Rheinebene bzw. Ober-Olm und Wörrstadt im rheinhessischen Tafelland41. In ihren Proportio-
nen, dem Flechtbanddekor auf Kopf- und Fußplatten sowie der Gliederung der Bügel verweisen sie auf
eine einheitliche Gussvorlage. Allerdings sind die Tierkopffüße nicht identisch, bei der Fibel von Ober-
Olm fällt der Fuß deutlich länger aus42. Alle Stücke wurden nach dem Guss mit kleinen Dreieckspunzen
zusätzlich verziert und erhielten – soweit erhalten und nachvollziehbar – eine Scharnierkonstruktion des
Nadelapparates. In den Rahmen der rechteckigen Kopfplatte wurden jedoch verschieden ausgestaltete,
vollplastische Knöpfe eingesetzt, woraus leicht unterschiedliche Gesamtlängen zwischen 10,8 und
40 KÜHN 1974, 1120-1125 Taf. 307-309 Typ 31.41 Einzelne Nachweise in Fundliste 1, Nr. 12-15.42 Bereits betont von G. Zeller, Neue fränkische Funde aus Dalsheim, Kr. Alzey-Worms. Mainzer Arch. Zeitschr. 1, 1994, 163.
207
Abb. 6. Verbreitungskarten jüngermerowingischer Bügelfi beln differenziert nach verschiedenen Typen (Nachweise in Fundliste 1).
11,5 cm resultieren. Bei der Fibel von Wörrstadt wurden aufgrund der größeren Dicke der Fibelknöpfe
nur drei statt vier Knöpfe in den oberen Rahmen vernietet43. Auch die Dame in dem gestörten Grab
43 GÖLDNER 1987, 221f. zählt die Fibel von Wörrstadt nur aufgrund der geringeren Fibelknopfanzahl irreführenderweise nicht zum selben Typ wie die Fibeln von Ober-Olm und Wolfskehlen, die er als Varianten zu seinem Typ Ober-Olm/Nierstein rechnet.
208
Abb. 7. Griesheim Grab 205.a) Ausschnitt aus dem Befundplan, M. 1:20. b) Bronzene Bügelfi bel des Typs Wolfskehlen, M. 1:2.
205 des Griesheimer Gräberfeldes trägt eine einzelne
Bügelfi bel des Typs Wolfskehlen (Abb. 7b), die – wie
in Grab 400 – im Beckenbereich gefunden wurde
(Abb. 7a,2). Eine Mantelfi bel ist nicht vorhanden,
sie wurde eventuell bei der sekundären Öffnung des
Grabes gestohlen bzw. entfernt, der Oberkörperbereich
der Toten ist völlig zerwühlt. Auf eine Mantelfi bel
verweist jedenfalls noch ein Fibelgehänge, bestehend
aus kleinen bronzenen Rechteckbeschlägen sowie einer
unverzierten Bronzebulla und einer einzelnen Glasperle
am unteren Ende (Abb. 7a,1). Der Gürtel wurde
wie in Grab 400 von einer einfachen beschlaglosen
Eisenschnalle zusammengehalten, die bronzene
Wadenbindengarnitur gehört ebenfalls zu dem Modell
III Variante 3 mit Klapperriemenzungen (Abb. 7a,3).
Eine silbervergoldete Fibel von Freiweinheim Grab 10
zeigt deutlich den Zusammenhang von älteren Fibeln
des Typs von Soest mit den Erzeugnissen des Typs
Wolfskehlen44. Kombiniert wurde diese Fibel in dem
Freiweinheimer Grab mit einer weiteren bronzenen
Bügelfi bel, die zu Göldners Typ Mainz gezählt werden
kann45. Dieser von zehn verschiedenen Fundplätzen
Abb. 8. Verbreitung der jüngermerowingischen Bügelfi beln des Typs Wolfskehlen (Nachweise in Fundliste 1).
44 KÜHN 1974, 252 Kat.Nr. 145 Taf. 47; ZELLER 1992, 62 Taf. 37,1; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 41f. Kat.Nr. 196; zur Datierung des Grabinventars in die Stufe JM I siehe zuletzt A. Wenzel, Zwischen Childerich und Karl dem Großen. Der Ingelheimer Raum in fränkischer Zeit (5.-7. Jahrhundert n.Chr.). Katalog zur Ausstellung, Nieder-Ingelheim 1997 (Ingelheim 1997) 38-40.45 Fundliste 1, Nr. 19. – GÖLDNER 1987, 197-199.
209
belegte Fibeltypus (Abb. 1,4.6) scheint hauptsächlich als Einzelfi bel verwendet worden zu sein, neben Grab
10 von Freiweinheim ist nur von dem saarländischen Fundplatz Gersheim ein Fibelpaar bekannt46. Die
Fibeln dieses Typs sind mit Längen zwischen 10 und 10,8 cm etwas kleiner und mit erhaltenen Gewichten
zwischen 51,5 und 58,8 g bzw. 70 g auch deutlich leichter als die bisher diskutierten jüngermerowingischen
Bügelfi beltypen47. Weitere Unterschiede bestehen in den mitgegossenen Fibelknöpfen und Eckelementen,
wobei immer insgesamt sieben Knöpfe vertreten sind. Die Rückseiten weisen im Kopfplattenbereich keine
erhabenen Rahmen mehr auf, sondern sind fl ach gegossen und besitzen nunmehr enge doppelständige
Achslager. Auch wenn bei fast allen Fibeln kein Nadelapparat mehr erhalten ist, betonte Göldner die
wahrscheinliche Verwendung von Scharnierkonstruktionen, worauf die engen Abstände des Achslagers
verweisen. Nur bei der Fibel von Dirmstein lässt sich noch eine Eisennadel mit völlig korrodiertem
Scharnier beobachten48. Die Ornamentik der Kopf- und Fußplatten ist weitgehend aufgelöst und zeigt einen
mehr oder minder stark stilisierten Tierstil II-Dekor. Die ebenfalls verschieden ausgestalteten Tierkopffüße
weisen bei den Exemplaren von Dirmstein und Bad Homburg-Gonzenheim Grab 2 am unteren Ende
Ösen auf. Eine kleine Öse besitzt auch die Fibel von Mülhofen „Auf’m Röthchen“, Kr. Mayen-Koblenz,
in die ursprünglich ein kleines, mit zwei Nieten zusammengehaltenes Bronzeblech eingesetzt gewesen
ist49. Göldner betonte die Verbreitung dieses Fibeltyps im rheinfränkischen Raum und vermutete die
Herstellung in mehreren Werkstätten.
Das Hauptverbreitungsgebiet dieses recht homogenen Fibeltyps ist eindeutig das Rhein-Main-Gebiet, nur
ein einzelner Beleg lässt sich mit Mülhofen im Neuwieder Becken fassen. Weitere Einzelstücke fi nden
sich im Blies- und im Neckartal (Abb. 6,2).
Die Trennung zwischen dem Mittelrhein-Gebiet um Andernach und dem Rhein-Main-Gebiet um Mainz
lässt sich sehr deutlich ebenfalls bei den anderen Typen der jüngermerowingischen Bügelfi beln feststellen.
Die Typen Andernach-Rengsdorf mit rechteckiger Kopfplatte (Abb. 6,3) und Andernach-Kärlich mit
halbrunder Kopfplatte (Abb. 9) sind hauptsächlich im Neuwieder Becken verbreitet, einzelne Belege
fi nden sich in Rheinhessen und auf der Schwäbischen Alb50. Für die Nadelapparate dieser Fibeln wurden
sowohl Spiral- als auch Scharnierkonstruktionen verwendet51.
Jüngermerowingische Bügelfi beltypen sind in größerer Ausprägung somit sowohl im Rhein-Main-Gebiet
als auch im Neuwieder Becken belegt (Abb. 5). Im Rhein-Main-Gebiet dominieren Fibeln der Typen
Mainz und Griesheim, während am Mittelrhein die Typen Andernach-Rengsdorf und Andernach-Kärlich
vorwiegend verwendet und sicherlich auch hergestellt wurden. Darüber hinaus kommt es zur Ausbildung
von ausgesprochen kleinräumig verbreiteten Typen, von denen diejenigen von Griesheim und Wolfskehlen
ausführlicher besprochen wurden. Hieran wären auch die Fibeln des Typs Oestrich nach Kühn mit
46 Fundliste 1, Nr. 16-25.47 Die mit 10,8 cm größte Fibel dieses Typs ist das Exemplar von Ingelheim-Freiweinheim Grab 10 (Fundliste 1, Nr. 19), deren erhaltenes Gewicht von 70 g deutlich über dem Durchschnittsgewicht von 55,35 g der anderen von Göldner gewogenen Bügelfi beln des selben Typs liegt.48 Eigene Autopsie, Museum Worms Inv.Nr. F779.49 Vgl. die Katalogangaben bei GRUNWALD 1998, 205.50 Typ Andernach-Rengsdorf: Fundliste 1, Nr. 26-36; Defi nition nach GÖLDNER 1987, 212-214; weitere fundortlose Fibel im Museum Hamm, KÜHN 1974, 476 Kat.Nr. 444 (Rheinhessen?) Taf. 143. – Typ Andernach-Kärlich: Fundliste 2, Nr. 3-12; Defi nition nach GÖLDNER 1987, 126-129.51 Typ Andernach-Rengsdorf: Spiralkonstruktionen bei Andernach-Kirchberg (Fundliste 1, Nr. 26), Kaltenengers (Fundliste 1, Nr. 32) und evtl. Bopfi ngen (Fundliste 1, Nr. 29, freundliche Auskunft D. Quast); Scharnierkonstruktionen bei Andernach (Fundliste 1, Nr. 28), Engers „Feuerhöhle“ Grab 1 (1954) (Fundliste 1, Nr. 30), Saffi g Grab 224 (Fundliste 1, Nr. 36). – Typ Andernach-Kärlich: fragliche Spiralkonstruktion bei der Fibel von Mainz-Laubenheim (Fundliste 2, Nr. 8), ansonsten nur Scharnierkonstruk-tionen belegt: Andernach (Fundliste 2, Nr. 3), Andernach (Fundliste 2, Nr. 4), Niederbieber Grab 6 (Fundliste 2, Nr. 10).
210
Abb. 9. Verbreitung jüngermerowingischer Bügelfi beln mit halbrunder Kopfplatte (Nachweise in Fundliste 2).
halbrunder Kopfplatte (Abb. 9)52 oder die Bügelfi beln mit rechteckiger Kopfplatte aus drei verschiedenen
Grabbefunden von Bad Kreuznach anzuführen, die trotz ihrer merkwürdig stilisierten Ornamentik und
mitgegossenen Knöpfe eine Verwandtschaft mit der Fibel von Bad Kreuznach-Bosenheim zeigen, die als
Variante dem Typ Griesheim angeschlossen werden konnte53. Zahlreiche einzeln auftretende Sonderfor-
men können in Details diesen Fibelserien locker angeschlossen werden, Kühn ordnete sie alle seinem Typ
von Mainz zu. So hängt etwa das Exemplar von Dettingen im Maintal bei Aschaffenburg aufgrund der
Fußplattenornamentik stilistisch mit dem Typ Andernach-Kärlich zusammen, die halbrunde Kopfplatte
dieses Typs ist bei dem mainfränkischen Derivat jedoch durch eine rechteckige Form ersetzt, wobei die
bogenförmige Gliederung allerdings wiederum auf den Typ von Andernach-Kärlich weist54. Eine Bügel-
fi bel singulärer Form von Dalsheim, Kr. Alzey-Worms55, lässt sich als einfachere Ausführung sehr gut
vergleichen mit einer versilberten und vergoldeten Bronzebügelfi bel von 15,4 cm Länge aus Grab 319
des alamannischen Reihengräberfriedhofes von Neudingen, Schwarzwald-Baar-Kreis. Dieses Stück
wurde von T. Brendle und V. Bierbrauer als langobardisches Erzeugnis, als Stil II-verzierte Version des
stempel-verzierten Typs Rieti, identifi ziert und an den Beginn des 7. Jhs. datiert56.
52 Vgl. Fundliste 2, Nr. 1-2 von Oestrich im Rheingau und Ober-Olm in Rheinhessen; KÜHN 1974, 1273-1275 Taf. 333, Typ 48; GÖLDNER 1987, 1. Teil, 121.53 Belege in Fundliste 1, Nr. 43-45; zur Vorlage von Bosenheim vgl. Fundliste 1, Nr. 5.54 Fundliste 1, Nr. 48. 55 Fundliste 1, Nr. 46. – Hierzu umfassend HILBERG, 2001, 300-310.56 Fundliste 1, Nr. 47.
211
Weitere Beziehungen zum langobardischen Raum sind etwa durch eine kleine Bügelfi bel von Asti, Prov.
Asti, Piemont, greifbar, die in ihrer Formausprägung eine deutliche Verwandtschaft mit den beiden Fibeln
des Typs Oestrich zeigt57.
Auch die mitgegossene Drahtraupenzier am Bügel, die sich nicht nur auf der Fibel von Neudingen
Grab 319, sondern auch auf den Bügelfi beln des Typs Bremen-Mahndorf fi ndet, ist charakteristisch für
langobardische Fibelerzeugnisse des östlich-merowingischen Reihengräberkreises58.
H. Göldner hatte als erster auf eine Scharnierkonstruktion statt der ansonsten üblichen Spiralkonstruktion
des Nadelapparates von Bügelfi beln aufmerksam gemacht59. An insgesamt zehn Einzelstücken bzw. Paaren
konnte er diese technische Eigenart nachweisen, wobei insgesamt sechs Fundplätze im Neuwieder Becken
liegen. Es handelt sich ausnahmslos um späte bronzene Bügelfi belformen, deren Herstellung er in die
2. Hälfte des 6. Jhs. datiert. Er vermutete zudem die Herstellung dieser Fibeln in einer gemeinsamen,
in der Umgebung von Neuwied befi ndlichen Werkstatt60. Scharnierkonstruktionen treten an späten
Bügelfi beln jedoch nicht nur bei den Typen Andernach-Kärlich mit halbrunder bzw. Andernach-Rengsdorf
mit rechteckiger Kopfplatte auf, sondern sind ebenfalls charakteristisch für die späten Bügelfi beln des
Rhein-Main-Gebietes61. Die Produktion in einer einzigen Werkstatt erscheint somit ausgeschlossen. Ob
die Eigenart, eine Scharnier- statt Spiralkonstruktion zu verwenden, von langobardischen Bügelfi beln
übernommen wurde, wie es von Brendle neuerdings betont worden ist62, lässt sich momentan zwar noch
nicht sicher belegen, erscheint aber möglich.
Eine Entwicklung der jüngermerowingischen Bügelfi beln aus älteren Vorläuferformen ist ebenfalls gut
nachvollziehbar bei einer bronzenen Bügelfi bel aus Grab 429 von Griesheim, die zum Typ Cividale nach
Kühn gehört (Abb. 10). Diese Fibel wurde – recht schlecht ausgebildet – den älteren und sorgfältiger
gearbeiteten Cividale-Fibeln, deren Laufzeit in die zweite Hälfte des 6. Jhs. fällt63, nachgegossen und mit
einer Scharnierkonstruktion des Nadelapparates versehen. Aufgrund der Perlenkette wurde die in maturem
Alter zwischen 40 und 60 Jahren verstorbene Frau im Verlauf der Stufe JM I bis JM II bestattet64. Auch
für die Verwendung der Scharnierkonstruktion lassen sich in dieser Fibelgruppe weitere Belege heran-
57 KÜHN 1974, 1274 Taf. 333, 48/3; ein weiteres fundortloses Stück ebd. 48/4.58 J. Werner, Die Langobarden in Pannonien. Beiträge zur Kenntnis der langobardischen Bodenfunde vor 568. Bayer. Akad. Wiss. Phil.-Hist. Klasse N.F. 55A (München 1962) 66; U. Koch, Das fränkische Gräberfeld von Klepsau im Hohenlohekreis. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 38 (Stuttgart 1990) 149.59 GÖLDNER 1987, 1. Teil, 290f.60 Ebd. 296-298, dort vermutet er eine Abhängigkeit zum merowingischen Könisghof in Andernach. Dieser Gedanke wurde von H. Roth pointiert weiterentwickelt, ROTH 1994, 517-522.61 Belege für Scharniere: Typ Griesheim: Alsheim (Fundliste 1, Nr. 1; Scharnierreste?), Griesheim Grab 400, (Fundliste 1, Nr. 3), Riedstadt-Goddelau (Fundliste 1, Nr. 4), Bad Kreuznach-Bosenheim (Fundliste 1, Nr. 5) „Starkenburg“ (Fundliste 1, Nr. 9), Waiblingen (Fundliste 1, Nr. 10; frdl. Mitteilung D. Quast). – Typ Wolfskehlen: Griesheim Grab 205 (Fundliste 1, Nr. 12), Wörrstadt Grab 1 (1905) (Fundliste 1, Nr. 15; Scharnierreste?). – Typ Mainz: Dirmstein (Fundliste 1, Nr. 17), Egartenhof (Fundliste 1, Nr. 18; Scharnierreste? Frdl. Mitteilung D. Quast), Freiweinheim Grab 10 (Fundliste 1, Nr. 19; Scharnierreste?); Typ Andernach-Rengsdorf: Andernach (Fundliste 1, Nr. 28), Engers „Feuerhöhle“ Grab 1 (1954) (Fundliste 1, Nr. 30), Saffi g Grab 224 (Fundliste 1, Nr. 36); Sonderformen: Neudingen Grab 319 (Fundliste 1, Nr. 47); Typ Oestrich: Oestrich (Fundliste 2, Nr. 1); Typ Andernach-Kärlich: Andernach (Fundliste 2, Nr. 3), Andernach (Fundliste 2, Nr. 4), Niederbieber Grab 6 (Fundliste 2, Nr. 10). – Göldner führte lediglich Bügelfi beln der Typen Wolfskehlen (Wörrstadt) bzw. Griesheim (Alsheim, Bad Kreuznach-Bosenheim, Goddelau-Erfelden) auf. Aufgrund der von ihm berücksichtigen Fibeln seines Arbeitsgebietes und dem dadurch resultierenden Fehlen der späten Bügelfi beln von rechtsrheinischen Fundplätzen kommt es zu einer Fehleinschätzung.62 BRENDLE/BIERBRAUER/DÜWEL/MEINEKE 2001, 353f. 357.63 Vgl. GÖLDNER 1987, 1. Teil, 247-249; KOCH 1998, 334-339, billigt ihnen eine lange Benutzungsdauer vereinzelt bis in die jüngermerowingische Periode zu, woraus sich auch ihre weiträumige Verwendung von Pannonien über Italien, die Alamannia und das Rheinland bis in das westfränkische Nordgallien erklären lasse.64 Nach MATTHES 1998, 73f. Beilage 1, gehören die Perlen zu seiner Perlen-Kombinationsgruppe B2, die er mit Schretzheim Phase 5 (absolutchronologisch etwa 620/30-650/60) synchronisiert.
212
ziehen65. Typologisch älter als die jüngsten Bügelfi beln sind ebenfalls die dem Typ Worms zugehörigen
Stücke von „Minden“/„Neuwieder Becken“ und „Ohne Fundort/Neuwieder Becken“66, bei denen Göldner
ebenso Scharnierkonstruktionen beobachten konnte. Alle diese Belege verweisen darauf, dass die Schar-
nierkonstruktion bereits im Verlauf der Stufen AM II-III an unterschiedlichen fränkischen und zum Teil
langobardischen oder langobardisch beeinfl ussten Bügelfi beln Verwendung fand. In der Stufe JM I war die
Verwendung einer Scharnierkonstruktion für den Nadelapparat dann ein übliches technisches Detail der
verschiedenen Werkstätten sowohl im Rhein-Main-Gebiet als auch im Andernach-Neuwieder-Raum67.
Auch die Zwickelmasken der Eckelemente an den Kopfplatten können an älteren Fibeltypen, die dem
Typ Schwarzrheindorf zugeordnet werden, vereinzelt festgestellt werden68. A. Koch verweist ebenso auf
die Fibeln des Typs Schwarzrheindorf, die die Entwicklung der Knopfeckelemente der jüngermerowin-
gischen Fibelgruppen vorwegnehmen, und vermutet, dass die Fibeln des Typs Schwarzrheindorf von ihren
Trägerinnen noch in JM I, zu Beginn des 7. Jhs., getragen worden sein können69. Annähernd zeitgleiche
langobardische Bügelfi beln könnten ebenfalls als Vorbilder in Betracht kommen, da mehrere Exemplare
mit halbrunder Kopfplatte bekannt sind, deren Zonenknöpfe als stilisierte Masken ausgebildet sind70.
Solche Masken dürften nicht als einfacher Zierrat verstanden werden. Als stilisierte Darstellung eines
Abb. 10. Griesheim Grab 429. Bronzene Bügelfi bel des Typs Cividale, M. 1:2.
65 Scharnierkonstruktionen weisen auch die Fibeln von Oberlahnstein, Rhein-Lahn-Kreis (H. Neumayer, Merowingerzeitliche Grabfunde des Mittelrheingebiets zwischen Nahe- und Moselmündung. Arch. Schr. Inst. Mainz 2 [Mainz 1993] 199 Taf. 40,1), Böblingen-Dagersheim, Kr. Böblingen (KÜHN 1974, Taf. 320 Nr. 41,1; Beobachtung zum Nadelapparat frdl. Mitteilung D. Quast) und Güttingen Grab 7, Kr. Konstanz (G. Fingerlin, Die alamannischen Gräberfelder von Güttingen und Merdingen in Südbaden. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit A 12 [Berlin 1971] 58; 171 Taf. 6,2), dessen Grablege in die Stufe JM I fällt, auf.66 „Minden-Grabfund, Kr. Bitburg-Prüm“ oder „Neuwieder Becken“: GÖLDNER 1987, 2. Teil, 83f. Kat.Nr. 403 mit Anm. 23 (Frage des Fundorts); KÜHN 1974, 1039 Nr. 13 Taf. 299,30/13. – Ohne Fundort/„Neuwieder Becken“: GÖLDNER 1987, 2. Teil, 121f. Kat.Nr. 585/586; KÜHN 1974, 1039 Nr. 14 Taf. 299,30/14; Göldner hält eine Herstellung bereits in der Mitte des 6. Jhs. für möglich. KOCH 1998, 275-279 betont, dass diese Fibeln auch noch nach dem zweiten Drittel des 6. Jhs. „bei offensichtlich konservativen, weniger an neuen Modetrends beteiligten Bevölkerungskreisen“ (S. 279) verwendet wurden.67 Es muss allerdings betont werden, dass der Nachweis einer Scharnierkonstruktion oftmals durch Korrosion des Nadelapparates unmöglich ist und dann nur durch Röntgenaufnahmen oder Neurestaurierungen geklärt werden könnte.68 GÖLDNER 1987, 1. Teil, 225 mit Belegen in Anm. 34, die alle aus dem fränkischen Raum stammen und s. E. in die Mitte bis 2. Hälfte des 6. Jhs. datieren.69 KOCH 1998, 283f.70 Vgl. etwa S. Fuchs/J. Werner, Die langobardischen Fibeln aus Italien (Berlin 1950) A 73 Taf. 15 (Castel Trosino Grab J); A 76 Taf. 17 (Nocera Umbra Grab 158); A 77 Taf. 17 (Nocera Umbra Grab 29); A 78 Taf. 19 (Chiusi Grab 3, zusätzlich stilisierte Maske im Kopfplattenfeld); A 81/82 Taf. 23 (Nocera Umbra Grab 37).
213
Schutz und Glück verheißenden Heilsbildes kann ihnen vielmehr ein magischer oder übelabwehrender
Sinninhalt zugesprochen werden71.
Ein charakteristischer Bestandteil der jüngermerowingischen Bügelfi beln stellt die Öse am Tierkopffuß
dar. Er ist sowohl bei großen und schweren Bügelfi beln als auch bei kleineren und leichteren Fibeln
vorhanden und kann somit nicht ausschließlich durch eine zusätzliche Sicherung schwerer Bügelfi beln
erklärt werden72. Interessant ist die Beobachtung bei dem Fibelpaar von Alsheim, wo nur bei einer
der beiden Bügelfi beln eine Öse am Tierkopffuß vorhanden ist, was sich auch bei dem Fibelpaar von
Waiblingen nachweisen lässt, wo ebenfalls nur eine der beiden Fibeln ein abgesetztes Fußende aufweist
(Abb. 1,3). Eine mit dem Befund von Griesheim Grab 400 vergleichbare Befestigung des Fibelfußes
ist nur bei der Fibel des Typs Mainz von Mülhofen „Auf’m Röthchen“ nachgewiesen73. Hier gehört ein
kleiner Bronzebeschlag in die Öse. Bei älteren Bügelfi beln sind solche Ösen am Tierkopffußende noch
unbekannt, Ösen treten vielmehr auf der Fibelrückseite auf74.
Späte Bügelfi beln – Zur Frauentracht der jüngeren Merowingerzeit
Eine Änderung in der Frauentracht ist bereits in der Stufe AM III sichtbar, in der erstmals die auf
mediterrane Vorbilder zurückgehende Mantelfi bel übernommen wird. Im späten 6. Jh., zu Beginn der
Stufe JM I, wurde die Tote in Griesheim Grab 43 bestattet, die aufgrund ihres reichhaltigen Grabinventars
zur Qualitätsstufe C im Sinne R. Christleins gerechnet werden kann75. Die Frau in Grab 43, aufgrund
der Runeninschrift auf einer der beiden Bügelfi beln hieß sie wohl Agilathruth, illustriert den Wandel
der fi belgeschmückten Kleidung am Übergang zur jüngermerowingischen Epoche. Am Mantel trägt sie
eine kleine, einen Durchmesser von 3,9 cm aufweisende Goldscheibenfi bel von Graenerts Serie A/Typ
Niedernberg76. Zum eigentlichen Kleid gehört nach wie vor ein Bügelfi belpaar aus vergoldetem Silber,
das jedoch keine Funktion beim Verschließen der Kleidung mehr besessen hat77.
Die Verbreitung dieser neuen Fibelkombination – ein oder zwei Bügelfi beln und eine Scheibenfi bel als
Mantelverschluss – ist vor allem in der östlichen Francia und in Alamannien belegt78. Das nicht identische
Bügelfi belpaar, das zur Typengruppe Mülhofen gehört, zeigt eine sehr weiträumige Verbreitung, wobei
71 H. Zeiß, Das Heilsbild in der germanischen Kunst des frühen Mittelalters. Sitzber. Bayer. Akad. Wiss. Phil.-Hist. Kl., München 1941, 2, H. 8; E. Salin, La civilisation mérovingienne. 4. Les croyances, conclusions – index général (Paris 1959) 267-278; allgemein J. Engemann, Zur Verbreitung magischer Übelabwehr in der nichtchristlichen und christlichen Spätantike. Jahrb. Antike u. Christentum 18, 1975, 22-48; AUFLEGER 1997, bes. 179-182; für Italien jetzt M. Sannazaro, Una stampiglia con busto frontale virile da Vicenza: nuovi dati per la conoscenza della ceramica longobarda in Italia. In: R. Fiorillo/P. Peduto (Hrsg.), III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Salerno 2.-5.10.2003 (Firenze 2003) 40-45.72 Typ Griesheim: Alsheim (Fundliste 1, Nr. 1; Gew. 68 bzw. 69,5 g), Griesheim Grab 400 (Fundliste 1, Nr. 3; Gew. 125 g), Bad Kreuznach-Bosenheim (Fundliste 1, Nr. 5; Gew. 124 g), „Worms“ (Fundliste 1, Nr. 11; Gew. noch 58,5 g); Typ Mainz: Bad Homburg-Gonzenheim Grab 2 (Fundliste 1, Nr. 16), Dirmstein (Fundliste 1, Nr. 17; Gew. 54 g), Mülhofen „Auf’m Röthchen“ (Fundliste 1, Nr. 23; Gew. 51,5 g); Sonderformen: Bad Kreuznach Grab vom 24.10.1890 (Fundliste 1, Nr. 43; aufgrund der Zeichnung im Album Müllers), Dalsheim (Fundliste 1, Nr. 46; Öse evtl. fragmentiert?), Neudingen Grab 319 (Fundliste 1, Nr. 47; Öse abgebrochen), Heidelsheim Grab (?) 1908 (Fundliste 1, Nr. 50).73 Fundliste 1, Nr. 23.74 BRENDLE/BIERBRAUER/DÜWEL/MEINEKE 2001, 355f. bezeichnet diese Ösen auf den Fibelrückseiten als Sicherungsösen, in die Schmuck- oder Sicherungskettchen nach mediterranen Vorbildern eingehängt werden konnten.75 R. Christlein, Besitzabstufungen zur Merowingerzeit im Spiegel reicher Grabfunde. Jahrb. RGZM 20, 1973 (1975) 147-180; GRAENERT 2001, 93-110. – Der Frau in Grab 43 war zwar keine Gefäßbeigabe aus Glas oder Metall beigegeben worden, eine Ansprache als Bestattung der Qualitätsstufe C belegen neben dem Fibelschmuck aus Edelmetall die insgesamt 11 Amethystperlen der Perlenkette.76 GRAENERT 2001, 48 Taf. 110 Nr. 21.77 Zuletzt GRAENERT 2001, 87f.78 CLAUß 1987, 537f. Abb. 46 spricht von einer Übergangsphase, die zu einer mit einer einzelnen Mantelfi bel geschmückten Kleidung überleitet.
214
unterschiedliche Dekorgruppen verschiedene geographische Schwerpunkte erkennen lassen79. Diese
Fibelform weist noch eine typische Verbreitung für Schmuckformen der älteren Merowingerzeit auf.
Die im Griesheimer Grab 400 bestattete Frau, die die reichste weibliche Bestattung des 7. Jhs. auf diesem
Gräberfeld darstellt, kombiniert ihre einzeln getragene große Bügelfi bel von 14,7 cm Länge mit einer
goldenen Filigranscheibenfi bel als Mantelfi bel. Diese Filigranscheibenfi bel besitzt ihre engsten Überein-
stimmungen mit zwei Scheibenfi beln von rheinhessischen Fundorten80, woraus man auf eine Herstellung
in einem gemeinsamen Atelier schließen könnte. Aber alle drei Fibeln zeigen auch stilistische Elemente,
die charakteristisch für Produkte aus in Alamannien gelegenen Werkstätten sind81.
Die in verschiedenen Typen ausgeprägten jüngermerowingischen Bügelfi beln zeigen eine Verbreitung,
die auf bestimmte Regionen beschränkt ist. Neben dem Rhein-Main-Gebiet treten sie vor allem im
Neuwieder Becken um Andernach auf (Abb. 5). Nur einzelne Fibeln der unterschiedlichen Typen fi nden
sich auch in weiter östlich und nördlich gelegenen Frauengräbern. Somit kann die Weiterentwicklung
und Verwendung von Bügelfi beln bis in die Mitte des 7. Jhs. als eigenständige kulturelle Erscheinung des
Rhein-Main-Gebietes bezeichnet werden. Die einzelnen Formen können dabei eine sehr kleinräumige
Verbreitung aufweisen, die – wie in Bad Kreuznach nachgewiesen – auch nur auf einer Nekropole
vorkommen können. Während man in beiden Regionen verstärkt Scharnierkonstruktionen für die Nadel-
apparate verwendete, unterscheiden sich die späten Bügelfi beln deutlicher in der Form ihrer Kopfplatte.
Im Neuwieder Becken überwiegen Fibeln mit halbrunder Kopfplatte, wohingegen in den Werkstätten
am Mittelrhein hauptsächlich rechteckige Kopfplatten bevorzugt wurden. Eine vergleichbare Unterschei-
dung zwischen diesen beiden Regionen ist auch bei anderen regional verbreiteten Schmuckformen oder
Keramikgefäßen sichtbar. Für das Neuwieder Becken lassen sich etwa Kreuzfi beln der Form FG 9 oder
silberne Drahtohrringe mit Polyeder und beidseitiger Umwicklung anführen, H. Ament betonte zudem,
dass Fremdformen meist westlicher Provenienz seien82. Während das Neuwieder Becken über das Moseltal
oder die alte Römerstraße von Metz nach Trier von den westlich gelegenen fränkischen Gebieten erreicht
werden kann, öffnet sich das Rhein-Main-Gebiet durch seine Flusssysteme nach Osten und Süden.
Kulturelle oder kunsthandwerkliche Beziehungen mit dem westlichen Austrasien im Maas- oder oberen
Moseltal sind nur sehr eingeschränkt nachweisbar83. Die Beziehungen oder Kulturkontakte, wie F. Stein
treffend schrieb84, sind im Rhein-Main-Gebiet eher nach Thüringen oder Mainfranken bzw. ins alaman-
79 KÜHN 1974, 1006-1016; neuerdings HILBERG 2001, 310-314.80 Es handelt sich um die Filigranscheibenfi beln von Freimersheim bei Alzey und von Abenheim nördlich von Worms, beide Kr. Alzey-Worms. THIEME 1978, 450 Kat.Nr. 1 Taf. 10,1; 459f. Kat.Nr. 47 Taf. 7,5; GRAENERT 2001, 146 Kat.Nr. II.1; 152 Kat.Nr. II.25 Taf. 8,5.8.10.81 THIEME 1978, 423f. (Gruppe I.5).82 Vgl. hierzu etwa H. Ament, Siedlung und Gräberfeld des frühen Mittelalters von Mertloch, Künzerhof (Kreis Mayen-Koblenz). Wissenschaftl. Beibde. Anzeiger German. Natmus. 9 (Nürnberg 1993) bes. 97 Abb. 87,3.4. – Zu den westlichen Verbindungen, v. a. bei bronzenen Gürtelschnallen mit Beschlagplatte, siehe M. Schulze-Dörrlamm, Die spätrömischen und frühmittelalterlichen Gräberfelder von Gondorf, Gem. Kobern-Gondorf, Kr. Mayen-Koblenz. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit B 14 (Stuttgart 1990) 242-244; 249-252; 273f.83 Für Rheinhessen sind diese Beziehungen etwa sichtbar in kleinen bronzenen Scheibenfi beln mit Mittelbuckel (ZELLER 1992, 131, H. Furtmayr, Unscheinbar? Bemerkenswertes zu gegossenen Scheibenfi beln aus Bronze. In: G. Graenert/R. Marti/A. Motschi/R. Windler [Hrsg.], HÜBEN UND DRÜBEN – Räume und Grenzen in der Archäologie des Frühmittelalters. Festschr. Max Martin. Arch. u. Museum 48 [Liestal 2004] 51-60), in vogel- und kreuzförmigen Taschenappliken (G. Zeller, Das fränkische Gräberfeld von Ingelheim, Rotweinstraße. Grabungskampagne 1978-79. Mainzer Zeitschr. 84/85, 1989/90, 309-312 Karte 1), in aquitanischen Gürtelbeschlägen wie Bingen (ZELLER 1992, Textband 173f., Katalog- und Tafelband 15 Einzelfund 44 Taf. 68,3; AUFLEGER 1997, 200 Kat.Nr. 5 Karten 1 und 21) und Dietersheim (ZELLER 1992, Textband 173, Katalog- und Tafelband 52 Einzelfund 426 Taf. 68,1) oder in den Greifenschnallen/D-Beschläge von Dietersheim Grab 1 von 1905 (ZELLER 1992, Textband 173, Katalog- und Tafelband 49 Taf. 68,2; 90,10) und Wiesbaden (AUFLEGER 1997, 241 Fundliste 10 Nr. 91).84 F. Stein, Frühmittelalterliche Bevölkerungsverhältnisse im Saar-Mosel-Raum. Voraussetzungen der Ausbildung der deutsch-französischen Sprachgrenze? In: W. Haubrichs/R. Schneider (Hrsg.), Grenzen und Grenzregionen. Veröffentl. Komm. Saarl. Landesgesch. u. Volksforsch. 22 (Saarbrücken 1994) bes. 82-87.
215
nische Neckartal ausgebildet85. Auch die späten jüngermerowingischen Bügelfi beln treten vereinzelt
an der östlichen Peripherie Austrasiens auf, vor allem in Alamannien bevorzugen die Frauen jedoch
bereits eine bügelfi bellose Tracht. Die dort von den lokalen Eliten verwendeten Filigranscheibenfi beln
sind hingegen jedoch auch den mittelrheinischen Damen, wie etwa Griesheim Grab 400, geläufi g. Die
zeitgleichen jüngermerowingischen Männergräber mit Prestigeausstattung der Stufen JM I und II, in
Griesheim handelt es sich um die Gräber 321 und 418, weisen ebenfalls eine enge Übereinstimmung mit
Elitebestattungen des süd- und südwestdeutschen Raumes auf86.
Vergleicht man diese Entwicklung von regionalen Verbreitungsbildern mit der älteren Merowingerzeit, so
könnte man auf Veränderungen in der Produktion, im Erwerb und in der Verwendung von Trachtzubehör
schließen87. Archäologische Hinweise oder Anzeichen für eine Werkstatt konnten bisher im Rhein-Main-
Gebiet nicht nachgewiesen werden. Außer in Mainz, wo sich sicherlich auch die Landbevölkerung
anlässlich kirchlicher Feiertage zusammenfand88, dürften metallverarbeitende Werkstätten an zahlreichen
Orten bestanden haben. Hierauf verweisen nicht nur die unterschiedlich ausgestalteten Fibeln der einzelnen
Typen, sondern auch ausgesprochen lokal verbreitete Bügelfi belformen, wie etwa die Bügelfi beln der
Typen Bad Kreuznach oder Wolfskehlen. Die Trägerinnen dieser Fibeln lebten in unmittelbarer Nachbar-
schaft zueinander und dürften diese Bügelfi beln in Bad Kreuznach oder vielleicht in Alsheim erstanden
haben89. H. Roth verwies auf die Rolle von städtischen Zentren und Königshöfen bei der Schmuckherstel-
lung90, auch Herrenhöfe der einzelnen Grundherrschaften dürften den Bedarf der lokalen Eliten gedeckt
haben. Durch die Analyse anderer Elemente der jüngermerowingischen Frauentracht des 7. Jhs. – etwa
von Wadenbindengarnituren oder Schuhschnallen91 – lassen sich vergleichbare Verbreitungsbilder wie bei
den jüngermerowingischen Bügelfi beln erkennen. Auch bei den öfter mit Bügelfi beln als mit Mantelfi beln
kombinierten tauschierten Scheibenfi beln lassen sich ausgesprochen regionalbezogene Verbreitungs- wie
Herstellungsmuster beobachten92, so etwa bei der bichrom tauschierten Scheibenfi bel mit aufgenietetem
Bronzering von Riedstadt-Goddelau, zu der es Parallelen im engeren Umfeld in Groß-Gerau Grab 30 und
85 Zur Bedeutung der rechtsrheinischen Gebiete für die Eliten des Rhein-Main-Gebiets vgl. INNES 2000, bes. 176f.86 Hilberg in GÖLDNER/HILBERG 2000; V. Hilberg, La nécropole de Griesheim - Productions locales et échanges interrégionaux d’une communauté rurale en Austrasie orientale. In: Actes de la Table-Ronde archéologique de Longroy 1998. Publ. Assoc. Française Arch. Mérov. (im Druck) mit Abb. 6-9. – Eine vergleichbare Ausstattungsqualität im gesamten Rhein-Main-Neckar-Raum weist nur noch Grab 117 von Frankenthal-Eppstein auf; Ch. Engels, Thüringer? Alamannen? Franken? Perspektiven der archäologischen Auswertung des frühmittelalterlichen Friedhofs Eppstein, Stadt Frankenthal. In: H. Bernhard (Hrsg.), Archäologie in der Pfalz. Jahresbericht 2000 (Speyer 2001) 177-181 Abb. 148-149.87 H. Steuer, Archäologie und germanische Sozialgeschichte. Forschungstendenzen in den 1990er Jahren. In: K. Düwel (Hrsg.), Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung. Ergbd. RGA 10 (Berlin, New York 1994) 10-55; ders., Handel und Fernbeziehungen. Tausch, Raub und Geschenk. In: Die Alamannen. Hrsg. vom Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg (Stuttgart 1997) 389-402.88 Zur Bedeutung religiöser Festtage siehe allgemein H.-W. Goetz, Europa im frühen Mittelalter 500-1050. Handbuch Gesch. Europas 2 (Stuttgart 2003) 238f.; 362.89 Für Bad Kreuznach ist in karolingischer Zeit ein Königspalast belegt. G. Zeller betont für das große, südöstlich des valentinianischen Kastells gelegene Gräberfeld eine kontinuierliche Nutzung bis in die merowingische Zeit. Auch die drei Frauen mit späten Bügelfi beln (vgl. Fundliste 1, Nr. 43-45) wurden auf dieser Nekropole bestattet. – Alsheim ist als Münzstätte kartiert bei J. Werner, Fernhandel und Naturalwirtschaft im östlichen Merowingerreich nach archäologischen und numismatischen Zeugnissen. Ber. RGK 42, 1961, 325 Abb. 13; 339 Fundliste 7A; W. Diepenbach, Die Münzprägung am Mittelrhein im Zeitalter der Merowinger. Mainzer Zeitschr. 44/45, 1949/50, 149 Kat.Nr. 17, geht von einer kurzen Münztätigkeit nur im zweiten Viertel des 7. Jhs. aus; W. Heß, Geldwirtschaft am Mittelrhein in karolingischer Zeit. Blätter dt. Landesgesch. 98, 1962, bes. 50; 52; umfassend GOCKEL 1970, wonach im 8. und 9. Jh. neben Privatgut zwei Königshöfe, der eine mit Kirche, belegt sind.90 ROTH 1994.91 Bereits R. Christlein hatte für die verschiedenen Typen von Wadenbinden eine lokale Herstellung vermutet; ders., Das alamannische Reihengräberfeld von Marktoberdorf im Allgäu. Materialh. bayer. Vorgesch. 21 (Kallmünz 1966) bes. 78-80 Abb. 25.92 Vgl. etwa die Belege zu tauschierten Scheibenfi beln bei ZELLER 1992, 133-136.
216
in Seligenstadt gibt, während einzelne Belege in Thüringen und als Variante in Mainfranken nachgewiesen
sind93. Gerade im Rhein-Main-Gebiet treten späte Bügelfi beln recht zahlreich in Erscheinung und wurden
häufi g von den – zumeist älteren? – Damen in der Frauentracht verwendet, was sicherlich nicht mehr als
„gelegentliches Auftreten“ bezeichnet werden kann.
Zur Ausstattung jüngermerowingischer Frauengräber im Rhein-Main-Gebiet
Mit ihren qualitativ hochwertigen Filigranscheibenfi beln können die Griesheimer Frauengräber 43 und 400
zu den reichsten jüngermerowingerzeitlichen Bestattungen des Rhein-Main-Gebietes in der Stufen JM I
und JM II gerechnet werden. Es handelt sich zudem um die einzigen Frauenbestattungen des Griesheimer
Gräberfeldes, die die Qualitätsstufe C erreichen. Besonders Grab 400 fällt durch seine Lage auf, da es in
der Umgebung der separierten reichen jüngermerowingischen Männergräber 418 und 415 liegt. Grab 43
liegt leider unmittelbar am Nordrand des durch die Sandgrube zerstörten Gräberfeldbereichs.
Eine Zusammenstellung der Grabinventare mit jüngermerowingerzeitlichen Bügelfi beln zeigt, dass diese
außer im Fall von Griesheim Grab 400 hauptsächlich mit tauschierten Scheibenfi beln als Mantelverschluss
kombiniert werden, wie die Grabinventare von Freiweinheim Grab 1094, Kleinlangheim Grab 3795, Bad
Kreuznach Grab vom 24. 10. 189096 und Wörrstadt Grab 1 (1905)97 zeigen98. In Riedstadt-Wolfskehlen
Grab 2 wird als Mantelfi bel eine Pressblechscheibenfi bel benutzt99, in Bad Kreuznach Grab vom 27.-
30. 1. 1891 wird noch ein Almandinrosettenfi belpaar mit Filigranzier verwendet, allerdings ist die
Zusammengehörigkeit dieses Grabinventars nicht gesichert100. Vereinzelt werden späte Bügelfi beln auch
als Mantelfi bel benutzt, wie es für die Exemplare mit halbrunder Kopfplatte von Ober-Olm Grab 2 und
Bad Reichenhall Grab 227 belegt ist101. Der größte Teil der Beigaben und Schmucksachen besteht in
diesen Gräbern aus Buntmetalllegierungen. Es handelt sich um Frauenbestattungen in ausgesprochen
ländlichen Nekropolen, in Mainz etwa ist die führende Bevölkerungsschicht der jüngermerowingischen
Zeit bereits zu beigabenreduzierten Bestattungen „ad sanctos“ übergegangen, wie die Gräber bei St.
Alban oder St. Hilarius zeigen102. Es handelt sich bei den nach wie vor mit Bügelfi beln bestatteten Frauen
auch um keine Bestattungen der Qualitätsstufe C, sondern um Gräber, die eher einer Stufe B zuzuordnen
93 Groß-Gerau Grab 30, Kr. Groß-Gerau: MÖLLER 1987, 58 Taf. 34,15; 131,6; Seligenstadt Grab (?) von 1904, Kr. Offenbach: ebd. 127f. Taf. 99,1; Waltersleben Grab 18, Stadt Erfurt: B. Schmidt, Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. Katalog (Südteil) Veröffentl. Landesmus. Vorgesch. 25 (Berlin 1970) 62 Taf. 57,7; 131,5; als Variante ohne Bronzering aber mit zentraler Kreuzdarstellung kann Kleinlangheim Grab 37, Kr. Kitzingen (Chr. Pescheck, Das fränkische Reihengräberfeld von Kleinlangheim, Lkr. Kitzingen/Nordbayern. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit A 17 [Mainz 1996] 220 Taf. 8,1) gerechnet werden.94 Fundliste 1, Nr. 19.95 Fundliste 1, Nr. 41.96 Fundliste 1, Nr. 43.97 Fundliste 1, Nr. 15.98 Die Geschlossenheit der Inventare von Riedstadt-Goddelau (Fundliste 1, Nr. 4), Ober-Olm „Grab 6“ (Fundliste 1, Nr. 13) und Heidelsheim Grab (?) 1908 (Fundliste 1, Nr. 50) kann bezweifelt werden.99 Fundliste 1, Nr. 4. Zusammenstellung der Parallelen bei U. Koch, Das alamannisch-fränkische Gräberfeld bei Pleidelsheim. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 60 (Stuttgart 2001) 259f. Abb. 110. – Die Geschlossenheit von Saffi g Grab 224, vgl. Fundliste 1, Nr. 36, wurde von K. Schäfer stark in Frage gestellt, da die Pressblechscheibenfi bel erst nachträglich zugeordnet, aber – genau wie die Riemenzunge und die Schnalle – eher aus Grab 223 stammen dürfte. K. Schäfer, Eine Preßblechscheibenfi bel mit Herrscherdarstellung aus dem 7. Jahrhundert. In: A. Vogel, Zwischen Kreuz und Schwert. Andernach im 7. Jahrhundert. Andernacher Beitr. 16 (Andernach 2001) bes. 109f.100 Fundliste 1, Nr. 44. Wie bei weiteren Kreuznacher Gräbern aus den Grabungen Müllers kann auch an der Geschlossenheit dieses Inventars gezweifelt werden, da die Almandinscheibenfi beln deutlich älter sind.101 Vgl. Fundliste 2, Nr. 2; 12. – Zur Tracht siehe CLAUß 1987, 541f. Abb. 44-45.102 ZELLER 1992, Textband, 129-141; 142f; C. Theune, Germanen und Romanen in der Alamannia.Strukturveränderungen aufgrund der archäologischen Quellen vom 3. bis zum 7. Jahrhundert. Ergbde. RGA 45 (Berlin, New York 2004) 253-256.
217
sind. Griesheim Grab 400 ist aufgrund der wertvollen goldenen Filigranscheibenfi bel und dem aufwändi-
gen Fibelgehänge deutlich von den anderen Frauengräbern mit späten Bügelfi beln abzusetzen. Die
Grabausstattungen von Wörrstadt Grab 1 (1905)103 und Kaltenwestheim Grab 5/59104 erreichen noch ein
vergleichbares Ausstattungsniveau. Diese Frauengräber werden nur von dem in die Stufe JM II datierenden
Frauengrab von Wonsheim, Kr. Alzey-Worms, überragt, das außer einer vierpassförmigen goldenen
Filigranscheibenfi bel der Serie B/Typ Wonsheim nach Graenert unter anderem eine zugehörige silberne
Bulla und einen gläsernen Anhänger in Bronzefassung, einen goldenen Münzfi ngerring mit einem Solidus
des Heraclius und Heraclius Constantinus (Prägung zwischen 613-629), einen Tremissis des Mainzer
Prägebezirks sowie ein Service aus gegossenen „koptischen“ Bronzegefäßen bestehend aus Kanne und
Becken enthielt105. Mit einer vergleichbaren Bestattung könnte auch für die gemmengeschmückte Filigran-
scheibenfi bel von Mölsheim, Kr. Alzey-Worms, gerechnet werden, die nur als Einzelfund überliefert
ist106. Ein moderneren Vorstellungen verpfl ichtetes Bestattungsritual107 wählte hingegen eine in Bingen-
Kempten beisetzende Sippe, indem sie ihren Toten Inschriftensteine zum Gedenken setzen ließ108. Neben
dem Grabstein der adligen Dame Bertichilde109 verweist ein Altfund aus dem Jahr 1779 auf die Bedeutung
Kemptens. Mehreren Gräbern zuzuordnen sind die Inschriften der Aiberga und des Paulinus110 sowie
eine qualitätvolle Filigranscheibenfi bel111, zu der aufgrund eines über die Fibelnadel geschobenen und
ankorrodierten Ringes eine kreuzverzierte Bronzebulla der Gruppe Walheim nach Schellhas gehört112.
103 Hierauf verweisen der vergoldete Bronzearmring mit almandinverzierten Tierkopfenden sowie die silbernen Ohrringe; ZELLER 1992, 242f. Taf. 49,9; 53,1; 134,3.6.104 Die Nekropole von Kaltenwestheim ist noch nicht publiziert. In Grab 5/59 fand sich außer der vergoldeten Bronzebügelfi bel noch „eine Stirnbinde mit Goldbesatz“; vgl. Fundliste 1, Nr. 6; W. Timpel, Fränkische Körpergräberfelder von Kaltenwestheim und Kaltensundheim, Lkr. Meiningen. In: Südliches Thüringen. Führer Arch. Denkmäler Deutschland 28 (Stuttgart 1994) 185-188.105 J. Werner, Münzdatierte austrasische Grabfunde. Germ. Denkm. Völkerwanderungszeit 3 (Berlin 1935) 60f. 102f. Nr. 48 Taf. 34; ders., Der münzdatierte fränkische Grabfund von Wonsheim (Rheinhessen). In: P. Grimm (Hrsg.), Varia Archaeologica. Wilhelm Unverzagt zum 70. Geburtstag dargebracht (Berlin 1964) 214-218 Taf. 41-42; THIEME 1978, 492 Kat.Nr. 188; GRAENERT 2001, 173 Kat.Nr. II.85 Taf. 54B,2.106 H. Amberger, Die fränkische Goldfi bel von Mölsheim (Rheinhessen). Germania 15, 1931, 180-182; H. Zeiß, Die Herkunft der Fibel von Mölsheim (Rheinhessen). Germania 15, 1931, 182-190; THIEME 1978, 477 Kat.Nr. 120 Taf. 15,3; GRAENERT 2001, 164 Kat.Nr. II.55 Taf. 85,1; 96,1.107 B. K. Young, Exemple aristocratique et mode funéraire dans la Gaule mérovingienne. Annales 41, 1986, 379-402. – INNES 2000, 34-37, 174f. betont die Veränderung des Bestattungszeremoniells im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung und der Darstellung von Macht.108 Allgemein ZELLER 1992, 99-101; R. Knöchlein, Bingen von 260 bis 760 n. Chr.: Kontinuität und Wandel – nach historischen und archäologischen Quellen. In: G. Rupprecht/A. Heising (Hrsg.), Vom Faustkeil zum Frankenschwert. Bingen – Geschichte einer Stadt am Mittelrhein. Binger Stadtgeschichte 2 (Mainz 2003) bes. 230-236.109 RGA II (1976) 304-306 s. v. Bertichilde-Grabstein (H.W. Böhme); BOPPERT 1971, 108-118. – Wo ursprünglich die Bestattung der Bertichilde lag, in oder bei der Heiligen-Drei-Könige-Kirche oder weiter nördlich bei den beiden anderen Inschriften, bleibt genauso spekulativ wie die Voraussetzung von zwei merowingerzeitlichen Siedlungskernen im heutigen Ortsbereich. Vgl. hierzu G. Behrens, Der Bertichildis-Grabstein von Kempten bei Bingen. Germania 21, 1937, bes. 117.110 Aiberga-Stein: BOPPERT 1971, 104-107; auf eine Datierung jünger als die 1. Hälfte des 6. Jhs. nach Boppert könnte die Kombination des Kreuzes als symbolische Invokation zu Beginn der Inschrift mit dem großen Christogramm in der unteren Hälfte des Steines hinweisen, wie sie nur noch von dem Mainzer Leutegund-Stein belegt ist, den BOPPERT 1971, 56-60 in das 6./7. Jh. datiert; auch die Verwendung eines Minuskel- oder halbunzialen B im Namen Aiberga fi ndet Parallelen in den Bopparder Inschriften des Bilefridus (BOPPERT 1971, 128-130, Dat.: 6./7. Jh.) und der Nomidia (BOPPERT 1971, 134-137, Dat.: 8. Jh.). – Paulinus-Stein: BOPPERT 1971, 120-122 mit einer Datierung in das 5./6. Jh.; zur Datierung des Paulinus-Steins ebenfalls in das 6./7. Jh. vgl. ENGEMANN 1995.111 THIEME 1978, 453 Kat.Nr. 18 Taf. 6,4 (die erwähnte Goldmünze gehört nicht zu diesem Komplex, sondern zu einer weiteren Filigranscheibenfi bel aus Bingen: THIEME 1978, 495 Nr. 205; ZELLER 1992, 22 Einzelfund 274 Taf. 43,7; GRAENERT 2001, 149 Kat.Nr. II.9c); GRAENERT 2001, 149 Kat.Nr. II.10 Taf. 7,1.2.112 Hessisches Landesmuseum Kassel, Inv.Nr. A 438 (Dm. 4,7-4,8 cm). Für ihre Hilfe danke ich Frau Dr. I. Kappel und Herrn Prof. Dr. E. Schmidberger herzlich. – An dieser Stelle kann leider keine detaillierte Diskussion zur Überlieferung dieses interessanten Fundkomplexes erfolgen. Von den bei ZELLER 1992, 99f. erwähnten Objekten lassen sich nur die beiden Inschriften, die Filigranscheibenfi bel und die Amulettkapsel eindeutig zu- bzw. nachweisen und sind zudem alle in zwei Berichten des Jahres 1779 erwähnt. Die Bügelfi bel des Typs Aquileia/Lörrach (ZELLER 1992, Taf. 36,1) ist erst seit 1824 in den Kasseler Inventaren – zumal ohne Fundortangabe bis 1874! – erfasst und könnte erst gegen Ende des 19. Jhs. zu diesem Komplex geraten sein.
218
Varianten: 5. Bad Kreuznach-Bosenheim, Kr. Bad Kreuznach. Einzel-stück. KÜHN 1940, 440f. Kat.Nr. 134 Taf. 38; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 15f. Kat.Nr. 69; ZELLER 1992, 31 ohne Abb. 6. Kaltenwestheim Grab 5/59, Ldkr. Schmalkalden-Meinin-gen. Einzelstück. W. Timpel in: J. Herrmann, Archäologie in der DDR. 2. Bd. Fundorte und Funde (Leipzig 1989) 575; ders. in: S. Dušek (Hrsg.), Ur- und Frühgeschichte Thürin-
Auffallend ist die hohe Anzahl von goldenen Filigranscheibenfi beln im Rhein-Main-Gebiet, besonders
in Rheinhessen113. In und um Mainz gibt es bezeichnenderweise keine Filigranscheibenfi beln bzw.
reichen jüngermerowingischen Grabausstattungen, diese sind eher im ländlichen Raum anzutreffen.
Hier fi nden sich aber auch vereinzelt in Bingen-Kempten, Ebersheim südlich von Mainz114 und sogar
rechtsrheinisch bei Hof Gimbach, Kelkheim-Fischbach im Taunus115, im 6. und 7. Jh. Grabinschriften und
schriftlose Bildsteine wie in Hofheim am Main116, die nicht nur die Ausweitung des Christentums von
Mainz ausgehend in den ländlichen Raum belegen dürften117, sondern auch von den führenden Familien
zur Darstellung ihrer Macht und ihrer sozialen Stellung benutzt werden.
Durch Schriftquellen des 7. Jhs. sind lokale Adelssippen für das Rhein-Main-Gebiet belegt, die somit auch
durch epigraphische Zeugnisse fassbar sind118. Fredegar berichtet für das Jahr 641, dass die Macancinses
– sicherlich militärische Einheiten aus Mainz und seiner umgebenden Civitas – von dem austrasischen
König während eines Aufstandes der Thüringer abfallen119. Für das Rhein-Main-Gebiet zeichnet sich
somit das Bild einer im ländlichen Raum in Dörfern und Villen siedelnden Bevölkerung ab, deren Eliten,
bestehend aus regionalen Adelssippen, miteinander in Konkurrenz standen und dies in entsprechenden
Bestattungen zum Ausdruck brachten120. Das Festhalten an der traditionellen Bügelfi bel bis in die Stufe
JM II ist somit nicht nur ein konservatives Trachtelement, sondern bringt auch die gesellschaftliche
Situation der Macancinses im 7. Jh. zum Ausdruck.
113 Vgl. die Kartierungen bei THIEME 1978, Karte 1 und ergänzt bei GRAENERT 2001, Karte 1.114 BOPPERT 1971, 60-62 aufgrund paläographischer Kriterien Datierung ins 7. Jh.; ZELLER 1992, 54f.115 Ebd. 80-82, eine eigene Autopsie der Inschrift ergab, dass diese eine randbegleitende Gitter- und Zickzackornamentik aufweist, wie sie für die jüngermerowingischen Inschriften des 6./7. Jhs. üblich ist; vgl. hierzu auch ENGEMANN 1995. Am Ende von Zeile 9 ist eindeutig ein weiteres, allerdings kleiner ausfallendes X eingemeißelt, so dass sich doch eine Altersangabe von 35 Jahren ergibt. – Der ebenfalls rechtsrheinisch bei Goddelau, Kr. Groß-Gerau, gefundene Remico-Stein dürfte älter und noch in das 6. Jh. zu datieren sein, vgl. BOPPERT 1971, 144f. 168-171.116 F. Kutsch, Ein christliches Frankengrab aus Hochheim a. M. Nass. Ann. 48, 1927, 24-30, mit weiteren Belegen für inschriftenlose Steine aus Mainz-St. Alban; Mainzer Zeitschr. 29, 1934, 41 Taf. 8,3.117 BÜTTNER 1951, bes. 21-23, 40; E. Ewig, Der Mittelrhein im Merowingerreich. In: ders., Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften (1952-1973). Beih. Francia 3 (München 1976) 1. Bd., 443.118 BÜTTNER 1951, 23; GOCKEL 1970, 294-312 betont die Wurzeln der mittelrheinischen Adelssippen im 7. Jh. – STAAB 1975, 296-311 zum merowingischen Adel.119 Fredegar: Chronicarum Fredegarii scholastici libri IV cum continuationibus, éd. par B. Krusch. MGH SS rer. Mer. 2 (Hannover 1888), IV 87.120 INNES 2000, 172-180.
Fundliste 1
Verbreitung jüngermerowingischer Bügelfi beln mit rechteckiger Kopfplatte
Typ Griesheim
1. Alsheim-Einzelfund, Kr. Alzey-Worms. Paar. KÜHN 1974, 140 Kat.Nr. 5 u. 5a Taf. 2; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 3 Kat.Nr. 5-6. 2. Griesheim Grab 53, Ldkr. Darmstadt-Dieburg. Einzelstück. Unpubliziert. Knopfeckelement einer Kopfplatte. 3. Griesheim Grab 400, Ldkr. Darmstadt-Dieburg. Einzel-
stück. Unpubliziert. 4. Riedstadt-Goddelau-Grabfund, Kr. Groß-Gerau. Einzel-stück. KÜHN 1974, 350f. Kat.Nr. 274 Taf. 89 („Osthofen, Kr. Worms“); GÖLDNER 1987, 2. Teil, 130 Kat.Nr. 632 („Godde-lau“); MÖLLER 1987, 110f. Taf. 75,4 („Goddelau“).
gens. Ergebnisse archäologischer Forschung in Text und Bild (Stuttgart 1999) 174 Abb. links. 7. Köln. Einzelstück. KÜHN 1940, 420 Kat.Nr. 102 Taf. 29; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 56 Kat.Nr. 270. 8. Nierstein-Grabfund, Kr. Mainz-Bingen. Einzelstück. KÜHN 1974, 320f. Kat.Nr. 239 Taf. 76; ZELLER 1992, 158 (hier als Einzelfund 17 aufgeführt) Taf. 39,1; GÖLDNER 1987, 2. Teil,
219
10. Waiblingen II-Grabfund, Rems-Murr-Kreis. Paar. KÜHN 1974, 423f. Kat.Nr. 379 u. 379a Taf. 122. 11. „Worms“. Einzelstück. KÜHN 1974, 463f. Kat.Nr. 428 Taf. 138; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 128f. Kat.Nr. 623
Typ Wolfskehlen 12. Griesheim Grab 205, Ldkr. Darmstadt-Dieburg. Einzel-stück. Unpubliziert. 13. Ober-Olm „Grab 6“, Kr. Mainz-Bingen. Einzelstück. KÜHN 1974, 346f. Kat.Nr. 271 Taf. 88; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 91f. Kat.Nr. 441; ZELLER 1992, 192f. Taf. 37,3. 14. Riedstadt-Wolfskehlen Grab 2, Kr. Groß-Gerau. Paar.
KÜHN 1974, 455 Kat.Nr. 417 Taf. 135; GÖLDNER 1987, 1. Teil, 220-222 Nr. 7; MÖLLER 1987, 113f. Taf. 80,1.2; 139,2.3. 15. Wörrstadt Grab 1 (1905), Kr. Alzey-Worms. Einzelstück. KÜHN 1974, 454 Kat.Nr. 416 Taf. 133; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 116f. Kat.Nr. 564; ZELLER 1992, 242f. Taf. 37,2.
Typ Mainz
16. Bad Homburg-Gonzenheim Grab 2, Hochtaunuskreis. Einzelstück. KÜHN 1981, 74 Kat.Nr. 36 Taf. 7; K. Böhner, Saalburg Jahrb. 15, 1956, 105-107 Abb. 8,6. 17. Dirmstein, Kr. Bad Dürkheim/Weinstraße. Einzelstück. KÜHN 1974, 170f. Kat.Nr. 42 Taf. 15; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 28 Kat.Nr. 135; H. Polenz, Katalog der merowingerzeitlichen Funde in der Pfalz. German. Denkm. Völkerwanderungszeit B12 (Stuttgart 1988) 97 Taf. 197,2. 18. Egartenhof, Stadt Sachsenheim, Lkr. Ludwigsburg. Einzelstück. KÜHN 1974, 179 Kat.Nr. 53 Taf. 19. 19. Freiweinheim Grab 10, Stadt Ingelheim, Kr. Mainz-Bingen. Einzelstück. KÜHN 1974, 252f. Kat.Nr. 146 Taf. 48; GÖLDNER 1987, 2. Teil, Kat.Nr. 195; ZELLER 1992, 62 Taf. 39,2. 20. Gersheim, Saar-Pfalz-Kreis. Paar. KÜHN 1974, 203 Kat.Nr. 90 Taf. 32; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 44 Kat.Nr. 207-208.
21. Mainz-Umgebung, Kr. Mainz-Bingen. Einzelstück. KÜHN 1974, 287f. Kat.Nr. 189 Taf. 62; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 80 Kat.Nr. 379; ZELLER 1992, 146 EF 5 Taf. 38,3. 22. Monzernheim, Kr. Alzey-Worms. Einzelstück. KÜHN 1974, 302 Kat.Nr. 213 Taf. 68; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 87 Kat.Nr. 420. 23. Mülhofen „Auf’m Röthchen“-Einzelfund, Stadt Bendorf, Kr. Mayen-Koblenz. Einzelstück. KÜHN 1940, 392 Kat.Nr. 59 Taf. 17 („Engers“); GÖLDNER 1987, 2. Teil, 33 Kat.Nr. 156 (hier noch unter „zwischen Engers und Mülhofen“ erfasst); GRUNWALD 1998, 205 Taf. 94,1. 24. Oestrich-Einzelfund, Rheingau-Taunus-Kreis. Einzel-stück. KÜHN 1981, 257f. Kat.Nr. 390 Taf. 60. 25. Sprendlingen, Kr. Mainz-Bingen. Einzelstück. KÜHN 1974, 400 Kat.Nr. 346 Taf. 111; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 108 Kat.Nr. 527; ZELLER 1992, 207 EF 6 Taf. 38,6.
Typ Andernach-Rengsdorf
26. Andernach „Kirchberg“, Kr. Mayen-Koblenz. Einzel-stück. KÜHN 1940, 374f. Kat.Nr. 25 Taf. 6; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 3f. Kat.Nr. 9; Schäfer 1988, 146 Taf. 3. 27. Andernach, Kr. Mayen-Koblenz. Einzelstück. KÜHN 1940, 372f. Kat.Nr. 21 Taf. 5; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 5 Kat.Nr. 15. 28. Andernach, Kr. Mayen-Koblenz. Paar. KÜHN 1940, 375 Kat.Nr. 26 Taf. 7; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 6f. Kat.Nr. 24-25. 29. Bopfi ngen Grab 5, Ostalbkreis. Einzelstück. G. Haseloff, Tierornamentik 730-733 Taf. 81,2. 30. Engers „Feuerhöhle“ Grab 1 (1954), Stadt Neuwied, Kr. Neuwied am Rhein. Einzelstück. GRUNWALD 1998, 185f. Taf. 28,7. 31. Gabsheim, Kr. Alzey-Worms. Einzelstück. KÜHN 1974, 199 Kat.Nr. 80 Taf. 29; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 42 Kat.Nr. 199. 32. Kaltenengers, Kr. Mayen-Koblenz. Einzelstück. KÜHN 1940, 394f. Kat.Nr. 64 Taf. 18 („Engers“); GÖLDNER 1987, 2. Teil, 32 Kat.Nr. 151 („Engers“). E. Hanel, Die mero-wingischen Altertümer von Kärlich und Umgebung. Arch.
Schr. Inst. Vor- u. Frühgesch. Mainz 4 (Mainz 1994) 51 Taf. 42,9. 33. Niederbreisig, Stadt Bad Breisig, Kr. Ahrweiler. Paar. KÜHN 1940, 453f. Kat.Nr. 154 Taf. 44; 2. Teil, 1987, 20 Kat.Nr. 90-91; K. Reynolds Brown/D. Kidd/Ch. T. Little (Hrsg.), From Attila to Charlemagne. Arts of the Early Medieval Periods in The Metropolitan Museum of Arts (New York 2000) 354 Kat.Nr. 17.193.92.93 Abb. 20,17. 34. Rengsdorf-Einzelfunde, Kr. Neuwied am Rhein. Paar. KÜHN 1940, 457 Kat.Nr. 158 Taf. 45; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 94 Kat.Nr. 452-453; GRÜNEWALD 2001, 232 Taf. 116,5.6. 35. Rhens Grab 48, Kr. Mayen-Koblenz. Einzelstück. GRUN-WALD 1998, 42 Anm. 75. 36. Saffi g Grab 224, Kr. Mayen-Koblenz. Paar. W. Melzer, Das fränkische Gräberfeld von Saffi g, Kreis Mayen-Kob-lenz. Internat. Arch. 17 (Buch am Erlbach 1993) 193f. Taf. 46,2; 72,1.2; K. Schäfer, Eine Preßblechscheibenfi bel mit Herrscherdarstellung aus dem 7. Jahrhundert. In: A. Vogel, Zwischen Kreuz und Schwert. Andernach im 7. Jahrhundert. Andernacher Beitr. 16 (Andernach 2001) bes. 109f.
Typ Bremen-Mahndorf
Typ 1 (größer = Länge über 11,5 cm/Breite über 5 cm, mit Flechtbanddekor):
37. Bremen-Mahndorf S-N-Grab 1 (383), Hansestadt Bre-men. Einzelstück. E. Grohne, Mahndorf. Frühgeschichte des Bremischen Raums (Bremen 1953) 171f. Abb. 70A. 38. Keszthely-Innenstadt „Bräuhaus-Garten“, Kom. Vesz-prem/Ungarn. Einzelstück. W. Lipp, Die Gräberfelder von Keszthely (Budapest 1885) 66f. Abb. 328 [= A Keszthelyi sírmezók (1884)]. – J. Hampel, Alterthümer des frühen
Mittelalters in Ungarn (Braunschweig 1905) 180f. (Bd. 2); Taf. 148 (Bd. 3); gutes Photo: Arch. Ért. 109, 1982, 327 Abb. 1. 39. Klein Denkte, Kr. Wolfenbüttel. Einzelstück. F. Niquet, Eine späte Bügelfi bel in einem eingetieften Gebäude von Klein Denkte, Kr. Wolfenbüttel. Stud. Sachsenforsch. 2, 1980, 301-319 Abb. 6.
90f. Kat.Nr. 438. 9. „Starkenburg“. Einzelstück. KÜHN 1974, 473f. Kat.Nr. 438 Taf. 141; MÖLLER 1987, 130f. Taf. 103,1; GÖLDNER 1987, 1. Teil, 221 Nr. 8.
220
Sonderform Variante Bad Kreuznach
43. Bad Kreuznach Grab vom 24. 10. 1890, Kr. Bad Kreuznach. Einzelstück. ZELLER 1992, 112f. Verschollen, Ansprache nach Zeichnung in Grabungsjournal Müller, RGZM Mainz. 44. Bad Kreuznach Grab vom 27.-30. 1. 1891, Kr. Bad Kreuznach. Paar. KÜHN 1940, 441f. Kat.Nr. 136 Taf. 39;
GÖLDNER 1987, 2. Teil, 23 Kat.Nr. 106-107 („bei Bingen“); ZELLER 1992, 113 Taf. 38,5. 45. Bad Kreuznach Grab vom 1. 11. 1893, Kr. Bad Kreuz-nach. Paar. ZELLER 1992, 114. Verschollen, Ansprache nach Verweis in Grabungsjournal Müller, RGZM Mainz.
Sonderform Variante Dalsheim
46. Dalsheim, Kr. Alzey-Worms. Einzelstück. G. Zeller, Neue fränkische Funde aus Dalsheim, Kr. Alzey-Worms. Mainzer Arch. Zeitsch. 1, 1994, 158 Abb. 2. 47. Neudingen Grab 319, Schwarzwald-Baar-Kreis. Einzel-stück. BRENDLE/BIERBRAUER/DÜWEL/MEINEKE 2001, Abb.
1-2; Farbphoto der Fibel in: Die Alamannen, hrsg. vom Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg (Stuttgart 1997) 492 Abb. 567 (Rs. mit Runeninschrift); 500 Abb. 581c.
Sonderformen
48. Dettingen, Kr. Aschaffenburg. Einzelstück. KÜHN 1974, 263 Kat.Nr. 162 Taf. 53 („Kleinostheim“); R. Koch, Boden-funde der Völkerwanderungszeit aus dem Main-Tauber Gebiet. German. Denkm. Völkerwanderungszeit A8 (Berlin 1967) 125 Taf. 1,5; 71,1. 49. Gnotzheim Grab 31, Ldkr. Weißenburg-Gunzenhausen. Einzelstück. H. Dannheimer, Die germanischen Funde der späten Kaiserzeit und des frühen Mittelalters in Mittelfran-
ken. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit A 7 (Berlin) 179f. Taf. 8,5; 31A,2; KÜHN 1974, 203f. Kat.Nr. 91 Taf. 32. 50. Heidelsheim Grab(?) 1908, Stadt Bruchsal, Lkr. Karls-ruhe. Einzelstück. KÜHN 1974, 225 Kat.Nr. 113 Taf. 37; F. Damminger, Die Merowingerzeit im südlichen Kraichgau und in den angrenzenden Landschaften. Materialhefte Arch. Baden-Württemberg 61 (Stuttgart 2002) 219 („Grab(?) 1908“) Abb. 55 Taf. 14E.
Fundliste 2
Verbreitung jüngermerowingischer Bügelfi beln mit halbrunder Kopfplatte
Typ Oestrich
1. Oestrich-Einzelfund, Rheingau-Taunus-Kreis. Einzel-stück. KÜHN 1981, 258 Kat.Nr. 391 Taf. 61. 2. Ober-Olm Grab 2, Kr. Mainz-Bingen. Einzelstück. KÜHN
1974, 345f. Kat.Nr. 270 Taf. 87; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 91 Kat.Nr. 440; ZELLER 1992, 161 Taf. 39,3; 113,1.
Typ Andernach-Kärlich
3. Andernach, Kr. Mayen-Koblenz. Einzelstück. KÜHN 1940, 374 Kat.Nr. 23 Taf. 6; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 8 Kat.Nr. 32. 4. Andernach, Kr. Mayen-Koblenz. Einzelstück. KÜHN 1940, 376 Kat.Nr. 28 Taf. 7; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 4f. Kat.Nr. 14; SCHÄFER 1988, 149 Taf. 15,2 („Gemarkung Andernach“). 5. Engers, Stadt Neuwied, Kr. Neuwied am Rhein. Paar, KÜHN 1940, 396 Kat.Nr. 67 Taf. 19; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 32f. Kat.Nr. 154-155 („zwischen Engers und Mülhofen“). 6. Gondorf Grab 2/1884-85, Kr. Mayen-Koblenz. Einzel-stück. KÜHN 1940, 409f. Kat.Nr. 90 Taf. 26 („Kärlich“); GÖLDNER 1987, 2. Teil, 55 Kat.Nr. 262-263 („Kärlich“); M. Schulze-Dörrlamm, Die spätrömischen und frühmittelalter-lichen Gräberfelder von Gondorf, Gem. Kobern-Gondorf, Kr. Mayen-Koblenz. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit B14 (Stuttgart 1990) Katalogband 55 Taf. 21,1.
7. „Hessen“. Einzelstück. KÜHN 1974, Taf. 291,38/8. 8. Mainz-Laubenheim, Kr. Mainz-Bingen. Einzelstück. KÜHN 1974, 271 Kat.Nr. 174 Taf. 57; GÖLDNER 1987, 2. Teil, 82 Kat.Nr. 394; ZELLER 1992, 123 EF 8 Taf. 38,2. 9. Mülhofen „Auf’m Röthchen“-Einzelfunde, Stadt Ben-dorf, Kr. Mayen-Koblenz. Paar. GRUNWALD 1998, 205 Taf. 93,4.6. 10. Niederbieber Grab 6, Stadt Neuwied, Kr. Neuwied am Rhein. Einzelstück. GÖLDNER 1987, 2. Teil, 90 Kat.Nr. 437; GRÜNEWALD 2001, 226 Taf. 111,17. 11. „Niederbreisig Grab 2“, Stadt Bad Breisig, Kr. Ahrweiler. Paar. GÖLDNER 1987, 2. Teil, 130 Kat. Nr. 633-634; ders., Ein Bügelfi belpaar vom Typ Andernach-Kärlich aus dem ehema-ligen Ostpreußen? Arch. Korrbl. 15, 1985 245-247.
Sonderform
12. Bad Reichenhall Grab 227, Lkr. Berchtesgadener Land. Einzelstück. KÜHN 1974, 146f. Kat.Nr. 12 Taf. 6; M. Bertram, Die frühmittelalterlichen Gräberfelder von Pocking-Inzing
und Bad Reichenhall-Kirchberg: Rekonstruktion zweier Alt-grabungen. Bestandskat. Mus. Vor- u. Frühgesch. 7 (Berlin 2002) 239 Taf. 43 E,1; 71,4; 83.
40. Altenhausen, Ldkr. Ohre-Kreis. Einzelfund. B. Schmidt, Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. Ka-talog (Nord- und Ostteil) Veröffentl. Landesmus. Vorgesch. 25 (Berlin 1975) 23f. Taf. 5,7. 41. Kleinlangheim Grab 37, Ldkr. Kitzingen. Einzelstück.
Typ 2 (kleiner = Länge um 8,7-8,8 cm/Breite um 4,4-4,6 cm, nur mit Punzverzierung):
Chr. Pescheck, Das fränkische Reihengräberfeld von Klein-langheim, Lkr. Kitzingen/Nordbayern. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit A 17 (Mainz 1996) 220f. Taf. 8,2. 42. Rossow, Ldkr. Uecker-Randow. Einzelstück. U. Scho-knecht in: Ausgr. u. Funde 11, 1966, 208f. Abb. 2a.
221
Abgekürzt zitierte Literatur:
AUFLEGER 1997M. AUFLEGER, Tierdarstellungen in der Kleinkunst der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich. Arch. Schr. Inst. Vor- u. Frühgesch. Mainz 6 (Mainz 1997)
BOPPERT 1971W. Boppert, Die frühchristlichen Inschriften des Mittelrheingebiets (Mainz 1971).
BRENDLE/BIERBRAUER/DÜWEL/MEINEKE 2001T. Brendle/V. Bierbrauer/K. Düwel/E. Meineke, Eine Bügelfibel aus Grab 319 des Gräberfeldes von Neudingen, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis. In: E. Pohl/U. Recker/C. Theune (Hrsg.), Archäologisches Zellwerk. Beiträge zur Kulturgeschichte in Europa und Asien. Festschrift für Helmut Roth zum 60. Geburtstag. Studia honoraria 16 (Rahden/Westf. 2001) 345-374.
BÜTTNER 1951H. Büttner, Frühes fränkisches Christentum am Mittelrhein. Archiv Mittelrhein. Kirchengesch. 3, 1951, 9-55.
CLAUß 1987G. Clauß, Die Tragsitte von Bügelfi beln – Eine Untersuchung zur Frauentracht im Frühen Mittelalter. Jahrb. RGZM 34, 1987, Bd. 2, 491-603.
ENGEMANN 1995J. Engemann, Epigraphik und Archäologie des spätantiken Rheinlands. In: H. Giersiepen/R. Kottje (Hrsg.), Inschriften bis 1300. Probleme und Aufgaben ihrer Erforschung. Referate der Fachtagung für mittelalterliche und frühneuzeitliche Epigraphik. Bonn 1993. Abh. Nordrhein-Westf. Akad. Wiss. 94 (Opladen 1995) 39-42.
GOCKEL 1970M. Gockel, Karolingische Königshöfe am Mittelrhein. Veröffentl. Max-Planck-Inst. Gesch. 1 (Göttingen 1970) 175-184.
GÖLDNER 1987H. Göldner, Studien zu rhein- und moselfränkischen Bügelfi beln. 2 Teile. Marburger Stud. Vor- u. Früh-gesch. 8 (Marburg 1987).
GÖLDNER/HILBERG 2000H. Göldner/V. Hilberg, Griesheim, Kreis Darmstadt-Dieburg – Gräberfeld des 6. bis 8. Jahrhunderts. Ausgrabungen in dem merowinger- bis karolingerzeitlichen Reihengräberfriedhof „An der Rückgasse“. Arch. Denkm. Hessen 1 (völlig neubearbeitete Aufl age, Wiesbaden 2000).
GRAENERT 2001G. Graenert, Merowingerzeitliche Filigranscheibenfi beln westlich des Rheins. Inaug.-Diss. München 1998 (Fribourg 2001).
GRÜNEWALD 2001V. Grünewald, Frühmittelalterliche Grabfunde im Bereich der unteren Wied (Neuwieder Becken). Uni-versitätsforsch. Prähist. Arch. 77 (Bonn 2001).
GRUNWALD 1998L. Grunwald, Grabfunde des Neuwieder Beckens von der Völkerwanderungszeit bis zum frühen Mittel-alter. Der Raum von Bendorf und Engers. Internat. Arch. 44 (Rahden 1998).
HASELOFF 1981G. Haseloff, Die germanische Tierornamentik der Völkerwanderungszeit. Studien zu Salin’s Stil I. Vor-gesch. Forsch. 17 (Berlin, New York 1981).
HILBERG 2001V. Hilberg, Masurische Bügelfi beln. Studien zu den Fernbeziehungen der völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren (Inaug.-Diss. Marburg 2001).
INNES 2000M. Innes, State and Society in the Early Middle Ages. The Middle Rhine Valley, 400-1000 (Cambridge 2000).
222
KOCH 1998A. Koch, Bügelfi beln der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich. Monogr. RGZM 41 (Mainz 1998).
KÜHN 1940H. Kühn, Die germanischen Bügelfi beln der Völkerwanderungszeit in der Rheinprovinz. Die germani-schen Bügelfi beln der Völkerwanderungszeit I (Bonn 1940)
KÜHN 1974H. Kühn, Die germanischen Bügelfi beln der Völkerwanderungszeit in Süddeutschland. 1. Band: Die Grundlagen. Die germanischen Bügelfi beln der Völkerwanderungszeit II (Graz 1974).
KÜHN 1981H. Kühn, Die germanischen Bügelfi beln der Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. Die germani-schen Bügelfi beln der Völkerwanderungszeit III (Graz 1981).
MATTHES 1998Chr. Matthes, Die Glasperlen des merowingerzeitlichen Gräberfeldes Griesheim (Berlin 1998).
MÖLLER 1987J. Möller, Katalog der Grabfunde aus Völkerwanderungs- und Merowingerzeit im südmainischen Hessen (Starkenburg). German. Denkm. Völkerwanderungszeit B11 (Stuttgart 1987).
ROTH 1994H. Roth, Produktion und Erwerb von Edelmetallerzeugnissen. Ein Modell für das frühe Mittelalter. In: C. Dobiat (Hrsg.), Festschrift für Otto-Herman Frey zum 65. Geburtstag. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 16 (Marburg 1994).
SCHÄFER 1988K. Schäfer (Hrsg.), Andernach im Frühmittelalter – Venantius Fortunatus. Begleitheft zur Sonderausstel-lung, Stadtmuseum Andernach 1988. Andernacher Beitr. 3 (Andernach 1988).
STAAB 1975F. Staab, Untersuchungen zur Gesellschaft am Mittelrhein in der Karolingerzeit. Geschichtliche Landes-kunde 11 (Wiesbaden 1975).
THIEME 1978B. Thieme, Filigranscheibenfi beln der Merowingerzeit aus Deutschland. Ber. RGK 59, 1978, 381-500.
ZELLER 1992G. Zeller, Die fränkischen Altertümer der nördlichen Rheinhessen. 1. Teil: Text; 2 Teil: Katalog und Tafeln. Germ.. Denkmäler Völkerwanderungszeit B 15 (Stuttgart 1992).
Dr. Volker HilbergStiftung Schleswig-Holsteinische LandesmuseenArchäologisches LandesmuseumSchloss GottorfD-24837 [email protected]
Abbildungsnachweise:
Abb. 1. L. Lindenschmit, Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit (Mainz 1858) Bd. 1, Heft 2, Taf. 8. – Abb. 2-5, 10. Zeichnungen: Landesamt für Denkmalpfl ege Hessen, Abteilung Archäologische und Paläontologische Denkmalpfl ege (P. Rispa).