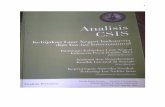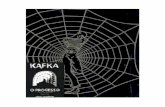Grenzüberschreitungen in Franz Kafkas Amerika Roman
Transcript of Grenzüberschreitungen in Franz Kafkas Amerika Roman
1
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Neure Deutsche Literaturwissenschaft HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Professor Dr. Stephanie Catani Sommersemester 2011
Grenzüberschreitungen in Franz Kafkas Amerika Roman Karls ‘Sündenfall’ : Vom paradiesähnlichen Utopieentwurf ins amerikanische Exil
Kaysha Riggs Germanistik
Sommersemester 2011 E-Mail: [email protected]
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 2
Inhaltsverzeichnis 1. Der „Fall“ Karls
a. Utopie Europa als Vaterland
b. Vaterfigur, die Karl wegschickte
c. Exemplarische Erhöhung der Vaterfiguren – Karls Onkel als Beispiel
d. Adam und Eva
2. Opferrolle
a. Johanna und Klara als starke Mädchen
b. Fleisch und Genesis
c. Hotel occidental
i. Oberköchin und Oberportier,
ii. Theresa die Schreibmaschinistin
iii. Robinson und Delemarsche
3. Amerika das Land der Sündhaftigkeit und der Gefallenen
a. Das Groteske in Literatur und Kunst
b. Wegsperre zum Erwachsensein Brunelda als Sexuelles Symbol
c. Die „gefallener Engel“ Rolle
d. Entfernt von dem heimisch-vertrauten Ort als Absperrung
4. Karl der ewige Sohn und die Biblische Spuren dahinten
a. Unschuld und der „ewige Sohn“
b. Die Sünden des Vaters gehen auf den Sohn über - Der Sohn muss die ins
Exil leben
c. Die Figur Karl als beispielhaft für von Kafka konstruierte Vater-
Sohn-Beziehung und Gottfigur und die Ewige Sohn Biblische Motiv
d. Amerika als Jüdisches Zion: Der Student Josef Mendel, der ewige Jude und die Juden im
Roman
5. Ankommen in der Fremde; Oklahoma und der Zirkusmenagerie
a. ‘Der Verschollene als Exilroman
b. Das Konstrukt Amerika und die Transzendentalphilosophoe
c. Kafkas Nietzsche Hintergrund und seine groteske Entfremdung
i. Die Verwandlung
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 3
Zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte: So ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. / Unter Mühsal wirst du von ihm essen /
alle Tage deines Lebens. Gen 3,7 Kafka hinterfragt seine Erbschaft als Jude und Motiv der Vater/Sohn Beziehung taucht
immer wieder in seinem Schreiben auf. Sieht man das von Kafka entworfene Europa als Beispiel
für das Leben im Paradies, als Vaterland, und die Hauptfigur Karl Roßmann als Zeichen einer
religiösen „Menschheit,“ so beschreibt der Roman eine neue Auslegung der biblischen Schilderung
des „Sündenfalls der Menschheit,“ deren Hauptfigur schließlich gefangen in einer grotesken
Unterwelt verbleibt. Mit einem Blick auf die Spuren von Bibelreferenzen und jüdische Figuren,
wird Karl Roßmann auf seinem Abenteuer als der ewige Sohn und ewige Jude in Kafkas „Amerika“
charakterisiert, ohne dass er die Grenze zum Erwachsensein überquert.
Bereits ab dem Erzählbeginn im New York des neunzehnten Jahrhunderts entwirft Kafka für
seine Hauptfigur Karl Roßmann eine Vielzahl von merkwürdigen Fügungen die ihn auf dem Weg
zum Erwachsensein begleiten sollen. Die Hauptfigur fällt in den Gesellschaftsschichten ständig
weiter nach unten, bevor er schließlich in einer grotesken Unterwelt verbleibt: eine Welt die Kafka
Amerika nannte. Amerika war das Land der unendlichen Möglichkeiten und Karl hätte jeder dieser
Optionen nutzen können, aber das Land das Karl vorgefunden hatte, war keineswegs ideal, denn er
bleibt immer in den unteren Schichten und das Land bleibt eine fiktive Traumwelt, die er für sich
nicht greifen kann, und die Karl herumschiebt. Mit dem „Fall“ von und aus Europa beginnt Karls
Reise weiter nach Westen und in Amerika durch die Unterschichten.
Wie das Buch langsam enträtselt, trifft Karl nur wenige Entscheidungen für sich
selbst. Immer wieder wird Karl weggeschickt, und immer wieder wird er wie ein Kind von einer
Frau zur nächsten Frau geschoben. Der Onkel versuchte Karl am Anfang klar zu machen, dass wenn
jemand ein selbständiges Leben führen möchte, er es sich selbst verdienen muss. Der Onkel erklärt,
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 4
dass er sich das Luxusleben, dass er sich verdiente, „vor dreißig Jahren selbst eingerichtet“1 hat.
Aber Karl wollte dem väterlich besorgten Onkel nicht zuhören. Innerhalb von Monaten nach seiner
Ankunft in Amerika hatte Karl alle Warnungen des Onkels in den Wind geschlagen. Der Bekannte
des Onkels, Herr Pollunder hatte Karl eingeladen, sein Landhaus bei New York zu besuchen. Er
hatte Karl mit dem Versprechen eines Treffens mit seiner Tochter Klara überzeugt, die Einladung
anzunehmen. Dem Onkel gegenüber stellt er für Karl die Erfahrung der ländlichen Erholung vom
hektischen Leben in der Großstadt in Aussicht. Eine Erfahrung, von welcher der Onkel dachte, dass
Karl noch nicht bereit war sie zu erfahren. Weil Karl trotzdem dorthin gegangen war zeigt der
Ausflug ihm sofort, wie die Frauen in Amerika angeblich alle sind. Kräftig, wollend, fordernd und
doch notleidend. Es scheint, als ob ihre Funktion im Buch sei, ihm zu zeigen, dass alle Mädchen die
Männer nur verführen wollen. Karl beschreibt, er „fühlte wieder ihre wachsende Kraft an seinem
Leib und sie hatte sich ihm entwunden, fasste ihn mit gut ausgenutztem Obergriff, wehrte seine
Beine mit Fußstellungen einer fremdartigen Kampftechnik ab und trieb ihn vor sich mit großartiger
Regelmäßigkeit.“2 Und er geht mit der Situation um, wie ein machtloses Kind.
Karl ist das Gegenteil von seinem Vater und Onkel, der männlichen Linie seiner Familie,
nämlich nicht selbstständig und nicht verantwortungsbewusst. Er könnte die männliche Rolle mit
keiner von seinen bisherigen Erfahrungen erfüllen. Diese Verantwortung könnte er nicht tragen.
Auf jeden Fall bestehen Parallelen zwischen Der Verschollene und den deutlichen Vater-Sohn
Beziehungen, für die Kafka in seinen anderen Werken so bekannt ist. Aber in Der Verschollene
besteht die schwierige Beziehung nicht ausnahmslos und vornehmlich zwischen Karl Roßmann und
seinem Vater, sondern auch zu der Vaterfigur als göttliche Instanz und dem Sohn als Mensch, der
gesündigt hat und jetzt mit Konsequenzen rechnen muss. Im Christentum sowie im Judentum
1 Kafka, Franz, Der Verschollene. (Stuttgart: Reclam 2006): 48. 2 Ibid., 64.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 5
markiert die Heirat eines Jungen den Punkt, an dem er vom Kind zum Erwachsenen wird. Er ist von
diesem Punkt an ein Mann, denn er muss für seine Frau, und seine zukünftige Familie
verantwortlich sein. Voreheliche Beziehungen waren seit dem Mittelalter in mehreren Religionen
scheinbar selbstverständlich ausschlaggebend für Bestrafung oder Verbannung ins Exil. Es ist der
menschliche Sündenfall, dass der Mann, also Karl als Symbol für den Menschen, nach unten zur
Erde geschickt wurde.
Die Bibel erklärt in der Genesis wie der Mann im Paradies vom Teufel verführt wird, da
Eva aus Versehen vom verbotenen Baum gegessen hatte, und wie infolgedessen Adam und Eva aus
dem Paradies verbannt wurden. Sie dürfen nicht mehr in der Utopie des Paradieses bleiben, da der
Mann eine Sünde begangen hat. Karl Roßmann ist von seinen Eltern bestraft worden, da er mit
seiner vorehelichen Beziehung eine Sünde begangen hat. Eine Sünde, für die er behauptet nicht
verantwortlich zu sein, weil das 35-jährige Dienstmädchen ihn verführt hätte. Deswegen wurde Karl
Roßmann aus der Unschuldigkeit der Utopie des alten, „heiligen“ Europas weggeschickt. Karl
behauptet, dass angeblich das Mädchen sich ihn genommen hatte, und dass sie bei dem
Geschehenen die Schuldige war. Karls Unschuld jedenfalls war mit diesem Vorfall
unwiederbringlich zerstört, und doch begibt sich Karl im Laufe des Romans immer wieder auf die
Suche nach seiner verlorenen Unschuldigkeit. In zahlreichen Beispielen zeigt der Roman, wie gerne
Karl die Opferrolle im Leben annimmt.
Karl ist in die Opferrolle gestellt, wie in der „Verführungsszene“ möchte er für sich keine
Verantwortung übernehmen. Kafka beschreibt weiterhin klare Parallelen mit biblischen Zügen. Wie
die Bibel zeigt auch Kafka die Wichtigkeit des Leibes auf. Wichtig für Karl ist, dass Johanna
Brummer die körperliche Grenze Karls überschreitet. Sie hat ihn vergewaltigt. Kafka gibt den
Vorfall in intertextueller Anspielung auf die biblische Erzählung des Sündenfalls wieder und
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 6
beschreibt wie durch diese Verbindung zwischen zwei Körpern, als Akt weiblicher Verführung die
Unschuld von Karl genommen wird. Man könnte sagen, Johanna tritt hier in die Rolle der
verführenden Schlange, Karl übernimmt Evas Position als Verführter. So beschreibt Kafka einen
Wechsel der geschlechtlichen Rollen aus der Bibelgeschichte. In Karls Schilderung nimmt er die
Opferrolle ein. Johanna nimmt seine Unschuld auf der Suche nach seinen nicht näher definierten
„Geheimnissen.“3 Auch in der Bibel ist bei der Erschaffung des Menschen, parallel zur Zeugung
von Karls Sohn gesehen, von einem Geheimnis die Rede:
29 Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehaßt; sondern er nährt es und pflegt sein, gleichwie auch der HERR die Gemeinde. 30 Denn wir sind die Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. 31 "Um deswillen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter und seinem Weibe anhangen, und werden die zwei ein Fleisch sein. 32 Das Geheimnis ist groß; ich sage aber von Christo und der Gemeinde. 33 Doch auch ihr, ja ein jeglicher habe lieb sein Weib als sich selbst; das Weib aber fürchte den Mann.4 Weiter beschreibt die Genesis wie der Mann die Frau aus seinem eigenen Fleisch erschaffen hat:
21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippen eine und schloß die Stätte zu mit Fleisch. 22 Und Gott der HERR baute ein Weib aus der Rippe, die er vom Menschen nahm, und brachte sie zu ihm.5
Karl beschreibt die Verführung als „ihm war als sei sie ein Teil seiner selbst und vielleicht aus
diesem Grunde hatte ihn eine entsetzliche Hilfsbedürftigkeit ergriffen. Weinend kam er endlich
nach vielen Wiedersehenswünschen ihrerseits in sein Bett.“6 Dieser Satz zeigt die biblischen
Parallelen der körperlichen „Einheit“ zwischen Mann und Frau auf. Eine Einheit, die Karl
allerdings danach traumatisiert fürchtet. Nicht lange nach dieser Szene fängt der Fall Karls an,
genau wie Adams Fall, nachdem Eva den Apfel gegessen hat. Der Schlange sagt, dass wenn sie
diesen Apfel isst, würde sie den Unterschied zwischen Gut und Böse wissen und dann würde sie
3 Kafka, Franz, Der Verschollene. (Stuttgart: Reclam 2006): 31. 4 Epheser 5:28-33 Luther Bibel 1912 5 Genesis 2:21-23 Luther Bibel 1912 6 Kafka, Franz, Der Verschollene. (Stuttgart: Reclam 2006): 31.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 7
den Göttern ähnlich sein. Johanna Brummer wolle irgendwelche Geheimnisse von Karl erfahren7
und Eva war ebenso neugierig und wollte vom verbotenen Baum essen, vom Baum der Erkenntnis.
Hier übernimmt Johanna wiederum die angedeutete weiblich neugierige Position Evas.
Zwei Elternfiguren die im Roman auftauchen sind die Oberköchin und der Oberportier im
Hotel occidental, die Mutter- und Vaterfiguren ähneln. Die Oberköchin trägt die Mutterrolle
ihrerseits gerne und nimmt Karl unter ihre Flügel. Die zwei übernehmen die Rolle des Elternpaars
für die Jungen, die im Hotel occidental arbeiten. Die Oberköchin war der Meinung, dass „es für
[Karl] besser und passender wäre sich irgendwo festzusetzen, statt so durch die Welt zu bummeln.“8
Sie übernimmt die Verantwortung, die vorher der Onkel trug, Karl klar zu machen, dass er sich
selbständig irgendwo ansiedeln soll und Verantwortung für sich selbst tragen muss. Dagegen wird
der Oberportier eher als die böse, strafende Vaterfigur gezeigt. Die Meinung der mütterlichen
Oberköchin hört und schätzt dieser eigentlich immer, da auch die beiden in einem scheinbar intimen
Verhältnis stehen. Gerne nimmt Karl hier wieder die Stellung als Sohn ein, um seine Opferposition
aufrecht erhalten zu können.
Die Schreibmaschinistin Theresa im Hotel occidental entschied sich sofort für eine
Freundschaft mit Karl. Sie kam zu ihm in seiner ersten Nacht im Hotel, klopfte mitten in der Nacht
an Karls Tür und fragte, ob sie rein kommen dürfte, worauf er antworte: „Der Schlüssel steckt auf
Ihrer Seite.“9 Die Tatsache, dass der Schlüssel immer auf der Seite der anderen Menschen steckt,
wird auch ein wiederkehrendes Thema für Karl. Er lässt auch hier die Anderen immer die Macht
haben. Türen spielen eine entscheidende Rolle für Karl, als feste Grenzen zwischen dem Selbst und
der Welt, zwischen Karl und allem anderen. Die Welt tritt immer in sein Leben ein.
Interessanterweise ist Karl im Hotel occidental als Türhüter beschäftigt. Er war der Liftjunge, der 7 Kafka, Franz, Der Verschollene. (Stuttgart: Reclam 2006): 31. 8 Ibid., 120. 9 Ibid., 125.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 8
die Gäste den ganzen Tag hoch zur ihrem Luxusleben bringt und dann wieder nach unten mitnimmt.
Ein Grenzhüter und Begleiter von der oberen „Welt“ zurück zur unteren Welt. Die gehobene Welt,
eben auch die des Onkels, darf Karl nicht mehr erleben, denn wenn er einmal seine Stellung
verlässt, wird er sofort aufgerufen, bestrafft und von seiner Stelle abgelöst.10 Aber er hat trotzdem
die Möglichkeit dieses Leben zu sehen, zu erfahren, sich den Geruch von teurem Parfum in die
Nase steigen zu lassen. Und doch bleibt dieses Leben für ihn unerreichbar.
Die Station im Hotel occidental war wichtig für Karl, da sie für ihn das letzte Mal eine
Grenze war, auf der er noch hätte umkehren können und wo er seine Füße immer noch ab und zu in
das Leben der höheren Schicht strecken könnte. Ähnliche Ideen hat Peter-André Alt in seiner
Biographie “Der ewige Sohn: eine Biographie” entworfen: „Das Hotel ist ein Sinnbild der
transitorischen Existenz, in dem sich, ähnlich wie im urbanen Verkehr, die Flüchtigkeit der
modernen Lebensverhältnisse spiegelt.“11 Karls nächste Arbeitstelle bot sich mit der Rückkehr der
einzigen „Freunde“ die Karl im Buch trifft. Delemarche und Robinson, auch verlorene Schafe und
passive Ausländer, nennen Amerika letztendlich doch ein Zuhause. Sie suchen für sich auch nichts
Großes, keine großen Ziele in Amerika. Am Beispiel der Sängerin Brunelda, wo Delemarche und
Robinson Arbeit fanden, stellt Kafka ein sehr übertriebenes, groteskes Beispiel einer Frau vor,
anhand dessen man die Wichtigkeit der verführerischen Natur und Gewaltigkeit der Frauen in Der
Verschollene festlegen kann. Die am meisten übertriebene Figur im Buch, die Sängerin Brunelda ist
ein extremes Beispiel von Kraft und das Zeichen einer weiblichen Übermächtigkeit, die Karl
vollkommen zu dieser chaotischen Unterwelt mitnimmt. Mit ihrer Kraft und ihrem körperlichen
Umfang in grotesker Darstellung ist Brunelda für Karl zu einer greifbaren Absperrung auf dem Weg
zum Erwachsenwerden stilisiert.
10 Kafka, Franz, Der Verschollene. (Stuttgart: Reclam 2006): 156. 11 Peter-André Alt., Franz Kafka. Der ewige Sohn : eine Biographie. München Verlag C.H Beck: 2005): 360.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 9
Das Groteske in Literatur oder Kunst zeigt oft Deformierungen oder Hässlichkeit, und ist
auch immer, seit der Mittelalter mit Sünden verbunden.12 Sex, Geschlecht, Chaos und der Körper
sind Kennzeichen des Grotesken.: „To the artist, the grotesque represents a partial liberation from
representational, a chance to create his own forms—a prerogative usually reserved for others.”13
Der Künstler muss oft nah an grotesken Tendenzen sein, um Kunst zu erschaffen. Beispiele von
Kafkas Ideen zu solchen grotesken Theorien mit dem Körper als eine Bestraffung sind auch in
anderen Geschichten von Kafka, wie etwa Der Hungerkünstler, enthalten. Beispiel des Grotesken
im Verschollenen ist beispielsweise die Darstellung der Zirkusmenagerie. Auch Nietzsche zieht
häufig Vergleiche zwischen Tieren und Menschen, genau wie die Verbindung zwischen Tier und
Mensch in der grotesken Kunst. Ralf Nicolai zitiert in seinem Buch über Kafka Nietzsche: „Der
Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde.“14
Kafka erschafft eine Menge von verletzten, gefangenen Kreaturen, die nirgendwo hingehören. Karl
hat am Ende des Buchs ein Platz gefunden; schließlich landet er in der Welt der Kreaturen die
ebenfalls nirgendwo hingehören. Er kommt in die groteske Unterwelt unter der amerikanischen
Gesellschaft. So ist der Held, oder Anti-Held „des Zaubermärchens z.B in der Ausgangssituation
nicht Teil derjenigen Welt, der er angehört: [...] gejagt, verkannt,“15 und sein wahrer Kern nicht
gezeigt. Karl, Kafkas gedanklicher Versuch eine Ausbruchsmöglichkeit zu entwerfen, wird von
Amerikas ,Unterwelt’ gejagt, ist der Anti-Held der nichts fertigbringt und nichts fertig ausführt.
Karl Roßmann, der all sein Eigentum und seine Identität als Europäer verloren hat, fand auch keine
amerikanische Identität und ist schließlich in der Welt verschollen.
„Immer wieder rückt man Karl in bedrängender Weise auf den Leib, wobei die Gewalt von
12 Geoffrey Harpham,. “The Grotesque: First Principles." The Journal of Aesthetics and Art Criticis: 465. 13 Harpham, 465. 14 Ralf R. Nicolai. Kafkas Amerika-Roman „Der Verschollene“ Motive und Gestalten. 16. 15 Lotman, Jurij. Die Struktur literarischer Texte, übers., Rolf-Dietrich Keil (München: Wilhelm Fink, 1972.): 543.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 10
Männern und Frauen gleichermaßen ausgeht,“16 wie Peter-André feststellt. Ab und zu, wenn er
nicht zuhören will, verfügt Brunelda über Karl und zwingt ihn in eine unterwürfig passive Haltung.
Immer wieder knüpft Karl mit diesen Frauen Beziehungen, die ihn eher weiter von der Lust nach
irgendwelchen sexuellen Begegnungen mit Frauen entfernen. Brunelda „drückte Karl noch fester
ans Geländer, er hätte mit ihr raufen müssen, um sich von ihr zu befreien.“17 Bruneldas
Körperlichkeit treibt Karl weiter weg von irgendwelchen sexuellen Erfahrungen oder vom Status
des Erwachsenseins, denn Karl hatte nicht nur beinahe Angst vor Brunelda und ihrem kräftigen
Verhalten, sondern sie verlangte von ihm auch Verantwortung. Wenn er für sie arbeitet, hätte er
sich um sie kümmern müssen und wie Delamarche im Bad helfen und beim Anziehen behilflich
sein müssen. Eine Erfahrung mit der Karl nichts zu tun haben wollte. Wie Alt weiter sagt, ist
Sexualität im Verschollenen „stets an gesellschaftliche Abhängigkeiten gebunden, die ihrerseits in
den Beziehungen der Körper gespiegelt werden.“18 Durch diese Reihe von gewaltsamen
Erfahrungen, ist es für Karl fast unmöglich eine erwachsene Beziehung mit einer Frau zu führen. Er
bleibt also fest in seiner kindlichen Rolle, „kein zweiter Robinson, der in der Neuen Welt strandet,
sondern ein von seinen Eltern aus dem Haus getriebener, offenbar ungeliebter Sohn.“19 Er ist der
gefallene Sohn in dieser „Unterwelt“ der Untermenschen in Amerika, in die er gefallen ist.
Die „gefallener Engel“ -Rolle benutzt Karl wegen der Möglichkeit, sich weiter in die Rolle
des zum Opfer gemachten armen Sohns zu stellen. Der Sohn der „aus Versehen“ weit von der
Utopie entfernt gelandet ist. Amerika repräsentiert eine Unterwelt, die als Groteske bezeichnet
werden kann, insoweit als dass sie das Gegenteil von der Utopie Karls ist. Alle Sünden sind hier in
diesem fremden, geschäftigen Land zu finden. Kafka malt diese Welt nah an Gemälden von
16 Alt, 365. 17 Kafka, Franz, Der Verschollene. (Stuttgart: Reclam 2006): 230. 18 Alt, 366. 19 Alt, 364.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 11
Hieronymus Bosch, der Maler der für seine grotesken, religiös fraglichen Gemälde bekannt ist.
Kafka malt eine Art von Albtraum, den Kafka selbst einmal hätte träumen können. Kafka malt
Amerika auf die Weise grotesk, dass Karl immer weiter von dem geschäftigen und scheinbar
gefährlichen Leben, welches er dort fand, wegzurennen versucht. Die Groteske in Amerika wird
wie folgt beschrieben: „Figürlich bedeutet […] so viel als seltsam, unnatürlich, abenteuerlich,
wunderlich, possierlich, lächerlich, fratzenmäsig und derg.[sic]“20 Mit jedem Schritt weiter weg
von New York wird Karl in der Gesellschaft immer weiter nach unten gedruckt. Karl entfernt sich
im letzten Fragment erneut von allem was ihm bekannt war. Der Koffer und die Fotos sind verloren.
Mit der Entfremdung in einem neuen Land, wie Homi Bhabha beschreibt, wird die Möglichkeit
irgendwie anzukommen zurückgewiesen, weil die „Zugehörigkeit zu einem heimisch-vertrauten Ort
immer mit der unheimlichen, aber unvermeidbaren Bedrohung verschränkt, [ist] die von dem
kulturell Anderen ausgeht, z.B mit dem Gefühl von Fremdheit, von Andersartigkeit und fehlender
Zugehörigkeit.“21 Als Karl nichts Bekanntes in Amerika finden kann und all seine vorherigen
Sachen verloren hatte, füllte er diese Leerstellen mit neuen, grotesken Umgebungen auf. Immer am
Rennen und am Rand der menschlichen Welt, fand Karl überhaupt keine Bequemlichkeiten und
bleibt weiter in seiner Zuschauerposition.
Durch den Versuch unschuldig und unverantwortlich zu bleiben, eben dieses „unwissende“
Kind, welches Karl spielt, bleibt er auf der kulturellen Grenze zu Amerika und zum Ankommen
stecken. Peter-André Alts Buch ist auf der Idee gegründet, dass „Kafkas literarisches Werk [...]
einer Ästhetik des Zirkulären verpflichtet [ist], in der sich die Ich-Konstruktion des ewigen Sohnes
spiegelt. [...] Der Ich-Entwurf des ‚ewigen Sohnes’ ist daher das Geheimnis der
20 Wolfgang Kayser. Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. (Oldenburg: 1957): 21. 21 Elisabeth Bronfen vorwart zum Die Verortung der Kultur von Homi K. Bhabha.(Stauffenburg Verlag, 2000): ix.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 12
Künstlerpsychologie, die Kafkas Schreiben grundiert.“22 Es ist genau dieser „ewige Sohn“ Entwurf
den Alt für den Autor selbst benannte: Kafka hat sich „niemals aus der Rolle des Nachgeborenen
befreit, der zögert, erwachsen zu werden. Seine Liebesgeschichten treiben in Katastrophen, da der
Eintritt in die Rolle des Ehemanns oder Vaters seine Identität als Sohn zerstört hätte.“23 Die
Schwelle zum Erwachsensein scheint in prägnanten Momenten durch die Schüssel zu Karls
„Zimmer“ symbolisiert. Nicht nur die Eltern von Karl haben ihm die Möglichkeit zum
Erwachsenwerden durch die, durch das Exil verwehrte Übernahme der Verantwortung für seine
Vaterschaft genommen, die Frauen drückten ihn, nach seiner Schilderung, auch immer wieder nach
unten. Und er lässt es zu.
Neben dem Motiv des ewigen Sohns, des ewigen Sohns des Heiligen Vaters, der für seine
Sünden mit dem amerikanischen Exil bestrafft wird, hat Karl auch Ähnlichkeiten zum „ewiger
Jude“-Motiv Kafkas, der in seinen Geschichten nie vom Judentum seines Vaters loskam. Karl
gleicht Adam, der den Menschen repräsentiert. So wirkt der Bibelspruch passend:
Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und gegessen hast von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen habe: Du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen: mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens; 18 und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. 19 Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staube wirst du zurückkehren!24 Die Beispiele von Kafkas zerrissenen religiösen Ansichten und seine biblischen Spuren tauchen
immer wieder auf. Karl ist wie der ewig heimatlose Jude - diese Judenfigur war früher mit dem
Jünger Johannes verbunden, eine Legende die in einer Anzahl von literarischen Schriften wieder
auftaucht. Dieser „Jude“ kämpft, genau wie Kafka selbst, mit seiner jüdischen Identität, zerrissen
zwischen zwei Glaubensansichten, der Vergangenheit und der Zukunft. Der ewige Jude hat, wie
22 Alt, 15. 23 Alt, 15. 24 1 Mose 3:17-19, Elberfelder 1905.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 13
auch Karl Roßmann, keinen Herrn mehr und wandert herum, auf der Suche nach seiner Rettung. Er
war „condemned to wander eternally over the face of the earth, awaiting the Master’s second
coming. ... today he is he symbol of a race,“25 beschreibt Nelson Sherwin Buschnell in seinen
Anmerkungen zu Kafkas jüdischer Identität. Der Verschollene könnte auch die „ziellose
Wanderungen Karls durch Amerika“ betitelt werden. Denn das entspricht genau dem Schicksal von
Karl, der ziellos und ewig wandert und wartet bis der Herr, beziehungsweise eine Vaterfigur,
wiederkommt, um ihm zu retten. Der ewige Jude porträtiert scheinbar jeden Juden der zerrissen
zwischen diesen zwei Identitäten ist. Der sich nach Zion zurückzukehren wünscht, aber in einem
anderen Land verschollen ist und wartet.
In Walter Sokels Artikel über Kafka als Jude, beschreibt er wie Kafkas Vater war: „The
epitome of a Yom Kippur Jew, that is, the incarnation of half-heartedness, hypocrisy and self-
deceiving compromise. His Judaism appeared a hollow ritualism which enshrined pretense in the
place of faith and mistook self regarding conventionality for a sense of community and tradition.”26
Karl ist im Roman trotzdem das genaue Gegenteil dieser Konventionen. Kafka beklagte, genau wie
viele junge jüdische Menschen damals, “Jewishness manifested itself as a double negative. Jews
were Jews because they were not like others, because they were different from everyone else.”27
Und in dem, was Kafka schreibt, entfernt er sich immer weiter vom Judentum und schreibt
eigentlich nicht explizit darüber. Er sah das Judentum, wie viele fortschrittliche junge Juden des 19.
Jahrhunderts, als Form der Unterdrückung an. Es scheint, als ob Kafka sein Judentum leugnen
wollte, obwohl er immer näher dahin zurück kommt als er älter wird. Und doch tauchen die
jüdische Themen in seinen Werken, in impliziten Andeutungen immer wieder auf. Im
Verschollenen findet sich das Treffen mit dem Studenten Josef Mendel bei Brunelda, draußen auf 25 Nelson Sherwin Bushnell. “The Wandering Jew and "The Pardoner's Tale" Studies in Philology: 452. 26 Walter H. Sokel, “Kafka as a Jew.” New Literary History. Vol. 30, No. 4, Case Studies (Autumn, 1999): 842. 27 Ibid., 843.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 14
dem Balkon, der Karls Neugier weckt, da dieser alles zu sein scheint, was Karl nicht ist. Josef
Mendel verkörpert den seit dem Mittelalter stereotypischen Juden, so ist Josef dem Bild
entsprechend ebenfalls auch frei. Mendel liest und studiert viel, ist denkfähig, einen kleiner
Spitzbart wird erwähnt. Josef Mendel ist erfolgreich in Amerika, hat einen guten Job gefunden, für
den er „sehr stark gearbeitet hat,“28 und auch in seinem Namen teilt er Ähnlichkeiten zum
deutschen-jüdischen Philosoph Moses Mendelssohn aus dem achtzehnten Jahrhundert.
Mendelssohn ist eine prominente Figur in der deutschen und jüdischen Literatur.
Später in Kafkas Leben interessiert er sich besonders für Antworten auf die religiösen
Fragen bezüglich seiner jüdischen Vergangenheit, des Judentums seines Vaters und bezüglich
dessen, was er als Kind unter dem ’Judentum’ gelernt hat. Seine existentialistischen Ideen gaben
ihm die Möglichkeit weiter mit diesen Gedanken einzugehen. Er liest, genießt und verfolgt die
Forschung von Nietzsche und Kierkegaard.29 In seinem Verhältnis zum Judentum hinterfragt er
alles und fängt an, seine Gedanken über den Existentialismus zu sammeln. Er fühlte sich immer
entfremdet in seinem Leben als Deutsch-Student in Prag und eben als Jude.30 Und so fängt er an,
zwei Welten zu unterscheiden: Wahr und Unwahr, Paradies und Unterwelt, Amerika und Europa.
Karl hat sich irgendwo in der Mitte verlaufen. Ralf Nicolai beschreibt diese existenzialistische
Theorie zur Karls Reise als „zwei Schritte enthalten insgesamt drei Standorte, nämlich den Ort des
Ursprungs, von dem der erste Schritt seinen Ausgang nimmt, dann das Ende des ersten Schrittes als
Station zwischen dem verlassenen Ursprung und dem noch nicht erreichten Ziel, und zuletzt, mit
dem abgeleisteten zweiten Schritt, die Ankunft am Ziel.“31 Somit sieht Nicolai ein, allgemein doch
eher fragliches, Ankommen Karls in Amerika. Kafka schickt Karl Roßmann ins Exil nach Amerika.
28 Kafka, Franz, Der Verschollene. (Stuttgart: Reclam 2006): 243. 29 Sokel, 837-853. 30 Sokel, 837. 31 Ralf R. Nicolai. Kafkas Amerika-Roman „Der Verschollene“ Motive und Gestalten: 10.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 15
Ein Exil als ‘dritter Ort’ und als ’dritter Bereich’ „zwischen einem ursprünglich verlorenen und
einem sekundär erworbenen Ort, zwischen Bekanntem und Fremden, zwischen einer Vergangenheit
die sich als solche durch den Verlust des Heimatortes als unwiderruflich verloren abzeichnet.”32
Was Kafka verlangt war eine Figur in größtmögliche Distanz von Europa und dem jüdischen,
gefangenen Leben in Prag zu schicken und ins geistige Exil zu verschwinden.
In Bezug auf Kafka selbst könnte der Roman auch als ein Exilroman gesehen
werden. Die Bestrafung nach Amerika zu gehen war für Karl Exil, ebenso wie für Kafka. Kafka
flüchtet sich in Gedanken aus seiner Umgebung nach Amerika in ein freiwilliges Exil. Er schreibt
über ein Land, das fremd war. Abgesehen von einigen Bildern, Büchern, und einer Anzahl von
Geschichten hat Kafka sich das Land gedanklich erschaffen, in erster Linie also ein neues Land.
Dieses Land war ein Gegenstück zu der Welt, die er kannte. Für Kafka existiert Amerika in seinem
Kopf und in Büchern als ein Traumland mit unglaublichen Möglichkeiten. Amerika in dem Roman,
ist ein Konstrukt, ein Ausdruck von Kafkas Vorstellung des damaligen Amerikas.
In seiner Untersuchung der Einheit des Erzählens und der alltäglichen Ebenen des Lebens,
hat Jurij Lotman in der Analyse Die Struktur literarischer Texte erhoben, dass
das Motiv [...] die elementare, unauflösbare Einheit des Erzählens [ist], die mit einem typisierten, in sich abgeschlossenen Ereignis auf der externen (alltäglichen) Ebene korreliert: Unter einem Motiv verstehe ich eine Formel, die der Gesellschaft in der Frühzeit auf die Fragen antwortete, die die Natur dem Menschen überall gestellt hat, oder die besonders lebhafte, wichtig erscheinende oder sich wiederholende Eindrücke von der Wirklichkeit fixierte. 33
Vor diesem Hintergrund war Karls Reise also auch ein Exil für Kafka. Aber wie Bridgewater
beweißt, war er nicht besonders erfolgreich, denn “’Karl Roßmann is in reality no more able to
escape from Prague than was Kafka, whose obsession with the central myth of the Judaeo-Christian
tradition forms the basis of all three novels, hence Max Brods comment that’‚ Kafka rechtet mit 32 Elisabeth Bronfen. “Exil in der Literatur: Zwischen Metapher und Realität.” Arcadia 28/1993.(1993): 167-183. 33 Jurij Lotman,. Die Struktur literarischer Texte, trans., Rolf-Dietrich Keil (München: Wilhelm Fink, 1972.): 533.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 16
Gott ab, wie einst Hiob es getan hat. Er richtet über den Sündenfall, die Austreibung aus dem
Paradies’”34 Dies beschreibt, dass Kafkas Versuch das wahre Amerika darzustellen nie besonders
erfolgreich sein konnte. Kafkas „Land ohne Grenzen,“ die sanften Hügel und der Stadt Ramses
existieren nicht.
Im Laufe des Romans sieht man Kafkas gefangene Figur in Der Verschollene in dieser
existenzialistischen Existenz, und Kafka benutzt die Freiheiten und Möglichkeiten des Buchs, der
Schrift und dieses neuen Landes um außerhalb Europas seine Gedanken von europäisch-
aufklärerischen Ideen zu befreien. Gefragt, warum Juden deutsche Schriftsteller werden möchten,
antwortet Kafka:
To get away from the Jewishness of their fathers, usually with the confused consent of their fathers […] so they wanted to write in German: but with their little hind legs they remained stuck in the Jewishness of their fathers and with their little front legs they were finding no new ground […] metaphor of the insect wriggling in suspension between what it wanted to leave and what it failed to arrive at, Kafka characterized his own work as inspired by total alienation.“35 Genau solche Antworten beschreiben, warum Kafka solch ’andere’ Geschichten schreiben wollte.
Denn Der Verschollene war das Gegenteil zu seinem Leben in Prag. Genau solche starken Spuren
der Entfremdung von der normalen Welt und körperlicher Entfremdung hat Kafka auch in seiner
Novelle Die Verwandlung beschreiben. Die Verwandlung, eine Novelle die 1912 erschien, handelt
von einem Jungen, der plötzlich eines Morgens als Ungeziefer erwacht. Die Geschichte beschreibt
genau einen Inbegriff von jemandem der sich fremd in seinem eigenen Körper und Leben fühlt,
einer Entfremdung von allem was bekannt und „Zuhause“ war, jemand, der plötzlich anders aussah
und fühlte. Kafka verfasste Der Verschollene fast in der gleichen Zeit, doch wo Der Verschollene
existenzialistische Grenzen hat, beschreibt Die Verwandlung wesentlich konkretere Beispiele einer
körperlichen Grenze, grotesker Entfremdung und körperlichem Einschluss.
34 Patrick Bridgewater,. Kafkas Novels An Interpretation. (New York: Rodopi 2003): 29. 35 Sokel, 837-853.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 17
Die Unschuldigkeit Karls wird im Roman nicht wieder gefunden. Die Enthüllung von
Kafkas innerer Groteske und zerrissener Weltanschauung zeigt eine brutale Welt, in der man sich
alles, was man im Leben möchte, selbst erarbeiten muss. Karl befindet sich immer bequem hinter
Türen und Schlössern, aus- oder selbst eingesperrt von der Welt, genau so wie er bequem von
anderen getrieben wird. Der Rezipient liest nur Karls Meinung zum Geschehen, weil es nur von
Karl erzählt bekommt, von Karl dem Opfer, dem gefallenen, verletzten Sohn. Dies macht es ganz
einfach für Kafka, diese Welt als eine Bestrafung zu malen. Der Leser sieht nur die selbe Kulisse
eines Zimmers wie Karl und dass alle die hinein kommen nur Eindringlinge sind. Der Leser liest
Amerika wie Kafka Amerika sah, eingesperrt in Prag und aus Europas aufklärerischer Mentalität,
durch eine enge, geschlossene, barsche Welt. Infolge fällt Karl vor dem Auge des Rezipienten
zurück in sein kindliches ‘Getrieben-werden’ und ist verschollen in der Geschäftigkeit und letztlich
unter den Mengen der Zirkusmenschen. Auch der Leser fällt durch die ausschließlich auf Karl
beschränkte Erzählweise sehr leicht zurück in ein unmündiges, geleitetes und nicht hinterfragendes
Lesen, da keine Zweifel durch einen Außenstehenden Erzähler an Karls Geschichte geweckt
werden. Somit wird der Rezipient im Lesen ein wenig Karl gleich.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg HS Borderline: Grenzen und Grenzverletzungen in der Literatur Sommersemester 2011
Riggs 18
Literaturverzeichnis Alt, Peter-André. Franz Kafka: Der ewige Sohn: eine Biographie. München Verlag C.H Beck: 2005. Bhabha, Homi K. Die Verortung der Kultur. Stauffenburg, 2000. Bridgewater, Patrick. Kafkas Novels; An Interpretation. New York: Rodopi 2003. Bronfen Elisabeth. “Exil in der Literatur: Zwischen Metapher und Realität.” Arcadia 28/1993, Heft 1 (1993): 167-183. Bushnell, Nelson Sherwin. “The Wandering Jew and "The Pardoner's Tale." Studies in Philology. Vol. 28, No. 3 (Jul., 1931): 450-460. Harpham, Geoffrey. “The Grotesque: First Principles." The Journal of Aesthetics and Art Criticis. Vol. 34, No. 4 (Sommer, 1976): 461-468. Kafka, Franz: Der Verschollene. Stuttgart: Reclam 2006. Kayser, Wolfgang. Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung. Oldenburg: 1957. Lotman, Jurij. Die Struktur literarischer Texte, trans., Rolf-Dietrich Keil. München: Wilhelm Fink, 1972. Ralf R. Nicolai. Kafkas Amerika-Roman „Der Verschollene“ Motive und Gestalten. Würzburg:
Königshausen & Neuman 1981. Sokel, Walter H. “Kafka as a Jew.” New Literary History. Vol. 30, No. 4, Case Studies (Autumn, 1999): 837-853.
Abbildung an der Titelseite Getty Images. 22nd April 1889 - “Oklahoma Land Rush” aufgerufen am 24.06.2011. “http://content.answcdn.com/main/content/img/getty/9/4/3070894.jpg.”