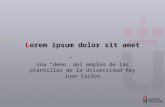Glaubers Begegnung mit dem Glaubersalz
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Glaubers Begegnung mit dem Glaubersalz
Abb. 1: Apothekergefäß für Glaubersalz mit der Aufschrift: Sal mirabil(e) Gl(auberi) = Glaubers Wundersalz (Bild: Deutsches Apothekenmuseum Heidelberg)
128
Glaubers Begegnung mit dem Glaubersalz 1
Rainer Werthmann
Die Substanz, die den meisten Menschen einfällt, wenn sie nach Johann Rudolph Glauber gefragt werden, ist das Glaubersalz: Natriumsulfat Na2SO4, das Natriumsalz der Schwefelsäu-re. Glauber nannte es Sal mirabile = wunderbares/wundersames Salz = Wundersalz.
Er erhielt es als Nebenprodukt bei der Herstellung von konzentrierter Salzsäure aus Koch-salz und Schwefelsäure oder Eisensulfat, etwa nach den Gleichungen
2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCloder 4 NaCl + 2 FeSO4 + 2 H2O + 0,5 O2 = 2 Na2SO4 + 4 HCl + Fe2O3
Das Herstellungsverfahren unter Einsatz von Schwefelsäure wird heute noch im großtech-nischen Maßstab angewandt. Es bildet eine der Grundlagen des 1791 entwickelten Leblanc- Sodaverfahrens und trug damit zum Aufbau der chemischen Industrie in Europa bei. Wäh-rend Glauber unter Sal mirabile noch die wasserfreie ebenso wie die kristallwasserhaltige Form des Natriumsulfats verstand, bezieht sich der von Glaubers Bezeichnung abgeleitete Mineralname Mirabilit heute nur noch auf die kristallwasserhaltige Form Natriumsulfat-De-kahydrat Na2SO4 ‧ 10 H2O.
Es gehörte zu Glaubers Arbeitsstil, zu allen bei seinen Versuchen erhaltenen Haupt- wie Nebenprodukten eine möglichst große Anzahl von Anwendungen aufzufi nden. Schließlich hatte er die meiste Zeit seines Lebens keinen adeligen Gönner, sondern musste vom Verkauf seiner Produkte leben. Zumindest folgende von Glauber empfohlene Anwendungen für kris-tallwasserhaltiges bzw. getrocknetes Natriumsulfat halten auch heutigen wissenschaftlichen Maßstäben stand:- als Abführmittel- als Flammschutzmittel für Holz 2
- als Latentwärmespeicher- als Trocknungsmittel für nichtwässrige Flüssigkeiten 3
- zum Schmelzaufschluss von Erzen- zum Schmelzaufschluss von Erzen in Gegenwart von Kohle (Vorform des Freiberger Aufschlusses)- zur Herstellung von Natriumsulfi d und Natriumpolysulfi d durch Reaktion einer Schmelze von wasserfreiem Natriumsulfat mit Kohle 4 (s. a. Kap. 16).
Extrem zukunftsweisend war seine Idee, das kristallwasserhaltige Salz könne als Latent-wärmespeicher dienen. In der Tat schmilzt es bei Temperaturen oberhalb 32,38 °C unter Wärmeaufnahme und kristallisiert in der Kälte unter Wärmeabgabe. Die extremen Kühlwir-kungen, die er beschreibt („ein solcher Magnet, die Kälte zu concentriren, und vielerhand Wunderdinge darmit auszurichten ...“) 5, sind aber überwiegend auf starke Abkühlung in ei-
129
Kap. 8
nem strengen Winter zurückzuführen. 6
Die dem Salz auch zugeschriebene Düngewirkung beruhte wohl eher auf einer Verunrei-nigung mit Kaliumsalzen.
Glaubers erste Begegnung mit dem von ihm später so intensiv bearbeiteten „sal mirabile“ = Glaubersalz ist eng mit seinem Besuch in Österreich 1625/1626 verknüpft. Damals befand er sich auf Wanderschaft und besuchte Wien, Wiener Neustadt und das Grab des von ihm ver-ehrten Paracelsus in Salzburg. In Wien und Wiener Neustadt erkrankte er an der „Ungarischen Krankheit“, sehr wahrscheinlich Fleckfi eber, magerte ab und konnte keine Speise vertragen. Man empfahl ihm eine Heilquelle außerhalb von Wiener Neustadt. Er beschreibt dieses Erleb-nis sowie die Quelle selbst ausgiebig in seinem Werk „De natura Salium“:
„Nach dem aber durch die Kranckheit mein Magen gantz alterirt, dass ich nicht essen können/ hat man mir gerathen/ daß ich ohngefehr eine Stunde von der Stadt zu einem/ an einen Weinberg gelegenen Brunnen gienge/ Wasser darauß zu trincken/ dann würde mir hernach das Essen wohl wieder schmecken“. 7
Durch das dortige Mineralwasser bekam er wieder Appetit und gesundete: „Da ich nun zum Brunnen kam/ zog ich mein Brod herauß/ tunckte die Brosamen
in den Brunn/ und fi eng an zu essen/ welches nur also bald besser als zu Hause geschme-cket/ da ich das beste Essen nicht gemocht/ ich brauchte die außgehölte Rinde an statt deß Bechers/ Wasser auß dem Brunn damit zu schöpff en/ weil ich dann darauff guten appetit zu essen fühlete/ aß ich endlich den Brodbecher auch auff / und gieng viel stärcker nach Hause/ als ich davon kam/ erzehlete/ wie wohl mir solch Wasser bekommen/ da sagte man mir/ wann ich damit fortfahren würde/ würde sich der verlohrne appetit ganz völlig wieder fi nden/ welchs auch geschah“. 8
Aus jenem Wasser kristallisiere beim Eindunsten ein Salz, aber nicht in würfeligen Kris-tallen wie Kochsalz, sondern in langen, strahligen Kristallen. Man sagte ihm damals, es sei Salpeter. Aufgrund der Kristallform und der medizinischen Wirkung schloss er aber Jahre spä-ter, in dem Wasser müsse Natriumsulfat = Sal mirabile = Glaubersalz gewesen sein. Weiter beschreibt er:
„[...] dann vorgedachter Brunn mit Holz eingefast/ darin zwischen dem Holze viel Wassermäuse ihre Wohnung hatten/ so bald man Brod in den Brunn legte/ und einige Brosamlein zu Boden fi elen/ also bald fi engen die Mäuse solche auff / verzehreten sie. Als ich fragte/ warum man solch guten Brunn nicht in Stein fassete/ und das Holz/ dahinder die Mäuse waren/ nicht weg thäte? Antworteten sie daß mans ohne Schaden deß Brun-nens nicht wol thun könte. Dann so man das Holz hinweg nähme/ welches albereit zu Stein worden/ so würde der Sand hernach fallen/ und der Brunn gestopff et werden/ das Holz aber/ so ausser dem Wasser/ war verfault/ welches ich damahl als ein Jüngling von 21 Jahren wohl in Acht genommen“. 9
130
Neben der medizinischen Wirkung war Glauber besonders beeindruckt von der Versteine-rungswirkung der Quelle und von dem nicht besonders salzigen Geschmack; er schreibt von süßgesalzenen Wassern. 10
Sehr wahrscheinlich handelte es sich um die Paul-Quelle von Bad Sauerbrunn bzw. ihren Vorläufer. 11 Wie Ausgrabungen anlässlich der Neufassung der Quelle in den Jahren 1925/ 1926 belegen, war diese Quelle schon in der Jungsteinzeit bekannt und wurde auch von Kel-ten und Römern genutzt. Man fand auch eine verschüttete Holzeinfassung, wie sie Glauber beschreibt. Die traditionellen Indikationen für dieses Heilwasser sind:
„Innerlich, den Anordnungen des Facharztes folgend getrunken, ist es sehr wirksam bei der Behandlung aller Stoff wechselkrankheiten, überschüssiger Magensäure, Diabetes, Harnsäure Diathese, Unregelmäßigkeiten der Darm- und Nierentätigkeit etc.“
Gelöste Substanz [g/kg] [%] vom Gelösten [%] vom Gelöstenohne M2+(HCO3)2
KCl 0,03572 1,52 6,34
NaCl 0,05821 2,47 10,33
Na2SO4 0,44873 19,04 79,61
NaHCO 0,01819 0,77 3,23
Ca(HCO3)2 0,96491 40,94
CaHPO4 0,00071 0,03 0,13
Sr(HCO3)2 0,00112 0,05
Mg(HCO3)2 0,74119 31,45
Al2(SO4)3 0,00152 0,06 0,27
H3BO3 0,00059 0,03 0,10
H2SiO3 0,05574 2,37
Fe(HCO3)2 0,02726 1,16
Mn(HCO3)2 0,00209 0,09
Summe ohne M2+(HCO3)2und H2SiO3 0,56367 100,01
Summe Gelöstes 2,35678 99,98
+ Kohlendioxid 2,49803
Tabelle 1 Analyse des Mineralwassers der Paul-Quelle in Bad Sauerbrunn aus dem Jahre 1910, umgeschrieben nach Dörner 12
131
Kap. 8
Bad Sauerbrunn liegt in südöstlicher Richtung etwa 7 km Luftlinie von Wiener Neustadt entfernt. Somit ist Glaubers Angabe „ohngefehr eine Stunde von der Stadt“ (Fußweg) realis-tisch. Auch seine Angabe „in einem Weinberg“, d. h. in landwirtschaftlich genutztem Gebiet, triff t auf die damalige Lage der Paul-Quelle zu. Ebenso ist die leichte Verschüttbarkeit mit Kies und Sand, von der Glauber berichtet, gerade für die Paul-Quelle charakteristisch und auch aus der Neuzeit bekannt: vor wenigen Jahren ist sie wieder einmal versiegt. 13 Für wei-tere Informationen zur Paul-Quelle und zur Geologie der Umgebung siehe die Arbeit von H. Küpper 14 sowie die Ortschronik von Bad Sauerbrunn.15
Das Wasser wird nach heutiger Nomenklatur als Calcium-Magnesi-um-Natrium-Hydrogencarbonat-Sul-fat-Säuerling eingestuft. Die ältere Be-zeichnung nach der im Bäderbuch von 1928 benutzten Nomenklatur lautet glaubersalzige Dolomit- bzw. magne-sitische Kalkquelle. 16 Die Umrechnung der Analyse von 1910 (Tabelle 1) zeigt, dass nach Abzug der „temporären Was-serhärte“, also der Hydrogencarbonate zweiwertiger Elemente, die sich beim Kochen als „Kesselstein“ absetzen, so-wie der gelösten Kieselsäure eine über-wiegend natriumsulfathaltige Lösung verbleibt, aus der beim Eindunsten in der Tat Glaubersalz Na2SO4 ‧ 10 H2O „Stralen-Weise dem Salpeter gleich“ 17 kristallisiert.
Die von Glauber beschriebene „Ver-steinerung“ der hölzernen Quellein-fassung sowie aller hineingeworfenen Gegenstände lässt sich auf den hohen Gehalt an Hydrogencarbonaten zwei-wertiger Elemente zurückführen, die Kalksinter bilden können wie etwa den „Sprudelstein“ von Karlsbad in Tschechien. Rückblickend hat es etwas Schicksalhaftes, dass Glauber zu Be-ginn seiner Alchemistentätigkeit in Ös-terreich mit genau demjenigen Salz in Berührung gekommen ist, mit dem er sich später so intensiv befasst hat und
Abb. 2: Titelblatt von Glaubers Buch „De Natura Salium“, in dem er u. a. seine Erlebnisse in Bad Sauerbrunn beschreibt (Quelle: SLUB Dresden, http://digital.slub-dresden.de/id27764349X)
132
das auch nach seinem Tod über Jahrhunderte mit seinem Namen verknüpft geblieben ist.
Warum Glauber dem Natriumsulfat den Namen „sal mirabile“ = „Wundersalz“ gegeben hat, lässt sich nur vermuten. Er sah in ihm das von Paracelsus hoch gelobte „sal enixum“ 18, dem auch eine verfestigende und konservierende Wirkung zugeschrieben wurde. Neben der gro-ßen Vielzahl von Anwendungen – in „Appendicis Generalis Zweite Centuria“ führt er dutzende an – haben ihn wohl vor allem drei Eigenschaften des Natriumsulfats besonders beeindruckt:- der milde, etwas fade, wenig salzige Geschmack: Nach Glaubers Ansicht ist ein Salz umso edler, je milder es schmeckt. Er führt an, dass reines Kochsalz milder schmeckt als Meerwasser (welches u. a. bittere Magnesiumsalze enthält); das aus Kochsalz hergestellte Glaubersalz bedeutet für ihn eine weitere Steigerung und Veredlung.- die Tendenz des getrockneten Salzes, durch Wasseraufnahme zu einem festen Stoff abzubinden: Hier sieht er, wie er auch bei der Beschreibung der Mineralquelle erwähnt, eine besonders starke „Versteinerungswirkung“, selbst gegenüber brennbaren Stoff en wie Holz, siehe die Verwendung als Flammschutzmittel. Das von seinem Vorbild Paracelsus entwickelte Sal-Prinzip (vergl. Kap. 10) wirkt gerade in Verfestigungs- und Kristallisations- prozessen.- die Fähigkeit, mit Kohle das braunrote Natriumpolysulfi d zu bilden: Hier sieht Glauber das „sal mirabile“ als ein Mittel, selbst das Prinzip der Brennbarkeit aus der Kohle herauszuzie- hen und zu konzentrieren. Die braunrote Farbe erinnert bereits an die postulierte Farbe des Steins der Weisen.
Abb. 3: Natriumsulfat mit 10 Molen Kristallwasser entsprechend dem Mineral Mira-bilit, Kristallisation von einer Rückstandshalde der Kaliindustrie (Foto: Mark Brooks)
133
Kap. 8
1 Bearbeiteter Auszug aus: Werthmann, Rainer: Neue Erkenntnisse über den Alchemisten Johann Rudolph Glauber (1604–1670) und sein Verwandtschaftsverhältnis zum Maler Johannes Glauber (1646 –1726), in: Mensch-Wissenschaft-Magie, Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, Band 27 (2010), S. 1–14
2 Glauber, Johann Rudolph: Johannis Rudolphi Glauberi Reichen Schatz- und Sammel-Kastens. Oder Appendicis Generalis Zweite Centuria, Amsterdam 1660, S. 113–115
3 ebd., S. 82/83
4 ebd., S. 89/94
5 ebd., S. 76
6 ebd., S. 70–80
7 Glauber, Johann Rudolph: De Natura Salium, enthalten in : Glauber, Johann Rudolph: Opera Chymica Band I, Frankfurt am Main 1658, S. 491, Reprint Hildesheim 2004
8 ebd., S. 491/492
9 ebd., S. 492
10 Glauber, Johann Rudolph: De Natura Salium, enthalten in : Glauber, Johann Rudolph: Opera Chymica Band I, Frankfurt am Main 1658, S. 493, Reprint Hildesheim 2004
11 Für die Informationen zur Paul-Quelle danke ich Herrn Mag. Dr. Gerhard Hobiger, Geologische Bundesanstalt Wien.
12 Dörner, Ludwig: Die Paul-Quelle in Sauerbrunn, Burgenland; Selbstverlag (Sauerbrunn 1928) S. 10
13 Persönliche Mitteilung von Prof. Dr. H. Gebelein, Universität Gießen
14 Küpper, H.: Geologie der Heilquelle Sauerbrunn, Burgenland, JB. Geol. B. A., Bd. 105, S. 39–47 (1962) 15 Bad Sauerbrunn, Ortschronik in drei Teilen, Bad Sauerbrunn ohne Jahresangabe, wahrsch. 1999
16 Conrad, V.: Österreichisches Bäderbuch – Offi zielles Handbuch der Mineralquellen, Kurorte und Kuranstalten Österreichs, Wien 1928
17 Glauber, Johann Rudolph: De Natura Salium, enthalten in : Glauber, Johann Rudolph: Opera Chymica Band I, Frankfurt am Main 1658, S. 492, Reprint Hildesheim 2004
18 ebd., S. 490
134