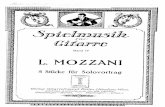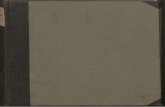Fritz Krafft: Otto von Guerickes Entdeckung der Unbegrenztheit des Weltraums. In: G. Wolfschmidt...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Fritz Krafft: Otto von Guerickes Entdeckung der Unbegrenztheit des Weltraums. In: G. Wolfschmidt...
Krafft-Nr.597/616Expedition in die Wissenschaft. Band 2: Sach- und Spaßgeschichten aus Physik und Astro-nomie. (Erlebnis Wissenschaft bei Wiley-VCH) Weinheim usw.: Wiley-VCH 2006, S. 101–118[um Fußnoten erweitert ozhne die Abbildungen wieder abgedruckt unter dem Titel ‚Otto vonGuerickes Entdeckung der Unbegrenztheit des Weltraums‘ in: Gudrun Wolfschmidt (Hrsg.):„Es gibt für Könige keinen besonderen Weg zur Geometrie“. Festschrift für Karin Reich.(Algorismus, Heft 60) Augsburg: Erwin Rauner Verlag 2007, S. 289–298]:
Zwischen Copernicus und Newton:Otto von Guerickes physikalisch-theologischeArgumentation für einen unbegrenzten Raum
von Fritz Krafft
Die Geschichte der Wissenschaften wird in der Regel teleologisch betrachtet, vomStandpunkt der Gegenwart aus und in dem Wissen um das, was aus der Wissenschafteiner früheren Zeit heute geworden ist, woraufhin dann auch nur das beachtenswerterscheint, was sich noch in der heutigen Wissenschaft erkennen lässt, die vermeintlicheWahrheit. Versetzt man sich dagegen in das Denken einer anderen Zeit, so wird klar,dass deren Vorstellungen von der Natur und von natürlichen Vorgängen aufgrund derspeziellen innerwissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Voraussetzungen undBedingungen, die sie jeweils prägten, aufgrund des von ganz anderen Komponentenkonstituierten Historischen Erfahrungsraumes, nie identisch mit gegenwärtigen ge-wesen sind, nie gleichartig waren – wenn es natürlich auch auf einer höheren Ab-straktionsstufe und hinsichtlich des gleichen Bezugsobjektes gemeinsame Grundlagengibt, die als Komponenten innerhalb der wechselnden und sich wandelndenErfahrungsräume wie ein roter Faden verbleiben und damit wenigstens eine Vergleich-barkeit gewährleisten. Auch das Denken der Giganten der Wissenschaft war zu allenZeiten nicht allein durch die Erkenntnisse geprägt gewesen, die aus späterer Sicht we-sentlich zur Erweiterung des Wissens und zum Umbruch des Denkens beigetragenhaben; vielmehr ist es stets auch sehr viel mehr von der geistigen Tradition geprägt ge-wesen, als eine das ‚Fortschrittliche‘ aussondernde spätere Zeit glorifizierend geltenlassen will.
Leben und Denken des Magdeburger Patriziers und Bürgermeisters Otto von Gue-ricke (20./30.11.1602 [alten/neuen Stils] bis 11./21.05.1686) [siehe KRAFFT 1978] fielenin einen Erfahrungsraum, der nach dem Zerbröckeln alter, einheitlicher Traditionen imZuge des Renaissance-Humanismus und der zahlreichen reformatorischen Bewegun-gen, von denen die lutherische ja nur die nachhaltigste gewesen ist, und vor der Stabi-lisierung {/102} neuer politischer, soziokultureller und wissenschaftlicher Maßstäbe ge-prägt war durch vielfältige Umbrüche – Umbrüche politischer und wirtschaftlicher,
-1-
religiöser und gesellschaftlicher, aber auch wissenschaftlicher Art, die ihrerseits Denk-und Handlungsweisen im zentralen Europa der Frühen Neuzeit wesentlich mit be-stimmten. Vor allem wurden im Zuge dessen altgewohnte Traditionen und Autoritätenverlassen oder doch zumindest in Frage gestellt, um wieder vor sie und zurück zu denoriginalen Quellen zu gelangen – das ist es ja auch, was die Vorsilbe ‚re-‘ in Re-nais-sance, Re-formation und zu dieser Zeit auch Re-volution ausdrücken soll.
Erst als sich nach der Wiedergewinnung der antiken Quellen zeigte, dass die alsklassisch empfundenen und gleichwertig neben einander gesetzten, ursprünglich abereinander inhaltlich und zeitlich ablösenden Schriften, von den aus- und angleichendenHarmonisierungen der Tradition befreit, voller Widersprüche waren, wurde der nichtpersonalisierten und als älter denn sämtliche menschlichen Äußerungen deklarierten‚Natur‘ selbst die Rolle der neuen Autorität zuerkannt. Nicht mehr alte, ursprünglichautoritäre Meinungen über sie zählten, sondern allein „ratio et experientia“, Vernunftund Erfahrung zur Gewinnung und Prüfung von Erkenntnissen über sie, und alswesentlicher Teil der Vernunft die allein Erkenntnissicherheit gewährende Mathematikmit ihrer inneren Logik. Beide gelten aber seit dem beginnenden 17. Jahrhundert alseine Einheit, das heißt: die erfahrene Natur galt als mathematisch strukturiert – nichtnur als mathematisch beschreibbar (das ist der wesentliche Unterschied zu den älterenmathematischen Disziplinen der Naturbeschreibung, etwa in der Astronomie und Op-tik). Ein Johannes Kepler bemühte sich deshalb in immer neuen Anläufen, die arche-typische Mathematik als auch Gott vorgegeben zu erweisen, sodass er sie als Musterseinem Schöpfungsplan zugrunde legen konnte [KRAFFT 1999/a]; denn nur daraufhinist es natürlich sinnvoll, in der Natur selbst nach den mathematischen Strukturen zusuchen und die Physik insgesamt zu mathematisieren.
Es entspricht somit nur den allgemeinen Zeitläuften, wenn selbst die Herrschaft dervormals einheitlichen physica als wissenschaftlicher Grundlage für ein innerhalb der grie-chisch-römisch-christlich-scholastischen Tradition Europas gleichartiges Naturver-ständnis nach und nach zerbröckelte. Die Naturwissenschaft ging im 17. Jahrhundertmehr und mehr eklektisch vor: Eine physica selectiva, die für ver{/103}schiedene Bereicheunterschiedliche Prinzipien wählte, war an die Stelle der weitestgehend einheitlichenAristotelischen Physik der Scholastik getreten; wenn deren Anteile vor allem am Lehr-gebäude der Naturphilosophie an den Universitäten auch noch sehr groß war, sodasssich jede neuartige Teillösung gegen dieses geschlossene Gedankengebäude durchzuset-zen hatte. Für das neoscholastische Schrifttum galten auch keine Konfessionsgrenzen.Vielmehr benutzte ein Guericke selbstverständlich die Lehr- und Handbücher der Ba-rockscholastik beider Konfessionen.
Vor allem fehlte vor Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica von1687 eine breit anerkannte ‚physikalische‘ Erklärung für das von Nicolaus Copernicusum 1510 entwickelte und in den 1540er Jahren bekanntgemachte neue, heliozentrischeWeltbild, das viele ältere und jüngere Zeitgenossen Otto von Guerickes wie ihn selberob seiner größeren Ökonomie faszinierte. Sein Schöpfer hatte es noch weitgehend aufder Basis Aristotelischer Physik erstellt [KRAFFT 1999/a], die jedoch inzwischen ihreausschließliche Gültigkeit, vor allem ihren Bezug zum kosmischen Geschehen, wie es
-2-
die Experten sahen, verloren hatte. Andererseits wurde aber die Heliozentrik von derkatholischen und protestantischen Kirche bekämpft, weil die Bestandteile der ge-meinsamen Basis unterschiedlich gewichtet wurden: Die scheinbar in der Bibel veran-kerte Geozentrik fand beim Klerus und den Theologen eine höhere Bewertung als dievon der Wissenschaft schon immer geforderte, von Copernicus aber erstmalsgegenüber der ptolemaiischen Ausgleichsbewegung wieder ernst genommeneGleichförmigkeit der Sphärenrotationen, aus der für ihn die Heliozentrik folgte.
Als 1610/11 die Jupitermonde von Galilei und anderen entdeckt wurden, der Erd-trabant also nicht mehr als der einzige Weltkörper gelten konnte, der nicht um dieSonne, sondern um einen seinerseits auf einer Umlaufbahn um die Sonne befindlichenPlaneten kreist, war den Befürwortern der Geozentrik ein entscheidendes Argumentgegen das heliozentrische System verloren gegangen. Die Unregelmäßigkeiten in denPlanetenbewegungen ließen sich kinematisch viel einfacher mit einer relativ zu ihnenbewegten Erde deuten. Daraufhin waren durch die Zusammenfassung von Bewegungs-elementen aller Planeten in der einen (jährlichen) Bewegung der Erde auch erstmalssämtliche Bewegungen am Himmel kinematisch zu einem in sich geschlossenen Systemzusammenzufassen, sodass jedes Be{/104}wegungselement eines Planeten an einen ganzbestimmten Ort gebunden und in den Komponenten seiner mathematischen Theoriedurch diesen bestimmt war – wie es ja auch die während der Renaissance entwickeltePerspektive in der Malerei für die Details eines Gemäldes konstruktiv festlegte. Coper-nicus hatte gleichsam erstmals ein perspektivisches Himmelsgemälde entworfen, in demsogar die Bewegung des Beobachters als perspektivische, das heißt: parallaktische Ef-fekte mit berücksichtigt wurde.
So gab es seit dem frühen 17. Jahrhundert eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten:Entweder man erkannte das inzwischen erweiterte Copernicanische System an, in demdie sich um ihre Achsen drehenden Planeten alle um die Sonne als das ruhende Zen-trum der Fixsternsphäre (wie die Trabanten um ihren jeweiligen Planeten als Zentral-gestirn) kreisen – oder das System Tycho Brahes, in dem Mond, Sonne und Fixstern-sphäre um eine ruhende Erde kreisen, während sich die fünf klassischen Planeten Mer-kur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, ihrerseits umkreist von ihren Trabanten, um dieSonne bewegen. Die gegenüber dem Ptolemaiischen System ökonomischere Bündelungder Planetenbewegungen um die Sonne bei Copernicus blieb also erhalten; und jenachdem, wie ein Forscher sich zu den Erklärungsmöglichkeiten für die Phänomeneauf einer sich rasch drehenden oder einer ruhenden Erde und zu dem päpstlichen De-kret gegen die Copernicanische Lehre aus dem Jahre 1616 stellte, war er dann entweder‚Copernicaner‘ oder ‚Tychoniker‘.
Den Stand der Auseinandersetzung um die Mitte des 17. Jahrhunderts [KRAFFT2004], als Otto von Guericke in diese Diskussion einstieg, um nach neuen, augen-scheinlicheren Argumenten für das von ihm aufgrund seiner juristischen und ingenieur-wissenschaftlichen Ausbildung favorisierte neue, ökonomischere heliozentrische Welt-bild zu suchen, illustriert sehr gut der Titelkupferstich zum Almagestum novum [Bologna1651; siehe KRAFFT 2000, 6–8] des Jesuiten Giambattista Riccioli, einem sämtliche vor-liegenden astronomischen Quellen seit der Antike auswertenden voluminösen Kom-
-3-
pendium der Astronomie und Kosmologie – aus der Sicht eines Jesuiten. Guerickebesaß dieses Werk und verdankte ihm fast sämtliche in sein Buch aufgenommenenastronomischen (mathematischen) Daten. Anders als deren Deutung unterlagen dieseja auch keinen konfessionellen Zwängen. {/105 Abb. 1 /106}
Auf dem Titelkupfer werden die beiden um die Mitte des 17. Jahrhunderts alleinnoch ernsthaft diskutierten Weltbilder von Urania (Astraea), der Allegorie des ge-stirnten Himmels, gegeneinander gewogen, wobei das geozentrische Tycho Brahes fürden Jesuiten Riccioli – es war ab 1610/11 an den katholischen Universitäten von denJesuiten nach und nach als kanonisch in den Unterricht eingeführte worden – über dasheliozentrische obsiegt, während das Ptolemaiische System bereits ausgedient hat undbeiseite gelegt wurde. Tychos System stellte ja einen Kompromiss zwischen den beidenanderen dar, insofern es die Erde unbewegt im Zentrum beließ, sodass angezweifelteFolgen der Heliozentrik vermieden wurden (tägliche und jährliche Bewegung des Erd-körpers, die nicht gespürt werden und von der ‚Physik‘ nicht erklärt werden konnten,unermessliche Entfernung der Fixsterne und entsprechende Ausdehnung des Univer-sums).
In der durch Bibelverse abgesicherten und in der Praefatio erklärten Allegorie einerglaubens- (vielmehr: konfessions-)konformen empirischen Astronomie schaut das gei-stige Auge hinter diese Welt und sieht empirische Wissenschaft und Theologie als har-monische Einheit – was für Riccioli heißt: als von der katholischen Theologie alsPrimat geprägte Einheit; dem folgte Guericke natürlich nicht. Die Folgerung, dass überdas Lob der augenfälligen Großartigkeit der empirischen Welt nicht das Lob ihresSchöpfers vergessen werden dürfe, ist dann allerdings wieder überkonfessionell. DerProtestant und Heliozentriker Guericke stößt denn auch nach der Ausbreitung derErgebnisse empirischer Astronomie und einer Relativierung seiner Ausführungen überdie Fixsternwelt im Schlusskapitel seines Werkes Experimenta nova (Exp. VII, 5) indasselbe Horn des mit Bibelversen (aus Hiob und den Psalmen) unterlegten Lobs desSchöpfers in seiner Schöpfung.
Das 17. und größtenteils noch das 18. Jahrhundert kennen noch keinen Bruch zwi-schen Naturwissenschaft und Theologie, beide bilden noch eine harmonische Einheit!Nur können die von Seiten katholischer (aber auch protestantischer) Theologen undsich ihnen anschließender Astronomen und Philosophen als Zeugnis für einen Still-stand der Erde angeführten Bibelverse durchaus anders, nämlich im Sinne einerhistorischen Exegese, interpretiert werden, wenn das Harmoniestreben nicht einseitigdurch die Theologie gewichtet wird, wie Wissenschaftler beider Konfessionen, allenvoran Johannes Kepler und Galileo Galilei, schon gezeigt hatten. {/107}
Die in dem Kupferstich allegorisch dargestellte Situation der Astronomie und Kos-mologie zeigt aber auch, dass in der Mitte des 17. Jahrhunderts noch keineswegs Co-pernicus oder gar Kepler die Maßstäbe kosmologischen Denkens lieferten, wie es eineteleologisch orientierte, das heißt: gegenwartsbezogene, Wissenschaftsgeschichte gernesehen möchte. Fast die gesamte katholische Welt dachte vielmehr so wie Riccioli, undselbst viele gebildete Protestanten waren Geozentriker geblieben. Natürlich gab es eineVielzahl von Wissenschaftlern, die die Waage der Urania genau anders hätten aus-
-4-
schlagen lassen; aber während die Ideen eines Johannes Kepler vor ihrer Einbettung inden übergeordneten Ideenzusammenhang einer Allgemeinen Gravitation und Trägheitbei Isaac Newton, also vor 1687, zwar durchaus nicht unbekannt waren, aber weitestge-hend (wie auch von Guericke) nicht anerkannt wurden [KRAFFT 1982], hätten auch siedas Ptolemaiische System als ausgedient empfunden.
Denselben Standpunkt hatte auch schon René Descartes 1644 in seinen Principia phi-losophiae (Pars III, § 15–18) bezüglich der drei von ihm als „Hypothesen“ diskutiertenSysteme vertreten, ohne dass er sich eingedenk der Verurteilung Galileis dann allerdingsfür eine der beiden, für Copernicus oder für Tycho Brahe, entschieden hätte.
Derartige Skrupel hatte Guericke nicht; für ihn bestanden keine geistigen Abhän-gigkeiten. Er gehörte nicht einer Universität an, war nicht Mitglied irgendeines gelehrtenZirkels, eines Hofes oder einer Akademie, auf die er mit seinen Äußerungen hätteRücksicht nehmen müssen, sondern im wesentlichen Autodidakt mit den praktischenErfahrungen eines theoretisch in Leiden geschulten Ingenieurs und ausreichend ver-mögend, um seine kostspieligen Experimente erdenken und ausführen zu können, aberangewiesen auf das in den Kompendien seiner Zeit gespeicherte Wissen, ansonstenaber auf eigene Intuition und Kombinationsgabe und auf den Gedankenaustausch ausAnlass seiner politischen Missionen mit Gelehrten und gebildeten Laien, die auch diePrüfinstanz seiner Experimente bildeten.
Die skizzierte Umbruchsituation mit ihren noch stark in der Tradition verwurzeltenphysikalischen und astronomischen Grundvorstellungen enthielt allerdings gleichzeitigdie Keime für neuartige Erkenntnisse; und es war nicht zuletzt Guerickes Einstieg vomhandfesten ingenieurwissenschaftlichen Denken her, mit dem neben speziellen Ent-deckungen und Erfindungen auch manche der neuen {/108} physikalischen Grundlagenzumindest als denkbare vorbereitet wurden.
Hierzu gehören seine Erfindung der Luftpumpe, wohl nicht vor dem Jahre 1646,sowie seine ersten Versuche im und mit dem durch sie erzeugten künstlichen Vakuum– wobei ‚Vakuum‘ zu dieser Zeit natürlich noch ‚(hochgradig) verdünnte Luft‘ bedeu-tete. Viele von diesen Versuchen hatte Guericke bereits 1653 und 1654 auf dem Re-gensburger Reichstag einem breiteren Publikum vorgeführt [KRAFFT 1996, S. LVIII]und hatten dabei auf den Kurfürsten von Mainz, Philipp von Schönborn, einen sostarken Eindruck gemacht, dass er die gesamte von Guericke mitgeführte Gerätschaftaufkaufte, mit an seinen Hof nach Würzburg nahm und den dortigen Mathematik-professor, den Jesuiten Kaspar Schott, die Versuche wiederholen und prüfen ließ. Dar-aus entwickelte sich ein längerer Briefwechsel zwischen Schott und Guericke über dieseVersuche und Guerickes Deutungen, den Schott als Anhang unter der Überschrift‚Experimentum novum Magdeburgicum‘ in seinem 1657 erschienenen Werk Mechanicahydraulico-pneumatica unter Beigabe von Abbildungen abdruckte. Hieraus erfuhr unteranderen Robert Boyle von Guerickes Geräten und Versuchen, baute erstere gemeinsammit Robert Hooke in verbesserter Form nach, wiederholte und ergänzte die Versucheund berichtete darüber 1659 in einer speziellen Schrift, die 1661 in Oxford auch in latei-nischer Übersetzung unter dem Titel: Nova experimenta physico-mechanica de vi aëris elasticaet eiusdem effectibus gedruckt wurde.
-5-
In der Vorrede der durch „neue“ Experimente erweiterten Berichterstattung inner-halb seiner 1664 in Nürnberg erschienenen Technica curiosa, sive Mirabilia Artis meinteSchott [SCHOTT 1664, S. 3), dass er „niemals etwas gleich Wunderbares in dieser Artgesehen, davon gehört, gelesen oder [sich] vorgestellt hat“, er glaube auch nicht, „dassdie Sonne jemals etwas Ähnliches, geschweige denn Wunderbareres seit Erschaffungder Welt beschienen“ hätte, wie auch mächtige Fürsten und hochgelehrte Männer,denen er die Versuche mitgeteilt und erläutert habe, bestätigt hätten. – Das klingt wieeine vorweggenommene Rechtfertigung aus der Ahnung heraus, dass die angelsäch-sische Scientific community und Literatur sich für die pneumatischen Erfindungen undVersuche schon bald lediglich auf Robert Boyle und das vermeintlich ‚Boylesche‘Vakuum berufen sollten.
Die Guerickeschen Versuche über die Eigenschaften und Wirkungen der Luft warenalso lange bekannt, bevor sein eigenes Werk da{/109}rüber 1672 erschien. Hierin neh-men die Experimente und ihre speziellen Deutungen das dritte von insgesamt siebenBüchern ein. Sie stellen also für den Verfasser nur einen Teil eines Weltbildes dar,dessen Gesamtdarstellung auch den Ort dieser Experimente innerhalb der guericke-schen Weltdeutung bestimmt und zeigt, dass sie wie auch die anderen mit der Schwe-felkugel [KRAFFT 2005, S. 297–305] mit ganz bestimmten Absichten erdacht und ange-stellt worden waren, und zwar um ein neuartiges physikalisches Weltbild augenschein-lich zu untermauern.
Bis auf die in den Augen der Zeitgenossen fehlgeschlagenen Versuche JohannesKeplers und Giovanni Alfonso Borellis hatten nämlich alle Theorien des Planeten-systems als rein kinematische Modelle ohne physikalisches Fundament, als bloßemathematische Hypothesen gegolten – Descartes bezeichnete sie ja noch ausschließlichals solche. Eine physikalische Erklärung der Bewegungsvorgänge vermochte außer ihmkeiner zu geben [KRAFFT 1999/b], wobei Descartes aber umgekehrt auch keinerleiVersuch machte, die spezifischen Bahnformen zu erklären, was allein durch die Äther-wirbel ohnehin nicht möglich gewesen wäre.
Für kosmologisch und physikalisch denkende Forscher wie William Gilbert,Johannes Kepler und Otto von Guericke war auch seit Copernicus ein weiteres Pro-blem hinzugekommen: Die Welt war mit einem Male sehr viel größer geworden. Hattesich der Durchmesser des aristotelisch-ptolemaiischen Kosmos durch die für diePlanetentheorien erforderlichen mathematischen Elemente zu ungefähr 20000 Erd-durchmessern berechnen lassen, so ergab sich aus der neuen Deutung derSchleifenbewegung der Planeten als parallaktischer Effekt der jährlichen Erdbewegungzwar für die planetarische Welt, also für die Saturnsphäre, ein etwas kleinerer (beiKepler ein nur etwa doppelt so großer) Durchmesser, doch rückte die Fixsternsphärewegen des Fehlens einer beobachtbaren Parallaxe selbst über dem Erdbahndurch-messer als Basis in unermessliche Entfernung, deren Unermesslichkeit dann nach derErfindung des Fernrohrs (1608) und seiner Verwendung zu astronomischen Winkel-messungen weiter wuchs, ohne dass vor 1838 überhaupt eine Fixsternparallaxe festge-stellt werden sollte, die dann wirklich einem Laien noch heute unvorstellbar große Ent-fernungen ergab.
-6-
Doch welche Funktion sollte dieser unermessliche Ätherraum zwischen Saturn- undFixsternsphäre erfüllen? Gott schafft nichts um{/110}sonst und ohne Zweck, wie schondie Scholastik im Anschluss an einen Leitsatz des Aristoteles konstatiert hatte [siehegenerell KRAFFT 1999/a]; und auch das 17. Jahrhundert dachte durchaus noch teleo-logisch. Rückblickend schrieb so auch Guericke 1661/62 zu Beginn des zweiten Buchesseiner Experimenta nova (Exp. II, 1), nachdem er die Größe des von den verschiedenenPlanetensystemen einzunehmenden Raumes berechnet hatte, dass ihn nicht nur die„dem menschlichen Verstande völlig unvorstellbaren unermesslichen Entfernungenhätten erschauern lassen“, sondern dass ihn besonders „jener überwältigende und gren-zenlos sich ausbreitende Zwischenraum“ zwischen den Planeten verwirrt und denWunsch erweckt hätte, ihn zu erforschen.
Hatte andere, wie Tycho Brahe, eben diese Konsequenz einer immensen Ausdeh-nung der Sternenwelt davon abgehalten, das heliozentrische Planetensystem anzuer-kennen, so scheint Guericke durch seine Ausbildung und Tätigkeit als Ingenieur vonder Ökonomie dieses Systems, das verschiedene Bewegungen aller Planeten durch dieeine der bewegten Erde als scheinbar erklärte, auch ohne schon die exakten Daten zukennen oder zu verstehen, so fasziniert und von seiner Richtigkeit so überzeugt gewe-sen zu sein, dass er das Problem mehr von der praktisch-experimentellen Seite her an-packte: Musste dieser ungeheure Raum denn von einem festen oder flüssigen Stofferfüllt sein? Wäre es nicht höchst unökonomisch gedacht, dieser gewaltigen Äthermassekeinerlei Aufgabe zuzuweisen?
Und dann erschien 1644 ein Werk, das von diesen Überlegungen her, die auf reinspekulativer Basis schon ein William Gilbert um 1600 angestellt hatte, in finsterste Ver-gangenheit zurückzufallen schien, die Principia philosophiae von René Descartes, worinwieder wie bei Platon Raum und Materie gleichgesetzt wurden, sodass eine Leere un-möglich, vielmehr aller ‚Raum‘ lückenlos von wirbelndem Äther erfüllt wäre.
Es ist verständlich, dass dem an handfestes technisches Arbeiten gewöhnten Inge-nieur Guericke, als er von diesem Buch – vermutlich 1646 auf dem Friedenskongressin Osnabrück, wo er insgesamt mehr als eineinviertel Jahr im Auftrag seiner Heimat-stadt weilte – hörte, nunmehr der Geduldfaden riss und er des nutzlosen akademischenDisputierens über dieses Problem überdrüssig wurde, wie er sich ausdrückte. Wenig-stens hat er sich bald nach seiner Rückkehr aus Osnabrück der praktischen Prüfungdieser Frage zugewendet, was ihn {/111} dann zur Erfindung der Luftpumpe und zumehreren Entdeckungen führte – wie der Elastizität der Luft, des Luftdrucks als Ursa-che für Erscheinungen, die bis dahin einem ‚horror vacui‘ zugeschrieben wurden, desGewichts der Luft auch innerhalb der Luftsphäre usw. Hatten der Widerlegung derTheorie des ‚horror vacui‘ auch schon die kurz zuvor oder parallel zu Guerickes Ver-suchen durchgeführten Experimente von Evangelista Torricelli und Blaise Pascal ge-dient, so war es insbesondere ein Experiment, mit dem Guericke allein ein entschei-dender Vorstoß gelang – was ihm auch durchaus bewusst war; denn er bildete das ‚Ex-perimentum‘, das heißt das Gerät, mit dem ihm diese Entdeckung gelang (beschriebenExp. III, 37), im Zentrum des Titelkupfers zu seinem Werk ab. Es beruht auf demzehnten der in Regensburg vorgeführten Experimente.
-7-
Guericke hatte seine imponierende Wirkung erst in Regensburg mehr zufällig ent-deckt und am 4. Januar 1657 Schott darüber berichtet, dass beim Anschluss eines eva-kuierten Rezipienten an eine in Wasser stehende Röhre dieses Wasser in große Höhengehoben würde, und hinzugefügt [SCHOTT 1657, S. 458 f.]: „Ich habe das inRegensburg durch eine Erfahrung festgestellt, die genaue Höhe aber nicht beachtet...“Das hatte ihn damals also noch nicht interessiert, aber auch keinen der Zuschauer; erschätzte die erreichte Höhe erst aufgrund Schotts diesbezüglicher Nachfrage nach-träglich ab. Als er diesen Versuch später mit der dazu konstruierten kunstvollen Ver-bindung von Rezipienten und Hebern für sein Studierzimmer Besuchern zeigte, wurdeer allerdings mehrmals gefragt, bis in welche Höhe das Wasser gehoben werden könne.Er berichtete darüber in einem von Schott in der Technica curiosa abgedruckten Brief am28. Februar 1662 mit folgenden Worten [SCHOTT 1664, p. 53–58, hier 54 f.; GUERICKE1968, S. (31)]:
„Da ich das damals noch nicht wusste, schaffte ich die Vorrichtung in meine höhergelegene Stube, verlängerte das Rohr und ließ es durch ein Fenster bis auf das Pfla-ster des Hofes hinab in den Eimer hineinreichen. Ich beobachtete die gleiche Wir-kung wie vorher. Da ich aber nichtsdestoweniger vermutete, diese Anziehung unddieses Emporsteigen des Wassers könne nicht bis ins Unbegrenzte wachsen,brachte ich das Gerät nach höher und höher liegenden Plätzen meines Hauses, bisich schließlich den Haltpunkt des Wassers fand, der in senkrechter Richtung beieiner Höhe {/112 Abb. 2 /113} von 20 Magdeburger Ellen lag. Als ich dies einige Malewiederholte und die ganze Vorrichtung ein paar Tage lang ruhig am selben Platzehatte stehen und zu anderen Zeiten den Vorgang sich von neuem hatte abspielenlassen, bemerkte ich, dass die Höhe, bei der das Wasser haltmachte, nicht immer diegleiche war, sondern um den Betrag einer Elle stieg oder fiel, besonders, wennRegen drohte. Daraus ersah ich schließlich, dass der Aufstieg des Wassers nichtdurch einen Ansog oder eine Flucht vor dem Leeren, sondern wirklich durch denLuftdruck erfolgte ...“Guericke gewann die Erkenntnis von der Höhe und dem Schwanken des Luftdrucks
also erst nach der Rückkehr aus Regensburg; aber er zog aus den Versuchsergebnissenbald die richtigen Schlüsse, und die Gespräche mit Valeriano Magni, der ihn auf demRegensburger Reichstag mit seinen eigenen und den torricellischen Experimenten be-kannt gemacht hatte, werden ihn dafür sensibilisiert haben. Wenn nämlich der Luft-druck (Guericke sprach damals noch von der gravitas aëris) zeitlich und örtlich in beideRichtungen schwankt – ein bloßes Absinken hätte auf eine undichte Stelle im Gerätschließen lassen müssen –, so könne das nur aus der unterschiedlichen Höhe der da-rüber befindlichen Luftsäule resultieren. Die Lufthülle könne folglich nicht sphärischbegrenzt sein, über ihr könnte sich keine entsprechende Äthersphäre als räumlicheBegrenzung befinden. Würde man sich den gesamten Raum oberhalb der Lufthüllenämlich mit einem auch noch so feinen flüssigen Stoff ‚Äther‘ ausgefüllt denken, somüsste dieser den unterschiedlichen Druck der im Vergleich dazu geringen Stoffmengeder Luft, auf die er von allen Seiten gleichmäßig drückt, ausgleichen, und es könntenkeine Schwankungen auftreten. Oberhalb der Lufthülle müsse sich vielmehr stoffleerer
-8-
Raum befinden. Folglich verflüchtige sich die Lufthülle auch allmählich sphärisch, bissie in großer Höhe allmählich ein Ende finde. – Wobei Guericke über diese ‚Höhe‘unterschiedliche Vorstellungen hatte: Während der Abfassung der Experimenta novanahm er 1663 (Exp. V, 9) als obere Grenze der Atmosphäre 1000 bis 2000 DeutscheMeilen an, 1665 sprach er gegenüber dem polnischen Gelehrten Stanislaus Lubienietzki,der seine Meinung über die Kometen erbat, dagegen von 1000 bis 2000, später sogarvon 10000 bis 20000 Meilen [KRAFFT 1969, S. 117–119]. {/114}
Neben dem ‚künstlichen‘, mittels Luftpumpe (oder Quecksilber-Barometer) herge-stellten ‚Vakuum‘ war damit die Existenz des ‚natürlichen‘ Vakuums zwingend erschlossen.Diese ‚natürliche Leere‘ könne aber wegen der elastischen Eigenschaften der Luft nuraußerhalb der Lufthülle angetroffen werden. Mit entsprechender Begeisterung hatte erdaraufhin schon am 22. Juli 1656 Schott geschrieben [SCHOTT 1657, S. 458 ff.; 1664, S. 26ff.; GUERICKE 1968, S. (19)]:
„Mir ist ganz kürzlich erneut rein zufällig geglückt – nicht durch meine Kunst undRührigkeit, sondern sozusagen durch die Verrichtung der Natur selbst (quasi per Na-turae ipsius operationem) –, einen augenscheinlichen Nachweis des reinen Vakuums,wie ihn die Aristoteliker verlangen, zu entdecken.“Der am Anfang stehende Schauder vor der ungeheuren Ausdehnung eines ohne
Sinn äthergefüllten Universums löst sich also im leeren Raum ober- und außerhalb deratmosphärischen Lufthüllen der Planeten wenigstens zu einem Teil auf. Die unendlicheGröße dieses ‚Nichts‘ ließ sich dann für Guericke ohne weiteres mit seiner protestanti-schen Idee vom Schöpfergott vereinen; denn dieses ‚Nichts‘ kann nur das Behältnis fürdie Weltkörper und anderen materiellen Dinge sein, wenn es leer und eigenschaftslosist und der Ausbreitung und Wirkung der zwischenkörperlichen ‚Kräfte‘ keinerlei Wi-derstand entgegensetzt, wenn es also unabhängig von ihnen besteht und keinen kör-perlich-stofflichen Abschluss erfährt. Deshalb sei auch nicht einzusehen, dass der leereRaum irgendwo und irgendwie begrenzt sei, dann aber auch nicht, dass die Zahl derSonnen mit ihren Planeten begrenzt sei. Dies wäre eine unangebrachte Beschneidungder göttlichen Allmacht und Schöpfungskraft.
Aber gerade gegen Giordano Bruno, der ja bereits einmal aufgrund des scheinbarenFehlens einer Fixsternparallaxe spekulativ auf ein unendliches (für ihn noch äthergefüll-tes) All mit unendlich vielen Sonnensystemen geschlossen hatte, waren deshalb nichtnur von Theologen beider Konfessionen so starke Einwände erhoben worden, dassdiese Vorstellung keine Anhänger fand; denn Gottes Allmacht, Gott selbst sei unend-lich, aber nicht seine Schöpfung, hieße das doch {/115} etwas Gleichwertiges neben ihnstellen, was der Person Gottes selbst vorbehalten sei. Johannes Kepler, Athanasius Kir-cher und René Descartes, die sich den Schlüssen Brunos nicht ganz zu verschließenvermochten, hatten das All deshalb zwar unermesslich, also für menschliches Fassungs-und Vorstellungsvermögen ‚unendlich‘ sein lassen, nicht aber tatsächlich unendlichoder auch nur unbegrenzt. Die beiden letzteren sahen dieses All dann mit unzählbarvielen (geo- beziehungsweise heliozentrischen) Planetenwelten angefüllt.
Diesen theophysikalischen Argumenten konnte sich kein Forscher des 17. Jahrhun-derts verschließen – gewiss auch nicht ein Otto von Guericke, dessen tiefe Religiosität
-9-
und Gläubigkeit aus vielen Kapiteln seines Werkes deutlich zu uns sprechen: GottesSchöpfung kann nicht wie er selbst unendlich sein!
Der als leer erwiesene Raum ist aber nur Behältnis für die Dinge, für die SchöpfungGottes, argumentierte Guericke deshalb. Er selbst sei ein Nichts, etwas Nichtdingliches –also keine Schöpfung Gottes (Exp. II, 8). Folglich sei der Raum als unabhängiges Behältnisetwas Unerschaffenes und somit unendlich, ein unendliches Bezugssystem für die in ihmerschaffenen Dinge. Durch diese begriffliche Differenzierung erhält Guericke die Möglich-keit – und eröffnet sie gleichzeitig den Zeitgenossen –, einen unendlichen Raum mit un-begrenzt vielen gesonderten Welten ohne Widerspruch zur Theologie zu denken. DieWeltkörper müssen dann durch nicht an ein Medium gebundene, unstoffliche ‚Kräfte‘unmittelbar über diesen eigenschaftslosen Raum hinweg aufeinander einwirken können –und hierzu hatte Guericke seine im späteren Sinne ‚elektrostatischen‘ Untersuchungen mitder Schwefelkugel angestellt, um solche ‚virtutes mundanae‘, wie er sie für die Erklärung desZusammenhalts und der Bewegung der Planetensysteme im unendlichen und leeren Raumbenötigte, zu demonstrieren (KRAFFT 2005). Isaac Newton sollte diesen, von ihm ‚absolut‘genannten Raum später als sensorium Dei, als „Denkraum Gottes“ bezeichnen, der schondeshalb notwendig unendlich sei, weil er anderenfalls Gottes Denkvermögen beschränkte.
Dieser unendliche Raum enthält dann nach Guericke zwar nicht unendlich vielediskrete Welten, aber unzählbar viele, weil es zwar keine unendliche Zahl gebe, aberauch keine größte (Exp. II, 10).
Es lässt sich nicht mehr feststellen, wann genau Otto von Guericke diese Kon-sequenzen aus seinen Versuchen und anfänglichen Überlegungen gezogen hat. Manchesklingt schon in den frühen Briefen {/116} an Schott an. Mit der detaillierten Ausführungin seinem Buch begann er Ende der 1650er Jahre. Erst von den Folgerungen her erhältaber die Erfindung der Luftpumpe, erhalten die anderen Entdeckungen Guerickeseinen Sinn als Ergebnisse und Bestätigungen gezielter Überlegungen; zeigt sich doch,dass sie alle im Zusammenhang mit drei Fragen stehen, deren ZusammengehörigkeitGuericke wie kein zweiter Denker seit Aristoteles erkannt hatte und deren Frag-Wür-digkeit im Zusammenhang keinem vor ihm so deutlich geworden war:
Was ist der Raum? Gibt es einen leeren Raum oder ist Raum stets erfüllter Raum undals leerer Raum nur ein denkbarer, ein spatium imaginarium, ein ‚rein gedachter Raum‘ alsbloße logische Abstraktion, wie es die Spätscholastik behauptet hatte? Wie können überdiesen leeren Raum hin die individuellen Weltkörper aufeinander wirken, und wie werdensie bewegt? Ist der Raum und damit die Zahl der in ihm enthaltenen Weltkörper begrenztoder unbegrenzt, also unendlich?
Die Antworten, die Guericke für diese Fragen fand, sind auch Bestandteil der New-tonschen Physik geworden – wobei allerdings offen bleiben muss, inwieweit die new-tonschen Antworten durch die Otto von Guerickes beeinflusst oder angeregt wurden.Schon im 17. Jahrhundert war man in England wenig bereit, als richtig empfundene Er-kenntnisse, die nicht von der eigenen nationalen Scientific community erbracht wurden,überhaupt wahrzunehmen oder dann gegebenenfalls auf den Urheber zurückzuführen.Immerhin hatte Guericke sein 1672 in Amsterdam erschienenes Werk der Royal Societyeingeschickt, in deren Sitzung vom 6. November 1672 es auch von Robert Hooke vor-
-10-
gestellt und zum Erwerb für die Bibliothek empfohlen wurde. Allerdings erklärte erdabei nur die elektrostatischen Versuche mit der Schwefelkugel für wiederholenswert,weil Luftpumpe und Vakuum-Versuche nicht über Robert Boyles Veröffentlichungenhinaus gingen.
Am 27. November führte dann Robert Boyle selbst die Guerickeschen Versuche mitder Schwefelkugel zur Demonstrierung der virtutes mundanae vor [BIRCH 1757, S. 59 /63; siehe KRAFFT 2005]. Damit führt dann wenigstens ein direkter Weg von GuerickesSchwefelkugel zur Glaskugelmaschine von Francis Hawksbee als erster eigentlicherElektrisiermaschine. Wozu Guericke seine Versuche angestellt hatte, {/117} sollte in derreduktionistischen Physik eines Isaac Newton ja sowieso keine Rolle mehr spielen.
Zitierte Literatur:[BIRCH 1757] Birch, Thomas: The History of the Royal Society of London. Bd 3,
London 1757.[GUERICKE 1672] Ottonis de Guericke Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica
de vacuo spatio, Primum à R. P. Gaspare Schotto [...] Nunc vero ab ipso AuctorePerfectius edita, variisque aliis Experimentis aucta... Amsterdam 1672; zitiert alsExp. [Faksimile-Ausgaben (1): Mit einem Nachwort von Hans Schimank, Aalen1962; (2): Hrsg.von der Otto-von-Guericke-Gesellschaft, Halle an der Saale 2002].
[GUERICKE 1968] Otto von Guerickes Neue (sogenannte) Magdeburger Versuche überden leeren Raum, nebst Briefen, Urkunden und anderen Zeugnissen seiner Lebens-und Schaffensgeschichte, übersetzt und hrsg. von H. Schimank, unter Mitarbeit vonH. Gossen †, G. Maurach und F. Krafft. Düsseldorf 1968. [Von der gleichzeitig er-schienenen Studienausgabe dieser Übersetzung ist eine erweiterte Neuausgabeerschienen:]
[GUERICKE 1996] Otto von Guerickes Neue (sogenannte) Magdeburger Versuche überden Leeren Raum. Mit einer einleitenden Abhandlung „Otto von Guericke in seinerZeit“ hrsg. von Fritz Krafft. Düsseldorf (später Berlin usw.) 1996.
[KRAFFT 1969] Krafft, Fritz: Experimenta Nova. Untersuchungen zur Geschichte eineswissenschaftlichen Buches. I: Das Manuskript der ‘Experimenta nova (ut vocantur)Magdeburgica’ Otto von Guerickes in den Jahren 1663 bis 1672. In: EberhardSchmauderer (Hrsg.): Buch und Wissenschaft. Beispiele aus der Geschichte derMedizin, Naturwissenschaft und Technik. (Technikgeschichte in Einzeldarstel-lungen, Nr.17) Düsseldorf 1969, S.103–130.
[KRAFFT 1978] Krafft, Fritz: Otto von Guericke. (Erträge der Forschung, 87)Darmstadt 1978 [mit Bibliographie der Literatur bis 1978].
[KRAFFT 1982] Krafft, Fritz: Die Keplerschen Gesetze im Urteil des 17. Jahrhunderts.In: Rudolf Haase (Hrsg.): Kepler Symposium. Zu Johannes Keplers 350. Geburts-tag, 25.–28. September 1980 im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes ’80Linz. Bericht. Linz (1982), S. 75–98.
-11-
[KRAFFT 1996] Krafft, Fritz: Otto von Guericke in seiner Zeit. In: GUERICKE 1996, S. XI–LXXXVIII.
[KRAFFT 1999a] Krafft, Fritz: »... denn Gott schafft nichts umsonst!« Das Bild derNaturwissenschaft vom Kosmos im historischen Kontext des SpannungsfeldesGott – Mensch – Natur. (Natur – Wissenschaft – Theologie. Kontexte inGeschichte und Gegenwart, 1) Münster 1999.
[KRAFFT 1999b] Krafft, Fritz: Zwischen Aristoteles und Isaac Newton: Auf dem Wegezum Konzept einer Allgemeinen Gravitation. Monumenta Guerickiana – Zeitschrift derOtto-von-Guericke-Gesellschaft 6 (1999), 3–23.
[KRAFFT 2000] Krafft, Fritz: Naturwissenschaftsgeschichte und Historische Naturwis-senschaft. In: Mensch – Wissenschaft – Magie. Mitteilungen der ÖsterreichischenGesellschaft für Wissenschaftshgeschichte 20 (2000), 5–36. [118]
[KRAFFT 2004] Krafft, Fritz: Astronomie und Weltbild zwischen Copernicus, Keplerund Newton. In: Barbara Mahlmann-Bauer (Hrsg.): Scientiae et artes. DieVermittlung alten und neuen Wissens in Literatur, Kunst und Musik. [10. Kongressdes Wolfenbütteler Arbeitskreises für Barockforschung in der Herzog AugustBibliothek, 5. bis 8. April 2000]. Wiesbaden 2004, S. 273–310.
[KRAFFT 2005] Krafft, Fritz: Die Suche nach dem, was die Welt zusammenhält. Zu denHintergründen und Zielen der Versuche Otto von Guerickes. In: FrederikeBoockmann / Daniel A. Di Liscia / Hella Kothmann (Hrsgg.): MiscellaneaKepleriana. Festschrift für Volker Bialas zum 65. Geburtstag. (Algorismus. Studienzur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, 47) Augsburg 2005,S. 285–308.
[SCHOTT 1657] Schott, Kaspar: Mechanica hydraulico-pneumatica... Accessit Experi-mentum novum Magdeburgicum... Würzburg 1657.
[SCHOTT 1664] Schott, Kaspar: Technica curiosa sive Mirabilia artis, libris XII. com-prehensa. Nürnberg 1664.
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Fritz Krafft, Schützenstraße 18, 35096 Weimar(Lahn).
-12-
Bild 1: Allegorische Wägung der Weltsysteme. Titelkupfer zu Giambattista Riccioli: Alma-gestum novum. Bologna 1650 (Foto: F. Krafft)
-13-