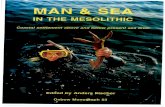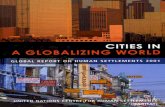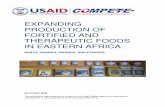Fortified settlements of the Bronze Age Sintashta culture in the Trans-Urals (Russian Federation)
Transcript of Fortified settlements of the Bronze Age Sintashta culture in the Trans-Urals (Russian Federation)
Deutsches Archaologisches lnstitut • Eurasien-Abteilung
Sonderdruck aus:
EURASIA ANTIQUA
Zeitschrift fUr Archaologie Eurasiens
Band 16 • 2010
..
Verlag Philipp von Zabern · Mainz am Rhein
Befestigte Siedlungen der bronzezeitlichen Sintasta-Kultur im Transural, Westsibirien (Russische Foderation)
Von Rudiger Krause, Ludmila N. Korjakova, Jochen Fornasier, Svetlana V. Sarapova, Andrej V. Epimachov, Sofija E. Panteleeva, Natalja A. Berseneva, Ivan V. Molcanov, Arie J. Kalis, Astrid Stobbe, Heinrich Thiemeyer, Rudiger Wittig und Andreas Ki:inig1
5chlagwi:irter: Keywords:
R ussische Fi:ide ratio n/Westsib i rien/Ka men nyj Am ba r/0 I' gi no/Bronzezeit/5 intasta ·K ultur/5 ied lung Russian Federation/Western 5iberia/Kamennyj Ambar/OI'gino/Bronze Age/5intasta-Culture/settlement
KmoYeBble cnosa: Pocc~A/3aypanbe/KaMeHHbliii AM6ap/Onbr~Ho/5poH30Bbliii seK/C~HrawniHCKaA KYilbrypajnoceneH~e
Fragestellungen und Arbeitsgebiet
In Westsibirien finden wir am Obergang von der Waldsteppe zur Steppe, dem Transural, an der Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend eine Reihe von Neuerungen, deren Herkunft und Genese unbekannt sind. Vordergrundig sind das befestigte und systematisch gegliederte Siedlungen am sudi:istlichen Auslaufer des Urals. Dazu gehi:iren Kurgane mit differenzierten Bestattungen in Schachtgrabern. Hier wurden einzelne lndividuen mit vielspeichigen, zweiradrigen (Streit-)Wagen sowie mit Metallgegenstanden ausgestattet, die ihren sozialen Rang kennzeichnen. In einem deutsch-russischen Kooperationsprojekt der Akademie der Wissenschaften in Ekaterinburg und der Goethe-Universitat in Frankfurt wird seit 2008 mit Unterstutzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Russischen Akademie der Wissenschaften ein interdisziplinares Forschungsvorhaben durchgefi.ihrt.2 Ziel ist es, in einer Siedlungskammer im Tal des Karagajly-Ajat, sudlich von Kartaly (Oblast' Celjabinsk), drei befestigte bronzezeitliche Siedlungen der fruh- bzw. mittelbronzezeitlichen Sintasta-Kultur aus der Zeit urn 2000 v. Chr. in ihrem Umfeld zu erforschen.3 Die Archao-
1 Unter Mitarbei t von: I. M. Batanina, I. V. Cecuskov, E. Kaiser, D. Knoll, P. A. Kosincev, A. M. Juminov, I. Marzolff, L. Ju. Muravjev. 0. V. Mikrjukova. V. V. Noskevic, A. Patzelt. E. Pernicka, A. Ju. Rassadn ikov. L. RUhl, M. Schaich, V. V. Zaikov.
2 Wir bedanken uns bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn und der Russischen Akademie der Wissenschaften in Ekaterinburg fUr die Forderung des Forschungsprojekts. Herrn Prof. Dr. h. c. Reinhold WUrth, dem Vorsitzenden des Stiftungsauf· sichtsrats der WUrth·Gruppe auf deutscher und der Firma Prosoft aus Ekaterinburg auf russischer Seite danken wir fUr ih re groB· zUgige Hilfe. FUr logistische UnterstUtzung danken wir der Eurasien-Abteilung des Deutschen Archaologischen lnstituts in Berlin, dem Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Ekate· rinburg mit der Generalkonsulin, Frau Dr. Renate Schimkoreit, dem BUrgermeister von Va rsavka. Herrn Viktor L. Varenikov. und schlieBlich dem OberbUrgermeister der Region Kartaly, Herrn Anatolii G. Vdovin.
3 Nach russischer Terminologie handelt es sich bereits um die Mittlere Bronzezeit, siehe Koryakova/Epimakhov 2007. 14; Hanks u. a. 2007, 354- 357. Dagegen ve rtritt Parzinger 2006, 246- 248 die An sicht, dass es sich noch um eine frUhbronzezeitliche Kul· turersche inung handel!.
Iogie will in einem interdisziplinaren Ansatz mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Fachrichtungen das Wechselverhaltnis zwischen den Menschen und ihrer Umwelt und damit den Einfluss des Menschen auf die Landschaft und die gesellschaftliche Entwicklung dieses bemerkenswerten Kulturraumes untersuchen . Dabei geht es urn spannende Fragen, die weit uber die Region hinaus bis in die europaische Vorgeschichtsforschung wirken. Denn wir wissen nicht, wer ihre Bewohner waren, woher sie kamen und wie sie wirtschafteten - waren sie Viehzuchter, Bauern oder beides? Aus graBen Kurganen ihrer Nekropolen kennen wir in Schachtgrabern angelegte Bestattungen mit Grabbeigaben aus Kupfer und Bronze. Es wurden zudem zweiradrige Streitwagen gefunden, die die bislang altesten bekannten der Alten Welt darstellen.4
An der Trennlinie zwischen Europa und Asien erstreckt sich vom Nordmeer bis in die Steppenzone mit einer Lange von uber 2.000 km der Ural -die ,Steinerne Mauer". Seine hi:ichste Erhebung ragt im Norden knapp 1.900 m empor. lm Osten beginnt Sibirien, ein Land von schier unendlichen Weiten. Hier begegnen sich Europa und Asien, ein Raum, fi.ir den wir heute den Begriff Eurasien verwenden. ,Sibir" oder ,Sibur" - dies sind die alten Namen Sibiriens, womit seit dem 13. und 15. Jahrhundert zunachst die Gebiete zwischen Ob und Ural, spater dann der westliche Teil des modernen Sibiriens gemeint waren. 5 Am sudi:istlichen Ende des Urals ist dem bewaldeten Mittelgebirge am Obergang zur Steppe ein hi.igeliges Land vorgelagert, das als Transural bezeichnet wird und im Osten in die Weiten der sibirischen Tiefebene ubergeht. Hier liegt das Untersuchungsgebiet des Projekts: zwischen den Wasserlaufen von Ural und Tobol, die einmal nach Suden in das Kaspische Meer, der Tobol hingegen nach Norden uber den lrtys und den Ob in das Nordmeer entwassern (Abb. 1).
4 Epimakhov/Koryakova 2004, 221 - 236. 5 Dahlmann 2009.
98
Abb.l. Die Lage der befestig·
ten Siedlungen der Sintasta-Kultur im
Transural am Obergang von der Waldsteppe zur
Steppe zwischen den Fllissen Ural und Tobol
(schraffiert). (Kartengrundlage von Natural
Earth, bearbei tet von D. Knoll, 2010).
Von Norden nach Si.iden wechseln die Vegetationszonen von der Waldzone i.iber die Waldsteppe bis hin zur Steppe im Si.iden, dem heutigen Kasachstan. Der Transural ist gekennzeichnet durch ein kontinentales Klima mit Niederschlagshohen an der Grenze zur Waldfahigkeit sowie temperaturund windbedingten hohen Verdunstungsraten wahrend der Vegetationsperiode. In der weitgehend baumfreien und heute von extensiver Beweidung mit Rindern und Pferden gepragten Graslandschaft sieht man deshalb nur auf Sonderstandorten mit besserer Wasserversorgung etwa kleine Birkenwaldchen (Abb. 2). Die dominierende Vegetation ist die Federgrassteppe. Sie ist allerdings durch Beweidung nur noch kleinflachig vorhanden, denn durch den anthropogenen Einfluss dominieren unterschiedliche Degradationsstadien, die sich z. B. durch verschiedene GansefuBarten (Chenopodiaceae) zu erkennen
Rudiger Krause u. a.
geben. Teilweise wurde die Steppe in ji.ingerer Zeit mit maBigem Erfolg auch unter den Pflug genommen, wovon im Arbeitsgebiet die Ruinen groBer Kolchosen zeugen, die seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in groBem Umfang Getreide anbauen sollten.
So ist denn auch eine wichtige und bislang nicht beantwortete Frage die nach der Wirtschaftsweise und nach dem Umfang von Ackerbau zur Zeit der befestigten Siedlungen in der Sintasta-Kultur. Ackerbau und der postulierte Getreideanbau wi.irden wie die Metallurgie6 -zu den Neuerungen in der Steppe zahlen, die den hohen kulturellen Status dieser bronzezeitlichen Gemeinschaften in den befestigten Siedlungen unterstreichen. Die entwickelte Metallurgie sowie Kupfer- und erste Bronzeartefakte stellen
6 Hanks/Doonan 2009, 329- 356.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
die Frage nach der Rolle der reichen Kupfererzvorkommen der Region und des Urals insgesamt
Als eines der wichtigsten Gebiete Eurasiens ist der Ural und sein Vorlan d bis heute im Hinblick auf die reichen Mineral- und Erzvorkommen von grofSer Bedeutung. Schon in der Bronzezeit spielten die Kupfererze eine herausragende Rolle, und es kam zu einer Bli.itezei t der Metallurgie. Am bekanntesten sind die umfangreichen Kupferbergwerke in Kargaly, Si.idural (Gebiet Orenburg),' die in die spate Bronzezeit datieren. Es gibt aber auch im ostlichen UralVorland ausgedehnte Lagerstatten und bronzezeitlichen Bergbau, wie z. B. die grofSe obertagige Grube (Pinge) von Vorovskaja Jama. Hier konnte durch Ausgrabungen die Kupfergewinnung wahrend der bronzezeitlichen Sintasta-Kultur nachgewiesen werden.8
Die befestigten Siedlungen dieser Zeit sind zwischen einem und vier Hektar graB, liegen zumeist in den Niederungen kleinerer Fli.isse und wurden Uberwiegend in einer Entfernung von 25 bis 30 km zueinander errichtet (Abb. 3). Bei alter Regelhaftigkeit gibt es jedoch auch bemerkenswerte Ausnahmen. Entgegen der Ublichen Entfernung von bis zu 30 km liegen in dem von uns ausgewahlten Untersuchungsgebiet entlang des kleinen Fli.isschens Karagajly-Ajat insgesamt drei Siedlungen - Kamennyj Ambar/O l'gino, Zurumbaj und Konopljanka - im Abstand von weniger als 10 km (Abb. 6). Gerade in dieser Region gewahren Forschungen einen einzigartigen Einblick in den Umgang des Menschen dieser Zeit mit dem ihm zur Verfi.igung stehenden
7 Chernych 1998, 71-76. 8 Zaykov u. a. 1999, 165- 176 bes. 169; Zaykov u. a. 2005,
101 - 114.
Raum. Waren diese drei Siedlungen etwa zeitgleich oder existierten sie nacheinander? Bildeten sie aufgrund ihrer besonderen Lage moglicherweise sogar
99
Abb. 2. Das weite Tal des Karagajly·Ajat. Bronze· zeitliche Siedlung Kamennyj Ambar/ Ol'gino mit der \aufenden Ausgrabung im Sommer 2009 in Bildmitte (Foto 2009).
I!!Troitsk
Abb. 3.
\:¥:~', . ! "? .-,
j •
I!!! Magnilogorsk
"3
r Vorovskaja Jama . ~ 7 •
8
•s
s. •
• 12 11 • • "'
1301'gino
•1 5Arkaim
• 17 Sintasta
18 lg
-..,.. _( km
I"' 0 25 50
Transural, Westsibirien. Die befestigten Siedlungen der Sintasta·Kultur: 1 Stepnoe; 2 Cernorec'e Ill ; 3 Bachta; 4 Pariz (Astarevskoe); 5 Ust'e; 6 Cekataj; 7 Kujsak; 8 Sarym·Sakly; 9 Rodniki ; 10 lsinej ; 11 Konopljanka; 12 Zurumbaj; 13 Kamennyj Ambar (Ol'gino); 14 Kizil'skoe; 15 Arkaim; 16 Kamysty; 17 Sintasta; 18 Sintasta 2 (Levobereznoe); 19 Andreevskoe; 20 Alandskoe; 21 Bersuat (Karte D. Knoll, nach 3AaHoB~Y/6aTaH~Ha 2007, Abb. 1).
100
eine griiBere, mitunter wirtschaftspolitische Einheit? Fragen, die bislang nicht gestellt wurden und die es nun zu beantworten gilt. Die These der russischen Forschung zu uberprufen - namlich ob um die jeweiligen Hauptsiedlungen herum weitere unbefestigte Siedlungen lagen und zusammen eine Siedlungseinheit bildeten - ist eine der wichtigen Aufgaben unseres Forschungsprojekts. Zunachst ist als gangi ge Forschungsmeinung festzuhalten, dass es sich bei den befestigten Siedlungen aller Wahrscheinlichkeit nach um sozioiikonomisch und politisch unabhangige Einheiten oder Zentralorte handelte, deren grundsatzliche Gemeinsamkeit in kulturell vergleichbaren Sitten und Gebrauchen sowie in der Verwen dung derselben Technologie bestand.
Es wird deutlich, dass das Siedlungsmodell eine vollkommen neue Form der Wohnarchitektur in der Steppe darstellt, die sicherlich ebenso neuer Formen der sozialen Organisation bedurfte. Denn wie sonst hatte man solch komplexe Siedlungsformen aus anderen Regionen ubernehmen, entwickeln und umsetzen kiinnen, wenn nicht durch eine straff organisierte und vor allem planmaBig durchgeflihrte Gemeinschaftsleistung? Nicht von ungefahr wurde in der Forschung daher auch immer wieder vermutet, dass mit der Entstehung dieser Siedlungen eine wachsende territoriale Kontrolle einherging, deren kriegerischer Charakter allein schon durch die hier vorhandenen Befestigungsanlagen zum Ausdruck kommt.
Es ist deshalb eine wichtige Herausforderung, die soziokulturelle Organisation der befestigten Siedlungen und die Frage, ob sie voneinander unabhangig oder durch eine politische ,Dachorganisation" miteinander verbunden waren, einer Klarung naher zu bringen. Neben und auBerhalb der befestigten Siedlungen muss es noch ein erhebliches Beviilkerungspotential gegeben haben, das in anderen Siedlungsformen im Umland lebte oder aber - und dies ist als Modell ebenfalls denkbar - bei dem nomadische oder transhumante Lebensweisen im Umfeld der befestigten (Zentral-) Siedlungen die Regel waren.
Nach den ersten beiden Feldkampagnen 2008 und 2009 kiinnen wir bereits auf eine Fulle an neuen Daten und neuen bzw. geanderten Fragestellungen blicken. In Zusammenarbeit mit verschiedenen russischen Kollegen flihren wir zahlreiche naturwissenschaftliche Untersuchungen durch. Fragestellungen und erste Ergebnisse zur Vegetationsgeschichte (A. j. Kalis, A. Stobbe), zur Rezent-Botanik (R. Wittig, A. Konig) und zur Archaobotanik (A. J. Kalis, L. Ruhl) sowie zur Geomorphologie und Bodenkunde (H. Thiemeyer) werden in diesem Vorbericht vorgestellt. Hinzu kommen AMS-Radiokarbondatierungen (B. Kromer) und Prospektionen wie Geophysik (A. Patzelt), topographische Aufnahmen mittels ei-
RUdiger Krause u. a.
nes Laser-Scanners (M. Schaich) sowie die Fernerkundung anhand von Satellitenbildern und der Aufbau eines GIS (1. Marzolff, D. Knoll). Weitere Untersuchungen zur Metallurgie (E. Pernicka) und zur Molekularbiologie Q. Burger) sind in Arbeit und werden in einem kommenden Vorbericht vorgestellt. Schliei31ich werden Restaurierungsarbeiten seitens der Archaologischen Staatssammlung in Munchen (R. Gebhard) durchgeflihrt. In dem nun vorliegenden , ersten Vorbericht ist es das Ziel, die Ausgrabungen und Prospektionen, erste Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen zur Landschaftsund Vegetationsgeschichte sowie zu den wirtschaftlichen Grundlagen in ihren Grundzugen darzustellen.9
Landschaft und Siedlungsraum -Geomorphologie und Bodenkunde
Die Hange des weitgespannten Tales im Siedlungsumfeld von Kamennyj Ambar/OI'gino, das auf der Niederterrasse des Karagajly-Ajat liegt, sind durch Seitentalchen und flache Senken untergliedert (Abb. 7). Die bronzezeitlichen Dauersiedlungen sind in der Landschaft in der Regel auf der Niederterrasse der Flusstaler zu finden. Daraus ergeben sich folgende allgemeine Fragen, denen nachgegangen werden soli: Wo lagen die miiglichen Ackerflachen? Wie viel Flache beniitigten die Menschen fur eine gesicherte Ernahrung? Welche Rolle spielten dabei die Bodenverhaltnisse? Welche Auswirkungen hatte die Landnutzung auf die Landschaft? Die Frage nach dem Einfluss des Klimas spielt bei der Beurteilung der lnwertsetzung der Landschaft, vor allem in marginalen Gebieten, eine zentrale Rolle. Eine tief greifende Klimaanderung zu Beginn des ersten Jts. v. Chr. (es wurde kalter und feuchter) war der Grund wirtschaftlicher und kultureller Veranderungen. Es entstand ein nomadisierendes Weidesystem. Somit stellt sich die Frage, ob es klimatische Einschrankungen zum Zeitpunkt der Besiedlung gab und ob solche ggf. mit verantwortlich fur die Siedlungsaufgabe waren.
Entkalkte Tschernoseme in den Lehmen der Niederterrasse und der Fullung der Seitentalchen sind weit verbreitet. Bioturbation (Steppennager, Ameisen) und Humusakkumulation spielten in allen Profilen eine dominierende Rolle. In den Talflillungen wiederum sind aktuell regelhaft gullyartige lineare Erosionsformen ausgebildet. AuBerdem kiinnen in den Talflillungen tschernosemburtige Sedimente an-
9 Siehe hier auch die bis\ang bereits erschienenen Kurzdarstellungen des deutsch-russischen Proiektes: Krause/Koryakova 2010; Fornasier/Krause 2010.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
getroffen werden, die fluvial umgelagert wurden. Es ist zu fragen, ob die Umlagerung des TschernosemMaterials noch im Pleistozan (und damit unter natUrlichen Bedingungen) oder erst im Holozan (quasinatUrlich) ablief. Wann fand dies statt, wenn letzteres zutrafe? Die schmalen TalfUIIungen, die Uber z. T. mehrere Kilometer die Hange hinauf verfolgt werden konnen, gehen mit deutlichem Knick abrupt in sehr flachgrUndige Hange Uber, die nicht ackerbaulich nutzbar waren. Es ware daher denkbar, dass auBer den Niederterrassenbereichen auch die TalfUIIungen in der Bronzezeit bevorzugte Ackerbauareale waren. Deshalb wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Erosionsspuren bereits bronzezeitlich sein konnten. Damit verbunden ist wiederum die Frage, ob sich Tschernoseme auch auf bronzezeitlichem Kolluvium bilden konnen. An einem Profit im lnnern der Siedlungsflache von Kamennyj Ambar/OI'gino wurde 2009 ein postbronzezeitlicher Tschernosem in dunkler GrubenfUIIung angetroffen. Dies belegt, dass die Richtung der Pedogenese nach der Besiedlung offensichtlich den gleichen Prozessen wie davor unterlag.10 Zur Altersdatierung der SedimentfUIIungen werden kUnftig Lumineszenzmethoden herangezogen, die fUr diese Art von Sedimenten hinreichend verlassliche Datierungen liefern . Unter heutigen Bedingungen scheint mit dem Oberflachenabfluss (nach Schneeschmelze und Starkregenereignissen) keine Sedimentumlagerung bis in die Vorfluter stattzufinden .
Allerdings gab es auch sehr junge anthropogene Eingriffe in die Landschaft, die zu tiefgreifenden Bodenveranderungen gefUhrt haben. Zwischen 1920 und 1930 gab es eine Phase der Kollektivierung (Entstehung von Kolchosen, Sovchosen), und bis etwa 1950 groBraumige NeulanderschlieBungen, die sich im Umbrechen der Steppenboden manifestieren. Der Zeitraum ab etwa 1970 bis 1980 war von einer lntensivierung der Landwirtschaft (DUngung) gekennzeichnet. Heute sind weite Bereiche wieder aus der agrarischen Nutzung genommen und die Steppenvegetation stellt sich erneut ein. Daneben zeugen tiefe SteinbrUche und Halden von intensiver Forderung von Bodenschatzen. Die Auswirkungen dieser jungen Eingriffe in die Landschaft mUssen von historischen Ereignissen getrennt werden.U
Ein weiterer methodischer Ansatz liegt in der Bodenmikromorphologie begrUndet. Sie wird einerseits fUr natUrliche Boden und Sedimente eingesetzt, andererseits sollen aus archaologischen Grabungsbefunden zusatzliche Erkenntnisse zu unterschiedlichen Nutzungen, technischen Prozessen, Tierhaltung, etc. gewonnen werden. Sind Befunde sekundar verandert worden? Welche pedogenetischen Prozesse
10 Plekhanova/Demkin 2008. 11 Kretin in 2004.
lassen sich erkennen? Von einem Prallhang-Sedimentprofil aus dem Tal des Karagajly-Ajat liegen bereits Mikromorphologieproben vor, die zurzeit im Mikromorphologielabor des Physisch-Geographischen lnstituts der Goethe-Universitat bearbeitet werden. Der Aufschluss zeigt Uber dem natiirlichen Hochflutlehm einen postbronzezeitlichen Hochflutlehm, der feinkiesig bis sandig ist und z. T. HUttenlehmkomponenten in gS - fG-Gro13e und Scherben fUhrt. Moglicherweise handelt es sich sogar um einen Laufhorizont. Hier stellt sich die Frage nach dem Ausloser der Veranderung im Sedimentationsgeschehen und ob diese natUrliche oder anthropogene Ursachen haben . Zur Klarung sind weitere (Bohrstock-)Kartierungen vorgesehen, die durch Ausgrabungen und Beprobungen abgesichert werden so lien.
Hinzu kommen Fragen Uber morphologische Veranderungen der Flussauen. Sie verfUgen Uber eine innere Gliederung, die sich an Vegetations- und Abflussrinnenmustern ·und durch schwach ausgepragte Gelandekanten auf der Oberflache der Niederterrasse festmachen !asst. Mittels Bohrstockprofilen soli geklart werden, wie Niederterrasse und holozaner Oberschwemmungsbereich aufgebaut sind und ineinander greifen. Die bereits ausgegrabenen Kurgane sUdlich des Flusses (Abb. 8) sitzen beispielsweise auf alteren Niederterrassenbereichen oder auf den auslaufenden pleistozanen, flachen Schwemmfachern.
Luftbildarchaologie und Geoinformationssystem
Einen unschatzbaren Wert fUr die Erforschung der sintasta-zeitlichen Denkmaler erlangten die Luftbildanalysen der Geologin lja Michajlovna Batanina, die in jahrelanger mUhsamer Forschungstatigkeit in den 90er Jahren des 20. Jhts. den eigentlichen Grundstein fUr unseren heutigen Wissensstand legte.12 lhr ist es zu verdanken, dass wir bislang mindestens 21 befestigte Siedlungen dieser spezifischen Zeitstellung kennen, die sich aile in der nordlichen Steppe des sUdlichen Transurals zwischen den beiden FIUssen Tobol und Ural auf einem Gebiet von ca. 200 x 300 km GroBe konzentrieren (Abb. 1; 3).13
Die auffallige Siedlungsverteilung auf relativ engem Raum fUhrte sehr schnell zu der popularen Bezeichnung ,Land der Stadte", die mittlerweile - auch in der wissenschaftlichen Literatur - enorme Verbreitung gefunden hat.14
12 3AaHOB~4/6aTaH~Ha 2007. 13 Aile Siedlungen liegen an versch iedenen Seitenarmen der FlUs·
se Tobol und UraL Nur die befestigte Siedlung Cekataj liegt an einem Seeufer. Vgl. Koryakova/Epimakhov 2007, 67.
14 Die Bezeichnung , Land der Stadte" geht auf G. B. Zdanovic zurUck, der diesen Begri ff - sicherlich in Anlehnung an Agypten, dem , Land der Pyramiden" - bereits in den 1980er Jahren
101
102
Basierend auf den Ergebnissen der Luftbildarchaologie beschreitet das deutsch-russische Kooperationsprojekt nun neue Wege in der Erforschung der kulturellen Hinterlassenschaften des Transurals. So fi.ihrt David Knoll in Zusammenarbeit mit Dr. Irene Marzolff vom lnstitut fi.ir Physische Geographie der Goethe-Universitat seit 2009 die raumliche Auswertung der archaologischen Befunde anhand eines Geoinformationssystems (GIS) durch. Unser Ziel ist die systematische und prazise Untersuchung der raumlichen Zusammenhange der archaologischen Daten sowie der begleitenden naturwissenschaftlichen Befunde, was fi.ir die Erforschung der Bronzezeit im Si.idural eine wirkliche Pionierarbeit darstellt. Dabei sollen sowohl bereits existierende als auch neu erfasste archaologische Befunde in eine digitale, hie rarchisierte GIS-Datenbank i.ibernommen, archaologische Fragestellungen mit Hilfe von GIS-Analysen untersucht und die computergesti.itzte archaologische Fernerkundung mit Hilfe eines breiten Spektrums an Luft- und Satellitenbildern unterschiedlicher Eigenschaften vorangetrieben werden.
Um eine effektive Vorgehensweise zu ermogli chen, haben wir fi.ir unser gesamtes Arbeitsgebiet mit den drei bronzezeitlichen Siedlungen historische Satellitenbilder der amerikanischen CORONA-Missionen erworben, welche als Schwarzwe iBfotos den Zustand der Landschaft im Jah r 1971 in hoher Auflosung (2-3 m) zeigen. Diese Bilder stellen fur viele Regionen der Welt die Dokumentation eines Zustands vor agrarwirtschaftlichen Umstrukturie rungen und lntensivierungen dar und ihre hervorragende Eignung fi.ir die archaologische Prospektion wurde gerade in den vergangenen Jahren in mehreren Untersuchungen im Nahen Osten eindri.icklich belegt. 15
Insbesondere die Kombination mit aktuellen hochauflosenden Satellitenbildern der IKONOS-, Quickbird- und SPOT-Generation (PixelgroBen ca. 1- 2.5 m) erwies sich als auBerst gewinnbringend, da sie einerseits den Ri.ickblick auf einen urspri.inglicheren Landschaftszustand und andererseits die genaue Lokalisierung und multispektrale Analyse von Befunden im heutigen Kontext erlaubt.
Charakteristika sintasta-zeitlicher Siedlungen
Die archaologische Erforschung der sintasta-zeitlichen Denkmaler ist ein recht junges Phanomen und reicht bis in die 1970er Jahre zuri.ick, als man in der
pragte. Siehe hier zuletzt die gleichnamige Publikation (Arka im - Land der Stadte), die in Zusammenarbeit mit I. M. Batanina ersch ien: 3AaHos~~/6aTaH~Ha 2007. Vgl. hierzu auch Koryako· va/Epimakhov 2007, 67.
15 Beck u. a. 2007; Parcak 2007; Casana/Cothren 2008.
Rudiger Krause u. a.
eponymen Siedlung Sintasta (Abb. 3) erste Felduntersuchungen durchfi.ihrte.16 In den Anfangsjahren war man sich des immensen Potentials sowie der Verbreitung dieses Kulturphanomens allerdings noch nicht bewusst, so dass die materiellen Hinterlassenschaften zunachst noch keiner eigenstandigen Gruppierung zugeordnet wurdenY Erst durch die immer umfangreicheren Ausgrabungen in den Siedlungen und Nekropolen von Sintasta18 und in der Folgezeit auch von Arkaim im russischen Sibirien (Oblast' Celjabinsk) begann die archaologische Forschung allmahlich, den auBerordentlichen Wert und die spezifischen Charakteristika dieser Denkmaler wahrzunehmen und ih re Ansicht zu zahlreichen Fragestellungen in Bezug auf die Bronzezeit des si.idlichen Uralvorlandes zu konk retisieren .19 Die zeitliche Kongruenz mit der sehr wechselhaften russischen Geschichte gerade zu Beginn der 1990er Jahre fi.ihrte allerdings - durch zahlreiche politische und ideologische Gri.inde motiviert - auch zu einer im wissenschaftlichen Sinne eher ungewollten, gesellschaftlichen Fokussierung auf die seinerzeit aktuellen Forschungen, wodurch ein Teil der Denkmaler in ihrer historischen Aussage i.iber Gebi.ihr in Anspruch genommen wurde. Erfreulicherweise handelt es sich dabei jedoch um Ausnahmeerscheinun gen.2o
Seit ihrer spektakularen Entdeckung wurden bislang in sieben Siedlungen archaologische Ausgrabungen durchgefi.ihrt, wobei die Anlagen von Sintasta, Arkaim und Ust'e (Abb. 3) in besonderem MalSe die wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf sich zogen. Diese Ausgrabungen ermoglichen es, grundlegende Aussagen zur spezifischen Siedlungsstruktur der befestigten Siedlungen zu treffen , die gleichsam auch den Ausgangspunkt fi.ir das neue deutsch-russische Forschungsprojekt bildeten.
Die Siedlungen der Sintasta-Kultur offenbaren im direkten Vergleich zu anderen Strukturen der eurasischen Steppenzone eine beachtliche Komplexitat und lassen sich grundsatzlich in drei architektonische Grundtypen unterteilen : die ersten beiden Typen sind durch ovale oder runde Grundrisse mit
16 reH~Hr u. a. 1992, 10- 13. Vgl. auch die ausflihrliche Darste l· lung der Forschungsgeschichte bei En~Maxos 2002, 13- 25.
17 So flihrten beispielswe ise noch K. F. Smirnov und E. E. Kuzmi· na (CM~pHos/Ky3bM~Ha 1977) das Material aus der Nekropole von Novij Kumak als einen lokal begrenzten Fundhorizont auf und datierten ihn in die mittlere Bronzezeit. Vgl. Koryakova/Epimakhov 2007, 66 f. Zur Forschungsgeschichte siehe auch E n~Maxos 2002, 13- 15; Parzinger 2006, 251.
18 Grundlegend reH~Hr u. a. 1992 sowie 3AaHos~~ 2002b. 19 Vgl. zu diesem Themenkomplex u. a. 3AaHOB~Y 1992; 3AaHoB~Y
2002a; B~HorpaAOB 2007. 20 Ahnliches gilt flir die vorschnell veriiffentli chten Rekonstruktio·
nen der Hausstrukturen von Arkaim, allgemein 3AaHOB~Y 1995; 3AaHOB~Y 1997.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
radial angeordneten Hausern charakterisiert, deren Eingange zum Siedlungszentrum hin ausgerichtet sind.21 Die dritte Kategorie besteht demgegenUber aus Siedlungen mit einem rechteckigen Fortifikationssystem, in das die Hauser eingebettet waren (Abb. 14).22 Typologisch als auch chronologisch wurden sie in der Forschung vielfach in eine Abfolge gestellt, die mit den ovalen Strukturen beginnt und mit den rechteckigen Siedlungen endet. Der umschlossene Siedlungsraum 23 betragt dabei zwischen 6.000 m2 und beachtlichen 35.000 m2.
Die Befestigungsmauern waren Uberwiegend in der charakteristischen Holz-Erde-Bauweise errichtet worden, bei der auf einem Fundament aus Rasensoden und FUllmaterial aus lokalem Naturstein ein HolzgerUst als Sicherung des Lehmaufbaus diente, der beim Austrocknen beinahe zementartigen Charakter erlangte. lnsgesamt konnten die Mauern auf diese Weise eine Hohe von 5- 6 m erreichen. Steinkonstruktionen sind demgegenUber auBerst selten und waren bislang nur in den beiden Siedlungen Kamennyj Ambar/Ol'gino und Alandskoe als Verkleidung au f der MauerauBenseite nachzuweisen.24
In den Sied lungen mit ovalem oder rundem Grundriss waren die Hauser zumeist in einem konzentrischen Kre is entlang der Fortifi kationsanlagen errichtet worden un d stief3en mit ihren Langseiten haufig direkt an die benachbarten Gebaude sowie mit einer Stirnseite an die Umfassungsmauer. DemgegenUber waren die Siedlungszentren nahezu regelhaft frei von jeder Bebauung. Wie das Beispiel Arkaim allerdings zeigt (Abb. 4), konnten auch deutlich komplexere Einteilungen der zur VerfUgung stehenden Flache vorgenommen werden, indem eine zusatzliche, innere Begrenzungsmauer errichtet wo rden war, an die sich ein zweiter Ring aus radial angeordneten Hausern anschloss.25
Die rechteckigen oder trapezformigen Hauser korrelieren in ihrer Grof3e mit den Ausmaf3en der jeweiligen Siedlung und konnen eine Grundflache zwischen 100 m2 und 250 m2 aufweisen. Von diesen Flachen diente allerdings nur ein kleinerer Teil als eigentlicher Wohnbereich ,26 da sich innerhalb der Gebaude regelhaft ein, in vielen Fallen sogar mehrere Brun nen fanden , neben denen sich zusatzlich Reste von Kuppelofen mit Spuren von metallur-
21 Dieses Siedlungsschema fi ndet sich beispielsweise in Alandskoe, Bersuat, Kizil'skoe, Sintasta, Arkaim, Sarym-Sakly, Kuisak und lsinei.
22 So etwa in den Siedlungen von Ust'e, Cekatai, Andreevskoe, Cernorechy'e- 111.
23 Koryakova/Ep imakhov 2007, 69. 24 Koryakova/Epimakhov 2007, 70. 25 3AaHoe~4/oaTaH~Ha 2007, Abb. 1-1 ; 7. 26 Zur Architektur sintasta-zeitlicher Hauser zusammenfassend Ko
ryakova/Epimakhov 2007, 72 f.
gischen Tatigkeiten zeigten.27 Die Wande dieser Brunnen waren mit Weidenflechtwerk ausgekleidet und die durchschnittliche Schachttiefe betrug je nach Hohe des lokalen Grundwasserspiegels bis zu 5 m.
Als ein charakteristisches Konstruktionsmerkmal sind im Hausinneren Langsreihen von Pfosten nachgewiesen worden, die das Dach stUtzten und die gleichzeitig zur weiteren Binnengliederung des Wohn- und Arbeitsbereichs dienten (Abb. 5) . Beiderseits des Eingangs konnten Ofen konstruktionen 28
freigelegt werden, die im Eingangsbereich als eine Art Warmebarriere fungiert haben sollen, wahrend die Hauser an ihren Langsseiten und an der gegenUberliegenden Stirnseite durch die angrenzenden Gebaude sowie die Umfassungsmauer iso liert wa ren.
Die Nekropolen dieser Siedlungen liegen -sofern sie lokalisiert sind - sUdlich der jeweiligen befestigten Anlagen .29 Ferner sind zahlreiche Graberfelder bekannt, die jedoch noch keiner Siedlung zugeordnet werden konnten und die sich Uber das
27 Mittels experim enteller Archaologie lieB sich ein Kausa \zusammenhang zwischen den Brunnen und der bemerkenswert engen Lage zu diesen Ofen aufzeigen. So ze igte es sich, dass ihre raum li che Verteilung fun ktional aufe inander abgestimmt war, indem ihre Ve rbindung einen deutlich verstarkten , na!Urlichen Luftzug erzeugte (vgl. Anm. 26) .
28 Koryakova/Epimakhov 2007, 72. 29 Koryakova/Epimakhov 2007, 68. lnsgesamt konnte bislang nur
fUr zwtilf Sied lungen ein zugehti riges Nekropo\enareal loka lisiert werden.
103
Abb. 4. Arka im. Luftbi\daufnahme der befestigten runden Siedlung von 1978 (nach 3AaHoe"4/ &aTaH~Ha 2007).
104
Abb. 5. Sintasta. Rekonstruk·
tion eines Wohnhauses im Schnitt mit Lehm· wanden, DachstUtzen
und Flachdachern nach den Ausgrabungen in
den 1970er Jahren (nach reH-Hr U. a.
1992, Abb. 21).
weite Gebiet von Kasachstan, dem Cis-Ural bis in die Wolgaregion verteilen. 30
Die Siedlungskammer Kamennyj Ambar/ Ol'gino
Die wissenschaftliche Erforschung der Mikroregion entlang des Flusses Karagajly-Ajat begann 1982 mit der Entdeckung der bronzezeitlichen Siedlungsanlage durch Ju. V. Tarasov, der dieses Bodendenkmal zu Ehren seiner Frau Ol'ga, Ol'gino, nannte. Spater wurde die Siedlung in Kamennyj Ambar umbenannt.31 Unter diesen beiden Bezeichnungen hat der Platz Eingang in die wissenschaftliche Literatur gefunden (Abb. 6). Kamennyj Am bar liegt 9,5 km ostlich des modernen russischen Dorfes Varsavka auf der ersten Terrasse am linken Ufer des Karagajly-Ajat und ist eine von insgesamt drei befestigten Siedlungen (Kamennyj Ambar, Konopljanka, Zurumbaj), die entgegen der regelhaften 25-30 km in nur geringer Entfernung von 7-9 km zueinander errichtet wurden. Das umliegende Territorium von Kamennyj Ambar besteht aus einer weiten Talsenke mit seichten Hugelkuppen an der Nord- und Sudseite. Es weist an den Randbereichen uberwiegend
30 lnsgesamt wurden im Transural bislang 5 Nekropolen (mit 200 Grabern}, im Cis-Ural 8 Nekropolen (100 Graber), im Nor· den Kasachstans ein Graberfeld (28 Graber) und im Wolga· gebiet 2 Nekropolen (33 Graber) ausgegraben (Koryakova/Epi· makhov 2007, 68). Vgl. auch Bac"nbeB u. a. 1994.
31 Tapacos 1983; En"Maxos u. a. 2005, 5.
RUdiger Krause u. a.
Kalkstein mit Quarzadern, in der Senke Alluvium sowie Kies auf und gehorte wahrend der letzten Eiszeit zur periglazialen Zone. Bis auf einige begrenzte Vorkommen fehlen Lossablagerungen. Die Hauptschichten auf den Terrassen sowie in den sie durchziehenden, flachen Senken bestehen aus Tschernosem mit Karboneinschli.issen im Unterboden.
Das Untersuchungsgebiet am Flusslauf des Karagajly-Ajat (Abb. 7) ist durch ein kontinentales Klima mit Niederschlagshohen an der Grenze zur Waldfahigkeit sowie temperatur- und windbedingten hohen Verdunstungsraten wahrend der Vegetationsperiode gekennzeichnet. Die dominierende Vegetation im Arbeitsgebiet ist grundsatzlich die Federgrassteppe. Allerdings ist die blutenreiche und bunte Federgrassteppe durch die anthropogene Beeinflussung meist nur noch kleinflachig vorhanden. Es dominieren vielmehr unterschiedliche Degradationsstadien, die sich etwa durch verschiedene GansefufSarten (Chenopodiaceae) auszeichnen (Abb. 2). Die lichten Birkenhaine in Senken und Erosionsrinnen sind ebenfalls stark von Steppenarten und Beweidungsanzeigern durchsetzt.
Die Topographie der Siedlung Kamennyj Ambar weist eine nahezu horizontal verlaufende und im Relief nur schwach strukturierte Flache auf und liegt 2,5-3 m uber dem Schwemmgebiet des Flusses. Sie ist auf einer Lange von 130 m mit einer Hohendifferenz von gerade einmal einem Meter in nordsudlicher Richtung nahezu ebenerdig. Wahrend 1990 die ersten Sondierungsgrabungen unter der Leitung von N. B. Vinogradov32 im ostlichen Teil der Siedlung bereits wichtige Daten uber die stratigraphischen Besonderheiten im Allgemeinen und uber die Befestigung im Besonderen erbrachten, wurden letztlich erst durch die lntensivierung der Feldforschungen ab 2004 ein topographischer Plan und im Folgejahr dann auch ein erstes Magnetbild33
erstellt.
Das Graberfeld Kamennyj Ambar-5
Annahernd zeitgleich zum Beginn der Erforschung der Siedlung, fl.ihrten russische Wissenschaftler gro!Sere Untersuchungen im Graberfeld Kamennyj Ambar-S durch, das 1986 von V. P. Kostjukov34 lokalisiert werden konnte . In den ersten drei jahren nach der Entdeckung konzentrierten sich die Feldforschungen von Kostjukov zunachst auf mittelalter-
32 B"HOrpaAOB 2003; Die Autoren mochten N. B. Vinogradov ihren aufrichtigen Dank fur die Nutzung seiner Materialien und seine gewahrte UnterstUtzung aussprechen.
33 Merrony u. a. 2009. Vgl. in Kurze auch Hanks u. a. (im Druck). 34 En"Maxos 2005, 5.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
1:200 000
• - fortified settlement ~ .. 4 3 2 I 0 1'2 ~ ..
a -cemetery
105
Abb. 6. Die bronzezeitliche Sied lungslandschaft entlang des KaragajlyAjat (vgl. Abb. 3). 1. Konopljanka; 2. Zurumbai; 3. Kamennyi Ambar-5; 4. Ol'gino (Kamennyi Ambar); 5. Karagayly-Ayat-27; 6. ,U mosta"
Abb. 7. Kamennyj Ambar/ Ol'gino. Grabungsareal und Basislager (Foto von DeltaplanFlieger 2009).
106
Abb. S. • Kamennyj Ambar/ Po!lenprofil Pferdewiese
0\'gino. Lage der bronzezeitlichen sintaSta-
A mittelu!tertiche A zeitlicher Kurgan Kurgangruppe
Siedlung und der (ausgegraben)
bronzezeitlichen und sintaSta-
jUngeren Kurgane .§,. spatbronzezeitliche
.0. zeitlicher Kurgan Kurgangruppe
(Kartengrundlage aus (nicht ausgegraben) (Datienmg: Srubnaja)
Google Earth, Kurgan aus 4
Kurgangruppe aus
Erganzungen von elt luftbildbefund luftbildbefund
D. Knoll, 2010). (Oatierung unbek.) (Datierung unbek)
Abb. 9. Kamennyj Ambar-5, Kurgan 2. Gesamtp\an (nach En~Maxos 2002, Abb. 2).
RUdiger Krause u. a.
liche Grabanlagen. Erst 1989 begann er seine Tatigkeiten am bronzezeitlichen Kurgan 2, die sich insgesamt uber drei Grabungskampagnen hinzogen und die in der Folgezeit von A. V. Epimachov zu einem erfolgreichen Abschluss gefi.ihrt wurden (Abb. 8).35 Sein Verdienst ist es auch, dass mit den Kurganen 3 und 4 zwei weitere Grabanlagen der Bronzezeit in den Fokus der Ausgraber traten , die unseren Kenntnisstand zu den Begrabnisritualen der Bewohner aus der nahegelegenen Siedlung Kamennyj Ambar betrachtlich erweiterten.
Das Graberfeld liegt am rechten Ufer des Flusses Karagajly-Ajat, in einer Entfernung von ungefahr einem Kilometer sud westlich der gleichnamigen Siedlung (Abb. 8). Mit einer Hi:ihe von 2-3m uber dem Wasserspiegel weist das Areal ebenfalls nur eine seichte Neigung zum Flussbett hin auf. Die Kurgane liegen in beachtlichen Entfernungen von 150-200 m voneinander und zeigten in den AusmaBen ihrer Aufschuttungen weitgehend Ubereinstimmungen: so erreichten sie eine Hi:ihe von bis zu einem Meter und einen Durchmesser der erodierten
35 KOCTIOKOB 1992; KOCTIOKOB 1993. - Die Ergebnisse der durch A. V. Epimachov abgeschlossenen Feldforschungen zeigen, dass die Kurgane 2, 3 und 4 wahrend der ersten Existenzphase der befestigten Siedlung Kamennyj Ambar/Ol'gino errichtet worden sind und die Kurgane 7, 9 und 10 der Srubno-Alaku\'-Periode zuzuordnen sind.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
Aufschuttungen von bis zu 30m. Von den drei bronzezeitlichen Kurganen besaf3 nur einer - namlich Kurgan 3 - eine einzelne Grabgrube, wahrend die Kurgane 2 und 4 mit ihren zahlreichen Grabern in mehreren Etappen errichtet worden waren.36
Allen drei Kurganen gemeinsam ist das Vorhandensein eines Kreisgrabens mit Durchgangen im sudwestlichen und im sud lichen Bereich (Abb. 9). Die Zentren der Kurgane waren angesichts einer vollstandigen, rituellen ,Plunderung" Ieider wenig aussagekraftig, doch konnte zumindest in Kurgan 4 ein ,reservierter" Platz fur die Errichtung einer zweiten zentralen Grabgrube nachgewiesen werden, die aber letztlich nicht angelegt wurde. Die weiteren Bestattungen sind relativ gleichmaf3ig in den Kurganarealen verteilt und annahernd kreisformig angeordnet. Exemplarisch ausgewahlte Radiokohlenstoffdatierungen ergeben fur die untersuchten Grabanlagen ein Datierungsintervall zwischen 1960- 1770 cal BC, das recht gut mit denen aus anderen sintasta-zeitlichen Denkmalern ubereinstimmt. 37
Aile graBen Grabgruben, in denen bis zu acht Bestattete lagen (Abb. 10), waren mit Holz-ErdeKonstruktionen abgedeckt. Holz wurde ferner als Verkleidung der Wande in den bodennahen Bereichen genutzt, wahrend in einigen wenigen Fallen am Boden der Grabgruben selbst Spuren organischer Unterlagen erhalten gewesen sind. Sofern nachweisbar, lagen die hauptsachlich nach Westsudwesten und Norden ausgerichteten Verstorbenen in Hockerstellung auf der linken (84 %) oder rechten (16 %) Seite sowie uberwiegend mit den Handen nahe am Gesicht. lnsgesamt konnten im untersuchten Bereich der Nekropole Uberreste von ungefahr 100 lndividuen freigelegt we rd en, wobei Kinderbestattungen vorherrschen (71 %) , wahrend die Verteilungsanalyse unter den Erwachse nen 22 % Manner und 7% Frauen ergab. Diese Ve rteilung entspricht zweifellos nicht der Norm und kann das demographische Modell der zugehorigen Siedlung Kamennyj Ambar kaum annahernd widerspiegeln. lm Gegenteil, die Disproportion der Geschlechter, die ungewohnlich hohe Anzahl der Kinder und das Fehlen von Bestattungen alterer Menschen zeugen von einem restriktiven Selektionsprinzip bei der Anlage der Nekropole, das moglicherweise auf familiaren bzw. verwandtschaftlichen Beziehungen basierte und das einen bemerkenswert hohen sozialen Status der Verstorbenen vermuten lasst. 38 Gleichzeitig
36 En"Maxos 2005 , 9-63 (Kurgan 2); 64- 77 (Kurgan 3); 78- 143 (Kurgan 4).
37 En"Maxos u. a. 2005, 92- 102. 38 Ein weiteres lndiz fUr die Exklusivitat der Bestattungen ist fUr
D. I. Razev (lllnoc co PAH) das Faktum, dass im gesamten osteologischen Material nur vereinzelt Hinweise auf Verletzungen und Erkrankungen zu Lebzeiten der Bestatteten zu erkennen sind.
~
\
mussen wir fragen, wo der grof3ere Teil der Bevolkerung bestattet wurde. Bislang gibt es dazu noch keine Hinweise, denn auch die Areale zwischen den Kurganen scheinen frei von Bestattungen zu sein .
Das Spektrum der Grabbeigaben bestatigt den hohen sozialen Rang der Bestatteten, denn es besteht uberwiegend aus Keramikgefaf3en,39 Metallobjekten sowie Stein-, Knochen- und Hornartefakten, wobei es sich urn Waffen, Werkzeuge, Bestandteile des Pferdegeschirrs und urn Schmuck handelt. Eine geschlechterspezifische Aufteilung der einzelnen Fundgruppen ist kaum moglich, dennoch treten schwere Waffen hauptsachlich in Mannerbestattungen auf. Vergleichbares gilt fLir einige Schmuckgegenstande, wie Muschelschalen, Amulette aus Hauern, Fayenceperlen und Nadeln, die Liblicherweise in Frauengrabern anzutreffen sind, jedoch wurden sie auch bei Kinderbestattungen gefunden .
39 In einzelnen Fallen ist die Nutzung von Holz- und BirkenrindengefaBen nachzuweisen.
107
Abb. 10. Kamennyj Ambar- 5, Kurgan 2, Grab 12. Vier Bestattete und Teile von Pferden. 1- 12 GefaBe; 13 sichelftirmiges Werkzeug; 14 Dolchmesser; 15 Beil; 16 Pfriem; 17 Armband ; 18 Perle n; 19 HauerAmulette; 20 Pfeilspitzen ; 21 Kiesel (nach En"Maxos 2002, Abb. 13).
108
Abb. 11. Kamennyj Ambar·S ,
Kurgan 2. 1 Beinplat· ten, 2 Steinartefakte,
3 Lanzenspitze; 4 Scheibenknebel
(nach En~Maxos 2002).
2
3
Offenbar nehmen in den Grabinventaren Artefakte aus Kupfer einen hohen Stellenwert ein. Darunter finden sich acht zweischneidige Messer (sog. Dolchmesser), neun Flachbeile, eine Lanzenspitze (Abb. 11,3), zwei MeiBel, zahlreiche sichelfi:irmige Gegenstande, ein Armband und andere, zumeist kleinere Artefakte wie Ahlen, Nadeln, Armbander, Ringe, Hakchen und Plattchen (Abb. 11). Einen besonderen Platz im Bestattungskontext nehmen schlieBiich (Streit-) Wagen mit Speichenradern als Grabbeigabe ein, fUr die es im gesamten eurasischen Raum zahlreiche Analogien gibt.40 In der Nekropole Kamennyj Ambar-5 sind sie durch Radab-
40 Anthony/Vinogradov 1995, 36- 41; Littauer/Crouwell 1996; Pen· ner 1998 und andere.
RUdiger· Krause u. a.
drUcke im Boden der Grabgruben, durch bestattete Teile von Pferden (Schadel, Extremitaten) sowie durch Bestandteile des Pferdegeschirrs, die Beigaben von zweiradrigen Wagen und von Pferden belegt. Hervorzuheben sind die runden bis halbrunden Scheibenknebel, von denen zwi:ilf Exemplare in vier Paaren vorliegen (Abb. 11,4). Einige StUcke weisen deutliche Gebrauchsspuren auf, einige wenige stellen zudem offensichtlich lmitationen dar.
Die befestigte Siedlung Kamennyj Ambar
Die befestigte Siedlung Kamennyj Ambar erstreckt sich Uber eine rechteckige, 115 x 155m groBe Flache mit abgerundeten Enden. Das Siedlungsinnere betragt ungefahr 18.000 m2. Unter BerUcksichtigung der ihr vorgelagerten muldenfi:irmigen Vertiefungen (im Osten und Nordwesten) sowie der nachweisbaren Kulturschichten im Westen betragt das archaologisch relevante Areal sogar annahernd 60.000 m2
•
Die Luftbildanalyse und die topographische Aufnahme mittels eines Scanners (s. u.) zeigen, dass Uberall im Gelande zahlreiche Eintiefungen verteilt sind. Einige liegen direkt im Verlauf der Befestigungs· mauer (sieben Vertiefungen im sUdwestlichen, eine im nordi:istlichen Bereich) oder aber auBerhalb der Umfassung (elf Vertiefungen sUdwestlich der Siedlung), elf weitere innerhalb der Grenzen der frUheren Siedlung. lnsgesamt sind somit nicht weniger als 30 Gruben dieser Art zu verzeichnen, bei denen es sich nach der bisherigen Forschungsmeinung um die Reste von spatbronzezeitlichen Hausplatzen handeln soil, wofUr es aber bis auf jUngeres Fundmaterial noch keine wirklichen Belege gibt.
In der Kampagne 2009 konnte Martin Schaich von der Siedlung Kamennyj Ambar auf einer Flache
Abb. 12. Kamennyj Ambar/0\'gino. Vorbereitungen fUr die DurchfUhrung einer hochaufliisenden Gelandeaufnahme mittels terrestrischen Scannens durch M. Schaich im Sommer 2009.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
von ca. einem Quadratkilometer von einem kleinen Fahrzeug (Abb. 12) aus durch terrestrisches Scannen eine hoch auflosende Gelandeaufnahme durchflihren und ein Gelandemodell sowie einen feinmaschigen Hohenschichtlinienplan erstellen (Abb. 13). Nun sind geringe Niveauunterschiede und insbesondere die Depressionen oder Senken, die das Siedlungsareal Uberziehen, genau lokalisierbar und mit den geophysikalischen Messergebnissen korrelierbar. AuBerdem konnte Schaich mit einem Differential-GPS von den Hauptmesspunkten der Ausgrabung die Weltkoordinaten bestimmen und die Ausgrabung sowie
alle weiteren Arbeiten in ein Koordinatensystem integrieren.
Einen wichtigen Stellenwert nehmen die geophysikalischen Messungen ein. Auf der Grundlage der ersten geomagnetischen Messungen von 2005 flihrten russische Geophysiker weitere Untersuchungen41 in verschiedenen Bereichen der Siedlung durch. lm Sommer 2009 wurde schlieBlich durch Dr. Arno Patzelt die gesamte Siedlungsflache gemessen
41 Mypasbes u. a. 2009a; Mypasbes u. a. 2009b.
109
Abb. 13. Kamennyj Ambar/ Ol'gino. Feinmaschiges Gelandemodell bzw. Hdhenschichtlin ienp ian des Siedlungsareals mit Magnetogramm (Grundlagen M. Schaich und A. Patzelt, Aufnahmen 2009).
110
Abb. 14. Kamennyj Ambar/ Ol'gino. Hochauf·
liisendes Magnetogramm der befestigten
Siedlung (Messung A. Patzelt 2009).
und ein hoch auflosendes Magnetogramm erstellt {Abb. 14). 42
Durch das in der Kampagne 2009 erstellte Magnetbild konnen nun erstmals die Binnengliederung und die Anzahl der Hauser innerhalb der Siedlung bestimmt und rekonstruiert werden (Abb. 14; 33). In der nordlichen Halfte von Kamennyj Ambar sind dies etwa 25 Hauser, die entlang von zwei schmalen parallelen ErschlieBungsachsen liegen, die mittleren Hauserreihen sind dabei aneinandergebaut. lm hinteren Drittel eines jeden Hauses sind eine oder auch mehrere Anomalien sichtbar. Am wahrscheinlichsten handelt es sich dabei um Brunnen, Herdstellen und Ofenstrukturen. Einen aufregenden Befund stellt zudem eine deutliche Zweiteilung der Befestigung und der Siedlung dar, die auf eine Bauabfolge hinweisen
42 Die geomagnetischen Messungen wurden mit einem Fluxgate Gradiometer Ferex 4.032 DLG und vier Sanden CON 650 vorgenommen, wobei die vier Sanden in einem Abstand von 0,5 m zueinander befestigt waren und eine Aufliisung von 0,1 Nanotesla (nD hatten. Aile 0,125 m wurde ein Messpunkt genommen. Da die Messungen entlang paralleler Linien durchgefUhrt wurden, die 0,5 m auseinander lagen, ergab dies in der Sum me 16 Messpunkte pro Quadratmeter. Zum Prozessieren der Daten wurde die Software GEOPLOT 3.0 (Geoscan Research, Bradford, U.K.) verwendet. Die endgultige graphische Umsetzung wurde mit dem Programm SURFER (Golden Software Inc., Golden, USA) vorgenommen.
Rudiger Krause u. a.
konnte. Spannend ist vor allem der Umstand, dass sich in de r sUdlichen Flache zum Fluss hin keine Hausbauten erkennen lassen, sondern zahlreiche Gruben bzw. Grubenansammlungen. Bislang ist jedoch noch vollkommen ungeklart, was sich dort befunden haben konnte. Zu denken ware an ,Aktivitatszonen", an Arbeitsplatze von Handwerkern oder Verarbeitungsplatze im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion bzw. mit der Viehwirtschaft.
Neben den geomagnetischen Messungen in Kamennyj Ambar wurden von A. Patzelt erste Messungen in den beiden anderen Siedlungen Zurumbaj und Konopljanka durchgefUhrt. Auch hier zeigen sich sehr gute Ergebnisse, die bis auf die Hauseinheiten herab die Strukturen der Siedlungsareale zu erkennen geben. In Zukunft soll zunachst in Kamennyj Ambar das umliegende Areal durch breite Messstreifen erschlossen werden, um zu klaren, ob es weitere Siedlungsstrukturen oder einzelne Hauser im Umfeld der befestigten Siedlung gegeben hat.
EinschlieBlich der Grabungskampagne 2009 gelang es in Kamennyj Ambar bislang, in sechs Grabungsarealen ca. 1.200 m2 der Siedlungsflache zu untersuchen (Abb. 15). In den Grabungsarealen 1-5 im Nordosten der Siedlung wurde ein Abschnitt der Fortifikation mit einem Eingangsbereich
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
und daran angrenzenden Siedlungsstrukturen frei· gelegt (Abb. 16).43 In den Grenzen des 208 m2 gro· Ben Grabungsabschnittes 6, der im Nordteil der Siedlung 2009 neu angelegt wurde, ist hier der Be· reich zwischen zwei parallelen Hausreihen gezielt ausgewahlt worden, um einerseits den Ubergangs· bereich von den Hauseingangen zur StraBe genauer zu untersuchen und andererseits mit dem Freilegen eines mdglichst ungestdrten Hausareals zu beginnen.
Auf diese Weise konnten in den Grabungskam· pagnen 2005-2009 sieben Hauser archaologisch nachgewiesen werden, wobei die Untersuchungen in drei Hauseinheiten (Haus 1-3) bereits abgeschlossen sind. Die Hauser 4-7 wurden in der Grabungskampagne 2009 hingegen erst in Teilbereichen frei· gelegt, so dass noch keine endgi.iltigen Aussagen zu ihrem Erscheinungsbild wie auch zu ihren AusmaBen getroffen werden kdnnen. lm Folgenden wollen wir exemplarisch die Befunde der Hauser 1 und 2 kurz darstellen.
Haus 1
Das in seiner Langsachse NW-SO ausgerichtete, rechteckige Haus 1 lag im norddstlichen Teil der Siedlung, grenzte mit seinem dstlichen Ende an die Verteidigungsmauer (Abb. 16) und nahm eine Flache von 144 m2 ein, wobei seine norddstliche Wand und die dstliche Hausecke durch Erdbewegungen spaterer Siedlungsaktivitaten stark gestdrt wa ren. Die Verfi.illung der Hausgrube bestand im suddstli· chen Teil i.iberwiegend aus gehartetem, im dstlichen Teil stellenweise sogar verziegeltem Lehm, auf dem vereinzelt der Negativabdruck von Hdlzern zu er· kennen war. Dies wird als eindeutiger Beleg dafi.ir gewertet, dass die Mauern in Holz·Erde-Technik errichtet wurden. Der zentrale und der ndrdliche Teil des Hauses wiesen hingegen eine zweigeteilte Ver· fi.illung auf, deren obere, 20- 40 em machtige Schicht aus feinem, graugelbem Lehm mdglicherweise zum ehemaligen Dach des zerstdrten Gebaudes gehdrt hatte. Die in diesem Stratum freigelegten Funde, zu denen vor allem zahlreiche Knochen gehdren, wur· den aller Wahrscheinlichkeit nach erst durch Be· wohner der spateren Besiedlung in die Eintiefungen verbracht. lnsgesamt wiesen die Fi.illschichten eine groBe Menge an Brandresten auf, deren Quantitat zur Siedlungsmauer hin ansteigt.
Wahrend die 67 innerhalb des Hauses freigelegten Pfostenldcher keine strukturierte Verteilung erkennen lieBen und sich somit in ihrer Anordnung einer abschliei3enden Interpretation entziehen, konnten im Zentrum der Wohnflache zumindest
43 En~Maxos 2007; Wapanosa 2007; KopAKOsa 2009; Wapanosa 2009.
zwei Brunnen sowie Reste von Ofenkonstruktionen eindeutig nachgewiesen werden. In ihrem direkten Umfeld fanden sich zudem Fragmente eines fi.ir die Datierung des Gesamtbefunds wichtigen, sintasta· zeitlichen Keramikgefai3es sowie eine Haufung von Tierknochen.
Der erste Brunnen (1/1) 44 war dabei zunachst nur als eine konzentrische, gelbe Bodenverfarbung auszumachen, um die aui3en herum ein graugri.iner, zuweilen ascheartiger Boden lag. Erst auf dem Niveau des anstehenden Bodens (- 80 em) veranderte sich die Zusammensetzung der Brunnenverfi.illung, dessen Zentrum nunmehr vollstandig aus graugri.i· nem Lehm sowie den fi.ir die Befunde dieser Art cha· rakteristischen Holzkohlebandern an den Konturen bestand . Bei - 130 em Tiefe war dann eine spi.irbare Verengung des eigentlichen Brunnenschachtes auf einen Durchmesser von ca . 1,0 m festzustellen, im weiteren Verlauf (unterhalb -200 em) dann noch· mals reduziert auf 0,7 m. Einzelfunde lagen i.iberwiegend im oberen Bereich der Verfi.illung und bestanden aus Tierknochen sowie Keramik· und Bronzefragmenten. Ab - 291 em Tiefe trat Grund· wasser ein, das weitere systematische Arbeiten in· nerhalb des Brunnenareals zunehmend erschwerte und schlieBiich vollends verhinderte (bei - 343 em). Zudem bestand das Fundspektrum, das bis zum Einstellen der Untersuchungen in diesem Bereich zuta· ge trat, nur noch aus einem FuBkndchel eines grd· Beren Hornviehs sowie aus verkohlten Holzzweigen.
Der zweite Brunnen (1/2) befand sich ca. einen Meter suddstlich vom ersten Brunnen (1/1) und wies keine weiteren Besonderheiten auf. Bei -93 em
44 Um Verwechslungen zu vermeiden und die Brunnen unterschiedlicher Hauser exakt voneinander un tersche iden zu kbn· nen, wurde von Anfang an die jeweilige Hausnumme r der Brunnenbeze ichnung vorangestellt (Beispiel: Brunnen 1/1 ~ Haus 1, Brunnen 1).
Abb. 15. Kamennyj Ambar/ Ol'gino, Grabungs·
111
areal 6. lm Vordergrund wird im traditionellen Schachbrettsystem das sintasta-zeitliche Haus 4 freigelegt (Sommer 2009).
112
Abb. 16. Kamennyj Ambar/
Ol'gino, Grabungsareale 1-5 der Jahre
2005 - 2009. Gesamt· plan mit den Hausern
1, 2, 3 und 7 sowie Teilen der
Fortifikationsan \age. Stand 2009.
Haus 7
•• •
y c
3CA) 2005-2009 N
1
•
Haus 1
G
~ &
• I>'
n 0
~ ..
H
"'
M
• •
' •
•
• •
)!{
RUdiger Krause u. a.
.J
.,
II
12
13
14
IS
16
17
18
19
20
ll
'-----'2m
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
Tiefe konnte allerdings im Zentrum der VerfUIIung ein runder, mit einem Durchmesser von bis zu 0,7 m groBer, helltoniger Bereich sehr festen Lehms nachgewiesen werden, bei dem es sich moglicherweise urspri.inglich um die Kuppel eines Ofens gehandelt hat. Eine Holzkonstruktion der Brunnenverschalung hatte sich nicht erhalten. Zu den Funden aus seinen Fi.illschichten zahlen Fragmente von drei kleinen, im Durchmesser bis zu 8 em starken Holzern , ferner Holzkohlesti.icke sowie ein groBer Stein mit Brandspuren.
Haus 2
Das Haus 2 {Abb. 16) lag si.idwestlich von Haus 1 und besaB mit ihm eine gemeinsame AuBenmauer, die in diesem Fall allerdings deutlich Ianger als die entsprechende Wand des benachbarten Gebaudes war, wodurch es mit einer Gesamtlange von i.iber 20m wesentlich groBere AusmaBe offenbart. Die Fundamentbreite betrug 80-90 em und war in einer Hohe (vom Boden der Hausgrube aus gemessen) von ca. 40 em erhalten. lm zentralen Bereich war Haus 2 durch eine noch in der Sintasta-Zeit eingetiefte Aschegrube und dann - in einer spateren Besiedlungsphase - zudem durch das Haus 3 i.iberlagert und daher in seiner si.idwestlichen Gebaudehalfte praktisch vollstandig zerstort worden. Dabei i.iberdeckte Haus 3 insgesamt fi.inf Brunnen sowie eine Ofenkonstruktion, die erst beim Entfernen seines FuBbodens (- 130 em Tiefe) zum Vorschein kamen. AuBerdem wurde unter dem Boden von Haus 2 ein Kindergrab angetroffen. Nach den erhaltenen drei Hausecken zu urteilen, besaB das Gebaude einen annahernd trapezformigen Grundriss mit einer Flache von ca. 273 m2•
Auch die VerfUllung der Hausgrube unterschied sich deutlich von der in Haus 1. So bestand sie im westlichen Teil aus einer dunklen Lehmschicht, durchsetzt mit kleineren Holzkohlesti.ickchen, wahrend der Lehmboden im ostlichen Teil durch Brandeinwirkung eine spezifisch rotliche Farbung zeigte. lnsgesamt konnten 105 Pfostenlocher fre'igelegt und dokumentiert werden, die vor allem den Mauerverlauf in der ostlichen und der westlichen Hausecke deutlich nachzeichnen lassen, wahrend sie im Zentrum des Gebaudes keine planmaBige Verteilung erkennen lieBen.
Die am besten erhaltenen Brunnen 2/1 und 2/1a lagen sehr eng beieinander und konnten daher auch erst ab - 300 em Tiefe als eigenstandige Befun de unterschieden werden (Abb. 17). In einem oberen Planum, in dem nur ein groBerer Brunnenschacht zu erkennen war, lieB sich ein bemerkenswerter Befund freilegen (Abb. 18). Von Si.iden fUhrte eine Treppe mit Resten einer Holzverschalung in mindestens fi.inf Stufen von der Oberflache auf ein
Niveau bei - 190 em Tiefe, wo der Zugang offenbar in eine Art Brunnenstube mi.indete. Dort lag am FuB der Treppe das Skelett eines kleinen Wiederkauers, auf den oberen Treppenstufen i.iberdies ein vollstandiges KeramikgefaB. Diese Fundeinheiten erweckten den Eindruck einer absichtlichen Niederlegung.
In beiden Brunnensehaehten haben sieh Reste der urspri.ingliehen Holzverkleidungen erhalten, die im ersten Fall aus ehemals aeht senkreehten Holzern bestand, um die Zweige mit einem Durehmesser von 1,5-3 em eingefloehten waren (Abb. 19). Die Lange der erhaltenen Pfloeke liegt bei 56-60 em, ihr Durehmesser bei bis zu 5 em und der Durehmesser der gesamten Konstruktion betrug im unteren Teil 57-60 em. Der Brunnen 2/1a war demgegeni.iber ab - 330 em Tiefe von innen mit senk-
113
Abb. 17. Kamennyj Ambar/Ol'gino, Haus 2. Freilegung der Brunnen 2/1 und 2/1a mit Holzeinbauten im Grundwasserbereich. Ausgrabung 2008.
Abb. 18. Kamennyj Ambar/ Ol'gino, Haus 2. Planum der Brunnenschachte 2/1 und 2/1a (bei -190 em). Ausgrabung 2008.
114
Abb. 19. Kamennyj Ambar/
Ol'gino, Haus 2. Brunnen 2/1. Reste des
hiilzernen Flechtwerks aus Birkenholz der
ehemaligen Brunnenverschalung.
Ausgrabung 2008.
recht stehenden, feuergeharteten, gehalfteten und zugespitzten Stammen (100 em x 10- 12 em x 7 em) verkleidet (Abb. 17). Der Durchmesser der gesamten Holzkonstruktion lag im oberen Teil bei 73-75 em, nahe dem Boden etwas geringer bei ca . 60 em. Neben einem fUr die Datierung besonders wertvollen Fragment eines sintasta-zeitlichen GefaBes aus der VerfUIIung von Brunnen 2/1 gehoren noch einige weitere, allerdings nicht bestimmbare Keramikbruchstucke, Schlacke, Tierknochen und ein Steinbeil zu den Kleinfunden.
Die Holzer des Brunnens wurden an der Archaologischen Staatssammlung in Munchen konserviert45 und in der Dendrochronologischen Abte ilung des Deutschen Archaologischen lnstituts in Berlin von U. HeuBner auf die Moglichkeit einer Jahrri ngdatierung untersucht.46 Jedoch enthalten die relativ dunnen Holzer zu wenige Jahrringe, so dass an vier Proben AMS-Datierungen von B. Kromer vorgenommen wurden (s. u.).
Die Untersuchungen in den anderen drei Brunnen von Haus 2, in denen sich stellenweise noch Bearbeitungsspuren an den Schachtwanden nachweisen lieBen und die das Kleinfundspektrum u. a. durch gerade Zweige mit einer Lange von ca . 35 em und einem Durchmesser von 1 em (Pfeile?) bereicherten, lassen bei aller gebotenen Vorsicht den Schluss zu, dass die Brunnen 2/3 und 2/4 fruher als die Brunnen 2/1 und 2/1a errichtet und dann wieder bewusst verfullt worden waren . Die Brunnen 2/1 und 2/1iJ. wiederum wurden dem natUrlichen Verfall preisgegeben und standen lange Zeit offen, bevor sie sich vollends mit Sediment fullten . Ober die zeitliche Einordnung des Brunnens 2/2 lasst sich demgegenuber nichts Genaues sagen.
45 Herrn Prof. Dr. Rupert Gebhard, Direktor der Archao logischen Sta?tssammlung MUnchen, danken wir sehr fUr die freund liche UnterstUtzung und fUr die Konservierung der Holzer.
46 Herrn Dr. U. HeuSner danken wir fUr die Untersuchung der Hiil· zer im Hinblick auf die Miiglichkeit dendrochronologischer Mes· sun gen.
RUdiger Krause u. a.
Sudlich der Brunnen 2/1 und 2/1a lag im Abschnitt K/15 schlieBiich die bereits erwahnte Kinderbestattung, die bei -142 em Tiefe in Form einer rechteckigen, NNO-SSW orientierten Holzkonstruktion zum Vorschein kam. Sie bestand aus zwei bis zu 65 em Iangen Holzern, auf denen kurzere, zwischen 32 und 45 em lange Querbalken mit einer Breite von 6-7 em auflagen. lm sudlichen Teil der Konstruktion fanden sich BruchstUcke eines KeramikgefaBes, weiter nordlich die schlecht erhaltenen Schadelknochen eines kleinen Kindes. Etwas tiefer lagen einige bruchige Rippenfragmente sowie BruchstUcke eines Schenkelknochens oder eines Schienbeins. Am nordlichen Ende der Holzkonstruktion wurde zudem bei - 177 em Tiefe eine Deponierung freigelegt, die aus einem Schadel und weiteren Knochen von Extremitaten kleineren Hornviehs bestand. Nach dem Fundort des Schadels zu urteilen, wa r das bestattete Kind mit dem Kopf nach SSW niedergelegt worden. Rechts des Kopfes stand ein GefaB, zu seinen FuBen lag die Opferstelle. Weitere Bestandteile des ursprunglichen Grabinventars haben sich nicht erhalten. Die Grabgrube war in der Sintasta-Zeit vollstandig im FuBboden von Haus 2 eingetieft (ca . bei 60-70 em) und mit Lehm ausgekleidet gewesen. Durch die Grabungen des Jahres 2009 konnten unter den Niveaus der Hauser mehrere neue Brunnen im Planum loka lisiert werden (Abb. 20), die im Sommer 2010 ausgegraben werden sollen.
Das Befestigungswerk: Mauer und Graben
Die Befestigung der Siedlung bestand aus einem Mauer-Grabensystem, das im Nordosten der Siedlung (Abb. 16) eingehender untersucht werden konnte. Auf der AuBenseite der bis zu 4 m breiten, uberwiegend aus Rasensoden und Lehmblocken errichteten Mauer lagen Steinplatten lokaler Herkunft (Abb. 21) aus Amphibolit, Kiesel, Schiefer, Quarz und schlieBiich Diorit, dessen Herkunft ca. 0,5-1,0 km nordlich der Siedlung lokalisiert wurdeY Ein Teil dieser an den Kanten bearbeiteten und sich stellenweise uberlappenden Steinplatten zeigte auf der Oberflache eine rotliche Fa rbung, die nu- durch Feuereinwirkung zu erklaren ist. Darauf verweist auch ein orangefarbener und z. T. ziegelartiger Lehmboden im Mauerversturz selbst. Vor Ort durchgefUhrte Rekonstruktio nsversuche48 ergaben, dass die ursprungliche Hohe dieser Verkleidung mindestens 2,0 m betragen haben muss. Holzkonstruktionen , die die Mauer von auBen begrenzten und zusatzlich abstUtzten, waren indes nicht nachzuweisen. De-ch ist von ihrer Existenz sicher auszugehen, worau r\lci t
47 3a~KOB U. a. 2009. 48 Die Rekonstruktionsversuche wurden unte r Anleitung von N. P.
Anisimov durchgefUhrt.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
allem die hohe Quantitat organischen Materials (Holzfragmente, Holzkohle) verweist
Entlang der AuBenseite der Mauer ve rlief ein Graben, der eine mittlere Breite von ca. 2 m und an den lnnen- und AuBenseiten jeweils zwei Abstufungen aufwies (Abb. 21). Am Boden verlief zudem eine kleine Rinne mit einer Breite von 40 em und einer Tiefe im anstehenden Boden von nicht mehr als 30-35 em. Der Hiihenunterschied zwischen der erhaltenen Mauerkrone und der Grabensohle betrug zumeist 1,8 m, an manchen Stellen aber auch bis 2,15 m. An seiner AuBenseite war dieser Graben mit einer kleinen ,Barriere-Mauer" abgegrenzt, der aus einem beigefarbenen sowie einem gelben umgelagerten Lehmboden bestand und der aller Wahrscheinlichkeit nach als Aushub aus dem Graben anzusprechen ist Die Mauerhiihe konnte noch mit bis zu 80 em verzeichnet werden.
lm niirdlichen Teil des Untersuchungsareals gelang schlieBiich die Freilegung eines Eingangsbereichs (Abb. 16), der sich als eine 3 m breite Unterbrech ung in de r inneren und auBeren Mauer nachweisen lieB. Dieser NO- SW ausgerichtete Befund iiffnet sich direkt auf den durch das Magnetogramm (Abb. 14) bereits bekannten StraBenzug. Zahlreiche Pfostenliicher entlang des Durchgangs sowie R~ste organischen Materials lassen darauf schlieBen, dass im Eingangsbereich eine hiilzerne Konstruktion existierte. Davon zeugen ebenso Pfostenstellungen mit einem Durchmesser von 15- 42 em, die in para lie-
len Rei hen entlang des Durchgangs lagen. Der Graben war im Eingangsbereich nicht unterbrochen, er verjungte sich nur auf die Breite der oben erwahnten Rinne. AuBerhalb des Grabens lag eine weitere Linie von einigen Pfostenlochern .
Funde aus Keramik, Stein, Knochen und Metall
Das Spektrum der Kleinfunde der Grabungskampagnen 2005-2009 umfasst erwartungsgemaB eine Vielzahl an Metal!-, Stein-, Knochen- und Hornobjekten. Weitere organische Materialien sind demgegen-
115
Abb. 20. Ka mennyj Ambar/ Ol'gino, Grabungsabschn itt 6. Brunnen 4/1 (vo rn im Bild) und 6/1 (h inten im Bild) , an dessen Rand ein GefaB vom Typ Srubn o-Aiakul' gefunden wurde (Stand Sommer 2009, Ausgrabung 2010 geplant).
Abb. 21. Kamennyj Ambar/OI'gino, Grabungsarea le 1- 5 (vgl. Abb. 16). Die Reste der Fortifi kation im Nordosten der Siedlung mit der Verteid igungsmauer, auf deren AuBense ite noch eine Verkleidung aus Steinplatten lokaler Herkunft lag.
116
Abb. 22. Kamennyj Ambar/
Ol'gino. Kleinfunde aus der Siedlung. a Stein
scheiben; b Pfeilspitzen aus Silex.
716/851
716/700
L---------~----------~lOcm
b
2 4
L-------------~ 5 em
Uber- mit Ausnahme der Brunnenhtilzer - wegen der sehleehten Erhaltungsbedingungen kaum Uberliefert.
An Steinobjekten fanden sieh neben Sehleifsteinen und Sehlagwerkzeugen vor allem Pfeilspitzen (Abb. 22), die zahlreiehe Analogien in sintastaund petrovka-zeitliehen Grabkomplexen besitzen, einsehlieBlieh des nahegelegenen Graberfelds Kamennyj Ambar-5. Ungewtihnlieh ist Ferner eine groBe Anzahl an Seheiben mit einem Durehmesser von 7-8 em bis hin zu 13-14 em (Abb. 22). Sie bestehen Uberwiegend aus einem sehr harten, quarzhaltigen Gestein und ihre Herstellung erforderte zweifellos einen hohen Erfahrungswert im Umgang mit dem Material. Bislang sind diese Steinseheiben, die aus den FUllsehiehten der sintasta-zeitliehen Hauser
RUdiger Krause u. a.
~----~----~lOcm
b
716/2245
71612244
n6!2243 716/2228
Abb. 23. Kamennyj Ambar/Ol'gino. Kleinfund e aus der Siedlung. a Artefakte aus Kupfer; b Kupfererze .
stammen, nur aus Kamennyj Ambar bekannt. Loehwerkzeuge wie Ahlen oder Nadeln aus untersehiedliehen Knoehen und mit polierten Enden sowie Astragale mit Bearbeitungsspuren an den Randern, drei Anhanger aus durehbohrten Eekzahnen eines Fuehses und zwei Knoehenpfeilspitzen komplettieren das Kleinfundspektrum aus dem bislang untersuehten Siedlungsareal.49 Hinzu kommt ein 3,2 x 1,2 em groBes Stofffragment, das im Unterkiefer eines kleinen Horntieres im Kindergrab gefunden wurde und dessen Faser eine Leinwandbindung aufweist.
Zahlreiehe Funde von Kupfererzen, Sehlaeken50 sowie bislang 93 Metallfragmenten belegen
49 Ein zweischneid iges Bronzem esse r aus Haus 3 mit rechtwinkligem Ubergang zum Gri ff, ohne abgesetztes Heft sowie rhombischem Querschnitt datiert in die spate Bronzezeit (11 - 111 Phase) und steht aufgrund seiner Charakteristika (relativ gro\Se Klinge, hohe KrUmmung) verschiedenen StUcken aus dem Kon text der sog. Petrovka-Kultu r nahe (AepraYes/oOYKapes 2002, 36- 41). Alle rdings zeigt das Messer in seinen Hauptmerkmalen ebenso Parallelen zum Fund aus dem Verchnij-Kizil' Depot (En~Maxos 2003).
50 Die Schlackenfunde stammen im Wesentlichen aus den HausverfUllungen und den Brunnen, einige StUcke wurden alle rd ings auch im Bereich des Walles gefunden.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
die Verarbeitung von Metall in der Siedlung (Abb. 23). Eine erste Analysenserie an 39 Kupferartefakten durch Ernst Pernicka hat ergeben, dass die Artefakte uberwiegend aus reinem Kupfer bestanden. Ein kleinerer Anteil enthielt Beimengungen von Arsen, und wenige Artefakte enthielten Zinnanteile von bis zu 3,5 %. In Erganzung mit bleiisotopischen Untersuchungen soli zukunftig die Frage der Relation der Kupfererze und Schlacken zu den Kupferartefakten untersucht werden, um damit Anhaltspunkte fUr die Rekonstruktion der Metallurgie zu gewinnen.
Keramik
Wahrend der Grabungskampagnen 2005 - 2008 wurden insgesamt 3.124 Keramikfragmente aufgefunden, von denen der groBte Teil (1.843 Exemplare) alterdings nicht mehr bestimmbar war. 51 Das verbleibende Keramikmaterial lasst sich in drei Gruppen unterteilen: Typ Sintasta mit 55,3 % (708 Exemplare; Abb. 24), Typ Petrovka mit 17,5 % (225 Exemplare; Abb. 25) und Typ Srubno-Aiakul' mit 27,2 % (348 Exemplare; Abb. 26). Die groBte Keramikkonzentrati on fand sich erwartungsgemaB in den VerfUllungen der Hauser und des Verteidigungsgrabens, wahrend die Flachen zwischen den Hausern und die eigentlichen Mauerschichten weitgehend fund leer waren.
So wurden in den Fullschichten von Haus 1 insgesamt 788 Fragmente geborgen, von denen 399 Scherben bestimmbar sind und sich wie folgt einteilen lassen: Typ Sintasta mit 73 % (291 Exemplare), Typ Petrovka mit 17% (68 Exemplare) und Typ Srubno-Aiakul' mit 10 % (40 Exemplare). lm Brunnen 2/1 wurden zusatzlich eine sintasta-zeitli che und sechs nicht bestimmbare Scherben gefunden, im Brunnen 2/2 zwei sintasta-zeitliche und neun unbestimmbare Fragmente. lnsgesamt konzentrierten sich die Keramikfunde im zentralen und sudlichen Teil des Hauses in Brunnennahe, wobei die am starksten mit Funden gesattigten Schichten den unteren und mittleren Fullschichten des Gebaudes (Niveau - 20 bis - 50 em Tiefe) entsprechen.
Die Keramik vom Typ Srubno-Aiakul' war auf einem Niveau von -0,01 bis - 0,62 m nachzuweisen (Mittelwert bei -0,27 m). Die nachst tieferen Schichten (Niveau -0,04 bis - 0,78, Mittelwert - 0,31) erbrachten Fragmente der petrovka-zeitlichen Keramik, wahrend die sintasta-zeitlichen Scherben schlieBiich bis in die untersten Straten hineinreichten (zwischen + 0,01 und -0,83 m, Mittelwert -0,45) . Diese stratigraphische Analyse verdeutlicht, dass die Petrovkaund die Srubno-Aiakui'-Keramik in den Fundschichten deutlich kompakter als die sintasta-zeitlichen
51 Das Keramikspektrum aus der Grabungskampagne 2009 wird derzeit noch ausgewertet.
Fragmente lagen und zudem vorzugsweise in der oberen VerfUllung anzutreffen waren.
lm Haus 2 konnten demgegenuber 630 Scherben geborgen werden, von denen allerdings nur 230 Fragmente bestimmbar sind und sich wie folgt einteilen lassen: Typ Sintasta mit 68,3 % (157 Exemplare), Typ Petrovka mit 15,6 % (36 Exemplare) und Typ Srubno-Aiakul' mit 16,1 % (37 Exemplare) . Zusatzlich fanden sich in den VerfUllungen der Grube 1 und der Pfostenlocher nochmals weitere vier unbestimmbare und drei sintasta-zeitliche Scherben.
lnsgesamt zeigt die Fundverteilung, dass der GroBteil der Keramik mit einer maxima len Funddichte zwischen - 0,40 und - 0,60 m Tiefe im ostlichen Hausbereich lag. Der stratigraphische Vergleich der verschiedenen Typen verdeutlicht dabei, dass die sintasta-zeitliche Keramik im Bereich von -0,05 bis -1,12 m auftrat (Mittelwert - 0,56 m). Die GefaBfragmente des Petrovka-Typs lagen in einem Bereich von -0,09 bis -0,62 m (Mittelwert - 0,39 m), wobei sie
117
Abb. 24. Kamennyj Ambar/ Ol'gino. Keramik vom Typ Sintasta aus der Siedlung.
118
Abb. 25. Kamennyj Ambar/ Ol'gino. Keramik
vom Typ Petrovka aus der Siedlung.
RUdiger Krause u. a.
eine Scherbe von einem spatbronzezeitlichen Gefa13 sowie zwei weitere von Gefa13en des Typs Sintasta.
Datierung der Befunde
Die Analyse der vertikalen und horizontalen Keramikverteilung lasst in den Grenzen der befestigten Siedlung bislang sicher nur von zwei chronologischen Komplexen sprechen, die im direkten Zusammenhang mit den freigelegten Objekten stehen: die SintastaZeit und die Srubno-Alakul'-Zeit. Die Keramik vom Typ Petrovka lie13 sich demgegenUber bislang nur typologisch greifen, da sie ausschlie13lich in umgelagerten und somit in stratigraphisch nicht aussagekraftigen Schichten auftrat. Aufgrund der Daten, die bei der Untersuchung der Befestigungsanlage gewonnen wurden, darf man allerdings zu Recht schlussfolgern, dass die Nutzungszeit dieses Keramiktyps chronologisch zwischen die Sintasta· (naher zu ihm) und die Srubno-Alakul'-zeitlichen Horizonte fallt. Diese Beob· achtung sowie die beachtliche Quantitat der Petrovka-Keramik lassen vermuten, dass sie mehr als nur einen blo13en ,Zusatz" zum Sintasta-Komplex darstellt. Beide Phanomene verweisen sogar auf das Vorhandensein von Objekten der Petrovka-Zeit in den noch nicht ergrabenen Teilen de r Siedlung.
Die stratigraphischen Beobachtungen lassen sich seit 2009 nunmehr auch erstmals mit absoluten Daten korrelieren , die am Curt·Engelhorn-Zentrum in Mannheim durch Dr. B. Kromer ermittelt werden konnten (Abb. 27) . Sechs Radiokohlenstoffdatierungen an je zwei Hiilzern aus den Brunnen 2/1, 2/1a und 2/4
'---------" scm (Abb. 17-19) ergeben kalibriert ein Datierungsinter-
allerdings aus umgelagerten Schichten stammen und somit erst sekundar in das zu diesem Zei t punkt bereits nicht mehr existente Gebaude gelangt waren. Die Keramik vom Typ Srubno-Alakul' lag im Be· reich zwischen - 0,08 und -0,86 m (Mittelwert bei - 0,52 m). Dabei verteilten sich 70 % dieses spaten Keramiktyps entlang der Grenzen von Haus 3, wodurch sein hohes Auftreten im Haus 2 erklart wer· den kann.
lm Bereich der Umwehrung, der Mauer und des Grabens fanden sich schlie13lich 442 Fragmente, von denen 160 bestimmbar waren und sich wie folgt einteilen lassen: Typ Sintasta mit 30,6% (49 Exemplare), Typ Petrovka mit 46,3% (7 4 Exemplare) und Typ Srubno-Alakul' mit 23,1% (37 Exemplare). Au13erhalb des Grabens wurden zudem weitere 20 Keramikfragmente gefunden, von denen sieben zum Typ Sintasta, drei zum Typ Petrovka und eine Scherbe zu einem Gefa13 der spaten Bronzezeit gehiiren. Die Funde aus der inneren Mauer sind quantitativ ebenfalls sehr gering. Von den hier fixierten, insgesamt 18 aufgefundenen Fragmenten stammen
vall zwischen 2100-1900 cal BC (kalibr. Alter 2o) . Damit ist die an den Brunnenhiilzern gewonnene Da· tenserie in der Tendenz etwas alter als die, die an menschlichen Knochen aus den benachbarten Kurga· nen von Kamennyj Ambar-5 (s. o.) gemessen wurden und die ein Datierungsintervall zwischen 1960-1770 cal BC aufweisen. Weitere Datierungen, die an Holzkohlen aus Hausern der Grabungskampagne 2009 vorgenommen werden, liegen derzeit in ersten Daten vor. Dabei deutet sich ebenso ein Datierungsintervall im 20. und 19. Jh. v. Chr. an . Es ist geplant, die Datenserie an unterschiedlichen Befunden und Materialien zum Aufbau eines unabhangigen ChronologiegerUsts in den kommenden Jahren auszubauen.
Naturwissenschaftliche Untersuchungen zur Rekonstruktion der Landschaft und der wirtschaftlichen Grundlagen
Die botanischen Untersuchungen
Die botanischen Untersuchungen in der westsibirischen Steppe haben das Ziel, das alltagliche Leben
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
der bronzezeitlichen Siedler, deren Wirtschaftsweise sowie ihren Einfluss auf die Vegetation zu erforschen. Dies geschieht mit Hilfe der Analyse von FrUchten, Samen, Holzkohlen, Pollen und Sporen aus den archaologischen Ausgrabungen sowie aus natUrlich gewachsenen Sedimenten in der Nahe der archaologischen Fundstellen. Zudem werden umfangreiche Untersuchungen zur aktuellen naturnahen Steppenvegetation durchgefUhrt
Die Landschaft im Tal des Karagajly-Ajat bietet fUr archaobiologische Untersuchungen gute Voraussetzungen, denn innerhalb der archaologischen Fundstelle sind viele Bodenvertiefungen vorhanden, wie z. B. der tiefe Graben urn die Siedlung herum, in deren VerfUIIungen sich reichlich verkohlte Pflanzenreste erhalten haben. Zum anderen befinden sich in jedem Haus ein oder mehrere verfUIIte, tiefe Brunnenschachte. lm Grundwasserbereich dieser Brunnensedimente haben sich unverkohltes Pflanzenmaterial sowie Pollen und Sporen in einem guten Zustand erhalten . Schliei3lich ist das einige Kilometer breite Tal des Karagajly-Ajat auffallig reich an Senken, Flussrinnen und Altarmen (Abb. 7}, die entweder noch Wasser fUhren oder bereits zugewachsen und verlandet sind und deren Sedimente (Seesedimente und Niedermoore) ausreichend Miiglichkeiten fUr archaopalynologische Untersuchungen bieten, urn die Landschaftsveranderungen zu rekonstruieren.
Onsite-U ntersuchungen
lm Jahr 2008 wurden aus dem breiten Graben sowie aus den Befunden vo n Haus 2 insgesamt 24 Proben fUr die Untersuchung der pflanzlichen Groi3reste entnommen und bearbeitet Aus der untersten VerfUIIung eines Brunnens von Haus 2 kon nten bei einer ersten Durchsicht 70 Pflanzentaxa aus 19 Pflan zenfamilien identifiziert werden. Davon waren in verkohltem Zustand 30 Taxa vorhanden, unter denen die Reste von Gansefui3 (Chenopodium div. spec.) und Federgras (Stipa div. spec.) vorherr-
labor-Nummer Proben name konv. 14C Alter BP
Hd -28408 Ol'gino-Brunnen 2/1a, 3644 ± 31 auBere 5 Ringe ETH -38106
Hd-28430 Ol'gino-Brunnen 2/1a, 3617 ± 31 innere 4 Ringe ETH-38104
Hd-28431 Ol'gino-Brunnen 2/1, 3618 ± 31 innere 10 Ringe ETH· 38105
Hd-28432 Ol'gino -B runnen 2/1, 3594 ± 31 auBere 5 Ringe ETH-38107
Hd-28457 Ol'gino-Brunnen 2/4, 3559 ± 26 auBere 5 Ringe ETH-38150
Hd-28458 0\'gino-Brunnen 2/4, 3636 ± 26 auBere 5 Ringe ETH-3815 1
119
Q \G.o\ . ( . '~ . .
.
schen. Ebenfalls waren 30 Taxa in unverkohltem Zustand im Brunnensediment nachweisbar, unter denen Reste von Beifui3 (Artemisia div. spec.) dominieren. Die restlichen zehn Taxa waren sowohl in unverkohltem als auch verkohltem Zustand vorhanden. Diese Zusammensetzung deckt sich weitgehend mit dem Pollenspektrum des Brunnensedimentes. Die bronzezeitlichen Pollen, FrUchte und Samen spiegeln somit eine Steppenvegetation wider, die der heutigen sehr ahnlich war. Auffallend war die groi3e Anzahl gut erhaltener verkohlter HUisenfrUchte (Familie der Fabaceae) . Sie fanden sich in zwei Drit-
li13C kal. Alter lo kal. Alter 2o
- 20.8 cal BC 2112-1954 cal BC 2134-1923
- 18.8 cal BC 2024-1941 cal BC 2116- 1891
- 24.7 cal BC 2024·1942 cal BC 2117-1892
-26.9 cal BC 2012·1906 cal BC 2030-1884
- 27.2 cal BC 1944·1883 cal BC 2011-1778
- 28.8 cal BC 2030·1958 cal BC 2127·1921
'----___J 5 ern
Abb. 26. Kamennyj Ambar/ Ol'gino. Keramik vom Typ Srubno-Alakul' a us der Siedlung.
Abb. 27. Kamennyj Ambar/ Ol'gino. Brunnen 2/1, 2/1a und 2/4 Ausgra· bung 2008. 14C-Datie· rungen von 6 Hiilzern der Einbauten in den Brunnen. Kalibriert mit 1NTCAL04 und CAL1B5 (Reimer u. a., Radiocarbon 46(3) 2004, 1029-1058).
120
Abb. 28. Karagajly·Ajat. Das Gewasser
• .Fernseh·See".
tel der Proben und ki.innten von etwa zehn unterschiedlichen Arten stammen. Fri.ichte von Fabaceae haben im verkohlten Zustand nur eine geringe Chance, erhalten zu bleiben. Daher i.iberrascht die in Kamennyj Ambar nachgewiesene groBe Zahl. Wozu die Menschen in der Bronzezeit diese Menge an Hi.ilsenfri.ichten in die Siedlung gebracht haben -fi.ir die eigene Ernahrung, als Viehfutter oder aus anderen Grunden - gilt es im Verlaufe der weiteren Untersuchungen zu klaren. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht, dass bislang keine domestizierten Kulturpflanzen als GroBreste nachgewiesen werden konnten - weder Getreide, Hi.ilsenfri.ichte noch andere.
Daran schlieBt sich unmittelbar eine der zentralen Fragestellungen des Projektes an, namlich die nach der Wirtschaftsweise und nach Getreide· anbau zur Zeit der befestigten Siedlungen in der Sintasta-Kultur. Denn Ackerbau und mi.iglicherweise auch Getreideanbau zahlen wie die Metallurgie zu den Neuerungen in der Steppe, die den hohen kulturellen Status dieser bronzezeitlichen Gemeinschaften in den befestigten Siedlungen unterstreichen (s. o.). Heute wird in der sibirischen Steppe groBflachig Ackerbau betrieben, auch wenn die sommerliche Vegetationszeit eigentlich zu kurz ist, urn rentablen Ackerbau zu ermi.iglichen. Es zeigt uns aber, dass Ackerbau prinzipiell in diesem Gebiet mi.iglich ist. Welche pflanzlichen Produkte haben also die bronzezeitlichen Siedler in Kamennyj Ambar, Ko· nopljanka und Zurumbaj oder den anderen Siedlun· gen im Tal des Karagajly-Ajat gegessen? Wurden diese einzig gesammelt, angebaut oder von weit her importiert? Oder lasst sich vielleicht sogar loka· ler Ackerbau nachweisen? Auf eben diese Fragen sollen die archaobiologischen Untersuchungen Ant· worten geben.
Aber nicht nur die menschliche Ernahrung musste sichergestellt sein, sondern auch die der
Rudiger Krause u. a.
Tiere. Wie wurde das Vieh, deren Haltung sich eindrucksvoll in der Vielzahl der nachgewiesenen Knochenartefakte niederschlagt, vor allem im Winter gefi.ittert, als die Steppenvegetation unter Schnee verschwunden war? Auch im Hinblick auf diese Frage ki.innte der groBen Anzahl nachgewiesener verkohlter Hi.ilsenfri.ichte eine entscheidende Bedeutung zukommen. Von nicht geringerem Stellenwert ist die Frage nach der Gewinnung und Nutzung von Brenn- und Baumaterial in dieser heute doch sehr waldarmen Landschaft. Die Konstruktion der Befestigungsmauer urn die Siedlung Kamennyj Ambar weist ein Holzgeri.ist auf, in den Siedlungsschichten sind Hunderte von Pfostengruben vorhanden und in den Grabanlagen wurden Holzeinbauten nachgewiesen, so dass mit einem durchaus betrachtlichen Holzverbrauch gerechnet werden muss. Daran kni.ipft sich unweigerlich die Frage, ob mi.iglicherweise in der Vergangenheit mit einer weit starkeren Bewal· dung gerechnet werden kann, als uns das heutige Landschaftsbild dies suggeriert.
Offsite-U ntersuch u ngen
Die bronzezeitliche Besiedlung in der westsibirischen Steppenzone wirft aufgrund ihres auBergewi.ihnlichen Siedlungstyps also viele Fragen auf. Von Interesse sind vor allem auch die Umweltverhaltnisse, in der die damaligen Menschen ihre Sied· lungen anlegten sowie die Auswirkungen deren Handelns auf die Landschaft. Die bislang aus Westsibirien publizierten Pollendiagramme52 bieten in diesem Zusammenhang ein zu grobes zeitliches Raster und eine zu geringe Zahl an identifizierten Pollentypen. lm Tal des Karagajly-Ajat werden daher sehr engmaschig hochaufli.isende Pollendiagramme erstellt, die es erlauben sollen, Vegetationsveranderungen zu erfassen, die eng mit der bronzezeitlichen Besiedlung in Zusammenhang stehen. Bislang konnten sechs Ablagerungen gefunden werden, die nach derzeitigem Untersuchungsstand diese Mi.iglichkeiten bieten.
Etwa 1 km i.istlich der Ausgrabung Kamennyj Ambar liegt die Lokalitat ,Fernsehsee"53 (Abb. 28), in der ein knapp 3 m machtiges Pollenprofil erbohrt werden konnte. Von diesem Gewasser haben R. Wittig und A. Konig eine detaillierte Kartierung der aktuellen Vegetation erstellt (Abb. 29). Es handelt sich urn eine etwa 140 x 30 m groBe Wasserflache, die von einem 10 bis 20 m breiten Verlandungs· gi.irtel umschlossen wird. An das offene Wasser schlieBen sich nach auBen hin eine schwimmende Krebsscheren-Gesellschaft (Stratiotetum a/aides), ein
52 Kremenetski u. a. 1997; Tarasov u. a. 1997; Zykin u. a. 2000. 53 Benannt nach den Dreharbeiten des ZDF·Teams von Peter Pres·
tel im Juli 2009.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
Rohrkolbenri:ihrricht (Typha angustifolia Fazies des Schoenoplecto-Phragmitetum), eine GroBseggen-Gesellschaft der Steifen Segge (Caricetum elatae) mit locker durchsetzten WeidengebUschen und schlieBIich ein FeuchtwiesengUrtel an. Bei der Untersuchung von bislang 19 Gewassern fiel der ,Fernsehsee" durch seine intakte Zonierung auf, die auf einen geringen Beweidungsgrad hinweist FUr die Ausbildung der unterschiedlichen Gewasservegetation stellte sich der Beweidungsgrad - Beweidung findet heute vor allem durch groBe Rinder- und Pferdeherden statt - als eine der wichtigsten Ursachen heraus. Manche Pflanzengesellschaften verdanken ihre Existenz gar erst der Beweidung. Vor allem aber verandert sich durch diese zunachst die Zusammensetzung des Ri:ihrichtgUrtels und der Deckungsgrad der GroBseggenbestande. So ki:innen als typische Beweidungsanzeiger die Pfeilkraut-Gesellschaft mit hohen Deckungsgraden vom lgelkolben (SagittarioSparganietum emersi) sowie aufgrund des verringerten Deckungsgrades der Gro13seggen die sich in den LUcken ansiedelnden Flutrasen und Schlammfluren zahlen (Abb. 30). In dieser Feststellung liegt die Mi:iglichkeit, mittels palaoi:ikologischer Untersuchungen an Seesedimenten neben der Rekonstruktion der regionalen Vegetation in der Umgebung auch Dynamik, Art und lntensitat der Beweidung in der Vergangenheit zu erfassen.
Als Beispiel seien die ersten Ergebnisse aus dem Profil Weihe, zwischen Kamennyj Ambar und Zurumbaj gelegen, genannt (Abb. 31). Die tiefsten Pollen proben (Abb. 32) belegen eine ungesti:irte Gewasservegetation, die keine Hinweise auf einen starkeren Beweidungseinfluss gibt, wobei aufgrund einer natUrlichen Beweidung mit Wildtieren natUrlich immer mit einer gewissen Beeinflussung der Vegetation zu rechnen ist Die Prozentwerte der Weide (Salix spec.) sind vergleichsweise hoch, denn erstaunlicherweise sind in allen bislang untersuchten Pollendiagrammen nur niedrige Werle nachweisbar, und das, obwohl Salix aufgrund der Untersuchung der rezenten Vegetation an wenig beweideten Gewassern eine groBe Rolle gespielt haben dUrfte und auch heute dort haufig anzutreffen ist Die folgende Zone ist durch deutliche Veranderungen der Gewasservegetation gekennzeichnet Die Werle von Sparganium steigen stark an und sprechen dafUr, dass sich anstelle des Rohrkolben-Ri:ihrichts eine Pfeilkraut-Gesellschaft mit vorherrschendem lgelkolben (Sparganium emersum) entwickelt hat Dies deutet auf einen deutlich starkeren Beweidungsdruck hin. Auch die Werte der Sauergraser (Cyperaceae), in deren Kurve Carex elata und damit die dominierende Art des GroBseggenbestandes enthalten ist, sinkt ab - 2,35 m ab und belegt die Auflichtung der Bestande. Die Werte der Weide sind gleichfalls gesunken. Dagegen treten mit dem Vogei-Kni:i-
121
Freiwasserzone mit submerser Vegetation Stratiotetumaloi<ls
Cicuto-Caricetum pseudocyperi
Typha angusti foMa-Fazies
terich (Polygonum aviculare), dem Breit-Wegerich (Plantago major), dem Ampfer (Rumex indet) und Fabaceae nun Arlen auf, die insgesamt auf eine Betretung der Vegetation schlieBen lassen.
Aber auch das Bild der Steppenvegetation verandert sich durch Beweidung: lhre Nutzung fUhrt zu einer Erhi:ihung des Chenopodiaceen-Anteils, wie die pflanzensoziologische Erhebungen im Gebiet eindeutig belegen konnten. Prinzipiell gilt das Verhaltnis von Artemisia zu Chenopodiaceae in der Literatur54
zum einen als Hinweis auf klimatische Veranderun gen, zum anderen ist es Kennzeichen unterschiedlicher Steppentypen. In den trockenen Steppenzonen Uberwiegen die Chenopodiaceae, wahrend in den feuchteren Gebieten Artemisia vorherrscht Klimatische Verschiebungen des Feuchtegrades bewirken demnach auch eine Verschiebung des Verhaltnisses von Artemisia zu Chenopodiaceae und werden in Pollendiagrammen daher allgemein klimatisch gedeutet Daneben fUhren aber auch Zersti:irungen bzw.
54 Tarasov u. a. 1998.
Abb. 29. Karagajly-Aiat. Vegetation sz on ie rung am ,Fernseh-See" am 11.07.2009. Der rote Punkt markiert die Entnahmestelle des Pollenproflls (Entwurf R. Wittig).
Abb. 30. Karagajly-Ajat. Vegetationszon ierung an einem stark beweideten Gewasser. Die GroBseggen (Carex elata) sind stark verbissen und dadurch grdBere Lucken zwischen den Bullen entstanden. lm Vordergrund hat sich bereits eine SchlammfiurGesellschaft entwickelt (Foto 2009).
122
Abb. 31. Karagajly·Ajat. Lokalitat
,Weihe". Hier konnte aus dem zentralen
Bereich, der nahezu 100 % Deckungsgrad
von Carex elata aufwies, ein 3 m machtiges ProAl
geborgen werden (Foto 2009) .
Beweidung zu vergleichbaren Vegetationsanderungen, 55 auch bei anhaltend gleichbleibenden Klimaverhaltnissen. In einer intensiv genutzten Landschaft wie der westsibirischen Grassteppe so lien daher erstmal fi.ir schwankende Verhaltnisse zwischen Artemisia und Chenopodiaceae anthropozoogene Ursachen in Erwagung gezogen werden. In den Pollenprofilen, vor allem im Profil Weihe (Abb. 31), zeigen sich mehrfach Schwankungen in den entsprechenden Pollenkurven und ein RUckgang von Artemisia und eine Zunahme der Chenopodiaceae ist genau zu dem Zeitpunkt zu beobachten, der auch den Beginn der Veranderungen der Gewasservegetation markiert. Besanders deutlich ist der Riickgang von Artemisia in einer Tiefe von 2,50 m erfasst. In dieser Zone treten zudem Pollenkorner auf, die zum Getreide-Typ zahlen. lnwieweit es sich wirklich urn Pollenkorner von angebauten Getreidearten handelt, oder ob diese moglicherweise auch von Wildgrasern stammen (z. B. produzieren einige Agropyron- und flymus-Arten ahnlich groBe Pollenkorner wie Getreide), ist naher zu priifen. Entsprechendes gilt fUr die Frage, ob die Wechsel zwischen Artemisia und Chenopodiaceae als Hinweise auf eine Nutzung der Steppe im Untersuchungsgebiet gedeutet werden konnen, oder als Ausdruck veranderter Feuchteverhaltnisse zu interpretieren sind. Die sich in Bearbeitung befindende radiometrische Altersbestimmung werden die notwendige Verkniipfung mit der Siedlungsgeschichte erbringen. Die pollenanalytischen Untersuchungen belegen aber in jedem Fall, dass sich die botanische Diversitat im Laufe der Zeit verandert hat. Ausgehend vom relativ artenarmen Atlantikum zeigt sich eine zunehmende Artenvielfalt, die zweifelsfrei auf menschliche Aktivitaten wie Viehhaltung etc. zuriickgefi.ihrt werden kann.
Bereits in diesem friihen Stadium der Arbeiten haben die Untersuchungen der heutigen Vegetation,
55 Liu u. a. 2006.
Rudiger Krause u. a.
die Analysen der Makroreste aus den Siedlungsbefunden sowie die pollenanalytischen Arbeiten (onund offsite) gezeigt, dass mit der Kombination dieser Disziplinen Einblick in das Zusammenspiel MenschUniwelt gewahrt werden kann. Die laufenden Analysen der heutigen, noch verhaltnismaBig naturnahen Vegetation versprechen die Herausarbeitung eines detaillierten Beziehungsgeflechtes zwischen Pflanzengesellschaften und anthropo-zoogenen Aktivitaten. Floristisch konnte bereits jetzt eine Reihe von Pflanzenarten lokal als aussagekraftige lndikatorpflanzen fi.ir die archaobotanische Rekonstruktion friiherer Umweltverhaltnisse festgelegt werden.
Das ve rkohlte Pflanzen material aus der archaologischen Ausgrabung erweist sich als sehr artenreich und relativ gut erhalten. Auch wenn die meisten der identifizierten Arten aus der Federgrassteppe stammen, deutet die Auswahl einiger Arten, vor allem die von nicht kultivierten HUisenfriichten, auf eine gezielte Sammelpraxis der bronzezeitlichen Menschen hin.
Die ersten palynologischen Auswertungen zeigen, dass im Tal des Karagajly-Ajat wahrend des gesamten Holozans mit einer typischen Steppenvegetation mit der Dominanz von BeifuB (Artemisia), aber mit wechselnden Waldanteilen zu rechnen ist. lm friihen Holozan (die alteste bislang 14C-datierte Ablagerung entstand etwa 7500 BP) ze igen sich relativ artenarme Pollenspektren, die im Laufe der Zeit artenreicher werden. Sowohl im regionalen als auch im lokalen Pollenniedersch lag treten dann ausgepragte Veranderungen auf, die nach bisherigem Kenntnisstand mit anthropo-zoogenen Aktivitaten zusammenhangen .
Weitere naturwissenschaftliche Untersuchungen
Von russischen Kollegen werden weitere naturwissenschaftliche Untersuchungen durchgefi.ihrt und ve rschiedene Materialgruppen bearbeitet. An dieser Stelle wollen wir auf der Grundlage ihrer Arbeitsberichte kurze Oberblicke und Ergebnisse zusammenfassen.
Die archaozoologischen Funde aus Kamennyj Ambar umfassen bislang mehr als 20.000 Knochen, von denen ein erster Teil aus den sintasta-zeitlichen Schichten der Ausgrabungen 2005/2006 unter der Leitung von Dr. P. Kosincev (Ekaterinburg) untersucht wurden. Das Knocheninventar setzt sich folgendermaBen zusammen: 51% Rinder, 38% kleines Hornvieh (Schaf/Ziege) sowie 5 % Pferdeknochen . Die Rinder wurden im Alter zwischen 0,5 und 4,5 Jahren regelhaft im Friihling geschlachtet, wahrend das kleine Hornvieh in jedem Alter (zumeist aber unter 2 )ahren) Uberwiegend im Herbst geschlachtet wurde. Die Bearbeitung des archaozoologischen Materials hat zwar gerade erst begonnen, doch verspre-
-
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
chen die auf3erordentlichen Ergebnisse bereits jetzt einen weiteren wichtigen Zugang zur Rekonstruktion der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Urnwelt in dieser Region.
Ebenfalls unter der Leitung von Dr. P. Kosincev wurden durch russische Biologen vom lnstitut fUr Pflanzen- und Tieri:ikologie erste Untersuchungen vor Ort durchgefUhrt, Proben fUr Phytolith-Analysen gesammelt und der Anteil an Kleinstlebewesen geschatzt Die vorlaufigen Phytolith-Analysen zeigen, dass die Kulturschichten im Siedlungsbereich wahrend klimatisch warmer Rahmenbedingungen entstanden sind und die Steppenflora dominierte. Das Vorkommen von Diatomeen (Kieselalgen) in allen Proben ist ungewi:ihnlich und bedarf noch weiterer Untersuchungen.
Unter der Leitung von Prof. Dr. V. V. Zajkov (Miass) wurden die geologischen Forschungen auf die Suche nach Mineralvorkommen - vor allem Erz -konzentriert. Dabei lief3en sich zahlreiche Lagerstatten unterschiedlicher Mineralien (Gold, Chrom, Naturbaustein) und von Kupfererz lokalisieren, die mi:iglicherweise bereits in prahistorischer Zeit ausgebeutet wurden. Basierend auf dem jetzigen Kenntnisstand ist ferner anzunehmen, dass in der Bronzezeit Ultrabasit-Erze fUr die Kupfererzgewinnung genutzt wurden.
Zudem konnten durch die russischen Geologen insgesamt 201 Steinartefakte aus Kamennyj Ambar petrographisch analysiert werden. Das Ergebnis dieser Untersuchungen zeigt, dass 24 Typen lokalen Gesteins und von Mineralien fUr die Herstellung von Steingeraten genutzt wurden, die fUr unterschiedliche Zwecke vorgesehen waren. Durch diese grof3e Varietat und Anzahl der verwendeten Mineralien, die aile aus der naheren Umgebung stammen, unterscheidet sich Kamennyj Ambar/Ol'gino von den anderen sintasta-zeitlichen Siedlungen.
Ausblick
Die neuen, interdisziplinaren archaologisch-naturwissenschaftlichen Forschungen im Transural gelten einer bronzezeitlichen Siedlungskammer im Tal des Karagajly-Ajat, wo in der Siedlung Kamennyj Ambar/ Ol'gino seit 2005 Ausgrabungen unserer russischen Partner stattfinden und die seit 2008 als deutschrussisches Kooperationsprojekt durchgefUhrt werden. Die befestigten Siedlungen im Transural datieren an die Wende vom 3. zum 2. Jt v. Chr. und gehi:iren der frUh- bzw. mittelbronzezeitlichen Sintasta-Kultur an.
Die Siedlung Kamennyj Ambar/Ol'gino hat einen rechteckigen Grundriss und besteht aus zwei Teilen. Das von A. Patzelt erstellte Magnetogramm zeigt eine von ca. 25 Hausern regelhaft bebaute
Flache im Norden (Abb. 14; 33), die in vier Reihen, durch zwei kleine Wegeachsen getrennt, wabenfi:irmig aneinander gebaut wurden. Die zum Fluss hin gelegene SUdhalfte weist demgegenUber keine erkennbaren Hausgrundrisse auf, sondern vielmehr zahlreiche runde und unregelmaf3ige Anomalien, die derzeit als Anhaufungen von Gruben gedeutet werden (Abb. 14). Damit liegt in der SUdhalfte eine deutlich geanderte Struktur und Nutzung der Flache vor, die wir derzeit ohne die geplante archaologische Erschlief3ung kaum erklaren ki:innen. Noch haben wir keine Anhaltspunkte dazu, ob beide Siedlungsteile gleichzeitig errichtet wurden und bestanden haben. Denkbar waren wirtschaftliche und handwerkliche Aktivitaten , die zahlreiche Eingriffe in den Boden mit sich brachten. Erst zukUnftige Ausgrabungen werden weitere Aussagen ermi:iglichen.
Die unterschiedlichen Siedlungsformen (rund, oval, rechteckig) haben in der russischen Forschung zu der Annahme gefUhrt, dass sich darin chronologische Abfolgen verbergen. Die Umzeichnungen nach alten Luftbildern durch I. M. Batanina 56 stellte einen ersten wichtigen Schritt in der Erfassung ihrer Formen und der Binnengliederung (Hausgrundrisse) der 21 bekannten Siedlungen dar. In unserem Arbeitsgebiet zeigen die neuen Magnetogramme der drei Siedlungen allerdings, dass die ursprUngliche zeichnerische Rekonstruktion der Siedlungsplane nur in ersten Ansatzen der Realitat entspricht und deshalb nur bedingt eine Grundlage fUr weiterfUhrende Untersuchungen darstellen. In den Magnetogrammen sind aile Hausgrundrisse und Details, wie etwa die Brunnen und andere Gruben, erkennbar. Diese neuen Daten eignen sich gut fUr Oberlegungen zu Populationsmodellen und allgemeinen Modellen zur Struktur der Gesellschaft. Die Anzahl von Hauseinheiten (Abb. 33) (Kamennyj Ambar 25/26, Konopljanka 21) ermi:iglichen die Rekonstruktion von Bevi:ilkerungsgri:if3en, die pro Siedlung in einer Gri:if3enordnung von rund 200-300 Personen gelegen haben dUrfte. Diese Daten bilden eine wichtige Grundlage, um modellhaft Oberlegungen zur Bevi:ilkerung im Umfeld oder Einzugsbereich einer Siedlung anzustellen und um letztendlich eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Menschen in dem Gebiet der befestigten Siedlungen (Abb. 3) gelebt haben ki:innten.
Die vegetationsgeschichtlichen Untersuchungen haben das enorme Potential der Feuchtbodenarchive offenbart, die fUr eine Rekonstruktion der Nutzung der Steppe fUr die Herden und die lntensitat des Eingreifens des Menschen Voraussetzung sind. Dabei zeigen sich bereits jetzt markante Phasen im Pollendiagramm, bei denen der Wechsel zwischen Artemisia und Chenopodiaceae als Hinweise auf eine
123
124
41daa
Rudiger Krause u. a .
... Abb. 32. Karagajly·Ajat. Lokalitat , Weihe". Ve reinfachtes vorlaufiges Pollen· diagramm.
Nutzung der Steppe im Untersuchungsgebiet gedeutet werden ki.innen.57 Andererseits gilt es zu prOfen, inwieweit diese auch als Ausdruck veranderter Feuchtverhaltnisse zu interpretieren sind. Erstmals wurden auf einer Ausgrabung im Gebiet der befestigten Sintasta -Siedlungen im Transural systematisch Kulturschichten geschlammt und verkohlte botanische GroEreste gesichert. Bislang fehlen dabei die ,gesuchten" Getreideki.irner. lm Gegensatz dazu sind Pollenktirner vom Getreide-Typ nachgewiesen, doch steht die zeitliche Einordnung der entsprechenden Schichten noch a us. Handelt es sich dabei tatsachlich um Pollenki.irner von angebauten Getreidearten , oder stammen diese mi.iglicherweise auch von Wildgrasern? Es bleibt also eine span nende Frage, ob in dieser Zeit bereits Getreide angeba ut wurde oder nicht.
Die Siedlung Kamennyj Ambar/OI'gino wurde von einer Befestigu ng begrenzt, die aus einem Graben und ei ner Mauer oder einem Wall aus Lehmbli.icken und einer Konstruktion aus Lehm und Holz bestand. Die AuEenseite der Umfassungsmauer war zudem auf einer Hi.ihe von mindestens zwei Metern mit Stein platten verkleidet. Die Hauser der SintastaSiedlung wurden aus Lehm (Wande) und Holz errichtet und besaEen regelhaft rechteckige Grundrisse. Eine Besonderheit stellen die Brunnen innerhalb der Grundrisse dar, die viele Fragen aufwerfen. Denn es ki.innen bis zu vier Brunnen innerhalb eines Hausgrundrisses liegen, die verschiedenen Bauphasen angehi.iren di.irften . Bislang wurde bei fri.iheren Ausgrabungen der Freilegung und Dokumentation der Brunnen kein groEer Stellenwert beigemessen . Heute haben wir die Chance, durch eine entsprechende Ausgrabung der Brunnen viet mehr lnformationen i.iber die Siedlung und das Siedlungsgeschehen zu erzielen. Durch die Feuchtbodenerhaltung enthalten sie in organischen Materialien oder als Pollenfanger wichtige Daten und lnformationen fi.ir die Rekonstruktion der Lebensverhaltnisse. So stellt sich etwa die Frage, ob die z. T. relativ graBen Hausflachen vollstandig i.iberdacht waren oder ob ein Teil dieser Flache auch als offener Hof fungieren konnte. Nicht zuletzt stellen sie eine wichtige Grundlage fi.ir die Wasserversorgung dar, und obwohl der Fluss in unmittelbarer Nachbarschaft liegt, mi.issen sie als Wasserspeicher eine wichtige Rolle gespielt haben. Eine
57 Derzeit stehen die Datierungen noch aus, die von Dr. B. Kromer in Mannheim angefertigt werden.
-
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
Uberlegung konnte etwa sein, dass die Brunnen fUr die Wasserversorgung in der kalten Jahreszeit auch fUr Tiere genutzt wurden. lnwieweit jedoch Tiere auch innerhalb der Hauseinheiten zumindest saisonal gehalten wurden und es somit eine Unterteilung in Wohn- und Stallbereiche gegeben haben konnte, ist mangels archaologischer Befunde noch unbekannt
Unter den wirtschaftlichen Aktivitaten spielte zweifellos die Viehhaltung eine groBe Rolle. Unter den zahlreichen Tierknochen finden sich Rinder, Schafe, Pferde und in geringer Anzahl auch das Schwein. Landwirtschaft konnte dagegen bislang noch nicht nachgewiesen werden, doch werden gerade hier die laufenden Untersuchungen an verkohlten GroBresten (Samen und Friichte, usw.) aus den Siedlungsschichten und die palnyologischen Untersuchungen von Feuchtsedimenten (Brunnen, Seen) sicherlich in absehbarer Zeit wichtige neue Erkenntnisse liefern und damit neue Grundlagen schaffen.
In den archaologischen Hinterlassenschaften nehmen Reste und Produkte metallurgischer Tatigkeiten in Form von Ofenfragmenten, Schlacken, Gussresten, Halbfabrikaten und Fertigprodukten einen erheblichen Anteil ein. Wir diirfen davon ausgehen, dass in den Sintasta-Siedlungen die Kupferverarbeitung eine wichtige Rolle spielte, wobei ihre Form und Organisation innerhalb der Siedlung noch unklar ist
Die zahlreichen Keramikfunde in Kamennyj Ambar weisen in der horizontalen wie auch in der vertikalen Verteilung darauf hin, dass es zwei Belegungsphasen gab. Gegriindet und errichtet wurde
die befestigte Siedlung in der Sintasta-PetrovkaPhase, wobei das wahl jiingere Petrovka-Eiement im Siedlungsbereich praktisch nicht nachweisbar ist Eine jiingere Besiedlungsphase der spaten Bronzezeit ist durch Keramik vom Typ Srubno-Aiakul' belegt Diese gehort jedoch in eine Zeit, als die befestigte Sintasta-Siedlung bereits aufgelassen war. Dieser jiingeren Phase werden die zahlreichen runden, muldenformigen Eintiefungen zugeordnet, die iiber das ganze Siedlungsareal und dariiber hinaus streuen. Soweit ausgegraben und erkennbar, gibt es im Bereich dieser muldenformigen Eintiefungen keine architektonischen Elemente wie Pfostenlocher oder Steinsetzungen, die mit der Architektur eines Hauses in Verbindung gebracht werden konnten. Vielleicht waren es auch runde Zelte, die in muldenfi:irmigen Vertiefungen aufgestellt wurden und eine Riickkehr zu alten Wohn- und Siedlungsformen erkennen lassen?
Es bestehen - wie die zuletzt formulierte -zahlreiche offene Fragen zur Genese und zur Struktur der befestigten Siedlungen und der Gesellschaft der Sintasta-Kultur, deren Klarung zum Verstandnis dieser bemerkenswerten bronzezeitlichen Kultur im Transural beitragen wird. Hier am Nordrand des graBen eurasischen Steppengiirtels (Abb. 1), an einer wichtigen Schnittstelle zwischen Ost und West, haben sie in einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne am Ubergang vom 3. zum 2. Jt v. Chr. ihre deutlichen Spuren im Boden hinterlassen. Das neue deutsch-russische Kooperationsprojekt hat die groBe Chance, durch seine interdisziplinare Ausrichtung wesentliche neue Grundlagen zum Verstandnis von
125
Abb. 33. Kamennyj Ambar/ Ol'gino. Rekonstruktion der befestigten Siedlung auf der Grundlage der Grabungsbefunde und der geomagnetischen Messungen (Graphik ArcTron 30, M. Schaich, 2009) .
126
Gesellschaft, Entwicklung und Geschichte der Sintasta-Kultur zu schaffen.
Die deutsch-russische Arbeitsgruppe
Goethe-Universitiit Frankfurt u. a.: Prof . D r . R U d i g e r Krause, PD Dr . Jochen Fornasier, Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr . RUdiger Wittig, Dr. Arie J. Kalis, Dr. Astrid Stobbe, Andres Konig, Dipl.-Biol., David Knoll, stud. phil., Lisa RUhl, stud. phil.,
Prof. Dr. Joachim Burger, Universitat Mainz Prof. Dr. Ernst Pernicka, Universitat TUbingen und CEZ Archaometrie, Mannheim Dr. A r no Pat zeIt, Terrana Geophysik, Miissingen Martin S c h a i c h, M.A., ArcTron 3D GmbH, Altenthann
Russische Akademie der Wissenschaften (RAN): Prof. Dr. Ludmila N. Korjakova, lnstitut fUr Geschichte und Archaologie, RAN, Ekaterinburg Dr. Pave I A. Kosin c e v, lnstitut fUr Pflanzen- und Tieriikologie, RAN, Ekaterinburg Dr . VI ad is I a v V. Nos k e vic, lnstitut fUr Geophysik, RAN, Ekaterinburg Dr. So fi j a E. Pant e I e eva, lnstitut fUr Geschichte und Archaologie, RAN, Ekaterinburg Dr. Svetlana V. Sarapova, lnstitut fUr Geschichte und Archaologie, RAN, Ekaterinburg Ivan V. Molcanov BA, cand. phil., lnstitut fUr Geschichte und Archaologie, RAN, Ekaterinburg Olga. V. Mikrjukova, M.A., Staatliche Ural-Universitat Ekaterinburg Alexei ju . Rassadnikov, BA, Staatli che Ural-Universitat Ekaterinburg
Dr. I j a M . Bat ani n a, Staatliche Universitat Ce ljab in sk Dr. Natalja A. Berseneva, lnstitut fU r Geschichte und Archaologie, RAN, Celjabinsk Dr. Andrej V. Epimachov, lnstitut fUr Geschichte und Archaologie, RAN, Celjabinsk Dr . N e IIi V. Levit, Staatliche Universita t Celjabinsk Igor V. C e c u k o v BA, Staatliche Universitat Ce ljabinsk Prof. Dr. Viktor V. Zajkov, lnstitut fUr Mineralogie, RAN, Miass Dr . An a to I ij M . J u min ov, lnstitut fUr Mineralogie, RAN, Miass
Abb i ld u n gsnachwe ise:
Sofern nicht anders bezeichnet, Stammen aile Abbildungen aus dem Ural-Projekt der Goethe-Universitat Frankfurt und der Akademie der Wissenschaften in Ekaterinburg.
Literaturverzeichnis
Abkiirzungen
1!1A PAH - lnstitut fUr Archaologie der Russischen Akademie der Wissenschaften (Moskau)
1!11!1~A YpO PAH - lnstitut fUr Geschichte und Archaologie der Ural-Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften (Ekaterinburg)
RUdiger Krause u. a.
111noc CO PAH - lnstitut fUr die Probleme der ErschlieBung des Nordens der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften, Tjumen'
nAI!1 '--leniY - Laboratorium fUr archaologische Forschungen der Staatlichen Universitat Celjabinsk
PIH<t> - Russische Stiftung fUr Geistes- und Sozialwis-senschaften
'--llnY - Staatliche Padagogische Universitat Celjabinsk '--leniY - Staatliche Universitat Celjabinsk IOYpiY - Staatliche SUd-Ural Universitat (Celjabinsk)
Archivalien
B~HorpaAOB 2003 H. 5. B~HorpaAOB, 1990-A. OTYeT o noneBbiX ~ccneAOsaH~Rx B KypraHCKO~ ~ 4enR6~HCKO~ o6naCTRX s 1990 r. '--lenR6~HCK, 2003 . Apx~s 1!1A PAH.
3A3HOB~Y 1992 I. 5. 3A3HOB~Y, 1992-A. 0TY8T 06 apxeonor~YBCKOM 06Cn8AOB3H~~ naMRTH~KOB 3nOX~ 6pOH3bl '--lenR6~HCKO~ o6nacT~ B 1992 r. Apx~s nAI!1 '--leniY.
En~Maxos 2007 A. B. En~Maxo8, 0TYeT o6 apxeonor~YecK~x pacKonKax yKpenneHHoro noceneH~R KaMeHHbl~ AM6ap 8 2005 r. (EKaTep~H6ypr 2007). Apx~8 1!11!1~A YpO PAH.
KopRK08a 2009 n. H. KopRK08a, 0TY8T o6 apxeonor~YBCK"'X paCKOnKax yKpenneHHOro noceneH~R KaMeHHbl~ AM6ap (Onbr~Ho) 8 2007 r. (EKaTep~H6ypr 2009) . Apx~8 1!11!1~A YPO PAH.
KOCTIOK08 1992 B. n. KOCTIOK08, 0TYBT 0 non88biX apxeonor~YBCK~X ~ccneA08aH~Rx 8 KapTan~HCKOM ~ Hara~6aKCKOM pa~oHax '--lenR6~HCKO~ o6naCT~ 8 1992 rOAY ('--lenR6~HCK 1992) . Apx~8 1!1A PAH.
KocTIOK08 1993 B. n . KOCTIOKOB, 1992-A. 0TY8T 0 none8biX apxeonor~YBCK~X ~ccneA08aH~Rx B KapTan~HCKOM ~ Hara~6aKcKOM pa~OH3X '--lenR6~HCKO~ 06naCT"' B 1992 fOAY ('--lenR-6~HCK 1993). ApX"18 1!1A PAH.
Tapaco8 1983 10. B. Tapacos, 1982-A. OTYeT o6 apxeonor"'YBCKO~
pa38BAKB 8 KapTan~HCKOM pa~oHe '--lenR6~HCKO~ o6-naCT~ 8 1982 fOAY ('--lenR6~HCK 1983). Apx~8 1!1A PAH.
Wapano8a 2007 C. B. Wapano8a, 0TYBT o pacKonKax noceneHVIR KaMeH
Hbl~ AM6ap (OnbrVIHO) 8 2006 r. (EK3T8pVIH6ypr 2007). Apx~8 li11!1VIA YpO PAH.
Wapano8a 2009 C. B. Wapano8a, OTYeT o pacKOnKax noceneHVIR KaMeH
Hbl~ AM6ap (Onbr~Ho) 8 KapTMVIHCKOM pa~oHe '--lenR-6"!HCKO~ 06naCT"' 8 2008 r. (EK3T8p"'H6ypr 2009). ApX"18 li11i1"1A YPO PAH.
Literatur
Anthony/Vinogradov 1995 D. W. Anthony/N. B. Vinogradov, Birth of the Chariot. Excavations of the Ural Mountains reveal traces of the first two-wheeled, high-performance vehicles. Archaeol
ogy 48, 2, 1995, 36-41.
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
Beck u. a. 2007 A. Beck/G. Philip/M. Abdulkarim/D. Donoghue, Evaluation of Corona and lkonos high resolution satellite imagery for archaeological prospection in western Syria. Antiquity 81, 2007, 161-175.
Casana/Cothren 2008 J. Casana/J. Cothren, Stereo analysis, DEM extraction and orthorectification of CORONA satellite imagery: Archaeological applications from the Near East. Antiquity 82, 2008, 732-749.
Chernych 1998 E. N. Chernych, Kargaly: Les plus grand ancien complexe minier et de metallurgie a Ia frontiere de !'Europe et de I'Asie. In : M.-Ch. Frere-Sautot, Paleometallurgie des caivres. Actes du colloque de Bourg-en-Bresse et Beaune 17- 18 octobre 1997 (Montagnac 1998) 71 - 76.
Dahlmann 2009 D. Dahlmann, Sibirien. Vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Paderborn 2009).
Epimakhov/Koryakova 2004 A. Epimakhov/L. Koryakova, Streitwagen der eurasischen Steppe in der Bronzezeit: Das Wolga-Uralgebiet und Kasachstan. In : M. Fansa/S. Burmeister (Hrsg.), Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa (Mainz 2004) 221-236.
Fornasier/Kra use 2010 J. Fornasier/R. Krause, Archaologische Spurensuche in Westsibirien . Frankfurter Wissenschaftler initiieren neues Forschungsprojekt zur Bronzezeit. UniReport. GoetheUnivers itat Frankfurt am Main 1, 2010, 3-4.
Hanks/Doonan 2009 B. Hanks/R. Doonan, From Scale to Practice: A New Agenda for the Study of Early Metallurgy on the Eurasian Steppe. World Preh istory 22, 2009, 329- 356.
Hanks u. a. 2007 B. K. Hanks/A. V. Epimakhov/A. C. Renfrew, Towards a refined chronology for the Bronze Age of the southern Urals, Russia. Antiquity 81, 2007, 353-367.
Hanks u. a. im Druck B. Hanks/C. Merrony/A. Epimakhov/L. Koryakova, A Geophysical Prospection of Middle Bronze Age Settlement and Cemetery Organisation in the South-eastern Urals, Russian Federation. In: Archaeological Prospection (im Druck).
Koryakova/Epimakhov 2007 L. Koryakova/A. Epimakhov, The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages (Cambridge 2007).
Krause/Koryakova 2010 R. Krause/ L. N. Koryakova, Nomaden oder Bauern als frlihe Streitwagenfahrer? Archaologie in Deutschland 1, 2010, 14-19.
Kremenetski u. a. 1997 C. V. Kremenetski/P. E. Tarasov/A. E. Cherkinsky, The Latest Pleistocene in Southwestern Siberia and Kazakhstan. Quaternary International 41/42, 1997, 125- 134.
Kretinin 2004 V. M. Kretinin, Eroded soils in Chelyabinsk Oblast. Eura· sian Soil Science 39, 2004, H. 8, 885 - 891.
Littauer/Crouwell 1996 M. A. Littauer/J. H. Crouwell, The origin of the t rue chariot. Antiquity 70 (270), 1996, 934- 939.
Liu u. a. 2006 H. Liu/Y. Wang/Y. Tian/J. Zhu/H. Wang, Climatic and anthropogenic control of surface pollen assemblages in East Asian steppes, China, Review of Palaeobotany and Palynology 138, 2006, 281-289.
Merrony u. a. 2009 C. Merrony/B. Hanks/R. Doonan, Seeking the Process: The Application of Geophysical Survey on some Early Mining and Metalworking Sites In: T. Kienlin/B. Roberts (Hrsg). Metal and Societies. Studies in honor of Barbara S. Ottoway (Bonn 2009) 421-431.
Parcak 2007 S. Parcak, Satellite remote sensing methods for monitoring archaeological tells in the Middle East. Journal of Field Archaeology 32, 2007, 65-81.
Parzinger 2006 H. Parzinger, Die frlihen Volker Eurasiens. Vom Neolithi kum bis zum Mittelalter (Mlinchen 2006).
Penner 1998 S. Penner, Schliemanns Schachtgraberrund und der europaische Nordosten: Studien zur Herkunft der frlihmykenischen Streitwagenausstattung. Saarbrlicker Beitrager zur Altertumskunde 60 (Bonn 1998).
Plekhanova/Demkin 2008 L. N. Plekhanova/V. A. Demkin, Paleosols of Kurgans of the Early Iron Age in the Transura l Steppe Zone. Eurasian Soil Science 41, 2008, H. 1, 1-12.
Tarasov u. a. 1997 P. E. Tarasov/D . Jolly/J. 0. Kaplan, A continuous Late Glacial and Holocene record of vegetation changes in Kazakhstan. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 136, 1997, 281-292.
Tarasov u. a. 1998 P. E. Tarasov/R. Cheddadi/J. Guiot/S. Bottema/0 . Peyron/ J. Belmonte/V. Ruiz-Danchez/F. Saad i/S. Brewer, A method to determine cool and warm biomes from pollen data; application to the Mediterranean and Kazakhstan regions. Journal of Quaternary Science 13, 4, 1998 335-344.
Zaykov u. a. 1999 V. V. Zaykov/A. P. Bushmakin/A. M. Yuminov/E. V. Zaykova/G. B. Zdanovich/A. D. Tairov/R. J. Herrington, Geoarchaeological research into the histo rical relics of the South Urals : problems, results, prospects. In: A. M. Pollard (Hrsg.), Geoarchaeology: exploration, envi roments, resources (London 1999) 165-176.
Zaykov u. a. 2005 V. V. Zaykov/A. M. Yuminov/A. Y. Dunaev/G. B. Zdanovich/S. A. Grigoriev, Geo-Mineralogical Studies of Ancient Copper Mines in the Southern Urals. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Euras ia 4, 2005, 101 -114.
Zykin u. a. 2000 V. S. Zykin/V. S. Zykina/L. A. Orlova, Stratigraphy and the Major Regularities in Environmental and Climatic Changes in the Pleistocene and Holocene of Western Siberia Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 1, H. 1, 2000, 3- 22 .
Bacl-lnbes u. a. 1994 Ill. 6. Bacl-lnbeB(n . <l> . KyaHeljoB/A. n. CeMeHOBa, noTanoBCKI-1Ci KypraHHblei MOrl-1nbHI-1K 1-1HA0!-1paHCKI-1X nneMeH Ha Bonre (CaMapa 1994).
127
128
BI-1HOrpaAOB 2007 H. 5. BI-1HorpaAOB, KynbTYPHO-I-1CTOp!-1YecK!-1e npoueccbl s cTenRx IQ)I(HOro Ypana 1-1 Ka3axcTaHa s HBYBJle II TbiC. AD H.3. (naMRTHI-1KI-1 Ci-1HT8WTI-1HCKOrO 1-1 neTpOBCKOrO Tl-1na): AsTOpecjJ . A1-1CC. AOKT. 1-1CT. HayK. (MOCKBB 2007).
reHI-1Hr u. a. 1992 B. <t>. reHi'IHr/r. 5 . 3ABHOBI'IY/B. B. reHI-1Hr, Ci-1HTBWTa. Apxeonor!-1YeCKI-1e naMRTHI-1KI-1 ap!-1~CKI-1X nneMeH YpB1lOKa3axcTaHCKi'IX CTene~. ToM 1 (4enR6!-1HCK 1992).
,QepraYes/50YKapes 2002 B. A. ,QepraYes/B. C. 5oYKapes, MeTBJllli'IYecKI'ie cepnbl n03AH8~ 6pOH3bl BOCTOYHO~ Esponbl (Ki-1Wi'IH8B 2002).
3a~KOB U. a. 2009 B. B. 3a~Kos/A. M. IOMi'IHOB/B. A. KoTilRpos/E. B. 3a~Kosa/E. ~- 4ypi'IH, 0TY8T 06 i'ICC118AOBBHI'IRX no TSMS «3noxa 6poH3bl cesepa ueHTpBilbHO~ Espa31'ii'l>>, pa3Ae11 «MI-1H8p81lbHO-Cblpb8BBR 6a3a 6pOH30BOrO BSKB HB IQ)I(HOM YpBile». In: n. H. KopRKOBB, 0TY8T 0 paCKOnKax yKpenneHHoro noceneHi'IR KaMeHHbl~ AM6ap (Onbri'IHO) s 2007 r. npi'1110)1(8Hi'l8 5 (EKaTepi'IH6ypr 2009).
3ABH0Bi'IY 1995 r. 5 . 3ABH0Bi'IY, ApaKi'IM: api'li'l HB YpBile i'llli'l HSCOCTORBWBRCR l.li-1Bi'llll-138l.li-1R. In: ApKai'IM: ~CC118AOB8HJ.1R .
noJ.1CKJ.1 . 0TKpbiTJ.1R (4811R61-1HCK 1995) 21 - 42. 3A8HOBI-1Y 1997
r. 5. 3ABH0Bi'IY, ApKBi'IM - KYilbTypHbl~ KOMnllSKC 3nox1-1 cpeAHe~ 6poH3bl IQ)I(Horo 3aypB1lbR. Pocci'I~CKaR apxeonori'IR 1997, H. 2, 47-62.
3A8HOBI-1Y 2002a r. 5. 3ABHOBJ.1Y, Ypano-Ka3aXCTBHCKI'i8 CTSni'l B 3noxy Cp8AH8~ 6pOH3bl : ABTOpecjJ. A1-1CC. AOKT. 1-1CT. HayK (4811R-6J.1HCK 2002).
3A8HOBW-I 2002b r. 5. 3AaHOBi'IY (Hrsg.), ApKBi'IM: HSKpOnOilb (no MaT8pi'IB11BM KypraHa 25 50JlbW8K8paraHCKOrO MOri'11lbHJ.1-K8) Bd. 1 (4enR6J.1HCK 2002).
Jochen Fornasier Arie J. Kalis RUdiger Krause Astrid Stobbe Johann Wolfgang Goethe-Universitat lnstitut fUr Archaologische Wissenschaften Vor- und FrUhgeschichte GrUneburgplatz 1 D-60323 Frankfurt am Main
Andreas Konig Rudiger Wittig Johann Wolfgang Goethe-Universitat lnstitut fUr Okologie, Evolution und Dive rsitat Abteilung Okologie und Geobotanik SiesmayerstraBe 70 D-60323 Frankfurt am Main
RUdiger Krause u. a.
3ABHOBi'IY/5aTBHJ.1HB 2007 r. 5. 3AaHOBJ.1Y/~ . M. 5aTaHJ.1Ha, ApKai'IM - CTpaHa ropOAOB. npoCTpaHCTBO i'l 06p83bl (4811R6J.1HCK 2007).
En1-1Maxos 2002 A. B. Eni'IMaxos, IQ)I(HOe 3aypB1lbe s 3noxy cpeAHe~ 6pOH3bl (4eJlR61'iHCK 2002).
Eni'IMaxos 2003 A. B. Eni'IMaxos, BepxHe-KJ.131'illbCKI'i~ KllBA - sapi'laHTbl i'IHTepnpeTaui'li'l. Apxeonori'IR, 3THorpacjJi'IR J.1 aHTpononorJ.1R Espa3J.1J.1 4, 2003, 96- 102.
Eni'IMaxos 2005 A. B. Eni'IMaxos, PaHHI'ie KOMnneKCHble o6~eCTsa
Cesepa l...(eHTpBilbHO~ Espa3i'li'l (no MaTepi'lanaM Mori'lllbHI'IKa KaMeHHbl~ AM6ap-5) Bd. 1 (4enR6!-1HCK 2005).
Eni'IMaxos u. a. 2005 A. B. Eni'IMaxos/5. X3HKC/K. P3Hcjlp10, PaAJ.1oyrnePOAHaR XpOHOJlOri'IR naMRTHi'IKOB 6pOH30BOrD BSKa 3aypB1lbR. Pocc!-1~cKaR apxeonori-1R 2005, 4, 92 - 102.
Mypasbes u. a. 2009a n. A. Mypasbes/B. B. HOCK8BJ.1Y/H. B. <t>eAOposa, Pe-3YilbT8Tbl MarHJ.1TOM8Tpi'IY8CKi'IX i'ICC118AOB8HJ.1~ apxeOJ10-rJ.1Y8CKJ.1X naMRTHI-1KOB 3nOXI'i 6pOH3bl Ha IQ)I(HOM YpaJle. YpBilbCKI'i~ reOcjJJ.13i'IY8CKJ.1TH BSCTHI'IK 1, 2009, 44- 52 .
Mypasbes u. a. 2009b n. A. Mypasbes/B. B. HocKeBi'IY/H. B. <t>eAOPOBa, ~HTepnpeTBL.li'IR p83YilbTBTOB MBrHi'ITOMSTpi'IYSCKi'IX i'ICC118AOB8HJ.1H apX80110rJ.1Y8CKi'IX naMATHi'IKOB 3nOXI'i 6pOH3bl Ha IQ)I(HOM YpBile. In : nRTbiS HBYYHbiS YTSHI'IR naMRTI-1 10. n. 6ynawes1-1Ya 2009 r. (EKaTepi'IH6ypr 2009) 237- 240.
CM!-1pHos/Ky3bMJ.1Ha 1977 K. <t>. CMJ.1pHOB/E. E. Ky3bMJ.1Ha, npoi'ICX0)1(A8HJ.18 J.1HAOJ.1-paHues B CB8T8 HOBS~Wi'IX apXSOJlOri'IYSCKi'IX OTKpbiTI'i~
(MOCKBa 1977).
Heinrich Thiemeyer Johann Wolfgang Goethe-Universitat
lnstitut fUr Physische Geographie Altenhtiferallee 1
D-60438 Frankfurt am Main
Ludmila N. Korjakova I van V . Molcano v BA Sof i j a E. Panteleeva
Sv e tlana V. Sarapova Natal ja A. Berseneva Andrej V. Epimachov
lnstitut fU r Geschichte und Archaologie der Urai-Abteilung der Russischen
Akademie der Wissenschaften Rosa-Luxemburg-Str. 56
620026 Ekaterinburg RUS-Russland
Befestigte Siedlungen der Sintasta-Kultur
Summary
Since 2006 a German-Russian research project has conducted scientific archaeological investigations on a Bronze Age settlement chamber in the valley of Karagajly-Ajat (district of Celjabinsk). The project is supported primarily by the German Research Foundation (DFG) and the Russian Foundation for Humanities and Social Sciences (RGNF). There, in the so-called Trans-Ural mountains of west Siberia, the transition from the forest steppe to the steppe, the research team discovered a number of innovations dating to the turn of the third to second millennium BC, whose origin and genesis were hitherto unknown. Particularly at the southern end of the Urals, at first view these phenomena appear as fortified and systematically subdivided settlements of the Sintasta and Petrovka cultures and kurgans with differentiated buria ls in shaft graves. The deceased were interred individually with multi-spiked, twowheeled wagons/chariots and metal artefacts as symbols of their social rank.
The international research team pursued foremost the important and thus far unsolved question of economic basis and the extent of agriculture practiced at the time of the fortified settlements of the Sintasta culture. Agriculture and the postulated cultivation of cereals, together with a developed metallurgy, count as innovations in the steppe, which in turn underscore the high cultural status of these Bronze Age communities within fortified settlements.
Initial excavation campaigns in 2008 and 2009 at the exemplary site of Kamennyj Ambar/OI'gino have provided a plenitude of new data and new or modified lines of inquiry. The article presents the first results of investigations on archaeology, history of vegetation, archaic and recent botany as well as geomorphology and soil science.
Pe3tOMe
C 2008 r OAa 8 paM ax repM8HO-pOCCV1~CKOrO HBy'-mOrO
npo eKTa, s A Ofllf e pe K aparai1nbi·Ai1aT (4enR6V1HCKaR
o6naCTb) , npOBOARTCfl apxeonorV14BCKV1B paCKOnKV1 V1 V1C
CnBAOB8HV1R npV1pOAHbiX YCfiOBI-1i1 B ::mox y 6pOH3bl . 3ABCb,
B 10rD-BOCT04HOM 3aypanbe, r A B fJBCOCTBnb nepeXOAVIT B
CTBnb, HB py6elKe 3-2 TbiC. AO H.3., 38C BV1ABTBnbCTBBH
i.jBnbl~ PRA C8pb83HbiX 1-13MBHBHI-1i1 , n pW-li-1 Hbl KOTOpbiX AO
c~tx nop He nonyY~tnV1 AOCTaT04Horo o 6bRCHBH V1R. AaHHaR
TeppV1TOpV1R 6blna 38CBnBHB HOCI-1TBnRMI-1 KYnbTYP CVI H
TBWTa-neTpOBKB, OCTBBV1BWI-1MV1 noce n BH I-1R 1-1 60nbWOB
KOnV14BCTBO KYPrBHOB c MHOr041-1cneHHbiMI-1 MOr~tnaMV1, B
KOTOpbiX 38XOpOHBHbl n10AV1 BbiCOKOro COI.ji-1BnbHOrD CTa
Tyca C KOnBCHVII.jBMI-1.
MBlKAYHBPOAHBR VICCnBAOBBTBnbCKBR rpynna, cpV1-
H8HCV1pyeMaR repM8HCKV1M V1CCnBAOBBTBnbCKV1M 06wBCT
BOM V1 Pocc~t~CKVIM ryMaH~tTapHbiM Hay4HbiM cj:JOHAOM,
pa60TBBT HBA AO CVIX nop HB p8WBHHbiMV1 npo6nBMBMV1
X03R~CTBB CV1HTBWTV1HCKO~ KynbTypbl. YKpenneHHbiB no
CBnBHVIR, V1HTBHCV1BHOB 3BMnBABnV1B C B03ABnbiBBHV1BM 3Bp
HOBbiX KynbTyp, a TBKlKB p83BV1TBR MBTBflnyprV1R, OTHOCRTCR
K HOBWBCTBBM B CTBnV1, nOA4BpKI-1BBIOWV1MV1 BbiCOKV1~
KYnbTYPHbli1 yposeHb CV1HTaWTV1HCKoro HaceneHI-1R.
B pe3ynbTaTe ~tccneAoBaHV1i1 2008- 2009 rr. Ha no·
CBnBHV1V1 KaMBHHbl~ AM6ap/ 0nbrV1HO nony4BHO MHOrO HO
BbiX ABHHbiX, cywBCTBBHHO AOnOnHRIOwVIX HBWV1 3H8HI-1R
no apxeonor~tV1, naneo60TBHV1KB, reoMopcponor~tV1 V1 no4BO
BBABHV110 perVIOHB V1 ny6ni-1KYBMbiX B ABHHO~ CTBTbB.
Zusammenfassung
Seit 2008 flihrt ein deutsch-russisches Forschungsprojekt archaologisch-naturwissenschaftliche Untersuchungen in einer bronzezeitlichen Siedlungskammer im Tal des Karagajly-Ajat (Oblast' Celjabinsk) durch . Hier in Westsibirien, im sogenannten Transural, finden wir am Ubergang von der Waldsteppe zur Steppe an der Wen de vom 3. zum 2. Jahrtausend eine Rei he von Neuerungen, deren Herkunft und Genese bislang unbekannt sind. VordergrUndig sind dies am sUdi:istlichen Ende des Urals befestigte und systematisch gegliederte Siedlungen der Sintasta- und Petrovka-Kultur, Kurgane mit differenzie rten Bestattungen in Schachtgrabern. Einzelnen lndividuen wurden mehrspeichige, zweiradrige (Streit-)Wagen sowie Meta llartefakte als Kennzeichen ihres sozialen Rangs beigegeben.
Das internationale Forscherteam, das maBgeblich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie der Russischen Stiftung fUr Geistes- und Sozialwissenschaften (RGNF) unterstUtzt wird, verfo lgt vor allem die wichtige und bislang unbeantwortete Frage nach der Wirtschaftsweise und nach der lntensitat von Ackerbau zur Zeit der befestigten Siedlungen der Sintasta-Kultur. Ackerbau und der postulierte Getreideanbau zahlen neben einer entwickelten Metallurgie zu den Neuerungen in der Steppe, die den hohen kulturellen Status dieser bronzezeitlichen Gemeinschaften in den befestigten Siedlungen unterstreichen.
Nach den ersten beiden Feld kampagnen 2008 und 2009 in der exemplarisch ausgewah lten Siedlung Kamennyj Ambar/OI'gino ki:innen wir bereits auf eine FUIIe an neuen Daten und neuen bzw. geanderten Fragestellungen blicken. Diese ersten Ergebnisse zur Archaologie, zur Vegetationsgeschichte, zur Rezent-Botanik und zur Archaobotanik sowie zur Geomorphologie und Bodenkunde werden im vorliegenden Beitrag vorgestellt.
129