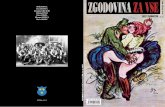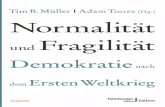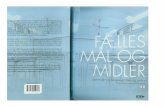"Energetik der Metapher" (Schlussfolgerungen zum ersten Teil). In: Ralph Bisschops. 1994. "Die...
Transcript of "Energetik der Metapher" (Schlussfolgerungen zum ersten Teil). In: Ralph Bisschops. 1994. "Die...
7
DUISBURGER ARBEITENZUR SPRACH- UND
KULTURWISSENSCHAFTDuisburg Papers on Research
in Language and Culture
Herausgegeben vonRen6 Dirven, Martin'Pifiz und Sieffied Jäger
PETER LANGFrankfurt am Main. Berlin . Bem' NewYorl«. Paris. lMen
Band 23
118
t SCHLUSSFOLGERUNGEN ZUM ERSTEN TEIL
8.1 Ricoeurs Vorschlag, das "ist" des metaphorischen Satzes, bzw. diemetaphorische Prädikation als solche, als die eigentliche Metapheranzusehen, erweist sich zusehends als operationell. Durch die Metaphorisie-rung des "ist" sind wir nicht mehr gezwungen, den Fokus im vorhinein aufseine Verträglichkeit mit dem Kontext hin umzudeuten. Sie gestattet folglichdas Erfassen des Bildspenders in all seinen Aspekten, sowohl den phänome-nalen als auch den emblematischen und energetischen.
8.2 Durch seine Metaphorisierung verliert das "ist" seine askriptiveFunlcion. Dennoch möchten wir es, im Gegensatz zu Ricoeur, auch nichtals "ist-wie" aufgefaßt sehen, derur dadurch wird die Funktion derAnni*rteit bei der Metapher überbewertet. Wir fassen das "ist" appositivauf: Es bringt Bildspender und Bildempfänger in eine Relation derNachbarschaft zueinander, wobei dieser von jenem eine Bestimmungerfährt. Die prädikative Funktion der Metapher (im erweiterten Sinne derBestimmung) wird also beibehalten.
8.3 Wir wehren uns gegen die herkömmliche Vergleichstheorie ausfolgendem Grund: Es gehört nicht zur Funktiol! der Metapher, aufÄhnlichkeiten als solche hinzuweisen. Falls eine Ahnlichkeit offensichrlich vorliegt (beispielsweise eine Übereinstimmung qua Form), so fungiertdiese lediglich als Vorwand, um den Bildspender in die Nähe desBildempflingers ar rücken. Auf keinen Fall stellt sie den Inhalt dermetaphorischen Prädikation dar.
Anmerkung: Wenn ich einen Dackel eine Gurke nenne, so will ich nicht nurbesagen, daß er aussieht wie eine Gurke. Der spöttische und herabsetzendeEffekt dieser Metapher geht daraus hervor, daß ich ein Säugetier mit einemGemäse, also einem Naturobjekt "niedrigerer" Ordnung, das außerdemgegessen wird, assoziiere.Dasselbe gilt beispielsweise für den Vergleich Elvis Presleys mit einerLitfaßsäule. Da Elvis Presley fiir Reklamekampagnen jeder Art verwendetwurde, und es heute noch wird, ist die Ahnlichkeit zwischen Bildspender undBildempfünger auch hier unübersehbar. Es war dem Produzenten dieserMetapher (rn casz dem SPIEGEL-Redakteur) aber nicht darum zu tun, auf dieseAhnlichkeitals solche hinzuweisen. Eine Litfaßsäuleisteinplumper, lebloserGegenstand. Indem Elvis Presley damit verglichen wird, wird besagt, daß ergegenüber der Ausnutzung seines Ruhmes durch die Reklame machtlos war.
8.4In Hinsicht auf die Aturtictrteisfunktion unterscheiden sichMetapher und Gleichnis nicht voneinander. tn beiden Fällen fungiert dieAtrntictrteit als Bindeglied zwischen Bildspender und Bildempfänger. Dabeiist es in beiden Fällen nicht um die Ahnlichkeit als solche zu tun, sondemum die Beistellung eines oft mit zahlreichen Implikationen beladenen Bildes.Die herkörnrnliche Definition der Metapher wird also nicht bestritten.Bildspender und Bildempfänger stehen tatsächlich in einer Art Ahnlichkeits-
8. Schlt$folgcrurycn zum theoretisclun Teil
verhältnis zueinander. Wenn dem nicht so wäre, ließe sich die Metaphernicht von der Metonymie unterscheiden.
8.5 In zatrlreichen Fällen ist die Ahntichkeit jedoch nicht evident.Am den Beispielen "der Mensch ist ein Schilfrohr', "die Natur ist einTempel" und 'Frau X ist eine Schlange" salrcn wir, daß die Ahnlichkeit alssolche bereits problematisch ist. Sie stellt sich erst aposteioihewq wennwir die Metapher bereits begriffen haben. Aufgrund ähnlicher Über-legungen meinen zahlreiche Metaphernforsche#), daß die Metapher nichtauf bereits festgestellten Atntictrteisbeziehungen beruhe, sondem dieseÄtrrtictrt<eit allererst schaffe(2) und bislang nicht watrgenommene Aspektedes Bildempfängers sichtbar mache. Diese Konzeption verleitet zu einerunkritischen Metaphernrezeption in der grundsätzlichen und ungeprtiftenAnnahme, sie wtirde "Wahrheit" vermitteln. Vielmehr stellte sich heraus,daß die sogenannte Ahnlichkeit, von der hier die Rede ist, von der Traditionher bereits vorgezeichnet ist. Zatrlreiche Qualitäten sind im vornhinein dazuprädestiniert, mit anderen verknüpft zu werden; wie etwa die Zerbrechlich-keit des Schilfrohrs mit der Unzulänglichkeit des Menschen, wie etwa dasSchleichen einer Schlange mit boshafter List. Wir erklärten diesen Umstandvon der Emblematik her. Tiere stehen beispielsweise für Temperamente. Inunserer Fallstudie zur Kleidungsmetaphorik im Alten Testament werden wirfeststellen, daß sogar zwischen Bildspender und Bildempfünger ein imvornhinein etablierter Nexus bestehen kann. Es wird sich zeigen, daßEzechiels Metaphernttrema des Gesetzes als Gewand durch einen präexistie-renden Nexus zwischen Gesetz und Gewand präfiguriert ist.
8.6 Die Emblematik läßt sich bezüglich ihres Inhalts erkunden, indemwir die Mythen heranziehen, in denen die betreffenden Embleme auftreten.Diese Mythen können allerdings auch innerfiktional sein. Anders gesagt:Der Autor kann sich selber die fundamentalen Bezüge Qtlots im Sinne vonN. Frye) zurechtlegen, aus denen bestimmte Objekte einen emblematischenWert erhalten und dadurch auch mit bestimmten Implikationen alsBildspender auftreten können. Im Klartext: Wir brauchen eine Metaphernicht anzustarren, bis sich uns blitzhaft ihr Sinn offenbart. Wir könnengezielt nach den Mythen, auf die der Autor zwückgreift, oder nach seinenwerkimmanenten p/o/s, ausschauen. Ein derartiges Verfahren leistet dieAuslegung der Metapher aufgnrnd positiver Fakten.
8.7 Diejenigen Eigenschaften des Bildspenders, durch die dem Bild-empfänger vermöge der metaphorischen Apposition eine (zwar nichtidentische) Eigenschaft zugeschrieben wird, möchten wir Signdurennennen. In der Alchimie bezeichnet dieser Ausdruck jene Merkmale eines
c) wie etwa Iv1ax Black, Roger Tourangeau, Harald Weimich, E. Flashar, u. a.(2) cf. Ivlax Black, Die Metqher, S. 6E und G. Kttrz, Metqher, Allegorie, Symbol, S.
t9 - 20.
119
120 DIE METApHER ALS wERTSETnaNG 1. Teil: Eturyetik iler Metqilur
Krautes, an denen sich .erkennen ließe, gegen welche Krankheit eseingesetzt werden könne. Ahnlich verhält es sich beim Emblem: es enthältMerkrnale, die seine metaphorische Verwendung im vomhinein vor-zeichnen.
8.8 Bemerkenswert ist nun, daß ein Emblem meist nicht nur eine einzigeSigrutur aufiveist, sondern mehrere (wie etwa im Falle der Sctrlange: däsSchleichen für List, der Biß flir den seelischen Schaden, usw.). Dadurchbestimmt die Metapher den Bildspender bereits in mehrfacher Hinsicht.Aufgrund dieser Rezeptionserfahrung heißt es von der Meüapher, sie seiunendlich paraphrasierbar, mittrin irreduzibel. Tatsächlich lfit sich dieSignifikanz einer Metapher nicht auf eine einzige Bedeutung fesflegen.Daraus kann rnan jedoch nicht ohne weiteres schließen, daß sie nichtparaphrasierbar wäre. Sie läßt sich in ihren jeweiligen Aspekten auslegen.Solcherlei Interpreüation kann (wie unsere Fallstudien zu Beckett undEzer,hiel zeigen werden) schwer und umständlich ausfallen. Die Behauptungaber, die Metapher wäre grundsätzlich nicht (oder in unendlicher Weise)paraphrasierbar, stellt für viele Fälle eine ururötige Kapitulation dar. Denndemzufolge besagte die Metapher überhaupt nichts Bestimmtes mehr. EineMetapher kann viele, sich gleichzeitig meldende Bedeutungen haben.Dennoch ist die Richtung, in der wir zu suchen (und zu paraphrasieren)haben, meist erkembar.
8.9 Die prädikative Geltung dieser jeweiligen Signaturen ist um soschwächer, als der Bildempfänger konkret erkennbar ist.Bei Bildempftingern hingegen, deren Erkennbarkeit schwer oder unmöglichist (wie etwa bei philosophischen, ethischen und ttreologischen Begriffen),ist Kontaminierung durch die Totalitjit der Signaturen, zuweilen auch durchdie ganze Struktur des Bildspenders vorprogrammiert.
S.lOlnteressant ist auch, daß das Emblem Eigenschaften, bzw.Signaturen aufweisen kann, die dem Bildspender an und für sich nichtanluften. Das wurde am Beispiel des Gorillas deutlich. Max Black undRoger Tourangeau suchen diesen Umstand damit zu erklären, indem sierrcinen, daß in der Metapher ein "sef of beliefs" (eine Reihe von An-nahmen) zum Ausdruck käme. Das kann in manchen Fällen stimmen. Es istjedoch keineswegs immer der Fall. Einem sehr frappierenden Beispielwerden wir in der Kleidungsmetaphorik begegnen. Sowohl in der alttesta-mentlichen Bildersprache als auch in der Metaphorik und Motivik SamuelBecketts haften dem Gewand organische Züge an. Solches kann nur von derEmblematikher verstanden werden. Mit unseren geläufigen Annatrmen (imSinne vom englischen "belief') läßt sich die Konzeption der Kleidung alsHaut nicht vereinbaren.
8. 1 1 Wie steht es, so fragen wir jetzt, um die so umstrittene Bedeutungder Metapher? Selber haben wir uns so wenig wie möglich mit grundsätzli-chen Fragen beschliftigt. Aber garu ohne sie kamen wir auch nicht aus.Also auch nicht ohne eine philosophische Prämisse. Wir beschränkten uns
8, Schh$folgenorgcn zun tluoretisclun Teil
auf eine einzige: Nihil est in intellectu quid non pius fuit in sensu. Das hatzur Konsequenz, daß wir die Annahme, durch die Metapher würden uneue'Bedeutungen geschaffen, nicht akzeptieren können. In dieser Hinsichtmüssen wir also Donald Davidson recht geben. Ein Wort kann durch eineandere Verwendung freilich eine andere Bedeutung erhalten, eine Bedeu-tung aber, die einem bereits geprägten Ausdruck durch die Metaphorisie-nurg hinzukäme, ist als Hokus-Pol«rs abzutudr). Der Kontroverse zwischenDonald Davidson einerseits und Max Black und Paul Ricoeur andererseitsist dadurchbeizukommen, daß die Bedeutung der Metapher wedereine neueBedeutung, noch eine Fusion von Bedeutungen, noch eine reduzierteBedeutung darstellt, sondern die durch die emblematische Gestaltdes Bildspenders vorgegebene Bedeutung. In "DerMenschisteinWolf" erhält das Wort "W'olf" die Bedeutung, die es vom Emblem desWolfes her hat. Dieses ist wiederum geprägt durch'überlieferte Sagen undMärchen. Diese Rückkoppelung auf überlieferte Konzeptionen erklärtnachträglich, warum zahlreiche Metaphorologen meinen, daß die Metaphereine andere oder "neue" (Ricoeur) Bedeunrng erhalte. Wir sahen närnlichbereits, daß das Emblem nicht mit dem entsprechenden Konzept und nichteinmal mit unserer eigenen Einstellung zum Bildspender übereinzustimmenbraucht. Die Metapher "Hund" ist immer boshaft gemeint, dennoch gibt esjede Menge Hundeliebhaber. Max Blacks Behauptung, die " Bedeutung einerinteresssantm Metqher" wiire "neu oder 'kreüiv', und nicht aas demStandard-Lexikon obleitbar'(2), möchten wir entgegenstellen, daß sietatsächlich nicht aus dem Lexikon ableitbar ist, aber trotzdemnicht neu ist.
8.12 Man kömte der Metaphorisierung der Prädikation folgendeFunktion zuschreiben: sie bringt zustande, daß die emblematische Bedeu-tung des Fokus, die in der Nullsprache nicht zur Geltung kommt, aktiviertwird.
8.13Eine weitere Konsequenz der Ricoeurschen Verlegung derMetaphorik in das "ist" des metaphorischen Satzes, besteht darin, daßmetaphorische Sätze als von kategorialen Prädikationen grundverschiedenanzusehen sind. Weder schafft die Metapher einen neuen Gattungsbegriff,noch zubsumiert sie ein Objekt unter einen bereits bekannten Gattungs-begriff (siehe dazu auch § 8.2).
<', 'I depend on the distinction between whd words mean ord wha they oe used to do.I think netqhor belongs uclusively to the domain of we. It is something brought off bythe inaginaive employment of word.s otd senlences od depends entirely on the ordinoTmeoings of those words ord hence on the ordins! meaningr of the sentences theycontprise' (Wlw Metqhon Mean, S. 3l).
@ Mehr tber die Metqher, S. 384.
tzt
___ 8. 14 Die l,eistung der Metapher ist nicht mit der Entstehung eines neuenlvo1es zu vergleichen. Darin ist sie von der Katachrese grundverschieden.In der Metaphorik ist der Bildspender kein embryonales-Konzept, sonderneiß ferltges wd a»ßerdem »tt t»agi»är» E)ge»stbefte» bbprreler Degirf.Die metaphorische Sprache ist also nicht prä-konzeptuell (wie Ricoeur esselber noch watrhaben wollte), sondern post-konzeptuell. Sie kann nurda ansetzen, wo ein bereits gebildeter Begriff bereisteht. Aus diesemGrunde leistet sie eine Hyper-Determination, bzw. eine überbestimmungdes Bildempfängers. Eine Metapher sagt oft zuviel. Daraus schöpft sie ihrensuggestiven Effekt.
8.15 Diese neue Konzeption des metaphorischen Satzes entspricht demspezifischen Bedeutungsmodus der Metapher. "Der Mensch ist ein Wolf,'besagt nicht, daß er zur Klasse der Wölfe gehöre, noch wird damit lediglichgemeint, daß er ".wild, raubtierhaft und verräterisch" sei(1). Diesermetrphorische Satz sagt, daß in ihm eine Kraft wirlsam wäre, die Wölfen(allenfalls in ihrer emblematischen Gestalt) in exemplarischer Weiseinhärieren würde.
8.16Ricoeur ahnte diesen Bedeutungsmodus bereits, als er denReferenten der Metapher als die aristotelische physis bezeichnete. Wirhaben diesen Gedanken weiter zu entwickeln gesucht: Die Metapher beziehtsich auf Kräfte, die entweder in den Erscheinungen vermutet werden, oderim §ender selber wirksam sind (im letzteren Fall bekundet die Metapher dieEinstellung des Senders, wie etwa Zuneigung oder Aggressivität).-
8.17 Wir haben nicht danach getrachtet, eine philosophische Bestimungdes Energetischen zu geben. In seiner positiven Form schwebt uns dasjenigevor, was Bergson mit dem Ausdruck dtut vitat bezeichnete. In seinernegativen Form bezeichnet es Starre, Passivität und Tod. Eine genauereBestimmung des Energetischen sähe wie folgt aus:- ln bezug auf eine Reihe von Vorschriften (Beispielsweise ein Gesetz) istdas Energetische die ko rreli e rende Eins te llun g .- In bezug auf Personen ist das Energetische das Temperament.- tn bezug auf Dinge ist das Energetische die ihnen zugeschriebene Kraft(2.B. New York ist ein Magnet).- In bezug auf Texte bezeichnet es u. a. ihren emotionalen Impact: Beispiele :Diese Rede wu ein "Schlag ins Gesicht", Diese Anspielung war ein"Seitenhieb'.
8. 18 lndem wir denmodus significondi der Metapher als die Verweisungauf das Energetische bestimmen, stellen wir eine breite Grundlage zu ihremdeskriptiven, explikativen und rhetorischen Gebrauch bereit.
I22 DIE METAPHER ALS wERTSETZaNG I. Teil: Druryetik iler Metqhtr
G) wie Max Black meint (cf . op. cit., S. 75).
(
, büwt,ilrLr 3 t k&'"t(r W* (w*l^'' W'tL s W
Bildspender ein Wert beigemessen wird, den derffiffirlendem Maße vertritt. Die Tatsache, daß
A. SöXk$Totgcrutgen zum tluoretischtn Teil
\1 ) L\iQrer d e s kr i p t i v e n Le i s tun g stellen Metaphern den Bildempfän-
ger als etwäs Aktives (oder auffällig Passives) dall).2) Die explikative Leistung der Metapher besteht oft darin, daß das
Auftreten eines Phänomens in der Sphäre des Bildempfängers als Momenteines Prozesses gedeutet wird, der in der Sphäre des Bildspenders deutlichbeobachtbar und verfolgbar ist.
3) Die rhetorische Funktion der Metapher bestehL-darin, daß
123
dem
elnWertesystem übermittelt, schwächt ihre kognitiven Ansprüche.
Anm e rkung : Ein rezentes Beispiel legt dies nahe. Kärzlich hörte ich jemandbehaupten, daß die Völkerkriege im ehemaligen Ostblockdie "Kinderkranlüei-ten" der freigeworde.nen Nationen wären. Diese Metapher ist von der Intentionher zweifelsohne explikativ. Sie fußt in der personalistischen Konzeption derMenscheit als Individuum. Von dieser Wurzeknetapher (root-metaphor)ausgehend deutet sie diejetzigen Völkerkriege als eine unabwendbare Phase ineiner mutuaßlichen Entwicklungsgeschichte. Ln Bndeffekt aber hat dieMetapher "Kinderkranlüeit" eine bewertende Funktion: sie verniedlicht diegrauenhaften Ereignisse, indem sie diese mit Mumps und Masern vergleicht.Sie bedeutet dem Fmpfänger, daß er sich nicht darüber aufregen sollte, undstimmt ihn obendrein auch noch hoffoungsvoll.
8.198s gibt zwei Typen der Bewerhrng: a) die Einschätzung des zubewertenden Gegenstandes hinsichtlich seines Ranges, und b) seine Ein-schätzung nach klar definierten Wertsetzungen. Ersterer Typus ist kerur-zeichnend fti,r hierarchische Wertesysteme. Wert hat das, was wtirdig underhaben ist, also das, wäs innerhalb einer "hoch-tief"-Skala einen "hohen"Rang einnimmt. Der zweite Typus schlägt sich im juristischen Denkennieder.
8.20 Die Metaphorik bewertet den Gegenstand nach dem ersten Bewer-tungstypus (was allerdings nicht notwendigerweise bedeutet, daß jeglichemetaphorische Rede hierarchiefreundlich wäre; die alttestamentlichenMetaphern beispielsweise leisten [siehe 12. Kapitel] gerade das Gegenteil).
8.21 Die Bestimmung eines Ranges nimmt sich im Vergleich zurWertschätzung wie folgt aus: Sie stellt kein gesondertes und explizites
(1) Das erkannte bereits Aristoteles. Diese Eirsicht ist u. a. von Wayne C. Boothe(Metqhor as Rhetoric, in: On Metaphor fiIrsg. von Sheldon Sacks], Chicago U. P.,Chicago/I-ondon 1978,pp.47-70), undFmm Yoiat(Metqhon odtheirAptness inTrdeNones for Perfwnes, in The Ubiquity of Metaphor [Hrsg. von Wolf Paprottre & Ren6DirvenlJohnBe{aminsPublishingCoryany, AmsterdamPhiladelphia, 1985, S. 263-294)wiederaufgegriffen worden.
124 DIE METAPHER ALS wERTSDTZTJNG 1. Teil: Ewrgetik ilet Mcq,lut
Werturteil dar, sondern eine unbestimmte Vielfalt von meist implizitenWertschätzungen. Wer einen Menschen "eine Perle" nennt, bewertet ihn injeder Hinsicht positiv, und nicht nur hinsichtlich besonderer Leistungen,Handlungen oder Verhaltensweisen. Der Bildempfäinger wird also nichtgemäß eindeutigen Kriterien als wertvoll dargestellt, sondern indem er inmannigfachen Hinsichten, welche aber nicht ausdr{icklich erwähnt werden,als "gut" (bzw. gediegen, tauglich, schön) bezeichnet wird.
8.22Die drei wichtigsten Befunde des theoretischen Teils dieser Ab-handlung seien noch einmal wiederholt. Thesenhaft zugespitzt lauten sie:- Die Metapher bezieht ihre Signifikanz vorn Emblem, und letztendlich voneinem Mythus.- Die Metapher hat als letztendlichen Referenten das Energetische. Darinunterscheidet sie sich von der kategorialen Rede.- Die Metapher leistet den Ausdruck und die Vermittlung einer Wertset-amg.
8.23 Diese Aussagen sind nun wiederum zu relativieren. DbAnzahlfuFallstudien ist nämlich noch zu gering, als daß die daraus hervorgehendenBefunde uns an generellen Aussagen befähigten. Sie stellen lediglich eineArbeitshypothese dar, die bei der Textanalyse zu einem nicht unerheblichenErkenntnisgewinn führen kann. Die obigen Aussagen mtißten durch denexistentialen Quantor "es gibt" eingeleitet werden. Für alle Fälle können wiralso sagen:- Es gibt einen Typus von Metaphem, die ihre Signifikanz vom Emblem
und letztendlich von einem Myttrus beziehen.- Es gibt ernenTypus von Metaphern, deren Referent das Energetische ist.- Es gibt einen Typus von Metaphem, die den Ausdruck und die Vermitt-
lung von Wertsetzungen leisten.An diese Serie existentialer Aussagen mtißte nunForderung geknüpft werden, daß man sich beigegebenen Metapher immer fragen sollte, ob sie nicht unter eine der dreiobigen Kategorien ftillt.
Wir können jedoch noch einen Schritt weitergehen und uns fragen,inwiefern es uns nicht gestattet ist, einen ganz bestimmten Metapherntypusherauszuarbeiten, der diese drei obigen Charakteristika allesamt aufweist.Die in unseren Fallstudien untersuchten Metaphern tun es. Indem sie auf einEmblem zurückgehen, das wiederum die Kodifizierung einer Kraft odereines Prozesses ist, beziehen sie sich zwangsläufig auch auf Energetisches.Und da Embleme den jeweiligen, durch sie verkÖrperten Kräfte bzw.Prozessen auch eine gewisse Rangordnung beimessen, leistet die Metapherkraft ihres emblematischen Hintergrunds auch eine Bewerhrng.
Unsere bisherigen Befunde gestatten also ebenfalls eine Reihung vonBehauptungen nach folgendem formalen Muster:
die heuristischeder Analyse einer
8. ScWt$folgcrwryen zurn tluorctischcn Teil tzs
(lxXFx AGxÄnxÄlx)
wobei Fx "ist eine Metapher", Gx "geht auf ein Emblem zurück", Hx"bezieht sich letztendlich auf Energetisches" und Ix "signalisiert eineWertsetzung" bezeichnen wtirden.
Dem entspräche die These: Es gibtetnenTypusvonMetaphern, dieihreSignifilenz von einem Emblem beziehen und deren Referent das Energeti-sche ist und die den Ausdruck und die Vermittlung einer Wertsetzungleisten.
M etho dolo gß che Kons e qaenzen
Der hier herausgescträlte Metapherntypus fungiert als interpretatorischesHilfsintrument. Wir werden in den jetzt folgenden Fallstudien die Entdek-kung machen, daß die Frage, ob eine gegebene Metapher nicht em-blematisch vorgezeichnet ist, uns zrl Fesstellungen ftihrt, die wir sonstnicht gemacht hätten. Damit sei nun nicht gesagt, daß wir die herkömm-liche, ph?inomenbezogene l-ektüre einer Metapher aufgeben wollen. Wirwerden uns bei jeder Metapher den Bildspender vor Augen ftihren, so wiewir ihn kennen, und all das, was wir über ihn wissen, zur Geltung kommenlassen. Solcherlei phänomenbezogene Interpretation bleibt bei der Hypo-thesenbildung immer noch unerläßlich. Die Frage nach eventuellenPri;rcdenzfiillen (bzw. nach der zugrunde liegenden Emblematik) kommterst an zweiter Stelle. Die daraus hervorgehenden Befunde körmen diephänomenbezogene Deunrng bekräftigen, einschränken oder korrigieren.Was wir vor allem sagen wollen, ist folgendes: Es lohnt sich bei derAnalyse von Metaphem nach Priaederufallen zu fragen. Es lohnt sichaußerdem, den zugrunde liegenden Mythos zu hinterfragen. Führt solcherleiFragestellung zu einem negativen Ergebnis, so haben wir Zeit verloren.Ftihrt sie hingegen zu einem positiven Resultat, so haben wir ein für dieInterpretation der untersuchten Metapher äußerst aufschlußreiches Faktumausfindig gemacht.