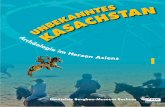Eine römerzeitliche Fernstraße mit angrenzendem Grabbezirk in Kärnten – die Ergebnisse der...
-
Upload
pfahlbauten -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Eine römerzeitliche Fernstraße mit angrenzendem Grabbezirk in Kärnten – die Ergebnisse der...
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
5
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren .................................................................................................... 7
Vorwort .............................................................................................................................................................. 9Programm ......................................................................................................................................................... 10
KriStina aDler-WÖlfl
Frührömische Funde aus Wien ...................................................................................................................... 13
chriStoPh baur, eleni SchinDler-KauDelKa
Magdalensberg. Zur Auswertung augusteischer Planierschichten –Akkulturation am Beispiel der einheimischen Keramik ............................................................................. 35
Szilvia bÍrÓ Der östliche Teil der deserta Boiorum. Ein Forschungsstand ....................................................................... 71
Patrizia De bernarDo StemPel
Zu den keltisch benannten Stämmen im Umfeld des oberen Donauraums .......................................... 83
gÜnther flePS
Größer als gedacht. Das römische Augsburg im Spiegel der neuesten Ausgrabungen ........................ 101
florin foDorean
Pannonia in the Peutinger map ...................................................................................................................... 115
DéneS gabler Das römerzeitliche Siedlungssystem auf dem Territorium von Savaria .................................................. 131
geralD grabherr
Zur römischen Frühzeit im südlichen alpinen Teil Raetiens ..................................................................... 153
manfreD hainzmann
Civitates regni et provinciae Norici – Fragen der Lokalisierung ....................................................................... 171
Peter herz
Das Entstehen einer Provinz. Gedanken zum römischen Recht und zur römischen Politik .............. 185
Julia KoPf
Indizien für Militärpräsenz im frühkaiserzeitlichen Fundmaterial Brigantiums .................................... 199
Péter KovÁcS
Der Bernsteinstrassenraum und seine Bewohner ....................................................................................... 217
INHALTSVERZEICHNIS
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
6
Stefan KrmniceK
Früher Münzgebrauch und Geldverkehr am Magdalensberg ................................................................... 227
felix lang, DoriS KnauSeDer
Eisenzeitliche Traditionen im Handwerk in Iuvavum/Salzburg – Bevölkerungskontinuität oder Zuwanderung? ............................................................................................ 239
Karl oberhofer
Die römerzeitliche Siedlung von Schönberg, MG Hengsberg, VB Leibnitz – Ein siedlungstypologischer missing link aus der Okkupationszeit? ........................................................... 253
henriK Pohl
Eine römerzeitliche Fernstraße mit angrenzendem Grabbezirk in Kärnten – die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen Kühnsdorf 2010 und 2011 ............................... 265
urSula Schachinger
Die Münzzirkulation der Spätlatènezeit im Südostalpenraum: Der Übergang von der keltischen zur römischen Münzzirkulation ......................................................... 281
bernharD Schrettle
Frauenberg bei Leibnitz – Von der spätlatènezeitlichen Kultstelle zum römischen Heiligtum ......................................................... 291
félix teichner (mit einem beitrag von heiKe SchneiDer)Zur Nachhaltigkeit römischer Raumordung in Pannonien am Beispiel einer Siedlungskammer an Marcal und Raab ......................................................................................................... 313
michael tSchurtSchenthaler, martin auer
Municipium Claudium Aguntum – die frühen Befunde ............................................................................ 337
Wolfgang vetterS
Das Goldvorkommen der Norischen Taurisker. – Ergebnis der geologischen Neuinterpretation des antiken Textes durch Kombination diverser Archivalien ................................................................... 351
Abkürzungen von Zeitschriften und Reihenwerken .................................................................................. 361
inhaltSverzeichniSur
hebe
rrech
tlich
ges
chüt
ztes
Mat
eria
l © F
rank
& T
imm
e V
erla
g fü
r wis
sens
chaf
tlich
e Li
tera
tur
© Frank &
Timme
265
Einleitung
Im Auftrag der ÖBBInfrastruktur AG führte die Archäologische Dienst Kärnten gem. GmbH im Herbst 2010 und Frühjahr 2011 baubegleitende archäologische Voruntersuchungen durch. Die archäologischen Untersuchungsbereiche lagen in der KG Kühnsdorf, MG Eberndorf, VB Völkermarkt im Südosten Kärntens. Die Grabungskampagne Kühnsdorf 2010 fand auf der Parzelle 462/3 (neu: 462/5) mit der Maßnahmennummer 76108.10. 2 statt1. Die Grabungskampagne Kühnsdorf 2011 wurde auf der Parzelle 564/2 (neu: 564/7) mit der Maßnahmennummer 76108.11.2 durchgeführt2. Auf den archäologisch untersuchten Flächen (Abb. 1) wurden ein Friedhof des 1. Jhs. n. Chr., eine römischkaiserzeitliche Straße, latènezeitliche Brandschüttungsgräbergräber und spätantike Körpergräber entdeckt.
Kühnsdorf 2010, Parz. 462/3
Mit den archäologischen Untersuchungen auf der Parzelle 462/3 in Kühnsdorf konnte das Grabareal eines kleinen ländlichen Friedhofs des 1. Jhs. n. Chr. erfasst werden3. Auf dem gesamten Grabungsareal wurden insgesamt elf archäologische Befundkomplexe ausgegraben und dokumentiert (Abb. 2). Es handelt sich ausschließlich um Grabbauten und damit in Zusammenhang stehende Schichten bzw. Befunde. Die Datierung erfolgt über die Funde, die in das 1. Jh. n. Chr. datieren4. Insgesamt fanden sich auf der ersten Befundoberfl äche sehr wenige datierbare Funde. Nur in den Gräbern selbst bzw. auf deren Brand-schüttungen konnte einiges an Keramik, z. T. sogar komplett erhaltene Gefäße, geborgen werden.Folgende Typen von Befunden wurden dokumentiert:– Zwei quadratische Streifenfundamente (Befund 2 und 3)– Zwei eingetiefte Brandschüttungsgräber mit Steineinfassung und Rollsteinabdeckung (Befund 1 und
11)– Ein Fundament für eine Umfriedungsmauer (Befund 10)– Eine Fläche mit fragmentierter Keramik (Befund 5)– Eine Brandschicht mit Fibelfragment (Befund 6)– Schuttschichtbefunde (Befunde 4, 8 und 9)Auf die aufgehende Konstruktion der Grabbauten kann indirekt geschlossen werden. Es fanden sich keine Reste eines aufgehenden Mauerwerkes, dafür zahlreiche Dachziegelfragmente. Für die Streifenfundamente (Befund 2 und 3) sind folgende Rekonstruktionen möglich: tempelförmiges Grabmal – Grabaedicula – baldachinförmiges Grabmal, Grabhäuschen5. Ein Grabaltar oder Grabpfeiler ist unwahrscheinlich, da diese zumeist ein massives Fundament hatten. Die bekannte römische Gräberstraße von Šempeter bei Celje
1 Grabungsbeginn: 13. 10. 2010. Grabungsende: 24. 11. 2010. Wissenschaftliche Gesamtleitung/Grabungsleitung: Univ.Doz. Dr. H. Dolenz/MMag. Regina Barlovits. Grabungsleitung (örtlich): Mag. Henrik Pohl. Verantwortliche für die Fundbestimmung: Mag. K. Gostenčnik, Dr. E. Schindler-Kaudelka. Vermessung: Andreas Jesse. Planerstellung: Andreas Jesse/DI Anita Kollmann.
2 Grabungsbeginn: 30. 3. 2011. Grabungsende: 3. 5. 2011. Wissenschaftliche Gesamtleitung/Grabungsleitung: Univ.Doz. Dr. H. Dolenz/MMag. R. Barlovits. Grabungsleitung (örtlich): Mag. H. Pohl. Verantwortliche für die Fundbestimmung: Mag. K. Gostenčnik, Dr. E. Schindler-Kaudelka, Dr. W. Artner. Vermessung: R. Glaser. Planerstellung: A. Jesse, DI A. Kollmann.
3 Pohl 2010. 4 Eine erste Fundeinschätzung verdanke ich Mag. K. Gostenčnik. 5 Kremer 2001.
HENRIK POHL
EINE RÖMERZEITLICHE FERNSTRASSE MITANGRENZENDEM GRABBEZIRK IN KÄRNTEN –DIE ERGEBNISSE DER ARCHÄOLOGISCHENUNTERSUCHUNGEN KÜHNSDORF 2010 UND 2011
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
266
Henrik PoHl
Abb. 1: Befundübersichtsplan der archäologischen Untersuchungen Kühnsdorf 2010 und 2011. Planerstellung: Archäologischer Dienst Kärnten, DI A. Kollmann.
Abb. 2: Parz. 462/3, Befundübersichtsplan. Planerstellung: Archäologischer Dienst Kärnten, A. Jesse, DI A. Kollmann.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
267
EinE römErzEitlichE FErnstrassE mit angrEnzEndEm grabbEzirk in kärntEn
in Slowenien6 bietet zahlreiche Beispiele von Streifenfundamenten. Die prachtvollen Grabaediculae von Šempeter vermitteln einen Luxus, wie er sicher nicht auf dem kleinen ländlichen Friedhof bei Kühnsdorf anzutreffen war. Denkbar – und in diesem Fall wahrscheinlich – ist eine schlichtere Variante römischer Grabbauten wie zum Beispiel die quadratischen Grabhäuschen in Köflach-Pichling7. Ein weiteres Beispiel für gemauerte Grabhäuschen sind die Gräber am Lugbichl des Magdalensberges8. Ebenso sind die Parallelen in der Konstruktion von Befund 2 und 3 in Kühnsdorf zu den 2009 erfassten Grabbauten von St. Paul9 unübersehbar.Neben diesen aufragenden Grabbauten fanden sich auf diesem Grabungsareal auch tief in die Erde eingelassene Bestattungen. Die Befunde 1 und 11 können als eingetiefte Brandschüttungsgräber mit Steineinfassung und Rollsteinabdeckung bezeichnet werden. Dabei wurde jeweils eine ca. 0,80 m tiefe Grube mit Steinen ausgekleidet, so dass eine regelrechte Kammer entstand. In diese Kammer wurde die Brandschüttung selbst zusammen mit Grabbeigaben in Form von Gefäßen und Speiseopfern eingebracht (Befund 11, Abb. 3). Diese Grube wurde anschließend mit Steinen verfüllt und mit einer Rollsteinabdeckung verschlossen. Befund 11 befand sich zusätzlich in einer großen, gemauerten Grabumfassung (Befund 10) mit den Maßen 8 m × 9,20 m × 5,50 m, sodass von einem viridarium gesprochen werden kann.Diese frühkaiserzeitliche Nekropole wird sich sicher noch weiter nach Westen erstreckt haben, dafür spricht der Befundkomplex 7. Die Befunde (ein rechteckiger gemauerter Streifen, eine Steinpackung, eine Brandschicht mit Leichenbrand und TSFragmenten) zusammen mit Resten von bemaltem Wandputz 6 Kolsek 1976. 7 Chornitzer 1995; Fuchs 2000. 8 Dolenz 1949; Egger 1950. 9 Barlovits u. a. 2009/2010a, 161–164; Pohl 2012.
Abb. 3: Parz. 462/3, Befund 11, Planum 3. Foto: Archäologischer Dienst Kärnten, H. Pohl.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
268
Henrik PoHl
sprechen für die stark gestörten Reste eines weiteren Grabbaus. Eine nahe westlich gelegene Gasleitung stört den Befund 7 und verhindert insgesamt, die westliche Ausdehnung der Nekropole zu erfassen.Alle Grabbauten sind NO-SW orientiert und lassen das Vorhandensein einer an den Fundstellen vorbeiführenden antiken Straße vermuten (Abb. 2). Ebenso darf von einem dazu gehörenden Gutshof (villa rustica) oder einer Siedlung (vicus) im näheren Umfeld ausgegangen werden. Die vermutete Straße wird von Südost kommend, an dem Friedhof vorbei in nordwestliche Richtung auf den Seebach zu verlaufen sein. Durch die Lage der Grabbauten (Befunde 1, 2, 3, 10 und 11) kann auf eine südwestlich vorbeiziehende Straße geschlossen werden.Im Umfeld von Kühnsdorf gibt es zahlreiche weitere Funde der frühen Kaiserzeit, die sich mit den Grabfunden von Kühnsdorf vergleichen lassen. Nicht weit von Kühnsdorf entfernt kam in Peraschitzen ein römisches Brandgrab zutage und konnte von H. Dolenz aufgenommen werden10. Es datiert in die erste Hälfte des 1. Jhs. und ist damit zeitlich und vor allem in seiner Konstruktion mit den Befunden 1 und 11 von Kühnsdorf vergleichbar. Die Art der eingetieften Steinkammern mit Brandschüttung und Rollsteinabdeckung scheint typisch für diese Zeit und Gegend zu sein. Ebenfalls in der Nähe lag der Tuffkalkstein- bruch von Peraschitzen, der nachweislich schon im 1. Jh. v. Chr. ausgebeutet wurde. Tuffsteinblöcke waren für Hauskonstruktionen am Magdalensberg verwendet worden11. Etwas weiter entfernt liegt Kleindorf, wo 1992 eine Urne sowie ein marmorner Frauenkopf als Teil eines Grabdenkmals aus dem 1. Jh. n. Chr. gefunden wurde12. Zu beachten sind ebenso die Funde aus Srejach am Klopeiner See. Eine zusammenfassende Darstellung der bisherigen Funde liefert H. Heymans13. Wichtig ist der Fund eines römischen Grabtitulus14. Die neueren Grabungsergebnisse erbrachten u. a. den Nachweis einer villa rustica, die in der zweiten Hälfte des 3. Jhs. einem Großbrand zum Opfer fiel15.All diese Funde zeigen, dass das Gebiet an der Kreuzung der Verkehrswege Drau und der antiken Straße zwischen Virunum und Celeia verhältnismäßig dicht besiedelt gewesen sein muss.
Kühnsdorf 2011, Parz. 564/7
Auf der gesamten, rund 1281 m2 großen Untersuchungsfläche auf Parz. 564/7 konnten 22 Befundkomplexe und damit in Zusammenhang stehende Schichten bzw. Befunde freigelegt und dokumentiert werden (Abb. 4). Herausragend ist dabei der Fund eines Teilstücks einer römischkaiserzeitlichen Straße mit angrenzendem Grabbezirk. Der dreieckige Grabbezirk wird im Süden durch eine Straße, im Westen durch einen Weg und im Osten durch eine Mauer begrenzt. Die wichtigsten Befundkomplexe sind: Befund 10 – Teil einer römischen Überlandstraße, Befund 130 – Fundamentgraben einer Umfassungsmauer sowie Befund 180 – parallele Gräben eines Weges. Im dadurch eingefassten, flächig untersuchten Grabareal konnten sieben spätlatènezeitliche Brandschüttungsgräber (Befund 20, 30, 40, 53, 70, 150, 200) sowie vier römischkaiserzeitlichen Körperbestattungen (Befund 60, 64, 80, 140) untersucht werden.Insgesamt lassen sich die Funde der archäologischen Untersuchung Kühnsdorf 2011 zwei Zeitperioden zuordnen. Der größte Teil der bestimmbaren Keramik und Kleinfunde entstammt der späten Latènezeit, wobei einige Funde konkreter Lt D1 zugeordnet werden können. Einziger Münzfund dieser Zeitperiode ist ein keltisches Kleinsilber16. Mit diesen aus Brandschüttungsgräbern stammenden Funden lässt sich ein Horizont noch weitgehend ohne mediterrane Importe fassen, der in das ausgehende 2. Jh. v. Chr. bis in die erste Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. datiert.
10 Dolenz 1960. 11 Piccottini 2004, 179 f. 12 Gleirscher 1992. 13 Heymans 2002. 14 Glaser 1989. 15 Barlovits u. a. 2009/2010b, 175–189. 16 Keltisches Kleinsilber(Kd 11/112), Göbl TKN (1973), Avers FF 1 (Tafel 45), Revers I b, c, d (Tafel 47), Mitte 1. Jh. v. Chr. bis
Mitte 1. Jh., kommt am Magdalensberg in Fundzusammenhängen von 30 v. Chr. bis Claudius vor.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
269
EinE römErzEitlichE FErnstrassE mit angrEnzEndEm grabbEzirk in kärntEn
Die zweite zahlenmäßig deutlich kleinere Fundgruppe kann römischkaiserzeitlich datiert werden17. Die Streufunde weisen auf eine ausgeprägte Störung der antiken Oberflächen und originalen Befunde. So ist auch das gesamte Umfeld der Straße übersät mit kleinen Keramikfragmenten, Leichenbrand und Metallteilen (KD11/1 – KD11/24). Ein Grund hierfür ist wahrscheinlich die nachantike landwirtschaftliche Tätigkeit.
Zur Chronologie der Befundkomplexe
Die Belegung dieses Grabbezirks ist nicht kontinuierlich. Auffällig ist die zeitliche Lücke zwischen den spätlatènezeitlichen Brandschüttungsgräbern und den spätantiken Körpergräbern, die immerhin ca. 400 Jahre beträgt. Ob die Erosion in diesem Gebiet weitere Gräber vernichtete oder wirklich keine vorhanden waren, lässt sich nicht mehr erschließen. Es ist theoretisch möglich, dass der Friedhof auf der ca. 270 m entfernten Parzelle 462/3 aus dem 1. Jh. n. Chr. diesen Hiatus geschlossen hat (Abb. 1). Auffällig ist, dass der Befundkomplex Befund 10 (Teil einer römischen Überlandstraße) die spätlatènezeitlichen Brandschüt
17 Eine erste Fundeinschätzung verdanke ich vor allem Mag. K. Gostenčnik, Dr. W. Artner, Dr. D. Božič sowie Dr. E. SchindlerKaudelka.
Abb. 4: Parz. 564/7, Befundübersichtsplan. Planerstellung: Archäologischer Dienst Kärnten, DI A. Kollmann.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
270
Henrik PoHl
tungsgräber nicht stört bzw. schneidet. Der spätlatènezeitliche Grabbezirk wurde demzufolge im okkupationszeitlichen Straßenbau berücksichtigt.Der Weg (Befund 180) zweigte von der römischen Straße (Befund 10) ab und führt in nördliche Richtung. Wahrscheinlich handelt es sich um eine via privata, die zu Gutshöfen auf der westlichen Seite des Seebachs führte. Der Fundamentgraben einer Umfassungsmauer (Befund 130) schneidet das spätlatènezeitliche Brandschüttungsgrab (Befund 200) und stößt an den Weg (Befund 180) an. Die spätlatènezeitlichen Gräber existierten also vor der Mauer (Befund 130). Der Grabbezirk wurde erst später durch die Mauer (Befund 130) zu einem Dreieck geschlossen.Aufgrund beabsichtigter Baumaßnahmen konnten die in direkter Verlängerung der antiken Straße befindlichen Parzellen 457/2 und 548/3 zuvor untersucht werden (Abb. 1). Die Ausgrabungen erbrachten weder in südwestlicher noch in nordöstlicher Richtung einen Nachweis für die Fortführung der Straße (Befund 10). Auf der nordöstlich gelegenen Parzelle 457/2 störten die Flussbegradigung des Seebachs und die Anlage eines Mühlbaches jegliche Befunde. Auf der südwestlich gelegenen Parzelle 548/3 folgte unter einer nur 0,10 m starken Humusschicht bereits der sterile Schotter. Die Fläche war also stark erodiert.
Zu den spätlatènezeitlichen Gräbern
Beispielhaft sei an dieser Stelle das Brandschüttungsgrab Befund 30, Parz. 564/7 vorgestellt:Bei Befundkomplex 30 handelt es sich um eine ovale schwarze Verfärbung mit den Maßen 1 m × 0,70 m. Bei der Anlage von Planum 1 kamen Keramikfragmente (KD11/29: bemalte Feinkeramik, Spätlatène) sowie Leichenbrand zum Vorschein. Direkt östlich von Befund 30 wurde eine Bronzekette entdeckt (KD11/32). Es handelt sich dabei um einen Teil einer Gürtelkette (weibliche Tracht), Lt D1. Im Profil zeigt sich eine 0,32 m tiefe schwarze Verfärbung mit auffallend großen und zahlreichen Leichenbrandresten (3100 g). Innerhalb des Befundes 31 (schwarze Verfüllung) befindet sich ein Rasiermesser mit Ösenring (KD11/36: Lt C/D 1)18. Dieses weist eine leicht zerstörte Schneide auf und ist (intentionell) verbogen. Im Umfeld der eigentlichen Brandgrube wurden zahlreiche Keramikkonzentrationen aufgefunden. Wahr scheinlich stammen sie von Gefäßen, die auf der Grube deponiert gewesen waren und durch die nachantike Landwirtschaft zerstört wurden. Der ungewöhnlich hohe Anteil von Leichenbrand von 3,1 kg sowie die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Beigaben (Kette als Teil der weiblichen Tracht, Rasiermesser als männliche Grabbeigabe) lassen die Frage nach einer Doppelbestattung aufkommen. Das bronzene Kettenteil befand sich aber nicht in der Brandgrube selbst, sondern ist als zufällig in der Nähe befindlicher Streufund anzusprechen. Die Frage einer möglichen Doppelbestattung muss daher verneint werden.
Funde zu Befund 30 (Abb. 5)
KD11/27, KD11/28: Eisentülle, Eisenring.KD11/29: Oxydierend gebrannte, bemalte Spätlatènekeramik.KD11/32: Teil einer Gürtelkette (weibl. Tracht), Lt C/D 1.KD11/36: eisernes Rasiermesser mit Ösenring, Lt C/D 1.KD11/45, KD11/46: Stift, Eisenringe.KD11/54: Bronzenagel und beschlag.KD11/65, KD11/66: Feine graue Spätlatènekeramik.KD11/87 – KD11/89: Leichenbrand, 3100 g!
Spätlatènezeitliche Gräber sind in Kärnten relativ selten19. 1969 wurde bei Kohldorf ein Brandgrab des späten 1. Jhs. v. Chr. angeschnitten. Es konnten die Urne, ein Tonteller, Scherben eines importierten Tonkruges sowie einige Bronzefragmente gefunden werden20.
18 Datierung dank freundlicher Mitteilung durch Dr. D. Božič und Dr. W. Artner. 19 Dem Autor momentan bekannt sind die nachfolgend erwähnten Grabfunde von Kohldorf und Faschendorf. 20 Piccottini 1969.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
271
EinE römErzEitlichE FErnstrassE mit angrEnzEndEm grabbEzirk in kärntEn
Abb. 5: Parz. 564/7, Fundtafel 1, Funde aus Befund 30. Zeichnung: Archäologischer Dienst Kärnten, H. Guckuk.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
272
Henrik PoHl
Interessante Parallelen zeigt der Grabbezirk von Faschendorf bei Teurnia (Kärnten)21. In und um den vor allem mittelkaiserzeitlich genutzten Grabbezirk konnten zahlreiche spätantike Körpergräber dokumentiert und ein spätlatènezeitlicher Bestattungsplatz mit z. T. wertvollen Beigaben angeschnitten werden. Eine kontinuierliche Belegung ist wahrscheinlich. Die dort aufgefundenen Aschegruben mit keramischen Fun
21 Polleres 2008; Polleres 1999; Polleres 2000; Polleres 2001.
Abb. 6: Parz. 564/7, Fundtafel 1, Funde aus Befund 30. Zeichnung: Archäologischer Dienst Kärnten, H. Guckuk.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
273
EinE römErzEitlichE FErnstrassE mit angrEnzEndEm grabbEzirk in kärntEn
den22 unterscheiden sich deutlich von den Brandschüttungsgräbern in Kühnsdorf hinsichtlich der Deponierung und Funde.In der Nähe von Kühnsdorf befand sich eine eisenzeitliche Siedlung auf der Gracarca23. Die zugehörigen Brandbestattungen bei Grabelsdorf datieren vom 9. bis in das 3. Jh. v. Chr. Nur einige Streufunde deuten die Belegung bis in das 1. Jh. v. Chr. an24.Die Entfernung von 4,4 km Luftlinie zwischen der Gracarca und Kühnsdorf legt nahe, dass sich bei Kühnsdorf eine eigene Siedlung befunden haben muss. Der Befund 190 zeigt eine größere Fläche von ca. 7 m Durchmesser, die durch Feldrollsteine (Dm 0,20 m) und eine schwarzhumose Erdschicht gebildet wird. Diese Fläche liegt in der nördlichen Ecke des Grabbezirks. Aufliegend wurden zahlreiche verbrannte Metall insbesondere Bronzeteile, Keramik sowie Leichenbrand gefunden (Abb. 6). Auch wenn das Fehlen von verziegeltem Lehm eine Interpretation als ustrinum ausschließt, könnte sich vielleicht an dieser Stelle ein für die Bestattungszeremonien bedeutender Platz befunden haben.
Zu den spätantiken Körpergräbern
Die Bestattung Nr. 1 (Befund 60) zeigt ein juveniles Skelett mit zwei Beigaben. Als Grabbehältnis ist ein Holzsarg anzunehmen, dessen Reste allerdings nicht mehr eruiert werden konnten. Eine Bestattung mit Grabtuch ist auf Grund der Lage des Skeletts eher unwahrscheinlich. Nördlich neben dem Schädel befand sich ein einhenkeliger Krug (KD11/40: 4./5. Jh.) als Grabbeigabe (Abb. 6). Bei der Bergung wurde
22 Polleres 2008, spätlatènezeitliche Befunde: 8–12, spätlatènezeitliche Funde: 111–112. 23 Gleirscher 1993a; Gleirscher 1993b; Gleirscher 1994; Gleirscher 1995. 24 Gleirscher 1996; Gleirscher 1995; Fera – Gleirscher 1997; Fera 1998.
Abb. 7: Parz. 564/7, Befund 10 (Straße) und vier spätantike Körpergräber (Befund 60, 64, 80, 140. Foto und Montage: Archäologischer Dienst Kärnten, H. Pohl.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
274
Henrik PoHl
eine Bronzemünze auf den Halswirbeln aufliegend gefunden (KD11/43). Diese Münze kann der Mitte des 4. Jhs. n. Chr. zugeordnet werden25. Mit der Münzdatierung in die Mitte des 4. Jhs. n. Chr. ist die Bestattung Nr. 1 (Befund 60) das einzig sicher datierbare Körpergrab. Die anderen drei Körpergräber (Befund 64, 80, 140) waren beigabenlos und lassen sich demzufolge nicht sicher der Bestattung Nr. 1 zuordnen. Die drei Körpergräber (Befund 64, 80, 140) liegen in direkter Nähe zu Bestattung Nr. 1, sind aber unterschiedlich orientiert (Abb. 7). Befund 60 liegt mit dem Cranium nach Westen, ist also Ost-West orientiert, während die anderen drei Skelette in nordsüdliche Richtung ausgerichtet sind.
Die Lage der Münze aus Bestattung Nr. 1 auf den Halswirbeln lässt auf eine ursprüngliche Deponierung im Mund schließen. Eine Untersuchung der Lage von Münzen in römerzeitlichen Körpergräbern ergab, dass man sie meist in den Mund legte bzw. in eine der beiden Hände26. Allerdings fällt auf, dass dieser an sich „heidnische“ Brauch hier in Kühnsdorf bei einer ostwestlich orientierten und damit christlich anmutenden Bestattung angewendet wird.
Zur römerzeitlichen Straße und deren möglichem Verlauf
Der Befund 10 aus der Grabungskampagne Kühnsdorf 2011 zeigt den erhaltenen Schotterunterbau einer Straße mit einer maximalen Mächtigkeit von 1,20 m bei einer maximalen Breite von 4,6 m (Abb. 8). Auch wenn der Erhaltungszustand von Straßenkörpern sehr unterschiedlich ist, lassen sich drei verschiedene Bereiche fast überall nachweisen: die Fahrbahn (agger) selbst, beiderseits von ihr Straßengräben sowie eine unterschiedlich breite, iter oder actus genannte Zwischenzone. Die antike Oberfläche und die Straßengräben hatten sich bei dem Straßenbefund in Kühnsdorf aufgrund der Erosion und nachantiken Landwirt 25 Centenionalis (AE 3), Constantius II. für Constantius Gallus ?, 351–355, Mzst. ?, RIC ? 26 Gorecki 1975, 236.
Abb. 8: Parz. 564/7, Befund 10 (Straße), Schnitt 1, Profil v. West. Foto: Archäologischer Dienst Kärnten, H. Pohl.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
275
EinE römErzEitlichE FErnstrassE mit angrEnzEndEm grabbEzirk in kärntEn
schaft nicht mehr erhalten. Ebenso wenig fanden sich Hinweise auf einen Belag aus Steinplatten oder einer Pflasterung. Eine Art Pflasterung war nicht nur innerhalb und in der Nähe von Ortschaften, sondern auch über Teilstücke von „Landstraßen“ möglich, wie das Beispiel in Friesach zeigt27. Als Straßendecke einer Provinzfernstraße war eine festgestampfte Kies, Sand oder Lehmabdeckung aber ebenso üblich, wenn nicht die Regel28. Die üblichen Termini, die den Ausbauzustand einer römerzeitlichen Straße beschreiben sind: via terrena – unbefestigte Erdstraße, via glarea strata – Straße mit Schotterung oder Kiesdecke, via lapide strata – Straße mit einem Belag aus Steinplatten oder Pflasterung. Die Straße bei Kühnsdorf kann also als eine via glarea strata bezeichnet werden. Es gab allerdings keine einheitliche „römische“ Konstruktion und Maße für den Straßenbau. Gerade die Breite römerzeitlicher Straßen konnte enorm schwanken und war vor allem den Bedürfnissen und topografischen Gegebenheiten angepasst29.Die besten Parallelen zu dem massiven Schotterunterbau der Straße von Kühnsdorf lassen sich noch immer bei den römischen Straßen finden30. Hinzu kommt, dass die Funde von der späten Latènezeit bis zur Spätantike einen zeitlichen Rahmen geben. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das 2011 untersuchte Straßenstück in Kühnsdorf als eine römerzeitliche Hauptstraße anzusprechen ist. Sie ist aufgrund ihrer Topografie und Konstruktion keine via privata („Privatstraße“) und wohl auch keine via vicinalis („Provinzstraße“). Ob es sich, den Rechtsstatus dieser Straße betreffend, um eine via publica („Staatsstraße“) oder via militaris („Heerstraße“) handelte, lässt sich aus der Konstruktion in diesem Fall nicht ableiten.
Woher kam die Straße, wohin führte sie und welche Bedeutung hatte sie?
Gesichert ist, dass das auf ca. 50 m Länge nachgewiesene Teilstück einer römerzeitlichen Straße in Südwest-Nordost Richtung bei Kühnsdorf verläuft. Bei dem Versuch der Beantwortung dieser Fragen „ist sehr genau zwischen römisch (weiter) genutzten Straßen, echten „Römerstraßen“ – also von ihnen neu angelegten und ausgebauten Trassen – sowie jüngeren mittelalterlichen Wegen zu unterscheiden. Mit dem Bau von Straßen entwickelte sich nämlich kein grundsätzlich neues Wegenetz, das in vielen Provinzen des Ostens und des Westens bereits vor der römischen Herrschaft bestanden hatte. Vielmehr wurden ältere Routen wohl erst bei entsprechendem Bedarf dem römischen Baustandard angepasst“31).
Was ist aus der näheren und weiteren Umgebung bezüglich der römerzeitlichen Straßenführung bekannt?
1935 wurde bei Friesach eine Römerstraße aufgedeckt und auf einer Teilstrecke die heutige Bundesstraße darüber gebaut. Deutlich erkennbar waren der Schotterunterbau sowie die Pflasterung der Straßenoberfläche32. Natürlich sind auch in und um Virunum Straßenzüge entdeckt und dokumentiert worden. 1930 erkannte F. Jantsch, dass sich die Gräberfeldstraße und zugleich auch die Hauptverkehrs und Durchgangsstraße von Virunum mit der modernen Bundesstraße deckt33. 1994 und 1995 konnten im Bereich der westlichen Vorstadt von Virunum Straßenzüge entdeckt werden, die eine Durchzugsstraße von bis zu 12 m Breite mit darunter befindlichen Abwasserkanälen belegen34. Die Kampagne 1999 erbrachte neue Erkenntnisse bezüglich des cardo maximus innerhalb des Stadtgebiets35. Der Fund einer Straßentrasse vom Magdalensberg nach Liebenfels wurde 2001/2002 von H. Dolenz beschrieben36.
27 Zedrosser 1953, 18. 28 Klee 2010, 42. 29 Klee 2010, 37. 30 Klee 2010, 39. 31 Klee 2010, 30. 32 Zedrosser 1953, 18. 33 Jantsch 1931. 34 Fuchs 1996; Fuchs 1994; Fuchs 1995. 35 Piccottini – Dolenz 1999a, 76. 80; Piccottini – Dolenz 1999b; Dolenz 2001. 36 Piccottini – Dolenz 2001/2002, 130.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
276
Henrik PoHl
Es sind zwei Meilensteine aus der Umgebung von Kühnsdorf bekannt: Nr. 47 Kreuzerhof bei Wabelsdorf, aus der Regierungszeit des Kaisers Septimius Severus und Nr. 48 Thon bei Grafenstein37, aus der Regierungszeit des Kaisers Marcus Aurelius mit der Distanzangabe „a Viruno m. p. VIII“. Beide Meilensteine liegen schon nördlich der Drau und belegen eine dort verlaufende Verbindungsstraße WolfsbergZollfeld. Auch befand sich ein Heiligtum des Genius Cucullatus bei Wabelsdorf (1. Jh. v. Chr. bis zur Spätantike)38. Aus dem Gebiet des heutigen Österreichs sind zahlreiche Nachweise für Römerstraßen bekannt: als Beispiel sei an dieser Stelle nur die römische Straße im Laßnitztal, Weststeiermark benannt39. Die generelle Konstruktion von Hauptstraßen in den Provinzen Noricum und Raetien ist bekannt.Der Ausgangspunkt für die Betrachtung der Transportwege vom nördlichen Adriaraum nach Noricum ist Aquileia (Abb. 9). Der direkte Weg über das Kanaltal und Santicum (Villach) nach Virunum war schwierig und nicht wintersicher. Als Alternative bot sich die zwar längere, dafür einfachere und wintersichere Streckenführung über Celeia nach Virunum an. Die spätantike Straßenkarte Tabula Peutingeriana zeigt eine Straßenführung von Celeia über Upellis, Colatione, Iuenna nach Virunum40. Zwischen den beiden sicher lokalisierten Orten Iuenna (Globasnitz) und Virunum (Zollfeld) liegt das 2011 gefundene Straßenstück bei Kühnsdorf.Allerdings passt der archäologische Befund von Kühnsdorf nicht in die bisher angenommene Streckenführung. Die Straße von Iuenna nach Virunum verläuft ganz allgemein von Südost nach Nordwest; das bei Kühnsdorf gefundene Straßenstück aber von Südwest nach Nordost, d. h. es steht im rechten Winkel zum angenommenen Verlauf. In Richtung Südwest zeigt es eindeutig auf den Klopeiner See, in Richtung Nordost aber auf einen relativ steilen Hügel ohne Geländeeinschnitte (Abb. 10). Man muss annehmen, dass die Straße hier abzweigte. Folgender Streckenverlauf ist vorstellbar: die Straße kommt vom südöstlich gelegenen Klopeiner See bis an oder über den Seebach, um dann nordwärts zur und über die Drau zu 37 Winkler 1985, 73. 38 Vetters 1948. 39 Fuchs 2006. 40 Zu den Stationen und den Streckenabschnitten siehe: Winkler 1985, 26.
Abb. 9: römerzeitliche Straßen zwischen Aquileia und Virunum. Quelle: Archäologieland Kärnten GmbH. ergänzt: H. Pohl.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
277
EinE römErzEitlichE FErnstrassE mit angrEnzEndEm grabbEzirk in kärntEn
ziehen, ähnlich wie auf der Karte der Josefinischen LA von 1764–1785 zu sehen. Dafür spricht auch ein in Völkermarkt gefundener Ring mit Gemme, ca. 150 n. Chr.41.Der Grabbezirk Kühnsdorf 2010 zeigt eindeutig eine Orientierung nach Südwesten. Es ist eine dort verlaufende via privata oder via vicinalis mit ähnlichem Verlauf wie die heutige Landstraße L 116 anzunehmen, die dann im Nordwesten auf die via publica getroffen sein konnte (Abb. 10).Die spätlatènezeitlichen Gräber im Grabungsareal Kühnsdorf 2011 lassen auf eine in der Nähe befindliche Siedlung schließen. Auch wenn bisher kaum „keltische“ Straßen archäologisch untersucht worden sind, muss man davon ausgehen, dass es Wegeverbindungen zwischen den einzelnen Siedlungen gegeben hatte. Die in der Nähe von Kühnsdorf liegenden eisenzeitlichen Ortschaften sind auf der Gracarca am Klopeiner See und am Waisenberg/Lamprechtskogel bei Mittertrixen zu suchen.Auffällig ist, dass der in Kühnsdorf gefundene Teil einer römischen Überlandstraße die spätlatènezeitlichen Brandschüttungsgräber nicht stört bzw. schneidet. Der spätlatènezeitliche Grabbezirk wurde demzufolge im späteren, römerzeitlichen Straßenbau berücksichtigt. Es ist allerdings kein Vorgängerbau erkennbar gewesen.Für den römerzeitlichen Straßenbau sprechen auch starke wirtschaftliche Interessen. Der bedeutende Tuffsteinabbau in Peraschitzen42 und die Güter der umliegenden villae rusticae verlangte nach einem Trans 41 Piccottini 1990. 42 Piccottini 2004, 179 f.
Abb. 10: topografische Situation bei Kühnsdorf. Quelle: KAGIS. Bild: H. Pohl.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
278
Henrik PoHl
portweg. Ein direkter Weg in Richtung Norden zum wichtigsten Eisenverhüttungszentrum Hüttenberg würde ebenfalls Vorteile bringen. Auch an eine Verschiffung der transportierten Güter muss an dieser Stelle gedacht werden. Auf der „vorzüglich schiffbaren Drau“43 konnten Waren zu jener Zeit noch am kostengünstigsten transportiert werden. Bei der Betrachtung der archäologischen Fundstellen zeigt sich, dass das Gebiet an der Kreuzung der Verkehrswege Drau und der antiken Straße zwischen Virunum und Celeia verhältnismäßig dicht besiedelt gewesen sein muss. Das bei Kühnsdorf gefundene römischkaiserzeitliche Straßenteilstück könnte die Verbindungsstraße zwischen dem Klopeiner See und Waisenberg/Lamprechtskogel darstellen, wobei sie die angenommene Hauptstraße WolfsbergWabelsdorfVirunum44 (Abb. 9) kreuzt und weiter Richtung Norden zu dem Eisenverhüttungszentrum Hüttenberg führt.
Abgekürzt zitierte Literatur
Barlovits u. a. 2009/2010aR. Barlovits – K. Gostenčnik – E. Krenn – H. Pohl, Trassenarchäologische Voruntersuchungen im Vorfeld der Errichtung der Koralmbahn Graz–Klagenfurt auf der ÖBB-Großbaustelle Lavanttal 2009, Rudolfinum 2009/2010, 159–174.
Barlovis u. a. 2009/2010bR. Barlovits – K. Gostenčnik – E. Krenn – H. Pohl – S. Radbauer, Erste flächige Voruntersuchungen auf der Koralmbahn-Trasse in Srejach, St. Kanzian am Klopeiner See 2009, Rudolfinum 2009/2010, 175–190.
Chornitzer 1995V. Chornitzer, Rettungsgrabung in der römischen Gräberstraße von Köflach-Pichling 1994 (VB Voitsberg, Steiermark), FÖ, 34, 1995, Wien, 195–219.
Dolenz 1949H. Dolenz, Die Gräberstraße auf dem Lugbichl, Carinthia 139, 1949, 157–164.
Dolenz 1960H. Dolenz, Zwei römerzeitliche Gräberfunde aus dem Jauntale in Kärnten. 1. Peraschitzen, Carinthia 150, 1960, 625–630.
Dolenz 2001H. Dolenz, KG Maria Saal, FÖ 40, 2001, 645 f.
Egger 1950R. Egger, Grab III auf dem Lugbichl, Carinthia 140, 1950, 457 f.
Fera 1998M. Fera, KG Grabelsdorf, FÖ 37, 1998, 731.
Fera – Gleirscher 1997M. Fera – P. Gleirscher, KG Grabelsdorf, FÖ 36, 1997, 802.
Fuchs 1994M. Fuchs, KG Maria Saal, FÖ 33, 1994, 414 f.
Fuchs 1995M. Fuchs, KG Maria Saal, FÖ 34, 1995, 13.
Fuchs 1996M. Fuchs, Die Notgrabungen im Zollfeld – Virunum im Rahmen des zweigleisigen ÖBB-Ausbaues – ein Vorbe-richt, Carinthia 186, 1996, 139–149.
Fuchs 2000G. Fuchs, Römerzeitliche Siedlungsbefunde in Köflach-Pichling, AÖ 11/2, 2000, 44 f.
43 Gaius Plinius Secundus, nat.hist. III, 25. 44 Nr. 5 bei Maurer 2001/2002, 27.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
279
EinE römErzEitlichE FErnstrassE mit angrEnzEndEm grabbEzirk in kärntEn
Fuchs 2006G. Fuchs, Die römische Straße im Laßnitztal, Weststeiermark – ein Forschungsbericht, in: E. Walde – G. Grabherr (Hrsg.), Via Claudia Augusta und Römerstraßenforschung im östlichen Alpenraum, IKARUS 1 (Innsbruck 2006) 439–456.
Glaser 1989F. Glaser, Eine römische Grabinschrift aus Srejach (Jauntal), Carinthia 179, 1989, 51–53.
Gleirscher 1992P. Gleirscher, KG St. Kanzian am Klopeiner See, FÖ 31, 1992, 476 f.
Gleirscher 1993aP. Gleirscher, Urzeitliche Siedlungsreste im Bereich der Gracarca am Klopeiner See in Unterkärnten. Gracarca Bericht 1, Carinthia 183, 1993, 33–94.
Gleirscher 1993bP. Gleirscher, KG Grabelsdorf, FÖ 32, 1993, 713.
Gleirscher 1994P. Gleirscher, KG Grabelsdorf, FÖ 33, 1994, 535.
Gleirscher 1995P. Gleirscher, KG Grabelsdorf, FÖ 34, 1995, 678.
Gleirscher 1996P. Gleirscher, Neues zum Gracarca-Friedhof über Grabelsdorf. Gracarca-Bericht 2, Carinthia I 186, 1996, 11–45.
Gorecki 1975J. Gorecki, Studie zur Sitte der Münzbeigabe in römerzeitlichen Körpergräbern zwischen Rhein, Mosel und Somme, BerRGK 56, 1975, 179–467.
Heymans 2002H. Heymans, KG Srejach, FÖ 41, 2002, Fundchronik 647 f.
Jantsch 1931F. Jantsch, Antike Bodenforschung in Kärnten 1930, Carinthia I 121, 1931, 1–17.
Klee 2010M. Klee, Lebensadern des Imperiums. Strassen im Römischen Reich (Stuttgart 2010).
Kolsek 1976V. Kolsek, Vzhodni del anticne nekropole Šempetru, Katalogi i Monografije 14 (Ljubljana 1976).
Kremer 2001G. Kremer, Antike Grabbauten in Noricum. Katalog und Auswertung von Werkstücken als Beitrag zur Rekonstruktion und Typologie, SoSchrÖAI 36 (Wien 2001).
Mauerer 2001/2002H. K. Mauerer, Die Römerstraßen und die keltischrömische Götterwelt im Lavanttal, Jahresbericht des Stiftsgymnasiums St. Paul 2001/2002, 21–62.
Piccottini 1969G. Piccottini, Eberndorf, BH Völkermarkt, FÖ 9, Heft 4, 1969, 191.
Piccottini 1990G. Piccottini, KG Völkermarkt, FÖ 29, 1990, 235.
Piccottini 2004G. Piccottini (Hrsg.), Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1986 bis 1990. Magdalensberg, Grabungsbe richt 17 (Klagenfurt 2004).
Piccottini – Dolenz 1999aG. Piccottini – H. Dolenz, Die Ausgrabungen in Virunum 1999, Rudolfinum 1999, 76–81.
Piccottini – Dolenz 1999bG. Piccottini – H. Dolenz, KG Maria Saal, FÖ 38, 1999, 832–834.
Piccottini – Dolenz 2001/2002G. Piccottini – H. Dolenz, Bericht der einzelnen Kustodiate. Abteilung für provinzialrömische Archäologie und Feldforschung, Rudolfinum 2001/2002, 117–145.
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme
280
Henrik PoHl
Pohl 2010H. Pohl, KG Kühnsdorf, FÖ 49, 2010, 242.
Pohl 2012H. Pohl, Eine neue römerzeitliche Gräberstraße bei St. Paul i. Lavanttal, in: C. Reinholdt – W. Wohlmayr (Hrsg.), Akten des 13. Österreichischen Archäologentags in Salzburg vom 25. bis 27. Februar 2010 (Wien 2012), 377–381.
Polleres 1999J. Polleres, KG Gschieß, FÖ 38, 1999, 831 f.
Polleres 2000J. Polleres, KG Gschieß, FÖ 39, 2000, 635–637.
Polleres 2001J. Polleres, KG Gschieß, FÖ 40, 2001, 641.
Polleres 2008J. Polleres, Der römische Grabbezirk von Faschendorf bei Teurnia (Kärnten) mit Beiträgen von A. Galik – K. WiltschkeSchrotta – M. Unterwurzacher – H.P. Bojar, Austria Antiqua 1 (Wien 2008).
Vetters 1948H. Vetters, Der heilige Bezirk von Wabelsdorf, Carinthia 136–138, 1948, 280–298.
Winkler 1985G. Winkler, Die römischen Straßen und Meilensteine in Noricum – Österreich, Kleine Schriften des Limesmuseums Aalen Nr. 35 (Stuttgart 1985).
Zedrosser 1953Th. Zedrosser, Die Stadt Friesach in Kärnten (Klagenfurt 1953)
urhe
berre
chtli
ch g
esch
ützt
es M
ater
ial ©
Fra
nk &
Tim
me
Ver
lag
für w
isse
nsch
aftli
che
Lite
ratu
r
© Frank &
Timme