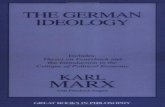Eine originale Syntax. Psychoanalyse, Diskursanalyse und Wissenschaftsgeschichte (on Friedrich...
-
Upload
uni-weimar -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Eine originale Syntax. Psychoanalyse, Diskursanalyse und Wissenschaftsgeschichte (on Friedrich...
Henning Schmidgen
Eine originale Syntax
Psychoanalyse, Diskursanalyse und Wissenschaftsgeschichte
[erschienen in Archiv für Mediengeschichte, Bd. 13 (2013), S. 27-43,
Sonderheft „Mediengeschichte nach Friedrich Kittler“]
Kittler kam zu spät nach Kalifornien. Als er 1982 zum ersten
Mal als Gastprofessor nach Berkeley und Stanford ging, war es
schon zwei Jahre her, daß Michel Foucault in Berkeley seine
programmatischen Howison-Lectures über »Wahrheit und
Subjektivität« gehalten hatte. Noch früher hatte Bruno Latour,
etwas weiter südlich, bei San Diego, die ethnographische
Untersuchung des Salk Institutes zum Abschluß gebracht, die in
Laboratory Life (1979) zu einer bioinformatischen Sicht des
Wissenschaftsprozesses führen sollte. Ebenfalls 1979 hatte Ian
Hacking den Philosophiestudenten in Berkeley und Stanford sein
Delphi-Manifest über »Wirklichkeit und Darstellung«
präsentiert, um im Anschluß daran mit dem Stanforder Physiker
Francis Everitt eine wegweisende Philosophie der
experimentellen Praxis zu entwickeln.1
Aus Sicht der Wissenschaftsgeschichte ist kaum zu sagen,
welche versäumte Begegnung stärker zu bedauern ist: die mit
Latour, der mit inscription device den Begriff in die
Wissenschaftsforschung einführte, der am offenkundigsten in die
Richtung weist, die auch von Kittlers »Aufschreibesystemen«
anvisiert wird; die mit Hacking, der – wie David Wellbery
gezeigt hat – schon in Why Does Language Matter to Philosophy? ein
»hermeneutisches Regime« der Bedeutung von einem »materiellen
Regime« einzelner Sätze unterschied und damit auf seine Weise
jene Äußerlichkeit des Schreibens thematisierte, die auch in
den Analysen Kittlers zentrale Bedeutung hat;2 oder die mit
Donna Haraway, die, wenig später, aber ebenfalls unweit von
Stanford, die Informatik der Herrschaft als ontologische Verschaltung
1 Michel Foucault, Truth and Subjectivity, Howison-Lectures, University of
California, Berkeley, 20./21. Oktober 1980, als Audio-Files zugänglich
unter <http://www.lib.berkeley.edu/MRC/foucault/howison.html> (letzter
Zugriff 22. Juli 2013); Bruno Latour/Steve Woolgar, Laboratory Life. The
Social Construction of Scientific Facts, Beverly Hills 1979 und Ian
Hacking, Representing and Intervening. Introductory Topics in the
Philosophy of Natural Science, Cambridge 1983, S. 130-146.2 David Wellbery, The Exteriority of Writing, in: Stanford Literature
Review 9, 1992, S. 11-23, hier S. 13.
2
zwischen Techniken und Körpern beschrieb: »Die Maschine, das
sind wir...«?3
Jedenfalls hat Kittler auf Versäumnisse dieser Art in
durchaus lacaniascher Weise reagiert: Er hat sie in
invertierter Form zurückgegeben. 1995, im »Nachwort zur dritten
Auflage« seines bis heute bekanntesten Buches, beklagt er den
Zustand der aktuellen Wissenschaftsgeschichte. Mit Blick auf
mögliche Anschlüsse an die Analysen der laborgestützten
»Vivisektionen von Sprache und Schrift«,4 wie sie vor allem im
zweiten Teil der Aufschreibesysteme enthalten sind, konstatiert
Kittler, es gebe, »trotz aller Versuche, Physiologie und
Medientechnik der Jahrhundertwende enger zu korrelieren, die
angemessene Wissenschaftsgeschichte erst in Ansätzen«.5
3 Donna Haraway, Lieber Kyborg als Göttin! Für eine sozialistisch-
feministische Unterwanderung der Gentechnologie, in: Bernd-Peter Lange/Anna
Maria Stuby (Hg.), »1984«, Berlin 1984, S. 66-84, hier S. 67 und S. 81. 4 Friedrich A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, 3. vollst. überarb.
Aufl., München 1995, S. 270. Die erste Auflage stammt von 1985, die zweite
erschien 1987.5 Ebenda, S. 524. An anderer Stelle wird den anglo-amerikanischen Historikern
wenigstens das Verdienst zugesprochen, »Wissenschaftsgeschichte als
Kriegsgeschichte« schreiben zu können, und zwar deshalb weil sie auf der
Seite derer stünden, die ihre Siege im Zweiten Weltkrieg einer »neuen
Technik des Denkens selber: dem Computer« verdankt hätten. Siehe Friedrich
Kittler/Christoph Tholen, Vorwort der Herausgeber, in: dies. (Hg.),
Arsenale der Seele. Literatur- und Medienanalyse seit 1870, München 1989,
S. 7-11, hier S. 7.
3
Die »Versuche«, von denen an dieser Stelle ohne nähere
Angaben die Rede ist, sind allem Anschein nach die Studien von
François Dagognet, Anson Rabinbach, Marta Braun und Soraya de
Chadarevian, die am Beispiel von Mareys »graphischer Methode«
den Zusammenhang von Wissenschafts- und Mediengeschichte in der
Tat prägnant verdeutlicht hatten – teilweise mit explizitem
Bezug auf Kittler.6
Fragt sich also, was »angemessen« heißt. Zunächst einmal
sieht Kittler die Wissenschaftsgeschichte in der Pflicht, die
Hintergründe für bezeichnende Begegnungen zwischen Physiologen
und Medientechnikern zu erhellen, beispielsweise zu klären,
»was Helmholtz in Chicago dazu gebracht hat, vor allen anderen
Kollegen Edison die Hand zu schütteln« – erst dann könne man
6 François Dagognet, Etienne-Jules Marey. La passion de la trace, Paris
1987; Anson Rabinbach, The Human Motor. Energy, Fatigue, and the Origins of
Modernity, New York 1990; Marta Braun Picturing Time. The Work of Etienne-
Jules Marey (1830-1904), Chicago 1992 und Soraya de Chadarevian, Die
»Methode der Kurven« in der Physiologie zwischen 1850 und 1900, in: Hans-
Jörg Rheinberger/Michael Hagner (Hg.), Die Experimentalisierung des Lebens.
Experimentalsysteme in den biologischen Wissenschaften 1850-1950, Berlin
1993, S. 28-49. Siehe ferner die Arbeiten von Timothy Lenoir, The Eye as
Mathematician. Clinical Practice, Instrumentation, and Helmholtz's
Construction of an Empiricist Theory of Vision, in: David Cahan (Hg.),
Hermann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science,
Berkeley – Los Angeles – London 1993, S. 109-153 sowie ders., Helmholtz and
the Materialities of Communication, in: Osiris 9, 1994, S. 185-207.
4
wissen, »was Augen heute sehen und Ohren heute hören«.7 Die
Aussagekraft solcher Begegnungen wird allerdings gleich wieder
heruntergespielt. Eine »angemessene Wissenschaftsgeschichte«
dürfe sich, so Kittler nämlich weiter, nicht mit »Anekdote[n]
über Muybridge oder Edison« zufrieden geben, sondern müsse sich
der Mathematik öffnen: »Das Aufschreibesystem von 1900, wenn es
denn zur Schließung kommt, wird ohne Peano, Hilbert, Turing
nicht beschreibbar gewesen sein.«8
Auch dies erscheint als lacanianische Wendung. Von der
Wissenschaftsgeschichte verläuft der Weg über eine Kombination
von Wissenschafts- und Technikgeschichte, um schließlich in der
Mathematik und ihrer Geschichte zu seinem eigentlichen
Bestimmungsort zu finden. Auf gedrängtem Raum wird so vom
Imaginären der Subjekte über »Gadgets oder Instrumente«9 auf
die symbolische Ordnung rekurriert. Denn es ist der Zug der
Signifikanten in dieser Ordnung, dem, wie Lacan (und Kittler
7 Kittler, Aufschreibesysteme, wie Anm. 4, S. 524.8 Ebenda.9 Jacques Lacan, Le séminaire, livre XX. Encore, Paris 1975, S. 33-34,
zitiert nach Friedrich Kittler, Draculas Vermächtnis, in: Dieter Hombach
(Hg.), Zeta 02. Mit Lacan, Berlin 1982, S. 103-136, hier S. 105.
5
mit ihm) sagt, die Subjekte »gehorsamer als die Schafe«
folgen.10
Der vorliegende Beitrag unternimmt einen ersten Versuch,
das Verhältnis des Kittlerschen Werks zur
Wissenschaftsgeschichte unabhängig von den gegenläufigen
Verspätungen des akademischen Betriebs zu betrachten. Die dabei
verfolgte Annahme lautet, daß dieses Verhältnis kaum als
äußerliches zu fassen ist. Denn zum einen ist es tatsächlich
nicht ausgemacht, ob (und wenn ja, ab wann) dieses Werk im
Sinne einer »Mediengeschichte« aufzufassen wäre, die sich in
mehr oder weniger umrissener Weise auf den ebenfalls mehr oder
weniger umrissenen Bereich der »Wissenschaftsgeschichte«
beziehen könnte. Wie die Herausgeber dieses Bandes in ihrem
Exposé zu Recht herausstellen, haben die Arbeiten von Kittler
nie »auf eine Theorie und Geschichte von Einzelmedien«
abgezielt, sondern waren im Grunde auf »eine Geschichte der
Literatur, des Geistes, der Seele und der Sinne« ausgerichtet –
oder, um den frühen Kittler zu bemühen, auf eine grundlegende
10 Jacques Lacan, Das Seminar über E. A. Poes »Der entwendete Brief«
[1956/1966], übers. von R. Gasché, in: ders., Schriften I, hg. von Norbert
Haas, Frankfurt am Main 1975, S. 7-60, hier S. 29 und Friedrich Kittler,
Die Welt des Symbolischen – eine Welt der Maschine, in: Götz
Großklaus/Eberhard Lämmert (Hg.), Literatur in einer industriellen Kultur,
Stuttgart 1989, S. 521-536, hier S. 531.
6
Auseinandersetzung mit dem Problemkomplex Literatur, Wahnsinn,
Wahrheit.11
Zum anderen steht Kittler, sofern er sich den »Programmen
des Poststrukturalismus« verpflichtet sieht, mit der
Wissenschaftsgeschichte sogar in direkterer Verbindung als mit
einer Mediengeschichte, die etwa an Marshall McLuhan oder
Walter Benjamin anschließen würde. Kittler betrachtet die
Archäologie des Wissens im Sinne Michel Foucaults als
wesentlichen Bestandteil der poststrukturalistischen Programme
und greift ausdrücklich Foucaults Vorhaben auf, »Macht- und
Wissensformen« auf die Regeln hin zu untersuchen, nach denen
»die faktisch ergangenen Diskurse einer Epoche« organisiert
sind.12 Auch die zahlreichen Referenzen auf Jacques Derrida,
die zumindest das Frühwerk von Kittler durchziehen, sind als
Gesten in diese Richtung zu begreifen. Derrida hat seine
frühesten Überlegungen zum Problem der Schrift ja in
Auseinandersetzung mit Edmund Husserls historisch-
epistemologischem Fragment über die »Ursprünge der Geometrie«
entwickelt, in dem das Phänomen der Schriftlichkeit mit der
11 Friedrich A. Kittler, Der Traum und die Rede. Eine Analyse der
Kommunikationssituation Conrad Ferdinand Meyers, Bern–München 1977, S. 324-
330.12 Kittler, Aufschreibesysteme, wie Anm. 4, S. 519.
7
Tradierung wissenschaftlichen Wissens in Zusammenhang steht
– ganz abgesehen davon, daß in diesem Fragment auch die Formel
vom »historischen Apriori« geprägt wird.13
In seiner Besonderheit wird das Verhältnis des
Kittlerschen Werks zur Wissenschaftsgeschichte jedoch erst
faßbar – so die zweite Annahme dieses Beitrags –, wenn die
Funktion in Rechnung gestellt wird, die der Psychoanalyse
Jacques Lacans in diesem Werk zukommt. Es ist bekannt, daß
neben Foucault (und Nietzsche) Lacan zu den wenigen
durchgängigen Bezugsgrößen der Arbeiten von Kittler zählt. Die
Rolle, die Lacan für das Kittlersche Werk spielt, wird im
Folgenden aber als eine grundsätzlich orientierende begriffen.
Zugespitzt könnte man sagen, daß sich Kittlers Anschluß an
Foucault (und Derrida) unter dem Vorzeichen der lacanianischen
13 Jacques Derrida, Husserls Weg in die Geschichte am Leitfaden der
Geometrie. Ein Kommentar zur Beilage III der »Krisis«, übers. von R.
Hentschel/A. Knop, München 1987, S. 120.
8
Psychoanalyse vollzieht, 14 was im Gegenzug zur Folge hat, daß
Lacans Theoreme (oder »Matheme«) historisiert werden. 15
Wir gehen davon aus, daß eben darin die ganze Aktualität,
aber auch die ganze Problematik von Kittlers Verhältnis zur
Wissenschaftsgeschichte liegt. Durch die Orientierung an Lacan
werden Themen generiert, die auch für die heutige
Wissenschaftsgeschichte von großem Interesse sind; die
Werkzeuge, mit denen diese Themen bearbeitet werden, bewahren
aber deutliche Distanz zu den Prinzipien und Methoden der
aktuellen Historiographie der Wissenschaften. 16
14 Es ist also nicht »die foucaultsche Umschrift Lacans«, die hier zur
Debatte steht. Siehe in diesem Sinn Geoffrey Winthrop-Young, Friedrich
Kittler zur Einführung, Hamburg 2005, S. 57. Es geht hier, genau umgekehrt,
um eine lacanianische Umschrift Foucaults. Siehe in ähnlicher Weise
Nicholas Gane, Radical Post-humanism. Friedrich Kittler and the Primacy of
Technology, in: Theory, Culture & Society 22/3, 2005, S. 25-41, hier S. 32.15 Zur Epistemologie des späten Lacan siehe Athanasios Lipowatz, Diskurs und
Macht. Jacques Lacans Begriff des Diskurses, Marburg 1982; Mark Bracher, On
the Psychological and Social Functions of Language. Lacan’s Theory of the
Four Discourses, in: ders. et al. (Hg.), Lacanian Theory of Discourse.
Subject, Structure, and Society, New York – London 1994, S. 107-128; Jason
Glynos/Yannis Stavrakakis (Hg.), Lacan & Science, London–New York 2002
sowie zuletzt Ivo Gurschler/Sándor Ivády/Andreas Wald (Hg.), Lacan 4 D. Zu
den vier Diskursen in Lacans Seminar XVII, Wien – Berlin 2013. 16 Die aktuelle Wissenschaftsgeschichte bezieht sich nur sehr selektiv auf
die Epistemologie Lacans. Siehe Latour/Woolgar, Laboratory Life, wie Anm.
1, S. 168; Hans-Jörg Rheinberger, Experimentalsysteme und epistemische
Dinge. Eine Geschichte der Proteinsynthese im Reagenzglas, Göttingen 2001,
S. 18, S. 154 und S. 246 sowie Evelyn Fox Keller, Das Leben neu denken.
9
1. Paranoia = Erkenntnis
Jeder Student der Medienwissenschaft weiß es. Die Handbücher
zur Medientheorie sagen es, der Autor selbst hat wiederholt
darauf hingewiesen: Der Titel Aufschreibesysteme verdankt sich
einer Übernahme des Ausdrucks aus Daniel Paul Schrebers
Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Deutlich weniger bekannt ist
demgegenüber der Sachverhalt geblieben, daß auch Lacan den
fraglichen Ausdruck verwendet hat – etwa in der Analyse, die
dieser »Unsterbliche«17 in den 1950er Jahren den Denkwürdigkeiten
gewidmet hat. Dort heißt es unter anderem, daß Schrebers Gott
die Dinge nur an der Oberfläche kenne. Dieser Gott »sieht nur,
was er sieht, was das Innere anbelangt, versteht er nichts,
aber nachdem alles durch das sogenannte Aufschreibesystem
[système de notation] irgendwo eingeschrieben ist, auf kleinen
Zetteln, wird er schließlich, am Ende dieser Totalisierung,
dennoch vollkommen auf dem laufenden sein.«18 Übrigens war es
auch Lacan, der Mitte der 1960er Jahre dafür sorgen sollte, daß
Metaphern der Biologie im 20. Jahrhundert, übers. von I. Leipold, München
1998, S. 65-102.17 Friedrich Kittler, Jacques Lacan, in: ders., Unsterbliche. Nachrufe,
Erinnerungen, Geistergespräche, München 2004, S. 117-126.18 Jacques Lacan, Das Seminar, Buch III. Die Psychosen, übers. von M.
Turnheim, Weinheim – Berlin 1997, S. 153.
10
in den epistemologisch ausgerichteten Cahiers pour l’analyse in
Fortsetzungen eine Übersetzung von Schrebers Denkwürdigkeiten ins
Französische veröffentlicht wurde.19
Das sind keine bloße Koinzidenzen. Tatsächlich erschließt
sich über Lacan überhaupt erst der Grund dafür, warum Kittler
die Schreber-Rolle für sich in Anspruch nimmt. Dem liegt
nämlich nicht bloß ein nietzscheanisches »Pathos für den
leidenden Körper« zugrunde, wie Wellbery vermutet hat,20 oder
eine Auffassung des Wahnsinnigen als Prognostiker und
Seismographen der modernen Gesellschaft, wie Jussi Parikka
nahelegt hat.21 Der Buchtitel konfrontiert mit einem
abstrakteren Problem: dem Verhältnis von Wahn und Wissenschaft.
In Kittlers Augen ist Lacan das außerordentliche Kunststück
gelungen, »Definitionen von Wahnsinn« zu finden, die »auch den
Definierenden einschließen«.22 Die Aufschreibesysteme stellen den 19 Siehe dazu Jacques Lacan, Présentation, in: Cahiers pour l’analyse 5,
1966, S. 69-72. Über die Cahiers pour l’analyse siehe Peter Hallward/Knox Peden
(Hg.), Concept and Form, 2 Bde., London – New York 2012.20 David Wellbery, Foreword, in: Friedrich A. Kittler, Discourse Networks
1800/1900, übers. von M. Metteler, with C. Cullens, Stanford, CA 1990, S.
vii-xxxiii, hier S. xv.21 Jussi Parikka, What is Media Archaeology?, Cambridge – Malden, MA 2012,
S. 56-57.22 Friedrich Kittler, Flechsig/Schreber/Freud. Ein Nachrichtennetzwerk der
Jahrhundertwende, in: Der Wunderblock 11/12, 1984, S. 56-68, hier S. 66,
Anm. 2.
11
ehrgeizigen Versuch dar, dieses Kunststück vom Terrain der
Psychoanalyse auf das der Literaturwissenschaft zu übertragen.
Es geht also nicht um ein irgendwie aufschlußreiches
Unbehagen in der Kultur, aber auch nicht um Krankengeschichten,
die wie Novellen zu lesen wären. Was durch die Schreber-Lacan-
Referenz fokussiert wird, ist vielmehr die strukturelle
Verwandtschaft von Wahngebilde und Theoriebildung, auf die
schon Freud am Ende seiner Auseinandersetzung mit den
Denkwürdigkeiten angespielt hatte: »Die durch Verdichtung von
Sonnenstrahlen, Nervenfasern und Samenfäden komponierten
›Gottesstrahlen‹ Schrebers sind eigentlich nichts anderes als
die dinglich dargestellten, nach außen projizierten
Libidobesetzungen [...].«23 Die schwindelerregende Perspektive,
die sich für den Gründervater der Psychoanalyse durch diese
»auffällige Übereinstimmung« zwischen paranoidem Wahn und
psychoanalytischer Theorie eröffnete, hatte er einige Monate
zuvor in einem Brief an Ferenczi klar umrissen: »Mir ist das
23 Sigmund Freud, Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch
beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides) [1910/11], in: ders.,
Gesammelte Werke, chronologisch geordnet. Band 8, Werke aus den Jahren
1909-1913, 3. Aufl., London 1955, S. 239-320, hier S. 315.
12
gelungen, was dem Paranoiker mißlingt«24 – eine Vergrößerung
des Ichs durch Deutungsarbeit.
Lacan konnte vergleichsweise gelassen in diesen Abgrund
blicken. Durch seine psychiatrische Erfahrung war er seit den
1920er Jahren mit den produktiven Aspekten der paranoischen
Psychosen bestens vertraut. Diese Vertrautheit ging so weit,
daß er im Aufsatz über das Spiegelstadium im Jahr 1949
beiläufig bemerkt, daß die »gesellschaftlich[e] Dialektik [...]
die menschliche Erkenntnis als eine paranoische
strukturiert«.25 Noch knapper faßte sich Lacan ungefähr zur
selben Zeit im »Vortrag über die psychische Kausalität«, wo er
nur kurz daran erinnert, früher einmal den Begriff der
»paranoischen Erkenntnis« geprägt zu haben.26
Zieht man den damaligen Stand der Lacanschen
Theoriebildung in Betracht, läßt sich die mit solchen
24 Sigmund Freud, [Brief an Sándor Ferenczi, 6. Oktober 1910, 171 F], in:
Sigmund Freud/Sándor Ferenczi, Briefwechsel, Band I/1 (1908-1910), hg. von
Eva Brabant/Ernst Falzeder/Patrizia Giampieri-Deutsch, Wien – Köln – Weimar
1993, S. 312-314, hier S. 313.25 Jacques Lacan, Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion wie sie uns
in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint [1949], übers. von P.
Stehlin, in: ders., Schriften I, wie Anm. 10, S. 61-70, hier S. 66.26 Jacques Lacan, Vortrag über die psychische Kausalität [1950], übers. von
H.-J. Metzger, in: ders., Schriften III, 2. Aufl., Weinheim – Berlin 1986,
S. 123-171, hier S. 157.
13
Statements aufgerufene Position etwa in folgender Weise
charakterisieren. Erkenntnis (conaissance) ist – erstens – nicht
einfach die Wahrnehmung eines Äußeren, die von einem Innen
unvermittelt aufgenommen wird, um auf diesem Wege zu
Übereinstimmungen zu kommen. Erkenntnis ist vielmehr zunächst
ein weitgehend offener, konstruktiver Vorgang, der zu durchaus
unterschiedlichen Wahrnehmungen führen kann. In ihrer Absetzung
vom common sense zeigt sich das beispielhaft an den extrem
künstlichen Wahrnehmungen der Wissenschaft, aber eben auch an
der Paranoia, die Lacan zufolge gerade nicht auf falschen
Interpretationen von Wahrnehmungen beruht, sondern zunächst
einmal auf anderen Wahrnehmungen.27
Zweitens, Erkenntnis ist ein interaktiver, sozialer
Prozeß, ein Prozeß, der nicht nur in der Auseinandersetzung von
Innen und Außen abläuft, sondern ebenso in einer
»gesellschaftlichen Dialektik«, d.h. in der Auseinandersetzung
zwischen Ich und Anderem. Deswegen sagt Lacan, connaissance sei
niemals co-naissance, also Gleichursprünglichkeit von Subjekt und
27 Jacques Lacan, Über die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur
Persönlichkeit [1932], übers. von H.-D. Gondek, in: ders., Über die
paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur Persönlichkeit und Frühe
Schriften über die Paranoia, Wien 2002, S. 13-358, hier S. 289.
14
Objekt oder Subjekt und Subjekt.28 Aufgrund seiner biologischen
Unbestimmtheit läuft das Ich immer schnell Gefahr, durch
Effekte des Imaginären (Bilder, Idole, »gute Gestalten«)
dominiert zu werden. Erst die Einlassung auf die
vergleichsweise langsame Welt des Symbolischen kann dazu
beitragen, diese Effekte aus dem Weg zu räumen und damit den
Annäherungsprozeß an »das Reale« voranzubringen.
Das wäre der dritte Punkt: Menschliche Erkenntnis ist in
dem Sinne paranoisch strukturiert, als sie, egal ob in
Alltagswelt, Labor oder Krankheit beheimatet, eine grundlegend
deutende Dimension enthält. Stets ist es für sie
charakteristisch, an kein definitives Ende zu kommen.
Erkenntnis kann das Wirkliche immer besser auslegen, es aber
nie wirklich erfassen. Auch in diesem Sinne ist das Reale das
Unmögliche.
Der frühe Lacan ließ es allerdings nicht dabei bewenden,
die Aufmerksamkeit auf formale Ähnlichkeiten zwischen Paranoia
und Erkenntnis zu lenken. Auch den Wahninhalten, der gesamten
Tönung und der persönlichen Ausrichtung des Deliriums galt sein
Interesse. Im klinischem Alltag erschien ihm der Paranoiker
28 Jacques Lacan, Das Seminar, Buch II. Das Ich in der Theorie Freuds und in
der Technik der Psychoanalyse, übers. von H.-J. Metzger, 2. Aufl., Berlin
1991, S. 283.
15
nicht als böswilliger, aggressiver Psychotiker, sondern als
idealistische, sozial engagierte und überaus moralische,
»hypermoralische« Persönlichkeit,29 die dazu tendiert, sich
selbst zu bestrafen. Der paranoische Psychotiker ist demzufolge
nicht in sich gekehrt, sondern richtet sich mit seiner
gesteigerten Aufmerksamkeit und Empfindsamkeit auf die Umwelt,
in der er lebt. Diesen Umweltaspekt bekräftigt Lacan, wenn er
erklärt, der Deutungswahn sei »ein Wahn des Treppenabsatzes,
der Straße, des öffentlichen Raumes«.30 In diesem Umfeld sei
der paranoische Psychotiker aufgrund seiner gesteigerten
Empfindsamkeit dazu in der Lage, blitzschnell »die Relevanz
eines vernommenen Satzes, eines kurz erblickten Bildes, der
Geste eines Passanten, der ›Spaltenlinie‹, an der der Blick
beim Lesen einer Zeitung hängen bleibt«, zu erkennen.31
Die Pointe ist, daß dem paranoiden Wahn in dieser
Sichtweise ein erheblicher »Realitätswert« zugesprochen wird.32
Lacan geht sogar so weit zu sagen, daß die paranoische Psychose
jene »instinktiven und sozialen Komplexe« klar zum Ausdruck
bringe, die die Psychoanalyse bei den Neurotikern nur unter
29 Lacan, Über die paranoische Psychose, wie Anm. 27, S. 267.30 Ebenda, S. 212.31 Ebenda, S. 211.32 Ebenda, S. 293.
16
Schwierigkeiten zutage fördere. Im Gegensatz zu »den Träumen,
die gedeutet werden müssen« sei der Wahn des Paranoikers »aus sich
heraus eine deutende Tätigkeit des Unbewußten«.33
Diese Form einer »deutenden Tätigkeit des Unbewußten« ist
es, an die Kittler mit seiner Übernahme der Schreber-Rolle
anschließt. Mit Lacan wäre zu präzisieren, daß es sich dabei
auch um eine Frage des Stils handelt: »Man kann das paranoische
Erlebnis und die Weltauffassung, die es hervorbringt, als eine
originale Syntax betrachten, die dazu beiträgt, durch die ihr
eigenen Verständniszusammenhänge die menschliche Gesellschaft
zu bestätigen.«34 Insofern scheint es nicht ganz treffend, mit
Blick auf Kittlers frühe Arbeiten von der Emergenz einer
»historischen Sensibilität« zu sprechen.35 Tatsächlich haben
wir es mit der Ausprägung einer historischen Sensitivität zu tun,
eines auf die Geschichte orientierten Beziehungsdenkens, das 33 Ebenda, S. 290.34 Jacques Lacan, Das Problem des Stils und die psychiatrische Auffassung
paranoischer Erlebnisformen, übers. von B. Weidmann, in: Salvador Dalí,
Unabhängigkeitserklärung der Phantasie und Erklärung der Rechtes des
Menschen auf seine Verrücktheit. Gesammelte Schriften, hg. von Axel
Matthes/Tilbert Diego Stegmann, Frankfurt am Main 1974, S. 352-356, hier S.
356 (Hervorhebung hinzugefügt).35 Hans Ulrich Gumbrecht, Mediengeschichte als Wahrheitsereignis. Zur
Singularität von Friedrich A. Kittlers Werk, in: Friedrich A. Kittler, Die
Wahrheit der technischen Welt. Essays zur Genealogie der Gegenwart,
Frankfurt am Main 2013, S. 396-422, hier S. 402.
17
(wie wir noch sehen werden) mit enormer Hellsichtigkeit
zwischen biographischen Details und großen Diskursformationen
oszilliert – wie ein Analytiker zwischen kleinen Versprechern
und ganzen Familienkomplexen oder ein Paranoiker zwischen dem
flüchtigen Blick eines Passanten und einem göttlichen System.
Die Form der Analyse, die so entsteht, ist nichts anderes
als »geglückte Paranoia«, wie Kittler an anderer Stelle mit
einer Formulierung Lacans sagt, die ihrerseits auf die oben
erwähnte Passage aus Freuds Brief an Ferenczi anspielt.36 Diese
Form der Analyse beschränkt sich nicht darauf, die für sie
spezifische Außenwelt – etwa die Literatur oder das Werk eines
Autors – abzubilden, sondern nähert sich dem von ihr selbst
generierten Gegenstand –»Diskursen« – an, ohne indes den
Ehrgeiz haben zu können, ihn letztlich dingfest zu machen. Ihre
Produktivität liegt genau darin, »von der Wahrheit nichts
wissen zu wollen«,37 d. h. deutlichen Abstand zum Generellen
und Allgemeinen zu halten, um im Gegenzug Treue zum konkreten
36 Friedrich A. Kittler, Einleitung, in: ders. (Hg.), Austreibung des
Geistes aus den Geisteswissenschaften. Programme des Poststrukturalismus,
Paderborn 1980, S. 7-14, hier S. 12 und Jacques Lacan, Die Wissenschaft und
die Wahrheit, übers. von H.-J. Rheinberger, in: ders., Schriften II, hg.
von Norbert Haas, 3., korr. Aufl., Weinheim—Berlin 1991, S. 231-257, hier
S. 254.37 Kittler, Einleitung, wie Anm. 36, S. 12.
18
Material bewahren zu können – oder eben zum Stil, zur
»originalen Syntax«.
Auf diese Weise kann Kittlers Analyse sich auf einer Ebene
mit den Denkwürdigkeiten Schrebers oder etwa den Romanen Thomas
Pynchons verorten. Sie sucht die Nähe zum Realitätswert
bestimmter Wahnvorstellungen, und zwar unabhängig davon, ob
diese nun in der Klinik oder durch den Literaturbetrieb
hervorgebracht werden. Umgekehrt ist eben deswegen Literatur
überhaupt dazu in der Lage, »Klartext« zu reden: weil sie
wahlweise »Paranoia der schlimmstmöglichen Wendung oder
Erkenntnis« ist.38
2. Die Historisierung einer Epistemologie
Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht mehr als ganz so
selbstverständlich, daß Kittler die Nähe zur Diskursanalyse
Foucaults gesucht hat. Zwar erinnert das Schema, das im
Nachwort zur zweiten Auflage der Aufschreibesysteme suggeriert
wird, an Kittlers frühe Beiträge zur »psychoanalytischen und
psychopathologischen Literaturwissenschaft«. So wird in der
1981 veröffentlichten Studie zu Novalis’ »Heinrich von
Ofterdingen« ein erster, an Lacan orientierter Teil zur
38 Kittler/Tholen, Vorwort der Herausgeber, wie Anm. 5, S. 7.
19
»Psychoanalyse von Klingsohrs Märchen« klar von einem zweiten,
auf Foucault (und Derrida) ausgerichteten Teil zur
»Diskursanalyse des romantischen Romans« unterschieden.39
Aber es wäre etwas zu einfach, die Dissertationsschrift,
Der Traum und die Rede, in analoger Weise von der
Habilitationsschrift, den Aufschreibesystemen, abzugrenzen. Denn
zum einen hat schon die Studie über Conrad Ferdinand Meyer sich
auf Lacan und Foucault berufen, um den Wahn ebenso wie die
Literatur auf die »Kommunikationssituation« des Schreibers
zurückzubeziehen: »Vor den Texten, deren Autor Conrad Ferdinand
Meyer heißt, heißt es Meyer als Hörer der Diskurse Anderer zu
analysieren.«40 Zum anderen bleiben auch und gerade die
Aufschreibesysteme insofern psychoanalytisch orientiert, als sie
Diskurse im Sinne Lacans als eine »symbolische Form«, also
letztlich als eine gegen das Imaginäre arbeitende Schrift
begreifen, mit »der sich das Unbewußte in sozialen Beziehungen
manifestiert«.41
39 Friedrich A. Kittler, Die Irrwege des Eros und die »absolute Familie«.
Psychoanalytischer und diskursanalytischer Kommentar zu Klingsohrs Märchen
in Novalis’ »Heinrich von Ofterdingen«, in: Bernd Urban/Winfried Kudszus
(Hg.), Psychoanalytische und psychopathologische Literaturinterpretation,
Darmstadt 1981, S. 421-470 (Hervorhebung hinzugefügt).40 Kittler, Der Traum und die Rede, wie Anm. 11, S. 24.41 Lipowatz, Diskurs und Macht, wie Anm. 15, S. 123.
20
Damit steht zwar auch die Frage nach den
»Möglichkeitsbedingungen von Literaturwissenschaft« im Raum.42
Aber die Antwort, die Kittler auf diese Frage gibt, bleibt auf
Distanz zu dem, was diesbezüglich von einer Archäologie des
Wissens oder einer Wissenschaftsgeschichte der
Literaturwissenschaft zu erwarten wäre. Statt nämlich etwa im
Sinne Foucaults die Formationsregeln anzugeben, denen die
Gegenstände, Äußerungsmodalitäten, Begriffe und thematische
Entscheidungen dieser Wissenschaft unterlagen,43 warten die
Aufschreibesysteme mit einer an Lacans Unterscheidung der »Vier
Diskurse« ausgerichteten Rekonstruktion von zwei Macht- und
Wissensformen auf, die in ihrer Entstehung zwar datiert sind,
aber bis heute die Relationierung zwischen Literatur und
Wahnsinn bestimmen. Auf der einen Seite steht die um 1800
aufkommende Hermeneutik, die in Lacans Schema dem »Diskurs des
Herrn« und dem »Diskurs des universitären Wissens« entspricht,
insofern sie die Herrschaft eines vorgeblich neutralen Wissens
begründet, das den Wahnsinn als sinnlos verurteilt. Auf der
anderen Seite wird der um 1900 entstandene Strukturalismus als
eine Kombination aus dem »Diskurs der Hysterie« und dem
42 Kittler, Aufschreibesysteme, wie Anm. 4, S. 519.43 Michel Foucault, Archäologie des Wissens, übers. von U. Köppen, 7. Aufl.,
Frankfurt am Main 1995, S. 58.
21
»Diskurs des Analytikers« in Stellung gebracht, der die
Unabschließbarkeit des Wissensprozesses akzeptiert und mit der
Willkürlichkeit von Signifikanten buchstäblich rechnen kann.
Die hier kenntlich werdende Differenz zu Foucault zeigt
sich am deutlichsten an der Geschlechterfrage. Sicherlich, auch
Kittler ist an der Beziehung von »Sexualität und Wahrheit«
interessiert, aber dieses Interesse ist, anders als bei
Foucault, nicht am relativ abstrakten Gebrauch der Lüste,
sondern an Strukturen konkreter Familien zurückgebunden: Dichter-
Mutter-Kind.44 »Das Andere« heißt in dieser Sichtweise »immer das
andere Geschlecht«, wie Kittler ausdrücklich betont,45 und
dementsprechend läßt sich der wesentliche Unterschied zwischen
den beiden »Aufschreibesystemen« nicht nur insgesamt an der
Frage des Wahnsinnsausschlusses, sondern auch und insbesondere
an der jeweils unterschiedlichen Rolle des Geschlechts
festmachen.
44 Vermutlich hat Kittler aus diesem Grund den Familien-Text von Lacan
übersetzt und erläutert. Siehe Jacques Lacan, Die Familie [1938], übers.
von F. A. Kittler, in: ders., Schriften III, wie Anm. 26, S. 40-100. Die
bedeutende Rolle, die Kittler in der deutschsprachigen Lacan-Rezeption
gespielt hat, ist noch nicht gewürdigt worden. Siehe immerhin Hans-Dieter
Gondek/Michael Schmid/Peter Widmer, Lacan in den deutschsprachigen Ländern
– eine Bilanz, Riss 33/34, 1996, S. 113-139, hier S. 117.45 Kittler, Aufschreibesysteme, wie Anm. 4, S. 218.
22
So steht die Hermeneutik für die Einsetzung der Mutter als
oberster Diskursmacht und damit zugleich als eines großen,
umfassenden und einheitlichen Tresors von Signifikaten, deren
Sinn letztlich festgelegt ist. Der Strukturalismus markiert
dagegen das Aufkommen von »Frauen im Plural«, die das Subjekt
des Wissens mit einer unbegrenzten Vielzahl von willkürlichen
und zufällig verteilten Zeichen, also Signifikanten
konfrontiert. Deshalb läßt sich auch sagen, daß die Einsetzung
des Aufschreibesystems 1900 auf einem »Damenopfer« beruht.46 Es
liquidiert alle Diskurse, »die Geschlechter unifizieren«, und
löst damit eine Wissensform ab, die – gestern wie heute – auf
einem »Männerbund der Erziehungsbeamten« beruht, der
sicherstellt, daß der Funktionsort »Mutter« immer auch durch
Abstraktionen wie »Die Natur« oder Institutionen wie »Die
Universität« alias Alma Mater besetzt werden kann.47
Neben einer Geschichte der Literaturwissenschaft und einer
Geschichte der Geschlechterverhältnisse in den
Geisteswissenschaften ist dies das dritte große Thema, das die
Aufschreibesysteme umreißen: die Geschichte der Universität. Und
erneut ist es die Orientierung an Lacan, die hierbei zu
46 Ebenda, S. 441.47 Ebenda, S. 439.
23
interessanten Perspektivierungen führt. Zwar rekurriert Kittler
in diesem Zusammenhang auch immer wieder auf Nietzsches quasi-
ethnographische Beschreibung der Universität als
»Bildungsmaschine«, in der diese als Zusammenfügung eines
professoralen Munds und einer Masse von studentischen Ohren
erscheint.48 Aber es ist die Lacansche Charakterisierung des
Diskurses des universitären Wissens als eines bürokratischen
Diskurses, auf die er sich in seinen Analysen vor allem stützt.
Lacan zufolge ist der »Diskurs der Universität« nämlich
mit dem »Diskurs des Herrn« insofern verwandt, als er die
Herrschaft eines objektiven Wissens proklamiert – eines
Wissens, das sich zum einen durch den Ausschluß der
Geschlechterdifferenz, also des Ausschlusses von Angst vor dem
unassimilierbaren Rest, dem »Objekt klein a«, konstituiert, und
das sich zum anderen durch eine Unterwerfung realisiert, die
eine bestimmte Art von Subjekt hervorbringt. Der Diskurs des
universitären Wissens ist der Diskurs eines All-Wissens (tout-
savoir) und zugleich der Diskurs eines unpersönlichen Systems,
einer Bürokratie.49 In diesem System können Studenten nur eins 48 Ebenda, S. 26 sowie z.B. Friedrich Kittler, Optische Medien. Berliner
Vorlesung 1999, Berlin 2002, S. 9.49 Jacques Lacan, Le séminaire, livre XVII. L’envers de la psychanalyse,
Paris 1991, S. 34. Die deutschsprachige Rezeption dieses Lacan-Seminars
basierte in den 1970er und 1980er Jahren auf einer Vorlesungsmitschrift von
24
werden: Verfasser von Doktorarbeiten, d. h. Produzenten von
Kultur.50
Die Aufschreibesysteme unternehmen es nun, diese Sichtweise
der Universität zu historisieren: beispielsweise indem sie mit
Blick auf das Aufschreibesystem 1800 bündig feststellen, »der
universitäre Diskurs geht vom Diskurs eines Herrn aus«;51
beispielsweise indem sie unterstreichen, daß die Universität
des 19. Jahrhunderts dadurch zur nährenden Mutter wird, daß sie
»Posititivität in einem bürokratischen und damit schriftlichen
Apparat« annimmt, »der ihre Karikatur und Fortschreibung
zugleich ist«;52 beispielsweise indem sie, zunächst auf
Foucault anspielend, behaupten, daß die preußische
Universitätsreform von 1908 eine »radikale Zäsur im Verhältnis
von Sexualität und Wahrheit« darstellt, dieses Verhältnis aber
wenig später – im Rekurs auf Lacan – wesentlich auf »Frauen«
zuschneiden, die »von Sexualität reden«.53
Der Anspruch dieser Analyse des universitären Diskurses
ist kein geringer. Einerseits reklamiert Kittler, damit einen
Monique Chollet. Siehe dazu Thanos Lipowatz, Die vier Diskurse, in: Zeta 02,
wie Anm. 9, S. 137-154, hier S. 152, Anm. 11. 50 Lacan, Le séminaire, livre XVII, wie Anm. 49, S. 220.51 Kittler, Aufschreibesysteme, wie Anm. 4, S. 83.52 Ebenda, S. 70.53 Ebenda, S. 445.
25
blinden Fleck zu erschließen, der noch für die Archäologie des
Wissens kennzeichnend ist: »Selbst Foucault hat 1970, als er
seine künftigen Forschungsprogramme skizzierte und begründete,
nämlich den ›Willen zur Wahrheit‹ auf seiner institutionellen
Basis mitsamt seinen ›materiellen, technischen, instrumentellen
Investitionen der Erkenntnis‹ zu erforschen, die Untersuchung
jener Institution ausgelassen, die ihn eben diese ›Ordnung des
Diskurses‹ entwerfen ließ: die akademische Institution des
Collège de France.«54
Andererseits soll diese Analyse der Universität nicht auf
der Makroebene der Sozial- oder Wirtschaftsgeschichte, sondern
auf der Ebene jener »kleinen Anordnungen« oder Strukturen
durchgeführt werden, die das Funktionieren dieser Institution
in der alltäglichen Praxis sichern. Dazu zählen einerseits die
»kleinen Pädagogiken, die den Kindern erst einmal die Geister
austreiben, um sie hochschulreif zu machen«,55 sowie
andererseits jene Kompilierungsverfahren und Vortragstechniken,
54 Friedrich Kittler/Manfred Schneider, Editorial, in: Friedrich A.
Kittler/Manfred Schneider/Samuel Weber (Hg.), Diskursanalysen 2.
Institution Universität, Opladen 1990, S. 7-11, hier S. 7. Das ist die eine
Absetzung von Foucault. Die andere formulierte Kittler in dem berühmten
Satz »Um 1850 endeten die historischen Untersuchungen Foucaults.« Siehe
dazu Kittler, Aufschreibesysteme, wie Anm. 4, S. 519.55 Kittler, Einleitung, wie Anm. 36, S. 8.
26
mit denen Hochschullehrer ihre Professoralität autorisieren.
Hegel verläßt sich auf einen Zettelkasten, um Weltgeschichte
»auf einen pädagogischen Schattenriß« zu verkleinern,56 während
Lacan einen »Medienverbund zwischen Recorder, Kopfhörer,
Schreibmaschine« einrichtet, um die für sein Seminar
erforderlichen feedback loops zwischen Gelesenem und Gesprochenem
herzustellen.57 Worauf Kittlers Analyse des universitären
Diskurses letztlich abzielt, könnte somit als Untersuchung von
University in Action bezeichnet werden.58
3. Verschiedene Schicksale
Nach Kittlers Rückkehr aus Kalifornien scheint sich, trotz der
dort versäumten Begegnungen, dennoch ein Übergang zu eröffnen,
der von den Aufschreibesystemen zur neueren Wissenschaftsgeschichte
führt. Ende der 1980er Jahre gibt Kittler mit Manfred Schneider
und Samuel Weber zwei Sammelbände heraus, die den eben nicht
nur an Foucault, sondern besonders an Lacan erinnernden Titel
Diskursanalysen tragen. Der erste dieser Bände ist den »Medien«
56 Friedrich Kittler, Die Nacht der Substanz, Bern 1989, S. 19.57 Kittler, Draculas Vermächtnis, wie Anm. 9, S. 103.58 Siehe in diesem Sinn etwa William Clark, Academic Charisma and the
Origins of the Research University, Chicago – London 2006, in der die
Aufschreibesysteme zwar in der Bibliographie auftauchen, aber an keiner Stelle
im Text zitiert werden.
27
gewidmet,59 der zweite der »Institution Universität«. Das
Editorial des zweiten Bandes benennt zumindest die Frage, die
sich mit der Passage zur Wissenschaftsgeschichte stellen würde:
»Wie läßt sich ein Wissen/Forschen noch fassen, das als
Experiment das Reale selbst manipuliert [...]?«60
Es ist aber nicht Kittler, sondern Samuel Weber, der diese
Frage konkretisiert. Im Anschluß an Gaston Bachelards
Einschätzung, daß wissenschaftliche Beobachtung »stets
polemische Beobachtung« ist, schlägt Weber vor, diesen
polemischen Charakter nicht nur – wie Bachelard – auf das
Verhältnis neuer Theorien zu älteren zu beziehen, sondern – mit
Latour – auch im Prozeß des Experimentierens selber zu
verorten. Demzufolge sind Latours Untersuchungen als
Fortführung des anti-realistischen Ansatzes von Bachelard zu
lesen, insbesondere insofern sich schon dieser dafür
interessierte, wie wissenschaftliche Phänomene im Labor
»sortiert, gefiltert, gereinigt, in die Form der Instrumente
gegossen werden.«61
59 Friedrich A. Kittler/Manfred Schneider/Samuel Weber (Hg.),
Diskursanalysen 1. Medien, Opladen 1987.60 Kittler/Schneider, Editorial, wie Anm. 54, S. 10.61 Samuel Weber, Interpretation und Institution, übers. von R. Landvogt, in:
Kittler/Schneider/Weber (Hg.), Diskursanalysen 2, wie Anm. 54, S. 152-166,
hier S. 156.
28
Es bleibt bei der Konkretisierung einer Frage. Die an
dieser Stelle eigentlich naheliegende Verschaltung von
»Aufschreibesystemen« und inscription devices findet nicht statt. Im
Gegenteil, Kittler entfernt sich in den folgenden Jahren immer
mehr von dem Vorhaben, das regelhafte Funktionieren der
Institution Universität auf der Ebene »kleiner Anordnungen« zu
analysieren. Das hat nicht nur mit dem Aufstreben der
Medienwissenschaft (und damit der Mediengeschichte) im
deutschsprachigen Raum zu tun. Dafür gibt es auch
programmatische Gründe. Schon im Nachwort zur zweiten Auflage
der Aufschreibesysteme spricht Kittler sich für historiographische
Momentaufnahmen aus, »deren Perioden in Jahrhunderten zählen«,
um im gleichen Atemzug detailliertere und stärker
kontextualisierte Rekonstruktionen als Beiträge zu einer
letztlich irrelevanten Geschichte »kleinster Schritte oder
Unterschiede« erscheinen zu lassen.62 In späteren Arbeiten
wendet sich Kittlers Gebrauch der Geschichte aber selbst vom
Prinzip der kontrastierenden Diskursschnappschüsse ab, um sich
traditionelleren Formen der Historiographie anzunähern.
Während im Gefolge der Aufschreibesysteme eine jüngere
Generation von Medienwissenschaftlern beginnt, sich mit ihren
62 Kittler, Aufschreibesysteme, wie Anm. 4, S. 521.
29
historischen Projekten in eigenständiger Weise an Derrida,
Foucault oder etwa Canguilhem zu orientieren,63 nehmen die
Aufsätze Kittlers zusehends den Charakter von Fallstudien an,
in denen die Logik ausgedehnter Diskurskomplexe zum Subjekt
avanciert, an dem sich die kleinteilige Geschichtlichkeit der
Subjekte nur noch im Sinne von Symptomen niederschlägt. So
verbindet »Die künstliche Intelligenz des Weltkriegs« einen
rasant kompilierten Überblick zur Entwicklung militärischer
Logistik mit pointierten Einzelbeobachtungen zur Biographie
Turings. Der für das Handbuch Vom Menschen verfaßte Artikel
»Kommunikationsmedien« kombiniert den ebenfalls
kompilatorischen Versuch, über die Geschichte dieser Medien »im
ganzen und allgemeinen zu sprechen«, mit Fokussierungen auf
vielsagende Details, beispielsweise die unterschiedliche
Beschaffenheit von »Schreibflächen«.64 Der späte Essay
Universities. Wet, Hard, Soft, and Harder bringt das Prinzip solcher
Oszillationen auf den Punkt. Der erste Teil, der mit einem 63 Siehe zum Beispiel Bernhard Siegert, Relais. Geschicke der Literatur als
Epoche der Post, 1751-1913, Berlin 1993, Bernhard Dotzler, Papiermaschinen.
Versuch über Communication & Control in Literatur und Technik, Berlin 1996
und Peter Berz, 08/15. Ein Standard des 20. Jahrhunderts, München 2001. 64 Friedrich Kittler, Die künstliche Intelligenz des Weltkriegs. Alan
Turing, in: Arsenale der Seele, wie Anm. 5, S. 187-202 und ders.
Kommunikationsmedien, in: Christoph Wulf (Hg.), Vom Menschen. Handbuch
Historische Anthropologie, Weinheim – Basel 1997, S. 649-661.
30
Kurzabriß der europäischen Universitätsgeschichte aufwartet,
ist »Anamnese« überschrieben. Weitere Teile werden als
»Diagnose« und »Prognose« betitelt.65 Die Nähe zu Lacan wird
damit nochmals unterstrichen.
Unsterbliche greift dagegen auf ein anderes Modell zurück.
Mit den in diesem Band enthaltenen »Nachrufen«, »Erinnerungen«
und »Geistergesprächen« verwandelt sich Kittler die Form der
Elogen an, die Bernard Le Bovier Fontenelle seit Anfang des 18.
Jahrhunderts in der Académie des Sciences auf verstorbene
Mitglieder gehalten hat und damit – Canguilhem zufolge – der
Wissenschaftsgeschichte im heutigen Sinn einen entscheidenden
Anstoß gegeben hat: durch die zusammenfassende, populär
gehaltene Darstellung des Verhältnisses von Leben und
Erkenntnis.66 Ähnlich weit greifen die Vorlesungen über
Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft und Optische Medien zurück, indem
sie, orientiert am Vorbild der Hegelschen Enzyklopädie, ein
»gleichermaßen historisches und systematisches Wissen« über
eine bestimmte Disziplin oder einen bestimmten
65 Friedrich Kittler, Universities. Wet, Hard, Soft, and Harder, in:
Critical Inquiry, Herbst 2004, S. 244-255.66 Kittler, Unsterbliche, wie Anm. 17 und Georges Canguilhem, Fontenelle,
philosophe et historien des sciences [1957], in: ders., Etudes d’histoire
et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie,
7. erw. Auflage, Paris 2002, S. 51-58.
31
Gegenstandsbereich präsentieren. Der Zweck dieser
Präsentationen ist die Einführung von Studenten in die Medien-
und Kulturwissenschaft. Geschichte tendiert hier dazu, zu einem
bloßen Werkzeug der Lehre zu werden – zum »pädagogischen
Schattenriß«.67
Für diese Entwicklung gibt es auch methodologische Gründe.
Trotz der wiederholten Anrufung des »Archivs« als zentralen
Wissensraums von Geschichtsschreibung und trotz des
gelegentlich als Routine präsentierten Einsehens von »Akten«,68
hat Kittlers Auseinandersetzung mit Geschichte nämlich im
Grunde stets an der Vorstellung festgehalten, daß Diskurse
»veröffentlichte Reden« sind. In diesem Sinne heißt es bereits
in Der Traum und die Rede: »Wie bei der Königsfelder Internierung
[Conrad Ferdinand Meyers] wird auch bei den anderen Reden
Anderer nur untersucht, was überliefert ist. Die
unveröffentlichten Dokumente des Zürcher Meyer-Archivs sind
nicht eingesehen worden.«69 Vor diesem Hintergrund liegt es
denkbar fern, einen Blick hinter die Kulissen des universitären
67 Friedrich A. Kittler, Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft,
München 2000 sowie ders., Optische Medien, wie Anm. 48, S. 17.68 Friedrich Kittler/Stefan Banz, Platz der Luftbrücke. Ein Gespräch, hg.
von Iwan Wirth, Berlin 1996, S. 11.69 Kittler, Der Traum und die Rede, wie Anm. 11, S. 25.
32
Betriebs zu werfen, um etwa der kleinteiligen Verfertigung von
wissenschaftlichen oder technischen Tatsachen auf der Ebene von
unveröffentlichten Notizbüchern, Zeichnungen und Briefen
nachzuspüren.
Darüber hinaus bleibt Kittlers Interesse an dem, was die
heutige Wissenschaftsgeschichte als »materielle Kultur«
bezeichnet,70 deutlich begrenzt. Mit Lacan geht er nicht nur
davon aus, daß die »Welt des Symbolischen« eine »Welt der
Maschine« ist.71 Umgekehrt gilt für Kittler auch, daß die Welt
der Maschine letztlich eine Welt des Symbolischen ist.
Bei Lacan wird diese Auffassung in nicht unerheblichem
Maße durch den Rekurs auf die wissenschaftshistorischen und -
philosophischen Studien Alexandre Koyrés gestützt, mit dem der
Psychoanalytiker seit den 1930er Jahren befreundet war. Koyré
zufolge besitzen wissenschaftliche Instrumente im
70 Siehe zum Beispiel Peter Galison, Image and Logic. A Material Culture of
Microphysics, Chicago – London 1997, S. 1-7, wo ausgeführt wird, die
»materielle Kultur« einer Wissenschaft bestehe aus den Maschinen,
Instrumenten und Ausrüstungsgegenständen, die den Alltag des Labors
bestimmen. Siehe in ähnlicher Weise Andrew Pickering, The Mangle of
Practice. Time, Agency, and Science, Chicago – London 1995, S. 1-34, der
als zentralen Gegenstand der Wissenschaftsforschung die »materiellen
Performanzen« sieht, die Wissenschaftler durch ihr Agieren im
»maschinischen Feld« des Labors hervorbringen.71 Kittler, Die Welt des Symbolischen, wie Anm. 10.
33
Wissenschaftsprozeß nämlich nur insofern Bedeutung, als sie
bereits ausformulierte Hypothesen verkörpern. Lacan übersetzt
diese Sichtweise in die zugespitzte These, daß die »physische
Natur« letztlich nichts anderes sei als »eine Hervorbringung
des Geistes [...], deren Instrument das mathematische Symbol
darstellt«.72 Oder in Koyrés eigenen Worten: »Nicht nur gültige
Experimente beruhen auf Theorie, sogar die Mittel, um sie
durchzuführen, sind nichts anderes als leibhaftige Theorie.«73
Damit ist genau die Position bezeichnet, gegen die sich die
Wissenschaftsgeschichte seit Hacking und Latour wendet.
Es überrascht daher nicht, daß der Materialismus, auf den
Kittler sich in seinen Analysen gelegentlich beruft, mit einem
historischen Materialismus nichts zu tun hat.74 Kittlers
vielzitierter Medienmaterialismus begreift sich vielmehr als
72 Jacques Lacan, Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der
Psychoanalyse, übers. von K. Laermann, in: ders., Schriften I, wie Anm. 10,
S. 70-169, hier S. 128. Siehe auch Jacques Lacan, Psychoanalyse und
Kybernetik oder Von der Natur der Sprache, in: ders., Das Seminar, Buch II,
wie Anm. 28, S. 373-390: »Und wenn das Instrument gemacht ist, um die
Hypothese zu bestätigen, so besteht keinerlei Bedarf, das Experiment zu
machen [...]« (S. 378). 73 Alexandre Koyré, Ein Messversuch [1953], in: ders., Leonardo, Pascal und
die Entwicklung der kosmologischen Wissenschaft, übers. von H. Günther,
Berlin 1994, S. 47-80, hier S. 66.74 Diedrich Diederichsen, On All Channels. Media, Technology, and the
Culture Industry, Artforum, September 2012, S. 446-453, hier S. 448.
34
»informationstheoretischer Materialismus«, der vor allem darauf
ausgerichtet ist, Schriftsätze auf die
Kommunikationssituationen zurückzubeziehen, in denen sie
entstanden sind oder entstehen werden.75 Daß die »materielle
Kultur« dieser Kommunikationssituationen erschlossen wird, um
sie am Leitfaden von Schreibzeug und Schreibflächen, von
Instrumenten und Maschinen in eine übergreifende Geschichte von
Kultur und Gesellschaft einzubetten, mag programmatisch
vertreten werden, ist in konkreter Weise aber an keiner Stelle
ausgeführt worden. Trotz des immer wieder bekräftigten
Bekenntnis zur Hardware hat es in Kittlers Arbeit eine
historisch motivierte Untersuchung einzelner medientechnischer
Gerätschaften, die mit den museumsbasierten instrument studies der
Wissenschaftsgeschichte vergleichbar wäre, nicht gegeben. 76
75 Friedrich Kittler, Real Time Analysis, Time Axis Manipulation, in: Georg
Christoph Tholen/Michael O. Scholl (Hg.), Zeit-Zeichen. Aufschübe und
Interferenzen zwischen Endzeit und Echtzeit, Weinheim 1990, S. 363-377,
hier S. 363. Siehe auch ders., Aufschreibesysteme, wie Anm. 4, S. 520. Das
elementare Datum für eine materialistische Diskursanalyse wird darin
gesehen, »daß Literatur (was immer sie sonst noch in Leserkreisen bedeuten
mag) Daten verarbeitet, speichert, überträgt«. Insofern scheint es
fraglich, ob Kittlers Ansatz tatsächlich als eine Überbietung des
Posthumanismus in der aktuellen Wissenschaftsforschung zu verstehen ist.
Siehe in diesem Sinn aber Gane, Radical Post-humanism, wie Anm. 14, S. 39.76 Zu den ›instrument studies‹ siehe zum Beispiel José Ramon Bertomeu
Sánchez/Antonio García Belmar (Hg.), Abriendo las cajas negras. Colección
de instrumentos científicos de la Universitat de València, València 2002
35
Und wenn sich in Kittlers Schriften doch einmal Hinweise
auf die historische Dichte der Medien finden, dann fungieren
diese nicht unter dem Label »Materialität«, sondern sind mit
dem schillernden Begriff des »Realen« im Sinne Lacans
verknüpft. Das Reale wird von Kittler nämlich nicht nur als das
Unmögliche schlechthin betrachtet oder in die Mathematik
reeller Zahlen aufgelöst.77 Es ist für ihn immer wieder auch
eine greifbare Körperlichkeit von Medien – so etwa wenn er mit
Blick auf das Kino schreibt: »Real ist nicht die Seele, sondern
das Zelluloid.«78 Oder wenn es im Kontext der Auschreibesysteme
heißt: »Diesseits der Illusionen Mensch und Welt bleibt an
Realem einzig eine Kontaktfläche oder Haut, wo etwas auf etwas
schreibt.«79
sowie David Pantalony/Richard L. Kremer/Francis Manasek, Study, Measure,
Experiment. Stories of Scientific Instruments at Dartmouth College,
Norwich, VT 2005.77 Siehe dazu etwa die überarbeitete Fassung von Friedrich Kittler, Die Welt
des Symbolischen – eine Welt der Maschine, in: ders., Draculas Vermächtnis.
Technische Schriften, Leipzig 1993, S. 58-80, hier S. 65-70, wo eine
eingeschobene Passage den Unterschied zwischen »dem Realen« und »dem
Reellen« mit Blick auf die Geschichte der Mathematik begründet.78 Friedrich Kittler, Romantik – Psychoanalyse – Film. Eine
Doppelgängergeschichte, in: Jochen Hörisch/Georg Christoph Tholen (Hg.),
Eingebildete Texte. Affairen zwischen Psychoanalyse und
Literaturwissenschaft, München 1985, S. 118-135, hier S. 133. 79 Kittler, Auschreibesysteme, wie Anm. 4, S. 282.
36
4. Schluß
Bis solche und andere Möglichkeiten des Anknüpfens genutzt
werden, wird es beim spannungsvollen Dialog zwischen Analyse
und Geschichte bleiben. Der Analytiker sieht sich dabei auf
eine Dialektik der Diskurse verpflichtet, die vor allem darauf
zielt, in großen Überblicken den einzig möglichen, den
»logischen« Wechsel von einer Macht- und Wissensform zur
anderen zu skizzieren. Der Historiker setzt dagegen am Netzwerk
der materiellen Kultur an, um schon innerhalb einzelner Macht-
und Wissensformen eine »Vielfalt und Komplexität der
vermittelnden Wege« zu rekonstruieren.80 Während ersterer den
Zusammenhang von Macht und Wissen im Sinne des Herr/Knecht-
Schemas erfaßt, begreift letzterer diesen Konnex nach dem
Vorbild multipler Relationen zwischen unpersönlichen Kräften.
Der Analytiker untersucht die medientechnischen Bedingungen
bestimmter Erfahrungen und die Möglichkeitsbedingungen
einzelner Wissenschaften. Der Historiker weist die damit
unterstellte Trennung zwischen Apriori und Aposteriori zurück
und versucht, die Immanenz der Ereignisse in einem Feld der
80 Michel Serres, Einleitung. Das Kommunikationsnetz: Penelope [1964], in:
ders., Kommunikation. Hermes I, übers. von M. Bischoff, Berlin 1991, S. 9-
23, hier S. 11.
37
Wissenschaft, das immer auch ein Feld der Medien ist, zu
rekonstruieren.
Daraus leitet sich ein wichtiger Unterschied in den
Darstellungsweisen ab. Der Analytiker kann nämlich mühelos von
der Panorama-Ansicht zur Detailaufnahme wechseln. Zunächst
zeigt er – um auf die Einleitung dieses Beitrags zurückzukommen
– die Konstellation »Medientechnik und Physiologie um die
Jahrhundertwende«. Im nächsten Moment sieht man, wie Helmholtz
»vor allen anderen Kollegen« Edison die Hand schüttelt. Dem
Historiker bleibt demgegenüber nichts anderes, als auf die
geduldige Arbeit an long shots zu setzen, mit der einzelne
Figuren, humane und non-humane Akteure, oder ganze Gruppen in
ihrer jeweiligen Umgebung sichtbar gemacht werden – im
fraglichen Beispiel etwa dem International Electrical Congress,
der im August 1893 im Rahmen der Weltausstellung in Chicago
stattfand.
Das hat auch mit dem Tempo der Darstellung zu tun. Der
Analytiker kann durch einen einzigen Schnitt suggerieren, daß
der Physiologe Helmholtz dieses Forum nutzte, um per Handschlag
die überragende Bedeutung des Medientechnikers Edison
anzuerkennen (und er kann im nächsten Moment die Bedeutung
solcher Anekdoten mit Blick auf die symbolische Ordnung
38
herunterspielen). Der Historiker sieht sich dagegen auf das
Wissen zurückgeworfen, daß »vor allen anderen Kollegen« im
fraglichen Zusammenhang nicht zeitlich, sondern räumlich
gemeint ist. Tatsächlich war der Kongreß, auf dem Helmholtz mit
standing ovations als wissenschaftliches Genie gefeiert worden
war, schon vorbei, als sich die Delegierten des Kongresses mit
weiteren geladenen Gästen im Grand Pacific Hotel zu einem
festlichen Abendessen zusammenfanden.81 Edison gehörte nicht zu
den Delegierten und war deswegen an einem etwas abseits
stehenden Tisch plaziert worden. Als Helmholtz ihn sah, stand
er von seinem Tisch auf, ging zu Edison und begrüßte ihn per
Handschlag – so jedenfalls die apokryphe Schilderung von
Hermann Lemp, der einige Jahre zuvor von der Neuenburger
Telegraphenfabrik Matthäus Hipps in die Dienste Edisons
gewechselt war.82
81 Siehe David Cahan, Helmholtz in Gilded-Age America. The International
Electrical Congress of 1893 and the Relations of Science and Technology,
in: Annals of Science 67/1, 2010, S. 1-38, hier S. 11.82 Siehe Ronald W. Clark, Edison. Der Erfinder, der die Welt veränderte,
übers. von L. Nürenberger, Frankfurt am Main 1981, S. 193. Kittler zitiert
diese Arbeit wiederholt in den ›Aufschreibesystemen‹, führt sie dort aber nicht
in der Bibliographie auf. Wie der englischen Ausgabe von Clarks Buch zu
entnehmen ist, verlässt sich die Darstellung an der fraglichen Stelle auf
David O. Woodbury, Beloved Scientist. Elihu Thomson. A Guiding Spirit of
the Electrical Age, New York – London 1944, S. 213-214. Die dort zitierten,
aber nicht näher nachgewiesenen Erinnerungen Lemps befinden sich im
39
Die Frage des Analytikers, was Helmholtz dazu gebracht
hat, Edisons Hand zu schütteln, wird der Historiker auf
ähnliche Weise beantworten. Zum einen wird er auf Lemps
Einschätzung zurückkommen, daß Helmholtz die unter den
theoretischen Physikern der damaligen Zeit verbreitete
Hochnäsigkeit gegenüber Praktikern wie Edison nicht teilte.
Insofern wäre hier aber nicht von einer Begegnung zwischen
Physiologie und Medientechnik, sondern eigentlich von einem
Aufeinandertreffen von physikalischer Grundlagenforschung und
angewandter Physik zu sprechen. Zum anderen wird der Historiker
daran erinnern, daß Helmholtz und Edison sich schon von einer
früheren Begegnung her kannten. Im September 1889 hatten sich
Helmholtz und Edison anläßlich einer öffentlichen Vorführung
des Phonographen auf der Jahresversammlung der Deutschen
Naturforscher und Ärzte in Heidelberg kennengelernt.83 Bei
dieser Vorführung zeigte sich Helmholtz durch den
»außerordentlich deutlich[en]« Klang des Phonographen
Thomson-Nachlaß im Archiv der American Philosophical Association in
Philadelphia, PA. Siehe Hermann Lemp, Memoirs (July 2, 1938), Elihu Thomson
Papers, Series VII. Works by Others, Mss. Ms. Coll. 74, Box Series VII-2.
Die von Woodbury wiedergegebene Passage findet sich auf S. 16 des Lemp-
Typoskripts. 83 Leo Königsberger, Hermann von Helmholtz. Band 3, Braunschweig 1903, S.
24-25.
40
beeindruckt, und Edison versprach ihm daraufhin, ihm »ein
solches Instrument zu schicken«.84
Noch von Heidelberg aus wies Edison seine Werkstatt in
West Orange telegraphisch an, nicht weniger als fünf motor
phonographs an Helmholtz nach Charlottenburg zu schicken. Je
einer davon war für Helmholtz und für Siemens bestimmt, zwei
weitere für die Urania in Berlin und eines zur freien
Verwendung. Im Januar 1890 berichtet Helmholtz in einem Brief
an Edison, daß die täglichen Vorführungen der beiden
Phonographen im Observatorium der Urania und die Demonstration
eines weiteren Geräts in Stuttgart enormen Zulauf gehabt und
schnell dazu geführt hätten, daß der Phonograph »der Löwe des
Tages in Deutschland« geworden sei.85 Siemens hatte einige
Wochen zuvor noch bessere Nachrichten für Edison gehabt: Die
Regierung des Deutschen Reiches bestellte über ihn fünfzig
Phonographen für den Einsatz in preußischen Schulen.86
84 Hermann von Helmholtz, Brief an Anna von Helmholtz (20. September 1889),
in: Ellen Siemens-Helmholtz (Hg.), Anna von Helmholtz. Ein Lebensbild in
Briefen, Band 2, Berlin 1929, S. 18-19.85 Hermann von Helmholtz, Brief an Thomas Alva Edison (2. Januar 1890), in
The Thomas Edison Papers. Digital Edition, D9505AAA, online zugänglich
<http://edison. Rutgers.edu/digital.htm> (letzter Zugriff 24. Juli 2013).86 Werner von Siemens, Telegramm an Thomas Alva Edison (28. November 1889)
und ders., Brief an Thomas Alva Edison (3. Dezember 1889), in The Thomas
Edison Papers. Digital Edition, D8905AIT und D8905AJA, online zugänglich
41
Helmholtz benutzte seinen Phonographen in der
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt für einige
Probeaufnahmen von Musik und Gesang und zeigte Interesse, das
Instrument auch für Untersuchungen zur Klangfarbe der Vokale
einzusetzen.87 In seinem Brief an Edison verwies er aber auch
auf die Schwierigkeiten, die Aufzeichnungen auf den Zinnfolien
genau zu vermessen. Edison antwortete, indem er im Frühjahr
1891 drei verbesserte Phonographen an Helmholtz schickte. Ein
Gerät verblieb bei Helmholtz in der Reichsanstalt, die beiden
anderen leitete er an August zu Eulenburg, den Minister des
Königshauses, weiter.88 Zu diesem Zeitpunkt war Wilhelm II.
längst begeisterter Nutzer des Phonographen. Über Siemens hatte
der Kaiser schon Anfang 1890 einen Phonographen bei Edison
bestellen lassen89 – möglicherweise um im Verbund mit den
<http://edison. Rutgers.edu/digital.htm> (letzter Zugriff 24. Juli 2013).87 Entsprechende Untersuchungen mit dem Phonographen wurden seit Mitte der
1880er Jahre durchgeführt. Siehe dazu die Ausführungen von Alexander J.
Ellis in »Section M« des Anhangs zu seiner Übersetzung von Hermann L. F.
Helmholtz, On the Sensations of Tone As a Physiological Basis for the
Theory of Music, 2. Aufl., London 1885, S. 538-543.88 Hermann von Helmholtz, Brief an Thomas Alva Edison (19. März 1891), in
The Thomas Edison Papers. Digital Edition, D9148AAH1, online zugänglich
<http://edison. Rutgers.edu/digital.htm> (letzter Zugriff 1. August 2013).89 Werner von Siemens, Telegramm an Thomas Alva Edison (24. Februar 1890),
in The Thomas Edison Papers. Digital Edition, D9055AAH, online zugänglich
<http://edison. Rutgers.edu/digital.htm> (letzter Zugriff 24. Juli 2013).
42
Schulphonographen das auf der Naturforscherversammlung in
Heidelberg skizzierte Projekt zu realisieren, »die Stimme des
alten Kaisers und des Kronprinzen Friedrich Wilhelm« weit und
breit hörbar zu machen.90
Für den Historiker würden sich somit die Gründe dafür
klären, daß Helmholtz 1893 in Chicago Edison die Hand
schüttelte. Dieser Handschlag verstünde sich nicht nur als
Ausdruck für die wissenschaftliche Wertschätzung der
technischen Produkte aus dem Hause Edisons, sondern auch – und
zuerst – als Bekräftigung einer bereits bestehenden
Bekanntschaft. Darüber hinaus reflektierte er die erfolgreiche
Einführung und Verbreitung des Edison-Phonographen in
Deutschland, die für Helmholtz mit der kostenfreien Überlassung
entsprechender Geräte für den eigenen Gebrauch verbunden war.
Aber vielleicht geht es gar nicht um Klärung, sondern um
Wirkung. Dann hätte, einmal mehr, der Analytiker das letzte
Wort.
90 Theodor Wangemann, Phonograph des Herrn Edison, Tageblatt der 62.
Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Heidelberg vom 18. bis 21.
September 1889, Heidelberg 1890, S. 141-143. Über die Vertrautheit Wilhelm
II. mit dem Phonographen siehe auch Friedrich Kittler, Grammophon Film
Typewriter, Berlin 1986, S. 123.
43