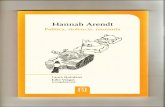Dries (2011): Günther Anders und Hannah Arendt - eine Beziehungsskizze
-
Upload
uni-freiburg -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Dries (2011): Günther Anders und Hannah Arendt - eine Beziehungsskizze
Günther Anders und Hannah Arendt als Jungvermählte, Berlin 1929 Günther Anders
Die Kirschenschlacht
Dialoge mit Hannah Arendtund ein akademisches Nachwort
Mit einem Essay von Christian DriesGünther Anders und Hannah Arendt
– eine Beziehungsskizze
Herausgegeben von Gerhard Oberschlick
Verlag C. H. Beck
Mit 9 Abbildungen
Gewonnen habe ich Hannah auf dem Ball mit der im Tan-
zen gemachten Bemerkung, daß Lieben derjenige Akt sei,
durch den man etwas Aposteriorisches: den zufällig getroffe-
nen Anderen, in ein Apriori des eigenen Lebens verwandle. –
Bestätigt hat sich diese schöne Formel freilich nicht.
G. A. (1929/1984)
© Verlag C. H. Beck oHG, München 2012
Gesetzt aus der Fairfi eld und der Akkurat Pro
durch Photosatz Amann, Aichstetten
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Umschlaggestaltung: Konstanze Berner, München
Umschlagabbildungen: Günther Anders. © Gerhard Oberschlick
Hannah Arendt, ca. 1930 © Hannah Arendt Bluecher Literary Trust
Printed in Germany
isbn 978 3 406 63278 5
www.beck.de
ı70 ı 71
Wie hilfl os da zwei ausgewachsene Philosophen von «Gott» reden und von «Glauben»; wie treuherzig Heidegger-Schüler ihrem Gott ein «Dasein» zuschreiben und dieses als «Sache» bezeichnen – mit überschäumender Gutwilligkeit ließe sich das als später emanzi-patorischer Befreiungsschlag und Loslösung vom Sprachgebrauch ihres Lehrers sehen. Der notorisch unnachgiebige Anders, der jedes Bekenntnis von «Glauben» als unverständliches Reden zu verhöhnen pfl egte – der nämliche Anders hielt jede Kritik an Arendt abwehrend zurück, und so sehr er bis zuletzt darüber ge-rätselt hat, so gründlich hatte er die Antwort auf seine umgekehrte Gretchenfrage, die – zu seinem, wenn auch kurzem, Glück – beizeiten zu stellen er unterlassen hatte, längst schon zu ihren Gunsten verdrängt.
Wie von Günther Anders aufgetragen, habe ich die Recht-schreibung wie zu seinen Lebzeiten behutsam modernisiert und insbesondere die – der Emigration nach Frankreich und USA ge-schuldete – ausschließliche Doppel-s-Schreibung gemäß der vom Verlag bevorzugten sogenannten alten Rechtschreibung aufgelöst; der «neuen» Rechtschreibung folgt nur einige Freiheit der Inter-punktion, die unserem Autor entgegenkommt.
Günther Anders und Hannah Arendt –
eine Beziehungsskizze
Von Christian Dries
Es konnte einfach nicht gutgehen: Ihr Verhältnis war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Nicht so sehr die Arbeitsgemeinschaft, die sie für einige Zeit verband, wohl
aber ihre Ehe. Die währte auf dem Papier kaum acht Jahre, von 1929 bis 1937; der «eheliche Verkehr» jedoch wurde, wie die Schei-dungsdokumente in nüchterner Indiskretion vermerken, schon sehr viel früher eingestellt. Im Rückblick betrachtete sie ihre erste Vermählung als Ausdruck von Eskapismus – eine Flucht vor der großen, einzigen, aber unmöglichen Lebensliebe, die ihr den Weg aus melancholischer Verdüsterung gewiesen und den Drang zu verstehen (nebst anhaltender Rücksichtnahme gegenüber schwarzwäldischer Fuchsschläue und einem politischen Sünden-fall) eingepfl anzt hatte, hinein in die Arme eines Mannes, der Nestwärme und philosophische Gespräche offerierte. Er, der hochbegabte Sohn aus gutem Hause, sah in ihr die Gefährtin für ein der elterlichen Lebens- und Arbeitspraxis abgeschautes Modell, was freilich mit der lebenshungrigen, widerspenstigen Halbwaise schlicht nicht zu machen war. Kein Stoff für eine be-sonders aufregende Geschichte, handelte es sich bei den Protago-nisten nicht um drei der herausragendsten Denker des 20. Jahr-hunderts, genauer: um zwei Denker und eine Denkerin, die uns bis heute unablässig beschäftigen – als Theoretiker wie als Perso-nen. Die Rede ist von Martin Heidegger, der in den 1930er Jahren den Führer zu führen gedachte, von seiner jungen, jüdischen Geliebten Hannah Arendt und deren erstem Ehemann Günther Anders, geborener Stern.
ı72 ı 73
Das persönliche und geistige Verhältnis des Ehepaares Arendt-Stern soll auf den folgenden Seiten skizziert werden. Für ein pro-fundes Porträt fehlt hier nicht nur der Raum. Zu viele Nachlaß-dokumente gälte es, besonders im Fall von Günther Anders, erst noch zu edieren und ins Gespräch zu bringen. Ein erster Umriß läßt sich aber heute schon zeichnen. Über das Private wissen wir leidlich gut Bescheid. Was bekannt ist, ist über viele, nicht immer ganz zuverlässige Quellen verstreut, hinterläßt als Collage jedoch einen haltbaren Eindruck (Abschnitt 1). Bei der Frage, ob und wenn ja, inwiefern beide Eheleute – womöglich sogar über die Ehe hinaus – Partner im Denken gewesen sind, vielleicht sogar als Symphilosophierende zu betrachten wären, betreten wir trotz erster explorativer Anläufe immer noch weitgehend Neuland (Ab-schnitt 2).1
1. Lebenswege
«Irgendwie ganz gleich wen»: Von Marburg nach Berlin 1925–1929
Ein Jahr nach seiner Promotion bei Edmund Husserl 1924 trifft der junge Günther Anders, der damals noch seinen Familien-namen Stern trägt, in Martin Heideggers Marburger Lehrveran-staltungen (darunter Übungen zu Hegels Logik und ein Seminar über Kants Kritik der reinen Vernunft) auf die Studentin Hannah Arendt. Doch diese unterhält zu jener Zeit ein erotisches Verhält-nis mit ihrem Professor und hat für den jungen Stern, gleichwohl er an der Universität durch intellektuelle Brillanz hervorsticht2, keine Augen. Erst 1929 sieht man sich auf einem Berliner Mas-kenball wieder – und landet zur Irritation der Eltern Stern nur wenig später auf dem Standesamt. Günther Anders’ jüngere Schwester, Eva Michaelis-Stern, erinnert sich: «Eines Tages bekam ich einen Anruf von Mutter aus Hamburg, daß sie ein Te-legramm von Günther bekommen hätten, von dem sie nicht wuß-ten, ob es ein dummer Witz war oder was es sonst bedeutet. Es lautete: ‹Erbitte 100 Mark für Wohnung und Hochzeit.› Mutter hoffte, daß ich ihr eine aufklärende Antwort geben könnte – ich wußte aber von gar nichts, versprach ihr aber, mich mit Günther in Verbindung zu setzen. […] Ich rief ihn an und sie waren beide am Telephon in Euphoria und erklärten mir, daß sie so bald wie möglich heiraten wollten. Ich kannte damals Hannah noch nicht – fand aber die Art und Weise, ihre Entscheidung den Eltern mit-zuteilen – gelinde gesagt – höchst taktlos. Das Ergebnis war, daß weder die Eltern, noch Hannahs Mutter zur Trauung kamen und ich die einzige von der Familie war, die anwesend war.»3 Über seinen schnellen Fang gibt der Bräutigam Jahrzehnte später zu Protokoll: «Gewonnen habe ich Hannah auf dem Ball mit der im
ı74 ı 75
Tanzen gemachten Bemerkung, daß Lieben derjenige Akt sei, durch den man etwas Aposteriorisches: den zufällig getroffenen Anderen, in ein Apriori des eigenen Lebens verwandle. – Bestätigt hat sich diese schöne Formel freilich nicht.»4 Freilich, denn die junge Braut geht leidenschaftslos in die Ehe. Unverblümt annon-ciert sie ihrem früheren Geliebten, dem sie ein Leben lang die Treue halten wird, die neue Verbindung, und zwar «mit der Bitte: vergiß mich nicht, und vergiß nicht, wie sehr und tief ich weiß, daß unsere Liebe der Segen meines Lebens geworden ist. Dies Wissen ist nicht zu erschüttern, auch nicht heute, da ich Heimat und Zugehörigkeit von meiner Rastlosigkeit bei einem Menschen gefunden habe, von dem Du es vielleicht am wenigsten verstehen wirst.»5
Eine direkte Reaktion auf diese Selbstanzeige ist nicht überlie-fert.6 Warum Hannah Arendt mit dem größtmöglichen Unver-ständnis rechnete, läßt sich jedoch aus einem nicht minder unver-blümten Brief Heideggers vom 25. Oktober 1925 ableiten: «Kurz vor meinem Abstieg [von der Hütte in Todtnauberg; C. D.] bekam ich einen Brief von Herrn Dr. Stern, worin er mir schildert, daß er in einer peinlichen Situation sei. Er habe nämlich im Sommer eine Arbeit verfaßt (über Umwelt – Zustand – Widerstand)7 und beim Ausarbeiten habe er nicht unterscheiden können, was meine ‹Gedanken› seien und was seine eigenen. Nun habe ihm Jonas8 meine Sommervorlesung vorgelesen und er sehe daraus, daß er mit mir ganz übereinstimme. Er bäte mich aber, vor der Publika-tion seine Arbeit zu lesen, damit er davor sicher sei, daß er mich nicht falsch interpretiere. So etwas kann sich nur Herr Stern leisten, der seit Jahren alles sich verschafft hat, was ich in Übun-gen und Seminaren gesagt habe. Ich habe ihm kurz geantwortet ‹in einem Fall wo ich nicht entscheiden kann, was meine eigenen Gedanken sind und was die eines anderen, da denke ich nicht an eine Publikation. Mit freundlichem Gruß.›»9
Warum also ausgerechnet dieser «Herr Stern»? Warum die eilige Eheschließung? An Gelegenheiten, sich von ihrer Lebens-liebe abzunabeln, litt die junge Hannah keinen Mangel. Auf eine
Affäre mit dem 20 Jahre älteren Schriftsteller Erwin Loewenson in Heidelberg, wo sie nach ihrer Flucht aus Marburg bei Karl Jas-pers promoviert, folgen noch einige mehr.10 Die Liaison mit Gün-ther Anders ist deshalb nicht nur «ein Kompromißunternehmen nach der Trennung von Heidegger»11; sie trägt überkompensatori-sche Züge – Hanna Leitgeb spricht sogar von einer «Trotz-Ehe».12 Früh verliert Arendt den Vater, der 1913 qualvoll an den Spätfolgen einer Syphilis stirbt. Bald wird sie von allerhand Ängsten geplagt, wie die Mutter in ihr Erziehungstagebuch notiert, vor anstehen-den Klassenarbeiten gerät sie in Panik, sie ist häufi g krank.13 Im April 1925 verfaßt die unterdessen 19jährige für Martin Heidegger ein poetisch verdichtetes Psychogramm mit dem sprechenden Titel Schatten, in dem ihr «Auf-sich-selbst-gedrückt-Sein», ihre Selbstverkapselung und ihre große Verletzbarkeit Ausdruck fi n-den.14 Nach der endgültigen Zurückweisung durch Heidegger sucht sie mit Aplomb Zufl ucht («Heimat») in geordneten Verhält-nissen, sowohl akademisch, beim väterlichen Karl Jaspers, als auch privat. Elfride Heidegger gegenüber erklärt sie später ihre damalige Gemütslage so: «[I]ch war, als ich aus Marburg fortging, fest entschlossen, nie mehr einen Mann zu lieben und habe dann doch noch geheiratet, irgendwie ganz gleich wen, ohne zu lieben.»15
Biographisch aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang auch ihre Studie über die jüdische Salonière und Schriftstellerin Rahel Varnhagen, an der Hannah Arendt nach der Promotion arbeitet (und mit der sie, unterstützt durch ein von Heidegger, Jaspers und Martin Dibelius befürwortetes Stipendium der Not-gemeinschaft der deutschen Wissenschaft, wesentlich zum pre-kären Familieneinkommen des jungen Ehepaars Stern beiträgt). Arendts «strukturierte Montage, in der das Narrative und das Konstruktive miteinander verwoben sind»16, offeriert stellenweise ein kaum verschlüsseltes Porträt ihrer eigenen Liebesgeschichte. Rahels Lebensweg wird zum Kierkegaardschen Hohlspiegel für Hannah Arendts existentielle Situation, eine Art Krankheit zum Tode, in der man zugleich verzweifelt lieben und nicht lieben will, um im Idealfall genau so zu sich selbst zu kommen. Die Motive
ı76 ı 77
Rahels, sich von romantisch überhöhten Amouren ab- und ihrem späteren Ehemann Karl August Varnhagen von Ense zuzuwenden, korrespondieren aufs engste mit Arendts eigenem Empfi nden: «Von Größe, Hochbegabtheit, Erhabenheit und Übermensch-lichem hat sie nun endgültig genug – und heiratet 1814 Varnha-gen.» Schließlich sei es besser, «einsam mit einem zweiten zusam-menzuleben, der einen liebt, als an […] platonischer Bewunderung zugrunde zu gehen.»17 So wie Arendt an Heidegger zugrunde ge-gangen wäre, der ihr nie mehr als die demütigende Rolle «dienen -de[r] Liebe in meiner Arbeit»18 zugeteilt hatte. Fortan hält sie sich an Günther Anders wie Rahel an Varnhagen, nämlich «wie an den Tag, um doch jede Nacht wieder zurückzufallen in die immer sich wiederholenden, eindringlichen und zudringlichen Träume der Nacht.»19 Noch ein Jahr nach der Hochzeit beschwört sie vor Heidegger die, nun zum Ermöglichungsgrund der Existenz tran-szendierte, «Kontinuität unserer – laß mich bitte sagen – Liebe.»20 Wie ernst es ihr damit ein Leben lang war und wie tief sie zugleich daran litt, hat Joachim Fest überliefert, den Hannah Arendt 1964 zum Radiogespräch in Baden-Baden traf.21 Heidegger habe sie «in jedem Sinne zum Leben erweckt», gesteht die Endfünfzigerin ihrem Interview-Partner während eines Spaziergangs auf der Lich-tentaler Allee – und zugleich «alles verdorben». Ihm verdanke sie alles, vor ihm sei sie gefl ohen, um nicht verlorenzugehen: «Ich nahm meine Siebensachen und machte mich davon. Nur eines ließ ich in Marburg zurück und habe es mir nie zurückholen können: die Liebe.»22
Ähnlich dem verständnisvollen Varnhagen, jenem selbst-losen «Bettler am Wege», der die gesellschaftliche Außenseiterin Rahel mit ihrer gebrochenen Biographie zumindest zeitweilig versöhnt23, ist der genialisch-gutmütige Günther Anders für Arendt in erster Linie der Mann, der sie mit Fachsimpeleien, hohen Dosen an Be-wunderung und heiterer Dienstbarkeit über die gebrochene Kon-tinuität ihrer Lebensliebe hinwegtröstet, ohne den Verlust an erotischer Tiefenspannung je ausgleichen zu können. Stets zeigt er sich rührend besorgt; das erste Mal kurz nach dem erwähnten
Maskenball anläßlich einer Halsentzündung seiner neuen Ge-fährtin, der er «mit einem Korb voll Zitronen und seiner guten Laune» zu Leibe rückt24, und später bis über die Scheidung hin-aus. Außerdem ist er humorvoll und intellektuell sowieso voll satisfaktionsfähig. Und er stammt aus gutsituierten Verhältnis-sen. Anders’ Vater William Stern ist Mitbegründer der Hamburger Universität und seinerzeit das, was man heute einen Wissen-schaftsstar nennen würde.25 Auch der begabte Sohn läßt auf eine glänzende akademische Karriere hoffen. Hannah Arendts Mutter Martha ist deshalb von der Heirat regelrecht begeistert, so wie Hans Jonas, der Kommilitone der Eheleute – «schließlich handelte es sich um meinen besten Freund und meine beste Freundin!»26 Die Sterns wiederum erhoffen sich von der Ehe, «daß ihr mit-unter sich verzettelnder Sohn unter der Obhut einer hochintelli-genten und zielstrebigen jungen Frau vielleicht in ruhigere Bah-nen gelangen würde.»27 Die Braut aber macht keinerlei Anstalten, sich nach der Eheschließung nun etwa in «die Frau an seiner Seite» zu verwandeln und dem Role Model der Schwiegereltern nachzueifern, für das ihr Gatte Sympathien hegt.
William Stern hatte in seiner resoluten und umtriebigen, aber zugleich sensiblen und mit einer «außergewöhnlichen Intelligenz» gesegneten Frau Clara «eine verständnisvolle Partnerin für seine Arbeit» gefunden und obendrein die dem wilhelminischen Haus-frauenklischee entsprechende «Stütze und Hilfe» in allen Widrig-keiten des Lebens.28 Für ihre entwicklungspsychologischen Stu-dien bildeten die beiden ein eingespieltes Forscherteam, «bei dem die Anteile des einen oder anderen Partners gar nicht mehr zu trennen sind.»29 Es ist dieses Bild inniger Lebens- und Denkge-meinschaft (mit männlicher Schlagseite), das Günther Anders sich ausgemalt und in der Retrospektive literarisch fi xiert hat: «Bestiehl mich, wo und wann und wie viel du willst! … Ich be-stehle dich ja ebenfalls.» (s. o., S. 29 f.)30 Hans Jonas beurteilt die Herzensangelegenheit in der Rückschau etwas nüchterner: «Gün-ther bildete sich ein, er habe hier eine wunderbare Gefährtin ge-funden, merkte aber nicht, daß sie über ihn hinauswuchs und
ı78 ı 79
sich unabhängig von ihm geistig weiterentwickelte.»31 Zu den «Schatten» seiner Frau fand er nur bedingt Zugang (vielmehr: es blieb der Weg durch einen Dritten stets verstellt). Auch hätte sich Hannah Arendts kecke «Lust am Rebellieren»32, am Selber-Den-ken und Selber-Verstehen, ihr ausgeprägter Hang zu Kino, Tanz und großer Sause, der schon in Marburg nicht unbemerkt geblie-ben war33, auf lange Sicht unmöglich in das Korsett von «Stütze und Hilfe» zwängen lassen, von «dienender Liebe» ganz zu schwei-gen. Mit einer Oberlehrer-Attitüde, wie Günther Anders sie in der Kirschenschlacht und auch sonst als literarisches Subjekt bevor-zugt einnimmt, war bei dieser Frau – «can’t help that» – nicht zu punkten. Und so wird aus der idealen Lebens- und Denkgemein-schaft bald ein Arrangement, das vor allem die Leidenschaft der Geister über ein kurzes emotionales Verfallsdatum hinaus konser-viert. Nicht nur in Arendts Rahel, sondern auch in Günther Anders’ Proletarier-Poem Duett aus dem Jahr 1932 darf man viel-leicht zwischen den Zeilen lesen: «Ich kann meinen Mann nicht riechen./Doch die Wände sind naß, und der Fußboden kalt./Da muß man zusammenkriechen./Und da ergibt es sich halt.»34
Wanderjahre: Berlin, Heidelberg, Frankfurt, Berlin 1929–1933
Das junge Paar hat wenig Geld, man lebt bescheiden in häufi g wechselnden Quartieren, einmal sogar in einem Großraumstudio, das während des Tages für den Betrieb einer Tanzschule zu räu-men ist, so daß Anders und Arendt buchstäblich zu Kaffeehaus-literaten werden.35 Vorübergehende Normalität stellt sich erst in Drewitz bei Potsdam ein, wo sie «Zimmer, Kammer und Miniatur-küche» miteinander teilen (s. o., S. 11), Kirschen essen und ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Diese plant Günther Anders damals noch in eine akademische Karriere zu überführen.36 Und die Zeichen dafür stehen trotz widriger wirtschaftlicher und poli-tischer Umstände keinesfalls ganz schlecht. Philosophisch erwei-
sen sich die gemeinsamen Jahre im Herbst der Weimarer Repu-blik als erstaunlich fruchtbar. Die geistige Zusammenarbeit zwi-schen den Eheleuten «war intensiv und freundschaftlich», berich-tet Hans Jonas, obwohl Hannah Arendt zunächst tatsächlich «eine etwas dienende Stellung einnahm» und ihrem Mann «bei seinen Arbeiten half».37 Vor allem bei dem Versuch, sich mit einer auf Kant, Heidegger, Scheler und Plessner bezogenen philosophischen Anthropologie für die höhere Universitätslaufbahn zu empfehlen. Von 1927–1929 entstehen in mehreren Anläufen unterschiedliche Entwürfe und Teilstücke dieses systematisch angelegten Projekts38, begleitet von zahllosen, keineswegs immer einseitig dominierten philosophischen Kirschenschlachten. Um die Jahreswende 1929/30 bringt Günther Anders den Kern seiner Überlegungen in der Hamburger sowie der Frankfurter Ortsgruppe der Kantgesell-schaft unter dem Titel «Freiheit und Erfahrung» zum Vortrag. Eine «[g]egenüber den mündlichen Ausführungen in wesentlichen Punkten erweitert[e]» Fassung ist als Die Weltfremdheit des Men-schen im Andersschen Nachlaß erhalten. Auf der ansonsten blan-ken Seite 1 des Typoskripts steht die schlichte Widmung: «Meiner Frau».
Das Frankfurter Publikum – darunter Theodor W. Adorno, Kurt Goldstein, Max Horkheimer, Karl Mannheim, Kurt Riezler, Paul Tillich, Dolf Sternberger, Max Wertheimer und natürlich Hannah Arendt, die als Frau Stern auftritt – ist von den Ausfüh-rungen derart angetan, daß es den Referenten zu einer Habili-tation ermutigt. Als sich schließlich auch Adornos olfaktorische Idiosynkrasie gegen vermeintliche «Freiburger Existentialdüfte»39 dämpfen läßt, ziehen die Sterns nach kurzem Zwischenhalt in Heidelberg guter Dinge von der Spree an den Main. In Frankfurt nimmt das Paar rege am akademischen Leben teil, hört bei Mann-heim und Tillich. Doch schon bald scheitert Günther Anders’ akademisches Vorhaben an der politischen Großwetterlage und an «Fakultätsschwierigkeiten», wie Hannah Arendt ihrem Mentor Jaspers berichtet.40 Probleme macht der potentielle Habilita-tionsbetreuer Paul Tillich, der Anders auf die Zeit nach dem natio-
ı80 ı 81
nalsozialistischen «Spuk» vertrösten will, aber auch Theodor W. Adorno, auf dessen ureigenem Terrain der nur ein Jahr ältere Habi-litand mit seinen, zudem völlig unmarxistischen, Philosophische[n] Untersuchungen über musikalische Situationen wildert.41 Und so kehrt man schließlich wieder zurück nach Berlin, wo Hannah Arendt in der gemeinsamen Wohnung in der Opitzstraße an ihrer Rahel weiterarbeitet, während ihr Mann auf Vermittlung Bertolt Brechts beim Berliner Börsen-Courier zum «Knaben für alles» wird und, mehr schlecht als recht entlohnt, «über vergewaltigte Kinder ebenso wie über einen Hegelkongreß oder eine Kriminal-novelle» schreibt.42 Oder über Rainer Maria Rilke, dessen Duine-ser Elegien er gemeinsam mit Hannah Arendt in einem von Heideg-gerismen durchzogenen kritischen Essay für die Neue Schweizer Rundschau zu interpretieren versucht. Zeitgleich rezensieren die Eheleute in separat erscheinenden Aufsätzen und mit unter-schiedlichen Stoßrichtungen Karl Mannheims 1929 erschienenes Buch Ideologie und Utopie.43 Zuvor war Günther Anders seiner Frau bereits bei der Überarbeitung ihrer Dissertation für den Druck zur Hand gegangen, um den Text «von seinen komplizierte-sten sprachlichen Wendungen, seinem ausufernd Heideggeri-schen Stil, zu befreien.»44 Die intellektuellen Anknüpfungspunkte und Schnittfl ächen sind zu Beginn der Ehe also durchaus nicht gering. Schon bald aber schlagen beide Partner unterschiedliche Denkbahnen ein. Günther Anders verkehrt unter Linken, im Um-feld von Brecht; Hannah Arendt sucht Kontakt zu Zionisten wie Kurt Blumenfeld und Salman Schocken.45 Sie arbeitet an der Rahel, er an einer antifaschistischen Großfabel (Die molussische Katakombe) – bis die politischen Ereignisse in Deutschland end-gültig eskalieren.
Misere der Emigration: Pariser Notgemeinschaft 1933–1937
Kurz nach dem Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 fl ieht Gün-ther Anders nach Paris46, vorerst ohne seine Frau. Die sucht im Auftrag von Kurt Blumenfeld, dem charismatischen Präsidenten der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, in der Preußischen Staatsbibliothek nach alltäglichen antisemitischen Äußerungen in der Tagespresse, in Vereinsverlautbarungen etc. – und wird darob prompt verhaftet. Laut eigener Aussage gelingt ihr jedoch mit Bei-hilfe des gutwilligen Vernehmungsbeamten, den sie mit mädchen-haftem Charme bezirzt, die baldige Freilassung. Einen von den Zionisten bestellten Anwalt lehnt sie angeblich auf Anraten ihres Häschers ab.47 Eva Michaelis-Stern, damals als einzige Verwandte vor Ort, hat die häufi g kolportierte Gefängnisepisode anders in Erinnerung: «Hannah blieb noch in Berlin, um eine Arbeit über Antisemitismus in der Staatsbibliothek fertig zu stellen. Das war ein Auftrag von Kurt Blumenfeld, dem Vorsitzenden der zioni-stischen Vereinigung. Es war von diesen beiden hochintelligenten Menschen sehr leichtsinnig, durch diese Arbeit Hannah großer Gefahr auszusetzen. Diese Tatsache war Hannah offenbar klar, denn sie hatte ihrer Wirtin Anweisung gegeben, mich in der Ju-gend-Alijah48 anzurufen, falls ihr etwas zustoßen sollte. Sie wußte, daß damals noch die Nazis erlaubten, daß sich Familienangehö-rige um Verhaftete kümmern konnten. Als nun die Wirtin bei mir anrief, um mir mitzuteilen, daß bei ihr Haussuchung stattgefun-den hätte und beide, Hannah und ihre Mutter, die damals bei ihr zu Besuch war, nicht nach Hause gekommen wären, ließ ich alles stehen und liegen und beriet mich mit Blumenfeld, was zu tun wäre. Er wollte mit der Sache nichts zu tun haben und überließ mir allein, ihr zu helfen. Ich beschloss also, zum Alexanderplatz in das Zentrum der Gestapo49 zu gehen, um festzustellen, ob sie dort verhaftet worden war. Vorher rief ich noch in allen Hospitälern an, um sicher zu gehen, daß es sich nicht um einen Unfall handelte. Ich wollte ja auch nicht die Aufmerksamkeit der Gestapo auf sie
ı82 ı 83
lenken, falls sie sie nicht verhaftet hätten. Der Alexanderplatz war das gefürchtetste Gebäude in Berlin, da viele Menschen von dort ins K. Z. verschwanden auf nimmer Wiedersehen. Zu meinem großen Erstaunen bestätigte der SS-Mann am Eingang sofort, daß Hannah dort im Gefängnis sei, und er führte mich in den Keller, wo er die Tür zu ihrer Zelle aufschloss und sie entließ. Ich war glücklich, sie so schnell befreit zu sehen – die Mutter hatte man offenbar schon vorher frei gelassen. Kaum waren wir aus dem Ge-bäude heraus, war das einzige, was Hannah zu mir sagte: ‹Das hätte ich auch alleine fertig gebracht›. Sie gab am selben Abend eine Abschiedsgesellschaft, zu der sie mich nicht einlud, und ging dann am nächsten Tag illegal über die Grenze nach der Tschecho-slowakei und von dort aus nach Paris.»50
Das Exil zwingt die einander Entfremdeten erneut unter ein gemeinsames Dach; ihre Ehe wird zur «Notgemeinschaft»51. Doch wie schon zuvor in Berlin geht man auch im von Emigran-ten überschwemmten Paris meist getrennte Wege. Günther An-ders legt seine bis dahin wenig erfolgreichen philosophischen Arbeiten erst einmal beiseite und pfl egt, einer frühen Neigung folgend, vor allem Umgang mit Künstlern, Journalisten und Lite-raten, darunter Brecht, Alfred Döblin und Stefan Zweig. Exzessiv betreibt er die Arbeit an der Katakombe, aus der er seiner Frau «re-gelmäßig» vorliest.52 In den ersten Monaten der Emigration ent-steht außerdem die Novelle Learsi (ein Ananym für Israel), die von der «outsider-Situation» der Juden handelt.53 Für akademi-sche Kolloquien bleibt da kaum Muße. Auch mit seinem Groß-vetter Walter Benjamin54, der bald ein enger Freund seiner Frau wird, führt er nur selten Fachgespräche: «Ich kann nicht sagen, daß wir in Paris miteinander philosophiert hätten. Denn wir wa-ren in erster Linie Antifaschisten, in zweiter Linie Antifaschisten, in dritter Linie Antifaschisten und außerdem mögen wir auch phi-losophiert haben.»55 Vermittelt durch Raymond Aron folgen beide Eheleute allerdings den Hegel-Vorlesungen Alexandre Kojèves an der École Pratique des Hautes Études. Im selben Hörsaal sitzt auch Jean-Paul Sartre. Über Alexandre Koyré und Jean Wahl ge-
lingt es Günther Anders schließlich noch, seine frühen anthropo-logischen Entwürfe zu veröffentlichen. Gemeinsam mit Emmanuel Levinas übersetzt er den ersten Teil der Weltfremdheit des Men-schen, der 1934 in den Recherches Philosophiques erscheint. Ein zweiter, gegenüber der Weltfremdheit stark erweiterter Aufsatz folgt zwei Jahre später (übersetzt von P.-A. Stéphanopoli), zusam-men mit Sartres La transcendance de l’ego.56
Hannah Arendt ergattert derweil eine Stelle bei Agriculture et Artisanat, einer Organisation, die junge Emigranten landwirtschaft-lich und handwerklich für das Leben in Palästina ausbildet. Von 1935 bis 1938 arbeitet sie als Generalsekretärin des Pariser Büros der Jugend-Alijah. Nebenbei entstehen die letzten Kapitel ihres Rahel-Buchs. Außerdem gibt es in ihrem Leben einen neuen Mann: Der bohemienhafte Heinrich Blücher, ehemaliges Mitglied des Spartakusbunds und philosophischer Autodidakt, zählt zu denen, die Hannah Arendt «homini generis» nennt. «Monsieur», so lautet bald ihr Kosename für den knorrigen Berliner, ist also ein echter Kerl; nicht so gutmütig wie Günther Anders und mit größerem Verständnis für melancholische Untiefen ausgestattet, dabei – wie Heidegger – zugleich von einer gewissen maieutischen Bruta-lität. Nicht nur, daß Blücher seine spätere Frau zeitlebens drängte und förderte, er paukte der leicht Erregbaren auch die fehlende Arbeitsdisziplin ein und schuf auf diese Weise den verläßlichen Rahmen, den sie für ihre kreative Tätigkeit brauchte.57 Nicht zu-letzt befreite er sie aus der inzwischen völlig leblosen Beziehung mit Günther Anders und dem damit verbundenen Zwang, «bis zu einem gewissen Grade aufzuhören, eine Frau zu sein.»58 Hans Jonas, der Blücher erst nach dem Krieg in Amerika kennenlernt, sieht in dem Bonvivant an Arendts Seite zunächst «[i]m Vergleich zu Günther Anders […] nicht die allererste Wahl […], doch im Laufe der Jahre merkte ich, daß er ihr viel bedeutete und es eine wirk liche Liebesehe war.»59 In der Tat. Was Hannah Arendt am 18. September 1937 an Heinrich Blücher schreibt, klingt nach dem glücklichen Ende einer existentiellen Suche, der Verbindung von Eigenständigkeit und Zugehörigkeit («Heimat») plus Leidenschaft:
ı84 ı 85
«Und als ich Dich dann traf, da hatte ich endlich keine Angst mehr […]. Immer noch scheint es mir unglaubhaft, daß ich beides habe kriegen können, die ‹große Liebe› und die Identität mit der eigenen Person. Und habe doch das eine erst, seit ich auch das an-dere habe. Weiß aber nun endlich auch, was Glück eigentlich ist.»60
Für Günther Anders dagegen bedeutet das Leben in Frankreich trotz partieller Erfolge als philosophischer und belletristischer Autor nichts Gutes. Ohne Arbeitsmöglichkeiten in fremdsprachi-ger Umgebung schlägt ihm, schon von Natur aus kein ganz aus-geglichener Charakter, die «Misere der Emigration»61 besonders schwer aufs Gemüt. Während seine Frau im Exil ihre praktische Seite entdeckt und sich endgültig von ihm abwendet, werden seine «Schatten» immer länger. Hannah Arendt gegenüber verwandelt er sich peu à peu in einen «schwer erträglichen Kauz […], der Tag für Tag kontinuierlich und konzentriert haßte».62 Und der gehaßt wird. Als ihn seine Schwester Eva in Paris besucht, ist sie entsetzt über die miserable Stimmung zwischen den Vertriebenen, die nur noch eine Papier-Ehe führen. Von der ursprünglichen Euphoria keine Spur: «Ich war später noch einmal für die Jugend-Alijah in Paris und erinnere mich, daß ich ganz deprimiert war, wie Hannah Günther behandelt hat.»63 Die Pariser Notgemeinschaft hatte sich endgültig auseinander gelebt. Es sind nur noch die «äußer-lichen Prätentionen» ihres Gatten, die Hannah Arendt vorerst von der längst überfälligen Scheidung abhalten, so daß sie noch nach Anders’ Abreise aus Paris in Richtung New York im Juni 1936 ihre Briefe pfl ichtschuldig mit «Hannah Stern» unterzeichnet. Hein-rich Blücher läßt sie wissen: «Ich habe unsere Ehe vor drei Jahren lösen wollen – aus Gründen, die ich Dir vielleicht einmal erzähle. Und hielt für die einzige Möglichkeit: passive Resistenz, Kündi-gung aller ehelichen Pfl ichten. Das war mein Recht, schien mir. Aber nicht mehr. Trennung wäre darauf die natürliche Konsequenz des andern gewesen. Die dieser andere zu ziehen nie für notwendig hielt. Meine passive Resistenz hielt ich ebenso aufrecht wie der andere die Vorstellung, mit mir verheiratet zu sein. […] Bis jetzt war das alles ziemlich egal. Ich habe nicht viel von der Hölle, die
das Zuhause war, gemerkt. Denn ich arbeitete wie ein Pferd, war fast nie zu Hause. Und mir war alles Persönliche nur noch zu einer Nervenfrage geworden.»64 Die ist nun endlich beantwortet. Zwei Monate, bevor Hannah Arendt das triste Bild ihrer Pariser Ehe-Ma-laise malt, hat «der andere» Paris verlassen; seine Ehe wird am 9. August 1937 briefl ich in Berlin geschieden.
Hannah Arendt bleibt in Paris, wird nach dem Einmarsch der Wehrmacht interniert, entkommt glücklich aus dem Lager Gurs in den Pyrenäen und macht mit ihrem neuen Gatten Heinrich Blücher – die Hochzeit erfolgte am 16. Januar 1940 – schließlich in Montauban Station. Kurz zuvor setzt der – insgesamt sehr über-schaubare – Briefwechsel mit Günther Anders ein65, auf dessen gutmütige Dienstbarkeit das frischvermählte Paar einmal mehr angewiesen ist. Neben Ein- und Ausreisevisa für Portugal benötig-ten sie, um ebenfalls ins sichere Amerika zu gelangen, sogenannte Affi davits.66 Anders besorgt die lebensrettenden Dokumente und erntet dafür postalisch Dank: «Merci, mon vieux. Les affi davit[s] sont arrivés – et je t’avoue très à propos.» Auf den edlen Helfer trinkt man eine Flasche Châteauneuf du Pape : «Je t’assure qu’il était ‹fi rst class›. […] Affectueusement Hannah.»67 Weitere Exilbriefe schildern die sich immer stärker verfi nsternde Schatten-existenz der Flüchtlinge («La vie dans les Pyrénées – où l’on avait littéralement rien à manger – était grotesque par son mélange de fausse idylle […] et de danger plus ou moins immédiat. Je sais maintenant ce que les Grecs appelaient le Hades, la vie quasi-nor-male des ombres»68), berichten über die Aufenthaltsorte Walter Benjamins («Pour Benji, il ne faut pas avoir peur»69) und das Schicksal gemeinsamer Freunde. In einem Brief vom 10. Juli 1940 schildert Arendt, wie sie und Blücher sich nach beider Inter-nierung nur zufällig wiederfi nden.70 Weil alle Habseligkeiten auf der Flucht verlorengegangen sind, bittet sie ihren Ex-Mann – er-folgreich – um Bares: «Mein lieber Junge – […] Das ganze ist mir sehr wie mit dem Onkel aus Amerika, vor allem seit der Geld-sendung. Ich mache mir nur Sorgen, woher Du das alles nimmst und wie groß Deine Pleite sein mag …»71
ı86 ı 87
Chancen der Misere: New York, Hollywood, San Diego, New York 1937–1950
Mehr wert als alles Geld der Welt sind die Affi davits, die Günther Anders nach Europa schickt. Hannah Arendt und ihrem zweiten Mann verschafft er damit nicht weniger als ein neues Leben. Wenn Eva Michaelis sich richtig erinnert hat, ist es das zweite Mal, daß ihr ein Mitglied der Familie Stern in höchster Not bei-springt. Das erste Lebenszeichen, das sie auf nordamerikanischem Boden aussendet, geht denn auch einen Tag nach ihrer Ankunft in New York am 23. Mai 1941 telegrafi sch an Günther Anders: «SIND
GERETTET WOHNEN 317 WEST 95=HANNAH». In den USA fi ndet sich die Gerettete schnell zurecht. Rasch lernt sie Englisch und beginnt, sowohl auf Deutsch als auch in der fremden Sprache zu publizieren, zunächst vor allem in der deutsch-jüdischen Emi-grantenzeitung Aufbau, in der auch Günther Anders einige Ge-dichte veröffentlicht.72 Am 31. Mai 1941 rapportiert sie ihm: «Ansonsten fühlen wir uns glänzend, auch ohne Geld. Monsieur kriegt etwas Unterstützung, unser Zimmer ist für Pariser Verhält-nisse, vor allem für die Verhältnisse, in denen wir seit einem Jahre gelebt haben, einfach der Gipfel des Luxus. NY ist wie ein sehr großes Berlin – soll mir auch recht sein.»73 Hannah Arendt macht in Amerika dort weiter, wo sie in der alten Heimat und im Pariser Exil aufgehört hatte. Sie vergrößert ihr Netzwerk, mischt sich in die intellektuelle Szene New Yorks, wird unter anderem Journali-stin und Lektorin, Geschäftsführerin der Jewish Cultural Recon-struction und bekanntlich keine 15 Jahre nach ihrer Ankunft in der neuen Welt zu ihrem eigenen Amüsement als Schriftstellerin regelrecht «berihmt» (und obendrein durchaus wohlhabend).74
Nicht so Günther Anders. Er fi ndet wieder einmal keinen rich-tigen Anschluß und fühlt sich außerdem «nicht nur nicht fähig, sondern auch nicht willens», auf Englisch zu schreiben.75 «Was [Günther Stern] anlangt, scheint er noch genau da zu stehen, wo er 1932 auch nicht gerade angekommen war»76, stellt Hannah Arendt im August 1941 fest. Aber der Verspätete unternimmt aller-
lei Anläufe, das Gefälle der Emigration zu überbrücken. Auf Basis seiner Novelle Learsi versucht er sich – reichlich naiv, wie er rück-blickend bekennt – als Drehbuchschreiber für Charlie Chaplin. Bei den Studiobossen Hollywoods will er mit seinen Suggestions for New Types of Pictures77 außerdem für ein neues Filmgenre wer-ben: ‹Was wäre wenn-Filme›, die mit der Kontingenz historischer Ereignisse spielen, indem sie den realen Geschichtsverlauf an neuralgischen Punkten in potentielle (nicht-fi ktive) Entwicklungs-alternativen umlenken. Das Exposé fl oppt ebenso wie die Learsi-Adaption: «Philosophie reimt sich nicht auf Hollywood.»78 Außer den Gedichten im Aufbau erscheinen während der vierzehn ame-rikanischen Exiljahre von Günther Anders noch diverse kleinere Arbeiten in Zeitschriften wie Austro-American Tribune, Commen-tary, Freies Deutschland, Neue Rundschau, The German American und anderen, ferner ein Vortrag über Rodin, Teile einer später stark erweiterten Kafka-Interpretation, sowie zwei Fundamental-kritiken Heideggers, die sowohl von Hannah Arendt als auch Theodor W. Adorno aufmerksam studiert werden. Mit der origi-nellen phänomenologischen Miniatur The Acoustic Stereoscope knüpft Anders an sein gescheitertes Habilitationsprojekt an, Ele-mente der frühen Anthropologie fi nden sich in der souveränen Besprechung von Sartres Esquisse d’une théorie des émotions.79 Viele Arbeiten hingegen bleiben in der Schublade und werden erst Jahre später veröffentlicht (oder wandern in den Nachlaß, wo sie noch heute liegen).
Während er vorübergehend bei Herbert Marcuse in Santa Monica wohnt, nimmt Anders den Kontakt zu berühmten Exil-kollegen wieder auf. 1942 stellt er die Kernstücke seiner frühen Anthropologie im Kreis der Frankfurter Schule zur Debatte.80 Ein Billett für den inneren Zirkel erwirbt er damit jedoch nicht: «Ich gehörte nirgendwohin. […] Eigentlich wurde ich nicht ernst ge-nommen».81 Zu allem Überfl uß verscherzt er es sich auch noch mit Hannah Arendt, weil diese ihn jetzt zum Adorno-Clan rech-net. Schuld daran ist ein Manuskript der Thesen über den Begriff der Geschichte, das Walter Benjamin Hannah Arendt vor seinem
ı88 ı 89
Selbstmord anvertraut hatte und das diese nach Amerika bringt, wo sie es in Erwartung einer baldigen Publikation an Adorno wei-terleitet. Doch nicht nur der, sondern auch Günther Anders hat dagegen offenbar Einwände, zu opak und ungeschliffen erscheint ihm das Nachlaßjuwel seines Großvetters.82 Für Hannah Arendt ist klar: Ihr Ex-Mann steckt mit der Frankfurter «Schweinebande» unter einer Decke. «G. [Günther Anders] ist offensichtlich kom-plett verkommen. Von mir aus»83, läßt sie in einem Brief an Hein-rich Blücher vom 2. August 1941 ihrem Frust freien Lauf. Kurze Zeit darauf bittet sie den endgültig Abgeschriebenen noch einmal eindringlich, ihr endlich mitzuteilen, «was da im weisen Rate be-schlossen worden ist, da Wiesengrund [= Theodor W. Adorno; C. D.] es, scheint’s, nicht für noetig hält, mich auf dem Laufenden zu halten.»84 Die Scharmützel mit dem «weisen Rate» ziehen sich hin, bis das Institut für Sozialforschung den Text 1942 in einem mimeographierten Heft (Walter Benjamin zum Gedächtnis) ver-öffentlicht. Nach Kriegsende fl ammt der Streit um das Erbe Ben-jamins erneut auf – doch dieses Mal ist es Günther Anders, der Hannah Arendt dazu drängt, sich mit einem Essay gegen das «Monopol» des Benjamin-Herausgebers Adorno zu positionie-ren.85
Finanziell hält sich Anders, in den ersten Monaten noch von seinen in Durham (North Carolina) lebenden Eltern unterstützt, als Hauslehrer über Wasser; er putzt in Hollywoods Kostümkam-mern SS-Stiefel, wäscht Tellerberge und stellt sich an Fabrikfl ieß-bänder. 1943 arbeitet er, wie viele Emigranten, für kurze Zeit im Offi ce of War Information (OWI), einer US-Behörde zur Verbrei-tung von Kriegsinformationen und -propaganda.86 Ende der 40er Jahre wird er schließlich Lecturer an der New School for Social Research, wo er Vorlesungen und Seminare zu anthropologischen und kunstphilosophischen Themen hält, mit der Mentalität sei-ner Studenten aber nicht viel anfangen kann (Heinrich Blücher, der seinen Posten später übernimmt, hingegen um so mehr).87 Die Bilanz von insgesamt 17 Jahren Emigrantendasein fällt in vielerlei Hinsicht höchst bescheiden aus. Auch wenn er seine «fahrenden
Jahre» retrospektiv verklärt – «ich hatte die zahllosen Chancen der Misere»88 –, bleibt für Günther Anders mit der Exilzeit immer das Scheitern großer Träume verbunden: Die Liebe seines Lebens ist dem nun fast Fünfzigjährigen ebenso abhanden gekommen wie die Aussicht auf eine glänzende akademische Karriere. «Als ich Günther um Weihnachten 1949 wiedersah», gibt der damals in Kanada ansässige Hans Jonas zu Protokoll, «war die alte Freund-schaft sofort wieder da. Allerdings sah ich, daß bei ihm etwas eingetreten war, was ich von früher her nie kannte – ein Zug von Bitterkeit. Alles hatte sich gegen ihn verschworen. Amerika hatte ihn schlecht behandelt.»89
Weder – noch: 1950–1975 und Postskriptum
Mit seiner zweiten Frau, der österreichischen Schriftstellerin Elisabeth («Liesl») Freundlich, die er kurz nach Kriegsende heira-tet, kehrt Günther Anders 1950 Amerika endgültig den Rücken. Für die alte Heimat kann er sich nicht mehr erwärmen: «So be-schloß ich, im Weder-noch: in Wien zu bleiben».90 Dort schlägt er sich als Rundfunkautor durch, übersetzt Bühnenstücke aus dem Englischen und engagiert sich in der Anti-Atombewegung. Wie Hannah Arendt macht er sich allmählich als Publizist einen Namen (sein Briefwechsel mit dem Hiro shima-Piloten Claude Eatherly wird sogar ein internationaler Bestseller91). Seit Mitte der 50er Jahre hält er zu seiner ersten Frau – die Ehe mit Elisabeth Freundlich ist zu diesem Zeitpunkt bereits gescheitert – auch wieder sporadischen Kontakt: «Bin gespannt, an welchem Buche Du jetzt bist (und wäre gespannt, zu erfahren, an welchem ich sitze. Too many.)».92 Ihr schmaler Briefwechsel erzählt von einigen Versuchen, sich bei Europareisen Hannah Arendts in den jeweili-gen Terminkalendern unterzubringen, was meistens scheitert – nicht selten zur Erleichterung Arendts.93 Günther Anders hinge-gen drängt: «Ist irgendetwas ganz Bestimmtes zwischen uns zu
ı90 ı 91
besprechen? Wohl kaum. […] As to me: ich möchte einfach Dich wiedersehen.»94 Über philosophische Streitfragen geben die Briefe keine Auskunft: «Aber d’accord sind wir vermutlich über nichts, außer daß man sich niemandem verschreiben darf.»95 Statt dessen informiert man sich über Alltagssorgen – «Ich sitze über viel zu vielen Skripten»96 –, die jüngsten «Broadcasting»-Events oder Hausmittel gegen Arthritis, unter der beide Korrespondenten in unterschiedlicher Ausprägung leiden. Außerdem bittet Gün-ther Anders um Unterstützung in Sachen Wiedergutmachung. Damit er als Verfolgter des NS-Regimes fi nan zielle Ansprüche gel-tend machen kann, soll Hannah Arendt seine Habilitationspläne aus den 30er Jahren bezeugen: «Also bitte sei, in um Dekaden verspäteter Hilfebereitschaft, so gut, ein bißchen zu puffen.»97 Mehrfach mahnt er darüber hinaus die Abfassung eines Benja-min-Essays an – man wolle das Feld ja nicht Adorno überlassen. À propos: «Gestern kam gespenstig und sauer Vergangenheit hoch: In einem Mahlerkonzert stand plötzlich ein Glatzgreis mit Knopf-augen neben mir: Adorno, für den ich plötzlich ‹lieber Anders› war. Er ist grauslicher denn je, von einer avidity mit dicker Grei-senbehendigkeit und Handküssen; dabei, in dem Alter, aggressiv gegen arme Schlucker. Nichts widerlicher als Aggressivität plus Feigheit.»98 Offenes Lob erntet Anders für den ersten Band der Antiquiertheit des Menschen, der 1956 erscheint: «Ich las sofort den Essay über die Atom-Bombe – der ist ausgezeichnet, das Be-ste, was darüber existiert.» Ähnlich hochgestimmt ist Hannah Arendts Urteil über Anders’ Beckett-Interpretation aus demsel-ben Band: «hervorragend!» Auch Heinrich Blücher sei «eher noch begeisterter als ich.»99
Am 23. Mai 1961, exakt 20 Jahre nach Hannah Arendts New Yorker Telegramm an ihren Fluchthelfer, kommt es in München dann doch noch zu einer leibhaftigen Begegnung. Günther An-ders warnt postalisch vor: «Und erschreck nicht: jung sehe ich nach meinen schweren Kränken nicht gerade mehr aus. Aber netter als der Adorno bestimmt noch.»100 Für die Adressatin offen-bar nicht. An Heinrich Blücher sendet sie nach dem Treffen ein
wenig schmeichelhaftes, ja regelrecht verächtliches Porträt: «Das war doch ziemlich erschreckend. Er sieht sehr verändert aus, nicht einmal so viel älter, obwohl er strohweiß geworden ist, als ir-gendwie indefi nable, runtergekommen, mit völlig verkrüppelten Händen, sehr dünn, sehr fahrig. Er denkt an nichts als an seinen Ruhm, völlig unbekümmert, leicht verrückt, vor allem ganz und gar wie seine Mutter, außer aller Realität lebend, alles mit einem Klischee bezeichnend, ungestört in einem château d’Espagne, dem eigentlich nichts Wirkliches entspricht. In Wahrheit ist er fi nanziell ganz ungesichert, verdient halbwegs, was er unbedingt braucht, aber auch dies wohl nicht immer, lebt von der Hand in den Mund, hat keine eigene Wohnung und schlimmen Ärger mit Zimmervermieterin, kriegt auch irgendwie seine Sachen nicht fertig, erzählte, er schriebe jede Seite 30 Mal!! Dabei fühlt er sich on the top of the world, redet davon, er bekäme nur Stargagen z. B., die sich dann als ungefähr das Übliche hier herausstellen, eher etwas weniger, lebt offenbar sehr bescheiden (nach deut-schen Begriffen), fühlt sich gesund, ist es aber sicher nicht. Ihm irgend etwas zu sagen, ist vollkommen unmöglich und ich habe gleich aufgegeben. Damit meine ich nichts Politisches, sondern z. B. über seine Gesundheit, seine fi nanzielle Lage. […] Mir scheint, die schlichte Wahrheit ist, daß er vis-à-vis de rien steht, es aber nicht realisiert. […] Kurz, er ist verhext».101
Auch sonst fi ndet Hannah Arendt kein gutes Wort. Per Brief an Blücher lästert sie, Günther Anders schwimme «selig im Atom-tod» und hänge sich gemeinsam mit Heidegger «an den Zug der Geschichte» (gemeint ist die Anti-Atom-Bewegung, für die beide Denker Partei ergreifen).102 Ihren Ex-Mann hält sie für komplett größenwahnsinnig, sogar für ernsthaft psychisch krank, nicht erst seitdem Hans Jonas ihr von einer bizarren Urlaubsbegegnung in Tirol berichtet hat, die eine jahrelange Eiszeit zwischen den alten Studienfreunden auslöst.103 Für Günther Anders hingegen schien das Münchner Treffen einfach nur «sehr schön». […] Und ich hoffe auf Wiederholung.»104 Doch dazu kommt es lange nicht. Die zweite und zugleich letzte Begegnung schließt – Ironie der Ge-
ı92 ı 93
schichte – unmittelbar an Hannah Arendts letzten Besuch bei dem inzwischen deutlich vom Alter gezeichneten Heidegger an. Auch Günther Anders macht auf sie einen desolaten Eindruck; sie empfi ndet Mitleid: «Ich weiß nicht, ob ich Dir erzählt habe», schreibt sie am 22. August 1975 von ihrem Feriendomizil in Tegna aus an Mary McCarthy, «daß mein erster Mann [Günther Anders] plötzlich auftauchte – in sehr schlechter Verfassung. Er erzählte mir nun, daß seine jetzige Frau – eine Amerikanerin, Pianistin – ihn verlassen hat. Er sitzt in Wien, ich glaube, ganz allein. Ziem-lich gräßlich.»105
Mit zunehmendem Alter, erst recht nach dem Tod Heinrich Blüchers 1970, wird der Kontakt zwischen den einstigen Ehe-leuten wieder intensiver; man telefoniert nun häufi ger, auch über Privates. Günther mahnt Hannah zur Rücksichtnahme auf die angeschlagene Gesundheit und verwendet in seinem vorletzten Brief dabei eine bedeutsame Formel – «amo te esse».106 Fünfzig Jahre zuvor hatte Martin Heidegger die bis dato vielzitierten Worte an Arendt gerichtet: «Amo heißt volo, ut sis, sagte einmal Augu-stinus: ich liebe Dich – ich will, daß Du seiest, was Du bist.»107 Von einer echten (Wieder-)Annäherung zwischen Hannah Arendt und Günther Anders, gar «einem Neuanfang, der nicht mehr gelebt werden konnte»108, kann trotzdem keine Rede sein. Eher handelt es sich um melancholisch-freundschaftliche Verbundenheit, ge-speist aus den Erinnerungen an gemeinsam durchlebte Jahre im Angesicht einer sich allmählich aufl ösenden Welt. An Karl und Gertrud Jaspers schreibt Hannah Arendt einmal: «Menschlich, nicht ‹existentiell›, ist es ja doch so, daß der eigene Tod normaler-weise […] von dem Tod der anderen, die zu einem gehören, vor-bereitet wird, als sterbe die Welt langsam ab, bzw. das Stückchen Welt, das man sein eigen nennt.»109 Für Arendt gehört nun Gün-ther Anders – neben Hans Jonas – zu den letzten noch verblie-benen Weltstücken, die aus frühesten Tagen in die Gegenwart hineinragen und, wenn schon nicht für die Kontinuität einer Le-bensliebe stehen, so doch wenigstens Heimatgefühle evozieren.
Der letzte Brief, den Anders an Arendt aufsetzt, datiert vom
26. November 1975 und dreht sich noch einmal um Habilitations-pläne und Wiedergutmachungsansprüche.110 Er wird nicht mehr beantwortet. Hannah Arendt erliegt am 4. Dezember in ihrer Wohnung am New Yorker Riverside Drive einem Herzinfarkt. Für Günther Anders ist die Nachricht ein Schock. «Die Briefe, die ich damals von ihm bekam, klangen, als betrauerte ein Mann seine Frau», bemerkt Hans Jonas. «Er war untröstlich. Dabei hatte er in der Zwischenzeit häßliche, feindselige Dinge über sie gesagt. Dennoch war er durch den Tod zutiefst getroffen und erlebte ihn als den endgültigen Verlust der von ihm am meisten geliebten Frau.»111 Um Weihnachten des unglückseligen Jahres nimmt er an seinem Schreibtisch in der Wiener Lackierergasse Platz und läßt seine «reproduktive Einbildungskraft» in die gemeinsame Vergangenheit schweifen.112 Das Produkt dieser Unternehmung, Die Kirschenschlacht, wird zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlicht (s. o., S. 63). Zwölf Jahre später, 1987, erscheint als Weihnachts-gabe des Verlags C. H. Beck dafür ein anderes Schubladen-Juwel aus der Abteilung reproduktive Vorstellungskraft – das 1946 im US-Exil verfaßte, vermutlich «beste philo sophische Lehrgedicht in deutscher Sprache»113: Mariechen. Eine Gutenachtgeschichte für Liebende, Philosophen und Angehörige anderer Berufsgruppen. Wer darin einmal mehr zwischen den Zeilen liest, fühlt sich un-mittelbar in die Drewitzer Kammer versetzt.
Alle Kirschen sind aufgegessen oder eingemacht, der philoso-phische Disput ist längst verebbt. Vom Balkon weht eine kühle Abendbrise, das junge Ehepaar bereitet sich auf die Nacht vor. Während sie die Kissen zurechtstopft, beginnt er im vertrauten, patriarchalisch-pädagogischen Tonfall zu erzählen: von Marie-chen, dem «fensterlos» einsamen Walfi sch, der verlassen durch die Beringstraße zieht und keinen Begriff von seinem Dasein hat, vom humorlosen Heidegger («Martinus Sanctus»)114, ganz ent-setzlich voneinander abgeschnittenen Leibnizschen Monaden und von der Liebe, die nur den Menschen vergönnt ist. Auch Rilkes Duineser Elegien haben einen kurzen Auftritt. Die Themen des Nachmittags erscheinen im Nachtgewand – aber mit einem
ı94 ı 95
unerwartet lebenspraktischen Schluß, der die kosmische Irrele-vanz des vermeintlichen ontologischen Hirtenvolks (s. o., S. 26), die im zweiten Dialog der Kirschenschlacht das Gemüt der Gelieb-ten so sehr erhitzt, kurzerhand ins Positive wendet: «Die Moral ist einfach: Freu dich.»115 Und zwar daran, ausgerechnet dieser Mensch, ausgerechnet hier und jetzt zu sein. Nur wenige Dinge gebe es, die von so ausgemachter Komik seien, wie der Zufall, daß das, was sei, tatsächlich «da» sei, «ausgerechnet jeder gerade/als er selbst; und daß bei jedem/dieser Zufall so beliebt ist», resü-miert der philosophische Geschichtenerzähler. Diesem «Doppel-faktum» lasse sich nur mit einer Art «amoureuse[m] amor fati» begegnen, einer Humor-Mischung von Verblüffen (das alte philo-sophische Staunen) und Freude, von «Sinn-Verzicht und Her-zenswärme,/Nihilismus und Vergnügen.»116 Der vergnügte, her-zenswarme Nihilismus, den der Erzähler seiner Gefährtin nahe bringen will, klärt nicht die letzten Fragen, aber er wirkt als kon-tingenzphilosophisches Antidepressivum existentiell beruhigend, «[…] weil Du alle/ontologischen Probleme,/ […] (zwar nicht lösen, aber immer)/praktisch durch zusammenkuscheln/stillen kannst in drei Minuten.»117
Günther Anders überlebt seine Lebensliebe um 17 Jahre und stirbt nach längerer Krankheit am 17. Dezember 1992 in einem Wiener Pfl egeheim.
2. Denkwege
Kein weites Feld
Hannah Arendt hat Konjunktur. Das öffentliche Interesse ist groß, und die Forschung läuft auf Hochtouren; von einer regelrechten «publizistischen Arendt-Industrie» ist die Rede.118 Sie hat in den letzten Jahren herausgearbeitet, wie stark die Weltbürgerin aus Niedersachsen vom Dialog mit der philosophischen Tradition, ihren Lehrern und Zeitgenossinnen geprägt war.119 Allein die bis dato erschienenen Briefwechsel – mit Karl Jaspers, Martin Heideg-ger, Heinrich Blücher, Mary McCarthy, Kurt Blumenfeld, Her-mann Broch, Uwe Johnson, Walter Benjamin und unlängst Gershom Scholem und Joachim Fest – sowie die Veröffentlichung ihres Denktagebuchs120 belegen eindrucksvoll das geistige Bezie-hungsgefl echt zu intellektuellen Wegbegleitern und Sparrings-partnern. Auch Hannah Arendts zweitem Mann Heinrich Blü-cher, der als autodidaktischer Philosoph an der New School for Social Research und am New Yorker Bard College lehrte, ohne eigene Schriften zu hinterlassen121, wird ein prägender Einfl uß auf die Gedankenwelt seiner Frau zugesprochen. Barbara Hahn nennt ihn den «Ko-Autor oder besser Ko-Denker der Studie über den Totalitarismus, das erste ihm gewidmete Buch»122; Werner Heuer spricht gar vom «Sokrates an ihrer Seite».123 Nur einen sucht man in diesem Kontext fast vergeblich: Günther Anders.
Er selbst hat nichts dazu beigetragen, das verzerrte Bild zu korrigieren. Sein Imprimatur zur Wiederveröffentlichung des ge-meinsam mit Hannah Arendt verfaßten Aufsatzes über Rilkes Duineser Elegien unterstellt einen im Lauf der Zeit zum unüber-brückbaren Graben angewachsenen Dissens in religiösen Fragen und, so darf man vermuten, darüber hinaus. Das «Stück» sei der-art von «Geist, Stil und Vokabular» seiner geistigen Produktion ab
ı96 ı 97
1930 entfernt, daß er «nicht zu befürchten brauche, mit dem Text identifi ziert zu werden», so Anders. Gleiches gelte umgekehrt für Hannah Arendt. Jahrzehnte nach dem «Abbruch gemeinsamer Versuche» lassen sich – neben beider Bezugspunkt Heidegger – scheinbar keine Parallelen und Konvergenzen (mehr) ausma-chen.124 Doch blieb das Drewitzer Symphilosophieren tatsächlich biographische Episode ganz ohne vernehmbaren Nachklang auf zweifelsohne ungleichen Denkwegen? Was spricht dafür, Gün-ther Anders und Hannah Arendt jenseits des gemeinsamen intel-lektuellen Ursprungs und trotz ihres privaten Zerwürfnisses als Geistesverwandte zu betrachten?
Auf den ersten Blick nicht viel. Zumindest die expliziten Ver-weise auf den jeweils anderen muß man in den Schriften von Günther Anders und Hannah Arendt mit der Lupe suchen. In Arendts bis dato auf deutsch publizierten Werken fi ndet sich – in einer Anmerkung – lediglich ein einziges explizites Zitat aus der Antiquiertheit des Menschen, auf das Arendt in einem Brief an An-ders auch zu sprechen kommt («ich habe Dich […] schmunzelnd in der Human Condition zitiert»125), sowie zwei, drei Formulie-rungen, die stark an den Andersschen Terminus vom «promethe-ischen Gefälle» erinnern, aber keinen Hinweis auf seinen Urheber enthalten.126 In besagter Anmerkung, auf Seite 455 f. der deutschen Ausgabe ihres ersten philosophischen Hauptwerks Vita activa, schreibt Hannah Arendt gönnerhaft: «In einigen interessanten Bemerkungen zur Atombombe in seiner Antiquiertheit des Men-schen weist Günther Anders allerdings mit Recht darauf hin, daß man im Falle der Atomexplosion kaum noch von Experiment und Laboratorium sprechen könne, weil ‹die Effekte so ungeheuer sind, daß im Moment des Experiments das ‹Laboratorium› ko- extensiv mit dem Globus wird› […]» Ein impliziter Bezug auf An-ders’ Abhandlung Über die Bombe und die Wurzeln unserer Apoka-lypseblindheit127 fi ndet sich darüber hinaus in Macht und Gewalt, worin Hannah Arendt anstelle von Anders jedoch einen Zeitschrif-tenartikel Andrej Sacharows zitiert: «Es ist, als habe sich das Ver-hältnis von Politik und Krieg, von Macht und Gewalt umgekehrt.
Die Friedenspolitik, die auf den Zweiten Weltkrieg folgte, war der Kalte Krieg, also die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, und ein Atomkrieg kann überhaupt nicht mehr als ‹Mittel› be-trachtet werden».128 Die Paraphrasen der Gefälle-These fi nden sich auf Seite 11 beziehungsweise 345 der Vita activa. Im selben Buch bemerkt Arendt auffallend beiläufi g: «Auf diese Entwick-lung, nämlich die merkwürdige Diskrepanz zwischen dem, was wir in Arbeit und im Herstellen erreichen, und der Art und Weise, wie wir uns in dieser erarbeiteten und hergestellten Welt dann be-wegen, ist oft hingewiesen worden; man spricht hier gemeinhin von einem angeblichen Nachhinken unserer allgemein menschli-chen Entwicklung hinter den Errungenschaften der Naturwissen-schaften und der Technik […].»129
Auch umgekehrt sind direkte Bezüge kaum auszumachen. In seinen Tagebüchern aus Auschwitz betont Günther Anders ein-mal ohne Querverweis, daß es nicht nur eine «Banalität des Bösen», sondern auch die «Bosheit des wirklich Bösen» gegeben habe.130 Viel expliziter wird er, auch an anderer Stelle, nicht. Der 1938 einsetzende und in Arendts Todesjahr endende Briefwechsel ist geringen Umfangs und geistesgeschichtlich kaum von Belang. Arendts Post an Heinrich Blücher sowie an ihre Freundin Mary McCarthy enthält hauptsächlich abfällig-mitleidige Bemerkun-gen über Günther Anders. Und so ließe sich in Anlehnung an eine berühmte Metapher Arendts annehmen, daß das Tischtuch zwi-schen beiden Ex-Partnern schon bald nach der Scheidung in jeder Hinsicht zerrissen war.131 Doch dieser Anschein trügt. Denn in fast allen Schaffensphasen seit der Eheschließung gibt es neben den fraglosen Unterschieden zahlreiche, meist implizite Bezug-nahmen, aber auch frappante thematische Überschneidungen und Konvergenzen, die einen kritischen Vergleich geradezu her-ausfordern. Erstaunlich, daß sich die Forschung bis heute nur wenig dafür interessiert hat.
«Eine vergleichende Studie zum Werk von Hannah Arendt und Günther Anders steht noch aus», beklagte schon vor 20 Jahren Ludger Lütkehaus.132 Bis heute hat sich daran nichts geändert.
ı98 ı 99
Konrad Paul Liessmann unternimmt eine erste Gegenüberstel-lung im notwendigerweise begrenzten Rahmen einführender Vor-lesungen in die Philosophie.133 In einem Aufsatz zitiert Bernd Neumann erstmals aus dem Briefwechsel von Anders und Arendt und nimmt außerdem auch auf die Rilke-Rezension sowie Han-nah Arendts Fabel Die weisen Tiere Bezug, in der die frisch Ver-mählte ihr Verhältnis zu ihrem Ehemann und zum Geliebten Hei-degger poetisch bearbeitet hat.134 Karin Maire untersucht Arendts Eichmann-Report und Günther Anders’ Briefwechsel mit dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly auf methodische und sach-liche Konvergenzen; in einem Text aus dem Jahr 2007 konstatiert sie eine gemeinsame anthropologische Ausgangsbasis und spricht – ganz zu Recht – von einem «dialogue caché», einem ver-borgenen Zwiegespräch, nicht ohne auf die konträren Konzeptio-nen des Totalitarismus- und des (politischen) Freiheitsbegriffs hinzuweisen.135 Dieter Thomä wirft in einer Abhandlung über Günther Anders’ naturphilosophisch fundierte Phänomenologie und Praxisphilosophie einen kurzen Seitenblick auf Hannah Arendt, speziell auf das Gemeinschaftsprodukt zu Rilke sowie die konträren Interpretationen von Hermann Brochs Tod des Vergil136, die Thomä als Endpunkte eines ursprünglich geteilten, von Hei-degger geprägten Gedankenwegs fi xiert.137 Mit dem exklusiven Fokus auf Heidegger verschattet er jedoch den Einfl uß der Philo-sophischen Anthropologie auf Anders und Arendt. Außerdem kreuzen sich beider Denkwege auch nach dem Krieg.
Sylvie Courtine-Denamy geht in ihrer Monographie über den Dialog Hannah Arendts mit «quelques-uns de ses contemporains» nur ganz am Rand auf Günther Anders ein, in der prominenten Reihe von «Heidegger’s children», die Richard Wolin bespricht, fi nden sich Arendt und Hans Jonas, der mit beiden eng verbun-dene Anders jedoch nur als Anekdote.138 Und Raimund Bahr er-klärt Hannah Arendt in seiner Anders-Biographie zwar zu Anders’ Lebensliebe, «mit der er durch eine besondere Form des Denkens verbunden war», und spricht von «Fehleinschätzungen und Unge-nauigkeiten in der Betrachtung dieser wohl außergewöhnlichen
Beziehung», ohne sein sicherlich zutreffendes Urteil aber näher zu begründen.139 Dabei konstatierte bereits die 1982 erschienene Arendt-Biographie Elisabeth Young- Bruehls für die erste Zeit der Ehe eine große geistige Übereinstimmung.140 Doch die Familien-ähnlichkeiten verblassen auch nach der Scheidung nicht.
Drewitzer Symphilosophie:Die Lehre von den Menschen
Das Denken von Günther Anders und Hannah Arendt ruht – die Forschung hat häufi g darauf hingewiesen – auf einem Funda-ment, das in Todtnauberg und Marburg gelegt wurde.141 Erste Er-weiterungen und Korrekturen dieses Fundaments beginnen schon früh, bei «Herrn Stern» nach dem endgültigen Bruch des ohnehin schwierigen Verhältnisses zu Heidegger Mitte der 20er Jahre, für Hannah Arendt mit ihrer Promotion bei Jaspers. Zu Beginn ihrer Ehe führen die Sterns den Aus- und Umbau eine Weile zu sammen fort – in gemeinsamer Arbeit (am Text von Arendts Disser tation, an der Weltfremdheit und an Rilkes Duineser Elegien), parallel zu-einander (in zwei separaten Rezensionen zu Karl Mannheims Ideologie und Utopie142) und in zahllosen Kirschenschlachten. Da-bei macht das Paar regen Gebrauch von einer rund 3000 Bände umfassenden Gemeinschaftsbibliothek. In den Exilwirren ver-lorengegangen143, hat sich aus ihrem Bestand ein Exemplar von Kants Kritik der praktischen Vernunft erhalten – mit Marginalien in den Handschriften beider Besitzer.
Spuren der Drewitzer Arbeitsgemeinschaft fi nden sich jedoch auch jenseits «gemeinsamer Versuche» wieder. Sie wurzeln in der Beschäftigung mit anthropologischen Fragen, denen vor allem Günther Anders sich in der Absicht philosophischer System-bildung ab 1927 verstärkt zuwendet – nicht ohne Hannah Arendt als Ko-Denkerin in den Arbeitsprozeß einzubeziehen. Als das «kategoriale Kind» dieses Unternehmens macht Ulrich Raulff den gegen Heideggers Thanatologie positionierten, gemeinhin Han-
ı100 ı 101
nah Arendt zugeschriebenen Begriff der «Gebürtlichkeit» (Nata-lität) des Menschen aus.144 Auch in bezug auf weitere zentrale Motive philosophischer Anthropologie sind Anders und Arendt d’accord. Beide sind der Ansicht, daß es ein ahistorisches, eindeu-tig bestimmbares menschliches Wesen nicht geben kann: «L’artifi cialité est la nature de l’homme et son essence est l’instabilité», lautet die an Helmuth Plessner erinnernde Kurzformel der An-dersschen Anthropologie.145 Hannah Arendt schreibt in einem Es-say von 1970, Veränderung sei «ein fester Bestandteil der ‹condi-tion humaine›» und die menschliche Zivilisation ein «künstliche[s] Gehäuse für die aufeinanderfolgenden Generationen».146 In Vita activa ist die Rede von der (bei Arendt sowohl ontologisch als auch handlungstheoretisch abgeleiteten) «grundsätzlichen Unzuverläs-sigkeit des menschlichen Wesens, das niemals heute dafür einste-hen kann, wer es morgen sein wird».147
Als prinzipiell «weltfremd», nicht von Geburt an auf der Erde heimisch, müsse der Mensch sich passende Umwelten erst zu-rechtschneidern und immer wieder aufs neue anmessen, so Gün-ther Anders. Die spezifi sche Lage des Menschen in der Welt cha-rakterisiert er positionstheoretisch und in Abgrenzung zu Heideg-ger als «Insein in Distanz», als einen «Abstand des Menschen von der Welt in der Welt».148 Das menschliche Dasein ist für Anders also nicht, wie bei Heidegger, durch sein Je-schon-in-der-Welt-sein bestimmt, sondern durch seine – mit Plessner gesprochen – exzentrische Position149, durch sein Nicht-selbstverständlich-dar-innen-sein, seine Distanz und Abgetrenntheit von der Welt, kurz: durch seine Weltfremdheit (in erkenntnistheoretischer Terminolo-gie: durch sein Angewiesensein auf Erfahrung). So begründet bei Anders eine «ontologische Differenz» (Werner Reimann) zwi-schen Mensch und Welt «ursprünglich den Menschen qua Men-schen», dessen Individualität paradoxerweise aus eben dieser Si-tuation der ursprünglichen Abgeteiltheit respektive «Dividualität» entspringt.150 Was zunächst wie ein Defekt anmutet, entpuppt sich als Garant der Freiheit: Aus der Weltfremdheit des Men-schen folgt seine Weltoffenheit (ein Ausdruck, den Anders von
Scheler übernimmt), die Fähigkeit, sich in der Welt immer wieder neu einzurichten, immer wieder ein anderer zu sein. Das bedeu-tet schließlich: Eine spezifi sche Menschennatur gibt es nicht – wesentlich ist dem Menschen gerade seine Unbestimmbarkeit und Nichtfestgelegtheit. Der damit verbundene Freiheitsbegriff ist notwendigerweise ein negativer.151 Gleiches gilt für Hannah Arendt. Auch sie begreift den Menschen als ein Wesen, das aus sich heraus immer wieder neue Anfänge stiften kann, weil es qua Geburt selbst ein Anfang ist: «[Initium] ergo ut esset, creatus est homo», lautet ihr von Augustinus entlehntes ontologisches Motto.152 Wie bei Anders ist der Mensch auch bei Arendt essen-tiell schöpferisch und spontan, durch Nichtfestgelegtheit und Weltoffenheit ausgezeichnet, als Person außerdem erst a poste-riori (genauer: post mortem) annäherungsweise faßbar: «Das We-sen einer Person – nicht die Natur des Menschen überhaupt (die es für uns jedenfalls nicht gibt) und auch nicht die Endsumme individueller Vorzüge und Nachteile, sondern das Wesen dessen, wer einer ist – kann überhaupt erst entstehen und zu dauern be-ginnen, wenn das Leben geschwunden ist und nichts hinterlas-sen hat als eine Geschichte.»153 Und so führt auch bei Hannah Arendt kein Weg vom Individuum zur vermeintlich allgemeinen Menschennatur: «Selbst […] wenn es einem gelingen sollte, ein peinlich genaues Verzeichnis aller menschlichen Möglichkeiten, wie sie uns heute vorliegen, anzufertigen, so wären damit die we-sentlichen Charaktere menschlicher Existenz keineswegs er-schöpft, nicht einmal im negativen Verstande, als hätte man nun wenigstens gefunden, was menschliche Existenz schlechterdings nicht entbehren dürfe, ohne aufzuhören, menschlich zu sein.»154 Arendts Skizze der Conditio humana erklärt der Idee einer über-zeitlich fi xierbaren menschlichen Natur dieselbe Absage wie Günther Anders: Essentia non est! Darüber hinaus wird Anthro-pologie bei ihr unweigerlich zur Glaubensfrage. Sollte es nämlich «so etwas wie ein Wesen des Menschen» dennoch geben, spe-kuliert Arendt, könne zweifellos nur ein Gott es erkennen und defi nieren, «weil nur ein Gott vielleicht imstande ist, über ein
ı102 ı 103
‹Wer› in dem gleichen Sinne Aussagen zu machen wie über ein ‹Was›.»155
Seine Nahrung erhält dieses Denken nicht nur, wie die For-schung immer wieder betont, bei Heidegger oder Jaspers, sondern ganz offensichtlich auch in der Philosophischen Anthropologie der 1920er Jahre, die Hannah Arendt vor allem durch Vermittlung und in der Variante ihres ersten Ehemannes näher kennenlernt. Treffend spricht Karin Maire daher von einer «conception parta-gée de l’anthropologie philosophique»156 – einer gemeinsamen Auffassung, die es trotz unterschiedlicher und eigenständiger Denkwege erlaubt, Günther Anders und Hannah Arendt als Symphilosophierende zu betrachten. Der Nachlaß von Günther Anders erweist sich in dieser Hinsicht als Fundgrube. Darin be-fi ndet sich unter anderem ein Fragment aus dem Kontext der Weltfremdheit, auf das hier exemplarisch näher eingegangen wer-den soll, zum einen, weil es fast wörtlich vorwegnimmt, was Han-nah Arendt 30 Jahre später als einen ihrer anthropologischen Grundgedanken unter dem Rubrum «Pluralität» formuliert, zum anderen, weil darin ein Sujet der Kirschenschlacht – nämlich die Kritik des «Monanthropismus» der philosophischen Anthropo-logie, die «kaum je von Menschen im Plural, fast immer vom Menschen, gewissermaßen im ‹platonischen Singular›» spricht (s. o., S. 39) – wieder auftaucht, das Dokument also als Beleg dafür gelten kann, daß sich die «reproduktive Einbildungskraft» von Günther Anders bei aller Freiheit in den Details keiner Ge-schichtsklitterung schuldig gemacht hat.
Der Vorwurf des «Monanthropismus» beziehungsweise des «Singularisierungsschwindels» (s. o., S. 42) fi ndet sich auch bei Hannah Arendt (freilich ohne die Kritik des «Monandrismus», welche Günther Anders ihr in der Kirschenschlacht in den Mund legt157). In Vita activa betont sie: «Es gibt kein menschliches Leben, auch nicht das Leben des Einsiedlers in der Wüste, das nicht, sofern es überhaupt etwas tut, in einer Welt lebt, die direkt oder indirekt von der Anwesenheit anderer Menschen zeugt.»158 Das bedeutet zweierlei: Einerseits gibt es «den Menschen» gewisser-
maßen nur als Vielheit. Andererseits sind alle Menschen, obschon qua Menschsein gleichartig, untereinander völlig verschieden, mithin einzigartig: «Im Menschen wird die Besonderheit, die er mit allem Seienden teilt, und die Verschiedenheit, die er mit al-lem Lebendigen teilt, zur Einzigartigkeit, und menschliche Plura-lität ist eine Vielheit, die die paradoxe Eigenschaft hat, daß jedes ihrer Glieder in seiner Art einzigartig ist.»159
Dieselbe Einsicht formuliert Günther Anders in seinem Frag-ment, das mit «Mangelnde Welteinbettung – es gibt nur einzelne Menschen nicht einzelne Tiere» überschrieben ist und das par-tiell auch in die Weltfremdheit eingegangen ist.160 Die einschlägige Passage lautet: «Es gilt […] dem Begriff des Menschen wie des Tieres von vornherein einzurechnen, daß es Menschen und Tiere gibt. Diese erst einmal angezeigte Allgemeinheit gehört dem Wesen ab ovo zu und kann nicht einfach als zufälliges Faktum dem Wesen angehängt werden. (Einfügung: So singular-plural-neutral einerseits die idea [im Original altgriechisch] sein mag, die Pluralität muß gleichsam neutralisiert in ihr mitvorkommen. (s. Platon, Staat.)) Mensch ist von vornherein Menschen, Tier von vornherein Tiere. Damit ist nicht vor irgendeiner induktiven Empirie kapituliert. Induktion suchte niemals den Pluralitätssinn ihrer Gegenstände zu verstehen, bearbeitete niemals Gegen-stände, qua mehrere, sondern stets nur mehrere Gegenstände – und überdies nur, um zuletzt zu einer unpluralen Allgemeinheit zu gelangen.» Und weiter: «So bedeutet die Pluralität beim Men-schen etwas grundsätzlich anderes als beim Tiere. Die mangelnde Welteinbettung, die dem Menschen in idealtypischem Verstande zukommt, wiederholt sich noch einmal innerhalb der mensch-lichen Dimension selbst: Der je einzelne Mensch ist eminent Ein-zelmensch […]. [im Original durchgestrichen: Es gibt Menschen besagt: es gibt je verschiedene Menschen. Es gibt Tiere der spe-cies A besagt: es gibt gleiche Tiere der Spezies A.]»
In dem Fragment bestimmt Günther Anders den Menschen als einen Gegenstand, der generell nur in Mehrzahl vorkommt, nur in Relation zu anderen Gegenständen seiner Art existiert.
ı104 ı 105
Etwas eingängiger formuliert Anders die Essenz des Textes in seinen – allerdings erst 1967 veröffentlichten – Wiener Tagebuch-einträgen vom Juni 1951: «Was ich meine, ist, daß der Mensch – Menschen ist; daß er nur im Plural existiert; daß die Menschen nicht nur zufälligerweise in Massenproduktion hergestellte Exem-plare des Eidos ‹Mensch› darstellen, sondern daß der Plural zum Typ gehört. ‹Menschen› ist nicht der Plural des Singular ‹Mensch›, vielmehr ist jeder Mensch bereits eine Singularisierung der Men-schen.»161 Die Auszeichnung «des Menschen» als plurales Wesen beinhaltet die beiden miteinander verwobenen Bedeutungsebe-nen, die auch Hannah Arendt im Blick hat: Auf der einen wird Pluralität als Vielheit interpretiert, auf der anderen als Binnen-differenz beziehungsweise Alterität. Während Homo sapiens je-doch das Grundmerkmal der Vielheit mit allen Tierarten teilt, macht Pluralität als Differenz beziehungsweise Alterität seine eigentliche differentia specifi ca aus. Für Günther Anders und Han-nah Arendt wird sie zum Index des spezifi schen Unter-Menschen-Seins «der» Menschen, zum Ausdruck eines die «ontologische Differenz» von Mensch und Welt – das «Insein in Distanz» – ver-doppelnden distanten Einbettungsverhältnisses von Mensch und Menschheit: Mensch ist man immer nur als jeweils so und so Be-stimmter unter anderen jeweils so und so Bestimmten. Das ist der Sinn des Ausdrucks «Der je einzelne Mensch ist eminent Einzel-mensch». Wie in der Andersschen Weltfremdheit, so ist auch bei Arendt der Begriff der Pluralität darüber hinaus ein Negativ-Be-griff, aus dem keine expliziten Bestimmungen folgen, der umge-kehrt vielmehr die Unfestgelegtheit und Kontingenz des mensch-lichen Daseins zusätzlich unterstreicht.
Mit seinen fragmentarischen Überlegungen hat Günther An-ders Jahrzehnte vor Hannah Arendt, aber sicherlich im Gespräch mit ihr, die beiden Bedeutungsebenen von Pluralität herausgear-beitet: Vielheit und Verschiedenheit – in einem anthropologi-schen Rahmen, der Arendts Überlegungen zur Conditio humana in Vita activa übersteigt. (Die geplante Veröffentlichung seiner Frühschriften dürfte dies belegen.) Das Urheberrecht für den Ge-
danken der Pluralität, der viele Väter hat, liegt damit sicher nicht bei ihm. Eine entsprechende Folgerung wäre philosophiegeschicht-lich naiv, und Günther Anders hätte sie schon deshalb abgelehnt, weil er den «ganz eigenständigen Denk- und Sprachstil» (s. o., S. 11) seiner ersten Frau zeitlebens hochschätzte. Die Vermutung liegt jedoch nahe, daß Hannah Arendt sich seinerzeit vor allem über ih-ren Mann mit dem Vokabular der Philosophischen Anthropologie vertraut machte, es also künftig nicht nur Max Scheler als «Lese-hilfe» zur Entschlüsselung der Arendtschen Anthropologie heran-zuziehen gilt, wie Hans-Peter Krüger meint162 , sondern in erster Linie Günther Anders.
Neben der anthropologischen «conception partagée» gibt es noch eine weitere im Wortsinn fundamentale Gemeinsamkeit; Hans Jonas kommt darauf in einem Brief an Günther Anders zu sprechen: nämlich «die (mit unserer teuren Hannah geteilte) Me-thode des Übertreibens, der Extremisierung jeder wichtigen und richtigen Einsicht».163 Zwar läßt sich die Geste der methodischen Revolte gegen das philosophische Establishment gewiß einmal mehr auch auf die gemeinsame Heidegger-Prägung zurückfüh-ren.164 Doch in der Wahl ihrer Mittel gehen Günther Anders und Hannah Arendt kaum mit dem akademischen Lehrer konform, dafür häufi g Hand in Hand. Sie mischen phänomenologische Analyse mit philosophischem Journalismus (wie in Eichmann in Jerusalem oder den Andersschen Tagebüchern), greifen auf litera-rische Quellen zurück (Hannah Arendt in ihrer Totalitarismus-Studie zum Beispiel auf Joseph Conrads Heart of Darkness, Gün-ther Anders auf eigene Fabeln, insbesondere Die molussische Katakombe) und entlehnen von Franz Kafka, Bertolt Brecht, John Heartfi eld und Walter Benjamin das kreative Prinzip von Montage und Retusche: Sachfremde und kontextferne Gegenstände wer-den derart miteinander kombiniert und arrangiert, und das heißt immer auch pointiert und zugespitzt, daß sich verborgene Sinnge-halte offenbaren und überraschende Perspektiven eröffnen.165 Getrost darf man Michael Grevens Urteil über Hannah Arendts Denken – «leidenschaftlich, parteilich, voller Einseitigkeiten und
ı106 ı 107
Entschiedenheit, wie sie dem wissenschaftlichen Betrieb nicht nur philosophischer Seminare im 20. Jahrhundert fremd gewor-den sind»166 – auch auf Günther Anders übertragen.
Eichmann nach Jerusalem
Die Gemeinsamkeiten erstrecken sich darüber hinaus auch auf zeitdiagnostische und kulturkritische Denkmotive. «Lustig, daß wir uns in unseren Themen so nahegekommen sind», stellt Gün-ther Anders in einem Brief an Hannah Arendt vom Oktober 1958 fest – und präzisiert: «ich meine Deine berühmte Münchner Rede.»167 Dabei handelt es sich um einen Vortrag, den Hannah Arendt anläßlich der 800-Jahr-Feier der Stadt München gehalten hat168 und in dem sie erläutert, wie sich die zeitgenössische Kul-turindustrie beziehungsweise die kapitalistische Wirtschaftsweise als solche zu einer alle Lebensbereiche dominierenden, ding- und weltzersetzenden Kraft auswächst – und zwar paradoxerweise um so stärker, je mehr Freizeit sie den modernen Animalia laborantia beschert. «We must not think that civilization will simply happen and all by itself begin to fl ourish – that culture can just happen – when there is ‹free› time», mahnt Arendt in einem anderen Kon-ferenzbeitrag.169 Was der Überschuß an Freizeit befördere, sei lediglich überschießender Konsumhunger, so daß schließlich «alle Gegenstände der Welt, die sogenannten Kulturgegenstände wie die Gebrauchsobjekte, dem Verzehr und der Vernichtung anheim-fallen»170 – eine Gefahr, die laut Arendt im Wesen des modernen Arbeitsregimes wurzelt. Dessen eigentliches Kennzeichen sei nicht die Warenproduktion, sondern die Umwandlung von Werktätigkeit in Arbeit (Laborisierung). Bezogen auf den Produktionsoutput be-deutet das: Aus mehr oder weniger dauerhaften Gebrauchsgegen-ständen werden Konsumgüter, die auf raschen Verbrauch hin ange-legt sind.171 Verzehr triumphiert über Verwendung, Herstellung über Bedarf.
Die Umstellung der Produktion auf die Massenerzeugung von
Verbrauchsgütern führt in Kombination mit fortschreitender Technisierung und Arbeitsteilung und dem Selbstverwertung s-interesse des Kapitals gemäß Hannah Arendt – und Günther Anders – zu einer radikalen Beschleunigung des gesamten Wirt-schafts- und Alltagslebens, in deren Folge der Abstand zwischen Produktion und Destruktion, zwischen Erwerb und Konsum einer Sache oder Dienstleistung immer geringer wird. Die «sinnfälligste Veranschaulichung» dieser Entwicklung ist für Hannah Arendt «die Tatsache, daß menschliches Leben, das immer das Sinnbild des Flüchtigsten und Vergänglichsten, was es überhaupt gibt, ge-wesen war, heute dauerhafter und weniger vergänglich zu sein be-ginnt als die Stadt und die Straße, das Haus und die Landschaft, in welche es hineingeboren ist.»172 In Arendts Augen expandiert der moderne Kapitalismus mit rasendem Tempo in Richtung einer globalen waste economy, angetrieben von gehetzten Dauerkon-sumenten, die unendlich mehr herstellen, als sie jemals konsu-mieren können (eine Variante der Andersschen Gefällethese173).
Auch Günther Anders widmet sich ausführlich dem inneren Zusammenhang von Massenfabrikation und (Welt-)Vernichtung. Für ihn ist die Moderne in einem «zweiten platonischen Zeit-alter»174 angekommen, einer Ära, in der die industrielle Blaupause dem nach ihrem Bild geformten Serienprodukt tatsächlich über-legen ist (wie die Platonische Idee ihrem Abbild) und in der dadurch bedingt die Differenz zwischen Produktion und Destruk-tion, zwischen Gebrauch und Verbrauch, allmählich verschwin-det. Nicht auf Dauer seien unsere modernen Massenprodukte hergestellt. Vielmehr kommen sie laut Anders umgekehrt «im Interesse der Unsterblichkeit der Produktion» mit eingebautem Verfallsdatum, als «virtueller Abfall» oder als notorisch Abhängige (gewissermaßen Produkt gewordene Gehlensche Mängelwesen) zur Welt. Hinter einer pompösen Fassade aus Markennarzißmus und Effi zienzgetöse wird König Kunde mit Pfusch beliefert. Aus Sicht der Herstellung ist der angeborene Warenmalus freilich – geldwerte – Tugend, «da er die Herstellung eines, diesen Defekt behebenden, neuen Produktes nötig macht und dadurch nicht nur
ı108 ı 109
die Produktion wie gehabt weiter in Gang hält, sondern die Zahl der erforderlichen Produkte kontinuierlich steigert.»175 Das eigent-liche Ideal der gesamten Konsumgüterproduktion, und man darf ergänzen: des Dienstleistungssektors, sei es daher, die Ding- re-spektive Warenform konstant zu «verfl üssigen». In dem schlei-chenden Trend zur «‹Liquidierung›» sieht Günther Anders das zen-trale Merkmal des aktuellen Produktionsregimes.176 Traum und Telos dieses Herstellungs- und Lebensmodells ist eine Gesell-schaft aus lauter «‹bemittelten Habenichtsen›»177 inmitten eines unablässig anschwellenden Produktionsstroms überfl üssiger Aus-schußware. Die Konsequenzen dieser in den industrialisierten Ländern der Erde konsequent gelebten Vision sind für Mensch und Welt gleichermaßen desaströs: Dem künstlich hergestellten dauerhaften Notstand auf seiten der Konsumierenden entspricht die Verwandlung der Erde in eine gigantische «‹Wegwerf-Welt›»178.
Auch als politische Denker haben sich Günther Anders und Hannah Arendt viel zu sagen. Wie Arendt sieht auch Anders im Konsumismus und Konformismus der westlichen Welt, ja aller in-dustrialisierten Nationen, totalitäre Tendenzen aufscheinen – Tendenzen, die auf die Stornierung der menschlichen Weltoffen-heit hinauslaufen und das Vermögen, neue Anfänge zu stiften, fundamental bedrohen. Und so gehen Anders und Arendt nicht nur in der anthropologischen Fundierung ihrer Gesellschaftskritik von ähnlichen Prämissen aus. Auch das Ergebnis ihrer gesell-schaftskritischen Diagnostik eint sie: die Befürchtung, das viel-fältige menschliche Wesen könne – bei Anders durch eine zum «Weltzustand» ausgewucherte Technokratie, bei Arendt durch das Absterben des Politischen, die bürokratische «Herrschaft des Niemand» und einen Kapitalismus mit totalitärem Antlitz – auf ein manipulierbares Reaktionsbündel reduziert werden.
Hintergrundfolie dieser Gesellschaftsanalyse ist bei beiden Denkern die lebenslange Auseinandersetzung mit dem National-sozialismus und seinen Folgen. Sowohl Günther Anders als auch Hannah Arendt untersuchen die bürokratisch-sozialtechnischen und mentalen Voraussetzungen des Völkermords an den euro-
päischen Juden, zum Teil zur selben Zeit und mit ähnlichen Er-gebnissen, so daß Lore Hühn eine «überraschende Nähe» von Arendts Theorie des Bösen zu Anders’ Gesellschaftskritik aus-macht.179 Überraschen kann diese Nähe allerdings kaum. Der umstrittene Gerichtsreport Hannah Arendts über den Prozeß gegen Adolf Eichmann, Eichmann in Jerusalem, und Günther An-ders’ offener Brief an Eichmanns Sohn Klaus mit dem provokan-ten Titel Wir Eichmannsöhne werden in Deutschland im selben Jahr, 1964, veröffentlicht.180 Die amerikanische Fassung des Arendtschen Prozeßberichts erscheint ein Jahr zuvor. Liest man der Publikationschronologie folgend beide Texte nacheinander, drängt sich förmlich die Vermutung auf, daß Günther Anders dem Hunderte Seiten füllenden Essay Hannah Arendts mit einer poin-tierten Theorieskizze über die Strukturhomologie von Verbrechen gegen die Menschheit und moderner Arbeitsorganisation antwor-ten wollte. Man kann auch sagen, er habe die von der Person Eichmanns ausgehenden moralphilosophischen Refl exionen nach-träglich um einen sozialphilosophischen Unterbau ergänzt. Indem er die arbeitsteilige, industrialisierte Organisation des Massen-mords als Voraussetzung der Gewissenlosigkeit der Täter an-prangerte und zugleich auf strukturelle Kontinuitäten zwischen NS-Regime und Moderne hinwies, fügte er der Arendtschen Ein-sicht in die «Banalität des Bösen» – eine Formulierung, die er im ersten Band der Antiquiertheit, wo im Zusammenhang mit der Atombombe von der «entsetzliche[n] Harmlosigkeit des Entsetz-lichen» die Rede ist, bereits antizipiert hatte181 – die modernisie-rungsphilosophische Analyse der «Rationalität des Bösen» hinzu.
In ihrem Eichmann-Buch charakterisiert Hannah Arendt den servilen NS-Bürokraten als Idealtypus des modernen Massen-menschen beziehungsweise – wie es in der Totalitarismus-Studie heißt – des «Spießers»182, dessen Angepaßtheit, Gedankenlosig-keit und blinde Systemtreue unter bestimmten Umständen mehr Unheil anrichtet als ein fanatisch-psychotischer Krimineller. Dem stellt Günther Anders mit der Figur des US-Army-Piloten Claude Eatherly einen idealtypischen Anti-Eichmann zur Seite, dessen
ı110 ı 111
Versuche, seine Mitschuld am ebenso monströsen wie aus Sicht der Piloten harmlosen technischen Akt des Atombombenabwurfs auf Hiroshima gewissermaßen nachträglich durch kleinkriminelle Delikte einzuholen und dadurch zugleich auf das Kriegsverbrechen aufmerksam zu machen (so Anders’ umstrittene Deutung von Eatherlys Verhalten nach 1945
183), in der Praxis kläglich scheitern. Für Anders personifi zierte dieser Don Quixote des Atomzeitalters weit mehr als Eichmann das moralische Dilemma der Moderne, in der selbst Massenmord zu einem technologisch vermittelten und entfremdeten Routinejob wird und umgekehrt nichts schwie-riger zu sein scheint, als die Verantwortung gerade für die gräß-lichsten Taten überhaupt noch eindeutig adressieren, geschweige denn als einzelner übernehmen oder gar bewältigen zu können.
Wer will, kann an dieser Stelle eine Brücke von der Kirschen-schlacht zu den konvergierenden Porträts des modernen Massen-menschen bei Günther Anders und Hannah Arendt schlagen: Vor der Folie des Drewitzer Dialogs (s. o., S. 58 f.) läßt sich der Arendt-sche «Spießer» als die ins Politische übersetzte dunkle Seite des ontologischen Monaden-Paradoxes auffassen. Das gesellschaft-lich atomisierte Individuum – bei Arendt der «Spießer», bei An-ders der «Mensch ohne Welt»184 – ist tatsächlich völlig «fenster-los», sein Bezug zur Mitwelt abgeschnitten, sein Kommunikati-onsmodus selbstrefl exiv bis zur Neurose: «Der Spießer ist der Bourgeois in seiner Isolierung, in seiner Verlassenheit von der ei-genen Klasse.»185 Ähnlich ver lassen ist bei Günther Anders der Ar-beitslose, die Beckettsche Figur des existentiell vergeblich War-tenden.186 Im positiven Sinne einzeln, aber nicht vereinzelt, ist der Mensch laut Hannah Arendt nur als Zoon politikon, das heißt in-sofern er sich dem hellen Licht der Öffentlichkeit aussetzt und sich mit anderen um Wohl und Wehe der gemeinsam bewohnten Welt sorgt. Beide Möglichkeiten: Monadische Atomisierung und pluralistische Inter-Monadi zität liegen im Kontingenzspektrum des Humanen.
Weltzustand Technik
Bereits ein erster oberfl ächlicher Blick macht deutlich: Zwischen Günther Anders und Hannah Arendt lassen sich, trotz der zum Teil konträren Prämissen ihrer Gegenwartsanalysen, zahlreiche Bezüge und Schnittmengen ausmachen. Es gibt sogar so etwas wie eine gemeinsame inhaltliche Klammer, die beider Philoso-pheme zusammenhält. Maurice Weyembergh hat bereits in den 1990er Jahren darauf hingewiesen. Gemäß Weyembergh macht Hannah Arendt den Übergang von der Neuzeit in die Moderne am Siegeszug der Technik fest.187 Doch wenn die Neuzeit, wie Arendt behauptet, sich mit dem kartesischen Subjektivismus auf den Weg zunehmender Weltentfremdung begibt, welche sich in der Moderne zur Grundlagenkrise der Wissenschaft verschärft, Weltentfremdung also die Signatur beider Epochen sein soll, warum dann überhaupt zwischen Neuzeit und Moderne unter-scheiden? Gemäß Weyembergh wird der Unterschied durch die Technik (genauer: die Technologie) markiert, durch welche «le monde moderne réalise au moins une partie de ce qui demeurait imaginaire ou théorique à l’âge moderne; il transforme donc cet imaginaire et ce théorique en monde.»188 Sowohl Hannah Arendt als auch Günther Anders kommen vor diesem Hintergrund im Kern zum selben Schluß: Je mehr die Technik von der Theorie zur gesellschaftlichen Praxis – zum politischen Faktor – wird, schließ-lich zur epochemachenden Kraft (Günther Anders spricht von einem «‹Technik› genannten Weltzustand»189), desto stärker wer-den alle menschlichen Tätigkeiten von ihr absorbiert; desto mehr tauscht sie ihre angestammte Objektposition gegen die des menschlichen Subjekts ein. Maschinen ersetzen Arbeitskräfte, die Freiheit des Handelns wird vom Primat der Sozialtechnik abgelöst und in vermeintlich «alternativlose» Sachzwänge einge-sperrt. So hat die moderne Technik nicht nur einen liquida-torischen Aspekt nach der Seite purer Vernichtung – von Natur, Gebrauchs- und Kulturgütern, von «Volksschädlingen» und Kriegsgegnern –, sondern auch nach der Seite des «Praxisentzugs»
ı112 ı 113
und der sozialen Exklusion (Arendt), der Konformierung und der Zurichtung von Menschen zu Verbrauchsmaterial für Maschinen und bürokratische Apparate (Anders) oder «eherne» biologische und soziale «Gesetzmäßigkeiten».
Indem sie Menschen zu ihren Agenten macht und auf diese Weise die essentielle menschliche Weltoffenheit storniert, offen-bart sich die moderne Technik sowohl für Günther Anders als auch für Hannah Arendt – auf Basis der von beiden geteilten anthropolo gischen Grundannahmen – letztlich als Katastrophe des menschlichen Wesens. Zwei Zitate, aus der 1960 auf deutsch erschienenen Vita activa und dem kurzen Text Die Frist aus dem-selben Jahr, mögen die grundlegenden Übereinstimmungen illu-strieren: So befürchtete Hannah Arendt, «daß die Neuzeit, die mit einer so unerhörten und unerhört vielversprechenden Akti vierung aller menschlichen Vermögen und Tätigkeiten begonnen hat, schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden wird, die die Geschichte je gekannt hat.»190 Und Günther Anders warnte davor zu glauben, «daß die Möglichkeit unserer Liquidierung nur ein zufälliges Nebenprodukt einiger spezieller Apparate, z. B. der Atomwaffen, sei. Vielmehr ist die Möglichkeit unserer Liqui-dierung das Prinzip, das wir allen unseren Apparaten mitgeben, gleichgültig mit welcher Sonderfunktion wir jeden von ihnen außerdem betrauen; das Prinzip, auf das es uns bei ihrer Kon-struktion ausschließlich ankommt. Denn worauf wir abzielen, ist ja stets, etwas zu erzeugen, was unsere Gegenwart und Hilfe ent-behren und ohne uns klaglos funktionieren könnte – und das heißt ja nichts anderes als Geräte, durch deren Funktionieren wir uns überfl üssig machen, wir uns ausschalten, wir uns ‹liquidie-ren›. Daß dieser Zielzustand immer nur approximativ erreicht wird, das ist gleichgültig. Was zählt, ist die Tendenz. Und deren Parole heißt eben: ‹ohne uns›.»191
Dieter Thomä macht an diesem Punkt eine markante Diffe-renz zwischen Günther Anders und Hannah Arendt aus. Während der eigentliche Skandal der Moderne für Arendt die Reduktion von Menschen auf reine Somaten und schließlich auf lebende
Leichname (wie in den nationalsozialistischen Konzentrations-lagern) sei, sehe Anders ihn in der Möglichkeit zur totalen Ver-nichtung menschlichen Daseins überhaupt: «Das Paradigma für Arendt ist das Lager, das Paradigma für Anders ist die Atom-bombe.»192 Zweifellos läßt sich Hannah Arendts Modernekritik als Klage über eine sukzessive Reduktion der Vielfalt essentieller menschlicher Ausdrucksformen auf das Niveau von Reproduk-tions- und Substitutionsaktivitäten zusammenfassen. Aber die Anderssche Bombenphilosophie steht zu Arendts Laborisierungs-diagnose nicht im Gegensatz. Es handelt sich vielmehr um die aus der Reduktion und Exklusion des modernen Menschen konse-quent folgende, in der technologischen Dynamik vorgezeichnete Verlängerung beziehungsweise Differenzierung der Arendtschen Verfallsthese aus Vita activa. Aus der umfassenden Reduktion des arbeitenden Menschen auf ein bloßes Maschinenanhängsel und aus der fi nalen Exklusion des arbeits- und damit perspektivlosen «Menschen ohne Welt» oder des staaten- und weltlosen politi-schen Flüchtlings folgt, so befürchten der Technikkritiker Anders und die Totalitarismusforscherin Arendt unisono, früher oder später seine Extermination.193
Auch Günther Anders erzählt die Geschichte der Moderne als Abfolge von Entwürdigungen des weltoffenen Menschen, die ihn zum bloßen Maschinenanhängsel, Freizeitnarren und weltlosen Ausschuß produkt machen. Umgekehrt wird die Atombombe auch von Arendt, im Vorwort der Vita activa und ausführlich in Was ist Politik?194, als ultimative Bedrohung erkannt. Außerdem beurteilt Arendt die mit der Arbeit – und nur mit ihr – verbundene anima-lische Vitalität in Vita activa außerordentlich positiv. Jenseits der Arbeit gebe es kein bleibendes Glück, heißt es ausdrücklich. Was immer den natür lichen Kreislauf des Arbeitens und Regenerierens zerstöre – große Armut ebenso wie großer Reichtum – «vernichtet die elementar sinnliche Seligkeit, die der Segen des Lebendigseins ist.»195 In der Moderne, darin sind sich Günther Anders und Han-nah Arendt einig, ist also beides fundamental bedroht: das Leben und das Wesen des Menschen. Anders zieht daraus nur den radika-
ı114 ı 115
leren Schluß und fokussiert in seinen späteren Schriften, insbe-sondere in Interviews und Pamphleten, stark auf das Überleben der Menschheit, während Arendt tiefergehend zu erinnern und zu rekonstruieren sucht, was auf dem neuzeitlich-modernen Weg der «Liquidierung» des Humanen bereits verlorengegangen ist.
Amor mundi oder Der ontologische Trost des Zusammenkuschelns
«Obwohl als ‹Philosoph› klassifi ziert, interessiere ich mich für Philosophie nur wenig. Mein Interesse gilt der Welt»196 , gestand Günther Anders einmal einem Interviewer. Und Hannah Arendt wies die Berufsbezeichnung aus ähnlichen Gründen zurück: «Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen», entgegnete sie Gün-ter Gaus im Fernsehstudio; «ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen – im selben Sinne, wie ich verstanden habe –, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatge-fühl.»197 Beide Aussagen ergeben in der Montage ein letztes ge-meinsames Bild, das auf die weniger gut ausgeleuchtete, teils ver-borgene Seite sowohl des Andersschen als auch des Arendtschen Denkens verweist. Diese Seite läßt sich in Korrespondenzen und kleineren Schriften, im Mariechen oder im Denktagebuch, aus-machen.
Während Günther Anders in der Antiquiertheit des Menschen und den Arbeiten zur Atombombe als «ontologisch Konservati-ver» gegen die Liquidierung von spätmodernen Restbeständen menschlichen Daseins anschreibt und das Überleben der Mensch-heit zum Gravitationszentrum seines Werks bestimmt, nimmt er im Mariechen (ebenso wie im thematisch verwandten Lieben ge-stern198) die antike Frage nach dem guten Leben wieder auf.199 Bringt man den herzensfrohen Nihilismus des Langgedichts nun mit der frühen Anthropologie aus den 20er Jahren und mit der Kir-schenschlacht in Verbindung, beginnen sich die Konturen einer Ethik der Kontingenz abzuzeichnen, in der die Heimatlosigkeit
aller vermeintlich monadischen «Schalentiere» (s. o., S. 16) und die Einsicht in die kosmische Irrelevanz des Menschen zum Aus-gangspunkt eines nicht-anthropozentrischen, biophilen Amor mundi werden. Dessen Kraft speist sich aus der Freude mensch-licher Lebewesen angesichts ihres ontologischen Losglücks – und das heißt in diesem Fall immer auch: angesichts ihrer Liebes-fähigkeit.200 All den Mariechens dieser Welt, jenen Milliarden von «traurig eingepuppten/Wesen», die weder Ich noch Du kennen, hat man demgegenüber «mit Verständnis/und mit Liebe zu begeg-nen»201, was eingedenk der Tatsache, daß «geschlossene Fenster» ja laut Günther Anders nirgendwo zur Naturkondition gehören (s. o., S. 55) immer noch recht «monandristisch» klingt – aller-dings nur, weil es sich hier gemäß Andersscher Fundamental-monadologie eben «um ein dialektisches Problem [handelt], dem wir Menschen nicht gewachsen sind.» (s. o., S. 59) Tatsächlich sind nämlich alle Monaden sowohl für sich als auch eins mit allen anderen. Wen diese paradoxe Einsicht in epistemischen oder gar ontologischen Kummer stürzt, dem oder der hilft wohl tatsächlich nur noch Zusammenkuscheln: «Immer, wenn die Wahrheit uns im Stich läßt,/ist solch Näherrücken, wenn auch/objektive als Methode/nicht ganz einwandfrei und sachlich,/doch ein Trost und fast wie Antwort.»202
Amor mundi – für gewöhnlich ist es Hannah Arendt, der dieser Terminus zugeschrieben wird. Aus Dankbarkeit für die von frühen «Schatten» befreite, spät erwachte Liebe zur Welt und zu den Mitmenschen, welche im Herstellen und Handeln die Welt als solche überhaupt erst konstituieren, sah sie ihn zunächst als Titel ihrer Vita activa vor, ließ die Idee jedoch bald wieder fallen.203 Auch wenn die Rolle, welche die zwischenmenschliche Liebe und die Liebe zur Welt in Hannah Arendts Werk spielt, recht ver-trackt ist204 und von nachweisbaren Parallelen zu Günther Anders in dieser Hinsicht wohl kaum gesprochen werden kann, gibt es doch einen gemeinsamen Nenner, auf den sich das grundsätzliche Weltverhältnis des pessimistischen Atomphilosophen und des melancholischen «Mädchens aus der Fremde» bringen läßt (und
den man nicht als Ausfl uß jener «Passion für ‹Verbindlichkeit›»205 erklären kann, die Martin Heideggers Eigentlichkeitsfuror allen seinen Eleven eingepfl anzt hat). Er lautet – in den Worten Han-nah Arendts – ganz einfach: «Die Welt ist eben doch zu schön.»206 Und weil Günther Anders nicht nur in der Kirschenschlacht das letzte Wort gehören soll, sei auf ein weiteres, anti-existentialisti-sches Motto verwiesen, das in der Rückschau – im Hinblick auf den angeblichen Apokalyptiker Anders, auf die beiden Leben und die Jahrhundertdenkwege von Günther Anders und Hannah Arendt wie auch auf ihre geistige Primärquelle – doppelt und drei-fach nachklingt:
«Darum fällt mein Ratschlag völlig/anders aus: ‹Sei sorglos›, sag ich.»207
Anmerkungen
ı124 ı 125
den Sinn. Zufall vielleicht, daß der phänomenologisch refl ektierende An-ders das Phänomen der Verzweifl ung ein Jahr darauf in einem Interview wie beiläufi g auf die – oberfl ächlich gesehen: paradoxe – titelgebende Formel brachte: «Wenn ich verzweifelt bin, was geht´s mich an?» (Mathias Greff-rath, Die Zerstörung einer Zukunft. Gespräche mit emigrierten Sozial-wissenschaftlern, Reinbek 1979 S. 19.) Paradox, denn: wen könnte meine Verzweifl ung sonst noch und gar mehr angehen, als mich selbst? Und doch: wenn ich meine Verzweifl ung mich angehen lasse, ist´s nicht mehr weit zum «ich bin meine Verzweifl ung». Sich von seiner Verzweifl ung zu unter-scheiden, ist der entscheidende Schritt in die Möglichkeit, aus ihr sich be-freiend zu lösen.
4 Jene ersten Skizzen von Ende 1975 liegen vielleicht im Nachlaß Paeschke, den das Deutsche Literaturarchiv Marbach aufbewahrt. Von dort erhielt ich die Mitteilung: «Der Briefwechsel von Günther Anders u. Hans Paeschke/Merkur Zeitschrift aus d. Jahren 1949–1982 umfaßt insgesamt ca. 900 Br. u. Ktn.» (E-Mail vom 13.8.2008 10:16) Ich habe auf die Einsichtnahme ver-zichtet, und darauf eigens nach Marbach zu fahren, weil jene ersten Skizzen durch die spätere Ausarbeitung, die sich in Anders’ Nachlaß fand, jedenfalls überholt sind und nur für eine kritische Ausgabe relevant sein könnten, die ich ihrerseits nicht für relevant halte.
5 Mit Beiträgen von Hans Jonas, Dolf Sternberger und Jürgen Habermas, in: Merkur 341, Stuttgart (Klett) Oktober 1976, S. 921–960.
6 Signatur ÖLA 237/04. 7 Als Hinweis des Herausgebers in eckigen Klammern: oben, S. 15 Anmer-
kung 7, das Faksimile S. 62 sowie den vergrößerten Ausschnitt S. 64. 8 Jetzt s. Anm. 6, Archivbox II/6. 9 Österreichischer Sprachgebrauch; für Deutschland: ein einfacher Stuhl. 10 Damit hat Anders alle Teile unseres Konvolutes markiert, ausgenommen
den letzten: Das «akademische Nachwort», das natürlich weit entfernt ist, Leibnizens Monadenlehre zu erschöpfen, hat sein Thema aber doch hübsch abgerundet zugespitzt.
11 Sein Inhalt liegt jetzt im ÖLA, Archivbox III/2. 12 Jonas an Anders, 1. März 1976, Nachlaß Anders. Dieselbe Episoden-Se-
quenz, zusätzlich noch etwas mehr religiös verbrämt, präsentieren fast wörtlich die 2003 in Frankfurt am Main posthum erschienenen «Erinne-rungen» von Hans Jonas, S. 339–347, bes. 341 f.
Anmerkungen zu «Günther Anders und Hannah Arendt – eine Beziehungsskizze» Von Christian Dries
1 Für Hinweise, Anregungen und erhellende Gespräche über die Familie Stern, Günther Anders und Hannah Arendt danke ich Edna Brocke, Wer-ner Deutsch (†), Petra Klotz, Karin Maire, Gerhard Oberschlick und Wer-ner Steinecke, der mir volle Einsicht in die Briefe von Eva Michaelis-Stern an Werner Deutsch gewährte, sowie Edouard Jolly für seine gewissenhafte Transkription französischsprachiger Arendt-Briefe.
2 Vgl. Hans Jonas: Erinnerungen, Frankfurt/M. 2003, S. 85. 3 Eva Michaelis-Stern an Werner Deutsch, Brief (ms.) vom 29. April 1992,
S. 1 (Privatbesitz; künftig: Adolf-Würth-Zentrum für Geschichte der Psy-chologie, Universität Würzburg); Orthographie, Interpunktion und kleinere Lapsus wurden – auch im Folgenden – behutsam angepasst bzw. korrigiert. Elisabeth Young-Bruehls Standardbiographie Hannah Arendts, die sich in weiten Passagen auf Gespräche der Autorin mit der Porträtierten stützt, schildert die Blitzhochzeit so: «Im September 1929 […] wurden er [Günther Anders; C. D.] und Hannah Arendt in Nowawes standesamtlich getraut, wobei nur ihre Eltern, Käthe Levin und zwei Freunde, Yela und Henry Lö-wenfeld, die als Trauzeugen fungierten, zugegen waren.» (Elisabeth Young-Bruehl: Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit, Frankfurt/M. 2004, S. 130).
4 Manuskript (hs.), 1. S., statt einer Überschrift in der rechten oberen Ecke: «1929/1984», Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien, Nachlaß Günther Anders, Signatur ÖLA 237/04. Siehe auch oben, S. 5.
5 Hannah Arendt/Martin Heidegger: Briefe 1925–1975 und andere Zeugnisse, Frankfurt/M. 2002, S. 66.
6 Joachim Fest gibt an, Heidegger habe sich über die Eheschließung erfreut gezeigt (vgl. Joachim Fest: Das Mädchen aus der Fremde: Hannah Arendt und das Leben auf lauter Zwischenstationen, in: Ders.: Begegnungen. Über nahe und ferne Freunde, Reinbek bei Hamburg 2004, S. 176–214; hier S. 191).
7 Höchst wahrscheinlich handelt es sich dabei um Teile von Günther Stern: Über das Haben. Sieben Kapitel zur Ontologie der Erkenntnis, Bonn 1928, darin auch als Kapitel 7 (Satz und Situation) eine stark komprimierte und grundlegend überarbeitete Fassung von Anders’ Dissertationsschrift Die Rolle der Situationskategorie bei den «logischen Sätzen».
ı126 ı 127
8 Hans Jonas (1903–1993) lernte Günther Anders 1921 als Student in Berlin kennen und traf ihn wieder 1925 als Hörer bei Heidegger. Die lebenslange Freundschaft der beiden Kommilitonen überstand sowohl profunde Mei-nungsverschiedenheiten als auch ein heftiges persönliches Zerwürfnis, von dem Jonas in einem erschütternden Brief vom 11. August 1959 an seine Stu-dienfreundin Hannah Arendt berichtet (siehe auch Anmerkung 103).
9 Arendt/Heidegger: Briefe, a. a. O., S. 50 f. Daß sich die beiden nicht nur auf akademischem Terrain rasch überworfen hatten, belegt auch Günther An-ders’ kurze «Heidegger-Erinnerung» von 1984. Dort schildert er ein Abend-essen bei Heideggers in Marburg, in dessen Verlauf er der Tischgesellschaft mit einer Voltaireschen Anspielung auf Heideggers Vortragsstil – «Es genügt nicht zu murmeln, man muß auch recht haben» – nachhaltig die Laune ver-salzt (Günther Anders: Heidegger-Erinnerung. März 1984, in: Ders.: Über Heidegger, München 2001, S. 11). Im Interview mit Mathias Greffrath erklärt Anders, Heidegger habe ihn seinerzeit «stets sehr verächtlich» be-handelt und für einen «Asphaltliteraten» gehalten (Elke Schubert (Hg.)): Günther Anders antwortet. Interviews & Erklärungen, Berlin 1987, S. 23 f.).
10 Vgl. Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 130. 11 Christiane Auras: Außenseiter und Weltbürger. Zur Lebens-Freundschaft
von Hannah Arendt und Hans Jonas, in: Dietrich Böhler/Jens Peter Brune (Hg.): Orientierung und Verantwortung. Begegnungen und Auseinander-setzungen mit Hans Jonas, Darmstadt 2004, S. 485–500; hier S. 491.
12 Hanna Leitgeb: Liebe unter Seeräubern. Von gebrochenen Herzen, schüt-zenden Häusern und der Treue eines Mädchens – Hannah Arendts Leben mit den Männern, in: Literaturen, 09/2002, S. 23–28; hier S. 24.
13 Vgl. Alois Prinz: Beruf Philosophin oder Die Liebe zur Welt. Die Lebens-geschichte der Hannah Arendt, Weinheim 1998, S. 33 f. Auch die Eltern von Günther Anders führen ein – allerdings wissenschaftlich motiviertes – Tagebuch über die Entwicklung ihrer Kinder. Auf der Basis der Aufzeich-nungen, die Anders’ Mutter Clara über Jahre hinweg macht, erscheint 1914 im Verlag Quelle und Meyer William Sterns bahnbrechende Psychologie der frühen Kindheit bis zum sechsten Lebensjahre.
14 Vgl. Arendt/Heidegger: Briefe, a. a. O., S. 21–25. 15 Arendt/Heidegger: Briefe, a. a. O., S. 77. 16 Ingeborg Nordmann: Hannah Arendt, Frankfurt/M. 1994, S. 38. 17 Hannah Arendt: Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jü-
din aus der Romantik, München 2006, S. 185. Auch Helgard Mahrdt sieht im Rahel-Buch den Versuch Arendts, sich – neben der Beschäftigung mit «Grundfragen jüdischen Daseins» – «am Leitfaden Rahels» vom «Zauber Heideggers, des Geliebten wie des Lehrers», zu befreien (Hannah Arendts Rahel Varnhagen-Biographie – eine Erzählung, in: Bernd Neumann/Dies./Martin Frank (Hg.): «The Angel of History is Looking Back». Hannah Arendts Werk unter politischem, ästhetischem und historischem Aspekt, Würzburg 2001, S. 75–105; hier S. 77). Nicht unplausibel ist in diesem Kon-
text die Überlegung Bernd Neumanns, Arendts Ehe mit Günther Anders habe auch den Zweck erfüllt, sich – in Abgrenzung gegen Heideggers Gräko philie – dem (eigenen) Judentum anzunähern (vgl. Bernd Neumann: Noch einmal: Hannah Arendt, Martin Heidegger und Günther Stern/An-ders – mit Bezug auf den jüngst komplettierten Briefwechsel zwischen Arendt und Stern und unter Rekurs auf Hannah Arendts unveröffentlichte Fabelerzählung Die weisen Tiere, in: Ders./Helgard Mahrdt/Martin Frank (Hg.): «The Angel of History is Looking Back». a. a. O., S. 107–126; ins-bes. S. 111 und 119).
18 Arendt/Heidegger: Briefe, a. a. O., S. 26. 19 Arendt: Rahel Varnhagen, a. a. O., S. 168. 20 Arendt/Heidegger: Briefe, a. a. O., S. 67. Die Affäre Arendt – Heidegger
wird erschöpfend behandelt bei Antonia Grunenberg: Hannah Arendt und Martin Heidegger. Geschichte einer Liebe, München 2006. Vgl. dazu auch Ludger Lütkehaus: Hannah Arendt – Martin Heidegger. Eine Liebe in Deutschland, Marburg 1999.
21 Das Radiogespräch ist neben anderen zeitgenössischen Dokumenten und einer instruktiven Einleitung der Herausgeber wieder abgedruckt in: Han-nah Arendt/Joachim Fest: Eichmann war von empörender Dummheit. Ge-spräche und Briefe, München 2011.
22 Zitiert nach: Fest: Das Mädchen aus der Fremde, a. a. O., S. 188 f. 23 Vgl. Arendt: Rahel Varnhagen, a. a. O., S. 156–168. 24 Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 131. 25 Zu William Stern und seiner herausragenden Bedeutung für die Psycholo-
gie als Wissenschaft vgl. Martin Tschechne: William Stern, Hamburg 2010. 26 Jonas: Erinnerungen, a. a. O., S 167. 27 Grunenberg: Hannah Arendt und Martin Heidegger, a. a. O., S. 136. 28 Eva Michaelis-Stern: Erinnerungen an meine Eltern, in: Werner Deutsch
(Hg.): Über die verborgene Aktualität von William Stern, Frankfurt/M. 1991, S. 131–141; hier S. 131 und 138.
29 Heike Behrens/Werner Deutsch: Die Tagebücher von Clara und William Stern, in: Werner Deutsch (Hg.): Über die verborgene Aktualität von Wil-liam Stern, a. a. O., S. 19–37; hier S. 26.
30 Vor diesem Hintergrund ist Thomas H. Machos Spekulation anzusiedeln, der Nom de Guerre Anders sei als Anagramm von Arendt zu deuten, «nach alter Regel mit der Erlaubnis gebildet, ‹s› für ‹t› zu setzen.» (Thomas H. Macho: Die Kunst der Verwandlung. Notizen zur frühen Musikphilo sophie von Günther Anders, in: Konrad Paul Liessmann (Hg.): Günther Anders kontrovers, München 1992, S. 89–102; hier S. 102). Ungeachtet der von An-ders selbst in die Welt gesetzten Genesislegende (vgl. Schubert (Hg.): Gün-ther Anders antwortet, a. a. O., S. 29 f.) muß man die Namensänderung wohl vor allem als Abgrenzung gegenüber dem eigenen – und besonders dem väterlichen – Ursprung deuten (vgl. dazu auch Werner Deutsch: Stern-kinder, in: Scheidewege, Jg. 33, 2003/2004, S. 128–139 sowie Günther Anders’
ı128 ı 129
Gedichte Vor dem Spiegel und Der fi ebernde Kolumbus, in: Günther Anders: Tagebücher und Gedichte, München 1985, S. 282 f. bzw. 372). Auch Hans Jonas teilt in seinen Erinnerungen (a. a. O., S. 282) diese Vermutung.
31 Jonas: Erinnerungen, a. a. O., S. 282. 32 Prinz: Beruf Philosophin, a. a. O., S. 42. 33 Vgl. Arendt/Heidegger: Briefe, a. a. O., S. 29. 34 Anders: Tagebücher und Gedichte, a. a. O., S. 308. 35 Vgl. Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 129. 36 Daß Hannah Arendt sich ebenfalls zu habilitieren gedachte, darf angenom-
men werden, ist aber nicht unumstritten (vgl. dazu Claudia Christopher-sen: «… es ist mit dem Leben etwas gemeint». Hannah Arendt über Rahel Varnhagen, Königstein/Ts. 2002, S. 11–16).
37 Jonas: Erinnerungen, a. a. O., S. 282. 38 Vgl. Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 27. Zu den Ar-
beiten zählen neben diversen Exkursen und Skizzen in erster Linie die bis dato unveröffentlichten Typoskripte Materiales Apriori und der sogenannte Instinkt. Ein Beitrag zur Theorie des Wissens (1927), Die Positionen Schla-fen – Wachen relativierender Exkurs (1928) sowie Situation und Erkenntnis (1929); alle: ÖLA 237/04.
39 Zitiert nach: Elke Schubert: Günther Anders, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 27.
40 Hannah Arendt/Karl Jaspers: Briefwechsel 1926–1969, München 1985, S. 49. 41 Vgl. dazu ausführlich Reinhard Ellensohn: Der andere Anders. Günther
Anders als Musikphilosoph, Frankfurt/M. 2008. Hannah Arendt bewahrte sich aus den Frankfurter Tagen eine nachhaltige Abneigung gegen Adorno – dessen erster Habilitationsanlauf 1928 ebenfalls gescheitert war – und die Frankfurter Schule, die sich im Zusammenhang mit Walter Benjamins Nachlaß später noch deutlich steigerte (vgl. Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 132 sowie Detlev Schöttker/Erdmut Wizisla (Hg.): Arendt und Benjamin. Texte, Briefe, Dokumente, 2. Aufl ., Frankfurt/M. 2006; insbes. Teil V: Dokumente).
42 Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 29. 43 Hannah Arendt/Günther Stern: Rilkes «Duineser Elegien», in: Neue Schwei-
zer Rundschau, 23. Jg., Nr. 11, 1930, S. 855–871; Hannah Arendt: Philo-sophie und Soziologie. Anläßlich Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, in: Die Gesellschaft, Jg. 7, Nr. 1, 1930, S. 163–176; Günther Stern: Über die sog. «Seinsverbundenheit» des Bewußtseins. Anläßlich Karl Mannheims «Ideo-logie und Utopie», in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 64. Band, 1930, S. 492–509. Siehe dazu auch Anmerkung 142.
44 Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 129. Der Liebesbegriff bei Augu-stin. Versuch einer philosophischen Interpretation erscheint 1929 im Berliner Springer-Verlag. Siehe auch oben, S. 15.
45 Vgl. Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 154–157. 46 Vgl. Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 34.
47 Vgl. Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 163 ff. 48 Die 1933 von Recha Freier gegründete und in Berlin-Charlottenburg an-
sässige Kinder- und Jugend-Alijah, eine Abteilung der bereits 1929 ins Le-ben gerufenen Jewish Agency, organisierte die Ausreise jüdischer Kinder und Jugendlicher aus dem Dritten Reich nach Palästina. Eva Michaelis-Stern baute nach ihrer Flucht aus Deutschland kurz nach dem «Anschluß» Österreichs 1938 die nach Großbritannien verlegte Zentrale der Jugend- Alijah in London mit auf (vgl. Erika Weinzierl/Otto D. Kulka (Hg.): Ver-treibung und Neubeginn. Israelische Bürger österreichischer Herkunft, Wien 1992, S. 220 f.; Eva Michaelis-Stern: Erinnerungen an die Anfänge der Jugendalijah in Deutschland, in: LBI Bulletin 70, 1985, S. 55–66); Hannah Arendt verlor durch die Verlegung ihre Stelle in der Pariser Sektion (vgl. Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 218).
49 Die Gestapo befand sich zu diesem Zeitpunkt in der damaligen Prinz- Albrecht-Straße 8 (heute Niederkirchnerstraße) in einer ehemaligen Kunst-gewerbeschule. Vermutlich meint Eva Michaelis-Stern das Polizeipräsidium am Alexanderplatz (vgl. dazu auch Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 164).
50 Michaelis-Stern an Deutsch, Brief (ms.) vom 29. April 1992, S. 1 f. (Privat-besitz; künftig: Adolf-Würth-Zentrum für Geschichte der Psychologie, Uni-versität Würzburg). Vgl. auch Michaelis-Stern: Erinnerungen an meine Eltern, a. a. O., S. 138 f.
51 Grunenberg: Hannah Arendt und Martin Heidegger, a. a. O., S. 207. 52 Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 32. 53 Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 32. Learsi ist wieder
abgedruckt in: Günther Anders: Kosmologische Humoreske und andere Er-zählungen, Frankfurt/M. 1978, S. 96–189. Eine weitere Novelle, der Hun-germarsch (ebd., S. 190–227), wird 1936 mit dem Novellenpreis der Emigra-tion des Querido-Verlags in Amsterdam ausgezeichnet.
54 Günther Anders’ Urgroßmutter, eine Cousine Heinrich Heines, hatte ne-ben ihrer Tochter Friederike Joseephy, Clara Sterns Mutter, noch einen Sohn: Emil Benjamin, Walter Benjamins Vater.
55 Günther Anders: «Brecht konnte mich nicht riechen». Interview mit Fritz J. Raddatz, in: Fritz J. Raddatz: ZEIT-Gespräche 3, Frankfurt/M. 1986, S. 7–30; hier S. 15.
56 Günther Stern: Une interprétation de l’a postériori, in: Recherches Philo-sophiques, Vol. 4, 1934/35, S. 65–80 und Ders.: Pathologie de la liberté. Essai sur la non-identifi cation, in: Recherches Philosophiques, Vol. 6, 1936/37, S. 22–54. Vgl. dazu auch Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 176 ff. sowie Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 36.
57 Vgl. dazu auch Edna Brocke: Die «große Hannah» – meine Tante, in: Detlef Horster (Hg.): Verschwindet die politische Öffentlichkeit?, Weilerswist 2007, S. 13–25.
58 Hannah Arendt/Heinrich Blücher: Briefe 1936–1968, München 1996, S. 35.
ı130 ı 131
59 Jonas: Erinnerungen, a. a. O., S. 285. 60 Arendt/Blücher: Briefe, a. a. O., S. 83. Zu Arendt und Blücher vgl. auch
Bernd Neumann: Hannah Arendt und Heinrich Blücher. Ein deutsch- jüdisches Gespräch, Berlin 1998 sowie Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 185–203.
61 Anders: «Brecht konnte mich nicht riechen», a. a. O., S. 15. 62 Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 42. Die Misere der
Emigration: der Zusammenbruch der privaten Welt, der Verlust des Welt-vertrauens und der aufgesetzte Optimismus der Flüchtlinge wird ein-drücklich geschildert in Hannah Arendts Essay Wir Flüchtlinge von 1943 (Hannah Arendt: Wir Flüchtlinge, in: Dies.: Zur Zeit. Politische Essays, er-weiterte Neuausgabe, Hamburg 1999, S. 7–21).
63 Michaelis-Stern an Deutsch, Brief (ms.) vom 29. April 1991, S. 2 (Privatbe-sitz; künftig: Adolf-Würth-Zentrum für Geschichte der Psychologie, Uni-versität Würzburg). Vgl. dazu auch Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 176. Eva Michaelis-Sterns frühe Vorbehalte gegen Hannah Arendt schlu-gen anläßlich des Erscheinens von Eichmann in Jerusalem (Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, 14. Aufl ., München 2005) in offene Ablehnung um (vgl. Eva Michaelis-Stern: Tragt ihn mit Stolz, den gelben Fleck!, in: Die Kontroverse. Redaktion F. A. Krummacher, München 1964, S. 152–160).
64 Arendt/Blücher: Briefe, a. a. O., S. 59. Am 16. Juli 1937 informiert Hannah Arendt Walter Benjamin: «Nun noch einige Personalia: dass Günther und ich uns scheiden lassen – ob diese Handlung im Perfekt oder im Praesens zu stehen hat, ist bei der Schwierigkeit der Prozedur nicht herauszukriegen – haben wir, wie mir nachträglich scheint, so lange vor allen andern geheim gehalten, bis die Andern sich rächten und es vor uns geheim hielten.» (Schöttker/Wizisla (Hg.): Arendt und Benjamin, a. a. O., S. 127)
65 Erhalten sind laut Bernd Neumann (Noch einmal: Hannah Arendt, Martin Heidegger und Günther Stern/Anders, a. a. O., S. 107) 32 Briefe Hannah Arendts nebst zweier Lebensläufe und einem beigelegten Brief Heinrich Blüchers sowie 22 Briefe und Postkarten von Günther Anders inklusive eines beigefügten Schreibens an US-Präsident Kennedy, in dem Anders für den in eine Nervenklinik eingewiesenen Hiroshima-Piloten Claude Eatherly Partei ergreift.
66 Mit Hilfe einer beglaubigten Bürgschaftserklärung – dem Affi davit – konn-ten außerhalb des Deutschen Reichs lebende Verwandte und Freunde NS-Verfolgten während des Zweiten Weltkriegs die Tür zur Einreise in Über-seeländer wie Großbritannien oder die USA aufschließen. Bei Young-Bruehl (Hannah Arendt, a. a. O., S. 231) steht dazu lapidar: «Schließlich wurde den Blüchers, auch aufgrund der Tatsache, daß sich Günther Stern in Amerika für sie einsetzte, ein amerikanisches Notvisum zugesichert. Arendts Position bei Jugend-Aliyah verhalf ihr zu einer Sonderregelung, und Blücher erhielt als ihr Ehemann ein Begleitvisum». Für eine Ausreise waren insgesamt drei
Dokumente erforderlich: das Affi davit sowie je ein Transit- bzw. Ausreisevi-sum und ein Einreisevisum.
67 Arendt an Anders, Brief (ms.) vom 23. Dezember 1939, ÖLA 237/04. Zu deutsch etwa: Danke, mein Freund. Die Affi davits sind da – und ich gestehe, sie kommen sehr gelegen! […] Ich versichere Dir, sie war erstklassig. […] Herzlich Hannah.
68 Arendt an Anders, Brief (hs.) vom 4. August 1940, S. 2, ÖLA 237/04. Zu deutsch etwa: Das Leben in den Pyrenäen – wo man buchstäblich nichts zu essen hatte –, war grotesk in seiner Mischung aus falscher Idylle […] und mehr oder weniger unmittelbarer Gefahr. Ich verstehe jetzt, was die Griechen den Hades nannten, das gleichsam normale Leben der Schatten.
69 Arendt an Anders, Brief (hs.) vom 4. August 1940, S. 4, ÖLA 237/04. Zu deutsch etwa: Um Benji muß man sich keine Sorgen machen.
70 Vgl. dazu Neumann: Noch einmal: Hannah Arendt, Martin Heidegger und Günther Stern/Anders, a. a. O., S. 124 f.
71 Arendt an Anders, Brief (ms.) vom 25. Mai 1941, ÖLA 237/04. 72 Arendts Aufbau-Artikel sind zusammengetragen in: Hannah Arendt: Vor
Antisemitismus ist man nur noch auf dem Monde sicher. Beiträge für die deutsch-jüdische Emigrantenzeitung «Aufbau» 1941–1945, München 2004. Zu Günther Anders’ literarischer Produktion während der Exiljahre vgl. die Bibliographie von Heinz Scheffelmeier unter http://www.forvm.at/texte/ ga_bibliographie.html (16.05.11).
73 Arendt an Anders, Brief (ms.) vom 31. Mai 1941, S. 2, ÖLA 237/04. 74 Arendt/Jaspers: Briefwechsel, a. a. O., S. 618 und 533. 75 Schubert (Hg.): Anders antwortet, a. a. O., S. 34. 76 Arendt/Blücher: Briefe, a. a. O., S. 124. 77 Günther Anders: Suggestions for New Types of Pictures. Unveröffentlich-
tes Typoskript (1943), ÖLA 237/04. 78 Schubert (Hg.): Anders antwortet, a. a. O., S. 37. 79 Günther Stern/Anders: Homeless Sculpture, in: Philosophy and Pheno-
menological Research, Vol. V, No. 2, 1944, S. 293–307 (deutsche Fassung: Obdachlose Skulptur. Über Rodin. Aus dem Englischen von Werner Rei-mann, München 1994); Nihilismus und Existenz, in: Neue Rundschau, Oktober-Heft 1946, S. 48–76 (wieder abgedruckt in: Über Heidegger, a. a. O., S. 39–71); Franz Kafka – pro und contra, in: Neue Rundschau, Frühjahr 1947, S. 119–157 (spätere Fassung: Kafka, pro und contra. Die Pro-zeß-Unterlagen, in: Mensch ohne Welt. Schriften zur Kunst und Literatur, 2. Aufl ., München 1993, S. 45–131); On the Pseudo-Concreteness of Heidegger’s Philosophy, in: Philosophy and Phenomenological Research, Vol. VIII, No. 3, 1948, S. 337–371 (deutsche Fassung in: Über Heidegger, a. a. O., S. 72–115); The Acoustic Stereoscope, in: Philosophy and Pheno-menological Research, Vol. X, No. 2, 1949, S. 238–243; Emotion and Reality (In Connection with Sartre’s «The Emotions»), in: Philosophy and Pheno-menological Research, Volume X, No. 4, 1950, S. 553–562.
ı132 ı 133
80 Vgl. Max Horkheimer: Günther Anders. Thesen über «Bedürfnisse», «Kul-turbedürfnis», «Kulturwerte», «Werte» (25. August 1942), in: Ders.: Gesam-melte Schriften, Bd. 12: Nachgelassene Schriften 1931–1949, Frankfurt/M. 1985, S. 579–586.
81 Anders: «Brecht konnte mich nicht riechen», a. a. O., S. 15. 82 Zu Günther Anders’ Rolle in dieser Angelegenheit vgl. Schöttker/Wizisla
(Hg.): Arendt und Benjamin, a. a. O., S. 36 f. 83 Arendt/Blücher: Briefe, a. a. O., S. 127. 84 Schöttker/Wizisla (Hg.): Arendt und Benjamin, a. a. O., S. 150. 85 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 16. November 1955, Hannah Arendt-
Zentrum an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (HAZ), Contai-ner 14.7, Nr. 009958.
86 Zu dieser Zeit arbeitete das OWI «twenty-four hours a day on hundreds of productions in scores of different languages» (Allan M. Winkler: The Politics of Propaganda. The Offi ce of War Information 1942–1945, New Haven 1978, S. 78) und griff deshalb auch großzügig auf die Emigrantenszene zurück.
87 Vgl. Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 37–40. 88 Anders: «Brecht konnte mich nicht riechen», a. a. O., S. 16. In Günther An-
ders’ Lied der Untreuen von 1943 heißt es: «Wer uns in Fahrt bringt, macht uns erfahren,/wer uns ins Weite stößt, uns weit. Nun danken wir alles den fahrenden Jahren,/und nichts der Kinderzeit.» (Anders: Tagebücher und Gedichte, a. a. O., S. 286)
89 Jonas: Erinnerungen, a. a. O., S. 283. 90 Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 41. 91 Günther Anders: Off limits für das Gewissen. Der Briefwechsel zwischen
dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly und Günther Anders (1959–1961), in: Ders.: Hiroshima ist überall, München 1995, S. 191–360. Der Briefwech-sel erschien 1961 zuerst bei Rowohlt. Vgl. dazu Fritz J. Raddatz: Unruhe-stifter. Erinnerungen, Berlin 2006, S. 210.
92 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 16. November 1955, HAZ, Cont. 14.7, Nr. 009958.
93 Vgl. Arendt/Blücher: Briefe, a. a. O., S. 427 und 435. 94 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 23. November 1955, S. 1, HAZ, Cont. 14.7,
Nr. 009955. 95 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 23. November 1955, S. 2, HAZ, Cont. 14.7,
Nr. 009955. 96 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 2. April 1958, HAZ, Cont. 14.7, Nr. 009945. 97 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 22. September 1958, HAZ, Cont. 14.7,
Nr. 009940. 98 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 12. April [1958], HAZ, Cont. 14.7, Nr. 009946. 99 Arendt an Anders, Brief (ms.) vom 9. Januar 1957, ÖLA 237/04. 100 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 12. April [1958], HAZ, Cont. 14.7, Nr. 009946. 101 Arendt/Blücher: Briefe, a. a. O., S. 544 f. Auch im Briefwechsel mit Mary
McCarthy hinterläßt das Treffen seine Spuren: «Der Tag mit Günther […]
war fast ein Desaster, aber er weiß es nicht, ich benahm mich sehr gut, weil ich dies natürlich schon vorher wußte. Nur es leibhaftig zu sehen ist wieder etwas anderes. Er ist ganz und gar ohne inneren Halt, lebt nur für seinen ‹Ruhm›, der eine Art von Château d’Espagne ist, weigert sich, die Dinge in ihrer Wirklichkeit zu sehen oder seine eigene Situation so zu akzeptieren, wie sie wirklich ist. Ich habe ihn über 12 Jahre nicht gesehen und seit un-gefähr 25 Jahren nicht richtig mit ihm geredet. Das Komischste war, daß er genauso war wie seine Mutter, die auch immer in irgendeiner Art einge-bildeter Glückseligkeit lebte.» (Hannah Arendt/Mary McCarthy: Im Ver-trauen. Briefwechsel 1949–1975, München 1995, S. 195 f.)
102 Arendt/Blücher: Briefe, a. a. O., S. 473, 476. 103 Vgl. den Brief (ms.) von Hans Jonas an Hannah Arendt vom 11. August 1959
(Nachlaß Hans Jonas, Philosophisches Archiv der Universität Konstanz, HJ 3–22–1). In Arendts Antwort vom 17. September ist zu lesen: «Wie traurig! In einem Wahn zu leben, ist schrecklich genug, und von allen Mög-lichkeiten des Wahnes ist der Größenwahn wohl der unerträglichste. All das war mir nicht ganz so neu und unerwartet wie Du denkst. Ich hatte auch an-genommen, daß der alte Wahn in ein neues Stadium getreten ist, als ich sah, daß Günther in dem Buch über die Atombombe sein niemals veröffentlich-tes Molussien so zitiert, als sei es erstens die Bibel und hätte zweitens eine Aufl age von mehreren Millionen. Das war ja bereits im eigentlichen Sinne verrückt. Was mir neu und sehr erschreckend war, ist die Bösartigkeit, die Du so betonst. […] Ich halte Günther seit sehr langer Zeit für einen kranken Menschen, aber er war dabei doch immer trotz einer wahren Egomanie durchaus gutartig.» (Nachlaß Jonas, HJ 3–22–4) In ihrem Brief (ms.) vom 29. Dezember 1959 an Günther Anders (ÖLA 237/04) nimmt Arendt diplo-matisch auf die Affäre Bezug: «Ich hatte in letzter Zeit ein bißchen Beden-ken in der Hinsicht was Dich anlangt. […] von Jonas hatte ich einen Brief über Euer mißglücktes Treffen, der mich einen Moment stutzig machte.»
104 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 13. Dezember 1961, HAZ, Cont. 14.7, Nr. 009928.
105 Arendt/McCarthy: Im Vertrauen, a. a. O., S. 546. Seine dritte Frau, die 18 Jahre jüngere Pianistin Charlotte Lois Zelkowitz, genannt Zelka, hatte Günther Anders am 20. September 1957 geheiratet. 1972 verließ sie ihn – die Ehe wurde nie geschieden – und kehrte zu ihrer Familie nach Monrovia in die USA zurück, wo sie am 6. Oktober 2001 an Lungenkrebs starb. In den 80er Jahren arbeitete sie neben ihrer Tätigkeit als Musikerin und Klavierlehrerin auch an einer englischen Übersetzung der Antiquiertheit des Menschen (siehe http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/projects/anders/zelka044.htm; 16.05.11). Eine vergleichbar mitleiderregende Zustandsbeschreibung, wie Hannah Arendt sie an Mary McCarthy liefert, gibt Fritz J. Raddatz, der Gün-ther Anders Mitte der 80er Jahre zum ZEIT-Interview in Wien aufsucht, in seinen Erinnerungen (Raddatz: Unruhestifter, a. a. O., S. 309 f.).
106 Anders an Arendt, Brief (hs.) vom 25. Juni 1975, ÖLA 237/04.
ı134 ı 135
107 Arendt/Heidegger: Briefe, a. a. O., S. 31. 108 Neumann: Noch einmal: Hannah Arendt, Martin Heidegger und Günther
Stern/Anders, a. a. O., S. 109 (vgl. auch ebd., S. 123). 109 Arendt/Jaspers: Briefwechsel, a. a. O., S. 507. 110 Vgl. Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 26. November 1975, HAZ,
Cont. 14.7.26. Zur Wiedergutmachungsfrage und zur sogenannten «Lex Arendt» vgl. auch Christophersen: «… es ist mit dem Leben etwas ge-meint», a. a. O., S. 11–16.
111 Jonas: Erinnerungen, a. a. O., S. 283. Um welche Verbalinjurien es sich ge-handelt haben könnte, läßt sich nur noch erahnen. Auf Seite 2 seines Briefs vom 11. August 1959 an Hannah Arendt gibt Hans Jonas einen Hinweis: «Bosheit und Verdächtigung: Wer anders denkt oder anderes tut als Gün-ther Anders ist Höriger oder Lakai: Jaspers – Adenauers, Du – des State De-partment, ich e tutti professori – der bürgerlich-akademischen Norm und Sekurität.» (Nachlaß Jonas, HJ 3–22–1)
112 Zur «reproduktiven Einbildungskraft» vgl. die Anmerkung 1 des Nachworts zur zweiten, erweiterten Aufl age von Günther Anders: Die molussische Ka-takombe, München (in Vorbereitung).
113 Wendelin Schmidt-Dengler: «Der verwüstete Mensch». Zu Günther An-ders’ Essay über Döblins Roman «Berlin Alexanderplatz», in: Raimund Bahr (Hg.): Urlaub vom Nichts, St. Wolfgang 2004, S. 117–132; hier S. 118.
114 Ist auch die Heidegger-Kritik des Mariechens bereits wie gewohnt wenig zimperlich, so hat Günther Anders seinen einstigen Lehrer, wenn auch in-direkt, so doch persönlich kaum je massiver angegriffen als in der Kirschen-schlacht. Nachdem er dort die honorigen Herren Scheler und Simmel ob ihres Hurra-Patriotismus zu Beginn des Ersten Weltkriegs als «Gratis-huren» (s. o., S. 45) abgewatscht hat, fragt man sich unmittelbar, mit wel-cher Vokabel er wohl den Heidegger von 1933 belegt hätte.
115 Günther Anders: Mariechen. Eine Gutenachtgeschichte für Liebende, Phi-losophen und Angehörige anderer Berufsgruppen, 2. Aufl ., München 1994, S. 79.
116 Anders: Mariechen, a. a. O., Anm. 4, S. 83. 117 Anders: Mariechen, a. a. O., S. 80. 118 Oliver Marchart: Die Welt und die Revolution, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte, Nr. 39, 25. September 2006, S. 33–38; hier S. 33. Vgl. dazu auch Otto Kallscheuer: Hannah Arendt eine Linke?, in: «Treue als Zeichen der Wahrheit». Hannah Arendt: Werk und Wirkung, Hrsg.: Alte Synagoge. Red.: Karl-Heinz Klein-Rüsteberg, Essen 1997, S. 121–137.
119 Vgl. dazu den Überblick bei Kurt Sontheimer: Hannah Arendt. Der Weg einer großen Denkerin, München 2005, S. 215–245.
120 Hannah Arendt: Denktagebuch 1950–1973, 2 Bände, München 2002. 121 Heinrich Blüchers Vorlesungen können im Blücher Archive des Bard Col-
lege, New York (URL: http://www.bard.edu/bluecher/) nachgelesen und teilweise auch nachgehört werden.
122 Barbara Hahn: Hannah Arendt – Leidenschaften, Menschen und Bücher, Berlin 2005, S. 54.
123 Werner Heuer: Der Sokrates an ihrer Seite, in: du, Heft 710, Oktober 2000, S. 8 f.; hier S. 8. Vgl. auch Erdmut Wizisla: Jetzt die Wahrheit über die Wahrheit. Der Mann, mit dem Hannah Arendt politisch denken und histo-risch sehen konnte: Heinrich Blücher zum 100. Geburtstag, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 289, 11. Dezember 1999, S. IV.
124 Hannah Arendt/Günther Stern: Rilkes «Duineser Elegien», in: Ulrich Fülle-born/Manfred Engel (Hg.): Rilkes «Duineser Elegien», 2. Bd. a. a. O., S. 45–65; hier S. 45.
125 Arendt an Anders, Brief (ms.) vom 3. Mai 1960, ÖLA 237/04. 126 Als «prometheisches Gefälle» bezeichnet Günther Anders den Abstand
zwischen menschlichem Herstellungsvermögen und der diesem hinterher-hinkenden Vorstellungskraft (vgl. Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Re-volution, 5. Aufl ., München 1980, S. 16 und 267 f.).
127 Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1, a. a. O., S. 233–324. 128 Hannah Arendt: Macht und Gewalt, 16. Aufl ., München 2005, S. 13. 129 Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 2002, S. 61;
Hervorh. C. D. 130 Günther Anders: Besuch im Hades, 3. Aufl ., München 1996, S. 205. 131 In Vita activa (a. a. O., S. 66) vergleicht Hannah Arendt die materielle Welt
mit einem Tisch, der sich – trennend und verbindend zugleich – zwischen die Menschen schiebt und um den herum sie sich handelnd und sprechend versammeln, um ihren Interessen nachzugehen: «Diese Interessen sind im ursprünglichen Wortsinne das, was ‹inter-est›, was dazwischen liegt und die Bezüge herstellt, die Menschen miteinander verbinden und zugleich von-einander scheiden.» (ebd., S. 224)
132 Ludger Lütkehaus: Philosophieren nach Hiroshima. Über Günther Anders, Frankfurt/M. 1992, Anm. 35, S. 117.
133 Konrad Paul Liessmann: Günther Anders und Hannah Arendt – Denken nach Auschwitz und Hiroshima, in: Ders.: Die großen Philosophen und ihre Probleme. Vorlesungen zur Einführung in die Philosophie, Wien 2001, S. 179–192.
134 Neumann: Noch einmal: Hannah Arendt, Martin Heidegger und Günther Stern/Anders, a. a. O.
135 Karin Maire: Der Täter und sein Gewissen. Zum Problem der Verantwor-tung bei Günther Anders und Hannah Arendt. Ein Vergleich, in: Raimund Bahr (Hg.): Urlaub vom Nichts, a. a. O., S. 93–115 und Dies. [Parienti-Maire]: Éléments d’un dialogue caché. Considérations sur Hannah Arendt et Günther Anders, in: Christophe David/Dies. (Eds.): Günther Anders. Agir pour repousser la fi n du monde, Paris 2007, S. 273–285.
136 Günther Anders: Über Broch. Der «Tod des Vergil» und die Diagnose seiner Krankheit, in: Ders.: Mensch ohne Welt, a. a. O., S. 195–200 und Hannah
ı136 ı 137
Arendt: Hermann Broch, in: Dies.: Menschen in fi nsteren Zeiten, Mün-chen 1989, S. 131–171. Paul Lützeler weist in seinem Nachwort zum Arendt – Broch – Briefwechsel darauf hin, daß möglicherweise erst Günther Anders’ «Verriß» des Brochschen Romans Arendt «auf das Buch aufmerksam ge-macht» hat (Paul Michael Lützeler: Der Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und Hermann Broch, in: Hannah Arendt/Hermann Broch: Brief-wechsel 1946–1951, Frankfurt/M. 1996, S. 227–250; hier S. 234).
137 Dieter Thomä: Das natürliche Leben und die Aufgabe des Philosophen. Anmerkungen über Günther Anders mit Seitenblicken auf Husserl, Heideg-ger, Arendt und Foucault, in: Raimund Bahr (Hg.): Zugänge. Günther An-ders. Leben und Werk, St. Wolfgang 2007, S. 35–67.
138 Sylvie Courtine-Denamy: Le souci du monde. Dialogue entre Hannah Arendt et quelques-uns de ses contemporains, Paris 1999; Richard Wolin: Heidegger’s Children, Princeton 2003, S. 35, 38.
139 Raimund Bahr: Günther Anders. Leben und Denken im Wort, St. Wolfgang 2010, S. 142 und 133.
140 Vgl. Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 128–138. 141 Vgl. dazu den Band Über Heidegger, der alle Arbeiten versammelt, in denen
sich Günther Anders explizit mit Martin Heidegger auseinandergesetzt hat, sowie das Nachwort von Dieter Thomä (Gegen Selbsterhitzung und Natur-vergessenheit. Nachwort zur Aktualität des Philosophen Günther Anders, in: Anders: Über Heidegger, a. a. O., S. 398–433), ferner Helmut Hildebrandt: Weltzustand Technik. Ein Vergleich der Technikphilosophien von Günther Anders und Martin Heidegger, Berlin 1990. Zu Arendt und Heidegger vgl. vor allem Grunenberg: Hannah Arendt und Martin Heidegger, a. a. O. sowie Seyla Benhabib: Hannah Arendt. Die melancholische Denkerin der Mo-derne. Erweiterte Ausgabe, Frankfurt/M. 2006 und Dana R. Villa: Arendt and Heidegger. The Fate of the Political, Princeton 1996.
142 Das Buch, ein Gründungsdokument der Wissenssoziologie, hatte bereits kurz nach seinem Erscheinen 1929 für außergewöhnlich heftige Debatten über den Status des Denkens und die Rolle der Intellektuellen (der «frei-schwebenden Intelligenz») gesorgt und sowohl Anders als auch Arendt zu Reaktionen provoziert, in denen sich jene philosophischen Themen und Arbeiten widerspiegeln, mit denen sie sich seinerzeit gerade befaßten. Während Hannah Arendt mit adeptenhaftem Bezug auf Heidegger, Jaspers und Augustinus die Autonomie ihres Fachs vehement gegen Mannheims These verteidigte, jedes Denken sei Ausdruck spezifi scher ökonomisch- sozialer Zusammenhänge bzw. Lebenssituationen, in denen es stehe, und damit per se perspektivisch, empfahl Günther Anders der Philosophie ganz auf der Linie seiner frühen anthropologischen Entwürfe, «die von der Soziologie offenbar gemachte Krise als ihre eigene zu übernehmen» und ihrerseits nach dem Sinn der Situationsabhängigkeit zu fragen, d. h. «die Situation zu verstehen, aus der Wahrheitsanspruch überhaupt erwachsen kann.» (Stern: Über die sog. «Seinsverbundenheit» des Bewußtseins,
a. a. O., S. 494). Zur Mannheim-Rezeption Arendts vgl. auch Young-Bruehl: Hannah Arendt, a. a. O., S. 136 ff. sowie Schöttker/Wizisla (Hg.): Arendt und Benjamin, a. a. O., S. 28.
143 Vgl. dazu Günther Anders’ Brief (ms.) an Hannah Arendt vom 4. Oktober 1957, HAZ, Cont. 14.7, Nr. 009949.
144 Ulrich Raulff: Wären wir nicht essbar wie Vieh, zerschlagbar wie Holz, brennbar wie Kohle, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 280, 05. Dezember 2001, S. V2/13. Laut Dieter Thomä (Gegen Selbsterhitzung und Naturvergessen-heit, a. a. O., S. 421) interveniert zuerst Günther Anders, nicht Hannah Arendt, philosophisch zugunsten der «Gebürtlichkeit». Vgl. dazu auch An-ders: Über Heidegger, a. a. O., S. 50 ff. und 90 sowie Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1, a. a. O., Anm. 24, S. 325 f.
145 Stern: Pathologie de la Liberté, a. a. O., S. 22. Zu deutsch etwa: Künst lichkeit ist die Natur des Menschen und sein Wesen ist Wandelbarkeit/Unbeständigkeit. Helmuth Plessner schreibt in Die Stufen des Organischen und der Mensch (Berlin/Leipzig 1928, S. 309 f.): «Als exzentrisch organisiertes Wesen muß er [der Mensch; C. D.] sich zu dem, was er schon ist, erst machen.» Von Natur aus nicht gesegnet mit der «unerreichbare[n] Natürlichkeit der anderen Lebewesen», sei der Mensch auf künstliche Welten angewiesen: «Weil dem Menschen durch seinen Existenztyp aufgezwungen ist, das Leben zu führen, welches er lebt, d. h. zu machen, was er ist – eben weil er nur ist, wenn er vollzieht – braucht er ein Komplement nichtnatürlicher, nichtgewachsener Art. Darum ist er von Natur, aus Gründen seiner Existenzform künstlich.»
146 Hannah Arendt: Ziviler Ungehorsam, in: Dies.: In der Gegenwart. Übungen im politischen Denken II, München 2000, S. 283–321; hier S. 302 f.
147 Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 311. 148 Günther Stern: Die Weltfremdheit des Menschen. Unveröffentlichtes Ty-
poskript (1930), S. 7, ÖLA 237/04. 149 Vgl. Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch, a. a. O.,
S. 288–293, insbes. S. 291 f. 150 Günther Anders: Situation und Erkenntnis. Unveröffentlichtes Typoskript
(1929), S. 56, ÖLA 237/04. 151 Aufschlußreiche Einblicke in die frühe Anthropologie von Günther Anders
geben Konrad Paul Liessmann: Günther Anders. Philosophieren im Zeital-ter der technologischen Revolutionen, München 2002, S. 30–52 und Wer-ner Reimann: Verweigerte Versöhnung. Zur Philosophie von Günther An-ders, Wien 1990. Vgl. dazu auch den Überblick bei Christian Dries: Gün-ther Anders, München 2009, S. 23–31.
152 Augustinus: De civitate Dei, Liber XII, 21. Zu deutsch: Der Mensch ist ge-schaffen, damit ein Anfang sei; vgl. Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 215 f.
153 Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 242. Bei Ludger Lütkehaus (Natalität. Philo-sophie der Geburt, Zug /CH 2006, S. 62–65) deutet sich eine mögliche Ver-knüpfung Andersscher mit Arendtscher Natalitätsphilosophie über den Be-griff der Aposteriorität an.
ı138 ı 139
154 Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 19. 155 Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 20. 156 Maire [Parienti-Maire]: Éléments d’un dialogue caché, a. a. O., S. 276. 157 Hannah Arendt ist nie als Feministin in Erscheinung getreten – im Gegen-
teil: «Es sieht nicht gut aus, wenn eine Frau Befehle erteilt. Sie soll versu-chen, nicht in solche Positionen zu kommen, wenn ihr daran liegt, weibli-che Qualitäten zu behalten», doziert sie im Fernsehgespräch mit Günter Gaus (Hannah Arendt: Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk, München 2005, S. 48). Hans Jonas notiert in seinen Erinnerungen (a. a. O., S. 286): «Sie [Hannah Arendt; C. D.] war übrigens gegen die femini-stische Bewegung eingestellt und sagte mir einmal: ‹Ich bin durchaus dage-gen und möchte nicht meine Privilegien verlieren› – nämlich die Privilegien der Dame, der die Herren zu Diensten sind.» Siehe auch oben, S. 29.
158 Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 33. 159 Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 214. 160 Das aus drei handschriftlich beschriebenen Seiten bestehende Fragment
ist Teil einer 36 lose Blätter umfassenden blauen Mappe mit der Aufschrift «Philosophie des Menschen 1927–1929» (ÖLA 237/04). Die korrespondie-rende Stelle in der Weltfremdheit fi ndet sich unter «Ad. I.» auf S. 31 des Typoskripts.
161 Anders: Tagebücher und Gedichte, a. a. O., S. 206. 162 Hans-Peter Krüger: Die condition humaine des Abendlandes. Philosophi-
sche Anthropologie in Hannah Arendts Spätwerk, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Jg. 55, Heft 4, 2007, S. 605–626; hier S. 611.
163 Jonas an Anders, Brief (hs.) vom 19. April 1980, ÖLA 237/04. 164 Vgl. Thomä: Gegen Selbsterhitzung und Naturvergessenheit, a. a. O., S. 400 f. 165 Zu Günther Anders’ gelegenheitsphilosophischer Methode vgl. ausführlicher
Dries: Günther Anders, a. a. O., S. 17 ff. sowie die Aufsätze zu Brecht, Heart-fi eld und Georg Grosz, in: Anders: Mensch ohne Welt, a. a. O., S. 133–172, 173–191 und 201–237. Zu Hannah Arendt vgl. u. a. Ingeborg Nordmann: Tra-ditionsbruch und Montage. Hannah Arendts Totalitarismusbegriff im Kon-text von Benjamin und Kafka, in: Daniel Ganzfried/Sebastian Hefti (Hg.): Hannah Arendt – Nach dem Totalitarismus, Hamburg 1997, S. 78–85.
166 Michael Th. Greven: Hannah Arendt – Pluralität und die Gründung der Freiheit, in: Peter Kemper (Hg.): Die Zukunft des Politischen. Ausblicke auf Hannah Arendt, Frankfurt/M. 1993, S. 69–96; hier S. 71.
167 Anders an Arendt, Brief (ms.) vom 28. Oktober 1958, HAZ, Cont. 14.7, Nr. 009943.
168 Wieder abgedruckt in: Hannah Arendt: Zwischen Vergangenheit und Zu-kunft. Übungen im politischen Denken I, München 2000, S. 277–302.
169 Hannah Arendt: On the Human Condition, in: Alice Mary Hilton (Ed.): The Evolving Society. The Proceedings of the First Annual Conference on the Cybercultural Revolution – Cybernetics and Automation, New York 1966, S. 213–219; hier S. 217. Zu deutsch etwa: Wir dürfen nicht glauben, daß
Zivilisation einfach passiert und aus sich selbst heraus gedeiht – daß Kultur sich einfach ereignet – wenn es nur sogenannte Freizeit gibt.
170 Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 157. 171 Vgl. Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 147 f. 172 Arendt: Zwischen Vergangenheit und Zukunft, a. a. O., S. 76. 173 Im zweiten Band der Antiquiertheit spricht Günther Anders vom Gefälle
«zwischen dem Maximum dessen, was wir herstellen können, und dem (be-schämend geringen) Maximum dessen, was wir bedürfen können.» (Die Anti-quiertheit des Menschen, Bd. 2: Über die Zerstörung des Lebens im Zeital-ter der dritten industriellen Revolution, 2. Aufl ., München 1981, S. 19)
174 Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 2, a. a. O., S. 37. 175 Günther Anders: Der Blick vom Mond. Refl exionen über Weltraumfl üge,
2. Aufl ., München 1994, S. 156 und 125. 176 Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 2, a. a. O., S. 266. 177 Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 2, a. a. O., S. 49. 178 Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 2, a. a. O., S. 42. 179 Lore Hühn: Vorwort, in: Claudia Bozzaro: Hannah Arendt und die Banalität
des Bösen, Freiburg 2007, S. i-ii; hier S. ii. 180 Auch Günther Anders hat 1964 und 1966 in Wien – während der beiden er-
sten Strafverfahren gegen den ehemaligen SS-Hauptsturmführer Franz No-vak, einem engen, für die Deportationstransporte zuständigen Mitarbeiter Eichmanns – die Rolle des Prozeßbeobachters eingenommen (vgl. Anders: Besuch im Hades, a. a. O., S. 192).
181 Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1, a. a. O., S. 272. Dieselbe Nähe zu Arendts Eichmann-Porträt wird augenfällig, wenn Günther Anders im Interview mit Fritz J. Raddatz den Mann an der Abschußrampe der Atomrakete als zu beschränkt bezeichnet, «um sich das, was er tun könnte, also seine unbeschränkte Vernichtungsmacht, vorstellen zu können» (An-ders: «Brecht konnte mich nicht riechen», a. a. O., S. 29).
182 Vgl. Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 10. Aufl ., München 2005, S. 721 f. bzw. Organisierte Schuld, in: Dies.: Sechs Essays, Heidelberg 1948, S. 43.
183 Georg Geiger (Der Täter und der Philosoph – Der Philosoph als Täter. Die Begegnung zwischen dem Hiroshima-Piloten Claude R. Eatherly und dem Antiatomkriegphilosophen Günther Anders oder: Schuld und Verantwor-tung im atomaren Zeitalter, Bern u. a. 1991) hat die Umstände des Brief-wechsels zwischen Anders und Eatherly nachgezeichnet und sowohl mit ei-nigen Vorurteilen bezüglich der Person Eatherly aufgeräumt als auch plau-sibel dargelegt, daß die Anderssche Interpretation von Eatherlys Devianz nicht frei ist von Projektionen und Legendenbildung.
184 Vgl. dazu die Einleitung in: Anders: Mensch ohne Welt, a. a. O., S. XI-XLIV; speziell S. XI-XXVI.
185 Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, a. a. O., S. 722. 186 Vgl. dazu die Anderssche Beckett-Interpretation Sein ohne Zeit. Zu Becketts
ı140
Stück «En attendant Godot» (in: Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1, a. a. O., S. 213–231) sowie das Lied der Arbeitslosen (in: Mensch ohne Welt, a. a. O., S. IX).
187 Vgl. Maurice Weyembergh: L’âge moderne et le monde moderne, in: Anne-Marie Roviello/Ders. (Eds.): Hannah Arendt et la modernité, Paris 1992, S. 157–173; hier S. 167.
188 Weyembergh: L’âge moderne et le monde moderne, a. a. O., S. 158. Zu deutsch etwa: […] die Moderne verwirklicht zumindest einen Teil dessen, was für die Neuzeit noch imaginär oder theoretisch geblieben war; sie führt also dieses Imaginäre und Theoretische in die Welt ein.
189 Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Band 2, a. a. O., S. 9. 190 Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 411. 191 Günther Anders: Die atomare Drohung. Radikale Überlegungen zum ato-
maren Zeitalter, 7. Aufl ., München 2003, S. 198 f. 192 Dieter Thomä: Das natürliche Leben und die Aufgabe des Philosophen,
a. a. O., S. 52. 193 Vgl. dazu auch die Doktorarbeit des Verfassers: Christian Dries: Die Welt
als Vernichtungslager. Eine kritische Theorie der Moderne im philosophi-schen Dreieck von Günther Anders, Hannah Arendt und Hans Jonas. Bie-lefeld transkript (i. V.).
194 Hannah Arendt: Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaß. Hg. von Ur-sula Ludz. Vorwort von Kurt Sontheimer, München 1993.
195 Arendt: Vita activa, a. a. O., S. 127. 196 Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet, a. a. O., S. 67. 197 Hannah Arendt: Ich will verstehen, a. a. O., S. 46 und 48 f. 198 Günther Anders: Lieben gestern. Notizen zur Geschichte des Fühlens,
3. Aufl ., München 1997. 199 So auch Thomä: Das natürliche Leben und die Aufgabe der Philosophie,
a. a. O., S. 55 f. 200 Vgl. dazu auch Dries: Günther Anders, a. a. O., S. 100. 201 Anders: Mariechen, a. a. O., S. 23. 202 Anders: Mariechen, a. a. O., S. 32. 203 Vgl. Arendt/Jaspers: Briefwechsel, a. a. O., S. 301, 326. 204 Vgl. dazu ausführlich Dieter Thomä: Verlorene Passion, wiedergefundene
Passion. Arendts Anthropologie und Adornos Theorie des Subjekts, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Jg. 55, Heft 4, 2007, S. 627–647. Für Barbara Hahn (Hannah Arendt – Leidenschaften, Menschen und Bücher, a. a. O., S. 78) ist die Frage nach Liebe und Freundschaft bei Arendt «nicht in Essays oder Büchern zu verhandeln, in deren Titel sie wandern könnte. Sie führt in die leere Mitte ihres Schreibens, rührt an das Unsagbare, we-gen dessen alles andere geschrieben wurde.»
205 Anders: Über Heidegger, a. a. O., S. 326. 206 Arendt/Jaspers: Briefwechsel, a. a. O., S. 290. 207 Anders: Mariechen, a. a. O., S. 68.
Abbildungsnachweis
Das Umschlagfoto von Hannah Arendt sowie die Fotos auf den Seiten 2 und,
28: Courtesy of the Hannah Arendt Bluecher Literary Trust.
Alle übrigen Abbildungen (Fotos, Zeichnung, Faksimiles) entstammen dem Nachlass Günther Anders, Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek , Signatur: ÖLA 237/04 – © Gerhard Oberschlick
Inhalt
Die Kirschenschlacht. Von Günther Anders Zur Erinnerung an Hannah …………………………… 7
Monaden ……………………………………………… 11
Die Irrelevanz des Menschen ………………………… 25
Akademisches Nachwort ……………………………… 53
Editorische Notiz. Von Gerhard Oberschlick ……………… 61
Günther Anders und Hannah Arendt – eine Beziehungsskizze. Von Christian Dries 1. Lebenswege ………………………………………… 73
«Irgendwie ganz gleich wen»: Von Marburg nach Berlin 1925–1929 …………………………………………… 73
Wanderjahre: Berlin, Heidelberg, Frankfurt, Berlin 1929–1933 …………………………………………… 78
Misere der Emigration: Pariser Notgemeinschaft 1933–1937 …………………………………………… 81
Chancen der Misere: New York, Hollywood, San Diego, New York 1937–1950 ………………………………… 86
Weder – noch: 1950-1975 und Postskriptum ……… 89
2. Denkwege …………………………………………… 95
Kein weites Feld …………………………………… 95
Drewitzer Symphilosophie: Die Lehre von den Menschen ………………………………………… 99
Eichmann nach Jerusalem …………………………106
Weltzustand Technik ……………………………… 111
Amor mundi oder Der ontologische Trost des Zusammenkuschelns …………………………… 114
Anmerkungen …………………………………………………… 117
Abbildungsnachweis ………………………………………… 142