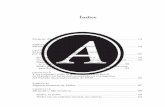The Modernist God State: A Literary Study of the Nazis' Christian Reich
Die Wikinger und das Fränkische Reich. Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung
Transcript of Die Wikinger und das Fränkische Reich. Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung
MittelalterStudiendes Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters
und seines Nachwirkens, Paderborn
Herausgegeben von Kerstin P. Hofmann, Hermann Kamp
und Matthias Wemhoff
Schriftleitung: Nicola Karthaus
Band 29
Paderborn 2014
Kerstin P. Hofmann · Hermann Kamp · Matthias Wemhoff (Hg.)
Die Wikinger und das Fränkische Reich Identitäten zwischen
Konfrontation und Annäherung
unter Mitarbeit von Nicola Karthaus
Wilhelm Fink
Gedruckt mit Unterstützung des Exzellenzclusters 264 „Topoi“.
Topoi-Logo CMYK (minimale Breite im Druck: 4 cm)
Topoi-Logo Graustufen (minimale Breite im Druck: 4 cm)
Logo-Variante für Verkleinerungen unterhalb einer Breite von 4 cm.(Flyer u.ä.)
Umschlagabbildung:Der große Runenstein König Harald Blauzahns in Jelling.
Foto: Anne Pedersen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung
einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien,
soweit es nicht §§ 53 und 54 UrhG ausdrücklich gestatten.
© 2014 Wilhelm Fink, Paderborn (Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn)
Internet: www.fink.de
Satz: Thomas Eifler, BerlinEinbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München
Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn
ISBN 978-3-7705-5850-6
Inhalt
Vorwort der Herausgeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hermann KampEinleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kerstin P . HofmannAkkulturation und die Konstituierung von Identitäten . Einige theoretische Überlegungen anhand des Fallbeispieles der hogbacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rudolf SimekDie Gründe für den Ausbruch der Wikingerzüge und das fränkische Reich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Alheydis PlassmannDie Wirkmächtigkeit von Feindbildern – Die Wikinger in den fränkischen und westfränkischen Quellen . . . . . . . . . . . . . 61
Birgit MaixnerDie Begegnung mit dem Süden: Fränkische Rangzeichen und ihre Rezeption im wikingerzeitlichen Skandinavien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Volker HilbergZwischen Innovation und Tradition . Der karolingische Einfluss auf das Münzwesen in Skandinavien . . . . . . . . . . . . 133
Heiko SteuerMittelasien und der wikingerzeitliche Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Lars JørgensenNorse Religion and Ritual Sites in Scandinavia in the 6th–11th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Jens Peter SchjødtPaganism and Christianity in the North . Two Religions – Two Modes of Religiosity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Inhalt6
Anne PedersenJelling im 10 . Jahrhundert – Alte Thesen, neue Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Jörn StaeckerDer Glaubenswechsel im Norden – Die Neukonzeptionalisierung Dänemarks unter König Harald Blauzahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Vorwort
Die große Sonderausstellung „Die Wikinger“ wird nach Stationen in Kopen-hagen und London vom 9 . September 2014 bis zum 4 . Januar 2015 in Berlin im Martin-Gropius-Bau gezeigt . Sie ist ein Gemeinschaftswerk des Dänischen National museums Kopenhagen, des British Museum und des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin . Dies gilt – eine echte Beson-derheit – für die gesamte Phase der Konzeption und Entwicklung . Durch frühzei-tige Planung konnten Wissenschaftler in den einzelnen Ländern die Epoche der Wikinger vorab gemeinsam analysieren . Nur so sind Perspektivwechsel möglich, die zu neuen Erkenntnissen führen – auch über scheinbar feststehende Bilder in den einzelnen Nationen hinweg . Von deutscher Seite war es uns von Anfang an wichtig, die Beziehungen zwischen dem fränkisch-deutschen Reich und den sich formierenden skandinavischen Reichen besonders in den Blick zu nehmen . Ist das Fränkische Reich tatsächlich ein Orientierungsrahmen für das dänische Königtum gewesen? Gibt es fassbare Bezüge in den Repräsentationsformen, der religiösen Praxis und der gesellschaftlichen Strukturierung der Reiche?
Diese grundlegenden Fragen können nur im Zusammenwirken von Archäologie und Geschichte geklärt werden . Deshalb haben sich zwei dafür besonders qualifi-zierte Wissenschaftseinrichtungen zusammengetan: Das an der Universität Pader-born angesiedelte „Institut zur interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens“ (IEMAN) und das Berliner Exzellenzcluster 264 „Topoi“, welches „The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations“ untersucht . Die Wikingerzeit bietet dafür ein herausragendes, wenn auch zeitlich etwas jüngeres Forschungsgebiet . Selten hat eine Gruppe eine solche Dynamik bei der Verbindung und Durchdringung von weit entfernten Räumen bewiesen, wie das die seefahrenden Wikinger getan haben . Zudem wurden die dabei entstehenden Möglichkeiten zum Wissenstransfer auf vielfältigste Weise genutzt . Insofern bietet dieser Blick in das hohe Mittelalter auch Erkenntnisse, die bei der Erforschung älterer Epochen gewinnbringend sein können . Dies gilt ganz besonders für die zentrale Frage der Topoi-Forschungsgruppe „Space & Collective Identities“1 nach der Herausbildung von Identitäten im Zuge von Kulturkon-takten . Das Paderborner Mittelalterinstitut hat – gerade im Vorfeld von großen Ausstellungs- und Forschungsprojekten – eine besondere Veranstaltungsreihe entwickelt: das „Archäologisch-historische Forum“ (AHF) .2 Hier treffen fünf bis
1 Einen Einblick in die Forschungen, Aktivitäten und Publikationen der Cross Sectional Group V gibt: http://www .topoi .org/group/e-csg-v-topoi-1/ . Es handelt sich hierbei um die Vorgängergruppe der key topic group „identities . space and knowledge related identification“; siehe http://www .topoi .org/group/identities/ .
2 Bereits erschienene Bände: Hässler, Hans-Jürgen/Jarnut, Jörg/Wemhoff, Matthias (Hg .): Sach-sen und Franken in Westfalen . Zur Komplexität der ethnischen Deutung und Abgrenzung zweier frühmittelalterlicher Stämme (Studien zur Sachsenforschung 12), Oldenburg 1999; Fenske, Lutz/
Hofmann, Kamp, Wemhoff8
sechs Archäo logen auf eine vergleichbare Zahl von Historikern und vermitteln im intensiven Gespräch ihre jeweiligen Positionen und Forschungsstände . Ferner führt dies zu einem besseren Verständnis für die Hintergründe und Bedingtheiten der Kenntnisstände der anderen Disziplin, letztlich die Voraussetzung für die Erarbei-tung einer validen Gesamtsicht .
Die gemeinsam mit Birgit Maixner3 durchgeführte Tagung „Das Fränkische Reich als Vorbild? Zur Dialektik von Akkulturation und skandinavischer Identitäten konstituierung während der Wikingerzeit“ fand vom 22 . bis zum 24 . April 2010 in der besonderen Atmosphäre des ehemaligen Benediktinerinnen-klosters Gehrden im Hochstift Paderborn statt . Aufgrund aktueller Forschungen, insbesondere in Jellinge, kam es bis in das Jahr 2014 immer wieder zu Ergänzungen und Aktualisierungen der hier abgedruckten Beiträge . Dafür möchten wir allen Autoren sehr herzlich danken . Ferner danken wir dem IEMAN und insbeson-dere Nicola Karthaus für die Redaktion und Betreuung des Tagungsbandes, dem Excellenz cluster Topoi für die Übernahme der Druckkosten und dem Verlag Wilhelm Fink für die verlegerische Betreuung . So liegt rechtzeitig zur Eröffnung der Wikingerausstellung in Berlin ein Forschungsband vor, der nicht nur allen historisch und archäologisch interessierten Besuchern einen vertieften Einblick in die Thematik ermöglicht .
Kerstin P . Hofmann Hermann Kamp Matthias Wemhoff
Jarnut, Jörg/Wemhoff, Matthias: Deutsche Königspfalzen . Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung, Bd . 5: Splendor palatii . Neue Forschungen zu Paderborn und ande-ren Pfalzen der Karolingerzeit (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11/5), Göttingen 2001; Jarnut, Jörg/Wemhoff, Matthias (Hg .): Erinnerungskultur im Bestattungsritual (MittelalterStudien 3), München 2003; Ehlers, Caspar/Jarnut, Jörg/Wemhoff, Matthias (Hg .): Deutsche Königspfalzen . Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung, Bd . 7: Zentren herrschaftlicher Repräsentation im Hochmittelalter . Geschichte, Architektur und Zeremoniell (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11/7), Göttingen 2007; Jarnut, Jörg/Köb, Ansgar/Wemhoff, Matthias (Hg .): Bischöfliches Bauen im 11 . Jahrhundert (Mittelalter Studien 18), München 2009 .
3 Senior Fellow des Exzellenzclusters Topoi vom 01 . 12 . 2009 bis 31 . 05 . 2010 .
Hermann Kamp
Einleitung
Noch immer üben die Wikinger und ihre Lebensweise auf viele Menschen eine große Faszination aus . Seit Ende April 2014 läuft im deutschen Privatfernsehen mit ‚Vikings‘ eine kanadisch-irische Abenteuerserie, die ein authentisches Lebens-bild der Wikinger vermitteln will und sich einigen Zuspruchs erfreut .1 Doch das Interesse an den Wikingern bleibt nicht bei der Unterhaltung stehen, sondern geht vielfach mit dem Bedürfnis einher, mehr über die Kultur der Wikinger zu erfah-ren . Die vielen Besucher, die Jahr für Jahr jene Stätten wie in Roskilde, in Schles-wig (Haithabu) oder York in England aufsuchen, an denen ihnen Überreste der Wikingerzeit anschaulich präsentiert werden, bezeugen dies ebenso wie jene, die die großen wie kleinen Ausstellungen über die Wikingerzeit bevölkern, die in regel-mäßigen Abständen in Europa eröffnet werden .
Dass in den zurückliegenden Jahrzehnten solche Ausstellungen ungebrochen große Besucherzahlen anziehen konnten, lag nicht zuletzt an den vielen neuen Erkenntnissen über die Wikinger, die sich aufgrund von archäologischen Funden, verbesserten technischen Analysefähigkeiten und neuartigen Zugängen zu den schriftlichen Quellen immer wieder einstellten . Von daher erstaunt es auch nicht, dass etwa 20 Jahre nach der Wikingerausstellung des Europarates 1992/1993, die in Berlin, Kopenhagen und Paris zu sehen war, nun im September 2014 erneut in Berlin eine große internationale Ausstellung zu den Wikingern eröffnet wird . Sie wurde vom dortigen Museum für Vor- und Frühgeschichte gemeinsam mit dem dänischen Nationalmuseum und dem British Museum konzipiert und in Kopen-hagen und London auch schon gezeigt . Dieses länderübergreifende Ausstellungs-projekt verdankt seine Existenz aber nicht allein dem Wunsch, das in den letzten Jahren erweiterte Wissen einem größeren Publikum vorzustellen . Ziel ist es auch, eine neue, bisher eher vernachlässigte Perspektive auf die Wikinger zu entfalten, nämlich sichtbar zu machen, wie die Skandinavier des 9 . und 10 . Jahrhunderts mit den fremden Kulturen umgegangen sind, auf die sie durch ihre Handelsfahrten, ihre zahlreichen Raubzüge und Eroberungen, ihre diplomatischen Verbindungen oder aber im Zuge der Auswanderung oder als Adressaten von Missionsaktivitäten gestoßen sind .
Wie bei solchen Unternehmungen üblich, gab es auch in diesem Fall im Vor-feld einige Tagungen, die dazu dienten, den wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu ermitteln, um von da aus das Ausstellungskonzept zu entwickeln . Eine die-ser Tagungen fand im April 2010 auf Schloss Gehrden in der Nähe von Pader-born statt . Unter dem Titel „Das Fränkische Reich als Vorbild? Zur Dialektik von Akkulturation und skandinavischer Identitätenkonstituierung während der
1 Vgl . www .prosieben .de/tv/vikings/die-story [14 . 5 . 2014] .
Hermann Kamp10
Wikingerzeit“ versammelte sie Vertreter verschiedener Fächer von der Archäologie über die Geschichte bis zur Religionswissenschaft, um den fränkischen Einfluss im damaligen Skandinavien näher zu bestimmen und den verschiedenen Facetten des Kulturkontaktes und Kulturtransfers nachzugehen . Die Ergebnisse dieser Tagung werden nun mit diesem Band zum Beginn der deutschen Ausstellung in Berlin publiziert .
Mag die Rede vom Vorbildcharakter des Fränkischen Reiches für die Bewohner des damaligen Skandinaviens noch unmittelbar einleuchten, so stößt man doch sehr schnell auf eine Reihe von Schwierigkeiten, will man nur genauer bestimmen, wie man den Einfluss fränkischer Vorstellungen und Kulturgüter auf die Wikinger erkennen und in seiner Bedeutung ermessen kann . Die Probleme beginnen schon mit der Quellenlage . Zwar gibt es einige mehr oder minder zeitgenössische Geschichtsschreiber, die über Vorgänge in Skandinavien oder auch über die Akti-vitäten von Wikingern auf dem Kontinent oder den britischen Inseln berichten, aber diese Texte sind doch in hohem Maße von Stereotypen, von fest gefügten Feindbildern, durchsetzt und interpretieren das Verhalten der Wikinger mithilfe von Deutungsmustern, die fränkisch-christliche Vorstellungen von Mensch, Gott und Gesellschaft auf die Wikinger übertragen, wie man dem Aufsatz von Alheydis Plassmann in diesem Band entnehmen kann .2 Auch die späteren Autoren, selbst wenn sie bewusst wie der Saxo Grammaticus im 12 . Jahrhundert die Wikinger als ihre Vorfahren betrachten, lassen nicht erkennen, wie ihre Vorfahren, die Skandi-navier des 9 . und 10 . Jahrhunderts, gedacht und mit welchen Beweggründen und Hintergedanken sie gehandelt haben . Selbstverständlich kann man dem Saxo Grammaticus ebenso wie den Werken Snorri Sturlusons oder der altnordischen Literatur einiges über die Religion und Lebensauffassung der Wikinger entneh-men . Aber viel ist es nicht . Und so sind es in erster Linie die Objekte aller Art, die Archäologen ausgegraben und aufbereitet haben, auf denen die meisten, vor allem die neueren Erkenntnisse über die Wikingerzeit beruhen . Und in der Tat erlauben es diese Sachzeugnisse aufgrund ihrer Herkunft, ihres Fundortes, ihres Dekors und anderer Eigenschaften Aussagen über Kulturkontakte, ihre Häufig-keit oder ihre Verbreitung zu treffen . Doch zugleich enthalten sie selbst so gut wie keine Selbstaussagen der damaligen Menschen, so dass es nicht leichtfällt, mit ihrer Hilfe die Bedeutung der jeweiligen Güter und die damit verbundenen Ideen für die Wikinger zu erschließen .
Ob das gelingt, hängt in besonderer Weise von den Konzepten ab, derer man sich bedient, um sie zum Sprechen zu bringen . Mit den verschiedenen theore-tischen wie methodischen Ansätzen, die die Untersuchung von Kulturtransfer und Kulturwandel in quellenarmer Zeit leiten können, mit ihren Vor- und Nachteilen, beschäftigt sich Kerstin P . Hofmann in ihrem nachfolgenden Beitrag sehr aus-
2 Siehe Plassmann, Alheydis: Die Wirkmächtigkeit von Feindbildern – Die Wikinger in den frän-kischen und westfränkischen Quellen, S . 61–83 .
Einleitung 11
führlich, der deshalb auch als eine theoretische Einführung gelesen werden kann .3 Aus diesem Grund sei es an dieser Stelle auch bei dem Hinweis belassen, dass die archäo logischen Funde schon etwas über die Identität derer mitteilen, die sie hin-terlassen haben, wenn man sie als Bestandteil von Ritualen, Monumenten oder Routinen analysieren kann, in denen sich die Identität von Gemeinschaften immer wieder aufs Neue verkörpern kann . Allerdings sagen sie auch nur so lange etwas über ihre Bedeutung aus, wie man den Nachweis antreten kann, dass die Gemein-schaften die entsprechenden Rituale praktiziert und die Bauten oder Bilder auch genutzt haben, was im Einzelnen wieder schwerer zu belegen ist .4 Doch nur dann erfasst man auch die Bedeutung, die das fremde Kulturgut für die Rezipienten und ihre Kultur gewinnen konnte .
Ebenso wichtig ist ein zweites, damit verbundenes Moment . Kulturkontakt, vor allem aber Kulturtransfer und -wandel stellen zumeist mehr als die bloße Anerken-nung oder Übernahme von Kulturgütern dar . Sie umfassen stets auch eine produk-tive Aneignung des Fremden, die dem Neuen eine ganz andere Stellung und Funk-tion zuweist, als es in der Kultur besitzt, der es entlehnt wird . Insofern ist es auch sinnvoll, wie Kerstin P . Hofmann dies tut, mit einem dynamischen Kulturbegriff zu operieren, der vor allem auf die jeweilige Zuschreibung von Bedeutung abhebt . So muss man auch den Prozess der Akkulturation nicht mehr als eine Einbahnstraße verstehen, sondern kann ihn sich als einen Vorgang vorstellen, bei dem sich die Bedeutung der übernommenen Güter wandeln und es durchaus zu produktiven Missverständnissen, zu Synkretismen oder aber auch zu ganz neuen Nutzungen kommen kann .5 Genau das ist es denn auch, was gemeint ist, wenn im Untertitel von der Dialektik zwischen Akkulturation und skandinavischer Identitätsbildung die Rede ist .
Um wessen Identität es dabei geht, bedarf allerdings auch noch der Erläute-rung . Denn sehr schnell zeigte sich während der Tagung, dass Archäologen und Historiker mit unterschiedlichen Wikingerbegriffen operieren . Während in der Geschichtswissenschaft als Wikinger nur jene Skandinavier bezeichnet werden, die ihre Heimat im 9 . und 10 . Jahrhundert verließen, um im Frankenreich, in England oder Irland zu plündern, Tribute einzuziehen oder sich dort auch anzusiedeln, ver-binden die Archäologen mit dem Wort alle Skandinavier, auch die, die in ihrer Heimat blieben und nicht auf Raubzüge gingen . So gesehen zielen sie mit ihrer Begrifflichkeit primär auf eine bestimmte Kultur, die sich etwa in bestimmten Stil-formen oder im Gebrauch bestimmter Materialien niederschlägt und feste zeitliche Grenzen aufweist, nämlich die Zeitspanne von 750 bis 1050 . Auch wenn man die Skandinavier im genannten Zeitraum mit guten Gründen als Wikinger ansprechen kann, sollte man sich dabei stets vor Augen halten, dass es immer nur ein kleiner Teil von ihnen war, der sich an den Raubzügen ins Frankenreich oder nach England
3 Siehe Hofmann, Kerstin P .: Akkulturation und Konstituierung von Identitäten . Einige theoretische Überlegungen anhand des Fallbeispiels der hogbacks, S . 21–50 .
4 Vgl . ibid ., S . 26 .5 Vgl . ibid ., S . 33ff .
Hermann Kamp12
beteiligte, eine Minderheit, die neben dem dänischen Königtum die entscheidende Rolle für die sich seit 800 vervielfältigenden Kontakte zum Frankenreich spielte .
Dass diese Kontakte für die Kultur der Wikinger nicht folgenlos blieben, auch zu einem Kulturtransfer und Kulturwandel in Skandinavien führten, unterstrei-chen die nachfolgenden Beiträge für jeweils ganz unterschiedliche Bereiche . Je nachdem kam es zu direkten Übernahmen oder gar Nachahmungen bestimmter Güter, an anderer Stelle aber begegnet man auch einem ausgeprägten Bestreben, die fremden Impulse zwar aufzugreifen, aber mit eigenen Traditionen zu verbinden und etwas Eigenständiges aufzubauen, was eher für eine begrenzte Wirkung des karolingischen Vorbilds spricht . Dies sei kurz erläutert .
1 . Übernahme und Nachahmung
Es sind vor allem zwei Bereiche, in denen sich die unmittelbare Übernahme frän-kischer Kultur ohne jeden Zweifel beobachten lässt: bei der Bewaffnung und im Handel . So sind es einerseits fränkische Schwerter, die sich in ganz Skandinavien in den Gräbern hochgestellter Personen finden lassen .6 Darüber hinaus wurden solche Schwerter schon früh in den skandinavischen Ländern nachgeahmt, wobei es im Einzelnen allerdings schwer fällt, zwischen Import und Imitat zu unterscheiden, zumal skandinavische Waffenschmiede offenkundig in der Lage waren, fränkische Knäufe mit einheimischen Klingen und umgekehrt zu verschweißen . Die beson-dere Bedeutung der Schwerter kommt aber vor allem darin zum Ausdruck, dass ansonsten kaum Gegenstände fränkischer Herkunft unmittelbar als Grabbeigaben genutzt wurden . Wie Birgit Maixner, die sich vor allem auf norwegische Grab-funde stützt, zeigt, findet man dort zwar weitere Metallobjekte, die fränkischen Statussymbolen wie Schwertgurtgarnituren, Pferdekopfgeschirr, Prunksporen und Prunkgürtel entstammen, aber nur selten in ihrer ursprünglichen funktions-gerechten Form belassen wurden . Immerhin zeigen auch diese Umformungen, in welchem Maße die damaligen Eliten im Norden karolingische Luxusgüter genutzt haben, um ihre eigene Stellung in der Gesellschaft über den Tod hinaus zu demons-trieren .
Neben den Schwertern sind es dann vor allem fränkische Münzen gewesen, die man form- und funktionsgetreu nutzte, zumindest gilt dies für das dänische Haitha bu, das sich als Emporium im Laufe des 9 . Jahrhunderts allmählich eta-blierte .7 Ähnlich wie bei den Schwertern griff man dabei, wie man den Ausfüh-rungen Volker Hilbergs entnehmen kann, zum einen auf originale fränkische Prä-gungen zurück . Zugleich begegnet man hier allerdings auch vielen Imitaten, die sich vor allem an die frühen Denare Karls des Großen anlehnen . Auch wenn man
6 Siehe hierzu und zum Folgenden Maixner, Birigit: Die Begegnung mit dem Süden: Fränkische Rangzeichen und ihre Rezeption im wikingerzeitlichen Skandinavien, S . 85–131 .
7 Siehe hierzu und zum Folgenden Hilberg, Volker: Zwischen Innovation und Tradition . Der karolin-gische Einfluss auf das Münzwesen in Skandinavien, S . 133–215 .
Einleitung 13
die Münzstätte nicht nachweisen kann, wo diese Nachbildungen geprägt wurden, so spricht doch vieles dafür, diese in der Nähe Haithabus zu verorten, also im Reich des dänischen Königs, den Volker Hilberg denn auch als die treibende Kraft hinter dieser nordischen Münzherstellung ausmacht . Wie eng man sich hier an das karo-lingische Vorbild anlehnte, mag man daran erkennen, dass die dänischen Herrscher das Aussehen der Münzen kaum veränderten und auch ihren Namen nicht aufprä-gen ließen .
Auch die Einfälle der skandinavischen Gruppen ins Frankenreich oder nach England selbst sind ein Zeichen für die Anziehungskraft, die fränkische Produkte auf die Wikinger ausübten . Darauf verweist Rudolf Simek, der sich in seinem Aufsatz mit den Gründen für den massenhaften Aufbruch in den Jahren nach 800 beschäftigt und mit der Rolle, die das Karolingerreich dabei spielte .8 Denn für ihn laufen die schon im Mittelalter angeführten Erklärungen ins Leere, die eine Über-bevölkerung in den skandinavischen Ländern, eine Verarmung breiter Schichten oder die Tyrannei des norwegischen Königs Harald Schönhaar für den Exodus verantwortlich machten . Vielmehr sieht er neben den Versuchen dänischer Könige oder Gegenkönige, die Karolinger durch die Organisation solcher Einfälle poli-tisch und missionspolitisch schwächen zu wollen, vor allem in den wiederholten Verhandlungen zwischen den fränkischen Königen und den dänischen Königen und Großen einen wichtigen Auslöser für die Überfälle . Auf diese Weise erlangten für ihn die Dänen ein Wissen über die Reichtümer und deren Lage im Karolinger-reich, das sie dann in Krisenzeiten nutzten, um sich diese zu verschaffen . Dass sie zuweilen schon bei diesen Verhandlungen mit entsprechenden Gaben bedacht wurden, wie man dem Beitrag von Birgit Maixner entnehmen kann,9 mochte sie dann aber im Einzelfall auch wieder davon abgehalten haben, sich an den Überfäl-len zu beteiligen .
Zu den Indikatoren, die einen Einfluss der fränkischen Kultur in Skandinavien verraten, gehören selbstverständlich auch die Amulette, Fibeln, Münzen und Silbergefäße, die mit einem Kreuzeszeichen versehen sind oder gar ein Bildpro-gramm enthalten, das Anleihen an die christliche Ikonographie aufweist . Aller-dings stammen, wie nicht anders zu erwarten, die meisten der entsprechenden Funde aus dem 10 . Jahrhundert, als der Übertritt zum Christentum in Dänemark und in der Normandie von den jeweiligen Herrschern bereits vollzogen worden war und auch den Bekenntniswechsel des Gefolges und mithin der beherrschten Bevölkerung mit sich gebracht hatte . Insofern sind auch die früh überlieferten mit Kreuzen versehenen Funde kaum ein Zeichen für den Import von religiösen Vorstellungen, sondern eher für die Herkunft der betreffenden Objekte aus dem Frankenreich . Dem entspricht es nur, wenn in den karolingischen Quellen die einfallenden Wikinger nicht nur als Heiden apostrophiert werden, sondern auch ihr vereinzelter Glaubens übertritt den fränkischen Autoren zumeist wenig glaub-
8 Siehe Simek, Rudolf: Die Gründe für den Ausbruch der Wikingerzeit und das fränkische Reich, S . 51–60 .
9 Vgl . Maixner: Die Begegnung (Anm . 6), S . 89 .
Hermann Kamp14
würdig erscheint .10 Allerdings legen deshalb auch die Fundstücke des 10 . Jahrhun-derts, die christliche Zeichen aufweisen, einen wesentlich stärkeren Einfluss des Frankenreiches nahe, da sie nunmehr auch auf die christlichen Vorstellungen und Lebensauffassungen bei den Wikingern verweisen . Das galt natürlich insbesondere für diejenigen Wikinger, die sich in den Jahren nach 911 in der Normandie nieder-ließen, den christlichen Glauben ihrer neuen Nachbarn übernahmen und sich schnell assimilierten .11 Und doch haben die Skandinavier selbst in dieser Zeit des Übergangs wie bereits in den Jahrzehnten zuvor nicht nur einfach fremde Produkte und Ideen übernommen .
2 . Abgrenzung und Eigenständigkeit
Was man häufig beobachten kann, wenn zwei verschiedene Kulturen miteinander in Kontakt kommen, erkennt man auch im Umgang der Skandinavier mit der frän-kischen Kultur . Neben der bloßen Übernahme von Gegenständen und Ideen trifft man bei ihnen auch auf Versuche, Elemente der fränkischen Kultur mit denen der eigenen zu vermengen oder gar etwas ganz Neues daraus zu schaffen .12 Von der ersten Form des Umgangs zeugen zunächst einmal die Anhänger, Talismänner und Fibeln, die sie aus fränkischen Beschlägen und Münzen nicht nur hergestellt, son-dern zugleich mit den ihnen eigenen Ornamenten (Tierstil) und Symbolen (Thors-hammer) versehen haben – eine Praxis, die in vielen Beiträgen angesprochen wird .
Ein anderes Beispiel für die produktive, ja innovative Aneignung fremder Kulturgüter bilden die so genannten hogbacks . Dabei handelt es sich um hausför-mige Steindenkmäler, die an Grabsteine erinnern und mit Tierdarstellungen und Kampfszenen ausgeschmückt wurden . Dies wie auch der Stil erinnert an skandi-navische Vorbilder, zugleich trifft man aber auch, wie Kerstin P . Hofmann darlegt, auf angelsächsische und irische Formelemente und wohl auch auf Anleihen bei der christlichen Ikonographie .13 Nachzuweisen sind diese Denkmäler fast ausschließ-lich im Norden Englands, und zwar für die Zeit zwischen 919 und 954, als dort Norweger eine Königsherrschaft etablierten . Da diese in Skandinavien unbe-kannten Grabsteine aber nur in Gebieten gefunden wurden, in denen aus Irland vertriebene Norweger lebten und nicht in den schon bestehenden rein skandina-vischen Siedlungen, hat man es aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem eigenstän-digen, in Auseinandersetzung mit der vorgefundenen, teils christlich geprägten Kultur entstandenen Produkt der Migration zu tun . Das aber macht erneut deut-lich, wie variabel die so genannten Wikinger auf neue Impulse reagierten, sich diese
10 Vgl . Plassmann: Die Wirkmächtigkeit (Anm . 2), S . 69f .11 Vgl . ibid ., S . 77ff . 12 Vgl . zu den verschiedenen Verhaltensformen im Umgang mit fremden Kulturen Hofmann: Akkul-
turation (Anm . 3), S . 28f .13 Siehe ibid ., S . 44ff .
Einleitung 15
nicht nur anverwandelten, sondern etwas Neues schufen, ohne damit aber ihre bisherigen Traditionen gänzlich aufzugeben .
Nicht minder deutlich tritt die Vermengung fränkisch-christlicher und wikin-gischer Kulturelemente bei den von Jörn Staecker analysierten Prunkkästchen hervor, dem ‚Bamberger Schrein‘ und dem ‚Camminer Schrein‘ .14 Denn beide Kästchen weisen auf dem Deckel und an den Seiten eine Reihe eigenartiger Tier-darstellungen auf, die in jedem Fall aber vom Stil her eindeutig auf skandinavische Werkstätten der Wikingerzeit und auf eine Herstellung in der zweiten Hälfte des 10 . Jahrhunderts verweisen . Doch zugleich erkennt Staecker auf den Kästchen ein Bildprogramm, in dem aller Wahrscheinlichkeit nach die vier Evangelisten durch ihre herkömmlichen Mensch- und Tiersymbole dargestellt sind . Damit aber ver-knüpfen beide Kästchen in eigenartiger Art und Weise vorchristliche Darstellungs-formen mit der christlichen Ikonographie . Indem sie so eine nordische Sicht auf das Christentum versinnbildlichen, stehen die beiden Prunkkästchen nicht mehr nur für eine Vermengung unterschiedlicher kultureller Vorstellungen, sondern bringen, so Staecker, etwas Eigenständiges hervor .
Dass die neue Deutung der Schreine im Rahmen eines Beitrages erscheint, der sich vor allem mit den berühmten Monumenten von Jelling auseinandersetzt, erstaunt nicht . Denn mehr als alle anderen Überreste der wikingerzeitlichen Kultur Skandinaviens steht die Grabanlage von Jelling, in der Nähe von Vejle auf Jütland gelegen, für die Zusammenführung von nordischen und christlichen Elementen . Allerdings haben sich durch die Grabungen der letzten Jahre die Akzente bei der Deutung des Monuments deutlich verschoben . Die alte, viel gehörte These, derzu-folge der dänische König Harald Blauzahn nach seinem Übertritt zum Christen-tum die Überreste seines Vater aus der Grabkammer im Nordhügel in die in der Nähe neu errichtete Kirche umgebettet und so die ursprünglich heidnische Anlage in christlichem Sinne umgestaltet habe, lässt sich nämlich nicht mehr halten . Staecker geht vielmehr davon aus, dass Haralds Mutter um 958/959 in dem im Norden liegenden Hügel begraben wurde, wobei er es sogar für möglich hält, dass sie schon Christin war, als man sie dort bestattete .15 Dementsprechend bringt er dann das Kammergrab, das man unter der später errichteten Kirche in Jelling gefunden hat, als ursprüngliche Grabstätte für König Gorm, also Haralds Vater, ins Spiel, in der dieser um 970 beigesetzt worden sei . Erst einige Jahre später habe dann Harald den berühmten Runenstein setzen lassen, zum Gedenken an seinen Vater, aber ebenso um die Erinnerung an seine eigenen Glanztaten, die Eroberung Norwegens und die Christianisierung der Dänen, wachzuhalten . Dass die Grab-anlage nach 970 umgestaltet wurde, führt er auf die Vorstöße Ottos II . 973/974 nach Dänemark zurück . Ebenso wie in den beiden erwähnten Schreinen, erkennt Staecker in Jelling und vor allem im Runenstein, den Harald dort setzen ließ, ein ganz und gar eigenständiges Gemisch von Tradition und Innovation, das sich be-
14 Siehe Staecker, Jörn: Der Glaubenswechsel im Norden – Die Neukonzeptionalisierung Dänemarks unter König Harald Blauzahn, S . 297–359 .
15 Vgl . hierzu und zum Folgenden ibid ., S . 349 und S . 355ff .
Hermann Kamp16
wusst von fränkischen oder ottonischen oder auch angelsächsischen Vorbildern abgrenzte . Auf eine imitatio imperii seien weder die Bauten noch die sonstigen Zeugnisse aus der Zeit Haralds zurückzuführen .
Die Monumente von Jelling sind auch Thema des Beitrages von Anne Pedersen, die die jüngsten Ausgrabungen aus nächster Nähe mit verfolgt hat .16 Um deren Ertrag sichtbar zu machen, rekapituliert sie nochmals die Geschichte der Gra-bungen, um sodann ausgehend von den wichtigsten Neuentdeckungen, dem hohen Pfahlzaun und der überdimensionalen Schiffssetzung, nach Vorbildern für die Anlage in Skandinavien Ausschau zu halten . Da sie an drei dänischen Fundorten ähnliche Ensembles aus Runenstein, Grabhügel und Schiffsetzungen nachweisen kann, sieht sie in Jelling die bewusste Zurschaustellung alter Traditionen, mit denen der König seine Herrschaft in einer Zeit des Glaubenswandels zu legitimieren suchte . Zugleich war aber diese Form der herrscherlichen Selbstdarstellung nicht nur traditionell, sondern neu- und einzigartig, ließ doch die Anlage in ihrer Größe alles Bekannte weit hinter sich und integrierte nicht bloß das Bekenntnis zum Christentum, sondern rekurrierte etwa auch in der an eine Buchschrift angelehnten Anordnung der Runen auf dem Runenstein bewusst auf fränkische Vorbilder .
Dass auch ein christlicher König wie Harald Blauzahn auf die alten Traditionen Rücksicht nehmen musste, wird man nach der Lektüre des Aufsatzes von Lars Jørgensen besser verstehen . Mit Blick auf die jüngeren Grabungen im dänischen Tissø und ähnlichen Funden in Schweden verweist er auf die große Bedeutung, die den vorchristlichen Opfer- und Sühneritualen auf den großen Höfen der skan-dinavischen Elite eingeräumt wurde, wo entweder eigens kleinere Gebäude für die Opferung von Tieren oder auch Menschen vorhanden waren oder aber bestimmte Teile der geräumigen Wohnhallen für Opfermähler genutzt wurden .17 Dabei zeigt sich nicht nur, wie sehr die soziale und politische Vorrangstellung an die Herr-schaft über die Kultstätten und die Organisation der verschiedenen Opferrituale gebunden war, sondern auch wie sehr die Fürsorge für die guten Beziehungen zu den Göttern bis ins 11 . Jahrhundert zum Habitus dieser Magnaten gehört hat . Von daher dürften die Vorbehalte bei den Großen gegenüber der Christianisierung nicht gering gewesen sein, vor allem aber dürften diese kaum gewillt gewesen sein, die Kontrolle über den Kult einfach aufzugeben, was erklärt, warum die ersten christlichen Kirchen an den alten Kultstätten entstanden, wofür ja auch Jelling ein beredtes Beispiel abgibt .
Paradoxerweise tritt das Bestreben, bei der Übernahme fränkischer oder christ-licher Vorstellungen die Eigenständigkeit nicht zu verlieren, am deutlichsten dort hervor, wo sich die Skandinavier in kürzester Zeit assimilierten, nämlich in der Normandie . Dort war 911 eine der letzten größeren Wikingergruppen, die plündernd durch das Frankenreich gezogen war, zu einem Vertrag mit dem karo-lingischen König bewogen worden, der ihnen die Ansiedlung und die Herrschaft
16 Siehe Pedersen, Anne: Jelling im 10 . Jahrhundert – Alte Thesen, neue Ergebnisse, S . 275–295 .17 Siehe Jørgensen, Lars: Norse religion and ritual sites in Scandinavia in the 6th–11th century,
S . 239–264 .
Einleitung 17
in der Grafschaft Rouen versprach, wenn sie sich ihm unterstellten und Christen würden, was sie dann auch taten . Diese Wikinger nahmen bekanntlich binnen kürzester Zeit nicht nur den Glauben, sondern auch die Sprache ihrer neuen Nach-barn an . Und doch behielten sie ihre eigene Identität, nämlich als Normannen . Das gelang ihnen nicht zuletzt, indem sie zwei negative Eigenschaften, die ihnen bislang von fränkischer Seite abwertend angeheftet worden waren, ins Positive wendeten und für sich reklamierten . Denn sie, die einst von den Franken als Geißel Gottes bezeichnet worden waren, nahmen nun für sich selbst in Anspruch, wie man in dem Beitrag von Alheydis Plassmann nachlesen kann, als Werkzeuge Gottes zu wirken, deren Aufgabe darin bestand, für einen Aufschwung des Christentums im Frankenreich zu sorgen . Und ebenso erkoren sie, deren Landsleute die Franken bis dato als leibhaftige Verkörperung der Hinterlist geschmäht hatten, die List, mit der der Schwache sich zu erwehren weiß, zu ihrem Markenzeichen . Und indem sie zugleich ihre besondere Bindung an das neu erworbene Land, das sie nun besie-delten, eben die Normandie, und an ihren vorbildlichen christlichen Herrscher herausstellten, sicherten sie ihre ethnische Identität als Normannen im Franken-reich noch für lange Zeit .18
3 . Die Bedeutung des fränkischen Einflusses
Auch wenn es im 9 . und 10 . Jahrhundert zu vielfältigen Kontakten zwischen den Skandinaviern und den Franken gekommen ist, wird man doch aufs Ganze gesehen den fränkischen Einfluss auf das wikingerzeitliche Skandinavien eher geringer veranschlagen . Weit weniger als in Kroatien oder in Böhmen finden sich, von den Schwertern einmal abgesehen, karolingische Statussymbole in den Gräbern der nordischen Führungsschichten . Und nicht anders fällt der Befund aus, wenn man sieht, dass bislang nicht mehr als 150 karolingische Münzen in Skandinavien gefunden wurden .
Zum aussagekräftigen Indikator für den eher schwachen fränkischen Einfluss taugt die geringe Verbreitung karolingischer Münzen in Skandinavien aber erst, wenn man sie mit den 10 .000 arabischen Dirhems in Beziehung setzt, die bis zum Ende des 10 . Jahrhunderts in Skandinavien zirkulierten und deren Bedeu-tung als Gewichtsgeld Heiko Steuer anhand der gefundenen Gewichtswaagen herausstellt .19 In der starken wirtschaftlichen Nutzung der arabischen Silbermün-zen sieht er zugleich das ökonomische Fundament für eine starke Anziehung, die die arabisch-islamische Kultur in jener Phase auf die Skandinavier ausgeübt hat . Dafür spricht für ihn nicht nur, dass solche Münzen mit ihren arabischen Schriftzeichen gefälscht und teils zu Anhängern und Armreifen und anderem Schmuck umgearbeitet wurden . Auch die arabischen Silbergefäße, die aus dem Osten importierten Gläser oder die Pluderhosen und Kaftane, die man in skan-
18 Vgl . Plassmann: Die Wirkmächtigkeit (Anm . 2), S . 77–81 .19 Siehe Steuer, Heiko: Mittelasien und der wikingerzeitliche Norden, S . 217–238 .
Hermann Kamp18
dinavischen Gräbern gefunden hat, unterstreichen die kulturelle Beeinflussung, die auf die Handelsverbindungen folgte . Dabei stellt sich ihm die gleiche, auch in anderen Beiträgen anklingende Frage nach dem Grad der Beeinflussung . Denn inwiefern die zu Anhängern umgearbeiteten Silbermünzen mit den ara-bischen Schriftzeichen oder die mit ins Grab gegebene Pluderhose eine besondere Wertschätzung der arabischen Kultur verraten, ist schwer zu sagen, da diese Gegen-stände möglicherweise nur deshalb aufbewahrt und getragen wurden, weil sie etwas Außergewöhnliches, etwas Fremdes, ein Mitbringsel oder ein Souvenir darstellten und folglich auch nicht mehr als eine Vorliebe für Exotisches, eine Art Extrava-ganz, zum Ausdruck brachten .20 In jedem Fall kommt aber den Beobachtungen von Heiko Steuer schon deshalb ein großes Gewicht zu, weil sie zum einen den karolingischen Einfluss auf das wikingerzeitliche Skandinavien deutlich relativieren und zum zweiten erkennen lassen, in welchem Maße wirtschaftliche Faktoren den Kulturaustausch bestimmten . Denn nachdem insbesondere die Herrscher des Samanidenreiches, aus dem die meisten Silbermünzen stammten, aus Geldmangel den Silbergehalt der Münzen rapide herabgesetzt hatten, verloren die Skandinavier ihr Interesse an den Münzen und bald auch an den übrigen Produkten arabisch-islamischer Provenienz .21
Dass die Skandinavier trotz der teils intensiven Kontake zu den fränkischen, angelsächsischen oder auch islamischen Reichen über so lange Zeit an ihrer Reli-gion festhielten, und welch große Veränderung sie sich zumuteten, als sie dann doch seit der zweiten Hälfte des 10 . Jahrhunderts im Gefolge ihrer Könige den christlichen Glauben annahmen, führt einem Jens Peter Schjødt in seinem Beitrag deutlich vor Augen .22 Denn für die heidnischen Skandinavier war die Religion keine Frage des Glaubens oder gar der Dogmatik, sondern beruhte auf tradierten Kenntnissen und der Fähigkeit, durch den richtigen Vollzug der Rituale die Götter für sich einzunehmen, damit sie für Wohlergehen, Glück und Gesundheit sorgten . So war die Ausübung der Religion eine Angelegenheit, die die Gemeinschaft als Ganzes betraf und nicht nur das einzelne Individuum . Der Übertritt zum Christen-tum lief nicht einfach auf einen Glaubenswechsel hinaus, sondern bestand in der Preisgabe von Vorstellungen, die mit der bisherigen Lebenspraxis und der sozialen Einbindung aufs Engste verflochten waren .
Das erklärt, warum vor allem im 9 . Jahrhundert die Widerstände gegen die Übernahme des christlichen Glaubens so stark waren . Aber es erklärt vielleicht auch, warum die Missionare dann aber am Ende doch erfolgreich waren . Denn in zweierlei Hinsicht, so Schjødt, war das Christentum der heidnischen Religion überlegen . Die Achillesferse war die Fixierung auf die überkommenen Rituale . Diese legitimierten sich zum einen durch die Tradition, waren letztlich aber nicht fixiert, weshalb auch andere Rituale, eben die christlichen, daneben treten konn-
20 Vgl . dazu auch Maixner: Die Begegnung (Anm . 6), S . 119 .21 Vgl . dazu Steuer: Mittelasien (Anm . 19), S . 234f . 22 Schjødt, Jens Peter: Paganism and christianity in the north . Two religions – two modes of religiosity,
S . 265–274 .
Einleitung 19
ten, so wie sich das gleichzeitige Tragen von Thorshämmern und Kreuzanhängern nicht ausschloss . Diese Offenheit der heidnischen Religion führte aber dazu, dass zumindest am Ende der Übergangszeit auch Zweifel an der Macht der alten Götter geweckt werden konnten . Wurde aber erst einmal über die Macht der Götter oder die des eines Gottes debattiert, so waren die Christen im Vorteil, da es für sie feste Glaubenswahrheiten gab, während die Heiden über keine feste Begrifflichkeit in Glaubensdingen verfügten . Und noch aus einem anderen Grund erwies sich die Bedeutung der Rituale für die religiöse Praxis als Nachteil für die Heiden . Hatten nämlich die Christen erst einmal eine Vormacht in der Gesellschaft gewonnen, so fiel es ihnen auch deshalb leicht sich durchzusetzen, weil sie mit einem Verbot der alten Rituale letztlich die alte Religion zerstörten, wobei es, wie in Island um die Jahrtausendwende geschehen, ja schon genügte, die Rituale aus dem öffentlichen Leben zu verbannen, um das Heidentum schnell zu marginalisieren und vergessen zu machen . Inwieweit auch der Glaubensinhalt des Christentums, vor allem die Eschatologie, die Angst vor Strafen und der Erlösungsgedanke, dessen Verbreitung in Skandinavien selbst förderte, bleibt eine offene Frage .
Mit Sicherheit aber war der Glaubenswandel in der zweiten Hälfte des 10 . Jahr-hunderts das Phänomen, das es vor allem erlaubt, von einer Akkulturation zu sprechen . Schon weniger sollte man dies aber mit dem Vorbildcharakter des Fran-kenreichs erklären, da sich die Herrscher, die die Christianisierung herbeiführten, wie Harald Blauzahn oder Olaf Tryggvason in Norwegen, zum einen eher am angelsächsischen England orientierten, nicht zuletzt um dem Einfluss des ostfrän-kischen Reiches und des dortigen Missionsbistums Hamburg-Bremen zu entgehen . Vor allem aber sollte man die Bedeutung des fränkischen oder dann ostfränkischen Vorbildes nicht akzentuieren, weil gerade in der Phase des Glaubenswechsels, wie nicht nur das Monument in Jelling andeutet, der Wille, etwas Neues auch im Rück-griff auf die alten Traditionen zu schaffen, bei den Skandinaviern der Wikingerzeit gerade am stärksten ausgeprägt war .
Kerstin P . Hofmann
Akkulturation und die Konstituierung von Identitäten .Einige theoretische Überlegungen anhand des Fallbeispieles der hogbacks1
Einleitung
Kolonialismus ohne große Auswirkungen – ist dies möglich? Diese Frage würde vor dem Hintergrund unserer gesellschaftspolitischen Situation heute wohl kaum jemand so stellen . Umso überraschender fällt Dawn Hadleys positive Ant-wort für die skandinavische Okkupation des mittelalterlichen Englands aus, der von „ Invisible Vikings“ spricht .2 Eine der wenigen Fundgattungen, die allgemein als Zeugnisse skandinavischer Herrschaft angesprochen werden – hausförmige Steindenkmäler, die unter dem Begriff hogbacks firmieren – wurden von „colonial monuments“3 inzwischen zu „monuments denoting conversion“4 und „tools for assimilation“ .5 Sind diese also ein materieller Beleg für den scheinbar seltenen Fall einer Akkulturation bei Kolonisten?
Die Folgen von Kulturkontakt für Identitäten sind derzeit jedenfalls ein ge sell-schaftliches Schlüsselthema und werden daher auch in den verschiedensten Wissen-
1 Bei diesem Aufsatz handelt es sich um eine modifizierte Version eines bereits an anderer Stelle ver-öffentlichten Manuskriptes: Hogbacks . Zeugnisse akkulturierter Migranten?, in: Kaiser, Elke/Schier, Wolfram (Hg .): Mobilität und Wissenstransfer in diachroner und interdisziplinärer Pers-pektive (Topoi . Berlin Studies of the Ancient World 9), Berlin/Boston 2013, S . 173–208 . Es ist die Vorabpublikation einiger Überlegungen, die im Zusammenhang mit einer von mir anvisierten Arbeit über Identitäten und Ur- und Frühgeschichte stehen . Es handelt sich also um work in progress, deren aktuellen Stand der Dinge ich hier ausschnitt- und skizzenhaft zur Diskussion stelle, um dann anhand einer Materialgattung eine von vielen möglichen Interpretationen vorzustellen .
Der Aufsatz entstand im Rahmen meiner Tätigkeit als Koordinatorin der Cross Sectional Group V „Space and Collective Identities“ des Exzellenzclusters 264 „Topoi . The Formation and Transforma-tion of Space and Knowledge“, dessen Mitgliedern ich für die zahlreichen anregenden Diskussionen im Rahmen von Workshops, Lesezirkeln etc . sehr zu Dank verpflichtet bin . Für diverse Hinweise, die Einsicht in unpublizierte Manuskripte bzw . Korrekturvorschläge danke ich ganz herzlich: Carmen Marcks-Jacobs, Anne Pedersen, Sabine Pinter, Stefan Schreiber, Jörn Staecker, Jürgen Straub und Felix Wiedemann .
2 Hadley, Dawn: Invisible Vikings, in: British Archaeology 64 (2002), online im Internet: http://www .britarch .ac .uk/ba/ba64/feat2 .shtml (letzter Zugriff: 22 . 03 . 2012 um 16:00 Uhr) .
3 Lang, James T .: The Hogback: A Viking Colonial Monument, in: Anglo Saxon Studies in Archaeol-ogy and History 3 (1984), S . 85–176 .
4 Stocker, David A .: Monuments and Merchants: irregularities in the distribution of stone sculptures in Lincolnshire and Yorkshire in the tenth century, in: Hadley, Dawn M ./Richards, Julian D . (Hg .): Cultures in Contact . Scandinavian Settlement in England in the Ninth and Tenth Centuries, Turnhout 2000, S . 179–212, S . 198 .
5 Klayman, Melinda: The Anglo-Scandinavian Hogback: A Tool for Assimilation, online im Internet: http://www .klayperson .com/hogbacks/ (letzter Zugriff: 22 . 03 . 2012 um 16:30 Uhr) .
Kerstin P. Hofmann22
schaften verstärkt diskutiert . Dabei wird einhergehend mit Akkulturation oft von der Gefahr des Identitätsverlusts gesprochen .6 Man könnte somit Akkulturation und Identitätskonstituierung leichtfertig als nicht zeitgleich vorkommende und somit unvereinbare Phänomene ansehen . Dies würde jedoch zu einer dualistischen und unterkomplexen Betrachtungsweise führen . Der Untertitel des 2010 auf Schloss Gehrden bei Paderborn stattfindenden Workshops hieß „Zur Dialektik von Akkulturation und skandinavischer Identitätenkonstituierung während der Wikingerzeit“ . Der ihm innewohnenden Aufforderung zur Reflexion soll daher hier nachgegangen werden . Vor dem Hintergrund räumlich verorteter materieller Kultur gilt es, sich mit den Konzepten Akkulturation und Identität näher ausei-nanderzusetzen . Als Fallbeispiel dienen mir die eben bereits genannten hogbacks, die zwar nicht dem eigentlichen Referenzgebiet des Workshops entstammen, aber anhand derer einige Aspekte von kulturellem Wandel durch Kulturkontakt m . E . besonders gut beleuchtet werden können .
Identität
Beim Menschen steht Identität als Selbstheit einer Person oder Gruppe/Entität nicht wie in der Mathematik oder Logik für ‚vollkommene Gleichheit‘ oder ‚Über-einstimmung‘, sondern wird als dynamische und fragile „Einheit ihrer (diachronen und synchronen) Differenzen“ bzw . „Synthesis des Heterogenen“7 durch sich von anderen distanzierende sowie zu sich selbst und anderen verhaltene Subjekte gebil-det .8
Die prozessuale Konstruktion von Identitäten basiert demnach auf einem Wechsel spiel zwischen Inklusion und Exklusion und geht stets mit dem Aufbau von Alteritäten – ‚übersetzbaren‘ Andersheiten – und der Abgrenzung zur Alieni-tät – ‚radikaler Andersheit‘ – einher (Abb . 1) . Die dabei erfolgenden Grenzziehun-gen können sehr unterschiedlich ausfallen . Sie hängen von der jeweiligen Situation und den Wahrnehmungs- und Bewertungsdifferenzen in den Selbst- und Fremdzu-schreibungen ab .9 Identität umfasst sowohl „Gleichheit“ als auch „Differenz“, also einerseits „dazugehören so ähnlich wie“ und anderseits „besonders sein im Unter-schied zu“ .10
6 Siehe z . B . Berry, John W .: Acculturation as Varieties of Adaptation, in: Padilla, Amado M . (Hg .): Acculturation . Theory, Models and Some New Findings, Boulder 1980, S . 9–25, S . 13f .
7 In Anlehnung an Paul Ricœurs Bezeichnung für den Prozess des ‚Emplotment‘ bei Erzählungen; Ricœur, Paul: Zeit und Erzählung, Bd . 1: Zeit und historische Erzählung, München1988, S . 106 .
8 Straub, Jürgen: Identität, in: Konersmann, Ralf (Hg .): Handbuch Kulturphilosophie, Stuttgart 2012, S . 334–339 .
9 Vgl . Brather, Sebastian: Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie . Geschichte, Grundlagen und Alternativen (RGA, Ergänzungsbd . 42), Berlin/New York 2004, S . 97–103 .
10 Byron, Reginald: Identity, in: Barnard, Allan/Spencer, Jonathan (Hg .): Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, London/New York 1997, S . 292 .
Akkulturation und die Konstituierung von Identitäten 23
Die Zugehörigkeiten ergeben sich jedoch nicht allein aus ‚bloß Konstruiertem‘ oder aus – mehr oder minder willkürlich – Imaginiertem, sondern basieren auf Erfahrungen, Überzeugungen und Gefühlen der Gruppenmitglieder,11 die inner-halb der betreffenden Entität auch ‚verdinglicht‘ werden können .12 Zu beachten ist jedoch, dass identitäre Gefühle und Gedanken „(lebens-)geschichtlichen Wandel sowie ein in sich vielfältiges Selbst in der Gegenwart mithin eine unabänderlich differentielle, transitorische und heterogene Struktur des Subjekts“13 voraussetzen . Identität ist folglich ein Prozess ständiger Anpassung und Modifikation . Sie spielt allerdings nur dann eine Rolle, wenn sich das Selbst oder das Andere in dynamisch wandelnden Welten differenziert und eine Antwort auf die sich daher stellende Identitäts- bzw . Alteritätsfrage nicht eindeutig ist und somit ein virulentes Problem darstellt .14 Deshalb stellt Jürgen Straub15 die universale Anwendung des für spät-moderne Gesellschaften der westlichen industrialisierten Welt des 19 . Jahrhunderts entwickelten Identitätsbegriffs zu Recht in Frage . Trotz seiner Zweifel an einer sinnvollen Übertragung auf vormoderne Zeiten, halte ich jedoch die Adaption
11 Vgl . Keupp, Heiner/Ahbe, Thomas/Gmür, Wolfgang/Höfer, Renate/Mitzscherlich, Beate/Kraus, Wolfgang/Straus, Florian: Identitätskonstruktionen . Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne, Hamburg 42008 .
12 Berger, Peter L ./Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit . Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt a . M . 172000, S . 94f .
13 Straub: Identität (Anm . 8) .14 Ibid .15 Straub, Jürgen: Personale und kollektive Identität . Zur Analyse eines theoretischen Begriffs, in:
Assmann, Aleida/Friese, Heidrun (Hg .): Identitäten . Erinnerung, Geschichte, Identität, Bd . 3, Frankfurt a . M . 1998, S . 73–104, S . 82f .
Abb . 1: Identitäten – Alteritäten – Alienität; vgl . Assmann: Das kulturelle Gedächtnis (Anm . 23), S . 131f .
Kerstin P. Hofmann24
des Identitätskonzeptes auch auf (prä)historische Zeiträume nachweislich großen Wandels – z . B . in sog . Innovationshorizonten –, für die zugleich hohe soziale und räumliche Mobilität angenommen werden kann, nach den oben grob abgesteckten Rahmenbedingungen für legitim und gewinnbringend .
Üblicherweise wird Identität im Gegensatz zu Nicht-Identisch dualistisch konstruiert . Dies greift jedoch zu kurz . Es sollte nach Jürgen Straub16 vielmehr von einem Begriffsnetz ausgegangen werden . Er spricht sich mindestens für eine triadische Struktur aus: Identität sei in einem Kontinuum zwischen den durch die Begriffe Totalität und Multiplizität aufgespannten Extremen anzusiedeln (Abb . 2) . Während die Multiplizität zu einer Zerrissenheit und Handlungsunfähigkeit füh-ren kann, sei die Totalität eine regide, gegen Fremdes und Neues abgeschottete, starr auf ihre eigene Reproduktion bedachte Zwangsstruktur . Letztere stand in der Archäologie lange Zeit Pate, wenn von kollektiven Identitäten die Rede war, näm-lich dann, wenn essentialistisch anhand einzelner äußerer Merkmale und Dinge auf situationsunabhängige, meist ethnische Identitäten rückgeschlossen wurde . Letztlich ist zwar für kollektive Identitäten – aufgrund der ihr fehlenden Leib-lichkeit mit Erlebenspotential sowie Bewusstsein und der dadurch stärker drohen-den Fragmentierung – die nähere Positionierung zur Totalität eine immer wieder praktizierte Lösungsstrategie . Diese führt allerdings häufig aufgrund der dadurch bedingten Abkoppelung von Neuerungen sowie der entstehenden Konflikte bei Fremdkontakten zu gravierenden Problemen, die dann meist auch zu einer zeitli-chen Begrenzung der Totalität führen .
Bei jeder kollektiven Identität stellt sich demnach zuallererst immer die Frage nach der Konstitution und Begründung des betreffenden Kollektivs selbst .17 Hierfür werden häufig gemeinsame Merkmale, eine für alle ‚bindende‘ und ‚verbindliche‘ geschichtliche Kontinuität und praktische Kohärenz angeführt . Ihre Inszenierung und Repräsentation spielen für kollektive Identitäten eine große Rolle . Hierfür sind bleibende ‚Lebenselemente‘ – wie Rituale und Routinen, Erzählungen, aber z . B . auch Erbstücke oder Archaika – von besonderer Bedeutung .18 Es darf dabei jedoch nicht vergessen werden, dass kollektive Identitäten Konstrukte sind und
16 Straub: Identität (Anm . 8); ders ./Chakkarath, Pradeep: Identität und andere Formen des kul-turellen Selbst . Vernunft, Liebe und die Wurzeln der Identität, in: Familiendynamik 35/2 (2010), S . 2–11, S . 6; vgl . Erikson, Erik H .: Das Problem der Ich-Identität, in: ders .: Identität und Lebens-zyklus . Drei Aufsätze, Frankfurt a .M . 1973, S . 123–224 .
17 Straub: Personale und kollektive Identität (Anm . 15), S . 98 .18 Straub: Identität (Anm . 8) .
Abb . 2: Die triadische Pragma-Semantik von Identität, Totalität und Multiplizität (vgl . Straub: Iden-tität [Anm . 8]) .
Akkulturation und die Konstituierung von Identitäten 25
nur insofern existieren, als es Individuen gibt, die sich zu ihnen aufgrund von zu spezifizierenden Gemeinsamkeiten im Verhalten und im Selbst- und Weltverständ-nis bekennen .19 Die Grenze zu den definierten Alteritäten ‚du‘ und ‚ihr‘ kann je nach Situation unterschiedlich verlaufen . Hier ist eine grundsätzliche Kenntnis des Anderen und seiner Identitätsstruktur vorhanden . Während die Alienität ‚sie‘ als Sammelbezeichnung für fremde Personengruppen fungiert, die aufgrund ihrer größeren kulturellen und sozialen Distanz in ihrer Untergliederung unverstanden bleiben (Abb . 1) .
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Der hier vorgestellte Identitätsbe-griff ist multipel – nicht binär –, prozessual und praxeologisch fundiert, subjekt-orientiert – aber nicht subjektzentriert –, sondern relational, entontologisiert und entessentialisiert .20
Von archäologischer Seite ist es nicht einfach, einem solchen Identitätsbegriff gerecht zu werden, fehlt es doch gewöhnlich an Selbstaussagen der Akteure . Wir können nur anhand der überlieferten materiellen Kultur auf mögliche Identitäts-diskurse rückschließen . Vielfach wurde daher versucht, nach sogenannten Iden-titätsmarkern zu suchen .21 Häufig handelt es sich hierbei um als Trachtelemente angesprochene Kleidungsstücke – insbesondere Fibeln und Gürtel – oder aber um Waffen .22 Ein gravierendes Problem ist hierbei jedoch, dass ein etwaiger derartiger Zeichengehalt von Objekten nicht in diese unveränderlich eingeschrieben, sondern er situativ- und kontextgebunden ein Produkt kulturspezifischer Bedeutungszu-schreibungen ist . Statt nach statischen Zuständen, gilt es, nach dem materiellen Niederschlag von identitätskonstituierenden Akten und denen von Identitätsdis-kursen zu suchen .
In diesem Zusammenhang ist die von Aleida und Jan Assmann23 auf Grund-lage von Maurice Halbwachs‘ Konzept der mémoire collective 24 entwickelte Idee, zwischen ‚kommunikativem Gedächtnis‘ und ‚kulturellem Gedächtnis‘ zu unter-scheiden, von Interesse . Das kulturelle Gedächtnis würde durch ‚extra-humane Speicher‘ wie Monumente, Bilder, Schrift(stücke), aber auch durch Architektur bzw . archäologische Befunde, die durch Repräsentationsakte semiotisch konno-
19 Straub: Personale und kollektive Identität (Anm . 15), S . 102ff .20 Siehe auch: Gehrke, Hans-Joachim/Hofmann, Kerstin P .: Plenartagungsbericht der Cross Sec-
tional Group V ‚Space and Collective Identities‘, in: Fless, Friederike/Grasshoff, Gerd/Meyer, Michael (Hg .): Berichte der Forschergruppen auf der Topoi-Plenartagung 2010 (eTopoi . Journal for Ancient Studies, Sonderbd . 1 [2011] . http://journal .topoi .org .), S . 5f .
21 Vgl . Müller-Scheessel, Nils/Burmeister, Stefan: Einführung: Die Identifizierung sozialer Gruppen . Die Erkenntnismöglichkeiten der Prähistorischen Archäologie auf dem Prüfstand, in: dies . (Hg .): Soziale Gruppen – kulturelle Grenzen . Die Interpretation sozialer Identitäten in der prähisto-rischen Archäologie (Tübinger Archäologische Taschenbücher 5), Münster 2006, S . 9–38 .
22 Vgl . z .T . äußerst kritisch hierzu: Brather: Ethnische Interpretationen (Anm . 9); Burmeister, Stefan: Zum sozialen Gebrauch von Tracht . Aussagemöglichkeiten hinsichtlich des Nachweises von Migrationen, in: Ethnogr .-Arch . Zeitschr . 38 (1997), S . 177–203 .
23 Vgl . Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis . Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 21997; Assmann, Aleida: Erinnerungsräume . Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999 .
24 Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt a . M . 41991 .
Kerstin P. Hofmann26
tiert sind, gestützt, verdinglicht und könne so längere Zeiträume überbrücken . Die Analyse dieser Zeugnisse für das Selbstverständnis historischer Gemeinschaften bezeichnete Hans-Joachim Gehrke25 vor einigen Jahren als Königsweg zur kollek-tiven Identität . Inzwischen viel rezipiert, ist das allerdings stark nationalistische Konzept der lieux de mémoires, der Erinnerungsorte, des französischen Historikers Pierre Nora .26 Nach ihm kristallisiert sich das kollektive Gedächtnis einer sozialen Gruppe an bestimmten ‚Orten‘ – metaphorisch auch auf Personen, Ereignisse und literarische Werke übertragbar – aus . Diese besitzen eine besonders aufgeladene, symbolische Bedeutung, die für die jeweilige Gruppe identitätsstiftende Funktion hat . Eine Idee, die sicherlich auch gewinnbringend z . B . für Zülpich, Aachen, aber auch Jellinge27 ist bzw . schon war, aber auch auf weniger spektakuläre Orte wie Friedhöfe im Allgemeinen angewandt werden kann . Zu beachten ist jedoch, dass Orte und Gegenstände zwar durch ihr Da-Sein zur Reflexion anregen und somit Hilfsmittel für die Aufrechterhaltung eines kulturellen Gedächtnisses sein können, es sich jedoch nicht um Speichermedien im eigentlichen Sinne handelt, denn es bedarf dennoch stets einer kommunikativen Vermittlung .28 Auf deren Existenz kann jedoch archäologisch höchstens indirekt rückgeschlossen werden . Indizien hierfür sind u . a . wiederholt an bestimmten Plätzen durchgeführte Rituale oder Raumbezüge zu Vorgängerbauten . Doch schon die Unterscheidung von konti-nuierlicher Belegung von Bestattungsplätzen und Wiederaufnahmen bzw . Denk-malbestattungen bereitet mitunter Schwierigkeiten . Ob es sich bei letzteren dann um eine ‚invented tradition‘,29 also das Wiederbeleben kultureller Überlieferungen beziehungsweise um einen instrumentalisierten Rückgriff auf die Ressource Ver-gangenheit, handelt, ist dann meist nur noch mehr oder minder gut spekulierbar .30
25 Gehrke, Hans-Joachim: Troia im kulturellen Gedächtnis, in: Zimmermann, Martin (Hg .): Der Traum von Troia . Geschichte und Mythos einer ewigen Stadt, München 2006, S . 211–225, S . 211 .
26 Nora, Pierre: Zwischen Geschichte und Gedächtnis . Die Gedächtnisorte, in: ders . (Hg .): Zwischen Geschichte und Gedächtnis (Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek 16), Berlin 1990, 11–33 .
27 Pollak, Marianne: Vom Erinnerungsort zur Denkmalpflege . Kulturgüter als Medien des kultu-rellen Gedächtnisses (Studien zu Denkmalschutz und Denkmalpflege 21), Wien 2010, S . 39; vgl . Pedersen, Anne: The Jelling Monuments – ancient royal memorial and modern world heritage site, in: Stoklund, Marie/Lerche Nielsen, Michael/Holmberg, Bente/Fellows-Jensen, Gillian (Hg .): Runes and Their Secrets . Studies in Runology, Copenhagen 2006, S . 283–314 .
28 Vgl . Dolff-Bonekämper, Gabi: Memorable moments – chosen cultural affiliations, in: Blaive, Muriel/Gerbel, Christian/Lindenberger, Thomas (Hg .): Clashes in European Memory . The Case of Communist Repression and the Holocaust (Studies in European History and Public Spheres 2), Innsbruck u . a . 2011, S . 143–153 .
29 Hobsbawm, Eric: Introduction: Inventing Traditions, in: ders ./Ranger, Terence (Hg .): The Inven-tion of Tradition, Cambridge 1983, S . 1–14 .
30 Vgl . Hofmann, Kerstin P .: Kontinuität trotz Diskontinuität? Der Wechsel von der Körper- zur Brandbestattung im Elbe-Weser-Dreieck und die semiotische Bedeutungsebene „Raum“, in: Bérenger, Daniel/Bourgeois, Jean/Talon, Marcel/Wirth, Stefan (Hg .): Gräberlandschaften der Bronzezeit/Paysages funéraires de l‘Age du Bronze . Internationales Kolloquium zur Bronzezeit/Colloque International sur l’Age du Bronze . Herne, 15 .–18 . Oktober 2008/Herne, 15–18 octobre 2008, Darmstadt 2012, S . 355–373 .
Akkulturation und die Konstituierung von Identitäten 27
Akkulturation
Durch Kulturkontakt evozierter Kulturwandel wird insbesondere in den deutsch-sprachigen Altertumswissenschaften – trotz z . T . heftiger Kritik31 – immer noch gern unter dem Oberbegriff ‚Akkulturation‘ geführt .32 Der in der Ethnologie bzw . cultural anthropology Ende des 19 . Jahrhunderts in zahlreichen Kulturkontakt- Studien allerdings relativ unsystematisch verwendete Terminus33 wurde 1932 von Richard Thurnwald als sozio-psychologischer Prozess34 und 1935 durch Robert Redfield, Ralph Linton und Melville Herskovits im „Memorandum for the Study of Acculturation“ methodologisch fundiert . Die im Memorandum veröffentlichte Definition dient, trotz der seit dem Erscheinen verschiedentlich geäußerten Kri-tik,35 heute immer noch allgemein als Referenzpunkt: „Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original patterns of either or both groups“,36 und dies obwohl sich der Anwendungsbereich
31 Es gibt zahlreiche Kritiker des Akkulturationskonzeptes, z . B . Murphy, Robert F .: Social Change and Acculturation, in: Transactions of the New York Academy of Sciences 26 (1964), S . 845–854; Barth, Fredrik: On the Study of Social Change, in: American Anthropologist 69 (1967), S . 661–669 . In der Ethnologie und Soziologie gilt der Akkulturationsansatz als Produkt einer zweifelhaften, strukturfunktionalistischen Vergangenheit zumeist als überholt . Mit ihm sei im Zeitalter des Kolo-nialismus ein ausbeuterisches soziales System wissenschaftlich unterstützt worden und anstelle seiner simplen Konzeptualisierung von Kulturwandel, bedürfe es vielmehr einer stärker differenzierenden Analytik kulturellen Austausches . Auch wenn ich vielen der vorgebrachten Kritikpunkte zustimme, scheint es mir bis zur Invention eines geeigneteren, politisch nicht so belasteten Begriffes dennoch sinnvoll, gerade in der Archäologie Akkulturation als Oberbegriff für durch Fremdkontakt ausgelösten soziokulturellen Wandel zu verwenden, da viele der neueren Ansätze häufig auf einer in der Archäo-logie so nicht vorhandenen Quellenbasis fundieren und/oder sie häufig nur bestimmte Aspekte und Relationen näher beleuchten; vgl . Ervin, Alexander M .: A Review of the Acculturation Approach in Anthropology with Special Reference to Recent Change in Native Alaska, in: Journal of Anthropolo-gical Research 36 (1980), S . 49–70, S . 49 .
32 Z . B . Gotter, Ulrich: ‚Akkulturation‘ als Methodenproblem der historischen Wissenschaften, in: Altekamp, Stefan/Hofter, Matthias René/Krumme, Michael (Hg .): Posthumanistische Klassi-sche Archäologie . Historizität und Wissenschaftlichkeit von Interessen und Methoden, München 2001, S . 255–280; Hägermann, Dieter/Haubrichs, Wolfgang/Jarnut, Jörg (Hg .): Akkultura-tion . Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem Mittelalter (RGA, Ergänzungsbd . 41), Berlin/New York 2004; Meyer, Marion: Akkulturationsprozesse – Ver-such einer Differenzierung, in: dies . (Hg .): Neue Zeiten – Neue Sitten . Zur Rezeption und Integra-tion römischen und italischen Kulturgutes in Kleinasien (Wiener Forschungen zur Archäologie 12), Wien 2007, S . 9–18 .
33 Vgl . Stagl, Justin: Fremdheit und Akkulturation, in: Neohelicon 23 (1996), S . 61–76, S . 71f . Für einen Überblick zu frühen Verwendungen des Begriffs siehe Herskovits, Melville J .: Acculturation: the Study of Culture Contact, Gloucester Mass . ²1958, S . 2–12 .
34 Thurnwald, Richard: The Psychology of Acculturation, in: American Anthropologist 34 (1932), S . 557–569 .
35 Siehe Beals, Ralph L . (1953): Acculturation, in: Kroeber, Alfred L . (Hg .): Anthropology today: An Encyclopedic Inventory (Kongress New York 1952), Chicago 1953, S . 621–641, S . 626 .
36 Redfield, Robert/Linton, Ralph/Herskovits, Melville J .: Memorandum for the Study of Accul-turation, in: American Anthropologist 38/1 (1936), S . 149–152, S . 149 .
Kerstin P. Hofmann28
des Akkulturationsbegriffes inzwischen wesentlich erweitert hat, z . B . auf ‚second hand contacts‘ .37
Das nach 1935 immer weiter entwickelte Akkulturationskonzept38 ist somit letztlich ein Versuch, für die Beschreibung exogen angeregten Kulturwandels ein Analysesystem zur Verfügung zu stellen, welches die Adaption von Entlehnungen thematisiert . Ihm liegt herkömmlich ein holistischer Kulturbegriff zugrunde, der alle Bereiche, auch Politik und Wirtschaft, umfasst, ohne auf die Antithese zwischen Natur und Kultur Bezug zu nehmen . Es stehen sich dabei einzelne, im Wesentlichen hermetisch gedachte Entitäten gegenüber . Dies entspricht jedoch nicht mehr unserem heutigen Verständnis von Gesellschaften, deren dynamische innere Gliederung es stets auch zu berücksichtigen gilt .39 Es bedarf also eines Kul-turkonzeptes, das ermöglicht, akteursorientiert Wandel durch Kulturkontakt unter Berücksichtigung intrakultureller Heterogenität zu analysieren . Diesen Anfor-derungen entspricht derzeit m . E . am ehesten der Ansatz von Andreas Wimmer, welcher Kultur als Kompromiss wie folgt definiert: „[…] so wäre Kultur als ein offener und instabiler Prozeß des Aushandelns von Bedeutungen zu definieren, der kognitiv kompetente Akteure in unterschiedlichen Interessenlagen zueinander in Beziehung setzt und bei einer Kompromissbildung zur sozialen Abschließung und entsprechenden kulturellen Grenzmarkierung führt .“40 Die in Kontakt tretenden Kulturen sind demnach nicht Totalitäten, sondern im zuvor beschriebenen kom-plexen, prozesshaften Verständnis kollektive Identitäten . Durch die damit einher-gehende Relationalisierung und Dynamisierung kommt es allerdings mitunter zu Auflösungserscheinungen der in der Definition binär bestimmten Analyseeinhei-ten, sprich, es fällt schwer bzw . ist unmöglich, z . B . Angel-Sachsen oder Franken und Skandinavier so strikt zu trennen . Dies gilt insbesondere für die langen Zeit-räume, die gewöhnlich in der Archäologie untersucht werden .
Im Rahmen der sozialpsychologischen Akkulturationsforschung wurde z . B . festgestellt, dass in kulturellen Überschneidungssituationen – neben Geschlecht, Alter, Status etc . als Einflussfaktoren – bei Personen häufig vier Typen der Ver-haltensregulation unterschieden werden können (Abb . 3): Der ‚Assimilationstyp‘
37 Rudolph, Wolfgang: „Akkulturation“ und Akkulturationsforschung, in: Sociologus 14 (1965), S . 97–113, S . 101f .
38 Z . B . The Social Science Research Council Summer Seminar on Acculturation, 1953: Acculturation: An Exploratory Formulation, in: American Anthropologist 56 (1954), S . 873–1000; Berry: Accul-turation (Anm . 6) .
39 Gotter: Akkulturation (Anm . 32), S . 269; siehe auch Kokot, Waltraud: Ethnologische Ansätze zur Akkulturationsforschung, in: Hitzl, Konrad (Hg .): Methodische Perspektiven in der Klassischen Archäologie . Akten der Tagung des Deutschen Archäologen-Verbandes am 19 . Juni 2004 in Freiburg (Schriften des Deutschen Archäologen-Verbandes 16), Tübingen 2005, S . 17–25, S . 23 .
40 Wimmer, Andreas: Kultur . Zur Reformulierung eines sozialanthropologischen Grundbegriffs, in: KZfSS 48 (1996), S . 401–425, S . 413 . Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit seinem Kulturbe-griff ist in diesem Rahmen leider nicht möglich . Für einen Überblick über die aktuelle Diskussion sie-he: Sutter, Alex: Randbemerkungen zu einer Reformulierung des Kulturbegriffs, in: Tsantsa . Zeit-schrift der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft 4 (1999), S . 107–110; Moebius, Stephan/Quadflieg, Dirk (Hg .): Kultur . Theorien der Gegenwart, Wiesbaden 2006; Khan-Svik, Gabriele: Kultur – ethnologisch betrachtet, in: Paideia 5/1 (2008), S . 1–21 .
Akkulturation und die Konstituierung von Identitäten 29
lehnt die alte eigene Kultur ab und integriert die Werte, Normen, Verhaltensweisen und Zeichensysteme der neuen Kultur problemlos in sein eigenes Handeln . Der ‚Kontrasttyp‘ sieht die eigene Kultur als überlegen an und lehnt die Fremdkultur ab . Für den ‚Grenztyp‘ haben beide Kulturen bedeutungsvolle Elemente, die für ihn jedoch inkompatibel sind, er schwankt daher ständig zwischen dem eigenen und dem fremden Orientierungssystem . Dem ‚Synthesetyp‘ gelingt es hingegen, Elemente beider Kulturen zu kombinieren, was zu einer multikulturellen Identität führen kann .41
Generell stellt sich die Frage, wie einzelne Handlungen, Individuen, personale sowie kollektive Identitäten verschiedener Größenordnungen und ihre jeweiligen Akkulturationsverhalten wechselwirken . Letztlich sind die Interdependenzen der
41 Bochner, Stephen: The social psychology of cross-cultural relations, in: ders . (Hg .): Cultures in contact: Studies in cross-cultural interactions, Oxford 1982, S . 5–44; siehe auch Thomas, Alexan-der: Grundriß der Sozialpsychologie, Bd . 2: Individuum – Gruppe – Gesellschaft, Göttingen 1992, S . 326f .; online im Internet: www .uni-regensburg .de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Psychologie/Thomas/lehre/Intkultpsychologie/Folien0506/Kapitel_11 .ppt; zu beachten ist, dass es sich hierbei nicht um eine Persönlichkeitstypologie handelt, sondern nur die gängigsten Einstellungs- und Handlungsten-denzen aufzeigt werden sollen, die sich zudem gegenstandsbezogen und situativ verändern können .
Abb . 3: Veränderungstypen kultureller Identität in kulturellen Überschneidungssituationen nach Boch-ner (Grafik von Alexander Thomas leicht modifiziert; online im Internet: www .uni-regensburg .de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Psychologie/Thomas/lehre/Intkultpsychologie/Folien0506/Kapitel_11 .ppt – letzter Zugriff: 27 . 03 . 2012 um 20:55 Uhr)
Kerstin P. Hofmann30
einzelnen Ebenen ein nur transdisziplinär anzugehendes Forschungsdesiderat . Es werden damit so komplexe Themen angerissen wie die Bedeutung des Individuums für die Gruppe bzw . der Gruppe für das Individuum und seine Handlungen, die hier aber nicht näher behandelt werden können .
Das zweite fundamentale Problem bei der Übertragung des Akkulturations-konzeptes auf historische Gegebenheiten ergibt sich dadurch, dass Kulturkontakte üblicherweise ein Dauerphänomen darstellen, so dass Anfang und Ende schwer zu bestimmen sind . Bei Gruppen bzw . Personen, die endemischen Austausch mit anderen pflegen, verliert das Akkulturationskonzept seine heuristische Prägnanz .42 Sinnvoll untersucht werden können daher eigentlich nur durch Mobilität entste-hende Fremdkontakte und deren Folgen . Es muss stets eine – wie auch immer gear-tete – kulturelle Grenze zwischen den untersuchten Entitäten bestehen .43
Als drittes Problem des Akkulturationskonzeptes wird heute allgemein die fehlende Berücksichtigung der Dynamik von Kulturkontakten angesehen .44 Sie ist m . E . nur unter Einschränkungen überhaupt möglich . Eine denkbare Erweite-rung des Akkulturationskonzeptes bietet Urs Bitterlis Klassifikation von Kultur-kontakten,45 die vor allem im deutschen Sprachraum sehr einflussreich war und ist .46 Ausgehend von Fallstudien, in denen Begegnungen zwischen Europäern und Nichteuropäern in der Neuzeit thematisiert wurden, unterschied der Schweizer Historiker Bitterli zwischen vier Typen des Kulturkontaktes, die nicht als genetisch eindeutige Reihe zu verstehen sind: 1) die punktuellen Kulturberührungen, bei denen es sich meist um oberflächliche (Erst-)Kontakte zwischen Kolonisatoren und der indigenen Bevölkerung handelt . 2) den konfliktuellen, mehr oder min-der gewaltsamen Kulturzusammenstoß von unterschiedlicher Intensität . Dieser kann von sporadischen Raubzügen bis zur militärischen Eroberung variieren .47
42 Gotter: Akkulturation (Anm . 32), S . 268 .43 Gotter, Ulrich: Zwischen Südsee, Paris und Sanssouci . Konzepte von Kulturtransfer und der fri-
derizianische Hof, in: Friedrich300 – Colloquien, Friedrich der Große – Politik und Kulturtrans-fer im europäischen Kontext . Beiträge des vierten Colloquiums in der Reihe „Friedrich300“ vom 24 ./25 . September 2010 . Online im Internet: http://www .perspectivia .net/content/publikationen/ friedrich300-colloquien/friedrich-kulturtransfer/gotter_kulturtransfer (Stand 14 . 02 . 2012 um 14:25 Uhr; letzter Zugriff: 25 . 03 . 2012 um 13:45 Uhr), § 31 und § 32; vgl . Osterhammel, Jürgen: Kulturelle Grenzen in der Expansion Europas, in: Saeculum 46 (1995), S . 101–138 .
44 Gotter: Akkulturation (Anm . 32), S . 275; Kokot: Ethnologische Ansätze (Anm . 38), S . 23f .45 Bitterli, Urs: Kulturbegegnung und Kulturzusammenstoß in der Sicht des Kolonialhistorikers, in:
Wendehorst, Alfred/Schneider, Jürgen (Hg .): Begegnungsräume von Kulturen . Referate des 4 . interdisziplinären Colloquiums des Zentralinstituts (Schriften des Zentralinstituts für Fränkische Landeskunde und allgemeine Regionalforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg 21), Neustadt a . d . Aisch 1982, S . 75–88; ders .: Alte Welt – neue Welt . Formen des europäisch-überseeischen Kul-turkontakts vom 15 . bis zum 18 . Jahrhundert, München 1986, S . 17–54; ders .: Die ‚Wilden‘ und die ‚Zivilisierten‘ . Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der europäisch-überseeischen Begeg-nung, München ²1991, S . 81–179 .
46 Siehe z . B . Gotter: Akkulturation (Anm . 32), S . 270ff .; Münkler, Marina: Erfahrungen des Frem-den . Die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13 . und 14 . Jahrhunderts, Berlin 2000, S . 14–20; Osterhammel: Kulturelle Grenzen (Anm . 43), S . 106f .
47 Marina Münkler schlug vor, sowohl im Hinblick auf territoriale als auch kulturelle Hegemoniean-sprüche zwischen peripherem und zentralem Kulturzusammenstoß zu unterscheiden; Münkler: