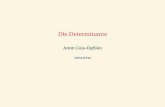Die urnenfelderzeitliche Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil - Prospektionsbericht 2013
Transcript of Die urnenfelderzeitliche Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil - Prospektionsbericht 2013
Bericht über die Rammkernsondierungen RKS 1–9 in der urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung von Prigglitz-Gasteil im südöstlichen Niederösterreich
Mag. Dr. Peter TREBSCHE
Urgeschichtemuseum Niederösterreich
Schlossgasse 1
2151 Asparn an der Zaya
2
03 Bericht Teil B – Gesamtdarstellung der Maßnahme
PRIGGLITZ-GASTEIL BOHRUNG 2013
Maßnahmennummer: 23134.13.2
Maßnahmenbezeichnung: Prigglitz-Gasteil Bohrung
Bundesland: Niederösterreich
Verwaltungsbezirk: Neunkirchen
Katastralgemeinde: Prigglitz
Flurname/Adresse: Gasteil Nr. 7 (Gruberhof)
Grundstücks-Nummern: 1393/1, 1395, 1397/1, 1399/2 (EZ 45)
Anlass für die Maßnahme: Forschungsprojekt
Durchführungszeitraum: 8.7.2013 bis 11.7.2013
Fundverbleib: Urgeschichtemuseum Niederösterreich, Asparn an der Zaya, Inv.-Nr. 22692
Ausführende Institution: Urgeschichtemuseum Niederösterreich, Schlossgasse 1, 2151 Asparn an der
Zaya
Autor des Berichts: Mag. Dr. Peter TREBSCHE, Urgeschichtemuseum Niederösterreich, Schlossgasse
1, 2151 Asparn an der Zaya, Email: [email protected]
Anlass der Prospektionsmaßnahme Im Rahmen des Forschungsprojektes zur urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung von Prigglitz-Gasteil,
das vom Urgeschichtemuseum Niederösterreich durchgeführt und von der Kulturabteilung des Landes
Niederösterreich finanziert wird, fanden begleitend zu den Ausgrabungen (Maßnahmennummer
23134.13.01) auch Prospektionen mittels Rammkernsondierung statt.1 Bei den seit 2010 jährlich
durchgeführten Ausgrabungen hatte sich herausgestellt, dass bislang in keiner der untersuchten
Flächen 1–6 der anstehende Fels bzw. der zu erwartende natürliche Hangschutt aus kalkalpinen
Gesteinen erreicht wurde. Die Mächtigkeit der urnenfelderzeitlichen Kulturschichten sowie der
darunterliegenden Bergbauhalden sind nach wie vor unbekannt. Um Einblick in den Schichtaufbau der
Halden zu gewinnen und um die alte Geländeoberfläche vor Beginn des Bergbaus in Gasteil zu
erreichen, wurde die Firma Balon aus Poysdorf mit der Durchführung von Rammkernsondierungen
beauftragt.
1 Literatur zur Fundstelle und zu den Grabungen ist im Bericht zu Maßnahme 23134.13.01 angeführt.
3
Topographie Bei mehreren Begehungen des anthropogen stark veränderten Geländes der Fundstelle Gasteil mit dem
Geologen Günther Weixelberger (Ingenieurbüro für Geologie, Pitten) und dem Mineralogen Michael
Götzinger (Institut für Mineralogie und Kristallographie der Universität Wien) wurden geeignete
Stellen für die Rammkernsondierungen festgelegt. Dabei musste Bedacht auf die Möglichkeiten für
den Transport und die Aufstellung der Rammkernsonde genommen werden, die auf einem
Raupenfahrzeug montiert war. Zunächst wurden neun Sondierungspunkte im Gelände markiert
(Abb. 1), wobei die Punkte 1 bis 3 in einer Flucht auf dem Scheitel der „Großen Halde“ lagen. Die
Punkte 4 bis 9 sollten sämtliche sichtbaren Terrassierungen südlich der „Sandgrube“ erfassen (von der
westlichsten, obersten Terrasse im Wald bis zur östlichsten, untersten Terrasse direkt oberhalb der
Landesstraße). Der Punkt 5 wurde knapp unterhalb der Grabungsflächen 4 bzw. 5, der Punkt 8 wenig
südlich von Fläche 1 und der Punkt 1 im vermuteten Bereich von Hampls Schnitt 1 (1956) angelegt,
um einen Vergleich mit den durch Grabung gewonnenen Profilaufschlüssen zu gewinnen und die
Fortsetzung der Stratigraphie außerhalb der Grabungsflächen untersuchen zu können.
Technischer Bericht Die Rammkernsondierungen wurden von Josef Balon mit einem Gerät der Firma Geotool, Type GTR
780 GHB durchgeführt (Abb. 2). Der Durchmesser der Schlitzsonden betrug von 0–1 m 80 mm, von
1–5 m 60 mm und ab 5 m bis Endteufe 50 mm. Das Schlaggewicht betrug 63,5 kg, die Fallhöhe 750
mm. Die Schlagzahlen pro Dezimeter Eindringtiefe wurden händisch aufgezeichnet und durch
Günther Weixelberger in Diagrammen dargestellt (siehe Anhang zum Bericht Weixelberger). Alle
Sondierungen wurden bis auf 7 m Teufe geführt, danach war ein Nachschlagen der Sonden durch den
Verbruch der dünnen Sondagelöcher nicht mehr möglich.
Das Sediment aus den Schlitzsonden wurde entnommen und auf mit Plastikfolie abgedeckter
Dachwellpappe aufgelegt. Anschließend erfolgt die fotografische Dokumentation der Rammkerne mit
einer digitalen Spiegelreflexkamera Canon EOS 1000D. Die Rammkerne wurden von der
Geologiestudentin Mag. Andrea Blümel im Maßstab 1:20 auf Millimeterpapier gezeichnet und
sedimentologisch beschrieben. Dabei wurden die Kulturschichten fortlaufend von 1 bis 34 nummeriert
(KS1–34). Die Befunde wurden im Beisein von Günther Weixelberger, Michael Götzinger sowie von
Uwe Kolitsch (Mineralogisch-Petrographische Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien) und
Christian Auer (Fachabteilung Geochemie der Geologischen Bundesanstalt), die im Rahmen einer
Exkursion die Fundstelle besichtigten, ausführlich diskutiert (Abb. 3). Für ihr Interesse und ihre
Expertise gebührt den beteiligten Spezialisten herzlicher Dank!
Zuletzt wurden sämtliche Funde, organische Materialien, Erz- und Sedimentproben den Rammkernen
entnommen und verpackt. Die Bohrlöcher wurden anschließend wieder verfüllt. Die genaue Lage der
Sondagen wurde mit einem Tachymeter Leica TCR803 im Landeskoordinatensystem vermessen,
4
wobei die Grabungsfestpunkte verwendet wurden. Die Sondagepunkte erhielten die
Kurzbezeichnungen RKS (Rammkernsondierung) 1–9.
Insgesamt wurden acht händische Zeichnungen auf Millimeterpapier im Format A3 angefertigt (Plan
1–8). Es wurden 65 Digitalfotos mit einer Auflösung von 3888 x 2592 Pixel angefertigt. Es wurden 33
Fundnummern vergeben (Fn. 1143–1175), wobei die Nummerierung an die im Vorjahr durchgeführte
Ausgrabung in Fläche 4 (Maßnahmennr. 23134.12.1) anschließt.
Abb. 1. Geländedarstellung der Fundstelle Prigglitz-Gasteil mit Lage der Grabungsflächen 1–6 und
der Rammkernsondierungen (RKS) 1–9 (RKS 3 konnte nicht ausgeführt werden). Plan: P. Trebsche,
Urgeschichtemuseum Niederösterreich. – M. 1:1000.
5
Abb. 2. Prigglitz-Gasteil. Josef Balon bei der Arbeit mit der Rammkernsonde der Firma Geotool. RKS
5, Aufnahme von Westen. Foto: P. Trebsche, Urgeschichtemuseum Niederösterreich.
Verlauf der Maßnahme Die Rammkernsondierungen wurden am 9. und 10. Juli 2013 in folgender Reihenfolge durchgeführt:
RKS 2, 1, 4, 6, 5, 7, 8, 9. Der vorgesehene Sondierungspunkt 3 auf dem Scheitel der großen Halde
konnte mit dem Rammkerngerät nicht erreicht werden, da der Pfad zu schmal und zu steil war. Die
Dokumentation und Entnahme der Funde dauerte bis 11. Juli 2013.
Darstellung der Stratigraphie Rammkernsonde 1 und 2
Die Rammkernsonden (RKS) 1 und 2 bilden zusammen ein Profil durch die „Große Halde I“ nach
Franz Hampl, und zwar von der Verebnungsfläche B (RKS 1) bis zur rezenten Planierung der
Schottergrube (RKS 2).2 Der geplante dritte Sondierungspunkt RKS 3 auf dem Scheitel der Halde I
knapp oberhalb der Landesstraße konnte aufgrund der starken Hangneigung mit der Rammkernsonde
nicht erreicht werden.
2 Zur Bezeichnung der Halden und Geländepunkte vgl. F. Hampl / R. Mayrhofer, Urnenfelderzeitlicher Kupferbergbau und mittelalterlicher Eisenbergbau in Niederösterreich. 2. Arbeitsbericht über die Grabungen d. NÖ. Landesmuseums 1953–1959. Archaeologia Austriaca 33, 1963, Abb. 11.
6
Abb. 3. Prigglitz-Gasteil. Michael Götzinger, Clemens Schalko, Uwe Kolitsch und Christian Auer bei
der Diskussion der Rammkerne. Foto: P. Trebsche, Urgeschichtemuseum Niederösterreich.
In Rammkernsonde 1 (Oberkante 727,25 m) wurde unter dem Humus zunächst eine grobe Halde in
2,05–3,0 m Tiefe erreicht, darunter unter natürlichem Hangschutt zwei voneinander wieder durch
Hangschutt getrennte Feinhalden aus Serizitschiefer, die den in den Grabungsflächen 1–6
beobachteten urgeschichtlichen Feinhalden von der Korngröße und Zusammensetzung her
entsprechen. Im Liegenden befindet sich eine Kulturschicht (KS 17) oder alte Bodenbildung. Bei
7,0 m Tiefe stand die Sonde auf einem Gesteinsblock oder dem anstehenden Fels auf.
Die Rammkernsonde 1 wurde zwischen den Halden II und III nach Hampl abgeteuft und muss
ungefähr im Bereich von Feuerstelle II in Hampls Suchgraben I liegen.3 Da der Suchgraben 1956 nicht
genau vermessen wurde, lässt sich keine exakte Korrelation herstellen. Jedenfalls zeigt die RKS 1,
dass unter dem von Hampl im Südprofil von Suchgraben I verzeichneten „Gehängeschutt“ (Tiefe etwa
1 bis knapp 4 m) weitere Feinhalden folgen und sich der anstehende Fels frühestens in 7 m Tiefe
befindet.
3 Ebd. Abb. 17 und 20.
7
Dieser Befund wird durch RKS 2 bestätigt, die unterhalb des rezenten Profils der „Sandgrube“ auf
dem heutigen Holzlagerplatz abgeteuft wurde (Oberkante 720,86 m). Im Profil der Sandgrube wurden
von Hampl urnenfelderzeitliche Befunde und Schichten beobachtet4, die in der Rammkernsonde 2
angetroffenen Schichten müssen also stratigraphisch älter sein. RKS 2 zeigte mehrere feinkörnige
Haldenkörper bis 5,4 m Tiefe, die durch eine lehmige Kulturschicht (KS 4) sowie mehrere
Verwitterungshorizonte (KS 5–9) voneinander getrennt waren. Darunter folgte ein mächtiger
Verlehmungshorizont und möglicherweise eine alte Bodenbildung, ab 6,75 m Tiefe wurde natürlicher
Hangschutt unbekannter Mächtigkeit angetroffen. Der anstehende Fels wurde hier nicht erreicht.
Fasst man das heute rund 5,5 m hohe Westprofil der Sandgrube und die RKS 2 zusammen, so beträgt
die Mächtigkeit der sicher anthropogenen Ablagerungen (Haldenschichten) an dieser Stelle
mindestens 11 m. Die Rammkernsondierungen sollten entlang der Linie RKS 1–2 weiter verdichtet
werden, um mehr datierbares organisches Material zu gewinnen und den Verlauf der Schichten sowie
des möglicherweise in RKS1 erreichten anstehenden Felsgesteins zu verfolgen.
Rammkernsonde 4
Die Rammkernsonde 4 (Abb. 4; Oberkante 744,76 m) wurde auf der obersten erkennbaren künstlichen
Terrassierung im Westen der Fundstelle abgeteuft. Bis etwa 5,8 m Tiefe wurden drei Feinhaldenkörper
angetroffen, die durch eine Kulturschicht (KS 18) und eine alte Bodenbildung (KS 19) bzw.
Hangschutt voneinander getrennt sind. In 6,85 m Tiefe wurde Gestein, vermutlich der anstehende Fels
erreicht. Auch dieses Ergebnis sollte durch eine zweite Rammkernsonde auf der obersten Terrasse
überprüft werden.
Rammkernsonde 5 und 6
Die Rammkernsonde 5 (Oberkante 723,99 m) liegt 1,3 m westlich von Fläche 4 bzw. 5, ungefähr in
der Verlängerung des Südprofils von Fläche 4 bzw. des Nordprofils von Fläche 5. Die oberste
Feinhalde sowie die mächtigen Kulturschichten KS 23 und 24 entsprechen den in der Grabung
festgestellten Befunden (SE 764–768). Darunter folgt eine mindestens 4 m mächtige, in sich
gegliederte Feinhalde in sehr lockerer Lagerungsdichte (T. 2,25–6,2 m). Die unterste Schicht könnte
Feinhalde darstellen oder natürlichem Hangschutt entsprechen, die genaue Bestimmung der Tiefe (ca.
6,2–7 m) ist aufgrund der Stauchung des Bohrkerns und des Kernverlustes nicht möglich. Jedenfalls
ergänzt die Rammkernsonde die Ergebnisse der Grabung hervorragend, auch wenn das Anstehende
nicht erreicht wurde.
4 Ebd. Abb. 15.
8
Abb. 4. Prigglitz-Gasteil, Sedimente aus Rammkernsonde 4. Foto: P. Trebsche, Urgeschichtemuseum
Niederösterreich.
Die Rammkernsonde 6 (Oberkante 726,59 m) befindet sich etwas südlich des von Hampl 1958
angelegten Grabungsfeldes VI bzw. des Suchgrabens X, die leider nicht exakt vermessen wurden, auf
der größten Geländeterrasse südlich anschließend an die „Sandgrube“. Die Stratigraphie in RKS 6 ist
jener von RKS 5 ziemlich ähnlich: Unter den insgesamt 1,05 m mächtigen Kulturschichten KS 18 und
KS 19 liegt eine insgesamt ca. 4,7 m mächtige geschichtete Feinhalde, die auch eine Kulturschicht
bzw. Holzkohleanreicherung (KS 20) beinhaltet. Ab 6,1 m Tiefe folgt wahrscheinlich Hangschutt
unbekannter Mächtigkeit; der anstehende Fels wurde auch hier nicht erreicht.
Die von Hampl angelegte Grabungsfläche VI führte bis in eine Tiefe von knapp 2 m und erbrachte
urnenfelderzeitliche Befunde und fundreiche Kulturschichten.5 Diese dürften den in RKS 6
dokumentierten Kulturschichten 18 und 19 entsprechen. Die darunter liegende Feinhalde von 4,7 m
Mächtigkeit muss also stratigraphisch älter sein.
Rammkernsonde 7, 8 und 9
Im Bereich zwischen dem Fahrweg und der Landesstraße befinden sich drei künstliche
Geländeterrassen, auf denen die RKS 7, 8 und 9 angelegt wurden. Bei der Verbreiterung der
5 Ebd. Abb. 23.
9
Landesstraße im Jahr 2000 konnten in der frisch abgegrabenen Böschung urnenfelderzeitliche Funde
geborgen werden und sogar unterhalb des Straßenniveaus im begleitenden Drainagegraben noch
Kulturschichten beobachtet werden.6 Die prähistorische Zeitstellung der darunter liegenden Halden ist
dadurch eindeutig erwiesen und konnte auch durch die 2010 untersuchte Grabungsfläche 1 bestätigt
werden.7
Im Unterschied zu den bereits besprochenen Rammkernsondierungen oberhalb des Fahrweges
erbrachten die RKS 7–9 auf den unteren Terrassierungen eine abwechselnde Folge von
Verlehmungszonen, Feinhalden und Kulturschichten. Die Entstehung der Verlehmungszonen ist nicht
geklärt, eventuell sind sie auf Unwetterereignisse zurückzuführen. Weder natürlicher Hangschutt noch
der anstehende Fels wurden in diesen drei Rammkernsondierungen erreicht.
In RKS 7 (Oberkante 714,91 m) zeigte sich unter eine mächtigen Verlehmungszone zunächst eine
Feinhalde, anschließend eine 0,15 m mächtige Kulturschicht in 2,65–2,8 m Tiefe (KS 29), darunter
eine weitere Verlehmungszone und eine Feinhalde sowie eine Kulturschicht (KS 30) in 3,65–4,2 m
Tiefe. Die Feinhalden darunter sind äußerst locker gelagert (Kernverlust).
RKS 8 (Oberkante 710,10 m) wurde 3,8 m südlich von Grabungsfläche 1 (in der Verlängerung des
Westprofils) abgeteuft. In 0,55–0,75 m Tiefe wurde eine Kulturschicht (KS 31) angetroffen, welche
höchstwahrscheinlich SE 45 in Fläche 1 entspricht. Die darunterliegende Kulturschicht KS 32 in einer
Tiefe von 0,80-0,95 m findet hingegen in Fläche 1 keine Entsprechung, es sei denn, dass die SE 70
oder 78 nach Süden wannenförmig ansteigen. Unter einer sandigen Haldenschicht folgen zwei weitere
Kulturschichten (KS 33 und 34) in einer Tiefe von 1,75–2,35 m, was dem Niveau der in der
„Tiefsondage“ von Fläche 1 erreichten SE 87–89 entspricht. Unter diesem Horizont befinden sich
feine Haldenschichten, unterbrochen von Hangschutt, und ab 6,15 m Tiefe Verlehmungshorizonte. Die
RKS 8 lässt sich also sehr gut mit der in Fläche 1 angetroffenen Stratigraphie vergleichen und bestätigt
die Fortsetzung der meisten Kulturschichten aus Fläche 1 in Richtung Süden.
RKS 9 (Oberkante 705,93 m) befand sich auf der untersten Geländeterrasse, ca. 1 m westlich der
Oberkante der Straßenböschung, und lässt sich daher direkt mit dem im Jahr 2000 dokumentierten
Schichtaufschluss in der Böschung der Landesstraße vergleichen. Unter einer ca. 0,75 m mächtigen
Feinhalde folgen zwei Kulturschichten (KS 27 und 28) in 0,95–1,9 m Tiefe. Sie entsprechen
höchstwahrscheinlich jenen beiden urnenfelderzeitlichen Kulturschichten, die im Jahr 2000 in der
6 R. Lang, KG Prigglitz. Fundberichte aus Österreich 39, 2000, 596–597.
7 P. Trebsche, Wiederaufnahme der Forschungen in der urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil. Archäologie Österreichs 21/2, 2010, 18–19; ders., KG Prigglitz. Fundberichte aus Österreich 49, 2010, 311.
10
westlichen Straßenböschung beobachtet wurden.8 In der Rammkernsonde treten unter KS 27 und 28
Verlehmungshorizonte mit groben karbonatischen Gesteinen auf, die den Eindruck von
Felssturzmaterial erweckten, aber auch eine grobe Haldenschüttung oder natürlichen Hangschutt
darstellen könnten. Es folgt ab 2,5 m Tiefe eine mindestens 4,5 m mächtige geschichtete Feinhalde,
deren Unterkante in 7 m Tiefe noch nicht erreicht wurde. Sie ist also stratigraphisch älter als die
erwähnten urnenfelderzeitlichen Kulturschichten.
Darstellung des Fundspektrums Es wurden 33 Fundnummern vergeben, von denen vier Fundnummern Knochenfragmente und 21
Fundnummern Holzkohlestücke enthielten. Außerdem wurden Gesteins- und Sedimentproben sowie
elf Proben zur Schlämmung oder Flotation entnommen.
Zusammenfassende wissenschaftliche Bewertung Die Rammkernsondierungen erwiesen sich als kostengünstige und probate Methode, um in der
Bergbausiedlung von Prigglitz-Gasteil Aufschlüsse über die Stratigraphie der Halden bis in eine Tiefe
von 7 m zu erlangen. Die Ergebnisse sind gut mit den Grabungsprofilen zu korrelieren und erbringen
wertvolle Informationen über den weiteren Verlauf von Kulturschichten und die Mächtigkeit der
feinkörnigen Halden. Mit Ausnahme der obersten Rammkernsondierungen RKS 1 und RKS 4 konnten
nirgendwo Hinweise auf den anstehenden Fels gewonnen werden. Beim derzeitigen Kenntnisstand
beträgt die Mächtigkeit der „Großen Halde I“ im Bereich des Profils der „Sandgrube“ mindestens 11
m. Auch an den übrigen Sondierungspunkten sind die Feinhalden, die stratigraphisch älter als die
urnenfelderzeitlichen Kulturschichten aus den jeweiligen Grabungsaufschlüssen sein müssen,
mindestens 4 m mächtig. Aus den meisten Rammkernen konnte organisches Probenmaterial gewonnen
werden, das eine absolute Datierung mit der C14-Methode erlaubt.
In Zukunft sollen die Rammkernsondierungen verdichtet werden, um die zwei Profillinien auf dem
Scheitel der „Großen Halde“ sowie über die südlich gelegenen Terrassierungen zu vervollständigen.
Falls die mit der Rammkernsonde erreichbare Tiefe von 7 m nicht ausreicht, um zumindest an einigen
Stellen den anstehenden Fels zu erreichen, sollten Kernbohrungen durchgeführt werden.
8 Vgl. Anm. 6.