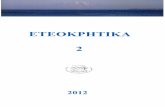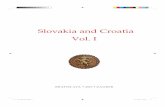Die Siedlungskammer von Pestenacker und ihre Stellung innerhalb des bayerischen Jungenolithikums -...
-
Upload
museum-manching -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die Siedlungskammer von Pestenacker und ihre Stellung innerhalb des bayerischen Jungenolithikums -...
Ernst-Pietsch-Stiftung Deggendorf
Vorträge 32. Niederbayerischer Archäologentag
Redaktion: L. Husty, Th. Richter, R. Sandner, K. Schmotz
© 2014 Verlag Marie Leidorf GmbHGeschäftsführer: Dr. Bert WiegelStellerloh 65 ● D-32369 Rahden/Westf.E-Mail: [email protected]: http://www.vml.de
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-89646-242-5ISSN 1438-2040
PC-Satz: Thomas Link & Ulrike Lorenz-Link GbR, Margetshöchheim
Druck: Ebner, Deggendorf
Gedruckt mit Unterstützung folgender Institutionen:
INHALT
Vorwort 5
Friederich, SuSanne: Salzmünde – eine historische und aktuelle Rechtsgeschichte 21
Saile, ThomaS: 100 Jahre Altheim – Aktuelle Anmerkungen zu einem altbekannten Platz 37
richTer, ThomaS: (K)ein Kampf um Altheim – Das Silexinven-tar der Grabungen 1914 und 1938 im namengebenden Erdwerk der Altheimer Kultur von Holzen Gem. Essenbach Lkr. Landshut. 59
limmer, BarBara: Die Siedlungskammer von Pestenacker und ihre Stellung innerhalb des bayerischen Jungneolithikums – Eine chronologische Skizze 91
TöchTerle, ulrike: Altheim am Kiechlberg bei Thaur? Das 4. und 3. Jahrtausend v. Chr. im Unterinntal (Nordtirol) – Zum Forschungsstand und Siedlungsbild im Inntal 119
maurer, JakoB: Die Mondsee-Gruppe: Gibt es Neuigkeiten? Ein allgemeiner Überblick zum Stand der Forschung 145
Geelhaar, marTina – FaSSBinder, JörG W. e.: Zum Potential der magnetischen Prospektion am Beispiel hallstattzeitlicher Herrenhöfe in Stadt und Landkreis Landshut (Niederbayern) 191
kreiner, ludWiG: Volkfest mit mehrtausendjähriger Tradition? Ein Gruben/Graben-Opferplatz aus Eichendorf, Lkr. Dingolfing- Landau 217
Trixl, Simon: Vorbericht zur Untersuchung der jungneo lithischen und eisenzeitlichen Tierwelt aus Eichendorf, Lkr. Dingolfing- Landau 227
WandlinG, WalTer – ZieGauS, BernWard: Raetien in der Krise – Römische Depotfunde des 3. Jahrhunderts n. Chr. am unteren Inn bei Bad Füssing 245
huSTy, ludWiG: Der Bogenberg im Lichte aktueller Forschungen – Neue archäologische Erkenntnisse am heiligen Berg Nieder- bayerns. 265
neueder, hanS: Ein bayerisches Urkloster auf dem Bogenberg? Überlegungen zu den Ausgrabungsergebnissen am Bogenberg aus der Sicht des Historikers – Ein Vorbericht 287
SchmoTZ, karl: Die frühromanische Burgrotunde von Hengers-berg, Lkr. Deggendorf – Ein Beitrag zur Kenntnis hochmittel-alterlicher Zentralbauten in Bayern 297
Bibliographie 419
Autorenverzeichnis 437
Vorträge des 32. Niederbayerischen Archäologentages
91–118 7 Abb.
Rahden/Westf. 2014
91
DIE SIEDLUNGSKAMMER VoN PESTENACKER UND IHRE STELLUNG INNERHALB DES BAyERISCHEN
JUNGNEoLITHIKUMS EINE CHRoNoLoGISCHE SKIZZE
BARBARA LIMMER
EinleitungDiese Untersuchung befasst sich mit der jungneolithischen Siedlungs-kammer von Pestenacker im westbayerischen Alpenvorland, Landkreis Landsberg am Lech. Auf einem Talabschnitt von ca. 3,5 Kilometern wurden hier drei Feuchtbodensiedlungen1 entdeckt und teilweise ausgegraben. Es handelt sich um die Siedlungen Pestenacker-Nord, Unfriedshausen und Pestenacker. Die Siedlungen folgen zeitlich aufeinander, sodass sich diese Siedlungskammer bestens für chronologische Untersuchungen eignet. Die älteste Siedlung ist Pestenacker-Nord. Neue 14C-Daten an Getreide bestätigen die Datierung in den Zeitraum von ca. 3735 bis 3630 v. Chr.2. Darauf folgt Unfriedshausen, das dendrochronologisch in den Zeitraum von 3537 bis 3517 v. Chr. datiert wurde3. Die jüngste Siedlung ist Pestenacker, deren dendrochronologische Daten von 3496 bis 3410 v. Chr.4 reichen.Die drei Siedlungen sind gut bis sehr gut datiert und weisen teils hervor-ragende Erhaltungsbedingungen mit bis zu 1,20 m Stratigraphie auf. Die Wahrscheinlichkeit chronologische Veränderungen in den Siedlungs- und Hausstrukturen oder im Fundmaterial erkennen und herausarbeiten zu können, ist nirgendwo in Bayern so groß wie in dieser Siedlungskammer.So wurden bereits bei der Bearbeitung der Baubefunde von Pestenacker-Nord neben vielen Gemeinsamkeiten auch Unterschiede zu den benach-barten Siedlungen deutlich. Alle drei Dörfer liegen im Tal auf Niedermoor-boden, während auf der Anhöhe Lößboden zu finden ist. Die Dorfstruktur ist in allen drei Fällen ähnlich: Es handelt sich jeweils um ein umzäuntes Dorf mit einem zentralen Weg, an dem beidseitig Häuserzeilen angeord-net sind, wobei sich hier kleinere Abweichungen zwischen den Siedlungen feststellen lassen5. Außerhalb der Umzäunung befindet sich nach Guntram
92
BarBara Limmer
Schönfeld sowohl in Unfriedshausen als auch in Pestenacker eine so-genannte Filialsiedlung6. Auch in Pestenacker-Nord gibt es nach Schönfeld Anzeichen für eine solche Siedlung7.Die Hausgrößen sowie die Raumaufteilungen und Einbauten – insbe-sondere Öfen und Herde – scheinen in den drei Siedlungen ebenfalls relativ einheitlich, wobei in Pestenacker-Nord diesbezüglich einige Unterschiede beobachtet werden konnten8.Die in Pestenacker-Nord herausgestellten Abweichungen zu den beiden anderen Siedlungen finden Parallelen in der vorangehenden Schussenrieder Gruppe, die westlich des Lechs verbreitet war9. Vergleiche zu frühjungneo-lithischen Feuchtbodensiedlungen im restlichen Bayern sind nicht mög-lich: Auf der Krautinsel im Chiemsee, Lkr. Rosenheim, und in Polling, Lkr. Weilheim-Schongau, wurden keine entsprechenden Baubefunde dokumentiert; aus Niederbayern fehlen Feuchtbodensiedlungen dieser Zeit. Lediglich zwei Siedlungen mit partieller Feuchtbodenerhaltung sind aus dem Altheimer Zeithorizont bekannt: Ergolding-Fischergasse und Essenbach-Koislhof, Lkr. Landshut10. Allerdings lassen insbesondere die Befunde aus Ergolding-Fischergasse, entweder erhaltungs- oder grabungs-bedingt, kaum Angaben zur Bauweise und Struktur zu. Hingegen geben die drei südwestbayerischen Siedlungen Aufschluss darüber, wie die Be-bauung der in Niederbayern zahlreich vorhandenen Mineralbodensied-lungen ausgesehen haben könnte, denn in diesen Siedlungen fehlen echte Hausbefunde. Es sind lediglich Gruben mit wohl unterschiedlicher Funkti-on bekannt11. Einige der Mineralbodensiedlungen sind darüber hinaus be-festigt, wie etwa die eponyme Siedlung von Altheim. Derartige jungneo-lithische Erdwerke fehlen aus dem westbayerischen Alpenvorland. Zwar ist für die Hangterrasse in der Siedlungskammer ein Bodenabtrag von gut einem halben Meter verbürgt12, dennoch kann das Fehlen der Erdwerke als westlicher Einfluss13 und als ein Merkmal der Lechgruppe angesehen werden14, da der Bodenabtrag mit Sicherheit nicht in der gesamten Region einheitlich war. Zum anderen ist im Nördlinger Ries ein Michelsberger Erdwerk auf dem Goldberg im ostalbkreis bekannt15, sodass gegebenen-falls mit weiteren Erdwerken zu rechnen wäre. Die Affinitäten von Pestenacker-Nord zu Schussenrieder Siedlungen scheinen also nicht allein der Quellenerhaltung geschuldet zu sein, zumal sich darüber hinaus auch in der Keramik – sowohl in Pestenacker-Nord als auch in Pestenacker – ebenfalls „Westbezüge“ feststellen lassen. Des Weiteren können in beiden Siedlungen auch gute Parallelen im nieder-bayerischen Fundmaterial sowie eigenständige Merkmale nachgewiesen
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
93
werden, sodass die Zuordnung der Siedlungskammer zur Altheimer Gruppe – die im Prinzip noch auf Paul Reinecke zurückgeht16– gegen wärtig nicht mehr haltbar erscheint. Vom Raum entlang des Lechs bis in das Nördlinger Ries hinein wird daher eine eigene Kulturausprägung postuliert – die so-genannte Lechgruppe17.Nach einer ersten Analyse des keramischen Materials der Siedlungen Pestenacker-Nord und Pestenacker konnten einige chronologisch relevante Gefäßformen bzw. Merkmale herausgearbeitet werden. Durch Vergleiche mit altheimzeitlicher Keramik aus bayerischen und ausgewählten außer-bayerischen Fundorten18 lassen sich so nun etliche bayerische Fundorte in ein erstes chronologisches Gerüst einordnen. Viele Vergleichsregionen, wie z. B. die Slowakei, Norditalien oder das Salzkammergut wurden bei dieser Untersuchung bewusst nicht berücksichtigt19.
Vergleichende Untersuchungen zur altheimzeitlichen Keramik in BayernDie älteste Siedlung der Siedlungskammer ist – wie bereits erwähnt – Pestenacker-Nord, aus der aufgrund der kleinen Grabungsfläche nur relativ wenig Fundmaterial vorliegt. Ferner ist die Keramik im Vergleich zu Pestenacker stark zerscherbt und allgemein in einem schlechteren Er-haltungszustand. Die Keramik aus Unfriedshausen wurde noch nicht untersucht, weshalb bislang keinerlei Aussagen hierzu getroffen werden können. Aus Pestenacker liegt umfangreiches Scherbenmaterial vor, das sich derzeit noch in Bearbeitung befindet. Da ein großer Teil jedoch bereits gesichtet wurde, sind erste konkrete Aussagen zu treffen.Allgemein lässt sich bemerken, dass in der Siedlungskammer eher ge-schlossene Gefäßformen vorherrschen.Das Gefäßspektrum sowie die Gefäßformen aus Pestenacker-Nord ent-sprechen auf den ersten Blick dem niederbayerischen Altheimer Formen- und Typenkanon, doch wurden darüber hinaus auch Formen und Merk-male angetroffen, die für das Altheimer Keramikspektrum bisher nicht be-schrieben wurden. Zum einen wurde hier feiner Schlickauftrag festgestellt, wie er z. B. für Spätmünchshöfen, die Pollinger Gruppe und auch älteres Pfyn bekannt ist20, zum anderen fanden sich Fragmente von zwei kleinen, enghalsigen Fläschchen, zu denen sich beste Vergleiche im Fund material des eponymen Polling sowie auch in Schussenrieder Fundkomplexen an-führen lassen21. Die beste Parallele zu einer flachen, runden Schale aus Pesten acker-Nord findet sich in der Siedlung Ehrenstein, die ebenfalls schussenriedzeitlich zu datieren ist22. Einige konische Becher aus Pesten-
94
BarBara Limmer
acker-Nord (Abb. 1,1–2) finden gute Vergleiche im Nördlinger Ries, etwa in Nähermemmingen (Abb. 1,3)23, während aus Niederbayern vergleich-bare Gefäße weitgehend fehlen24. Dagegen ist in Pestenacker-Nord ein bestimmter Typ von Kelchgefäßen (vgl. Abb. 3,2), der in Niederbayern häufig anzutreffen ist, nicht belegt25.Auch aus Pestenacker liegen keine derartigen Kelchgefäße vor, dafür treten ebenfalls konische Becher auf. Darüber hinaus gibt es auch auf der Gefäßwand aufgesetzte, gerade verlaufende plastische Leisten, die bisher nur aus dem Gebiet der Lechgruppe – aus Nähermemmingen (Abb. 1,4–5) – bekannt sind26. Die konischen Becher und die Gefäße mit aufgesetzten Leisten werden daher vorerst als Merkmale der Lechgruppe gewertet.Die Gefäßprofile aus Pestenacker sind bei manchen Gefäßformen flauer, bei anderen stärker profiliert als in Pestenacker-Nord. Feiner Schlickauf-trag kommt nicht mehr vor, dafür tritt überglätteter Schlicker auf.Während sich einige Gefäßformen aus Pestenacker kaum von denen aus Pestenacker-Nord unterscheiden, lassen sich bei anderen deutliche Unterschiede feststellen. Besonders augenfällig ist eine Tasse aus Pesten-acker-Nord (Abb. 2,1). Diese ist deutlich größer als alle aus Pestenacker vorliegenden Stücke. Sucht man nach gut vergleichbaren, ähnlich großen Tassen, lassen sich aus Bayern folgende Fundorte anführen (vgl. hierzu Abb. 2,2–4): Mamming-Hochfeld, Lkr. Dingolfing-Landau27, Straubing-Lehmgrube Dendl28, Stephansposching, Lkr. Deggendorf29, und Altheim, Lkr. Landshut30.Einige der hier angeführten niederbayerischen Stücke wurden mit Tassen der klassischen Badener Kultur in Verbindung gebracht31. So auch drei Tassenfragmente aus Mamming (Abb. 2,3)32. Nach einem formalen Ver-gleich der Mamminger Stücke mit Badener Tassen vom Grasberg bei ossarn, Stadt Herzogenburg, pol. Bez. St. Pölten Land/Niederösterreich, führt die Bearbeiterin Carmen Keßler Bedenken bzgl. dieser Zuordnung an. Sie zeigt bei der Überprüfung dieser These, dass die Tassen ebenso gut in einen älteren Abschnitt datiert werden können33. Aus demselben Be-fund – obj. Nr. 66 – stammt ferner ein Schöpfergriff, der nach Keßler ebenfalls gute Parallelen in der Badener Kultur besitzt, sich aber auch von einer seltenen Münchshöfener Form herleiten lässt34. Unberücksichtigt bei dieser Diskussion bleibt die Tatsache, dass es sich um einen geschlossenen Befund handeln soll, in dem auch ein Standfußfragment enthalten war35. Das Stück gehört nach Keßler wohl zu einer Fußschale, wie sie aus Spät-Münchshöfener, Jordansmühler und Bisamberg-oberpullendorfer Fund-zusammenhängen bekannt sind36. Das Fragment lässt sich darüber hinaus
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
95
Abb. 1: A Konische Becher und Wandscherben mit Leistenapplikationen der Lechgruppe; B „Eierbecher“ und Gefäße mit Fingertupfenzier. – M. 1:5.
auch mit Fußschalen aus Jevišovice C2 sowie auch aus Altheimer und Pfyner Fundkomplexen vergleichen37.Die formal besten Entsprechungen innerhalb des bayerischen Materials finden die Mamminger Tassen in Straubing-Lehmgrube Dendl (Abb. 2,4). Zum einen weisen die Straubinger Tassen ebenfalls stark hochgezogene Henkel auf, zum anderen sind diese rechts und links vom Henkel (bzw. umlaufend) mit Knubben versehen – ähnlich der größeren Tasse aus Mamming. Überrandständige Henkel sowie das Anbringen von Appliken beiderseits des unteren Henkelansatzes lassen sich wiederum bei Tassen aus Jevišovice Schicht C2 in Mähren sowie auch bei einem Krug aus der älteren Schicht von Cimburk in Böhmen nachweisen (Abb. 2, 5–6)38. Dane-ben finden sich beiderseitig vom Henkel angebrachte rand- wie bauchstän-dige Appliken des häufigeren auch bei altheimzeitlichen Krügen39, wäh-
96
BarBara Limmer
Abb. 2: A Tassen des älteren Altheimer Zeithorizontes in Bayern; B Vergleichsfunde aus der älteren Schicht von Cimburk und Jevišovice Schicht C2. – M. 1:5.
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
97
rend Vergleichbares bei den normalgroßen Tassen der Altheimer Gruppe sowie der Lechgruppe bislang nicht beobachtet werden konnte.Den bisher vorgestellten Tassen lässt sich formal auch eine Tasse aus einem Brandgrab in Stephansposching anschließen (Abb. 2,2). Dieses Ge-fäß besitzt jedoch keine Appliken und der Henkel ist auch nicht ganz so stark hochgezogen. Somit lässt sich diese Tasse bestens mit der eingangs angeführten Tasse aus Pestenacker-Nord vergleichen (Abb. 2,1). Ein weiteres Exemplar einer Großtasse liegt aus Altheim vor. Dieses Ge-fäß weist keinen überrandständigen Henkel auf und ähnelt in seiner Form eher den Kelchgefäßen, die wiederum mit der Schicht von Jevišovice C2 gleichzusetzen sind40. Darüber hinaus wurde eine ähnliche Tasse in Eichendorf-Aufhausen, Lkr. Dingolfing-Landau, aufgefunden, die wohl tatsächlich mit der Badener Kultur in Verbindung zu bringen sein dürfte41. Hierfür sprechen die Begleit-funde von kannelurverzierten Scherben42. Daneben fehlen im Fundmaterial echte altheimtypische Arkadenränder, während chamtypische Kerbleisten vertreten sind43. Zum anderen weist die Tasse aus Eichendorf-Aufhausen formal eine andere Gestaltung auf, als die oben angeführten Stücke. Die Eichendorfer Tasse ist bis auf einen abgesetzten Standfuß ungegliedert44. Die oben vorgestellten Stücke weisen dagegen alle einen deutlich hervor-tretenden Umbruch auf und keine davon besitzt einen abgesetzten Stand-fuß.Es lässt sich also festhalten, dass sich die hier vorgestellten Tassen – mit Ausnahme von Eichendorf-Aufhausen – gut mit Fundstücken aus Jevišovice Schicht C2 bzw. der älteren Schicht aus Cimburk vergleichen lassen, während keine Vergleiche aus Schicht C1 bzw. dem jüngeren Cimburk und Pestenacker vorliegen. Die Schicht Jevišovice C2 läßt sich nach Claudia Sachße der Drahnovicer Phase, also der Stufe Trichterbecher IIa und Protoboleráz (Ia) zuordnen45. Ferner kann die ältere Schicht von Cimburk mit einem Teil des Materials aus Jevišovice C 2 gleichgesetzt werden46. So wird das, was die 14C-Daten von Pestenacker-Nord bereits andeuten noch deutlicher: Die hier vorgestellten bayerischen Großtassen gehören einem vor- bzw. protobolerázzeitlichen Horizont an, der sich in Bayern auf spätes Münchshöfen und/oder frühes Altheim zu erstrecken scheint. Eine Zuordnung dieser Gefäße zur Badener Kultur ist somit nicht länger haltbar, zumal die klassische Phase der Badener Kultur – mit deren Tassen die hier vorgestellten Großtassen gerne verglichen werden – etliche hundert Jahre später zu datieren ist47.
98
BarBara Limmer
Abb. 3: A Böhmisch bzw. mährisch beeinflusste Gefäße und Zierelemente des älteren Alt-heimer Zeithorizontes (Drahnovicer Phase); B Vergleichsfunde aus der älteren Schicht von
Cimburk und Jevišovice Schicht C2. – M. 1:8 (Nr. 4 nicht maßstabsgetreu).
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
99
Neben den Tassen lassen sich in Straubing-Lehmgrube Dendl und in Altheim weitere Merkmale finden, die wiederum mit der älteren Schicht von Cimburk bzw. Jevišovice C2 zu parallelisieren sind. Hierbei handelt es sich zum einen um die bereits erwähnten Kelchgefäße ohne Arkadenrand (Abb. 3,2.5)48, zum anderen um Schüsseln, die plastische Applikationen zwischen den Ösen und dem Randbereich aufweisen (Abb. 3,1)49. Letztere wurden bis-her in Niederbayern wiederum aus Altheim50 und Straubing-Lehmgrube Dendl51, aber auch aus dem westbayerischen Merching-Leitschlag, Lkr. Aichach-Friedberg, publiziert52. Derartige Applikationen finden beste Par-allelen in der älteren Schicht von Cimburk (Abb. 3,4)53.Nach Jevišovice verweist des Weiteren auch eine in Altheim aufge fundene Flasche mit medaillonartigen Appliken (Abb. 3,3). Bereits J ürgen Driehaus verglich diese mit Gefäßen aus Jevišovice, allerdings mit solchen der Schicht C154. Nach der Vorlage des Fundmaterials von 1981 lässt sich der beste Vergleich in der Schicht C2 finden (Abb. 3,6). Bei dem Vergleichsstück aus Jevišovice wie auch bei dem Gefäß aus Altheim werden jeweils zwei Ringknubben durch plastische gekerbte Leisten miteinander verbunden55; möglicherweise wurden die Ringknubben sogar auf die plastische Leiste aufgesetzt. Auch auf Flaschen der Schicht C1 gibt es gekerbte plastische Leisten sowie Ringknubben. Allerdings werden die Ring knubben hier nie durch die Leisten miteinander verbunden, sondern die Zier elemente stehen jeweils für sich alleine56. Des Weiteren finden sich auf den C1-zeitlichen Flaschen im Schulter- und/oder Halsbereich häufig Ösen, wohingegen weder bei dem Gefäß aus Altheim noch bei den drei vergleichbaren Ge-fäßen aus Jevišovice C2 Ösen nachgewiesen werden können57. Doch gibt es in Niederbayern auch Parallelen zur Schicht C1 von Jevišovice, bzw. der jüngeren Siedlungsphase von Cimburk, die nach Claudia Sachße weitgehend mit der ohrozimer Phase, also TBK II B bzw. Boleráz Ib bis IIa gleichzusetzten sind58. Diese Funde stammen aus Ergolding-Fischer-gasse. Es handelt sich um Sonderformen, die Bernd Engelhardt beim 12. Niederbayerischen Archäologentag 1993 vorstellte59: Hierzu zählen ein Gefäß mit Brustapplikationen und eine kleine Kanne mit Ausguss tülle (Abb. 4,1.3). Das Gefäß mit Brüsten findet eine nahezu exakte, wenn auch deutlich kleinere Entsprechung in Schicht C1 von Jevišovice60 (Abb. 4,6), doch auch aus der jüngeren Phase von Cimburk stammen Analogien (Abb. 4,4)61. Die Kanne mit Ausgusstülle ähnelt ebenfalls einem Gefäß der jüngeren Schicht von Cimburk (Abb. 4,5)62. In dieselbe Richtung deutet ein eingeritztes Motiv – drei ineinander geschachtelte satteldachförmige Muster – auf einer Knickwandschüssel aus Aholming, Lkr. Deggendorf63.
100
BarBara Limmer
Abb. 4: A Gefäße und Zierelemente des jüngeren Altheimer Zeithorizontes (Ohrozimer Phase); B Vergleichsfunde aus der jüngeren Schicht von Cimburk und Jevišovice Schicht
C1. – M. 1:5.
Vergleichbare Motive, allerdings in Form von Einstichen oder aufgesetzten Tonapplikationen, finden sich wiederum in Jevišovice C1 und der jüngeren Schicht von Cimburk64.Aus Ergolding-Fischergasse liegen darüber hinaus zwei Fragmente von Fußschalen mit vier Füßen vor (Abb. 5,3–4). Zu diesen Stücken lassen
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
101
sich im Umkreis je ein ähnliches Gefäß aus Altenerding-Fuchsberg, Lkr. Erding (Abb. 5,2) und Aiterhofen-Ödmühle, Lkr. Straubing-Bogen, anfüh-ren (Abb. 5,1)65. Jürgen Driehaus sah das Altenerdinger Gefäß noch als Sonderform66, doch gehören derartige Fußgefäße wohl zum Formenkanon der Altheimer Gruppe.In Altenerding-Fuchsberg fallen daneben ein „Eierbecher“ sowie eine Scherbe mit Fingertupfenreihen auf (Abb. 1,7–8). Eierbecherartige Gefäße werden einerseits für die Münchshöfener Kultur angeführt67, andererseits sind ähnliche Stücke wiederum aus Jevišovice C2 belegt (Abb. 1,6)68. Die besten Vergleichsstücke zu dem Altenerdinger Exemplar finden sich jedoch in Thayngen-Weier am Bodensee, Kanton Schaffhausen, also der Pfyner Kultur, wo sich auch eine Parallele für die Altenerdinger Scherbe mit Fingertupfen anführen lässt (Abb. 1,9–10)69. Auch aus dem Fund-komplex Reute-Schorrenried, Lkr. Ravensburg, liegen aus Pfyn-Altheimer Zusammenhang Fragmente von Fußgefäßen vor70.
Abb. 5: Fußschalen der Altheimer Gruppe. – M. 1:5.
102
BarBara Limmer
Derzeit lässt sich jedoch nicht abschließend klären, ob das Altenerdinger Stück den dort äußerst seltenen Münchshöfener Funden zuzurechnen ist, oder ob es dem Altheimer Zeithorizont angehört. Letzteres scheint – vor allem aufgrund der mehrfachen Parallelfunde zur Pfyner Kultur – nach dem derzeitigen Kenntnisstand jedoch wahrscheinlicher.Neben den beiden bereits genannten Funden gibt es eine unpublizierte Scherbe mit Punktzierband aus Altenerding-Fuchsberg, die wiederum auf Kontakte Richtung Westen verweist71. Ähnliche Verzierungen konnten etwa auch in Kempfenhausen im Starnberger See, Lkr. Starnberg, und in Pestenacker nachgewiesen werden, wobei das Altenerdinger Stück den Kempfenhausener Funden am nächsten steht72. Allgemein finden diese Zierweisen die besten Parallelen in der Pfyner und der Pfyn-Altheimer Gruppe73, während vergleichbare Elemente aus Niederbayern derzeit weit-gehend fehlen74. Darüber hinaus lassen sich in Pestenacker weitere Westbe-züge z. B. in bestimmten Gefäßformen und Zierweisen fassen, wobei diese ihre besten Entsprechungen in Fundensembles haben, die an den Übergang von der Pfyner zur Horgener Kultur zu datieren sind75. Einige in Pestenacker auftretende Gefäßformen fehlen dagegen in den bis-her genannten niederbayerischen Fundkomplexen. Es handelt sich hierbei um Gefäße mit stark abgesetztem, einziehenden Hals (Abb. 6,4). Ein ent-sprechendes Gefäß findet sich auch im Erdwerk von Bad Abbach-Alkofen, Lkr. Kelheim (Abb. 6,1). Daneben weisen diese Gefäße nun auch schon deut-liche Bezüge zu Chamer Gefäßen auf (Abb. 6,9)76. Es muss sich hier also um eine chrono logisch relevante, späte Form handeln. Ebenfalls für eine späte Datierung spricht ferner der Fund einer kannelierten Scherbe der Boleráz-Gruppe aus Befund 58 in Aiterhofen-Ödmühle (Taf. 4,2), die nach Andreas Hanöffner und Lucie Siftar in die Stufe Boleráz Ic zu datieren sein dürfte77.Zwar in Pestenacker und Merching-Stummenacker, Lkr. Aichach-Fried-berg 78, jedoch nicht in Bad Abbach-Alkofen und Aiterhofen-Ödmühle an-zutreffen sind schlauchartige Gefäße (Abb. 6, 6.7), wie sie der Chamer Gruppe zueigen sind (Abb. 6, 11)79 und auch im Übergangshorizont von Pfyn zu Horgen gebräuchlich waren80. Auch das Gefäß aus der Skelett-grupe I von Inningen, Lkr. Augsburg81, ähnelt den Schlauchgefäßen der Chamer Gruppe (Abb. 6, 5. 10)82. Da in der Chamer Gruppe Ösen jedoch weitgehend fehlen und durch ovale Knubben ersetzt werden, dürfte das
Abb. 6: Gefäßformen und Spinnwirtel des jüngeren Altheimer Zeithorizontes mit Tendenzen zur Chamer Gruppe. – M. 1:8. ►
104
BarBara Limmer
Gefäß aus Inningen der späten Lechgruppe zuzuordnen sein. Weitere Af-finitäten zur Chamer Kultur finden sich ferner in Aholming. Eine stark karinierte Schüssel trägt Fingereindrücke auf dem Umbruch (Abb. 6, 3)83. Ähnliche Gefäßformen und Zierweisen treten etwa in Dobl, Lkr. Rosen-heim (Abb. 6, 13), in Saal a. d. Donau-Untersaal, Lkr. Kelheim, oder auch in Riekofen-Kellnerfeld obj. 53, Lkr. Regensburg, auf84. Auch die bereits erwähnte Knickwandschüssel mit dem dreifachen dachförmigen Ritz-muster findet in Dobl formal Parallelen85, genauso wie der in Aholming aufgefundene doppelkonische Spinnwirtel mit Kerben (Abb. 6, 2)86. Dieser weist zudem wieder Ähnlichkeiten mit einem Stück aus Jevišovice C1 auf87. Darüber hinaus stammt ein unverzierter doppelkonischer Spinnwirtel aus Merching-Stummenacker (Abb. 6, 8)88. Aus anderen Altheimer Fund-komplexen sind bisher nur flache, scheibenförmige Spinnwirtel bekannt geworden89, wohingegen doppelkonische Spinnwirtel (teils ebenfalls mit Kerben) in der Chamer Gruppe am häufigsten vertreten sind (Abb. 6,12)90.
Chronologische SyntheseAus dem eben vorgestellten keramischen Material lassen sich also Merk-male für einen älteren und einen jüngeren Horizont sowohl der Lech gruppe als auch der Altheimer Gruppe herausstellen (vgl. hierzu Abb. 7).Der ältere Horizont lässt sich gleichsetzen mit der älteren Schicht von Cimburk, die in die Baalberger Stufe der älteren Trichterbecherkultur datiert, sowie mit der Schicht C2 von Jevišovice, der sog. Drahnovicer Phase, wel-che die Stufen TBK IIa und Protoboleráz (Ia) umfasst und wahrscheinlich schon vor Protoboleráz Ia beginnt. In diese Stufe ge hören nach den hier vorgestellten Ergebnissen Pestenacker-Nord, obj. 66 aus Mamming-Hoch-feld, die Gräber aus Stephansposching, das Erdwerk von Altheim, Strau-bing-Lehmgrube Dendl, Schicht C von Ergolding-Fischergasse91, vermut-lich Altenerding-Fuchsberg, sowie der absoluten Datierung zufolge auch Kempfenhausen92. Eine Leitform dieser Phase stellen die Großtassen dar93.Der jüngere Horizont lässt sich dagegen mit der jüngeren Schicht von Cimburk, der Schicht C1 von Jevišovice sowie mit der sog. ohrozimer Phase in Verbindung bringen, welche die Stufe TBK II b und Boleráz Ib-IIa umfasst. Diesem Horizont gehören weiterhin an Ergolding Fischergasse Schicht B94, Bad Abbach-Alkofen, die Skelettgrube I von Inningen, Aiter-
Abb. 7: Chronologie-Entwurf für den Altheimer Zeithorizont in Bayern. Fundorte in regulärer Schrift sind entweder undatiert oder 14C datiert. Dendrochronologisch datierte Fundorte sind fett, Kulturgruppen und Stufen- bzw. Phasenbezeichnungen kursiv gedruckt. ►
106
BarBara Limmer
hofen-Ödmühle obj. 58, Aholming, Merching-Stummenacker und Pesten-acker95. Da sich im bisher publizierten Material von Ergolding- Fischergasse einige Gefäßformen aus Pestenacker, Merching-Stummen acker, Alkofen, Inningen und Aiterhofen-Ödmühle nicht nachweisen lassen, dürfte Ergol-ding-Fischergasse Schicht B älter als diese Siedlungen zu datieren sein. Merching-Stummenacker, Inningen, Bad Abbach-Alkofen, Aiterhofen-Öd-mühle und Aholming dürften sich zeitlich teils mit Pesten acker überlappen oder zumindest nahe stehen. Nach dieser Untersuchung und mit Blick auf das Inventar von Aholming ist ferner zu überlegen, ob vermischt erscheinende Inventare mit altheim-typischen und chamtypischen Merkmalen96, wie etwa das Fundensemble aus obj. 53 von Riekofen-Kellnerfeld, nicht doch geschlossen sein könnten und einen Übergangshorizont von Altheim zu Cham definieren97.Das jüngste gesicherte Datum des Altheimer Zeithorizontes stammt nach derzeitigem Kenntnisstand aus Pestenacker, dessen letztes dendrochrono-logisches Datum – wenn auch ohne zuweisbare Befunde – bei 3410 v. Chr. liegt98. Nachdem sich in Pestenacker, Bad Abbach-Alkofen, Inningen, Aiterhofen-Ödmühle und Aholming bereits einige Tendenzen zu Cham bzw. Horgen nachweisen lassen, ist vermutlich also auch in Bayern der Beginn des Übergangs von Altheim zu Cham ähnlich zu datieren wie jener von Pfyn zu Horgen: um etwa 3400 v. Chr., wie die dendro-chronologisch datierten Siedlungen Arbon-Bleiche 3 (3384–3370 v. Chr.) und Sipplingen-Schicht 11 (3317–3306 v. Chr.) belegen99.Ein Indiz für eine relativ späte Zeitstellung liefern im Arbeitsgebiet Ge-fäße mit stark abgesetztem Hals, schlauchförmige Gefäße und wohl auch doppelkonische Spinnwirtel. offen bleiben muss hierbei, ob bzw. welchem Horizont sich Unfriedshausen zuordnen lässt, da das keramische Material der Siedlung bislang noch nicht gesichtet wurde.Letztendlich kann festgehalten werden, dass für die Zuweisung von jung-neolithischen Fundstellen zum frühen oder späten Horizont zum einen größere Fundensembles und zum anderen möglichst durchgängige Ge-fäßprofile oder auffällige Zierweisen notwendig sind. Fundorte mit langer Laufzeit, wie etwa Aiterhofen-Ödmühle, werden eine zeitliche Einordnung betreffend jedoch immer problematisch bleiben.
Merkmale der LechgruppeDie Lechgruppe findet sich auf dem ehemaligen Pollinger Verbreitungs-gebiet. Hier, wie auch in oberschwaben und am Bodensee, fehlen Erd-werke, die in Niederbayern häufig belegt sind. Im Keramikspektrum der
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
107
Lechgruppe bleiben Kelchgefäße ohne Arkadenrand aus, dafür können als Lokalformen z. B. konische Becher und plastische Leisten genannt werden. Während sich in Niederbayern vermehrt Bezüge nach Böhmen und Mähren feststellen lassen, fallen in den Siedlungen entlang des Lechs auch immer wieder Bezüge Richtung Westen auf, sodass dieses Gebiet als Schnittstelle zwischen Pfyn/Pfyn-Altheim einerseits und Altheim sowie den östlich angrenzenden Kulturgruppen andererseits angesehen werden kann. Scharfe Kulturgrenzen lassen sich nicht fassen100.
FazitDie Siedlungskammer gibt einzigartige Einblicke in die Zeit zwischen 3700 und 3400 v. Chr.: seien es aufgrund der hervorragenden Erhaltungs-bedingungen, Erkenntnisse zu Kleidungs- oder Essgewohnheiten oder – nun erstmals zusammen mit Vergleichsfunden aus anderen Regionen – auch zu einem chronologischen und chorologischen Stilwandel in der Keramik. Wobei für weitergehende Aussagen die vollständige Bearbeitung aller Befund- und Fundgattungen abgewartet werden muss, insbesondere der Keramik aus Unfriedshausen.
Anmerkungen1 Pestenacker-Nord ist schon seit geraumer Zeit trocken gefallen, sodass hier keine orga-
nische Erhaltung mehr gegeben ist. 2 Es handelt sich hier um die Mittelwerte. Die Daten wurden im AMS-Labor Erlangen der
Friedrich-Alexander-Universität gewonnen und mit Calib 6.0 kalibriert. Einige sekundär verbaute Bretter der Siedlung Unfriedshausen datieren in die Jahre um 3760 und um 3670 v. Chr. (Schönfeld 2009b, 167). Möglicherweise handelt es sich bei diesen um ehemalige Holzbestände aus Pestenacker-Nord.
3 BlfD 2010, 7.4 Bauer 2009, 181. Bei den jüngsten Daten (3429 und 3410 v. Chr.) handelt es sich ledig-
lich um einzelne Pfähle, die keiner Bauphase mehr zugewiesen werden können.5 So konnten etwa in Pestenacker-Nord große Vorplätze zwischen den Häusern und
dem Weg wahrscheinlich gemacht werden (vgl. hierzu Limmer 2004). In Pestenacker sind ebenfalls Vorplätze anzuführen, die jedoch deutlich kleiner sind (Schönfeld 1991, 48). Ein Blick auf den Plan der Gründungsphase (Schönfeld 2009a, 145 Abb. 12; 154 Abb. 24) lässt vermuten, dass zumindest auch die Häuser 3, 6 und 8 einen kleinen Vor-platz besaßen. Ein weiterer Unterschied ergibt sich in Pestenacker durch eine zweite Häuserzeile nördlich des Weges. In Unfriedhausen stehen dagegen in der Siedlung 2 (Unfriedshausen-West) die Häuser nicht mit der Giebelseite, sondern traufseitig zum Weg hin orientiert (Schönfeld 2009b, 159 Abb. 4).
6 Siehe hierzu Schönfeld 2009a; 2009b.
108
BarBara Limmer
7 Von Pestenacker-Nord ist zwar nur ein kleiner Ausschnitt ausgegraben, doch streuen die Funde über einen sehr großen Bereich und sogar über eine Straße hinweg, was laut Ausgräber auf eine Filialsiedlung hindeuten könnte (Schönfeld 2009a, 456).
8 Die Häuser sind in der Regel ungefähr 7,4–8,0 x 3,4–4,0 m groß (Schönfeld 2009a, 144; 2009b, 161; Limmer 2006). Allerdings lassen sich diese Zwischenwände in Unfriedshausen und Pestenacker-Nord nur über die bekannten Funde aus Pesten-acker rück schließen (Schönfeld 2009b, 162–168; Limmer 2006). Daneben konnten in Pesten acker-Nord etliche Abweichungen zu den anderen beiden Siedlungen festgestellt werden: Haus 2, Siedlungsphase 1 scheint eine Einraumhütte zu sein, Haus 3, Sied-lungsphase 1 weist einen ungewöhnlichen Knick in der südöstlichen Wand auf und die Kuppelöfen sind in einigen Fällen in Pestenacker-Nord im Vergleich zu Pestenacker um 90° gedreht (dies lässt sich insbesondere in Haus 1, Phase 1 c und 2 deutlich beobachten (Limmer 2006).
9 Vgl. hierzu Limmer 2006.10 Vgl. hierzu Hanöffner 2009.11 In Straßkirchen lassen diese Gruben vermuten, dass die Häuser darüber, wie etwa in
Pestenacker oder Unfriedshausen, in Zeilen angeordnet waren (Viol 1996, 47–49 Abb. 45). Vgl. hierzu auch Schönfeld 2001 sowie Limmer 2010.
12 Schreiber 1990, 400.13 Weder aus der Pfyner noch aus der Pfyn-Altheimer Gruppe sind Erdwerke bekannt.14 Schönfeld sieht die Feuchtbodensiedlungen im westbayerischen Alpenvorland als
topografisch angepasstes Pendant zu den Erdwerken in Niederbayern (Schönfeld 2001; 2009b, 168).
15 Schröter 1975; Keefer 1993, 119.16 Reinecke 1935.17 Diese ist im Wesentlichen auf dem Verbreitungsgebiet der vorangegangen Pollinger
Gruppe zu finden (Limmer 2006; 2010). Bereits zur Zeit der Münchshöfener Gruppe scheint sich eine gewisse Eigenständigkeit dieser Region herauszukristallisieren (vgl. hierzu Meixner 2013).
18 Es handelt sich hier um Fundorte in den Fundregionen Baden-Württemberg, Böhmen, Mähren und der Westschweiz. Diese wurden nicht umfassend behandelt, lediglich eini-ge gut stratifizierte Fundorte herangezogen, um meiner Dissertation „Das keramische Material aus Pestenacker. Untersuchungen zur jungneolithischen Keramik aus dem Tal des Verlorenen Baches (Arbeitstitel)“ nicht vorzugreifen.
19 Diese Regionen werden ebenfalls in meiner in Arbeit befindlichen Dissertationsschrift behandelt.
20 Vgl. hierzu etwa Müller-Karpe 1961, 18 Taf. 27, Nr. 9.12.17.19; Uenze 1989,21; Bleuer/Hardmeyer 1993, Abb. 342; Blaich 1995, 96.
21 Müller-Karpe 1961, Taf. 13,7–17; Strobel 2000, z. B. Taf. 34,775.22 Lüning 1997, 54 Taf. 81,18; Limmer 2014.23 Driehaus vermutete bereits, dass es sich bei den konischen Töpfen um eine Lokalform
aus dem Nördlinger Ries handeln könnte (Driehaus 1960, 73). 24 Aus Altheim sowie vom Galgenberg, Lkr. Landshut, liegt jeweils ein konischer Becher
vor (Driehaus 1960, Taf. 10,17; ottaway 1999, 97 Fig. X3.1 a), wobei das Altheimer Stück nur etwa halb so groß ist wie der Galgenberger Becher und eher den konischen Näpfen nach Driehaus entspricht. Ferner finden sich auf beiden Gefäßen anstelle der sonst üblichen Arkadenleiste mehrere randständige Knubben.
25 Kelchgefäße ohne Arkadenrand (wie Abb. 3,2) fehlen hier. Den Kelchgefäßen mit Ar-
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
109
kadenrand (vgl. hierzu Driehaus 1960, Taf. 20,1.3) lassen sich dagegen ähnliche Gefäße aus Pestenacker-Nord an die Seite stellen.
26 Es handelt sich hierbei definitiv nicht um Fragmente von Kragenflaschen. Leisten-applikationen sind sonst nur aus weiter entfernten Regionen – wie z. B. Mähren – be-kannt, fehlen jedoch bisher im Altheimer Kerngebiet.
27 Kreiner 1993b, 40 Abb. 5,1.2, sowie bei Keßler 2011, Taf. 5,4.5; Taf. 6,2.28 Driehaus 1960, Taf. 32,1.2.29 Schmotz 1995, 39 Abb. 4.30 Driehaus 1960, Taf. 10,11.31 Matuschik 2001, 678; Blaich 1997; Kreiner/von den Driesch 1991, 39.32 Hier sind nur zwei Tassen abgebildet. 33 Keßler 2011, 74–76. Sie weist darauf hin, dass sich die Tassen formal „ebenso gut in die
Altheimer Kultur eingliedern“ lassen. „Einzig die Henkelgestaltung wirft Fragen auf“ (Keßler 2011, 76).
34 Keßler 2011, 76–77; Süß 1976, 35 Taf. 19,3.35 Auf die Geschlossenheit weisen sowohl der Ausgräber, als auch die Bearbeiterin hin
(Kreiner 1993, 44; Keßler 2011, 44–45).36 Keßler 2011, 60. Mit Badener Fußschalen lässt sich dieses Exemplar nicht vergleichen,
da die Badener Füße meist massiv und wesentlich höher sind (vgl. hierzu etwa Sachße 2010, Taf. 49,A2. B 2; 51, A2; 52, 6. Selbst der Hohlfuß aus Franzhausen, obj. 206, St. Pölten/Niederösterreich – Taf. 67,2 – weicht deutlich von dem Mamminger Stück ab).
37 Zu den Fußschalen, in diesem Artikel als Eierbecher bezeichnet, siehe weiter unten.38 Vgl. hierzu Medunová-Benešová 1981, Taf. 31,1.2 sowie Zápotocký Abb. 37a, 3 Taf.
22, 7. Driehaus brachte die Stücke aus Straubing bereits mit dem böhmischen Jungneo-lithikum in Verbindung (Driehaus 1960, 74), wohl auch deswegen, weil sich in der-selben Fundstelle auch das Fragment einer Baalberger Amphore fand (Driehaus 1960, 73–74 Taf. 32,4).
39 Vgl. hierzu etwa Driehaus 1960, Taf. 5,14 (hier vermutlich eine Flasche); Schneider 1968, Abb. 3,1; Petrasch 1989, Abb. 18,10; 24,13; ottaway 1991, Abb. 17,5; 1995, Abb. 65,9; Han öffner/Siftar 2006, Taf. 17,4. Auch aus Pestenacker liegen mehrere derartige Appliken vor.
40 Zu den Kelchgefäßen siehe unten.41 Blaich 1997.42 Ebd. Abb. 7,3; 8,2.43 Vgl. hierzu Blaich 1997, Abb. 3–10.44 Ebd. Abb. 5,10.45 Sachße 2010, 25 mit Anm. 66; 227.46 Nach böhmischer Terminologie gehört das ältere Cimburk dem „jüngeren Abschnitt der zwei-
ten (Baalberger) Stufe der älteren böhmischen Trichterbecherkultur“ an (Zápotocký 2000, 98).47 Matuschik 2001, 677.48 Der Übergang von den Kelchgefäßen zu weitmundigen Töpfen und teils auch Schalen
und Schüsseln ist fließend und bedarf noch einer genaueren Unterteilung. Kelchgefäße mit und ohne Arkadenrand z. B. bei Driehaus 1960, 23 Taf. 20,1–8 (Altheim), ebd. Taf. 31,12 (Straubing-Lehm grube Dendl); Schmotz 1996, 39 Abb. 8 (Gefäß aus Hockerbe-stattung 1 von Stephans posching). Des Weiteren sind ein Kelchgefäß aus Weihen stephan, Lkr. Landshut (Kehrer 2001, Taf. 5,5) sowie aus Altenerding-Fuchsberg (Driehaus 1960, Taf. 23,30) bekannt. Vergleichsfunde in Jevišovice Schicht C2 (ohne Arkadenrand) bei Medunová-Benešová 1981, Taf. 8.
110
BarBara Limmer
49 Aus der jüngeren Phase von Cimburk liegen keine derartigen Applikationen vor.50 Driehaus 1960, Taf. 5,10; 9,17; 11,24; 12,4.16; 13,9.51 Ebd. Taf. 31,6.52 Knittel/LFD 2001, 42; 56 Abb. 30,14.53 Vgl. hierzu Zápotocký 2000, Abb. 37 b. Bereits Driehaus (1960, 207) führt für die
Leisen applikationen Parallelen aus Böhmen an.54 Driehaus 1960, 207.55 Ebd. Taf. 9,21; Medunová-Benešová 1981, Taf. 4,6.56 Vgl. Medunová-Benešová 1981, Taf. 66,1.3; 67,1.2.5.57 Vgl. hierzu auch die C2-zeitlichen Flaschen Medunová-Benešová 1981, Taf. 3,3.5.58 Sachße 2010, 24–28; 227. Schon Driehaus brachte die Schicht Jevišovice C1 mit
ohrozim in Verbindung (Driehaus 1960, 197). Hierzu bereits Maran 2001, 735.59 Engelhardt 1994, 46 Abb. 4. Schon an anderer Stelle wurde darauf hingewiesen, dass es
sich bei den von Engelhardt abgebildeten Gefäßen um Formen handelt, die zum Kanon von Jevišovice C2 und C1 gehören (Köninger/Kolb/Schlichtherle 2001, 646).
60 Medunová-Benešová 1981, Taf. 69,2; 180,2 (hier ist die Schichtzuweisung nicht ganz klar: das Stück stammt entweder aus Schicht C1 oder C. Schicht C1 und C2 ließen sich nicht immer eindeutig trennen; diese Schichtpakete wurden als Schicht C bezeichnet. Hierzu Medunová-Benešová 1981, 3).
61 Zápotocký 2000, 69 Taf. 19,2; 41,1 (das letzte Stück ist ein Altfund und lässt sich nicht eindeutig einer bestimmten Schicht zuordnen). Ein brustähnlicher Hohlbuckel stammt ferner aus dem wohl nicht geschlossenen Befund 86 von Riekofen-Kellnerfeld, Lkr. Regensburg (Matuschik 1990, 29;37 Taf. 11,14). Gefäße mit Brustapplikation lassen sich auch schon für frühjungneolithische Kulturen anführen, z. B. aus der cortaillodzeitlichen Schicht 5 von Zürich-Mozartstraße (Gross 1987, 104 Abb. 142) oder etwa auch aus dem eponymen Polling (Müller-Karpe 1962, Taf. 9,7; 16,3). Doch auch aus der Pfyn-Alt-heimer Siedlung Ruhestetten-Egelsee, Lkr. Sigmaringen, ist ein Gefäß mit Brustapplika-tionen bekannt (Schlichtherle 1995, 76 Abb. 66).
62 Zápotocký 2000, 69 Taf. 16,14. Ein Wandfragment mit Tülle ist ferner vom „Alten Berg“ in Wittislingen, Lkr. Dillingen a. D., belegt (Driehaus 1960, Taf. 32,19). Eine Art Krug mit Tülle – wohl chamzeitlich – stammt ferner aus Riekofen-Kellnerfeld (Matuschik 1990, 167 Taf. 33,4).
63 Driehaus 1960, Taf. 28,7.64 Medunová-Benešová 1981, Taf. 76,7; 94,5; Zápotocký 2000, Abb. 38, B Nr. 5 (links
unten – hier nur zwei Applikationen) Taf. 3,8. Aus den älteren Schichten fehlen ver-gleichbare Muster.
65 Driehaus 1960, Taf. 23,36; Hanöffner/Siftar 2006, 63 Taf. 20,3.66 Driehaus 1960, 73.67 Vgl. hierzu Süß 1976, Taf. 12,7–9. Leider sind alle drei Exemplare nur fragmentarisch
erhalten. Bei dem besten Vergleich – Nr. 9 aus osterhofen-Altenmarkt, Lkr. Deggen-dorf – handelt es sich ferner um einen Lesefund, sodass die Zugehörigkeit zur Münchs-höfener Kultur fraglich ist. Aus Altenerding-Fuchsberg liegen zwar auch zwei Münchs-höfener Scherben vor, doch geht nicht hervor, dass diese gemeinsam mit dem Fußgefäß gefunden wurden, bzw. aus derselben Kulturschicht stammen (Driehaus 1960, 33–35; Süß 1976, 99).
68 Medunová-Benešová 1981, Taf. 6,4. Möglicherweise handelt es sich bei dem Fußbruch-stück aus Cimburk (Zápotocký 2000, 68–69 Taf. 4,14) ebenfalls um einen Eierbecher.
69 Wininger 1971, Taf. 27, 19 (Fingertupfen) sowie 29 und 30 („Eierbecher“).
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
111
70 Mainberger 1998, 143 Taf. 12,217–218 (wobei sich lediglich Nr. 218 mit dem Alten-erdinger Stück vergleichen lässt).
71 Die Scherbe ist im Museum Erding ausgestellt.72 Driehaus 1960, Taf. 26,13 (Scherbe mit Punktzier). Hierzu etwa auch Limmer 2008
sowie 2014 (Schüsselchen mit Punktreihenverzierung).73 Die bei Driehaus abgebildete Scherbe lässt sich mit einem Bodenfragment aus der
Pfyner Siedlung Steckborn-Schanz, Bodensee/Kanton Thurgau, vergleichen (Winiger/Hasenfratz 1985, 133 Taf. 44,3). Umlaufende Punktreihen sowie Punktreihenbänder sind z. B. auch in der Pfyn-Altheimer Siedlung Reute-Schorrenried aufgefunden worden (Mainberger 1998, Taf. 8,128; 9, 146–150; 10, 151–167). Aus Pestenacker liegen weitere, bisher unpublizierte Scherben mit derartigen Zierweisen vor, ferner sind sie für Kempfenhausen geradezu typisch (vgl. hierzu Limmer 2008).
74 Bis auf eine einfache Einstichreihe am Rand (Driehaus Taf. 8,22; 17,2) findet sich in Niederbayern lediglich auf einer Scherbe von Wisselsing ein Band aus Einstichen (Driehaus Taf. 28,15). Vgl. hierzu auch Limmer 2014.
75 Es handelt sich z. B. um Töpfe, die sich mit Töpfen aus Arbon-Bleiche 3, Bodensee/Kanton Thurgau, vergleichen lassen (vgl. hierzu de Capitani 2002, 269 Abb. 363,4 oder auch 274 Abb. 368,8).
76 Vgl. hierzu Burger 1988, Taf. 11,5; 18 (beide Dobl); 93,5 (Saal a. d. Donau-Untersaal).77 Hanöffner/Siftar 2006, 66–67. 78 Schneider 1968, Abb. 3,5.79 Burger 1988, z. B. Taf. 8,5.80 Vgl. hierzu Kolb 1998, Abb. 3,1–2.81 Maier 1965, 12 Abb. 182 Burger 1988, z. B. Taf. 9,1.83 Driehaus 1960, Taf. 28,5.84 Burger 1988, Taf. 23,2; 28,10; 93,8; Matuschik 1990, Taf. 12,1.85 Etwa Burger 1988, Taf. 20,2. 86 Vgl. hierzu Burger 1988, Taf. 54,1.6.87 Medunová-Benešová 1981, Taf. 110,4.88 Schneider 1968, 16 Abb. 7,5.89 Sie stammen aus Ergolding-Fischergasse (ottaway 1995) und Riekofen-Kellnerfeld
obj. 32 (Matuschik 1990, 48 Taf. 14,2) sowie aus Altenerding-Fuchsberg (unpubliziert, ausgestellt im Museum Erding).
90 Burger 1988, 54 Taf. 54–55.91 Hanöffner kann im mittleren Horizont von Ergolding-Fischergasse, der Schicht C, Be-
züge zum Protobolerázhorizont nachweisen (Hanöffner 2009, 175–176).92 Eine Siedlung der Pfyn-Altheimer Gruppe (Limmer 2008), die dendrochronologisch
zwischen 3723 und 3719 v. Chr. datiert ist (Herzig 1997, 30–33).93 Möglicherweise sind auch die Kelchgefäße Anzeiger für den frühen Horizont in Nieder-
bayern – diese These bedarf aber einer weiteren Analyse um sichere Aussagen hierzu treffen zu können.
94 Für Schicht B führt Hanöffner Bezüge zu frühem Boleráz an (Hanöffner 2009, 175–176).
95 Aiterhofen-Ödmühle könnte eine sehr lange Laufzeit haben: Hier wurde Keramik der Spätmünchshöfener, der Altheimer sowie der Chamer Gruppe angetroffen. Derzeit lässt sich jedoch nicht entscheiden, ob die Altheimer Keramik insgesamt dem späten Hori-zont zugerechnet werden kann.
112
BarBara Limmer
96 Z. B. altheimtypische Arkandenränder, die vergesellschaftet sind mit chamtypischen Merkmalen wie etwa der Verzierung der Gefäßwand mit Ritzungen, Kerbmustern/ Fingertupfen und Kerbleisten.
97 Irenäus Matuschik führte für den Befund 53 aus Riekofen-Kellnerfeld „aufgrund der Fundumstände und der Fundzusammensetzung massive Bedenken an der Geschlossen-heit des Inventars“ an (Matuschik 1990, 30).
98 Nachdem laut Kolb am Bodensee sämtliche Boleráz-Keramik in Siedlungen mit Schlag-daten im 34. Jahrhundert aufgefunden wurde (Kolb 1998, 138–139), könnte der Befund 58 aus Aiterhofen-Ödmühle (mit Boleráz-Scherbe) evtl. noch später zu datieren sein als die obersten Schichten von Pestenacker – vorausgesetzt, dass die Boleráz-Elemente in Bayern zur selben Zeit einsetzen wie am Bodensee.
99 Kolb 1998, insbesondere 131–137; de Capitani 2002, 189–197.100 Die Mondseegruppe, die Kulturgruppen Norditaliens sowie auch etwa die Michels-
berger Kultur sind bei dieser Darstellung nicht berücksichtigt worden.
AbbildungsnachweisAbb. 1: 1-2 Limmer; 3-5 Driehaus 1960, Taf. 33; 23; 25; 27; 6 Medunová-Benešová 1981,
Taf. 6,4; 7 Driehaus 1960, Taf. 23,11; 8 Driehaus 1960, Taf. 24,18; 9-10 Winiger 1971, Taf. 27; 19; 30.
Abb. 2: 1 Limmer; 2 Schmotz 1995, Abb. 4; 3 Kreiner 1993, Abb. 5; 4 Driehaus 1960, Taf. 32,1.2; 5 Zápotocký 2000, Abb. 37 A,3; 6 Medunová-Benešová 1981, Taf. 31,1; 3.
Abb. 3: 1 Driehaus 1960, Taf. 11,24; 12,4; Taf. 31,6; 2 Driehaus 1960, Taf. 20,7; Taf. 31,12; 3 Driehaus 1960, Taf. 9,21; 4 Zápotocký 2000, Abb. 37 B,4.5; 5 Medunová-Benešová 1981, Taf. 8,1-3; Medunová-Benešová 1981, Taf. 4,6.
Abb. 4: 1 Engelhardt 1994, Abb.4; 2 Hanöffner/Siftar 2006, Taf. 7,14; 3 Engelhardt 1994, Abb. 4; 4 Zápotocký 2000, Taf. 19,2; 5 Zápotocký 2000, Taf. 16,14; 6 Medunová-Benešová 1981, Taf. 69,2.
Abb. 5: 1 Hanöffner/Siftar 2006, Taf. 20,3; 2 Driehaus 1960, Taf. 23,36; 3 u. 4 Engelhardt 1994, Abb. 4.
Abb. 6: 1 Petrasch 1989, Abb. 31,13; 2 Driehaus 1960, Taf. 54,10; 3 Driehaus 1960, Taf. 28,5; 4 Limmer; 5 Maier 1965, Abb. 1; 6 Schneider 1968, Abb. 3,5; 7 Limmer; 8 Schnei-der 1968, Abb. 7,5; 9 Burger 1988, Taf. 18,1; 10 Burger 1988, Taf. 9,1; 11 Burger 1988, Taf. 104,28; Taf. 8,5; 12 Burger 1988, Taf. 54,1; 13 Burger 1988, Taf. 28,10.
LiteraturBauer 2009S. Bauer, Die Feuchtbodensiedlung Pestenacker – Holzkonstruktionen, Siedelphasen und
Waldnutzung während der Altheimer Kultur. In: L.Husty/M.M. Rind/K. Schmotz (Hrsg.), Zwischen Münchshöfen und Windberg. Gedenkschrift für Karl Böhm. Internat. Arch. Studia honoraria 29 (Rahden/Westf. 2009) 177–203.
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
113
Blaich 1995F. Blaich, Pilsting Wiesen. Eine Fundstelle der späten Münchshöfener Kultur und ihre Be-
ziehungen zu südöstlichen Nachbarkulturen. Bayer. Vorgeschbl. 60, 1995, 81–132.
Blaich 1997F. Blaich, Neues zur Badener Kultur in Südostbayern. Bayer. Vorgeschbl. 62, 1997, 1–28.
Bleuer/Hardmeyer 1993E. Bleuer/B. Hardmeyer, Zürich „Mozartstraße“. Neolithische und bronzezeitliche Ufersied-
lungen 3: Die neolithische Keramik. Züricher Denkmalpflege Arch. Monogr. 18 (Zürich 1993).
BlfD 2010http://www.blfd.bayern.de/medien/feuchtboden.pdf (Stand 13.9.2013)
Burger 1988I. Burger, Die Siedlung der Chamer Gruppe von Dobl, Gemeinde Prutting, Landkreis
Rosenheim und ihre Stellung im Endneoltihikum Mitteleuropas. Materialh. Bayer. Vorgesch. A 56 (Fürth/Bay. 1988).
De Capitani 2002A. De Capitani, Gefäßkeramik. In: A. de Capitani/S. Deschler-Erb/U. Leuzinger/E. Marti-
Grädel/J. Schibler, Die jungsteinzeitliche Siedlung Arbon-Bleiche 3, Funde. Archäo logie im Thurgau 11. Veröff. Amt für Archäologie im Kanton Thurgau (St. Gallen 2002) 135–274.
Driehaus 1960J. Driehaus, Die Altheimer Gruppe und das Jungneolithikum in Mitteleuropa (Mainz 1960).
Engelhardt 1994B. Engelhardt, Die Altheimer Feuchtbodensiedlung Ergolding-Fischergasse bei Landshut
und ihr Hinterland – Die Entwicklung eines Kleinraumes von der Linienbandkeramik bis zum mittleren Spätneolithikum. In: K. Schmotz (Hrsg.), Vorträge des 12. Nieder-bayerischen Archäologentages (Buch a. Erlbach 1994) 41–87.
Gross 1987E. Gross, Zürich „Mozartstrasse“. Neolithische und bronzezeitliche Ufersiedlungen Band 1.
Ber. Züricher Denkmalpflege. Monogr. 4 (Zürich 1987).
Hanöffner 2009A. Hanöffner, Ergolding-Fischergasse und Essenbach-Koislhof: zwei jungneolithische
Siedlungen mit partieller Feuchtbodenerhaltung in Niederbayern. Ber. Bayer. Boden-denkmalpfl. 50, 2009, 171–185.
Hanöffner/Siftar 2006A. Hanöffner/L. Siftar, Die Ausgrabungen in Ödmühle, Gemeinde Aiterhofen, Lkr.
Straubing-Bogen 1975–1980. Jahresber. Hist. Verein Straubing u. Umgebung 108, 2006, 31–277.
Herzig 1997F. Herzig, Dendrochronologische Untersuchungen der Hölzer. In: H. Beer/M. Mainberger,
Tauchuntersuchungen an einer jungneolithischen Seeufersiedlung bei Kempfenhausen
114
BarBara Limmer
im Starnberger See – Vorbericht über die Sondagen 1985, 1986 und 1997. Ber. Bayer. Bodendenkmalpfl. 38, 1997, 27–36.
Keefer 1993E. Keefer, Steinzeit. Slg. Württemberg. Landesmus. Stuttgart 1 (Stuttgart 1993).
Kehrer 2001K. Kehrer, Ein Siedlungsplatz mit Grabenanlage des Jungneolithikums und der Früh-
bronzezeit in Weihenstephan, Lkr. Landshut. Beitr. Arch. Niederbayern 1 (2001) 133–240.
Keßler 2011C. Keßler, Mamming-„Hochfeld“. Ein polykultureller Siedlungsplatz mit Funden der
Münchshöfner und Altheimer und der Trichterbecherkultur (unpubl. Magisterarbeit, Saarbrücken 2011).
Knittel 2001F. Knittel, Merching. In: Fundchronik für das Jahr 1998. Bayer. Vorgeschbl. Beih. 14, 2001,
42.
Köninger/Kolb/Schlichtherle 2001J. Köninger/M. Kolb/H. Schlichtherle, Elemente von Boleráz und Baden in den Feucht-
bodensiedlungen des südwestdeutschen Alpenvorlandes und ihre mögliche Rolle im Transformationsprozess des lokalen Endneolithikums. In: P. Roman/S. Diamandi (Hrsg.), Cernavoda III – Boleraz. Ein vorgeschichtliches Phänomen zwischen dem oberrhein und der unteren Donau. Symposium Mangalia/Neptun (18.–24. oktober 1999). Studia Danubiana, Ser. Symposia II (Bukarest 2001) 641–672.
Kolb 1998M. Kolb, Kulturwandel oder Kulturbruch? – Betrachtungen zum Übergang von der Pfyner
zur Horgener Kultur. In: B. Fritsch/M. Maute/I. Matuschik/J. Müller/C. Wolf (Hrsg.), Tradition und Innovation. Prähistorische Archäologie als historische Wissenschaft. Fest-schrift für Christian Strahm. Internat. Arch. Studia honoraria 3 (Rahden/Westf. 1998) 129–141.
Krenn-Leeb 2001A. Krenn-Leeb, Eine trichterbecherzeitliche Grube mit nierenförmigen Webgewichten von
Spielberg bei Melk, Niederösterreich. Preistoria Alpina 37, 2001, 287–331.
Kreiner 1993aL. Kreiner, Eine jungneolithische Siedlung mit Tieropfern von Mamming, Ldkr. Dingol-
fing-Landau, Niederbayern. Acta Praehist. et Arch. 25, 1993, 16–47.
Kreiner 1993bL. Kreiner, Eine jungneolithische Siedlung mit opfergruben aus Mamming, Lkr. Dingol-
fing-Landau. In: K. Schmotz (Hrsg.), Vorträge des 11. Niederbayerischen Archäologen-tages (Buch a. Erlbach 1993) 35–45.
Kreiner/von den Driesch 1992L. Kreiner/A. von den Driesch, Ein Dorf mit Zeremonialgruben der Facies Wallerfing aus
Mamming. Arch. Jahr Bayern 1991 (1992) 37–39.
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
115
Limmer 2006B. Limmer, Pestenacker-Nord: Baubefunde einer ehemaligen Feuchtbodensiedlung an der
Wende vom frühen zum späten Jungneolithikum. Ber. Bayer. Bodendenkmalpfl 45/46, 2004/05 (2006) 9–43.
Limmer 2008B. Limmer, Zugereiste aus oberschwaben. Kempfenhausen – Eine Inselsiedlung der Pfyn-
Altheimer Gruppe? In: F. Falkenstein/A. Zeeb-Lanz (Hrsg.), Kumpf, Kalotte, Pfeil-schaftglätter. Zwei Leben für die Archäologie. Gedenkschrift für Annemarie Häußer und Helmut Spatz. Studia honoraria 27 (Rahden/Westf. 2008) 153–162.
Limmer 2010B. Limmer, Altheimzeitliche Siedungs- und Hausstrukturen in ostbayern sowie im west-
lichen oberbayern und Schwaben – Ein Vergleich. Fines Transire 19, 2010, 81–97.
Limmer 2014B. Limmer, Von Nah und Fern… Spätjungneolithische Feuchtbodensiedlungen im west-
bayerischen Alpenvorland und ihre transalpinen Kontakte. Schriftliche Fassung des Beitrags zur Tagung „Das Inntal als Drehscheibe zwischen Kulturen nördlich und südlich des Alpenhauptkammes – Zeitscheibe Neolithikum und Kupferzeit vom 16.02.–18.02.2012 in Innsbruck“ (Manuskript zum Druck eingereicht im April 2013).
Lüning 1997J. Lüning, Die Keramik von Ehrenstein. In: Das jungsteinzeitliche Dorf Ehrenstein,
Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-Kreis. Ausgrabungen 1960 Teil III: Die Funde. For-schungen und Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 58 (Stuttgart 1997) 9–93.
Maier 1965R. A. Maier, Michelsberg-Altheimer Skelettgruben von Inningen bei Augsburg in
Bayerisch-Schwaben. Germania 43, 1965, 8–16.
Mainberger 1998M. Mainberger, Das Moordorf von Reute. Archäologische Untersuchungen in der jungneo-
lithischen Siedlung von Reute-Schorrenried (Staufen i. Br. 1998).
Maran 2001J. Maran, Zur Westausbreitung von Boleráz-Elementen in Mitteleuropa. In: P. Roman/S.
Diamandi (Hrsg.), Cernavoda III – Boleráz. Ein vorgeschichtliches Phänomen zwischen dem oberrhein und der unteren Donau. Symposium Mangalia/Neptun (18.–24. oktober 1999) Studia Danubiana Ser. Symposia II (Bukarest 2001) 733–748.
Matuschik 1990I. Matuschik, Die neolithische Besiedlung in Riekofen-„Kellnerfeld“ – Beiträge zur
Kenntnis des Spätneolithikums im südlichen Bayern (unpubl. Dissertation Universität Freiburg i. Br.).
Matuschik 2001I. Matuschik, Boleráz und Baden aus Sicht des Südbayerischen Späthneolithikums,
zugleich ein Beitrag zur Genese der Badener Kultur. In: P. Roman/S. Diamandi (Hrsg.), Cernavoda III – Boleráz. Ein vorgeschichtliches Phänomen zwischen dem oberrhein
116
BarBara Limmer
und der unteren Donau. Symposium Mangalia/Neptun (18.–24. oktober 1999) Studia Danubiana, Ser. Symposia II (Bukarest 2001) 673–720.
Medunová-Benešová 1981A. Medunová-Benešová, Jevišovice-Stáry Zámek. Schicht C2, C1, C. Katalog der Funde.
Fontes Arch. Moravicae XIII (Brno 1981).
Meixner 2013D. Meixner, Pioniere am Lechrain. In: G. Mahnkopf (Hrsg.), Geschichte aus dem Boden.
Archäologische Ausgrabungen in Blankenburg, Sonderband zum 33. Jahresbericht des Heimatvereins für den Landkreis Augsburg e. V. (Augsburg 2013) 112–195.
Müller-Karpe 1961H. Müller-Karpe, Die spätneolithische Siedlung von Polling. Materialh. Bayer. Vorgesch.
17 (Kallmünz 1961).
ottaway 1992B. S. ottaway, Eine Altheimer Feuchtbodensiedlung beim Koislhof, Gemeinde Essenbach,
Landkreis Landshut, Niederbayern. Arch. Jahr Bayern 1991 (1992) 39–43.
ottaway 1995B. S. ottaway, Ergolding, Fischergasse – Eine Feuchtbodensiedlung der Altheimer Kultur
in Niederbayern. Materialh. Bayer. Vorgesch. A 68 (Kallmünz 1995).
ottaway 1999B. S. Ottaway, A changing Place, The Galgenberg in Lower Bavaria. From the fifth to the
first millennium B.C. BAR Internat. Ser. 752 (Oxford 1999).
Petrasch 1989J. Petrasch, Das Altheimer Erdwerk bei Alkofen, Gem. Bad Abbach, Lkr. Kelheim. Ber.
Bayer. Bodendenkmalpfl. 26/27, 1985/86, 33–80.
Reinecke 1935P. Reinecke, Siedlung mit Altheimer Keramik aus oberbayern. Germania 19, 1935,
158–159.
Sachße 2010C. Sachße, Untersuchungen zu den Bestattungssitten der Badener Kultur, Universitäts-
forsch. Prähist. Arch. 179 (Bonn 2010).
Schlichtherle 1995H. Schlichtherle, Ödenahlen – eine jungneolithische Siedlung der „Pfyn-Altheimer Gruppe
oberschwabens“ im nördlichen Federseeried. Archäologische Untersuchungen 1981–1986, In: Siedlungsarchäologie im Alpenvorland III. Die neolithische Moorsiedlung Ödenahlen. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 46 (Stuttgart 1995) 9–128.
Schmotz 1995K. Schmotz, Eine Konzentration Münchshöfener Bestattungen in Stephansposching, Lkr.
Deggendorf, Ndb. In: Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1992–1994. Kat. Gäu-bodenmus. Straubing 24 (Straubing 1995) 35–39.
Die SieDlungSkammer von PeStenacker
117
Schneider 1968o. Schneider, Eine neue Altheimer Siedlungsstelle in Merching, Ldkr. Friedberg. Bayer.
Vorgeschbl. 33, 1968, 1–18.
Schönfeld 1992G. Schönfeld, Ein Wohnstallhaus aus der jungneolithischen Talbodensiedlung von Pestenacker,
Gem. Weil, Ldkr. Landsberg a. Lech, oberbayern. Arch. Jahr Bayern 1991 (1992) 44–50.
Schönfeld 2001G. Schönfeld, Bau- und Siedlungsstrukturen der Altheimer Kulturgruppe. Ein Vergleich
zwischen Feuchtboden- und Mineralbodensiedlungen. In: K. Schmotz (Hrsg.), Vorträge des 19. Niederbayerischen Archäologentages (Rahden/Westf. 2001) 17–62.
Schönfeld 2009aG. Schönfeld, Die altheimzeitliche Feuchtbodensiedlung von Pestenacker. Ber. Bayer.
Bodendenkmalpfl. 50, 2009, 137–156.
Schönfeld 2009bG. Schönfeld, Ein jungsteinzeitliches Filialsiedlungssystem im Talgrund des Loosbachs bei
Unfriedshausen. Ber. Bayer. Bodendenkmalpfl. 50, 2009, 157–168.
Schreiber 1990U. Schreiber, Geologische Untersuchungen im Umfeld der endjungneolithischen
Siedlung bei Pestenacker, Ldkr. Landsberg am Lech, unter Mitarbeit von F. Nöthlings u. R. Schramedei. In: Siedlungsarchäologische Untersuchungen im Alpenvorland. 5. Kolloquium der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 29.–30. März 1990 in Gaien-hofen-Hemmenhofen. Ber. RGK 71, 1990, 390–405.
Schröter 1979P. Schröter, Zur Besiedlung des Goldberges im Nördlinger Ries. In: Ausgrabungen in Deutsch-
land, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1950–1975. Teil 1: Vorge-schichte, Römerzeit (Ausstellung Mainz 1975). Monogr. RGZM 1,1 (Mainz 1975) 98–114.
Strobel 2000M. Strobel, Die Schussenrieder Siedlung Taubried I (Bad Buchau, Kreis Biberach). Ein
Beitrag zu den Siedlungsstrukturen und zur Chronologie des frühen und mittleren Jung-neolithikums in oberschwaben (Stuttgart 2000).
Süß 1976L. Süß, Zur Münchshöfener Gruppe in Bayern. In: H. Schwabedissen (Hrsg.), Die Anfänge
des Neolithikums vom orient bis Nordeuropa. Fundamenta A3, Teil Vb (Köln/Wien 1976) 1–121.
Uenze 1989H. P. Uenze, Die Facies Wallerfing. Eine Kulturgruppe des Jungneolithikums in Südbayern. Arch. Denkmäler Landkreis Deggendorf 2 (Deggendorf 1989).Viol 1996P. Viol, Die Altheimer Keramik des Fundplatzes Straßkirchen, Lkr. Straubing-Bogen
(unpubl. Magisterarbeit, Frankfurt a. Main 1996)
118
BarBara Limmer
Winiger 1971J. Winiger, Das Fundmaterial aus Thayngen-Weier im Rahmen der Pfyner Kultur. Monogr.
Ur- u. Frühgesch. der Schweiz 18 (Basel 1971).
Winiger/Hasenfratz 1985J. Winiger/A. Hasenfratz, Ufersiedlungen am Bodensee. Archäologische Untersuchungen
im Kanton Thurgau 1981–1983. Antiqua 10 (Basel 1985).
Zápotocký 2000M. Zápotocký, Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in
Böhmen. Pam. Arch. Suppl. 12 (Praha 2000).
Autorenverzeichnis
437
Dr. Susanne Friederich, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Richard-Wagner-Str. 9, 06114 Halle (Saale)[email protected]
Dr. Jörg W. E. Faßbinder, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Hof-graben 4, 80539 Mü[email protected]
Martina Geelhaar M.A., Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Denk-malerfassung und Denkmalforschung, Referat Siedlungs- und Kultur-landschaftsdokumentation, Geophysikalische Prospektion, Hofgraben 4, 80539 Mü[email protected]
Dr. Ludwig Husty, Kreisarchäologie Straubing-Bogen, Klosterhof 1, 94327 [email protected]
Dr. Ludwig Kreiner, Kreisarchäologie Dingolfing-Landau, Obere Stadt 13, 84130 [email protected]
Barbara Limmer M.A., kelten römer museum, Im Erlet 2, 85077 [email protected]
Mag. Jakob Maurer, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien Department of Prehistoric and Historical Archaeo-logy of the University of ViennaA-1190 Wien, Franz-Klein-Gasse 1 [email protected]
Hans Neueder, Friedrichstr. 7, 94327 [email protected]
Thomas Richter M.A., Kreisarchäologie Landshut, Alte Regensburger Str. 11, 84030 [email protected]
438
Autorenverzeichnis
Prof. Dr. Thomas Saile, Universität Regensburg, Institut für Geschichte, Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte, 93040 [email protected]
Dr. Karl Schmotz, Kreisarchäologie Deggendorf, Herrenstraße 18, 94469 [email protected]
Mag. Dr. Ulrike Töchterle, Institut für Archäologien – Restaurierung, Uni-versität Innsbruck, A-6020 [email protected]
Simon Trixl M. A., Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, Kaulbachstraße 37, 80539 Mü[email protected]
Walter Wandling M.A., Kreisarchäologie Passau, Passauer Str. 39, 94121 [email protected]
Dr. Bernward Ziegaus, Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstr. 2, 80538 Mü[email protected]