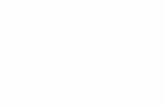[Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the...
Orthopäde 2006 · 35:904–916
DOI 10.1007/s00132-006-0977-z
Online publiziert: 23. Juni 2006
© Springer Medizin Verlag 2006
H. Gollwitzer1 · P. Diehl2 · L. Gerdesmeyer3 · W. Mittelmeier4
1 Abteilung für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Berufsgenossenschaftliche
Unfallklinik Murnau/Staffelsee · 2 Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie,
Technische Universität München · 3 Department Endoprothetik und Wirbelsäulenchir-
urgie, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Mare-Klinikum Kiel-Kronshagen4 Orthopädische Klinik und Poliklinik, Universität Rostock
Diagnostische Strategien bei Verdacht auf peri prothetische Infektion einer Kniegelenk -total endoprothese
Literaturübersicht und aktuelle Empfehlungen
Leitthema
Die Infektion stellt in der Kniegelenken-
doprothetik eine der wesentlichen Kom-
plikationen dar und tritt trotz moderner
Operationsverfahren, strenger Hygiene
und Antibiotikaprophylaxe bei der Pri-
märimplantation in 0,4–2% der Fälle auf
[6, 22, 46]. Verschiedene Grunderkran-
kungen können das Infektionsrisiko erhö-
hen und so beträgt die Infektrate z. B. bei
Patienten mit rheumatoider Arthritis >4%
[7]. Im Revisionsfall sind sogar Infektra-
ten von >5% zu beobachten [22]. Die si-
chere Differenzierung von aseptischer Lo-
ckerung und Infektion ist für die Wahl des
operativen Vorgehens und die Prognose
nach Totalendoprothesen- (TEP-)Wechsel
entscheidend. Infektionen und Reinfekti-
onen nach septischen Prothesenwechseln
gehen mit einer bedeutenden Morbidität
und enormen volkswirtschaftlichen Kos-
ten einher.
Die Endoprotheseninfektion kann im
Wesentlichen in 4 Typen klassifiziert wer-
den [55]:
Typ 1 positive intraoperative Kultu-
ren während des Prothesen-
wechsels,
Typ 2 frühe postoperative Infektion
(<1 Monat),
Typ 3 akute hämatogene Infektion
Typ 4 späte (chronische) Infektion
(>1 Monat).
Während die Diagnose der frühen und
akuten Infektion aufgrund des klinischen
Bildes meist keine Schwierigkeiten be-
reitet, stellt die Diagnostik der chro-
nischen „Low-grade-Infektion“ eine Her-
ausforderung dar. Diese periprothetischen
Infektionen sind häufig symptomarm und
nur schwer von aseptischen entzündlichen
Reaktionen zur differenzieren.
Auch die Beurteilung und Wertung
positiver intraoperativer Kulturergeb-
nisse während des Prothesenwechsels
(Typ-1-Infektion) kann Schwierigkeiten
bei der Differenzierung von Kontamina-
tion und echter Infektion bereiten. Hier ist
v. a. die Entnahme multipler Proben mit
jeweils frischen Instrumenten hilfreich, da
der Nachweis des gleichen Infektionserre-
gers in verschiedenen Proben auf ein re-
levantes infektiöses Geschehen hinweist.
Therapeutisch wird hier meist eine test-
gerechte systemische Antibiose über min-
destens 4 Wochen empfohlen.
Einschränkend muss für sämtliche Stu-
dien zur Infektdiagnostik vorweg erwähnt
werden, dass keine einheitlichen Kriterien
zur definitiven Diagnose der Prothesen-
infektion vorliegen und auch die zumeist
untersuchten Goldstandards der intraope-
rativen Kultur und/oder Histologie selbst
keine 100%ige Sensitivität und Spezifität
besitzen. Dies erklärt die manchmal gra-
vierenden Unterschiede in den verschie-
denen Untersuchungen zur Wertigkeit
der einzelnen diagnostischen Verfahren.
Klinische Befunde
Während das klinische Bild der infizierten
Knie-TEP im akuten Fall mit den ty-
pischen Symptomen von Rötung, Schwel-
lung, Erguss, aufgehobener Funktion und
starken Schmerzen bis hin zur Sekretion,
Fistel und zum präseptischen Krankheits-
bild reicht und unschwer auf die vorlie-
gende Infektion hinweist, muss bei den
blander verlaufenden chronischen Infek-
tionen immer zuerst der Verdacht auf ein
infektiöses Geschehen gelenkt werden.
Wesentliche Differenzialdiagnosen sind
dabei die aseptische Lockerung, mecha-
nische Komplikationen, das komplexe re-
gionale Schmerzsyndrom (CRPS) sowie
die Arthrofibrose. Gerade bei der Arthro-
fibrose sollte vor Diagnosestellung immer
eine blande verlaufende Infektion ausge-
schlossen werden [19].
In der Anamnese sollte nach kompli-
zierter Wundheilung, zurückliegender
Antibiotikabehandlung, persistierender
Sekretion und andauernden Schmerzen
nach Implantation der einliegenden En-
doprothese gefahndet werden. Auch bei
einer Bewegungseinschränkung und ins-
904 | Der Orthopäde 9 · 2006
besondere bei neu aufgetretenen Schmer-
zen nach zunächst gut funktionierender
TEP (>3 Monate postoperativ, auch nachts
und in Ruhe) sollte differenzialdiagnos-
tisch an eine Infektion gedacht werden.
Unspezifische klinische Befunde sind
eine schmerzhafte Bewegungseinschrän-
kung, Schwellung, intraartikuläre Erguss-
bildung, Rötung, persistierende Sekretion
und (sub)febrile Temperaturen. Die häu-
fig beschriebene „sterile“ Fistel sollte als
eindeutiges Infektzeichen gewertet wer-
den, da eine direkte Verbindung zur Haut-
flora und damit eine bakterielle Besiede-
lung der Endoprothese besteht.
Radiologische Zeichen
Die radiologische Diagnostik bei Verdacht
auf Knie-TEP-Infektion dient v. a. der Be-
urteilung einer Prothesenlockerung so-
wie dem differentialdiagnostischen Aus-
schluss von mechanischen Komplikati-
onen und Gleitflächenabrieb (Standauf-
nahmen!).
Typische radiologische Befunde einer
Protheseninfektion sind selten, da die kli-
nischen Befunde den radiologischen Ver-
änderungen meist vorauseilen. Bei schlei-
chenden Infektionen können sequentielle
Röntgenbilder die Ausbildung einer foka-
len Osteopenie, Osteolysen und periosta-
le Knochenneubildung nachweisen. Wäh-
rend früh auftretende Osteolysen als cha-
rakteristischstes radiologisches Merkmal
der TEP-Infektion zu werten sind, werden
späte Osteolysen meist aseptisch durch
Abrieb verursacht (. Abb. 1).
Die Computertomographie (CT) und
Magnetresonanztomographie (MRT) lie-
fert in der Infektdiagnostik meist keine
zusätzliche Information, die CT kann je-
doch in Zusammenschau mit nuklearme-
dizinischen Verfahren die Auswertung
derselben erleichtern.
Laboruntersuchungen
Die Bestimmung der Entzündungspa-
rameter stellt im diagnostischen Loga-
rithmus nach Anamnese und klinischer
Untersuchung den nächsten wichtigen
Schritt der Infektionsdiagnostik dar. Hier
zeichnen sich v. a. die Blutkörperchensen-
kungsgeschwindigkeit (BSG) und das C-
reaktive Protein (CRP) durch eine rela-
tiv hohe Sensitivität aus (. Tab. 1). Nach
einem postoperativen Anstieg mit Gip-
fel am 2. bis 3. Tag sollte es bei kompli-
kationsloser TEP-Implantation zu einem
raschen Abfall des CRP-Wertes mit An-
näherung an den Normwert bis zum 10.
postoperativen Tag kommen [42]. Persis-
tierende CRP-Erhöhungen können auf
ein infektiöses Geschehen hinweisen.
Abhängig von den festgelegten
Grenzwerten (z. B. BSG>10 mm/h oder
>30 mm/h) besitzen die beschriebenen
Entzündungsparameter jedoch eine mehr
oder weniger geringe Spezifität für die pe-
riprothetische Infektion (s. . Tab. 1).
> BSG und CRP werden zur Aus-schlussdiagnostik empfohlen
Im Allgemeinen werden somit CRP und
BSG zur Ausschlussdiagnostik empfoh-
len, da normale BSG- und CRP-Werte ei-
ne periprothetische Infektion relativ un-
wahrscheinlich machen [29].
Die Bestimmung der Leukozyten-
zahlen ist in der Diagnostik der Knie-
TEP-Infektion nur von untergeordneter
Bedeutung, da die Leukozytenzahlen
nur eine sehr geringe Sensitivität besit-
zen [41]. Eine Erhöhung der Leukozyten-
werte ist zudem meist mit einem klinisch
ausgeprägten Infektgeschehen verknüpft,
welches kein diagnostisches Problem dar-
stellt. Chronische Infekte gehen in der Re-
gel mit normalen Leukozytenwerten ein-
her, hier kann eine chronische Infektanä-
mie vorliegen.
Neuere Laborparameter könnten die
Infektdiagnostik entscheidend verbes-
sern. So untersuchten DiCesare et al. [12]
den Interleukin-6- (IL-6-)Serumspiegel
in einer Studie an 58 Patienten, welche
sich einer Revision einer einliegenden
Hüft- oder Knie-TEP unterziehen muss-
ten. Dabei zeigte eine Erhöhung des IL-
6-Serumspiegels mit einer Genauigkeit
von 97% eine zugrunde liegende Endo-
protheseninfektion an [Sensitivität=1,00;
Spezifität=0,95; positiver Vorhersagewert
(PPV)=0,89; negativer Vorhersagewert
(NPV)=1,00]. Die ermutigenden Ergeb-
nisse dieser relativ kleinen Studie müssen
nun in größeren Untersuchungen bestä-
tigt werden.
Als weiterer hochspezifischer Parame-
ter bakterieller Infektionen gilt Procalci-
tonin. Hier liegen noch keine Ergebnisse
in der Diagnostik von TEP-Infektionen
vor, allerdings konnten Martinot et al. [36]
bei der bakteriellen Arthritis eine Spezifi-
tät von 0,94 für eine Erhöhung des Procal-
citonin-Wertes im Serum aufzeigen.
Nuklearmedizinische Verfahren
3-Phasen-SkelettszintigraphieDie Knochenszintigraphie ist ein dia-
gnostisches bildgebendes Verfahren, wel-
ches die Verteilung eines osteotropen Ra-
diopharmazeutikums (meist Techneti-
um-99m-Methylendiphosphat, 99mTc-
MDP) in planarer und ggf. auch tomogra-
Abb. 1 9 a Radiolo-gische Zeichen der septischen Prothesen-lockerung einer Knie-TEP mit ausgeprägten Osteolysen. b Osteo-lysen entlang der in-tramedullären Stielver-ankerung einer Revisi-onsendoprothese bei TEP-Infektion
906 | Der Orthopäde 9 · 2006
Leitthema
phischer Technik wiedergibt. Die 3-Pha-
sen-Skelettszintigraphie ist dabei ein indi-
rektes Maß für die metabolische Aktivität
des Knochens und setzt sich üblicherwei-
se aus Perfusions-, Blutpool- und Spätauf-
nahmen zusammen.
Da metabolische Veränderungen den
morphologischen Befunden üblicher-
weise vorausgehen, kann die Skelettszin-
tigraphie pathologische Befunde oft frü-
her aufdecken als dies durch konventio-
nelle Untersuchungen (z. B. Röntgenauf-
nahmen) möglich ist. Andererseits sind
Traceranreicherungen durch den Nach-
weis von Veränderungen des Knochen-
stoffwechsels unspezifisch und auch um
asymptomatische Endoprothesen häufig
noch mehrere Jahre nach Implantation er-
höht. So konnten Larikka et al. [30] für die 99mTc-Knochenszintigraphie in der Di-
agnostik der TEP-Infektion auch nur ei-
ne Spezifität von 0,05 aufzeigen, und viele
weitere Studien bestätigten die nicht zur
Differenzierung entzündlicher peripros-
thetischer Prozesse ausreichende geringe
Spezifität [9, 50].
Allerdings besitzt die 99mTc-Knochen-
szintigraphie durch die hohe Sensitivität
einen zuverlässigen negativen Vorhersa-
gewert und kann daher zur Ausschlussdi-
agnostik eingesetzt werden [9, 50]. Heu-
te wird die 3-Phasen-Skelettszintigraphie
meist zur sequentiellen Untersuchung in
Kombination mit Leukozyten- oder An-
tigranulozytenszintigraphie (AGS) einge-
setzt. Eine Inkongruenz in der periprothe-
tischen Traceranreicherung gilt dabei als
Hinweis auf eine zugrunde liegende Infek-
tion. Als alleiniges nuklearmedizinisches
Verfahren hat die Skelettszintigraphie in
der Diagnostik der Knie-TEP-Infektion
keine wesentliche Bedeutung mehr.
Gallium-67-Zitrat-SzintigraphieDie 67Ga-Zitrat-Szintigraphie wurde als
nuklearmedizinisches Verfahren zur bes-
seren Abbildung infektiöser Prozesse ein-
geführt. Das radioaktive Ga-67 bindet
nach der i. v.-Injektion an Serumtransfer-
rin, und dieser Komplex gelangt schließ-
lich über den Extrazellulärraum auch an
den Ort der Infektion. In infizierten Are-
alen liegt eine erhöhte Konzentration an
Lactoferrin vor, welches von Granulo-
zyten freigesetzt wird. Durch die deutlich
höhere Affinität des Galliums zu Lacto-
Zusammenfassung · Abstract
Orthopäde 2006 · 35:904–916 DOI 10.1007/s00132-006-0977-z
© Springer Medizin Verlag 2006
H. Gollwitzer · P. Diehl · L. Gerdesmeyer · W. Mittelmeier
Diagnostische Strategien bei Verdacht auf periprothetische Infektion einer Kniegelenktotalendoprothese. Literaturübersicht und aktuelle Empfehlungen
Zusammenfassung
Die sichere Bestimmung der periprothe-
tischen Infektion des Kniegelenks ist eine dia-
gnostische Herausforderung. Die vorliegende
Arbeit gibt eine Literaturübersicht zu den
verfügbaren diagnostischen Verfahren.
Bei Infektionen nach Knietotalendopro-
these (Knie-TEP) zeigen die Blutkörperchen-
senkung und das C-reaktive Protein (CRP) ei-
ne relativ hohe Sensitivität bei geringer Spe-
zifität und werden deshalb vornehmlich
zum Infektausschluss eingesetzt. Die Leuko-
zytenszintigraphie zeigte sehr unterschied-
liche Wertigkeiten, ein Einsatz als Standarddi-
agnostikum kann nach den vorliegenden Da-
ten nicht empfohlen werden.
Für die Antigranulozytenszintigraphie
und die FDG-PET als neuere Verfahren konn-
te in den durchgeführten kleineren Studien
eine gute Genauigkeit mit hoher Sensitivität
gezeigt werden. Eine Validierung in größeren
Studien ist notwendig. Unbestritten ist die
hohe Spezifität der mikrobiologischen Unter-
suchung präoperativer Punktate, jedoch ver-
bleiben durchschnittlich 20% falsch-negative
Befunde. Eine Punktion wird jedoch aufgrund
der Möglichkeit der präoperativen Keimdiffe-
renzierung empfohlen.
Eine gute Genauigkeit zeigte auch die in-
traoperative Gefrierschnittuntersuchung. Als
Standards werden die intraoperative Kultur
und Histologie eingesetzt, die echte Wertig-
keit ist jedoch aufgrund fehlender Goldstan-
dards schwer zu beurteilen.
Große Studien zu den diagnostischen Ver-
fahren und validierte Kriterien zur definitiven
Diagnosestellung sind zur Optimierung des
diagnostischen Algorithmus notwendig.
Schlüsselwörter
Kniegelenkendoprothese · Infektion ·
Szintigraphie · PET · PCR · Gelenkpunktion
Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations
Abstract
Reliable confirmation of periprosthetic infec-
tion after total knee arthroplasty is a diagnos-
tic challenge. The present work reviews pub-
lished data evaluating the available diagnos-
tic tools.
Erythrocyte sedimentation rate and C-re-
active protein serum levels are relatively sen-
sitive methods with rather low specificity to-
wards periprosthetic infection and are main-
ly applied to exclude infection. Studies eval-
uating scintigraphic methods – especially
white cell scans – provide inconsistent data
with varying accuracy. Consequently, white
cell scans cannot be recommended as stan-
dard methods.
Immunoscintigraphy with antigranulo-
cyte antibodies and FDG-PET scans dem-
onstrated promising results with particular-
ly high sensitivities, but have to be validated
in larger studies. Microbiological evaluation
of joint aspirates proved high specificity for
periprosthetic infection. However, an average
of 20% of infected cases remained undetect-
ed. Nevertheless, aspiration is widely recom-
mended for preoperative isolation of the in-
fecting organism. Intraoperative frozen sec-
tions demonstrated excellent specificity with
good sensitivity. The real accuracy of intraop-
erative culture and permanent histology can-
not be determined due to the missing gold-
en standard; however, a combination of both
methods is recommended to define the fi-
nal diagnosis.
Large studies validating both methods
and criteria for the final diagnosis of peripros-
thetic infection are necessary to optimize the
diagnostic algorithm.
Keywords
Knee arthroplasty · Infection · Scintigraphy ·
PET · PCR · Joint aspiration
907Der Orthopäde 9 · 2006 |
ferrin erfolgt ein Transfer des radioak-
tiven Tracers von Transferrin zu Lacto-
ferrin und somit eine Darstellung des in-
fizierten Situs.
In der klinischen Realität zeigte sich
jedoch eine Anreicherung des Tracers
auch an Orten mit aseptisch erhöhtem
Knochenstoffwechsel, und die Spezifität
der Infektionsdarstellung war weit weni-
ger hoch als erhofft [9]. Die 67Ga-Szinti-
graphie ist ähnlich wie die konventionelle
Knochenszintigraphie sehr sensitiv, je-
doch unzureichend spezifisch.
Durch die sequentielle Anwendung der
Technetium-Gallium Szintigraphie sollte
durch eine inkongruente Anreicherung
von Technetium und dem entzündungs-
spezifischeren Gallium eine Differenzie-
rung von Knochenstoffwechselsteigerung
und echter entzündlich-infektiöser Re-
aktion möglich werden, was in einzelnen
Studien bestätigt wurde [23]. Diese kom-
binierte Untersuchung konnte allerdings
die hohen Erwartungen in den meisten
der vorliegenden Untersuchungen nicht
erfüllen und wies eine schlechtere Genau-
igkeit als die Szintigraphien mit markier-
ten Leukozyten auf [38, 50]. Folglich wer-
den die Verfahren nicht zur (alleinigen)
Diagnostik der Knie-TEP-Infektion emp-
fohlen [9].
Indium-111-Oxin-Leukozyten szintigraphieDie Szintigraphie mit 111In-Oxin-mar-
kierten autologen Leukozyten erlaubt die
Verteilung der markierten Leukozyten im
Körper des Patienten von extern mittels
Einzelaufnahmen und ggf. SPECT-Unter-
suchungen (single-photon emission com-
puted tomography) zu verfolgen. Dazu
werden patienteneigene Leukozyten ent-
nommen, in einem relativ aufwendigen
Verfahren isoliert, und nach radioaktiver
Markierung reinjiziert. Diese markierten
Leukozyten akkumulieren dann in Be-
reichen mit fokaler Infekt- oder Entzün-
dungsreaktion.
Die alleinige Szintigraphie mit 111In-
markierten Leukozyten zeigte in den vor-
liegenden Veröffentlichungen relativ un-
terschiedliche Resultate bzgl. Spezifität
und Sensitivität (. Tab. 2). Falsch-posi-
tive Befunde können hier v. a. durch die
relativ häufige postoperative Umvertei-
lung und Aktivierung des Knochenmarks
um die Prothese bedingt sein. Von Nach-
teil ist die relativ schlechte anatomische
Auflösung des Verfahrens. Die Sensitivi-
tät wird i. Allg. geringer eingestuft als bei
der 99mTc-Skelettszintigraphie.
Scher et al. [51] konnten nachweisen,
dass die Genauigkeit der 111In-markier-
ten Leukozytenszintigraphie relativ un-
abhängig von der vor bestehenden In-
fektdauer bzw. der Chronizität des In-
fekts ist [51], allerdings zeigten die Unter-
suchungen wie bei anderen Autoren auch
Einschränkungen bei Sensitivität und
Spezifität (s. . Tab. 2), weshalb das Ver-
fahren nicht als Standarddiagnostikum
empfohlen wird.
Technetium-99m-HMPAO-LeukozytenszintigraphieDie Szintigraphie mit 99mTc-HMPAO-
markierten Leukozyten ermöglicht eben-
falls den Nachweis der Verteilung von ra-
dioaktiv markierten und reinjizierten au-
tologen Leukozyten als planare Aufnah-
me oder als SPECT. Diese Art der Szin-
tigraphie versucht über eine verbesserte
Leukozytenmarkierung den Anteil der
markierten Lymphozyten – und damit
das für eine bakterielle Infektion unspe-
zifische Hintergrundsignal – zu reduzie-
ren. Der Einsatz von 99mTc-markierten au-
tologen Leukozyten hat im Vergleich zu 111In-Oxin-markierten den Vorteil einer
früheren und kürzeren Untersuchungs-
dauer, einer niedrigeren Strahlenexposi-
tion und einer besseren Bildqualität.
Zusätzliche Spätaufnahmen nach 24 h
könnten im Vergleich zur alleinigen Be-
urteilung in der Frühphase nach 2–4 h
die Genauigkeit verbessern ([24, 30]
und . Tab. 2). Insgesamt konnte für die 99mTc-HMPAO-Szintigraphie jedoch kei-
ne wesentlich höhere Genauigkeit ver-
glichen mit der 111In-Leukozytenszinti-
graphie nachgewiesen werden [9]. Ledig-
lich Pelosi et al. [47] erzielten mittels ei-
ner zusätzlichen semiquantitativen Ana-
lyse der periprothetischen Leukozytenak-
tivität hervorragende Ergebnisse.
Eine sequentielle Kombination der
Leukozytenszintigraphien mit der 99mTc-
Skelettszintigraphie oder 67Ga-Zitrat-
Szintigraphie wird durch verschiedene
Arbeitsgruppen zur Erhöhung der Spe-
zifität empfohlen [24, 44], (. Tab. 2). Ei-
ne inkongruente Anreicherung der radio-
aktiven Tracer kann auch hier zur bes-
seren Differenzierung periprothetischer
Prozesse genutzt werden. Dabei gilt eine
fokal stärkere Anreicherung der radioak-
tiv markierten Leukozyten verglichen mit
Technetium oder Gallium als Hinweis auf
ein infektiöses Geschehen. Insgesamt wer-
den die Leukozytenszintigraphien jedoch
meist zum Ausschluss einer Infektion ein-
gesetzt.
Technetium-99m-Antigranulo-zytenszintigraphie (99mTc-AGS)Die Antigranulozytenszintigraphie (AGS)
erlaubt den indirekten Nachweis von In-
fektionsherden über die Verteilung radio-
aktiv markierter monoklonaler Antikör-
Tab. 1 Wertigkeit von BSG und CRP in der Diagnostik der Knie-TEP-Infektion
Autor, Jahr Patienten
(n)
Sensiti-
vität
Spezifität PPV NPV Genauigkeit
(Wahrschein-
lichkeit kor-
rekter Aussage)
BSG
Barrack et al. 1997 [5]a 69 1,00 0,25 - - 0,47
Barrack et al. 1997 [5]b 69 0,80 0,63 0,47 0,88 0,68
Di Cesare et al. 2005 [12] 58d 1,00 0,56 0,49 1,00 0,69
Levitsky et al. 1991 [31]b 72d 0,60 0,65 0,25 0,90 0,65
Panousis et al. 2005 [45] 92d 0,75 0,68 0,26 0,95 0,68
Teller et al. 2000 [53]c 166d 0,29 0,88 0,26 0,89 0,80
CRP
Di Cesare et al. [12] 58d 0,94 0,78 0,64 0,97 0,83
Kordelle et al. 2004 [29] 50 1,00 0,38 0,69 1,00 0,74
Panousis et al. 2005 [45] 92d 0,67 0,64 0,22 0,93 0,64
Virolainen et al. 2002 [58] 68d 0,79 0,68 - - -a BSG >10 mm/h. b BSG >30 mm/h. c BSG >40 mm/h. d Hüft- und Knie-TEP. PPV positive predictive value/positiver Vorhersagewert. NPV negative predictive value/negativer Vorhersagewert.
908 | Der Orthopäde 9 · 2006
Leitthema
per gegen humane Granulozyten. Damit
gelingt aber nicht nur ein Nachweis von
Entzündungsherden, sondern auch eine
positive Knochenmarkdarstellung. Die
Akkumulation der markierten Antikör-
per nimmt in einem entzündlichen Fo-
kus typischerweise von den Frühaufnah-
men (4 h) zu den Spätaufnahmen (24 h)
zu. Hier wird ebenfalls die begleiten-
de Durchführung einer 3-Phasen-Skelett-
szintigraphie empfohlen.
Vorteile der AGS gegenüber der Leu-
kozytenszintigraphie sind die schnelle
Verfügbarkeit ohne aufwendige Leuko-
zytenisolation und eine geringere Strah-
lenexposition als bei der 111In-Leukozyten-
szintigraphie. Allerdings besteht aufgrund
der murinen Genese der Antikörper das
Risiko der Ausbildung humaner Anti-
maus-Antikörper und die Gefahr einer
allergischen bzw. anaphylaktischen Reak-
tion, weshalb die AGS nur unter Notfall-
bereitschaft durchgeführt werden sollte.
Die Arbeitsgruppe um Klett u. Kor-
delle [29] fand viel versprechende Ergeb-
nisse für die AGS (s. . Tab. 2) und emp-
fiehlt eine Stufendiagnostik mit der Be-
stimmung von CRP-Wert und AGS. Ei-
ne Erhöhung des CRP und eine posi-
tive AGS wurden dabei als Infektion ge-
wertet. Für das kombinierte Vorgehen im
Rahmen der Stufendiagnostik konnte ei-
ne Sensitivität von 1,00 und eine Spezifität
von 0,83 an 32 Patienten mit Knie-TEP er-
zielt werden. Die Ergebnisse der verschie-
denen Studien zu den vorgestellten Szinti-
graphieverfahren sind in . Tab. 2 zusam-
mengefasst.
Fluor-18-Desoxyglukose-Positronen emissionstomographie (FDG-PET)Ein relativ neues Verfahren in Diagnos-
tik der Endoprotheseninfektion ist die
FDG-PET. Mittels FDG-PET kann über
radioaktiv markierte 18F-Desoxyglukose
eine fokale Steigerung des Glukosestoff-
wechsels (v. a. bei Tumoren und Entzün-
dungsprozessen) nachgewiesen werden.
Der infundierte radioaktiv markierte Zu-
cker reichert sich als „falscher Metabo-
lit“ intrazellulär in Bereichen mit gestei-
gertem Glukosestoffwechsel an und kann
dort mittels PET nachgewiesen werden.
Entscheidend für eine adäquate intrazel-
luläre Aufnahme des Metaboliten ist ein
normaler oder niedriger Blutglukosespie-
gel (nüchterner Patient, strenge Blutzu-
ckereinstellung bei Diabetes mellitus). Bei
hohen Blutzuckerwerten nimmt die Sen-
sitivität des Verfahrens folglich ab.
Wesentliche Vorteile der FDG-PET
sind die geringe Anfälligkeit für Arte-
fakte, die kurze Untersuchungszeit und
die relativ geringe Strahlenbelastung.
Günstig ist außerdem die hohe dreidi-
mensionale Auflösung, wodurch bei ad-
äquater radiologischer Diagnostik eine
exakte Zuordnung fokaler Stoffwechsel-
steigerungen möglich wird. Grundlage ist
dementsprechend eine suffiziente radio-
Tab. 2 Wertigkeit der verschiedenen Szintigraphieverfahren in der Diagnostik der Knie-TEP-Infektion
Autor, Jahr Prothesen (n) Sensitivität Spezifität PPV NPV Genauigkeit
Indium-111
Johnson et al. 1988 [24]a 28 1,00 0,50 0,47 1,00 0,65
Johnson et al. 1988 [24]a,b 28 0,88 0,95 0,88 0,95 0,93
Joseph et al. 2001 [25]c 58e 0,66 0,98 0,91 0,89 0,90
Magnuson et al. 1988 [34] 98e 0,88 0,73 - - 0,81
Palestro et al. 1991 [44] 41 0,89 0,75 0,50 0,96 0,78
Palestro et al. 1991 [44]b 24 0,67 0,78 0,50 0,88 0,75
Palestro et al. 1991 [44]c 19 0,86 1,00 1,00 0,92 0,95
Pring et al. 1986 [48] 50e 1,00 0,91 0,90 1,00 0,93
Rand u. Brown 1990 [49] 38 0,83 0,85 0,83 0,85 0,84
Scher et al. 2000 [51] 88 0,88 0,78 0,75 0,90 0,83
Teller et al. 2000 [53]b 166e 0,64 0,78 0,30 0,93 0,76
Wukich et al. 1987 [60] 24e 0,95 0,45 - - 0,60
Tc-99m-HMPAO
Glithero et al. 1993 [18] 31e 0,50 1,00 1,00 0,81 0,84
Larikka et al. 2001 [30]b 30 0,88 0,77 0,58 0,94 0,80
Larikka et al. 2001 [30]a,b 30 1,00 0,82 0,67 1,00 0,87
Merkel et al. 1985 [38] 16e 0,86 1,00 1,00 0,90 0,94
Pelosi et al. 2004 [47]a,d 95e 0,96 0,96 – – 0,96
Van Acker et al. 2001 [57] 21 1,00 0,53 0,42 1,00 0,65
Van Acker et al. 2001 [57]b 21 1,00 0,93 0,83 1,00 0,95
Tc-99m-Antigranulozyten-AK
Klett et al. 2003 [27]a 28 1,00 0,80 0,81 1,00 0,89
Kordelle et al. 2004 [29] 32 1,00 0,82 0,83 1,00 0,91
von Rothenburg et al. 2004 [59] 38e 0,93 0,65 0,63 0,94 0,76
von Rothenburg et al. 2004 [59] 12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00a Zusätzlich 24 h verzögerte Aufnahmen. b In Kombination mit 99mTc-Knochenszintigraphie. c Leukozytenszintigraphie in Kombination mit 99mTc-markiertem Schwefelkolloid. d Semiquantitative Analyse. e Knie- und Hüft-TEP.
910 | Der Orthopäde 9 · 2006
Leitthema
logische Diagnostik, wodurch die Genau-
igkeit des Verfahrens wesentlich gesteigert
wird [20]. Nachteilig sind die relativ ho-
hen Kosten und die (noch) geringe Ver-
fügbarkeit.
In den bisher publizierten Studien mit
relativ kleinen Fallzahlen konnte durch-
wegs eine hohe Sensitivität bei relativ
hoher Spezifität nachgewiesen werden
(. Tab. 3). Falsch-positive Befunde sind
dabei v. a. auf eine nicht ausreichende ra-
diologische Diagnostik [20] und auf eine
erhöhte Anreicherung des Tracers bei Ab-
riebkrankheit zurückzuführen [26]. Eine
Beurteilung sollte hier wie bei allen nu-
klearmedizinischen Verfahren stets in
Zusammenschau mit einer aktuellen ra-
diologischen Bildgebung erfolgen. Nach
den bisher vorliegenden Daten bietet die
FDG-PET eine viel versprechende Metho-
de, die präoperative Infektabklärung bei
einliegender Knie-TEP zu verbessern.
Mikrobiologische Diagnostik
Die Indikation zur mikrobiologischen Di-
agnostik besteht bei jedem Verdacht auf
Protheseninfektion, da nur ein bakterio-
logischer Nachweis des Infektionserregers
die Diagnose festigen und über ein Anti-
biogramm eine testgerechte antibiotische
Therapie ermöglichen kann!
Um die Sensitivität der mikrobiolo-
gischen Diagnostik nicht zu mindern,
sollte mit dem Beginn der antibiotischen
Therapie bis nach der Probengewinnung
gewartet werden [5], bzw. eine laufende
Antibiotikagabe mindestens 2–4 Wochen
vor Probengewinnung abgesetzt werden.
Nach Absetzen einer Antibiotikatherapie
muss eine regelmäßige klinische Kontrolle
bei potenziellem Sepsisrisiko erfolgen!
Generell sollten Untersuchungen in
soliden und flüssigen Medien auf aerobe
und anaerobe Keime und Pilze erfolgen
[5]. Einzelne Autoren empfehlen eben-
falls die Inkubation des gewonnenen Pro-
bematerials in Blutkulturflaschen [29].
Da es sich bei den Erregern implantatas-
soziierter Infektionen häufig um niedrig
virulente und langsam wachsende Bak-
terien handelt, welche zudem durch ei-
ne vorausgegangene Antibiotikatherapie
geschädigt sein können, sollte eine Inku-
bation mikrobiologischer Proben immer
für mindestens 14 Tage erfolgen. Zudem
sollten die Transportzeiten der mikro-
biologischen Präparate so kurz wie mög-
lich gehalten werden, dies gilt insbesonde-
re bei notfallmäßigen Entnahmen nachts
und an Wochenenden. Bei Vorliegen ei-
ner fistelnden Infektion sollte anstelle des
Tupferabstrichs, welcher häufig durch Kei-
me der Hautflora kontaminiert ist, eine
Curettage des Fistelganges durchgeführt
werden.
GelenkpunktionDie Aspiration von Gelenkflüssigkeit
zur mikrobiologischen Diagnostik bietet
die Möglichkeit der präoperativen Keim-
identifizierung und ist somit in allen Fäl-
Tab. 3 Wertigkeit der FDG-PET in der Diagnostik der Knie-TEP-Infektion
Autor/Jahr Prothesen
(n)
Sensiti-
vität
Spezifität PPV NPV Genauigkeit
Chacko 2002 36 0,92 0,75 - - 0,81
De Winter 2000 17 1,00 0,89 - - 0,94
Gollwitzer et al. 2005 [20] 19 1,00 0,72 0,56 1,00 0,79
Love et al. 2000 [33] 31b 1,00 0,55 0,55 1,00 0,71
Van Acker et al. 2001 [57] 21 1,00 0,73 0,60 1,00 0,81
Van Acker et al. 2001 [57]a 21 1,00 0,80 0,67 1,00 0,86
Zhuang et al. 2001 [61] 36 0,91 0,72 0,59 0,95 0,78a In Kombination mit 3-Phasen Knochenszintigraphie. b Knie- und Hüft-TEP.
Tab. 4 Wertigkeit der mikrobiologischen Kultur von Gelenkpunktaten in der Diagnostik
der Knie-TEP-Infektion
Autor, Jahr Prothesen
(n)
Sensitivität Spezifität PPV NPV Genauigkeit
Barrack et al. 1997 [5] 69 0,55 0,96 0,85 0,84 0,84h
Barrack et al. 1997 [5]d 53 0,75 0,96 0,75 0,96 0,93h
Barrack et al. 1997 [5]e 16 0,42 1,00 1,00 0,36 0,56h
Duff et al. 1996 [13 39 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00g
Fuerst et al. 2005 [16] 75 0,69 0,97 0,85 0,92 0,91g
Glithero et al. 1993 [18] 54a 0,89 0,97 0,94 0,95 0,94g
Kordelle et al. 2004 [29] 39 0,50 1,00 1,00 0,50 0,67f
Johnson et al. 1988 [24] 28a 0,12 0,81 0,25 0,65 0,58h
Levitsky et al. 1991 [31] 72a 0,67 0,96 0,75 0,94 0,91g
Morrey et al. 1989 [41]b 73 0,45 b b b b
Panousis et al. 2005 [45] 92a 0,70 0,95 0,78 0,92 0,90h
Steinbrink u. Frommelt
1995 [52]
2158c 0,82 0,96 0,87 0,94 0,92g
Teller et al. 2000 [53] 166a 0,28 0,99 0,83 0,90 0,90g
Virolainen et al. 2002 [58] 69a 0,75 1,00 - - -a Knie- und Hüft-TEP. b Alle infiziert. c Nur Hüfte. d Ohne vorherige Antibiotikatherapie. e Nach vorheriger Antibiotikatherapie (mindestens 2 Wochen vor Aspiration abgesetzt). f Goldstandard: Histologie.g Goldstandard: intraoperative Kultur (und bei einzelnen Autoren auch klinischer Befund). h Goldstan-dard: intraoperative Kultur und Histologie.
Tab. 5 Wertigkeit der intraoperativen mikrobiologischen Kultur in Übereinstimmung
mit der permanenten Histologie in der Diagnostik der Knie-TEP-Infektion
Autor/Jahr Patienten
(n)
Sensitivität Spezifität PPV NPV Genauigkeit
Atkins et al. 1998 [3] 297a 0,65 0,996 0,96 0,95 0,95e
Kordelle et al. 2004 [29] 50b 0,41 1,00 1,00 0,49 -e
Kordelle et al. 2004 [29] 31c 0,76 0,93 0,93 0,76 -e
Kordelle et al. 2004 [29] 20d 0,25 1,00 1,00 0,67 -e
Panousis et al. 2005 [45] 92a 0,75 0,96 0,75 0,96 0,93f
a Knie- und Hüft-TEPs. b Abstrich. c Inkubation in Blutkulturflasche. d Gewebe. e Goldstandard: Histologie.f Goldstandard: Histologie und Kultur.
911Der Orthopäde 9 · 2006 |
len des geplanten einzeitigen Endoprothe-
senwechsels sowie zur Abklärung bei un-
klarer Infektsituation indiziert.
Die Punktion eines Gelenks mit einlie-
gender Prothese hat aufgrund des erhöh-
ten Infektionsrisikos unter strengsten ste-
rilen Kautelen wie bei einem operativen
Eingriff zu erfolgen! Aufgrund des Konta-
minationsrisikos durch Hautkeime muss
die Bewertung gerade eines positiven mi-
krobiologischen Befunds durch Sapro-
phyten (koagulasenegative Staphylokok-
ken, Propionibakterien, Korynebakte-
rien) kritisch beurteilt und die Punktion
gegebenenfalls wiederholt werden. Durch
Wiederholung der Aspiration kann auch
eine Steigerung der Sensitivität – insbe-
sondere bei Patienten unter laufender
Antibiotikatherapie – erreicht werden [5].
Besteht bei mehreren Proben weiterhin
eine Unsicherheit in der Beurteilung, so
kann eine molekulare Typisierung weitere
Informationen liefern. Generell resultie-
ren aus der Punktion des Kniegelenks we-
niger falsch-positive Befunde als bei Hüft-
punktion, was wahrscheinlich auf die in-
guinal höhere Keimbesiedelung zurück-
zuführen ist [5].
Die Wertigkeit der Gelenkpunktion in
der Diagnostik der Knie-TEP-Infektion
wird nach wie vor nicht einheitlich beur-
teilt, und die vorliegenden Studiendaten
zeigten sehr unterschiedliche Ergebnisse
(. Tab. 4). Diese Unterschiede sind zum
einen durch die Vielzahl verschiedener
Inkubations- und Entnahmeverfahren
verursacht, und zum anderen auf die un-
terschiedlichen Goldstandards zur defini-
tiven Diagnose der TEP-Infektion zurück-
zuführen.
Aufgrund der doch sehr schwanken-
den Sensitivität sollte mit der entgültigen
Diagnosestellung auf den Erhalt der in-
traoperativen Kulturen und insbesonde-
re der permanenten Histologie gewar-
tet werden [32]. Auch in großen Studien
– wie bei Steinbrink u. Frommelt [52] an
>2000 Hüftendoprothesen untersucht –
konnten nur 82% der Infektionen durch
eine präoperative Punktion aufgedeckt
werden. Etwa jede 5. TEP-Infektion bleibt
somit bei der präoperativen Punktion un-
diagnostiziert.
Unbestritten ist die hohe Spezifität bei
positivem Keimnachweis, was zu einer
insgesamt guten Genauigkeit des Verfah-
rens führt (. Tab. 4). Positive Befunde
können jedoch theoretisch immer durch
eine Kontamination bedingt sein, wes-
halb sich der Operateur nicht blind auf
den Punktatbefund verlassen sollte!
Der Einfluss systemischer Antibioti-
ka auf die Wertigkeit der Gelenkpunkti-
on wurde durch Barrack et al. [5] in ei-
ner Studie an insgesamt 69 Patienten un-
tersucht. Aspirate von Patienten ohne po-
sitive Antibiotikaanamnese waren signi-
fikant sensitiver und genauer als Punkti-
onen bei Patienten, welche vorher – auch
mit einem antibiotikafreien Intervall von
>14 Tagen bis zur Punktion – Antibioti-
ka einnahmen (s. . Tab. 4). Ein Absetzen
der Antibiotika 2 Wochen vor Aspiration
konnte die Sensitivität also nur in gerin-
gem Maße steigern [5].
Im Falle eines wiederholt negativen
Keimnachweises bei klinischem Verdacht
auf eine chronische Infektion kann ei-
ne Arthroskopie zur weiteren Diagnos-
tik und Gewinnung von Probenmaterial
in Erwägung gezogen werden. Fuerst et
al. [16] konnten für die mikrobiologische
Untersuchung arthroskopisch gewon-
nener Proben (ohne vorheriges Anfüllen
des Gelenkes mit Spülflüssigkeit) bei 26
untersuchten Knie-TEP eine Sensitivität
von 1,00 bei gleichzeitig hoher Spezifität
nachweisen (Spezifität=0,95, PPV=0,87,
NPV=1,00, Genauigkeit=0,96). Ein wei-
terer Vorteil ist sicherlich die gleichzeitige
Möglichkeit der Gewebegewinnung zur
histologischen Aufarbeitung und die Be-
urteilung des Gelenkbinnenraums.
Die Gramfärbung von Gelenkpunk-
taten und Gewebeproben besitzt für die
Infektdiagnostik aufgrund der geringen
Sensitivität keine Bedeutung [3, 5, 11].
Intraoperativ gewonnene GewebebiopsienFür die Gewinnung intraoperativer Ge-
webeproben zur mikrobiologischen Un-
Tab. 6 Wertigkeit der PCR zum Nachweis von DNA für bakterielle 16S-rRNA in der
Diagnostik der Knie-TEP-Infektion
Autor/Jahr Patienten
(n)
Sensitivität Spezifität PPV NPV Genauigkeit
Kordelle et al. 2004 [28] 50a 0,36 1,00 1,00 0,61 0,68c
Kordelle et al. 2004 [29] 22 0,20 1,00 1,00 0,60 0,62c
Mariani et al. 1996 [35] 50 1,00 0,49 0,41 1,00 0,62b
Panousis et al. 2005 [45] 92a 0,92 0,74 0,34 0,98 0,76d
a Knie- und Hüft-TEP. b Goldstandard: intraoperative Kultur. c Goldstandard: Histologie. d Goldstandard: intraoperative Kultur und Histologie.
Tab. 7 Wertigkeit der Histologie in der Diagnostik der Knie-TEP-Infektion
Autor/Jahr Prothe-
sen (n)
Sensitivität Spezifität PPV NPV Genauig-
keit
Gefrierschnitt
Abdul-Karim et al. 1998 [1]a 64b 0,43 0,97 0,40 0,93 0,91d
Athanasou et al. 1995 [2] 106b 0,90 0,96 0,88 0,98 0,95f
Banit et al. 2002 [4]c 55 1,00 0,96 0,82 1,00 0,96f
Fehring u. McAlister 1994 [14] 107b 0,18g 0,90 0,18 0,90 0,81f
Feldman et al. 1995 [15]a 33b 1,00 0,96 0,90 1,00 0,97f
Feldman et al. 1995 [15]a 33b 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00e
Lonner et al. 1996 [32]a 175b 0,84 0,96 0,70 0,98 -e
Lonner et al. 1996 [32]c 175b 0,84 0,99 0,89 0,98 -e
Pace et al. 1997 [43] 25b 0,82 0,93 0,82 0,86 0,88f
Panousis et al. 2005 [45] 92b 0,92 0,74 0,34 0,98 0,76d
Permanente Histologie
Duff et al. 1996 [13] 55 0,93 0,98 0,93 0,98 0,96
Lonner et al. 1996 [32] 175b 0,94 0,98 0,67 0,99 -f
Panousis et al. 2005 [45] 92b 0,92 1,00 1,00 0,98 0,76d
a >5 PMNs/high power field (x40). b Knie- und Hüft-TEP. c >10 PMNs/high power field (x40). d Goldstan-dard Kombination aus Kultur und permanenter Histologie. e Goldstandard: permanente Histologie.f Goldstandard: mikrobiologische Kultur. g Analyse ohne vorher festgelegte Kriterien.
912 | Der Orthopäde 9 · 2006
Leitthema
tersuchung gilt wie bei der Punktion, dass
zur Vermeidung falsch-positiver Befunde
auf eine streng sterile Entnahme geachtet
werden muss. Dies bedeutet, dass wäh-
rend der Probenentnahme jeglicher Kon-
takt mit der Haut des Patienten oder mit
Handschuhen vermieden werden sollte.
Zur Vermeidung von Kreuzkontami-
nationen sollte jeweils das Entnahme-
instrument gewechselt werden. Die Ent-
nahme multipler Proben wird empfohlen
(>5), da hierbei zum einen das Risiko eines
falsch-negativen Befundes reduziert wer-
den kann, zum anderen die Differenzie-
rung von Kontamination und echter In-
fektion vereinfacht wird [3]. Die alleinige
Materialentnahme mittels Abstrichtupfer
hat sich nicht als suffizient herausgestellt,
hier sollte zudem Gewebe von repräsenta-
tiven Lokalisationen entnommen werden
(Abszessmembran, Sequester, Knochen-
Implantat-Interface).
Die in . Tab. 5 angegebenen Studien-
ergebnisse zur Wertigkeit der intraopera-
tiven Mikrobiologe sind weniger als echte
Sensitivitäten und Spezifitäten zu sehen,
sondern mehr als Korrelation von intra-
operativer Kultur und Histologie, welche
regelhaft als Goldstandard herangezogen
werden.
Von Tunney et al. [56] wurde die Ein-
sendung des explantierten Kunstgelenks
zur aeroben und anaeroben mikrobiolo-
gischen Untersuchung empfohlen. Nach
den vorliegenden Ergebnissen konnte da-
durch ein Keimnachweis bei >70% der
angeblich „aseptischen“ Endoprothesen-
lockerungen der Hüfte erbracht werden.
Die Interpretation dieser Resultate und
die klinische Relevanz bleiben abzuwar-
ten.
PolymerasekettenreaktionBei der Polymerasekettenreaktion (PCR,
polymerase chain reaction) macht man
sich einer DNA-Amplifikationstechno-
logie zum Nachweis bakterieller DNA in
Synovia und periprothetischem Gewebe
zu Nutzen. Über repetitive Zyklen einer
primergestützten DNA-Synthese gelingt
eine Verstärkung einer spezifischen „Vor-
lage-DNA“ (Template). Der Nachweis die-
ser Template-DNA ist bereits mit sehr ge-
ringen Bakterienmengen möglich, theore-
tisch ist eine einzige Kopie des Genmateri-
als ausreichend [35]. Diese hohe Empfind-
lichkeit des Verfahrens ist auch der Grund
für die große Anfälligkeit durch Konta-
mination. Typischerweise wird der Nach-
weis eines Gens angestrebt, welches für
die bakterielle ribosomale 16S-RNA (16S-
rRNA) kodiert. Ein positiver PCR-Befund
ist somit hinweisend auf vorliegende bak-
terielle DNA, jedoch unspezifisch für die
verschiedenen Bakterienspezies.
Bei der PCR handelt es sich um ein
schnelles und sensitives Verfahren, wel-
ches jedoch für Knochen- und Gelenkma-
terialien (mit Ausnahme der M.-tubercu-
losis-PCR) noch nicht validiert oder zu-
gelassen wurde [17]. Aufgrund des Nach-
weises von bakterieller DNA und DNA-
Fragmenten gelingt der PCR keine Aus-
sage über die klinische Relevanz und die
Replikationsfähigkeit der nachgewiesenen
Bakterien. So kann die PCR auch nach
antibiotischer Eradikation von Bakterien
noch ein positives Ergebnis durch Repli-
kation verbliebener DNA-Fragmente lie-
fern.
Wie . Tab. 6 zeigt, beruht die Bewer-
tung der PCR in der Diagnostik der TEP-
Infektion auf sehr unterschiedlichen Er-
fahrungen, weshalb nach der bisherigen
Studienlage keine valide Aussage zur Wer-
tigkeit getroffen werden kann. Schwie-
rigkeiten bereitet häufig die Differenzie-
rung von richtig-positiven Befunden und
falsch-positiven Befunden aufgrund von
Kontaminationen. „Falsch-positive“ Be-
funde bei negativer mikrobiologischer
Kultur können durch Kontamination,
aber auch durch niedrig virulente Orga-
nismen, geringe Bakterienzahlen, eine
starke Immunabwehr und den Nachweis
bakterieller Fragmente ohne klinische Re-
levanz verursacht werden.
Hier stellt sich auch die Frage, ob die
Häufigkeit der septischen Endoprothe-
senlockerung nicht bislang weitgehend
unterschätzt wurde. So konnten mittels
PCR wesentlich höhere Raten an bakte-
rieller Besiedelung von bislang als „asep-
tisch“ eingestuften Endoprothesenlocke-
rungen nachgewiesen werden [8, 56]. Die
klinische Relevanz dieser Beobachtungen
ist jedoch bisher unklar.
Zur Reduzierung des Risikos falsch-
positiver Befunde kann der direkte Nach-
weis von bakterieller rRNA als Ausdruck
transkriptionsfähiger Bakterien an-
gestrebt werden. Des Weiteren wird häu-
fig ein Schwellenwert des PCR-Signals zur
Differenzierung von Kontamination und
echtem Befund in der Größe von 10 lysier-
ten Bakterienzellen festgelegt [35]. Falsch-
negative Befunde können durch Polyme-
raseenzyminhibitoren in der Synovia oder
durch Verluste aufgrund von Fehlern in
der PCR-Durchführung verursacht wer-
den.
Bisher kann die PCR aufgrund der
nicht unwesentlichen Kosten und der un-
sicheren Sensitivität und Spezifität nicht
als Standardverfahren in der Infektdi-
agnostik nach Knie-TEP empfohlen wer-
den. Indikationen bestehen in der Dia-
gnosesicherung bei fortbestehendem kli-
nischen Verdacht trotz wiederholt nega-
tiver Kulturen, und insbesondere bei „ste-
rilen Infektionen“, wie sie z. B. durch (aty-
pische) Mykobakterien verursacht werden
können [21].
Zytologie und Histologie
Synoviale ZellanalyseDie zytologische Analyse des Gelenkpunk-
tats stellt ein einfaches und weitgehend
unterschätztes Diagnostikum der Endo-
protheseninfektion dar. Mit der Punktion
des Gelenks für die mikrobiologische Un-
tersuchung empfiehlt sich die begleitende
zytologische Evaluation. Dazu sollte die
Gelenkflüssigkeit in einem EDTA-Röhr-
chen gesammelt werden und auf erhöhten
Proteingehalt, erniedrigte Glukosewerte,
sowie v. a. auf eine Vermehrung der Leu-
kozytenzahlen und einen erhöhten Anteil
polymorphkerniger neutrophiler Granu-
lozyten hin untersucht werden.
Trampuz et al. [54] konnten bei
133 Patienten aussagekräftige Ergeb-
nisse für eine periprothetische Infektion
mit Grenzwerten der Leukozytenzahlen
von >1,7×103/μl (Sensitivität=94%, Spe-
zifität=88%, PPV=0,73, NPV=0,98) und
einem Anteil der neutrophilen Granulo-
zyten von mehr als 65% (Sensitivität=97%,
Spezifität=98%, PPV=0,94, NPV=0,99)
nachweisen [54]. Aufgrund der häufig
niedrigen Virulenz der Erreger bei Pro-
theseninfekten müssen den Autoren zu-
folge auch die Grenzwerte verglichen mit
nativen Gelenken niedriger angesiedelt
werden.
Mason et al. [37] bestätigten die Nütz-
lichkeit der Leukozytenanalyse im Ge-
lenkpunktat und empfahlen als Grenz-
werte ≥2,5×103 Leukozyten/μl und einen
Anteil von ≥60% polymorphkernigen
Zellen. Für die Kombination beider Kri-
terien fand die Arbeitsgruppe eine Sen-
sitivität von 0,98 bei einer ebenfalls sehr
hohen Spezifität von 0,95 (PPV=0,91,
NPV=0,82). Bei entzündlichen Grunder-
krankungen (z. B. rheumatoide Arthritis)
ist die zytologische Analyse der Gelenk-
flüssigkeit hingegen nur eingeschränkt
aussagekräftig.
HistologieWie bei der mikrobiologischen Untersu-
chung wird auch zur histologischen Aus-
wertung die Entnahme multipler Proben
empfohlen. Entscheidend ist auch hier
die Entnahme des Gewebes aus repräsen-
tativen Arealen, um falsch-negative Be-
funde zu vermeiden [14, 32]. Die histolo-
gische Beurteilung erfolgt zumeist nach
den Kriterien von Mirra et al. [39, 40] mit
der Auswertung von mindestens 5 „high
power fields“. Dabei erfolgt die Auszäh-
lung der neutrophilen Granulozyten im
Gewebe (nicht in Fibrin), ein positiver
Befund entspricht einer Zahl von >5 bzw.
>10 neutrophilen Granulozyten pro „high
power field“ (40fache Vergrößerung) [32,
39, 40].
Generell können der intraoperative
Gefrierschnitt und die permanenten His-
tologie differenziert werden. Für die in-
traoperative Gefrierschnittuntersuchung
konnte regelrecht eine hohe Korrelation
mit der mikrobiologischen Kultur nach-
gewiesen werden (. Tab. 7). Die intra-
operative Gramfärbung besitzt aufgrund
der geringen Sensitivität keine Bedeutung
[3].
Verglichen mit der Gefrierschnittun-
tersuchung gilt die permanente Histolo-
gie als das sicherere Verfahren, da nicht
nur wenige Bereiche untersucht werden,
sondern eine sequentielle Analyse des ge-
samten Gewebes erfolgt. Die in . Tab. 7
angegeben Werte für die Histologie zei-
gen durchwegs eine hohe Genauigkeit des
Verfahrens, weshalb die Histologie noch
am ehesten als alleiniger Goldstandard
angesehen werden kann. Jedoch werden
auch bei diesem Verfahren keine 100%ige
Sensitivität und Spezifität erreicht.
Diskussion
Obwohl die Endoprotheseninfektion so
alt ist wie die Kniegelenkendoprothetik
selbst, herrscht nach wie vor weder ein
Konsens über die Diagnostik, noch über
die beste Therapie. Kein diagnostisches
Verfahren besitzt alleine eine 100%ige
Sensitivität und Spezifität. Dies führt folg-
lich zu Unsicherheiten in der Interpreta-
tion der Studienergebnisse zu diagnosti-
schen Verfahren, da selbst die Goldstan-
dards (meist intraoperative Kultur oder
Histologie) nur eingeschränkte Gültigkeit
besitzen.
Zur validen definitiven Diagnosestel-
lung der Knie-TEP-Infektion wird eine
Zusammenschau der verschiedenen Be-
funde aus Laborwerten, Mikrobiologie,
Histologie, intraoperativen Befunden und
Nachbeobachtung empfohlen. Hier sollte
ein einheitlicher Konsens zur Vergleich-
barkeit zukünftiger Studien angestrebt
werden.
Für die einzelnen diagnostischen Ver-
fahren liegen häufig Studien mit erstaun-
lichen Unterschieden zur Wertigkeit der
Verfahren vor. Derart gravierende Unter-
schiede sind neben den unsicheren Gold-
standards vor allem auf zu kleine Pati-
entenkollektive zurückzuführen. Einzel-
ne Patienten haben dadurch einen deut-
lichen Einfluss auf die Resultate. Für die
valide Beurteilung diagnostischer Verfah-
ren sind große Studien notwendig, welche
aufgrund der allgemein geringen Infekti-
onsrate als Multicenterstudien angelegt
werden müssen.
Unterschiede in den Studienergeb-
nissen sind auch durch die individuellen
Entscheidungsgrenzen zwischen „infi-
ziert“ und „nicht infiziert“ zurückzufüh-
ren, welche gerade bei neueren Verfah-
ren wie der FDG-PET subjektiv oder gar
retrospektiv festgelegt werden. Bei nied-
rigen Schwellenwerten wird meist eine
hohe Sensitivität bei niedriger Spezifität
erreicht, hohe Schwellenwerte führen zu
gegenteiligen Ergebnissen.
Ferner werden die Ergebnisse entschei-
dend durch die Patientenauswahl beein-
flusst. So berichten retrospektive Untersu-
chungen zu invasiven und nuklearmedizi-
nischen Verfahren regelhaft über ein vorse-
lektiertes Patientengut, da gerade Patienten
mit unsicherer Infektsituation diesen zu-
914 | Der Orthopäde 9 · 2006
Leitthema
sätzlichen Verfahren unterzogen wurden.
Andererseits ist aber gerade das Patienten-
gut mit klinisch und laborchemisch unsi-
cherem Infektstatus für die weiteren dia-
gnostischen Untersuchungen relevant.
Zusammenfassend kann man fest-
halten, dass eine BSG<10 mm/h und ein
CRP<0,5 mg/dl einen periprothetischen
Infekt bereits mit relativ hoher Sicherheit
ausschließen. Bei klinischem Verdacht
oder Erhöhung der Entzündungsparame-
ter sollte eine präoperative Gelenkpunkti-
on zur Diagnosesicherung durchgeführt
werden. Hier sollte neben der mikrobio-
logischen Untersuchung eine zytologische
Auswertung erfolgen. Die mikrobiolo-
gische Untersuchung besitzt trotz einge-
schränkter Sensitivität aufgrund der hohen
Spezifität und der Möglichkeit der präope-
rativen Keimdifferenzierung einen hohen
Stellenwert. Bei fortbestehender diagnosti-
scher Unsicherheit besteht die Möglichkeit
der nuklearmedizinischen Untersuchung
mittels sequentieller Leukozytenszintigra-
phie, AGS oder FDG-PET. Die neueren
Verfahren AGS und FDG-PET könnten
Vorteile in der Diagnostik der Knie-TEP-
Infektion haben, jedoch müssen die vor-
liegenden Daten noch in größeren Studi-
en bestätigt werden.
Intraoperativ empfiehlt sich die mikro-
biologische und histologische Auswertung
mehrerer Proben, zur definitiven Festle-
gung des operativen Procederes kann bei
Unsicherheit auch noch die Gefrierschnitt-
untersuchung herangezogen werden. In-
wieweit eine mikrobiologische Untersu-
chung des Explantats und die PCR Bedeu-
tung erlangen, bleibt abzuwarten.
Ebenso kann die Entwicklung neuerer
Verfahren wie die Genexpressionsanaly-
se mittels Genchips mit Spannung erwar-
tet werden. In einer ersten Arbeit konnten
Deirmengian et al. [10] ausgezeichnete Re-
sultate in der Diagnostik bakterieller Ar-
thritiden erzielen. Durch eine Analyse des
Genexpressionsmusters der Leukozyten in
synovialer Flüssigkeit gelang eine sichere
Unterscheidung von septischer Arthritis
und gichtbedingter Entzündungsreaktion.
Anhand des eingesetzten Genchips konn-
te die Expression von nicht weniger als 1615
Genen untersucht werden.
Fazit für die Praxis
Trotz der Entwicklung moderner dia-
gnostischer Verfahren wie FDG-PET und
PCR stellt die sichere präoperative Di-
agnostik der Knie-TEP-Infektion eine
große Herausforderung dar. Basis der
Infektionsabklärung bleibt neben der
Anamnese und der klinischen Unter-
suchung die Bestimmung der Entzün-
dungsparameter, und hier insbesondere
von BSG und CRP. Eine normale BSG bei
normalem CRP schließt einen Infekt mit
relativ großer Sicherheit aus. Bei klinisch
weiter bestehendem Infektverdacht kön-
nen die nuklearmedizinischen Untersu-
chungen und hier v. a. die AGS und die
FDG-PET zum Infektausschluss genutzt
werden. Bei positiven Befunden emp-
fiehlt sich die mikrobiologische Abklä-
rung, um anhand der hochspezifischen
präoperativen Punktion nicht nur die Di-
agnose zu sichern, sondern auch den
Keimnachweis zu führen.
Eine zytologische Untersuchung des
Punktats mit Nachweis erhöhter Leuko-
zytenzahlen und eines gesteigerten An-
teils an polymorphkernigen neutrophi-
len Granulozyten (>65%) besitzt nach
der vorliegenden Datenlage eine gu-
te Aussagekraft. Besteht ein Verdacht
auf Infektion und gelingt ein präopera-
tiver Keimnachweis nicht, so sollte intra-
operativ der diagnostische Verdacht mit-
tels histologischer Gefrierschnittuntersu-
chung erhärtet oder widerlegt werden.
Die endgültige Diagnose kann letztend-
lich nur mittels Histologie und intraope-
rativer Bakterienkultur gesichert werden.
Als wesentliches Fazit bleibt anzumer-
ken, dass eine vorausgehende (unge-
zielte) antibiotische Therapie die Sen-
sitivität der mikrobiologischen Verfah-
ren signifikant herabsetzt und möglichst
erst nach erfolgter Probenentnahme be-
gonnen werden sollte. Aufgrund der ge-
ringen Proliferationsrate der meist nied-
rig virulenten Erreger implantatassozi-
ierter Infektionen sollte eine Inkubation
des Probenmaterials auf verschiedenen
Nährmedien (flüssig, fest, anaerob, ae-
rob) über mindestens 14 Tage erfolgen.
Gelenkpunktate sollten zusätzlich zyto-
logisch untersucht werden. Intraopera-
tiv sollten mindestens 5 Proben aus ver-
schiedenen repräsentativen Arealen as-
serviert und sowohl mikrobiologisch als
auch histologisch analysiert werden. Die
nuklearmedizinischen Verfahren kön-
nen meist nur bei negativen Befunden zu
einem relativ sicheren Infektausschluss
beitragen, positive Ergebnisse sollten im-
mer in Zusammenschau mit den anderen
Befunden kritisch beurteilt werden.
Korrespondierender AutorDr. H. GollwitzerAbteilung für Unfall- und Wiederherstellungs-chirurgie, Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, Prof.-Küntscher-Straße 8, 82418 Murnau/ [email protected]
Interessenkonflikt. Es besteht kein Interessenkon-
flikt. Der korrespondierende Autor versichert, dass kei-
ne Verbindungen mit einer Firma, deren Produkt in
dem Artikel genannt ist, oder einer Firma, die ein Kon-
kurrenzprodukt vertreibt, bestehen. Die Präsentation
des Themas ist unabhängig und die Darstellung der In-
halte produktneutral.
Literatur
1. Abdul-Karim FW, McGinnis MG, Kraay M et al.
(1998) Frozen section biopsy assessment for the
presence of polymorphonuclear leukocytes in pa-
tients undergoing revision of arthroplasties. Mod
Pathol 11(5): 427–431
2. Athanasou NA, Pandey R, de Steiger R et al. (1995)
Diagnosis of infection by frozen section during re-
vision arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 77(1): 28–
33
3. Atkins BL, Athanasou N, Deeks JJ et al. (1998) Pro-
spective evaluation of criteria for microbiologi-
cal diagnosis of prosthetic-joint infection at revi-
sion arthroplasty. The OSIRIS Collaborative Study
Group. J Clin Microbiol 36(10): 2932–2939
4. Banit DM, Kaufer H, Hartford JM (2002) Intraope-
rative frozen section analysis in revision total joint
arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 401: 230–238
5. Barrack RL, Jennings RW, Wolfe MW, Bertot AJ
(1997) The Coventry Award. The value of preopera-
tive aspiration before total knee revision. Clin Or-
thop Relat Res 345: 8–16
6. Bengtson S (1993) Prosthetic osteomyelitis with
special reference to the knee: risks, treatment and
costs. Ann Med 25(6): 523–529
7. Bengtson S, Knutson K (1991) The infected knee
arthroplasty. A 6-year follow-up of 357 cases. Acta
Orthop Scand 62(4): 301–311
8. Clarke MT, Roberts CP, Lee PT et al. (2004) Polyme-
rase chain reaction can detect bacterial DNA in
aseptically loose total hip arthroplasties. Clin Or-
thop Relat Res 427: 132–137
9. Davis LP (1994) Nuclear imaging in the diagnosis
of the infected total joint arthroplasty. Semin Ar-
throplasty 5(3): 147–152
10. Deirmengian C, Lonner JH, Booth RE Jr (2005) The
Mark Coventry Award: white blood cell gene ex-
pression: a new approach toward the study and
diagnosis of infection. Clin Orthop Relat Res 440:
38–44
915Der Orthopäde 9 · 2006 |
11. Della Valle CJ, Scher DM, Kim YH et al. (1999) The
role of intraoperative Gram stain in revision total
joint arthroplasty. J Arthroplasty 14(4): 500–504
12. Di Cesare PE, Chang E et al. (2005) Serum interleu-
kin-6 as a marker of periprosthetic infection fol-
lowing total hip and knee arthroplasty. J Bone
Joint Surg Am 87(9): 1921–1927
13. Duff GP, Lachiewicz PF, Kelley SS (1996) Aspiration
of the knee joint before revision arthroplasty. Clin
Orthop Relat Res 331: 132–139
14. Fehring TK, McAlister JA Jr (1994) Frozen histologic
section as a guide to sepsis in revision joint arthro-
plasty. Clin Orthop Relat Res 304: 229–237
15. Feldman DS, Lonner JH, Desai P, Zuckerman JD
(1995) The role of intraoperative frozen sections in
revision total joint arthroplasty. J Bone Joint Surg
Am 77(12): 1807–1813
16. Fuerst M, Fink B, Ruther W (2005) Die Wertigkeit
von präoperativer Punktion und arthroskopischer
Synopvialisprobenentnahme bei Knietotalendo-
prothesenwechsel. Z Orthop Ihre Grenzgeb 143(1):
36–41
17. Geipel U, Herrmann M (2004) Das infizierte Im-
plantat. Teil 1: Bakteriologie. Orthopade 33(12):
1411–1426
18. Glithero PR, Grigoris P, Harding LK et al. (1993)
White cell scans and infected joint replacements.
Failure to detect chronic infection. J Bone Joint
Surg Br 75(3): 371–374
19. Gollwitzer H, Burgkart R, Diehl P et al. (2006) The-
rapie der Arthrofibrose nach Kniegelenkendopro-
thetik. Orthopade 35(2): 143–152
20. Gollwitzer H, Heizer V, Stahl A et al. (2005) Die F-
18-FDG-PET als neues Verfahren zur präoperativen
Diagnostik der Totalendoprotheseninfektion: Was
ist der Nutzen für den orthopädischen Chirurgen?
Eine prospektive Studie. 1. Gemeinsamer Kongress
Orthopädie – Unfallchirurgie, Berlin, 2005
21. Gollwitzer H, Langer R, Diehl P, Mittelmeier W
(2004) Chronic osteomyelitis due to Mycobacteri-
um chelonae diagnosed by polymerase chain re-
action homology matching. A case report. J Bone
Joint Surg Am 86(6): 1296–1301
22. Hanssen AD, Rand JA (1999) Evaluation and treat-
ment of infection at the site of a total hip or knee
arthroplasty. Instr Course Lect 48: 111–122
23. Henderson JJ, Bamford DJ, Noble J, Brown JD
(1996) The value of skeletal scintigraphy in predic-
ting the need for revision surgery in total knee re-
placement. Orthopedics 19(4): 295–299
24. Johnson JA, Christie MJ, Sandler MP et al. (1988)
Detection of occult infection following total joint
arthroplasty using sequential technetium-99m
HDP bone scintigraphy and indium-111 WBC ima-
ging. J Nucl Med 29(8): 1347–1353
25. Joseph TN, Mujtaba M, Chen AL et al. (2001) Effica-
cy of combined technetium-99m sulfur colloid/in-
dium-111 leukocyte scans to detect infected total
hip and knee arthroplasties. J Arthroplasty 16(6):
753–758
26. Kisielinski K, Cremerius U, Reinartz P, Niethard FU
(2003) Fluordeoxyglucose positron emission to-
mography detection of inflammatory reactions
due to polyethylene wear in total hip arthroplasty.
J Arthroplasty 18(4): 528–532
27. Klett R, Kordelle J, Stahl U et al. (2003) Immunos-
cintigraphy of septic loosening of knee endopros-
thesis: a retrospective evaluation of the antigranu-
locyte antibody BW 250/183. Eur J Nucl Med Mol
Imaging 30(11): 1463–1466
28. Kordelle J, Hossain H, Stahl U et al. (2004) Wert der
16 s rDNA Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) zur
intraoperativen Infektdetektion bei Endoprothe-
senrevisionseingriffen. Z Orthop Ihre Grenzgeb
142(5): 571–576
29. Kordelle J, Klett R, Stahl U et al. (2004) Infektdi-
agnostik nach Knie-TEP-Implantation. Z Orthop Ih-
re Grenzgeb 142(3): 337–343
30. Larikka MJ, Ahonen AK, Junila JA et al. (2001) Im-
proved method for detecting knee replacement
infections based on extended combined 99mTc-
white blood cell/bone imaging. Nucl Med Com-
mun 22(10): 1145–1150
31. Levitsky KA, Hozack WJ, Balderston RA et al. (1991)
Evaluation of the painful prosthetic joint. Relative
value of bone scan, sedimentation rate, and joint
aspiration. J Arthroplasty 6(3): 237–244
32. Lonner JH, Desai P, Dicesare PE et al. (1996) The re-
liability of analysis of intraoperative frozen sec-
tions for identifying active infection during revisi-
on hip or knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am
78(10): 1553–1558
33. Love C, Pugliese PV, Afriyie MO et al. (2000) Utility
of F-18 FDG Imaging for diagnosing the infected
joint replacement. Clin Positron Imag 3(4): 159
34. Magnuson JE, Brown ML, Hauser MF et al. (1988)
In-111-labeled leukocyte scintigraphy in sus-
pected orthopedic prosthesis infection: compa-
rison with other imaging modalities. Radiology
168(1): 235–239
35. Mariani BD, Martin DS, Levine MJ et al. (1996) The
Coventry Award. Polymerase chain reaction detec-
tion of bacterial infection in total knee arthroplas-
ty. Clin Orthop Relat Res 331: 11–22
36. Martinot M, Sordet C, Soubrier M et al. (2005) Dia-
gnostic value of serum and synovial procalcitonin
in acute arthritis: a prospective study of 42 pati-
ents. Clin Exp Rheumatol 23(3): 303–310
37. Mason JB, Fehring TK, Odum SM et al. (2003) The
value of white blood cell counts before revision to-
tal knee arthroplasty. J Arthroplasty 18(8): 1038–
1043
38. Merkel KD, Brown ML, Dewanjee MK, Fitzgerald RH
Jr (1985) Comparison of indium-labeled-leukocyte
imaging with sequential technetium-gallium scan-
ning in the diagnosis of low-grade musculoskel-
etal sepsis. A prospective study. J Bone Joint Surg
Am 67(3): 465–476
39. Mirra JM, Amstutz HC, Matos M, Gold R (1976) The
pathology of the joint tissues and its clinical rele-
vance in prosthesis failure. Clin Orthop Relat Res
117: 221–240
40. Mirra JM, Marder RA, Amstutz HC (1982) The pa-
thology of failed total joint arthroplasty. Clin Or-
thop Relat Res 170: 175–183
41. Morrey BF, Westholm F, Schoifet S et al. (1989)
Long-term results of various treatment options for
infected total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat
Res 248: 120–128
42. Niskanen RO, Korkala O, Pammo H (1996) Serum
C-reactive protein levels after total hip and knee
arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 78(3): 431–433
43. Pace TB, Jeray KJ, Latham JT Jr (1997) Synovial tis-
sue examination by frozen section as an indicator
of infection in hip and knee arthroplasty in com-
munity hospitals. J Arthroplasty 12(1): 64–69
44. Palestro CJ, Swyer AJ, Kim CK, Goldsmith SJ (1991)
Infected knee prosthesis: diagnosis with In-111
leukocyte, Tc-99m sulfur colloid, and Tc-99m MDP
imaging. Radiology 179(3): 645–648
45. Panousis K, Grigoris P, Butcher I et al. (2005) Poor
predictive value of broad-range PCR for the detec-
tion of arthroplasty infection in 92 cases. Acta Or-
thop 76(3): 341–346
46. Peersman G, Laskin R, Davis J, Peterson M (2001)
Infection in total knee replacement: a retrospec-
tive review of 6489 total knee replacements. Clin
Orthop Relat Res 392: 15–23
47. Pelosi E, Baiocco C, Pennone M et al. (2004) 99mTc-
HMPAO-leukocyte scintigraphy in patients with
symptomatic total hip or knee arthroplasty: impro-
ved diagnostic accuracy by means of semiquanti-
tative evaluation. J Nucl Med 45(3): 438–444
48. Pring DJ, Henderson RG, Keshavarzian A et al.
(1986) Indium-granulocyte scanning in the painful
prosthetic joint. AJR Am J Roentgenol 147(1): 167–
172
49. Rand JA, Brown ML (1990) The value of indium 111
leukocyte scanning in the evaluation of painful or
infected total knee arthroplasties. Clin Orthop Re-
lat Res 259: 179–182
50. Reing CM, Richin PF, Kenmore PI (1979) Differenti-
al bone-scanning in the evaluation of a painful to-
tal joint replacement. J Bone Joint Surg Am 61(6):
933–936
51. Scher DM, Pak K, Lonner JH et al. (2000) The pre-
dictive value of indium-111 leukocyte scans in the
diagnosis of infected total hip, knee, or resection
arthroplasties. J Arthroplasty 15(3): 295–300
52. Steinbrink K, Frommelt L (1995) Behandlung der
periprothetischen Infektion der Hüfte durch ein-
zeitige Austauschoperation. Orthopäde 24: 335–
343
53. Teller RE, Christie MJ, Martin W et al. (2000) Se-
quential indium-labeled leukocyte and bone scans
to diagnose prosthetic joint infection. Clin Orthop
Relat Res 373: 241–247
54. Trampuz A, Hanssen AD, Osmon DR, et al. (2004)
Synovial fluid leukocyte count and differential for
the diagnosis of prosthetic knee infection. Am J
Med 117(8): 556–562
55. Tsukayama DT, Estrada R, Gustilo RB (1996) In-
fection after total hip arthroplasty. A study of the
treatment of one hundred and six infections. J Bo-
ne Joint Surg Am 78(4): 512–523
56. Tunney MM, Patrick S, Gorman SP, Nixon JR et al.
(1998) Improved detection of infection in hip re-
placements. A currently underestimated problem.
J Bone Joint Surg Br 80(4): 568–572
57. Van Acker F, Nuyts J, Maes A et al. (2001) FDG-PET,
99mtc-HMPAO white blood cell SPET and bone
scintigraphy in the evaluation of painful total knee
arthroplasties. Eur J Nucl Med 28(10): 1496–1504
58. Virolainen P, Lahteenmaki H, Hiltunen A et al.
(2002) The reliability of diagnosis of infection du-
ring revision arthroplasties. Scand J Surg 91(2):
178–181
59. von Rothenburg T, Schoellhammer M, Schaffstein
J et al. (2004) Imaging of infected total arthroplas-
ty with Tc-99m-labeled antigranulocyte antibody
Fab’fragments. Clin Nucl Med 29(9): 548–551
60. Wukich DK, Abreu SH, Callaghan JJ et al. (1987)
Diagnosis of infection by preoperative scintigra-
phy with indium-labeled white blood cells. J Bone
Joint Surg Am 69(9): 1353–1360
61. Zhuang H, Duarte PS, Pourdehnad M et al. (2001)
The promising role of 18F-FDG PET in detecting in-
fected lower limb prosthesis implants. J Nucl Med:
4244–4248
916 | Der Orthopäde 9 · 2006
Leitthema
![Page 1: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: [Diagnostic strategies in cases of suspected periprosthetic infection of the knee. A review of the literature and current recommendations]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051401/6343c4dfbd0b0d0a6b08818b/html5/thumbnails/13.jpg)