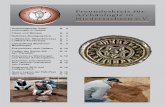Der ethische Fortschritt bei Martha Nussbaum. Über den Versuch, das Spannungsverhältnis zwischen...
Transcript of Der ethische Fortschritt bei Martha Nussbaum. Über den Versuch, das Spannungsverhältnis zwischen...
DER ETHISCHE FORTSCHRITT BEI MARTHA NUSSBAUM
Über den Versuch, das Spannungsverhältnis zwischen
Universalismus und Partikularismus zu überwinden
Seminararbeit für die Lehrveranstaltung
SE 180078 Neue Fragestellungen der Tugendethik
Veranstaltungsleiterin: Univ.-Prof. Dr. Angela Kallhoff
Institut für Philosophie
Universität Wien
SS 2014
vorgelegt von
Nathalie Brügger
Matrikel-Nummer: 1349561
Studienkennzahl: A 066 941
Wien, 30.09.2014
2
Hiermit erkläre ich, die vorgelegte Arbeit selbständig verfasst und ausschließlich die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle wörtlich oder dem Sinn
nach aus anderen Werken entnommenen Textpassagen und Gedankengänge sind durch
genaue Angabe der Quelle in Form von Anmerkungen bzw. In-Text-Zitationen ausge-
wiesen. Dies gilt auch für Quellen aus dem Internet, bei denen zusätzlich URL und
Zugriffsdatum angeführt sind. Mir ist bekannt, dass jeder Fall von Plagiat zur Nicht-
Bewertung der gesamten Lehrveranstaltung führt und der Studienprogrammleitung ge-
meldet werden muss. Ferner versichere ich, diese Arbeit nicht bereits andernorts zur
Beurteilung vorgelegt zu haben.
Wien, 30.09.2014
3
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ................................................................................................................. 4
2. Rekonstruktion: Martha Nussbaums nicht-relative Tugenden .......................... 6
2.1. Das Bedürfnis nach einer objektiven Moraltheorie ............................................... 6
2.2. Die menschliche Natur als Quelle der Normativität .............................................. 7
2.3. Grunderfahrungen und Spezifikationen ................................................................. 8
3. Problem: Vereinigung von Universalismus und Partikularismus .................... 12
3.1. Gibt es eine universale Spezifikation? ................................................................. 12
3.2. Nussbaums Stellungnahme .................................................................................. 13
3.3. Vagheit und Widersprüche .................................................................................. 14
4. Untersuchung: Der ethische Fortschritt in der Praxis ...................................... 17
4.1. Fähigkeiten-Ansatz als Kriterium ........................................................................ 17
4.2. Die menschliche Natur und die Erbsünde ............................................................ 20
4.3. Eine Frage der Definition..................................................................................... 23
5. Schluss .................................................................................................................... 26
6. Literaturverzeichnis .............................................................................................. 28
4
1. Einleitung
„Die Menschen trachten in der Tat nach dem Guten und nicht nach der absoluten Be-
wahrung des Hergebrachten.“1 Von diesem positiven Menschenbild geleitet, propagiert
Martha Nussbaum die Idee einer globalen Ethik, welche zwischen universalistischem
Anspruch und partikulären Gegebenheiten keinen Widerspruch sieht, sondern einen
Zusammenhang entdeckt. Das Glied dieser Verbindung bildet die Aristotelische Idee
einer allen Menschen gemeinsamen Natur. Auf dieser Basis schafft sie eine Tugend-
ethik, welche die unterschiedlichsten Kulturen und Religionen zusammenbringen und
einen ethischen Fortschritt ermöglichen soll.
In dieser Arbeit werde ich Nussbaums Essentialismus-These sowie deren Implika-
tionen eingehend analysieren und daraufhin überprüfen, inwiefern sie ihrer Idee einer
objektiv gültigen Moral gerecht werden kann. Dieser Anspruch wird von Relativisten
kritisiert, welche die unterschiedlichen ethischen Vorstellungen verschiedener Kulturen
als einzigartige Systeme betrachten, die auf keine gemeinsame Grundlage zurückzufüh-
ren sind. Und ohne die Möglichkeit, die vielfältigen Ideen anhand universaler Kriterien
zu vergleichen und gegeneinander abzuwägen, gibt es auch keine in dieselbe Richtung
strebende moralische Entwicklung.
Da hier Nussbaums Moraltheorie im Vordergrund stehen wird, wird sich auch die
Literaturauswahl vor allem auf sie konzentrieren. Neben der Darstellung ihrer These der
conditio humana wird diskutiert, inwiefern es Nussbaum gelingt, die relativistischen
Vorwürfe zu widerlegen. Dabei werden jedoch nicht alle Annahmen hinterfragt – einige
Konzepte wie eben jene Feststellung der menschlichen Natur sowie die daraus abgelei-
teten Grunderfahrungsbereiche und Fähigkeiten werden für die Argumentation voraus-
gesetzt. Die kritische Betrachtung setzt erst auf einer tieferen Ebene, bei der Verbindung
dieser universalen Idee mit partikulären Gegebenheiten, ein.
Die Relevanz dieser Untersuchung liegt neben der Aktualität von Nussbaums
Schriften in ihrer Bedeutung für die Praxis. Nussbaum hat das erklärte Ziel, ihre Theorie
auf aktuelle soziale und politische Strukturen anzuwenden und gibt sich überzeugt, dass
es ohne ihren Ansatz auch keine adäquate Begründung der sozialen Gerechtigkeit und
1 Nussbaum, Martha: „Nicht-relative Tugenden: Ein aristotelischer Ansatz“, in: Rippe, Klaus-Peter und
Peter Schaber [Hrsg.]: Tugendethik. Stuttgart: Reclam 1998: 150.
5
Verteilung geben kann; „With it [ihrer Theorie], on the other hand, we have what we
urgently need at this time – the basis for a global ethic and a fully international account
of distributive justice.“2
Die vorliegende Arbeit wird in drei Teile gegliedert. Als erstes wird Nussbaums
Grundidee einer objektiven Moraltheorie rekonstruiert. Dabei wird sowohl auf die Ver-
ankerung der Normativität in der menschlichen Natur als auch auf die zweistufige Ent-
wicklung der nicht-relativen Tugenden eingegangen. Im nächsten Teil wird die zweite
Stufe, die Ausformulierung der Spezifikationen, näher betrachtet. Die dabei erzeugte
Spannung zwischen Universalismus und Partikularismus versucht Nussbaum in ihrer
Erwiderung zwar aufzulösen, doch zurück bleibt eine gewisse Vagheit und Wider-
sprüchlichkeit. Als drittes wechselt der Fokus auf den ethischen Fortschritt in der Pra-
xis. In diesem Schritt wird Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz zur Unterstützung der
Grunderfahrungstheorie zu Hilfe genommen und am Beispiel der Erbsünde beispielhaft
untersucht, mit welchen Kriterien gewisse Spezifikationen ausgeschlossen werden kön-
nen. Anschliessend wird die zuvor aufgeworfene Frage adressiert, ob Nussbaums Theo-
rie letztendlich eher dem Universalismus oder dem Relativismus zugerechnet werden
soll. Im Schlusswort werden die Ergebnisse noch einmal in aller Kürze zusammenge-
fasst.
2 Nussbaum, Martha: „Social Justice and Universalism: In Defense of an Aristotelian Account of Human
Functioning“, in: Modern Philology 90, 1993: S50.
6
2. Rekonstruktion: Martha Nussbaums nicht-relative Tugenden
2.1. Das Bedürfnis nach einer objektiven Moraltheorie
Viele zeitgenössische Tugendethiker setzen sich in ihren Schriften mit der Herausforde-
rung des moralischen Relativismus auseinander. Diese von Philippa Foot angestossene
Debatte wurde unter anderem von Alasdair MacIntyre, Rosalind Hursthouse und Martha
Nussbaum aufgegriffen und diskutiert.3 Dabei steht dem Begriff ‚relativ‘, welcher die
Betonung auf ‚partikuläre‘ Umstände legt, der ‚objektive‘ Geltungsanspruch mit seinen
‚universalen‘ Annahmen entgegen. Nussbaum definiert ‚Relativismus‘ als die
Auffassung, daß sich die angemessenen Kriterien für das ethisch Gute einzig und allein
aus den jeweiligen lokalen Bedingungen ableiten lassen, daß sie an die Traditionen und
Praktiken einer jeden Gesellschaft oder Gruppe gebunden sind, die sich die Frage nach
dem Guten stellt.4
Diese These wird von einigen Forschungsrichtungen wie der Sozialanthropologie oft als
empirische Tatsache betrachtet und führt im Umkehrschluss zu der Idee, dass die mora-
lischen Systeme unterschiedlicher Kulturen nicht auf gemeinsamen Nenner reduziert
und verglichen werden können.5
In ihrem Aufsatz Nicht-relative Tugenden: Ein aristotelischer Ansatz spricht sich
Nussbaum gegen solch relativistische Zugeständnisse in der Tugendethik aus. Anstatt
dessen betont sie die Notwendigkeit einer universal gültigen Moraltheorie, auf deren
Basis die Normen anderer Traditionen bewertet werden können. So sollen schädliche
Strukturen wie die Diskriminierung gewisser Bevölkerungsgruppen aufgrund willkürli-
cher Merkmale wie der Hautfarbe, des Geschlechts oder der Religion nicht einfach als
‚Eigenheiten‘ abgetan oder sogar als ‚schützenswerte Tradition‘ verharmlost werden.
Vielmehr müssen diese repressiven Ungerechtigkeiten aufgrund einer gemeinsamen
Argumentationsbasis als ethisch unangemessen kritisiert werden können. Durch solche
3 Vgl. Gowans, Christopher W.: „Virtue Ethics and Moral Relativism“, in: Hales, Steven D. [Hrsg.]: A
Companion to Relativism. Malden MA: Wiley-Blackwell 2011: 391f. 4 Nussbaum 1998: 115.
5 Vgl. Gowans 2011: 393; vgl. Nussbaum 1998: 118; vgl. Nussbaum 1993: S47ff.
7
transkulturellen Diskurse soll langfristig ein universaler ethischer Fortschritt möglich
sein. 6
2.2. Die menschliche Natur als Quelle der Normativität
Solch eine objektiv fundierte Moral glaubt Nussbaum durch den Rückgriff auf die aris-
totelische Tugendethik bieten zu können. In Aristoteles findet sie einen paradigmati-
schen Vertreter der Idee, dass die Tugendethik mit der Forderung nach Objektivität
durchaus vereinbar ist.7
Jene allgemeine Gültigkeit soll dadurch erreicht werden, dass Gründe angeführt
werden, welche sich „aus menschlichen Wesensmerkmalen [ergeben], die unter der
Oberfläche aller lokalen Traditionen vorhanden sind und wahrgenommen werden müs-
sen“.8 Das bedeutet, es gibt eine menschliche Natur mit charakteristischen Eigenschaf-
ten, aus denen substantielle ethische Implikationen abgeleitet werden können. Diese
Annahme wird als ‚Essentialismus‘ oder auch ‚robuster Naturalismus‘ bezeichnet.9 Da-
bei ist es wichtig, den Essentialismus vom metaphysischen Realismus abzugrenzen; es
wird nicht behauptet, dass es eine von der Geschichte unabhängige menschliche Natur
gibt, welche das Menschsein bestimmt. Nussbaum vergleicht ihre Idee vielmehr mit
einem nicht-metaphysischen, internalen Realismus wie er bei Hilary Putnam oder
Charles Taylor zu finden ist.10
Ganz im Gegenteil sind die menschlichen Eigenschaften
aufs engste mit dem konkreten Erleben verbunden:
Es gibt keinen archimedischen Punkt, keinen reinen Zugang zu einer gleichsam jungfräu-
lichen – auch menschlichen – ‚Natur‘ an sich. Es gibt nur ein menschliches Leben in sei-
ner gelebten Form. Aber in dem gelebten Leben stoßen wir auf Erfahrungen, die um be-
6 Vgl. Nussbaum 1998: 115 f.
7 In dieser Arbeit wird Aristoteles‘ Position, abgesehen von einigen wenigen Verweisen auf Originalstel-
len, ausschliesslich aus der Perspektive von Martha Nussbaum widergegeben. Dies bedeutet nicht, dass
diese Darstellung unumstritten ist. So kritisiert beispielsweise Christopher Bobonich, Nussbaums Inter-
pretation habe mehr mit den Theorien von Hilary Putnam und Amartya Sen gemeinsam als mit Aristote-
les selbst. Als wichtige Unterschiede nennt er Nussbaums Sicht auf den Egalitarismus, Universalismus,
ihr Pluralismus des Guten sowie die Idee des internalen Realismus. Vgl. Bobonich, Christopher: „Internal
Realism, Human Nature, and Distributive Justice: A Response to Martha Nussbaum“, in: Modern Philol-
ogy 90, 1993: S74. 8 Nussbaum 1998: 117.
9 Vgl. Nussbaum 1993: S49; vgl. Gowans 2011: 395f. Für eine ausführliche Darstellung des Naturalismus
bei Aristoteles selbst sowie verschiedene Interpretationsweisen des naturalistischen Arguments vgl. Kall-
hoff, Angela: Ethischer Naturalismus nach Aristoteles. Paderborn: mentis 2010. 10
Vgl. Nussbaum 1993: S49f.
8
stimmte Schwerpunkte zentriert sind, welche vernünftige Ausgangspunkte für eine kul-
turübergreifende Reflexion abgeben.11
Und da alle Menschen qua ihrer menschlichen Natur den gleichen Existenzbedingungen
unterworfen sind, können die moralischen Implikationen, die sich aus diesen ergeben,
einen Anspruch auf universale Gültigkeit erheben.12
Eine Anwendung dieses Grundge-
dankens findet sich in Nussbaums Konzept der Grunderfahrungen.
2.3. Grunderfahrungen und Spezifikationen
Nussbaum schreibt die Idee der Grunderfahrungen Aristoteles zu. Dieser charakterisiert
zur Einführung seines Tugendkatalogs jeweils einen universalen Erfahrungsbereich, „in
dem jeder Mensch mehr oder weniger irgendwelche Entscheidungen treffen und sich in
irgendeiner Weise verhalten muß.“13
Solchen Erfahrungen kann nicht ausgewichen
werden. Sie gehören zum menschlichen Leben und die Reaktion darauf wird durch die
Kategorien ‚angemessen‘ oder ‚unangemessen‘ bewertet.14
Bei der Suche nach einer Liste mit universalen Tugenden sind zwei Stadien zu un-
terscheiden;15
In einem ersten Schritt werden die Grunderfahrungsbereiche eingegrenzt.
Aristoteles legt (laut Nussbaum) eine Liste mit elf verschiedenen Bereichen vor:16
1. Furcht vor grossen Schäden, insbesondere vor dem Tod
2. Körperliche Begierden und damit verbundene Freuden
3. Verteilung der begrenzten Ressourcen
4. Umgang mit dem eigenen Besitz, sofern es um andere geht
5. Umgang mit dem eigenen Besitz, sofern es um Gastfreundschaft geht
6. Einstellung und Handlungen im Hinblick auf den eigenen Wert
7. Einstellung gegenüber Kränkung und Schaden
8. ‚Geselliger Verkehr in Worten und Handlungen‘
a) Wahrheit in der Rede
b) Verkehr mit anderen in spielerischer Weise
11
Nussbaum 1998: 154f. 12
Vgl. Nussbaum 1998: 124f. 13
Ebd.: 119f. Hervorhebung im Original. 14
Vgl. ebd.: 122f. 15
Vgl. ebd.: 127. 16
Vgl. ebd.: 120f.
9
c) Verkehr mit anderen in allgemeineren Weise
9. Einstellung gegenüber Freud und Leid von anderen
10. Geistiges Leben
11. Die eigene Lebensplanung und -gestaltung
Da die Tugendethik immerzu offen für Veränderungen bleiben soll, erhebt die Liste
keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit, sondern hat einen flexiblen Charakter.
Die Frage, wie auf diese Grunderfahrung richtig reagiert werden soll, wird zunächst
bloss mit einer noch inhaltsleeren Tugendbezeichnung beantwortet. Die Tugenden tra-
gen die folgenden Namen oder Umschreibungen:17
1. Tapferkeit
2. Mässigung
3. Gerechtigkeit
4. Freigiebigkeit
5. Grosszügige Gastfreundschaft
6. Seelengrösse
7. Sanftmut
8. a) Wahrhaftigkeit
b) Gefälliges Verhalten (im Gegensatz zu Grobheit, Tölpelhaftigkeit oder Un-
empfindlichkeit)
c) Ohne Namen, aber eine Art Freundlichkeit (im Gegensatz zu Reizbarkeit und
Streitsucht)
9. Echtes Verständnis (im Gegensatz zu Neid oder Schadenfreude)
10. Verstandesmässige Tugenden wie Verständigkeit oder Klugheit
11. Praktische Vernunft
Deren ‚schwache‘, beziehungsweise nominale Definition lautet jedoch bloss, dass jene
Tugend „die ständige Bereitschaft ist, in diesem Bereich richtig zu handeln, worin dies
auch immer bestehen mag.“18
Damit ist noch nichts darüber gesagt, was es in einer kon-
kreten Situation bedeutet, beispielsweise tapfer zu sein. Dafür werden in einem zweiten
Schritt ethische Theorien benötigt, welche von der nominalen Definition ausgehend
versuchen, eine umfassende Definition der Tugend zu geben – die Spezifikation. Solche
17
Vgl. Nussbaum 1998: 120f. 18
Ebd: 120.
10
Konkretisierungen können unterschiedlich ausfallen, sodass es mehrere, miteinander
konkurrierende Ausformulierungen der nominalen Tugend gibt.19
Um diesen Vorgang verständlich zu machen, vergleicht Aristoteles den ethischen
Entwicklungsprozess mit dem Fortschritt in den Naturwissenschaften. So machen Men-
schen auf der ganzen Welt dieselbe Grunderfahrung eines grollenden Geräuschs in den
Wolken. Ohne zu wissen, was es genau ist, benennen sie das Phänomen ‚Donner‘. Nach
dieser nominalen Definition werden zur Erklärung verschiedene, sich teilweise wider-
sprechende Theorien entwickelt. Über die Zeit hinweg erweist sich eine der vielen Spe-
zifikationen den anderen überlegen und die wissenschaftliche Konkretisierung behaup-
tet sich gegen den Glauben, Zeus wolle die Wolken in Bewegung setzen.20
Solch eine
allmähliche Eingrenzung der möglichen Antworten soll auch im moralischen Bereich
möglich sein; „wir können den Fortschritt in der Ethik – wie den Fortschritt in der wis-
senschaftlichen Erkenntnis – als Fortschritt bei der Suche nach der richtigen umfassen-
deren Spezifikation einer Tugend verstehen“.21
Von dieser Idee geleitet nannte bereits Aristoteles zu jeder Tugend eine konkrete
Spezifikation.22
Davon gibt es für ihn, wie in der Wissenschaft, jeweils bloss eine einzi-
ge – nämlich die genaue Mitte zwischen Übermass und Mangel im Bezug auf sich
selbst:23
Außerdem gibt es viele Arten der Verfehlung […], während es nur eine Weise des richti-
gen Handelns gibt. Daher ist auch das eine leicht und das andere schwer. Leicht ist es,
den Zielpunkt (skopos) zu verfehlen, schwer aber, ihn zu treffen. Auch deshalb also gehö-
ren Übermaß und Mangel zum Laster, die Mitte dagegen zur Tugend: ‚Denn Menschen
sind gut auf nur eine Art, schlecht aber auf viele‘.24
Aristoteles wird jedoch vorgeworfen, dass er trotz seines Anspruchs auf Objektivität ein
typisch griechisches Ideal skizziert, das nicht interkulturell gültig ist.25
Nussbaum, die
dieser Kritik widerspricht, stimmt hingegen Aristoteles‘ teleologischer Denkweise zu
und teilt dessen Überzeugung, dass Menschen dazu bereit sind, sich in eine gemeinsame
19
Vgl. Nussbaum 1998: 123. 20
Vgl. ebd.: 123f. 21
Ebd.: 125. 22
Vgl. ebd.: 120. 23
Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik. Übersetzt und herausgegeben von Ursula Wolf. Reinbek bei
Hamburg: Rowohlt 20113: 83/1106a-b.
24 Ebd.: 84/1106b. Hervorhebungen im Original.
25 Vgl. Nussbaum 1998: 118f.; vgl. Gowans 2011: 394.
11
Richtung weiterzuentwickeln: „Die Menschen trachten nicht nach Übereinstimmung
mit der Vergangenheit, sondern nach dem Guten.“26
Doch die Frage bleibt bestehen, ob
es in der Ethik in Anbetracht einer globalisierten, pluralistischen Welt, ebenfalls einen
solchen wissenschaftsähnlichen Fortschritt hin zu einer einzigen, ‚nicht-relativen‘ Spe-
zifikation geben kann und wenn ja, wie dieser begründet wird.
26
Nussbaum 1998: 126f.
12
3. Problem: Vereinigung von Universalismus und Partikularismus
3.1. Gibt es eine universale Spezifikation?
Diese Frage nach einer universal gültigen Spezifikation spricht Nussbaum selbst als
einen möglichen Einwand gegen ihre Theorie an.27
Sie unterscheidet dazu „zwischen
der Einzigartigkeit eines Problems und der Einzigartigkeit einer Lösung“.28
Die ‚Einzigartigkeit des Problems‘ bezieht sich auf die in dieser Arbeit vorausge-
setzte Annahme, dass es eine wie oben beschriebene menschliche Natur gibt und die
Grunderfahrungsbereiche klar eingegrenzt werden können. Auf diese Ebene gibt es also
einen als universal anerkannten Tugendkatalog, welcher die Namen der verschiedenen
Exzellenzen auflistet, sodass sich verschiedene Kulturen an einer gemeinsamen Debatte
über die richtige Definition derselben Tugend beteiligen können.29
Doch die Einigkeit über eine Frage ‚Wie genau wird die Tugend x definiert?‘ ist
nicht gleichbedeutend mit einer ‚Einzigartigkeit der Lösung‘. Da jede Gesellschaft
durch einen jeweils einzigartigen Kontext beeinflusst wird, scheint ein Pluralismus von
Spezifikationen naheliegend und Nussbaum räumt ein: „Es wurde nicht gezeigt, daß am
Ende dieser Debatte, wie Aristoteles glaubt, eine einzige Antwort steht.“30
Trotzdem, so
gibt sie sich überzeugt, lässt sich die Spannung zwischen Universalismus und Partikula-
rismus auflösen und Aristoteles habe bereits die Grundzüge dafür gegeben, „sich vorzu-
stellen, auf welche Weise die Tugenden nicht-relativ sein könnten“.31
27
Vgl. Nussbaum 1998: 129ff. 28
Ebd.: 129. 29
Diese hier akzeptierte Annahme der Existenz einer menschlichen Natur sowie deren moralische Impli-
kationen sind keineswegs unumstritten. Nussbaum diskutiert selbst zwei verschiedene Einwände gegen
die Idee der Grunderfahrungen. Einerseits fragt sie danach, ob überhaupt allen Menschen gemeinsame
Erfahrungsbereiche existieren können, da jede Erfahrung konstruiert ist und durch den individuellen Hin-
tergrund interpretiert wird. Andererseits stellt sie sich auch dem Einwand, dass einige angeblich universa-
le Erfahrungen vielmehr kontingent sind und auf nicht-notwendigen sozialen Bedingungen basieren,
sodass eine Änderung der Umwelt gewisse Grunderfahrung verschwinden lässt. Für Nussbaums Verteidi-
gung gegen diese Fragen vgl. Nussbaum 1998: 131ff. Kritik am Konzept der menschlichen Natur kommt
aber nicht nur von Nussbaum selbst, sondern auch von anderen Autoren. Vgl. Bobonich 1993: S76ff. oder
Schleissheimer, Bernhard: Ethik heute. Eine Antwort auf die Frage nach dem guten Leben. Würzburg:
Königshausen & Neumann 2003: 139ff. 30
Nussbaum 1998: 130. 31
Ebd.: 131.
13
3.2. Nussbaums Stellungnahme
Die Erwiderung zur Verteidigung der Aristotelischen Position gliedert Nussbaum in
vier Teile.32
Als erstes verwirft sie die Idee, dass es bloss eine Spezifikation einer Tu-
gend geben darf: „Die Antwort kann sich durchaus als Disjunktion erweisen.“33
Aber
trotzdem ist es erforderlich, die konkurrierenden Vorschläge gegeneinander abzuwägen
und die weniger angemessenen zu verwerfen;
Ein erfolgreiches Ausschließungsverfahren ist keine geringe Leistung. Sollte es uns bei-
spielsweise gelingen, Auffassungen von der richtigen Einstellung zum eigenen menschli-
chen Wert auszuschließen, die auf der Vorstellung von der Erbsünde basieren, wäre dies
moralisch von enormer Bedeutung, auch wenn wir bei der Suche nach einer positiven
Spezifikation hier stehenbleiben.34
Das Ziel ist letztendlich „eine (wahrscheinlich kleine) Anzahl von akzeptablen Auf-
fassungen“35
auszumachen.
Zweitens sind die Unterschiede der Spezifikationen den kulturellen Besonderheiten
geschuldet. Als Beispiel für solche gesellschaftsabhängigen Präzisierungen nennt Nuss-
baum die konkrete Ausübung der Gastfreundschaft, welche sich in ganz verschiedenen
Gepflogenheiten manifestiert.36
Drittens wird betont, dass diese Bereitschaft, die ‚Priorität des Besonderen‘ anzuer-
kennen, nicht als relativistisches Zugeständnis gedeutet werden soll. Universalismus
und Partikularismus schliessen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind miteinander
vereinbar:
Die Tatsache, daß eine gute und tugendhafte Entscheidung je nach dem gegebenen Kon-
text anders ausfällt, bedeutet nicht, daß sie nur in bezug auf oder innerhalb eines begrenz-
ten Kontextes richtig ist; […] Es ist absolut und objektiv überall in der menschlichen
Welt richtig, sich an den besonderen Merkmalen des Kontextes, in dem man lebt auszu-
richten; […]. Sollte sich jemals eine andere Situation mit den gleichen ethisch relevanten
– auch kontextuellen – Merkmalen ergeben, wäre die gleiche Entscheidung wieder abso-
lut richtig.37
32
Vgl. Nussbaum 1998: 138ff. 33
Ebd.: 138. 34
Ebd.: 139. 35
Ebd.: 139. 36
Vgl. ebd.: 139f. 37
Ebd.: 141. Hervorhebung im Original.
14
Die jeweilige moralische Handlung ist also nicht relativ, sondern innerhalb der konkre-
ten Umstände absolut angemessen oder unangemessen.
Viertens hat die Aristotelische Tugendethik nicht den Anspruch, feste Handlungs-
regeln zu formulieren. Im Gegenteil ist diese Fähigkeit, auf die Besonderheit einer Situ-
ation einzugehen und neue Spezifikationen zu entwickeln, ein inhärenter Bestandteil
dieses Moralsystems. Dadurch hat die Tugendethik den Vorteil, flexibel zu sein mit neu
entstehenden moralischen Herausforderungen mitzuwachsen.
3.3. Vagheit und Widersprüche
Besonders überraschend an Nussbaums Erwiderung ist das gleich zu Beginn angeführte
Zugeständnis, dass es einen Pluralismus an Spezifikationen, also je nach Situation
„durchaus mehrere oder sogar viele konkrete Präzisierungen“38
geben kann. Aber ob-
wohl sie damit entscheidend von Aristoteles Ideal einer singulären Spezifikation ab-
weicht, ist dies per se noch kein Argument gegen ihren Objektivitätsanspruch.
In Virtue Ethics and Moral Relativism zweifelt Christopher Gowans aber ganz
grundsätzlich daran, dass die Aristotelische Tugendethik fähig ist, aus der menschlichen
Natur eine objektive moralische Grundlage abzuleiten.39
In Reaktion auf Nussbaums
oben ausgeführte Verteidigung kritisiert Gowans zwei Unklarheiten;40
Erstens spricht Nussbaum von der Herausforderung, die Auswahl von Spezifikatio-
nen auf eine kleine Auswahl zu reduzieren. Sie bleibt jedoch vage und gibt keinen Hin-
weis darauf, wie das Ausschlussverfahren funktioniert und nach welchen Kriterien ge-
wisse Präzisierungen – etwa die erwähnte demütige Haltung gegenüber seinem eigenen
Wert, welche aufgrund des Wissens um die Erbsünde eingenommen wird – verworfen
werden sollen.
Zweitens wirft Gowans Nussbaum vor, dass sie nicht, wie sie vordergründig be-
hauptet, konsequent gegen den Relativismus argumentiert – im Gegenteil:
38
Nussbaum 1998: 139. Hervorhebung von mir. 39
Vgl. Gowans 2011: 391. 40
Vgl. ebd.: 404.
15
In fact, Nussbaum appeared more concerned to emphasize the place of cultural variations
and the diversity of circumstances in fully specifying the virtues than she was to show
how human nature provides us with ‘a single objective account of the human good’.41
Diese beiden Kritikpunkte hängen insofern zusammen, als dass der Fokus auf das Parti-
kuläre keine Antwort darauf gibt, nach welchen Prinzipien das Ausschlussverfahren und
damit der ethische Fortschritt ablaufen sollen. Doch Nussbaum weicht dieser Heraus-
forderung nicht bloss in Nicht-relative Tugenden aus. Auf die Frage nach dem Fort-
schritt zum Guten verweist sie unter anderem auf ihr Werk The fragility of goodness.
Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy.42
Dort erklärt Nussbaum, dass die
Aristotelische Ethikerin nicht nach derselben Präzision streben kann wie der Naturwis-
senschaftler, denn im Gegensatz zu letzterem sieht sich die Ethikerin mit einem beson-
deren Mass an Veränderlichkeit, Unbestimmtheit und unwiederholbaren Elementen
konfrontiert.43
Dabei drängt sich die Frage auf, welchen Beitrag eine nicht-
wissenschaftliche Abwägung in der Moral leisten kann;
It will be charged that Aristotle’s non-scientific view does too little. By refusing so firmly
the progress offered by commensurability, universality, and intellectualism it has left it-
self with no elaborated theory of deliberation, no systematic account of good deliberative
procedure. Aristotle would be happy to accept this charge: ‘Every account concerning
practical matters ought to be said in outline and not with precision.’ His writings give us a
sketch, which must be filled in by character and experience.44
Im Hinblick auf den gleichzeitigen Objektivitätsanspruch wirkt diese Aussage äusserst
widersprüchlich. Statt universale Vergleichskriterien anzubieten, werden diese explizit
verworfen. Dafür führt sie die gesamte Beurteilungsautorität auf das partikuläre Indivi-
duum zurück. Doch wie soll die Orientierung an einem einzigartigen Charakter mit kul-
turell einmaligen Erfahrungen dazu beitragen, Kritik an den Handlungen anderer Men-
schen, mit anderem Charakteren und anderen Kulturen zu üben?
Dieselbe Frage bleibt auch bestehen, als Nussbaum im dritten Schritt ihrer Erwide-
rung versucht, die Diskrepanz zwischen Universalismus und Partikularismus aufzulö-
41
Gowans 2011: 404. 42
Nussbaum verweist in Fussnote 25 auf Kapitel 8 Saving Aristotle’s appearances und in Fussnote 27 auf
Kapitel 10 Non-scientific delibaeration von eben jenem Buch. Vgl. Nussbaum 1998: 138; 141, bezie-
hungsweise Nussbaum, Martha: The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philoso-
phy. Cambridge: University Press 1986: 240ff.; 290ff. 43
Vgl. Nussbaum 1986:302ff. 44
Ebd.: 312.
16
sen. Dort formuliert sie die Vorgabe, dass in Situationen mit ‚denselben ethischen und
kontextuellen Merkmalen‘ jeweils die gleiche Handlung gezeigt werden muss. Da ‚Kon-
text‘ einfach ein anderes Wort für ‚Zusammenhang‘ ist, bringt diese Beschreibung einen
grossen Interpretationsspielraum mit sich – denn je nach Massstab ist jeder Situation in
ihrer Konstellation einmalig. Würde dieser Begriff in diesem Sinne verstanden, gäbe es
gleich viele Spezifikationen wie Situationen. Diese Inflation an Präzisierungen birgt die
Gefahr einer ‚anything goes‘-Mentalität, da jeder Handelnde darauf bestehen könnte,
dass seine Tat innerhalb seines nicht replizierbaren Kontextes gerechtfertigt ist, auch
wenn das aufgrund eben jener Besonderheit von niemanden nachvollzogen werden
kann.
Da diese radikale Interpretation Nussbaums Ansinnen, bloss eine begrenzte Anzahl
Spezifikationen zu akzeptieren, widerspricht, muss der Begriff ‚Kontext‘ enger verstan-
den werden. Aber es bleibt die Frage, wie diese Eingrenzung abläuft, das heisst welche
Merkmale ethisch relevant sind und nach welchen Prinzipien diese Merkmale als mora-
lisch gut oder schlecht bewertet werden können.
17
4. Untersuchung: Der ethische Fortschritt in der Praxis
4.1. Fähigkeiten-Ansatz als Kriterium
Ein Hinweis darauf, wie die aufgeworfenen Fragen beantwortet und der ethische Fort-
schritt in der Praxis gestaltet werden können, findet sich in der Beschreibung des Über-
gangs von der nominalen Definition zur Spezifikation – denn dies sei „[d]ie Aufgabe
der ethischen Theorie“.45
Im Fall von Nussbaum erschöpft sich die ethische Theorie nicht in ihrem Konzept
der Grunderfahrungen; des Weiteren leitet sie aus der menschlichen Natur auch ihren
Fähigkeiten-Ansatz (capability approach) ab. Diese Idee entwickelt Nussbaum in Soci-
al Justice and Universalism: In Defense of an Aristotelian Account of Human Functio-
ning ebenfalls in zwei Schritten. Als erstes analysiert sie die ‚Gestalt der menschlichen
Lebensform‘ (shape of the human form of life) und beschreibt eine Liste mit zehn Fä-
higkeiten und Einschränkungen, welche das menschliche Leben charakterisieren und
ohne die wir kein ‚gutes‘ Leben führen könnten; dies sind unsere Sterblichkeit, Körper-
lichkeit, kognitive Fähigkeiten, frühe kindliche Entwicklung, praktische Vernunft, Ver-
bundenheit mit anderen, Verbundenheit mit anderen Spezies und der Natur, Humor und
Spiel, sowie Getrenntheit, beziehungsweise starke Getrenntheit von anderen.46
Analog
dazu umschreibt sie in einem zweiten Schritt eine Liste mit ‚basalen menschlichen
Funktionsfähigkeiten‘ (basic human functional capabilities), die sich aus den oben ge-
nannten Lebenseigenschaften ergeben. Aus dem Faktum der Sterblichkeit lässt sich
beispielsweise die folgende menschliche Funktion ableiten: „Being able to live out a
complete human life, as far as is possible; not dying prematurely or before one’s life is
so reduced as to be not worth living“.47
Diese Aufzählung von Fähigkeiten deckt sich zum Teil, jedoch nicht komplett, mit
der Liste der Grunderfahrungen. Die Ähnlichkeit ist auf den gemeinsamen Ursprung,
45
Nussbaum 1998: 123. 46
Vgl. Nussbaum 1993: S55ff. Für eine ältere, dafür ausführlichere Version mit leicht abgeänderter Liste
(mit dem zusätzlichen Punkt ‚Fähigkeit zu Freude und Schmerz‘, dafür ohne ‚starke Getrenntheit‘ ) vgl.:
Nussbaum, Martha: „Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism“, in:
Political Theory 20(2), 1992: 202-246. Fast dieselbe, aber ein wenig kürzere Liste (erneut mit ‚Freude
und Schmerz‘, jedoch ohne ‚Verbundenheit mit anderen Spezies und der Natur‘, ‚Getrenntheit‘ und ‚star-
ke Getrenntheit‘) führt sie auch später noch mal an. Vgl. Nussbaum 1998: 151ff. 47
Nussbaum 1993: S58.
18
die universale menschlichen Natur, zurückzuführen. Die Unterschiede hingegen könn-
ten neben der jeweils eigenen Absicht und damit anderen Fokus der Texte auch der Tat-
sache geschuldet werden, dass die Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben,
sondern immerzu als flexibel und vorläufig gelten.
Nussbaum sieht die gesellschaftlichen Strukturen in der Pflicht, das Ausleben die-
ser potentiellen Fähigkeiten, beziehungsweise das menschliche ‚Gedeihen‘ (flourishing)
zu ermöglichen:
The idea is that, once we identify the most important function of human life, we are then
in a position to ask what social and political institutions are doing about them. Are they
giving people what they need in order to be capable of functioning in all these human
ways?48
Die moralischen Implikationen, welche sich aus dem Fähigkeiten-Ansatz ergeben, nennt
Nussbaum auch die ‚starke, vage Theorie des Guten‘ (thick, vague theory of the good).
Diese Bezeichnung, die in Anspielung an John Rawls‘ ‚schwache Theorie des Guten‘
(thin theory of the good) gewählt wurde, soll durch die Verankerung in der menschli-
chen Natur einen starken normativen Anspruch erheben, dabei aber gleichzeitig inso-
fern vage sein, „for it aims to leave room for much multiple specification in accordance
with varied local and personal conceptions“.49
Genau wie beim Spezifikationsprozess
der Tugendliste betont Nussbaum also auch hier die herausragende Bedeutung des Par-
tikulären und verbindet dies wiederum im gleichen Atemzug mit ihrer Forderung nach
Universalität; denn ihr Konzept der menschlichen Funktionen „aims to be as universal
as possible; indeed, its guiding intuition directs it to cross religious and cultural gulfs.”50
Auch in Social Justice and Universalism kritisiert Nussbaum das Vorgehen der Re-
lativisten, den Essentialismus abzulehnen und diesen voreilig mit fehlender Sensibilität
für andere Lebensweisen und patriarchalem Denken gleichzusetzen.51
Als Beispiel für
eine moralisch unangemessene Zurückhaltung der Relativisten erzählt sie die Anekdote
einer französischen Anthropologin, welche in Helsinki an einer Konferenz über Werte
und Technologie teilnahm. An diesem Anlass sprach diese sich gegen die Einführung
der Pockenimpfung in Indien aus, da jene von den Briten beorderte Einmischung zum
48
Nussbaum 1993: S53. 49
Ebd.: S54. 50
Ebd.: S54. Hervorhebung von mir. 51
Vgl. ebd.: S49.
19
Verlust des Gotteskults Sittala Devi führte, zu der die Erkrankten zuvor beteten. Die
Anthropologin sah darin eine bevormundende Intervention, geprägt durch die westlich-
essentialistische Ideologie, welche Leben und Tod, beziehungsweise Gesundheit und
Krankheit als vermeintliche Gegensätze betrachtet. Anstatt dieses Konzept zu verbreiten
plädierte sie dafür, die indische Kultur in ihrer ‚radikalen Andersheit‘ zu akzeptieren
und deren eigenen Umgang mit Krankheiten aus Rücksichtnahme nicht zu beeinflus-
sen.52
Nussbaum widerspricht dieser Kritik vehement und entgegnet, dass sie als Aristo-
telikerin zwar keineswegs die Absicht hat, das Fantasievermögens oder den Ausdruck
religiöse Gefühle der Inder zu beschneiden, aber dass diese kognitive Fähigkeit auch
nicht stärker gewichtet werden darf, als das dem Menschen durch seine Biologie ebenso
innewohnende Bedürfnis nach einem langen Leben. Um sich vom Vorwurf des Paterna-
lismus zu distanzieren schlägt Nussbaum vor, nicht selbst über die Priorität der ver-
schiedenen Werte zu urteilen, sondern den Betroffenen das Impfprogramm zu erklären
und ihnen anschliessend die Wahl, welches Bedürfnis sie höher gewichten, selbst zu
überlassen.53
Zur weiteren Ausübung der religiösen Praktiken stellt Nussbaum klar:
„Nothing would prevent them from doing so; but if they ceased to see point in the ob-
servances once the disease had been eradicated, the Aristotelian would weep no nostal-
gic tears.”54
Damit führt Nussbaum ein konkretes Szenario an, in dem sich ihre Theorie über die
menschliche Natur gegen die Relativisten durchsetzt und eine transkulturelle ethische
Entscheidung begründen kann. Auf die Frage nach bestimmten Ausschlusskriterien für
konkurrierenden Tugendspezifikationen angewendet wird deutlich, dass die Präzisie-
rungen mit den verschiedenen Fähigkeiten und Einschränkungen eines jeden Menschen
im Einklang stehen sollte. Falls eine Spezifikation mit dem Gedeihen einer Person inter-
feriert, kann die Aristotelikerin eine solche Definition mit dem Verweis auf die gemein-
same und universal gültige Begründungsbasis als unangemessen zurückweisen.
Um die von Nussbaum angesprochene, aber noch unbegründete Verwerfung der
Erbsünde zu legitimieren, muss also nachgewiesen werden, dass in diesem Fall eine
Diskrepanz zwischen der Auslebung der menschlichen Funktion und einer demütigen
Haltung gegenüber sich selbst besteht.
52
Vgl. Nussbaum 1993: S47f. 53
Vgl. ebd.: S66f. 54
Ebd.: S67.
20
4.2. Die menschliche Natur und die Erbsünde
Der sechste Aristotelische Grunderfahrungsbereich umfasst die „Einstellungen und
Handlungen im Hinblick auf den eigenen Wert“.55
Nussbaum behandelt zwei verschie-
dene Spezifikationen in Reaktion auf diese Erfahrung; Aristoteles‘ stolze Haltung, von
Nussbaum aus dem griechischen megalopsychos mit ‚Seelengrösse‘ übersetzt,56
und die
christliche Demut.
‚Seelengrösse‘ ist nicht nur die Bezeichnung der Konkretisierung, Aristoteles nennt
auch die noch inhaltsleere Tugend bei diesem Namen. Hier wird mit diesem Begriff
jedoch die im zweiten Schritt vorgenommene Konkretisierung gemeint, welche auf ei-
ner Ebene mit der christlichen Spezifikation konkurriert. Für Aristoteles ist Stolz die
angemessene Mitte zwischen dem Übermass ‚Eitelkeit‘ und dem Mangel ‚Kleinmütig-
keit‘.57
Letzteres hätte Aristoteles vielleicht mit der christlichen Haltung identifiziert,
denn Nussbaum konstatiert: „Die Tugend der Demut erfordert, daß man sich als klein,
nicht als groß betrachtet.“58
Aristoteles‘ Bestimmung von Stolz als Mitte kann jedoch
entgegen gehalten werden, dass er nicht die richtigen ‚Extreme‘ identifiziert hat. So
könnte nicht Seelengrösse, sondern vielmehr Demut die angemessene Mitte zwischen
der von ihm genannten Eitelkeit und der extremeren ‚Selbstverleugnung‘ bilden. Sei-
nem Ideal des Stolzes wird auch vorgehalten, dass es stark kulturgebunden ist und sei-
ner Vorstellung eines vornehmen Griechen entspricht.59
Da Nussbaum jedoch nicht den
Anspruch einer singulären Spezifikation der idealen Mitte hat, sondern sich auf die Ver-
einbarkeit mit und Förderung des menschlichen Gedeihens konzentriert, bleibt sie von
diesem Einwand unberührt.
Nussbaum führt ihre Abneigung gegenüber der Demut auf das damit verbundene
Konzept der Erbsünde zurück, von der sie ein negatives Bild zeichnet. Sie assoziiert
diese mit abwertenden Begriffen wie ‚Niedrigkeit‘ und ‚Schwäche‘.60
Diese Eigenschaf-
ten klingen bedrückend und erwecken den Eindruck, sie würden eine gesunde Selbstent-
faltung, zu der sicherlich viel Energie gehört, erschweren oder gar verhindern. Insofern
könnte im Sinne Nussbaums argumentiert werden, dass Demut aufgrund ihrer bedrü-
55
Nussbaum 1998: 121. 56
Vgl. ebd.: 119. 57
Vgl. Aristoteles 2011: 87/1107b. 58
Nussbaum 1998: 128. Hervorhebung im Original. 59
Vgl. ebd.: 119. 60
Vgl. ebd.: 128.
21
ckenden Natur im Hinblick auf die menschliche Entwicklung nicht die idealste Konkre-
tisierung sei. Es ist jedoch anzunehmen, dass Christen diese repressive Interpretation
nicht teilen und den ‚Fakt‘ der Erbsünde nicht als belastend betrachten. Denn dadurch,
dass Gott der Welt seinen Sohn schenkte und opfern liess, nahm dieser das Leid aller
Menschen auf sich und bot den Menschen eine Möglichkeit, von ihren Sünden befreit
zu werden:
Durch einen einzigen Menschen [Adam] kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde
der Tod und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten.
[…] Wie es also durch die Übertretung eines einzigen für alle Menschen zur Verurteilung
kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines einzigen [Jesus] für alle Menschen zur
Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. […] Denn wie die Sünde herrschte und zum
Tod führte, so soll auch die Gnade herrschen und durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben
führen, durch Jesus Christus, unseren Herrn.61
Die Hinwendung zu Jesus lässt Christen das ursprünglich negative Konzept der Erbsün-
de mit einer positiven Botschaft der Erlösung, unendlicher Gnade und des bedingungs-
losen geliebt-Werdens verbinden. Aus dieser Perspektive betrachtet steht die Erbsünde
der menschlichen Entfaltung nicht nur nicht im Weg, sondern erfährt eine Transforma-
tion hin zur allgegenwärtigen Unterstützung.62
Ein weiterer Hinweis zu Nussbaum Meinung über die Erbsünde zeigt sich in ihrer
Rezension Recoiling from Reason über Alasdair MacIntyres Buch Whose Justice?
Which Rationality? Darin kritisiert sie MacIntyres Einbezug dieser theologischen Lehre
in seine Argumentation. Sie führt zwei Gründe an, um zu zeigen, dass die Erbsünde
nicht ein philosophisches, sondern ideologisches Konstrukt ist und Autorität über die
Vernunft stellt:63
Erstens, so hält sie fest, stammt die Idee der Erbsünde nicht aus der menschlichen
Erfahrung, sondern hat einen irrationalen, theologischen Ursprung. Auf die konkurrie-
renden Spezifikationen übertragen bedeutet dies, dass jene angemessener ist, welche mit
dem eigenen Erleben und der menschlichen Vernunft übereinstimmt. Bezüglich der
61
Die Bibel. Einheitsübersetzung. Altes und Neues Testament. Stuttgart: Herder 1980: Römer 5,12-17. 62
Neben der Bibel als Quelle, deren Exegese je nach InterpretIn sehr unterschiedlich ausfällt, beruht die
Beschreibung dieser Auslegung auf einer Vielzahl persönlicher Gespräche. Natürlich soll damit nicht
behauptet werden, dass alle Christen eine solche Haltung gegenüber der Erbsünde einnehmen; aber es
gibt diese Deutung und mir persönlich scheint sie unter Theologen geläufig zu sein. 63
Vgl. Lutz, Christopher Stephen: Tradition in the Ethics of Alasdair MacIntyre. Relativism, Thomism
and Philosophy. Lanham: Lexington Books 2009: 168f.
22
Verankerung in der eigenen Erfahrung gestaltet sich ein Vergleich zwischen Seelen-
grösse und Demut jedoch schwierig. Beide sind für sich genommen plausible Bewer-
tungen des eigenen Empfindens; während eine Person, die aus ihrem Umfeld viel Bestä-
tigung erhält und sich als wichtiger, einflussnehmender Akteur empfindet, sich selbst
einen grossen Wert zuschreibt, ist es genauso nachvollziehbar, dass ein anderer Mensch
mit bescheidenerer Natur grosse Ehrfurcht gegenüber anderen sowie eine an-wen-auch-
immer-gerichtete Dankbarkeit für seine Existenz verspürt und deshalb seinen Selbstwert
zurückhaltener einstuft. Natürlich stimmt es, dass der Sündenfall in der Genesis selbst
nicht konkreter Gegenstand der menschlichen Erfahrung sein kann und sich nicht aus
rationalen Untersuchungen ableiten lässt. Die Demut aber deshalb zu verwerfen, steht
nicht im Einklang mit Nussbaums Fähigkeiten-Ansatz. Neben der Vernunft gehört näm-
lich auch das Vorstellungsvermögen zur menschlichen Natur, wobei Nussbaum die ver-
schiedenen Eigenschaften nicht hierarchisch, sondern als unvergleichbare Werte be-
trachtet. Des Weiteren widerspricht dies ihrem Grundgedanken der ‚starken, vagen
Theorie des Guten‘, die offen genug sein soll, um alle Kulturen mit einzubeziehen.
Auch die oben angeführte Pockenimpfungs-Anekdote führte Nussbaum mit den Worten
„While the Aristotelian would not wish to interfere with the capability of citizens to use
their imaginations and their senses for the purposes of religious expressions […]“64
ein.
Die Einflussnahme auf religiöse Praktiken bezeichnete sie explizit nicht als Interventi-
onsmotivation und stellte klar, dass der Zerfall des Kults in Anbetracht dessen, dass
Leben gerettet wurden, zwar nicht schlimm, aber trotzdem keineswegs beabsichtigt war.
Deshalb kann diese erste Kritik an MacIntyres Verwendung der Erbsünde nicht auf die
Spezifikation der Demut übertragen werden.
Zweitens, so kritisiert Nussbaum, zeigt die politische Geschichte dieser religiösen
Doktrin, dass sie immer wieder zur Stabilisierung der kirchlichen Autorität benutzt
wurde. Darin sieht sie einen weiteren Beleg für den Vorrang von Ideologie und Autori-
tät gegenüber Philosophie und Vernunft. Aber abgesehen davon, dass gerade gezeigt
wurde, dass Vernunft durch einen Rückgriff auf die menschliche Natur nicht gegen Re-
ligiosität aufgewogen werden kann und diese Beanstandung deshalb nicht als Kriterium
für konkurrierende Spezifikationen dient, weist Christopher Stephen Lutz auch ihre his-
torische Beurteilung zurück. Mit Verweis auf eine Anmerkung von Thomas Hibbs kriti-
64
Nussbaum 1993: S66.
23
siert Lutz Nussbaums einseitige Quellenauswahl und ihr selektives Wissen über die
Kirche.65
Lutz, der sich in seinem Buch Tradition in the Ethics of Alasdair MacIntyre.
Relativism, Thomism and Philosophy ausführlich mit den Lehren von Thomas von
Aquin auseinandersetzt, bemängelt ausserdem:
Nussbaum makes a tremendous accusation, but she does little to prove her case. The doc-
trine of original sin that Nussbaum imputes to Thomas Aquinas […] does little justice to
Thomas’s position. She gives no compelling evidence to support her claim about the
ideological origin of the doctrine.66
Auch wenn die korrekte Auslegung und Entstehungsgeschichte der Erbsünde an dieser
Stelle nichts zur Sache tut, ist der Eindruck des falsch-verstanden-Werdens bezeich-
nend. Falls, und so scheint es hier, Nussbaum die Erbsünde sowie deren Implikationen
anders interpretiert als die von ihr kritisierten Christen, fehlt eine wichtige gemeinsame
Diskussionsbasis. Dabei ist es doch, wie sie selbst sagt, äusserst wichtig, dass eine Kri-
tik auch von Innen geäussert wird:
For though Aristotelianism does not hesitate to criticize tradition where tradition perpe-
trates injustice or oppression, it also does not believe in saying anything at all without
rich and full information gathered not so much from detached study as from the voices of
those who live the ways of life in question.67
Da hier jedoch eine Perspektive auf die Erbsünde gezeigt wurde, welche weder zu Un-
gerechtigkeit noch Unterdrückung führt und auch auf keine andere Weise in klarem
Widerspruch mit der menschlichen Natur steht, scheint Nussbaums Ablehnung der De-
mut als Spezifikation aufgrund der Erbsünde unbegründet.
4.3. Eine Frage der Definition
Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, dass es trotz der starken Annahme einer universalen
menschlichen Natur schwierig sein kann, Spezifikationen als unangemessen zu kritisie-
ren. Nussbaum hat gegenüber Aristoteles den Vorteil, dass sie nicht das ambitionierte
Ziel vertritt, für jede Grunderfahrung bloss eine einzige Konkretisierung zuzulassen. Sie
zeigt sich auch mit einem Pluralismus an durch die jeweilige Kultur geprägten Spezifi-
65
Vgl. Lutz 2009: 171. 66
Lutz 2009:171. 67
Nussbaum 1993: S60.
24
kationen einverstanden, solange diese alle mit dem menschlichen Gedeihen in Einklang
stehen und nicht auf irgendeine Weise ungerecht oder repressiv sind.
Doch wenn es für jeden Erfahrungsbereich mehrere, vielleicht auch sehr viele Spe-
zifikationen gibt, ist es dann noch gerechtfertigt, dass Nussbaum einen universalen mo-
ralischen Anspruch vertritt, oder ist eher Gowans im Recht, wenn er ihr vorwirft, viel
relativistischer zu sein als sie vorgibt?68
Diese Grundsatzfrage ist auf zwei verschiede-
nen Ebenen zu beantworten.
Einerseits gibt es die Ebene der menschlichen Natur, mit den davon abgeleiteten
Grunderfahrungen und Fähigkeiten. Auf dieser Ebene ist der Anspruch eindeutig abso-
lut, denn die essentiellen Eigenschaften sind per Definition notwendig69
und jeder
Mensch besitzt sie qua seines Menschseins auf dieselbe Weise. Am Beispiel der
Fähigkeiten stellt Nussbaum beispielsweise klar: „As far as capabilities go, to call them
part of humanness is to make a very basic sort of evaluation. It is to say that a life with-
out this item would be too lacking, too impoverished, to be human at all.“70
Auf der zweiten Ebene der Spezifikationen hingegen gibt es eine gewisse Relativi-
tät. Nussbaums bereits angesprochen Verteidigung, dass „[d]ie Tatsache, daß eine gute
und tugendhafte Entscheidung je nach dem gegebenen Kontext anders ausfällt“ nicht
gleichbedeutend damit ist, „daß sie nur in bezug auf oder innerhalb eines begrenzten
Kontextes richtig ist“,71
bietet keinen absoluten Universalismus. Der universalistische
Anspruch wird insofern erfüllt, als dass eine im Kontext K1 vollzogene Handlung nicht
bloss von Menschen innerhalb desselben Kontexts als richtig beurteilt wird, sondern
dass auch andere Personen aus den Kontexten K2, K3, … Kn diese Handlung als ange-
messen einstufen, obwohl die Handlungsweise gemessen an ihren jeweils eigenen Kon-
texten vielleicht schlecht wäre. Doch die Tatsache, dass ein Urteilender aus K2 die
Handlung nicht relativ auf seinen eigenen Kontext, sondern relativ auf den Kontext K1
betrachtet, ist trotzdem eine Art der Bezogenheit. Damit ist diese ethische Theorie we-
der völlig relativ, noch völlig objektiv, in beide Richtungen gibt es extremere Ausfor-
mungen. In einem maximal relativ ausgeprägten Szenario gäbe es überhaupt keine
Massstäbe, um andere Taten zu loben oder zu kritisieren, da jede partikuläre Handlung
68
Vgl. Gowans 2011: 403. 69
Vgl. Nussbaum 1993: S50f. 70
Ebd.: S57. 71
Nussbaum 1998: 141. Hervorhebung im Original.
25
in ihrer absoluten Einzigartigkeit gesehen wird und unvergleichbar ist. Eine Moraltheo-
rie mit völlig objektivem Anspruch hingegen kann in ihrer überspitzten Form auf Prin-
zipien zurückgreifen, die ohne Unterschied und Berücksichtigung kontextueller Fakto-
ren für jeden einzelnen Menschen gelten.
Für Nussbaum, die den Relativismus so definiert, „daß sich die angemessenen Kri-
terien für das ethisch Gute einzig und allein aus den jeweiligen lokalen Bedingungen
ableiten lassen“,72
ist die Bezeichnung ihrer Tugenden als ‚nicht-relativ‘ gerechtfertigt –
denn das moralische Gute kann nicht bloss auf der Basis partikulärer Umstände, son-
dern auch durch die universale menschliche Natur bewertet werden. Trotzdem ist, wie
gerade gezeigt, ‚nicht-relativ‘ nicht gleichbedeutend mit ‚absolut objektiv‘. Und so sind
ihre ‚nicht-relativen-aber-auch-nicht-völlig-objektiven-Tugenden‘ am ehesten auf der
universalistischen Hälfte des breiten Kontinuums zwischen Universalismus und Partiku-
larismus einzuordnen.
72
Nussbaum 1998: 115. Hervorhebung von mir.
26
5. Schluss
In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie Martha Nussbaums Moraltheorie sich
im Spannungsfeld von Objektivismus und Relativismus, beziehungsweise Universalis-
mus und Partikularismus bewegt und was dies für die Idee eines globalen ethischen
Fortschritts bedeutet.
Um dieser Fragestellung nachzugehen, wurde zuerst Nussbaums Konzept einer es-
sentiellen menschlichen Natur und die daraus abgeleiteten nicht-relativen Tugenden
rekonstruiert. Danach wurde die Schwierigkeit thematisiert, welche sich im Übergang
von den universalen Grunderfahrungen hin zu den partikulären Spezifikationen ergibt.
In ihrer Verteidigung postuliert Nussbaum in Abgrenzung von Aristoteles einen Plura-
lismus von kulturell geprägten Konkretisierungen. Daraufhin kam Christopher Gowans
zu Wort, der Nussbaums Stellungnahme als vage bezeichnet und kritisiert, dass nicht
klar ist, wie das für den ethischen Fortschritt notwendige Ausschlussverfahren in die Tat
umgesetzt werden kann. Diese offene Frage wurde im dritten Teil aufgegriffen. Da in
der vorliegenden Arbeit versucht wurde, die Probleme innerhalb Nussbaums Moralthe-
orie zu lösen, wurde dafür nicht auf von ihr unabhängige Kriterien zurückgegriffen,
sondern auf eine andere Komponente ihres eigenen ethischen Systems; den Fähigkeiten-
Ansatz. Nachdem sich gezeigt hat, dass damit transkulturelle ethische Entscheidungen
wie die Frage nach der Einführung der Pockenimpfung begründet werden können, wur-
de versucht, die Argumentation auf die von ihr kritisierten Idee der christlichen Erbsün-
de anzuwenden. Hier zeigten sich jedoch die Grenzen ihrer naturalistischen Tugend-
ethik; durch den Rückgriff auf allen Menschen gemeinsame Erfahrungen und Fähigkei-
ten ist es nicht möglich, eine religiöse Vorstellung zurückzuweisen, die zwar vielleicht
faktisch schlichtweg falsch ist, aber das menschliche Gedeihen sonst in keiner Weise
hemmt oder gar befördert. Ob die Doktrin der Erbsünde die menschliche Entfaltung
einschränkt, hängt von der Konstruktion dieses Konzepts ab; Falls die Erbsünde als be-
lastend und unterdrückend empfunden wird, kann ihr durchaus vorgeworfen werden, die
Menschen in ihrer Freiheit einzuschränken. Wird die Erbsünde jedoch mit der positiven
Idee der Erlösung durch Jesus Christus verbunden und mit Erlösung, Gnade und Liebe
assoziiert, gibt es aus Nussbaums Perspektive keinen Grund mehr, die Spezifikation
einer demütigen Haltung gegenüber dem Leben als unangemessen zu bezeichnen.
27
Nussbaums Aristotelischer Naturalismus ist also insofern objektiv, als dass es tat-
sächlich universale Kriterien gibt, welche eine moralische Bewertung über die unter-
schiedlichsten Gesellschaften hinweg ermöglicht. Somit kann ihre Moraltheorie als Mit-
tel hin zu einem ethischen Fortschritt dienen – jedoch nicht mit einem wissenschafts-
ähnlichen, singulären Ziel, sondern mit einem Pluralismus, dessen Vielfalt unter dem
Streben nach dem Guten subsummiert werden kann.
Wie bereits anfangs deutlich gemacht wurde, steht diese Untersuchung jedoch unter
der voraussetzungsreichen Annahme einer essentiellen menschlichen Natur und dem
normativen Gehalt ihrer Implikationen. Die Kritik an der vorgebrachten Argumentation
kann deshalb bereits auf der Ebene der hier nicht diskutierten Vorannahmen angebracht
werden. Nussbaum selbst gibt sich diesbezüglich jedoch überzeugt,
daß die Argumente, welche diese Behauptung rechtfertigen, eine sich selbst begründende
Struktur haben: das heißt, daß jeder, der sich überhaupt auf die Untersuchung zur Bestäti-
gung dieser Argumente einläßt, damit bereits deren Bedeutung anerkennt.73
Falls sie mit dieser Annahme recht hat, würde dies bedeuten, dass alleine die Tatsache,
dass ich mich hier in dieser Arbeit mit ihrer Theorie auseinandergesetzt habe, ein Ar-
gument für die Richtigkeit ihrer Theorie ist.
73
Nussbaum 1998: 156.
28
6. Literaturverzeichnis
Aristoteles: Nikomachische Ethik. Übersetzt und herausgegeben von Ursula Wolf.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 20113.
Die Bibel. Einheitsübersetzung. Altes und Neues Testament. Stuttgart: Herder 1980.
Bobonich, Christopher: „Internal Realism, Human Nature, and Distributive Justice: A
Response to Martha Nussbaum“, in: Modern Philology 90, 1993, S. S74-S92.
Gowans, Christopher W.: „Virtue Ethics and Moral Relativism“, in: Hales, Steven D.
[Hrsg.]: A Companion to Relativism. Malden MA: Wiley-Blackwell 2011.
Kallhoff, Angela: Ethischer Naturalismus nach Aristoteles. Paderborn: mentis 2010.
Lutz, Christopher Stephen: Tradition in the Ethics of Alasdair MacIntyre. Relativism,
Thomism and Philosophy. Lanham: Lexington Books 2009.
Nussbaum, Martha: The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and
philosophy. Cambridge: University Press 1986.
- „Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essential-
ism“, in: Political Theory 20(2), 1992, S. 202-246.
- „Nicht-relative Tugenden: Ein aristotelischer Ansatz“, in: Rippe, Klaus-Peter
und Peter Schaber [Hrsg.]: Tugendethik. Stuttgart: Reclam 1998, S. 114-165.
- „Social Justice and Universalism: In Defense of an Aristotelian Account of Hu-
man Functioning“, in: Modern Philology 90, 1993, S. 46-73.
Schleissheimer, Bernhard: Ethik heute. Eine Antwort auf die Frage nach dem guten Le-
ben. Würzburg: Königshausen & Neumann 2003.