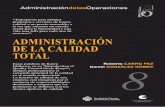Der Augsburger Druckgraphiker Daniel Hopfer (1471-1536) als Waffendekorateur
Transcript of Der Augsburger Druckgraphiker Daniel Hopfer (1471-1536) als Waffendekorateur
* Der vorliegende Text entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes der Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums (KHM, HJRK) in Wien. Chr.stian Beaufort-Spontin, dem Leiter dieses Projektes, bin ich für seine Unterstützung zu gro-ßem Dank verpflichtet; die finanzielle Förderung hat großzügigerweise die Gerda Henkel Stiftung in Düsseldorf übernommen. Das Metropolitan Muse-um of Art in New York gewährte in Ergänzung ein Andrew W. Mellon Fellowship; Stuart W. Pyhrr, Do-nald J. LaRocca und Dirk H. Breiding danke ich für ihre freundliche Aufnahme während dieses Aufent-halts. Folgenden Kollegen sei ebenso gedankt: Mat-thias Pfaffenbichler un. Chr.sta Angermann (KHM, HJRK), Christof Metzger (Wien), Álvaro Soler del Campo (Madrid), Freyda Spira (New York), Pierre Terjanian (New York), Tobias Capwell, David Edge und Alan Williams (London), Sergey Rymsha und Yulia Igina (St. Petersburg).
1 Gustav Pauli und Max Loßnitzer sprachen von „abdruckfähige[n] Waffenätzungen“; Gustav Pauli, Inkunabeln der deutschen und niederländischen Radie-rung, Berlin 1908, 3; Max Loßnitzer, Zwei Inkunabeln der deutschen Radierung, in: Mitteilungen der Gesell-schaft für vervielfältigende Kunst. Beilage der „Gra-phischen Künste“, 1910, 36 – 39.
2 Arpad Weixlgärtner umschrieb die gravierten Verzie-rungen mittelalterlicher Goldschmiedearbeiten als „un-gedruckte Drucke“; Arpad Weixlgärtner, Ungedruckte Stiche. Materialien und Anregungen aus Grenzgebieten der Kupferstichkunde, in: Jahrbuch der kunsthistori-schen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 29, 1910/11, 259 – 385, bes. 339 – 342. Daran angelehnt können die geätzten Verzierungen von Harnischen als „ungedruckte Radierungen“ umschrieben werden.
3 Vgl. das aktuelle Werkverzeichnis von Christof Metz-ger in: Ausstellungskatalog Christof Metzger, Daniel Hopfer. Ein Augsburger Meister der Renaissance. Eisen-radierung. Holzschnitte. Zeichnungen. Waffenätzungen, mit Beiträgen von Tobias Güthner, Achim Riether und Freyda Spira, München (Staatliche Graphische Sammlung) 2009 – 2010.
4 Gittertartsche Kaiser Karls V., Madrid, Patrimo-nio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. A 57; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 525, Kat.-Nr. W 1 (mit Lit.); ergänzend vgl. José María Marchesi, Catálo-go de la Real Armería, Madrid 1849, 106, Nr. 1817; Graf Valencia de Don Juan (Hg.), Bildinventar der Waffen, Rüstungen, Gewänder und Standarten Karl V. in der Armeria Real in Madrid (1. Teil), in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 10, 1889, Reg. 6267, Taf. 11 (Tartsche) und Taf. 6 (kleine Abdeckplatte).
Stefan Krause
Der Augsburger Druckgraphiker Daniel Hopfer (1471 – 1536) als Waffendekorateur*
Das dekorative Ätzen von Waffen ist eine Kunstform, die das Aussehen von Prunkrüstungen des Spätmittelalters und der Renaissance maßgeblich prägt. Stilistisch und technisch ist die Waffenätzung auf das Engste mit den graphischen Künsten verwandt1; ihr ist der freie, skizzenhafte Charakter einer Zeichnung eigen, und das Ätzen einer Rüstung ist in Bezug auf die handwerkliche Praxis identisch mit dem Ätzen einer Radierdruckplatte2. Trotz ihrer unmittelbaren Verbindung zur Graphik fand die Waffendeko- ration in der Forschung bisher nur selten die ihr gebührende Aufmerksam-keit. In der süddeutschen Renaissance gibt es jedoch einen Künstler, der wie kein anderer dafür prädestiniert ist, diese Kunst beispielhaft einer neuen Wertschätzung entgegenzuführen – es ist dies der Augsburger Druck-graphiker und Waffenätzer Daniel Hopfer (1471 – 1536).Daniel Hopfer arbeitete als Graphiker nahezu ausschließlich in der Technik der Radierung3. Zusätzlich zu seinen Arbeiten auf Papier kann ihm eine nicht geringe Zahl verzierter Waffen zugeschrieben werden; zwei dieser Werke, ein Schild in Madrid4 und das sog. Ottheinrich-Schwert in Nürn-berg5, tragen seine Signatur. Die Beschäftigung mit Hopfers Œuvre als Waffendekorateur wird jedoch durch einen Umstand wesentlich erschwert: Hopfers Werkstatt war eine der wichtigsten Quellen für ornamentale Vor-lagenblätter, die im frühen 16. Jahrhundert von vielen süddeutschen Künst-lern, allen voran von Waffenätzern, intensiv genutzt wurde. James G. Mann veröffentlichte 1940 eine kleine Gruppe von Waffendekorationen, von denen er annahm, sie seien von Daniel Hopfer bzw. von anderen Künstlern nach Vorlagen Hopfers gefertigt worden. Diesen von Mann prägnant unter „Hopfer Group“6 zusammengestellten Werken wurden in den folgenden Jahrzehnten laufend weitere hinzugefügt, doch blieb das zentrale Problem, das eigenhändige Werk Daniel Hopfers als Waffenätzer herauszuarbeiten, im Kern unbearbeitet. Ein Forschungsprojekt7 bot nun die Gelegenheit, eben diese Fragen einer Revision zu unterziehen und damit einem Teila-spekt aus dem Werk eines der wichtigsten graphischen Künstler der deut-schen Renaissance neue Geltung zu verschaffen.
Daniel Hopfer und die Hopfer Group
Daniel Hopfer wurde im Jahr 1471 in Kaufbeuren, einer zu jener Zeit wirt-schaftlich und kulturell aufstrebenden schwäbischen Reichsstadt, geboren. Die frühen Jahre in Daniels Leben liegen für uns im Dunkeln, doch dürfte er in Kaufbeuren bei dem Maler Bartholome Hopfer gelernt haben, der wahrscheinlich auch als sein Vater zu identifizieren ist8. 1493 zog Daniel nach Augsburg und spezialisierte sich dort auf das Handwerk der Druck-graphik und in Folge auch der Waffendekoration, die ihm beide für den Rest seines Lebens Wohlstand und weit über sein Ableben hinaus Einfluss
Abb. 1: Kolman Helmschmid und Daniel Hopfer, Rossstirn aus dem Besitz Ottheinrichs von der Pfalz (Stirnschildchen nachträglich aufgesetzt). Augsburg, 1523. Wien, Kunsthistorisches Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, Inv.-Nr. A 239b.
54
stefan krause
5 Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Inv.-Nr. W 2833; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 525, Kat.-Nr. W 2 (mit Lit.); ergänzend vgl. Ausstellungs-katalog Peter Flötner und die Renaissance in Deutsch-land, Nürnberg (Germanisches Nationalmuseum in der Fränkischen Galerie am Marientor) 1946 – 1947, 73, Kat.-Nr. 437.
6 James G. Mann, The etched decoration of Armour. A study in classification (Annual Lecture on Aspects of Art), in: Proceedings of the British Academy XXVII, 1940, 6 – 11 („The Augsburg School. I. The Hopfer Group“): Nr. (I): s. Anm. 110; Nr. (II): s. Anm. 23, WZ 11; Nr. (III): s. Anm. 91; Nr. (IV): s. Anm. 109; Nr. (V): s. Anm. 23, WZ 10; Nr. (VI): s. Anm. 64; Nr. (VII): s. Anm. 25, WZ 21; Nr. (VIII): s. Anm. 81 (Warwick Castle); Nr. (IX): s. Anm. 23, WZ 4; Nr. (X): Cambridge, The Fitzwilliam Museum, Inv.-Nr. M.1.6-1936; Nr. (XI): s. Anm. 66; Nr. (XII): s. Anm. 85; Nr. (XIII): s. Anm. 23, WZ 8; Nr. (XIV): s. Anm. 83. Zu Manns Hopfer Group s. auch Anm. 23.
7 Vgl. die einleitende Anmerkung oben.8 Die Stammtafel der Familie Hopfer von 1559 (?):
Augsburg, Stadtarchiv, Evangelisches Wesensarchiv, Nr. 1567 Tom. I [Acta das Patriziat betr.], Nr. I, 26; vgl. Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 551, Q 24, s. auch 12 f.
9 Wien, Österreichisches Staatsarchiv – Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Reichsakten V.B. 4014; vgl. Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 549, Q 15. Zum Familienwappen Hopfers vgl. ebenda, 17; J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. 6/1, Abgestorbener Bayerischer Adel (bearbeitet von Gustav Adelbert Seyler), Nürnberg 1884, 76 und Taf. 75; ebenda, Bd. 6/1, Teil III, Nürn-berg 1911, 183 f. und Taf. 130. Zu Hopfers Wappen-brief vgl. auch weiter unten.
10 Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 550, Q 20 und Q 21.
11 Die Totenliste der Augsburger Malerzunft verzeich-net: „1536 Thoniel Hoffpffer Zwelffer vnnd maller“, Augsburg, Stadtarchiv, Schätze 72b, Einschreibe-buch der Maler, Bildhauer, Goldschläger und Glaser 1480 – 1542, Kopie von Schätze 72c [Einschreibe-buch … Urschrift 1480 ff.] mit Fortsetzungen bis 1548, fol. 4r; zit. nach Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 551, Q 23.
12 Daniel Prasch, Epitaphia Augustana Vindelica, Bd. 1, Augsburg 1624, 259: „Auff der finstern Grabt: Da-niel Ho[p]fer“; vgl. auch Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 17 sowie 51, Anm. 48.
13 Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 41 – 44.14 Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 27 – 34.15 Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3).16 P. J. [Peter Jessen], Ein geätzter Schild von Daniel
Hopfer, in: Kunstgewerbeblatt. Monatsschrift für Geschichte und Litteratur der Kleinkunst, Organ für die Bestrebungen der Kunstgewerbevereine 5, 1889, 26 f. (ill.); s. auch El Conde V.do de Valencia de Don Juan, Catálogo Histórico-descriptivo de la Real Armería de Madrid, Madrid 1898 (unveränderte Neuauflage: Valladolid 2008), 29, Abb. 28.
17 Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 525, Kat.-Nr. W 1.18 Vgl. auch Eduard Eyssen, Daniel Hopfer von Kaufbeu-
ren, Meister zu Augsburg 1493 bis 1536, Inaug.-Diss. Heidelberg 1904, 9 und 73, D; Thomas Muchall-Viebrook, Daniel Hopfer, in: Ulrich Thieme – Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. 17, Leipzig 1924, 474.
19 Paul Post, Ein Frührenaissanceharnisch von Konrad Seusenhofer mit Ätzungen von Daniel Hopfer im Ber-liner Zeughaus, in: Jahrbuch der preuszischen Kunst-sammlungen 49, 1928, 167 – 186, bes. 174 – 185. Vgl. auch weiter unten.
20 Vgl. das Kapitel „Innsbruck und Augsburg – Der Lig- nitzer Harnisch“.
auf die Kunst des süddeutschen Raumes sichern sollte. Hopfers künstleri-scher und wirtschaftlicher Erfolg beruhte auf einem thematisch breit gefä-cherten Portfolio an Druckgraphiken. Seine Werkstatt verkaufte religiöse und mythologische Szenen, Porträts von Päpsten und Reformatoren, bäu-erliche Motive und Kopien nach Werken Dürers und Mantegnas. Von be-sonderer Bedeutung sind Hopfers ornamentale Vorlagenblätter, die großen Anteil an der Verbreitung des Formenguts der italienischen Renaissance in den Werkstätten oberdeutscher Künstler, nicht zuletzt jenen der Waffenät-zer, hatten.Der Erfolg als Künstler und Geschäftsmann führte sehr bald auch zu gesell-schaftlicher Anerkennung und Würdigung. Im Jahr 1514 wurde Hopfer Zechpfleger (Kassenverwalter) der Augsburger Heilig-Kreuz-Kirche. Zehn Jahre später verlieh Kaiser Karl V. Hopfer und seinen Erben ein Familien-wappen; dieses zeigt in Anspielung an den Namen des Künstlers einen hüp-fenden Wilden Mann („zum hupffenn geschickt“), der ein Büschel Hopfen-blätter in der Hand hält („ein Hopffensteutlen haltendt“) sowie Hopfen im Haar und um die Hüften trägt9. Ab 1532 vertrat Hopfer die Schmiedezunft bei Gericht und im Großen Rat der Stadt Augsburg. In dieser ehrenvollen Eigenschaft war er auch Mitglied jener Kommission, die im Juli 1534 die Beschlüsse zur Einführung der Reformation in Augsburg durchsetzte10. Hopfer selbst blieb es erspart, am eigenen Leib die dramatischen Auswir- kungen der protestantischen Bilderfeindlichkeit auf das künstlerische Leben Augsburgs miterleben zu müssen. Er starb im Jahr 153611, ein Jahr vor dem reformatorischen Bildersturm in Augsburg, als wohlhabender und angesehe-ner Bürger der Stadt und wurde dort in der „Finsteren Gräbd“ beim Dom begraben12. Hopfers Nachfahren sollte es über mehrere Generationen hin-weg gelingen, jene gehobene Stellung zu halten, die Daniel im frühen 16. Jahrhundert durch seine künstlerische Arbeit aufzubauen in der Lage war13.Hopfers druckgraphischem Œuvre blieb, befördert durch wiederholte Neuauflagen, auch über die folgenden Jahrhunderte hinweg ein gewisser Bekanntheitsgrad erhalten14. Die Erforschung seiner Radierungen setzte im 19. Jahrhundert ein und erreichte im rezenten Werkkatalog15 ihren Höhe-punkt. Die Waffenätzungen Daniel Hopfers hingegen wurden lange Zeit nicht als solche erkannt und blieben daher zum großen Teil wissenschaft-lich unbearbeitet. Peter Jessen war es, der 1889 an einem im Berliner Kunst-gewerbemuseum verwahrten Abguss des bereits erwähnten Madrider Schil-des Hopfers Signatur bemerkte16: „DAN / IEL. / HOP / FE / R“ sowie die Jahreszahl „M·D·XXXVI“ (1536) (Abb. 2) sind darauf zu lesen17. Jessen hielt es für keinen Zufall, die Signatur eines auf die Ätztechnik spezialisier-ten Druckgraphikers auf einer geätzten Plattnerarbeit zu finden, doch un-terließ er es, Hopfer weitere Waffenätzungen zuzuschreiben18. Paul Post versuchte 1928, die Dekoration der Harnischgarnitur Herzog Friedrichs II. von Liegnitz (1480 – 1547) auf der Basis motivischer Vergleiche dem Werk Hopfers einzugliedern19. Obwohl diese These kritisch zu betrachten ist20, verdient Post doch Anerkennung „for opening our eyes to those motifs used by Hopfer“21, um mit den Worten von James Mann zu sprechen. Seitdem ist Hopfers Œuvre als Waffenätzer auf knapp über 30 Arbeiten erweitert worden; bis auf den Schild in Madrid und das mit „D HOPFER“ signierte sog. Ottheinrich-Schwert in Nürnberg22 werden diese aber aufgrund des grossen Einflusses von Hopfers Graphiken auf die süddeutsche Waffen- ätzung nach wie vor als Zuschreibungen geführt23. Mangels archivalischer Quellen zu Hopfers Arbeit als Waffenätzer ist derzeit der einzige Weg, sich dem „Hopfer-Problem“ (in Anlehnung an Manns Hopfer Group24) zu nähern, die stilistische Analyse der zur Diskussion stehenden Werke.➤
55
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
21 Mann 1940 (zit. Anm. 6), 8.22 Das Schwert wurde erstmals ausführlich beschrieben
in: Wolfgang Wegner, Ein Schwert von Daniel Hopfer im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. F., Bd. V, 1954, 124 – 130. Zum Schwert vgl. Anm. 5 sowie das abschließende Kapitel dieses Textes.
23 Vgl. Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 525 – 531; aus dem eigenhändigen Werk Hopfers auszuschei-den sind: Kat.-Nrn. WZ 1 (vgl. Anm. 69), WZ 3 (vgl. Anm. 109), WZ 4 (ehem. Berlin, Zeughaus, Inv.-Nr. 25.33, jetzt Warschau, Muzeum Wojska Polskiego, Inv.-Nr. 190X), WZ 7, WZ 8 (die Ätzung möglicherweise modern), WZ 9, WZ 10 (Nürnber-ger Arbeit, Leeds, Royal Armouries, Inv.-Nr. IV.501), WZ 11, WZ 12, WZ 13, WZ 14 (Nürnberger Ar-beit), WZ 15 (Daniel Hopfer?), WZ 21 (Nürnber-ger Arbeit, Paris, Musée de l’Armée, Inv.-Nr. G 31, als Leihgabe in Strassburg, Musée Historique de la Ville de Strasbourg, Inv.-Nr. MH 601), WZ 24 (vgl. Anm. 74), WZ 27 (Streitaxt möglicherweise nicht von Hopfer, Sattel und Rossstirn eigenhändig; vgl. Anm. 81). James Manns Hopfer Group von 1940 (vgl. Anm. 6) ist ebenso heterogen; nur die Nummern (III), (VI), (VIII), (XI), (XII), (XIV) sind als eigenhändige Werke Hopfers anzusehen. Zur Problematik der Waf-fenätzungen Hopfers vgl. aktuell Freyda Spira, „Wie man Schrifft vn Gemalde auf Stäheline Eysene Waffen etzen soll“. Daniel Hopfer und die geätzte Dekoration von Rüstungen, in: Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 69 – 85.
24 Vgl. Mann 1940 (zit. Anm. 6).25 S. Anm. 4.26 Vgl. Valencia de Don Juan 1889 (zit. Anm. 4).27 Ausstellungskatalog Ebba Krull – Susanne Netzer
(Hgg.), Welt im Umbruch. Augsburg zwischen Renais-sance und Barock, Augsburg (Rathaus und Zeughaus) 1980, Bd. 2, 503, Kat.-Nr. 899 (Bruno Thomas).
28 Der Großteil der Motive lässt sich nicht eindeutig identifizieren. Die stehende weibliche Figur mit flan-kierenden Putten im unteren Teil des Schildes ist als Fortuna, die Personifikation des Glücks, zu identifi-zieren, sie ist jedoch auch mit Venus, der Göttin der Liebe, und Luxuria, der Personifikation der Wollust, in Verbindung zu bringen; vgl. Freyda Spira, Origi-nality as Repetition / Repetition as Originality. Daniel Hopfer (ca. 1470 – 1536) and the Reinvention of the Medium of Etching, Univ.-Diss. University of Pennsyl-vania 2006, 77 – 82.
Die signierte Gittertartsche von 1536 in Madrid
Daniel Hopfer war 65 Jahre alt und ein angesehener Bürger der Stadt Augsburg, als er im Jahr 1536 den bereits erwähnten, in Madrid verwahr-ten Schild25 mit Ätzmalerei dekorierte, signierte und datierte. Der Madri-der Schild, eine Gittertartsche, wäre seiner Form entsprechend Teil eines Harnischs für das Plankengestech, in dem zwei speziell geharnischte Reiter versuchen, in vollem Galopp und über eine trennende Barriere hinweg sich gegenseitig mit stumpfen Lanzen zu treffen. Das namensgebende Git-ter der Tartsche, zumeist aufgesetzt oder mit dem Schild in einem Stück aus dem Stahl getrieben, erleichterte es dem Turnierreiter, die Lanze des Gegners zum Brechen zu bringen und dadurch zusätzliche Punkte zu er-zielen. Die Madrider Tartsche wurde für Kaiser Karl V. (1500 – 1558)26 gefertigt, doch ist für diesen kein Harnisch für das Plankengestech doku-mentiert. Bruno Thomas vermutete aus diesem Grund, dass der Madrider Schild ein ergänzendes Verstärkungsstück für einen bereits existierenden, heute nicht bekannten Turnierharnisch des Kaisers war27.Die Dekoration der Gittertartsche Kaiser Karls V. ist eines der spätesten Werke von Daniel Hopfers Hand. Entstanden im Todesjahr des Künstlers, stellt sie die abschließende Stilstufe einer vielfältigen künstlerischen Kar-riere dar, die die Zeit von den 1490er Jahren bis in die 1530er Jahre, also insgesamt mehr als vier Jahrzehnte, überspannt. Hopfers Handschrift auf der Madrider Tartsche lässt zum einen jene schwungvolle Leichtigkeit er-kennen, die auch viele von Hopfers graphischen Ornamentvorlagen der 1520/30er Jahre auszeichnet. Die zeichnerische Gestaltung der Formen ist in diesem späten Werk aber auch als unpräzise und nachlässig zu charakte-risieren, was im Gegensatz zu den meisten früheren, Hopfer zuzuschrei-benden Waffendekorationen steht. Die rhombischen Felder der Tartsche zeigen in vergoldeter Ätzung mythologische Szenerien28, die eng mit Hop-fers graphischem Œuvre verbunden sind, so etwa das Motiv in der Mitte
Abb. 2: Desiderius Helmschmid und Daniel Hopfer, Gittertartsche Kaiser Karls V., Detail. Augsburg, datiert 1536. Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. A 57.
56
stefan krause
29 M = Christof Metzgers Catalogue raisonné der Druck-graphiken Daniel Hopfers in: Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3).
30 Spira 2006 (zit. Anm. 28), 189. Vgl. auch die eigen-willige Beinhaltung der beiden Figuren in Hopfers Radierungen M 120 und M 121. Der bogenschie-ßende Putto im linken oberen Eck des Schildes ist mit Hopfers Groteskenrahmen M 159 in Verbindung zu bringen. Der an eine Säule Gefesselte im rechten unteren Eck der Tartsche erinnert an ein ähnliches Motiv in Hopfers Kandelabern M 113.
31 Vgl. auch M 116, M 122, M 127, M 150 bzw. das sog. Ottheinrich-Schwert (vgl. Anm. 5 und Abb. 16) sowie den Kragen, New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 29.150.1b (dazugehörend: Schulterpaar 29.150.1g/h). Die wirren Locken fin-den sich auch in Werken anderer Künstler des frühen 16. Jahrhunderts, etwa bei Jan Gossart; vgl. Ausstel-lungskatalog Maryan W. Ainsworth (Hg.), Jan Gos-sart. Man, myth, and sensual pleasure, New York (The Metropolitan Museum of Art) – London (The Natio- nal Gallery) 2010 – 2011, 394 f., Kat.-Nr. 107 (Stijn Alsteens).
32 Die Abdeckplatte verdeckt die drei Schrauben, mit deren Hilfe die Tartsche an der Brust des Harnischs fixiert werden kann.
33 New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 40.135.4. Dieser Bart war womöglich ein Ver-stärkungsstück für die Sturmhaube in Madrid, Pat-rimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. A 120; vgl. Stephen V. Grancsay, The illustrated Inventory of the Arms and Armor of Emperor Charles V, in: Homenaje a Rodriguez-Monino. Estudios de erudición que le ofrecen sus amigos o discípulos hispanistas norteamericanos, Ma-drid 1966, Abb. 2 und 3, sowie S. 7, Anhang, Nr. 5. Zu dem Helm Madrid A 120 vgl. Anm. 126.
34 Vgl. Anm. 9.35 Alexander Freiherr von Reitzenstein, Die Augsburger
Plattnersippe der Helmschmid, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. F., Bd. II, 1951, 179 – 194.
36 Jakob Schrenck von Notzing, Die Heldenrüstkammer (Armamentarium Heroicum) Erzherzog Ferdinands II. auf Schloß Ambras bei Innsbruck, Faksimiledruck der lateinischen und der deutschen Ausgabe des Kupfer-stich-Bildinventars von 1601 bzw. 1603, hg., einge-leitet und erläutert von Bruno Thomas, Osnabrück 1981, Nr. 76.
des Schildes, das die Datierung 1536 zeigt (Abb. 2); das Figurenpaar in diesem Feld ist Hopfers Tropaion mit Adler, flankiert von zwei geflügelten Genien all’antica (M 15229) verwandt30. Der Dekor der Tartsche zeigt all jene Charakteristika, die James Mann für seine Hopfer Group zusammen-gestellt hatte, wie etwa ein vielfach variiertes kugelförmiges Ornament, ein zumeist grimmig erscheinender Delphin und eine stupsnäsige Harpyie (oder Meerjungfrau) mit Haube und Ohrlocken. Darüber hinaus ist auch auf die wirren Haarlocken zu verweisen, die auf dem Kopf so mancher weiblicher Figur auf der Gittertartsche zu erkennen und als Eigenheit der späteren Werke Hopfers anzusehen sind31. Ein weiteres, in Hopfers Spät-werk häufig auftretendes Detail ist die schmale gepunktete Linie, die die kleine Abdeckplatte am linken Rand der Gittertartsche32 rahmt. Hopfer machte von diesem Motiv unter anderem in seinen Majuskelalphabeten (M 143, M 144) intensiv Gebrauch, es lässt sich aber auch in einigen Hopfer zuzuschreibenden Waffenätzungen nachweisen, etwa auf einem Verstärkungsstück für Hals und Kinn (Bart) von Desiderius Helmschmid (um 1535) in New York33.Ein Detail im Dekor der Madrider Tartsche, das in Bezug auf Daniel Hop-fer besondere Aussagekraft besitzt, ist die Hopfendolde. Bereits erwähnt wurde das auf den Namen des Künstlers anspielende Familienwappen von 1524 (der hüpfende Wilde Mann mit Hopfenlaub)34; indem Hopfer die Hopfendolde in das ornamentale Repertoire seiner Waffenätzungen inte-griert, durchdringt er diese auf geistreiche Art mit einem für ihn signifi-kanten Ornament. Das Motiv der Hopfendolde verweist auch auf den sog. Stadtpyr, die heraldische Zirbelnuss, die das Stadtwappen Augsburgs ziert. Er findet sich auf Augsburger Münzen, die Plattner der Stadt markierten mit diesem Zeichen ihre Werke, und in einem Großteil der Graphiken Hopfers ist der Stadtpyr mit dem Monogramm des Künstlers verbunden. In Hopfers speziellem Fall kommt diesem Motiv die doppelte Bedeutung von Hopfendolde und Zirbelnuss zu und lässt sich somit als raffiniert ver-bildlichte Künstlersignatur identifizieren.Die Madrider Gittertartsche wird dem Augsburger Plattner Desiderius Helmschmid (1513 – 1579) zugeschrieben. Desiderius entstammte einer Augsburger Familie, die zu seiner Zeit bereits in dritter Generation das Plattnerhandwerk ausführte und die einige der größten Meister der Platt-nerkunst der Spätgotik und Renaissance hervorgebracht hat – Lorenz Helmschmid (ca. 1445 – 1516), dessen Bruder Georg/Jörg (erstmals er-wähnt 1467, gestorben 1502), Lorenz’ Sohn Kolman (1471 – 1532) sowie Lorenz’ Enkel, der eben erwähnte Desiderius35. Die Familie Helmschmid belieferte über Jahrzehnte hinweg den habsburgischen Hof mit Plattner- arbeiten und kooperierte, wie es scheint, bei vielen Aufträgen mit dem Waffenätzer Daniel Hopfer. Dies war nachweislich bei der Gittertartsche des Desiderius Helmschmid von 1536 der Fall und, etwa drei Jahrzehnte früher, wohl auch bei dem frühesten bekannten Werk von Kolman Helm-schmid, dem Sonnenberg-Harnisch.
Der Küriss für Feld und Turnier des Andreas Graf Sonnenberg
Andreas Graf Sonnenberg (ca. 1460 – 1511) war ein enger Vertrauter Kai-ser Maximilians I. (1459 – 1519) und hatte seit den 1480er Jahren in Ma-ximilians Gefolge an militärischen Kampagnen in Burgund, Österreich und Ungarn teilgenommen36. Um 1505/10 fertigte Kolman Helmschmid
57
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
37 Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 310; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 531, Kat.-Nr. WZ 28 (mit Lit.); ergänzend vgl. Bruno Thomas, Harnischstudien I: Stil-geschichte des deutschen Harnisches von 1500 – 1530, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, N. F. Bd. 11, 1937, 142 f. [= Bruno Thomas, Gesam- melte Schriften zur historischen Waffenkunde, 2 Bde., Graz 1977, Bd. 1, 622 f.]; Ortwin Gamber, Kolman Helmschmid, Ferdinand I. und das Thun’sche Skizzen-buch, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 71, 1975, 28; Schrenck von Notzing 1981 (zit. Anm. 36), Taf. 76 (mit Lit.).
38 Der Innsbrucker Hofplattner Hans Seusenhofer (1470 – 1555) berichtete 1527 von einer schweren Erkrankung nach der Ausführung einer Feuervergol-dung; vgl. David Schönherr, Urkunden und Regesten aus dem k. k. Statthalterei-Archiv in Innsbruck, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Al-lerhöchsten Kaiserhauses 2, 1884, CXXIV, Reg. 1727 (29. Oktober 1527).
39 Aktuell vgl. Pierre Terjanian, Princely Armor in the Age of Dürer. A Renaissance Masterpiece in the Philadelphia Museum of Art, Philadelphia 2011, 24 f. Diese oft als „Goldschmelz“ umschriebene Dekorationsmetho-de kam auch nach 1520, u. a. in Hopfers Werkstatt, zum Einsatz: vgl. die Garnitur für Mann und Ross König (Kaiser) Ferdinands I., Kolman Helmschmid, Augsburg 1526, Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 349 (die feuervergoldete und gebläute Dekoration von Daniel Hopfer und Werkstatt ist großteils verloren), dazugehörend die Streitaxt in Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 387 (Dekor in Feuervergoldung von Da-niel Hopfer); vgl. Bruno Thomas – Ortwin Gamber, Kunsthistorisches Museum, Wien. Waffensammlung. Katalog der Leibrüstkammer, I. Teil. Der Zeitraum von 500 bis 1530, Wien 1976, 222 f. Vgl. auch die Sturmhaube in Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. A 59 (vgl. Anm. 125).
40 Kilian Anheuser, Im Feuer vergoldet. Geschichte und Technik der Feuervergoldung und der Amalgamversil-berung (Schriftenreihe zur Restaurierung und Gra-bungstechnik Bd. 4), Stuttgart 1999, 28 – 31.
41 Der Sonnenberg-Harnisch zeigte ursprünglich Heili-genfiguren in Feuervergoldung auf gebläutem Grund, die heute nahezu vollständig verloren sind, am Rü- cken Maria mit Kind und der Inschrift „Ave Maria“ (vgl. Hopfers Radierung M 42), auf der Brust rechts die hl. Barbara; vgl. Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), 220 (erwähnen drei Figuren auf der Brust). Das Armamentarium Heroicum von 1601/03 zeigt zwei Figuren auf der Brust des Harnischs; Schrenck von Notzing 1981 (zit. Anm. 36), Nr. 76.
42 Bruno Thomas, Ausstellung von Harnischen und Waf-fen von Herrschern und Helden aus den Staatlichen u. a. Sammlungen Österreichs im Tower of London, Typo-skript 1949, Wien, KHM, HJRK, Bibliothek, Sig. 62.094, Nr. 12. Die gedruckte Version des Katalogs verweist nur im Kontext des Ottheinrich-Harnischs auf die Verbindung zwischen dem Sonnenberg-Har-nisch und Daniel Hopfer; vgl. Ausstellungskatalog James Mann – Bruno Thomas, Exhibition of Armour of Kings and Captains from the National Collections of Austria, London (H. M. Tower of London) 1949, 4, Kat.-Nr. 12, und 5, Kat.-Nr. 14. Schrenck von Not-zing 1981 (zit. Anm. 36), Nr. 76.
43 Vgl. Jahresbericht 2011. Kunsthistorisches Museum mit MVK und ÖTM, Wien 2012, Abb. S. 57. Vgl. auch das Detail in Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 80.
für Sonnenberg einen Küriss für Feld und Turnier37, der als das früheste bekannte Werk dieses Meisters anzusehen ist und zugleich einen Meilen-stein in der Entwicklung der mehrteiligen, im Feld und im Turnier ein-setzbaren Harnischgarnitur darstellt. Sonnenbergs Harnisch gehört mit seinen einfachen, gerundeten Formen der deutschen Renaissance an, seine Oberfläche ist blank poliert und nahezu komplett undekoriert – dies je-doch mit Ausnahme der zumeist schmalen Randstreifen auf vielen Teilen der Rüstung. Die grotesken Ornamente in diesen Feldern sind stilistisch und motivisch eng mit Daniel Hopfers Werk verbunden, doch wurden sie auf dem Sonnenberg-Harnisch nicht in Ätzung, der für Hopfer üblichen Technik, ausgeführt, sondern in Feuervergoldung auf gebläutem Grund. Dies ist umso bemerkenswerter, da es bedeuted, dass Hopfer als Waffende-korateur nicht ausschließlich in der Technik der Eisenätzung arbeitete.Die Feuervergoldung ist eine weit verbreitete, jedoch aufgrund der dabei entstehenden Quecksilberdämpfe hochgiftige Dekorationsmethode38. Bei der Feuervergoldung von Eisen bzw. Stahl wird Goldamalgam flächig auf die meist zuvor verkupferte (und oft mit Ätzmalerei verzierte) Oberfläche des Metalls aufgetragen. Der Quecksilberanteil des Amalgams wird durch Erhitzen (auf ca. 300 – 350 °C) abgedampft, das Gold hingegen verbindet sich fest mit dem verkupferten Metallgrund und erhält durch anschließen-des Polieren (zumeist mit Achat) seinen charakteristischen warmen Glanz. Der Harnisch des Grafen Sonnenberg zeigt eine Variante der Feuervergol-dung, die vor allem ab etwa 1490 bis ca. 1520 im süddeutschen Raum häufig zur Dekoration von Plattnerarbeiten verwendet wurde, deren Cha-rakteristika bisher aber nicht gesondert beschrieben worden sind39. Bei diesem Verfahren dient das Goldamalgam – den Ölfarben der Maler nicht unähnlich – als Farbe, mit der auf der Stahloberfläche figürliche Szenen, Inschriften etc. gemalt werden; Details, wie Gesichtszüge und Schattierun-gen der Figuren, werden mit einem Griffel in das Goldamalgam gezeichnet, Umrisslinien konnten nach Bedarf nachträglich präzisiert werden. Zusätz-lich macht sich der Künstler hier eine besondere Eigenschaft von Eisen bzw. Stahl zunutze: Die Oberfläche von Stahl erhält bei etwa 330 °C eine iri- sierende blaue Oxidschicht (Farbvarianten bei ca. 300 – 380 °C), die in Kombination mit den in Goldamalgam gemalten Motiven eine überaus effektvolle Wirkung entfaltet40.Die feuervergoldete und gebläute Dekoration des Sonnenberg-Harnischs ist das früheste bekannte Beispiel einer einheitlich im Stil der Renaissance ver-zierten Plattnerarbeit im süddeutschen Raum41. Bruno Thomas erkannte bereits 1949 die motivische Nähe der figürlichen Szenen auf diesem Har-nisch zu Daniel Hopfers Werk42. Die zwei Drachen mit verschränkten Hälsen auf dem Helm des Sonnenberg-Harnischs (Abb. 3) erinnern an ein ähnliches Motiv in dem grotesken Rahmen, den Hopfer zu der von seinem Sohn Lambrecht geschaffenen Radierung Triton mit Seepferd und Putto (M 129) beigesteuert hat. Die stupsnäsigen weiblichen Figuren mit Haube und Ohrlocken43 sind ähnlich auf der Madrider Gittertartsche zu sehen. Stilistisch unterscheidet sich der Dekor des Sonnenberg-Harnischs jedoch deutlich von Hopfers Ätzungen auf dem Madrider Schild von 1536. Die Figuren wirken hier kräftiger und unruhiger als die eleganten, leichtfüßi-gen Wesen der 1530er Jahre, doch verbindet gerade diese Eigenschaft sie mit Hopfers frühen, spätgotischen Radierungen. In der Rahmung von Hopfers Höfische Dame mit ihrem Verehrer (M 81) aus der Zeit um 1500 sind groteske Renaissancemotive wie Füllhörner und kämpfende tritonen-ähnliche Wesen zu sehen, die in ihrer energischen und an spätmittelalter-
58
stefan krause
44 Vgl. auch M 42 und M 26; letzeren Druck bringt Metzger vorbehaltlich mit der 1496 geweihten Wall-fahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg bei Augsburg in Verbindung; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 344 – 346.
45 Vgl. Anm. 95.46 Hollstein’s German Engravings, Etchings and Woodcuts,
Bd. XI: Urs Graf, zusammengestellt von John K. Row-lands, hg. von Fedja Anzelewsky und Robert Zijlma, Amsterdam 1977, 16, Nr. 9. Die Graphik wird nun eher als vom Künstler vordatierte Arbeit von 1523 an-gesehen; vgl. Berthold Haendcke, Die Schweizerische Malerei im XVI. Jahrhundert diesseits der Alpen und unter Berücksichtigung der Glasmalerei, des Formschnit-tes und des Kupferstiches, Aarau 1893, 24 f. Aktuell dazu: Ausstellungskatalog Anne Röver-Kann, Mit der schnellen Nadel gezeichnet. Experiment Radierung im Jahrhundert Dürers, Bremen (Kunsthalle) 2008, Bd. 1, 12.
47 Moriz Thausing, Dürer, Leipzig 1876, 335 f.; 2. Aufl. Leipzig 1884, Bd. 2, 69; Hans Jelinek, Dürer’s etching The Desperate Man: Discovery of a Date and Some Thoughts about an Old Controversy, in: Print review 4, 1975, 4. Zu Dürers Radierungen vgl. Rainer Schoch u. a. (Hg.), Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Bd. I: Kupferstiche, Eisenradierungen und Kaltnadel-blätter, München u. a. 2001, 197 f., Nr. 78; 198 – 200, Nr. 79; 200 – 202, Nr. 80; 205 f., Nr. 82; 206 – 208, Nr. 83; 210 – 212, Nr. 85.
liche Holzschnitte erinnernden Gestaltung mit den Szenerien auf dem Sonnenberg-Harnisch stilistisch auf einer Stufe stehen44. Von besonderer Bedeutung sind Hopfers Zehn ornamentale Horizontalfriese I bzw. II (M 133, M 134); diese sind motivisch den schmalen Randverzierungen des Sonnenberg-Harnischs eng verwandt und können mit diesem Werk auch stilistisch verbunden werden. So sind etwa die eigenwilligen Knopf-augen der beiden Drachen am Harnisch des Grafen Sonnenberg (Abb. 3) auch bei den Figuren in diesen Vorlagenblättern zu erkennen. In beiden Arbeiten, den gedruckten Ornamentfriesen und den feuervergoldeten Sze-nerien des Sonnenberg-Harnischs, verwendete der Künstler dieselben Rei-hen kurzer gebogener Linien, um die Plastizität und die Schattierungen der Figuren zu vermitteln. Hopfers Zehn ornamentale Horizontalfriese I bzw. II (M 133, M 134) wurden bisher auf etwa 1515 oder später datiert; wie in anderem Kontext45 zu sehen sein wird, können diese Drucke aber nicht nach ca. 1510 entstanden sein und datieren daher in etwa dieselbe Zeit wie der Sonnenberg-Harnisch. Der Sonnenberg-Harnisch und die Madrider Tartsche beleuchten die früheste gesicherte und die späteste Stufe in Daniel Hopfers Werk als Waffendekorateur. In einem Zeitraum von etwa drei Jahrzehnten hat sich Hopfer von einer an spätgotische Vorgänger erinnernden frühen Renais-sance in Richtung einer reifen Hochrenaissance entwickelt. Trotz dieser tiefgreifenden stilistischen Veränderung hat er sein ikonographisches Re-pertoire innerhalb dieser Zeitspanne nur bedingt verändert. Hopfer vari-ierte und ergänzte fortwährend die Zutaten seiner ornamentalen Kompo-sitionen, ohne diese aber vollständig abzuwandeln; er erreichte dadurch eine unendliche Vielfalt der Szenerien und sicherte seinen Arbeiten gleich-zeitig eine gewisse Wiedererkennbarkeit. Dies hat wohl auch zu einem nicht geringen Teil zu dem anhaltenden Erfolg beigetragen, den Hopfer als Waffenätzer im frühen 16. Jahrhundert weit über die Grenzen Augsburgs hinaus genoss.
Abb. 3: Kolman Helmschmid und Daniel Hopfer, Küriss für Feld und Turnier des Andreas Graf Sonnenberg, Detail des Helmes. Um 1505/10. Wien, Kunsthistorisches Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, Inv.-Nr. A 310.
59
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
48 E. [Ernst] Harzen, Ueber die Erfindung der Aetzkunst, in: Archiv für die Zeichnenden Künste 5, 1859, 125 – 127. Vgl. auch David Landau – Peter Parshall, The Renaissance print 1470 – 1550, New Haven – London 1994, 27 f. und 323 – 331.
49 Brust und Rücken eines Knabenküriss für Philipp I., „den Schönen“ (1478 – 1506), Meister „h“ (Nieder-lande oder Köln), 1488/90, Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 109a; Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), 127 f.; Ausstellungskatalog Dagmar Täube – Miriam Verena Fleck (Hgg.), Glanz und Größe des Mittelalters. Kölner Meisterwerke aus den großen Samm-lungen der Welt, Köln (Museum Schütgen – Kunst des Mittelalters) 2011 – 2012, 300 f., Kat.-Nr. 53 (Mat- thias Pfaffenbichler, Miriam Verena Fleck). Stech-zeug-Fragment des Gasparo Fracasso, Giovanni An-gelo Missaglia, Mailand, um 1490, Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. B 2; Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), 184 f.
50 Wien, KHM, HJRK, Stechzeug S XI (bestehend aus Inv.-Nrn. B 9, B 165) und Stechzeug S XV (beste-hend aus Inv.-Nrn. B 9, B 169, B 176); Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), 144 f.
51 Lorenz Helmschmid ätzte 1477 die gebläute Oberflä-che des Rossharnischs für Kaiser Friedrich III. (Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 69); Claude Blair, European Armour. Circa 1066 to circa 1700, London 1958, 174; Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), 104 f.
52 Mark Clarke, Writing recipes for non-specialists c. 1300: the Anglo-Latin Secretum philosophorum, Glasgow MS Hunterian 110, in: Erma Hermens – Joyce H. Town-send (Hgg.), Sources and Serendipity. Testimonies of Artists’ Practice. Proceedings of the third symposium of the Art Technological Source Research Working Group, London 2009, 50 – 64.
53 Vgl. Clarke 2009 (zit. Anm. 52), 62. 54 Claude Blair, Medieval swords and spurs in Toledo Ca-
thedral, in: The Journal of the Arms & Armor Soci-ety III, 1959 – 1961, 41 – 52; Ewart Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, London 1960 (Neuaufla-ge: Woodbridge 1997), Taf. 7 und 9.
55 Schwert, Westeuropa, ca. 1400, New York, The Met-ropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 32.75.225; vgl. Helmut Nickel, A knightly sword with Presentation In-scriptions, in: Metropolitan Museum Journal 2, 1969, 209 f.; Zeremonienschwert der ungarischen Gesell-schaft vom Drachen, Oberitalien, um 1433, Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 49, vgl. Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), 74 f. Vgl. auch den sog. Alfanje de San Pablo mit Inschrift und Rankenornament in Ätztechnik (?), angeblich aus der Mitte des 14. Jahr-hunderts; der Säbel ehemals in Toledo, seit dem Spa-nischen Bürgerkrieg (1936 – 1939) verschollen. Das Museo del Ejército in Toledo verwahrt eine moderne Kopie dieses Säbels; Germán Dueñas Beraiz (Toledo) bereitet eine Publikation zu diesem Säbel vor.
56 Vgl. Lionello G. Boccia – Eduardo T. Coelho, Armi Bianche Italiane, Mailand 1975, Nrn. 108 – 113, 209 – 214 etc.
57 Die frühesten bekannten gedruckten Ätzrezepte in deutscher Sprache: Georgius Agricola, Rechter Ge-brauch d’Alchimei, Frankfurt am Main (Christian Egenolff d. Ä.) 1531 (VD 16: R 492; Reprint: Wien 1972); Artliche kuenste mancherlei weise Dinnten vnd aller hand farben z8bereiten […], Mainz (Peter Jor-dan) 1531 (VD 16: ZV 802) bzw. die Ausgaben Er-furt (Melchior Sachse d. Ä.) 1531 (VD 16: A 3857) etc. Die seltene Ausgabe Nürnberg (Simon Dunckel) 1531 (nicht in VD 16) in New York, The Metro-politan Museum of Art, Inv.-Nr. 17.5; vgl. William M. Ivins Jr., An Early Book about etching, in: The Me-tropolitan Museum of Art Bulletin 12, Nr. 8, Aug. 1917, 174 – 176.
Daniel Hopfer und die Erfindung der Ätzkunst
Das druckgraphische Verfahren der Radierung wurde, soweit wir wissen, zuerst im süddeutschen Raum in den 1490er Jahren angewendet. Drei Künstler – Urs Graf d. Ä. (um 1485 – 1528), Albrecht Dürer (1471 – 1528) und Daniel Hopfer – standen seit Anbeginn der Diskussion über die Er-findung der Radierung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Grafs Dirne, ihre Füße waschend (Holl. 9) trägt die umstrittene Jahreszahl 1513 und wäre, entspräche diese Datierung dem Entstehungsjahr des Werkes, die früheste bekannte datierte Radierung46. Von Albrecht Dürer kennen wir insgesamt sechs Radierungen, die jedoch auf den kurzen Zeitraum von 1515 bis 1518 beschränkt sind47. Daniel Hopfer hat sein gesamtes Leben hindurch mit der Ätztechnik gearbeitet und einige seiner Radierungen in spätgotischem Stil stammen eindeutig aus einer Zeit, die weit vor den er-wähnten Blättern von Graf und Dürer liegt. Mit gutem Recht wird Hopfer daher als der Pionier der Radierung angesehen48; die erst vor kurzem ent-deckte signierte Schlacht von Thérouanne (M 72) aus der Mitte der 1490er Jahre verstärkt diese Annahme. Die Kunst der Harnischätzung ist, wie die der Radierung, eine Neuerung des späten 15. Jahrhunderts. Die ältesten Beispiele geätzter Harnische sind knapp vor Hopfers erster Radierung, etwa um 1490, nördlich und südlich der Alpen nachweisbar49. In Augsburg lassen sich die ersten bekannten Harnischätzungen etwa in jene Zeit datieren, als Hopfer begann, Radie-rungen zu drucken50; in einfacherer Form hatte Lorenz Helmschmid je-doch bereits in den späten 1470er Jahren mit der Ätztechnik experimen-tiert51. Wann und wo die ersten Plattnerarbeiten mittels Ätztechnik deko-riert wurden, ist nicht exakt feststellbar, das Ätzen von Metalloberflächen ist aber eine weit ältere Kunstform; sie ist zumindest seit dem späten 13. bzw. frühen 14. Jahrhundert in Form dekorierter Schwertklingen greif- bar. Ein englisches Handbuch künstlerischer Techniken aus jener Zeit, das erst kürzlich publizierte Secretum philosophorum52, gibt detailgenaue Anlei-tungen für das Schreiben auf Stahl („scribere in caliber“53) mittel säurehal-tiger Substanzen, Stahlmesser („cultello ex calibe“). Die älteste bekannte dekorierte Schwertklinge stammt aus etwa derselben Zeit wie das Secretum philosophorum; es ist das Schwert König Sanchos IV. von Kastilien, León und Galizien (1258 – 1295) in der Kathedrale von Toledo54. Während des 14. und 15. Jahrhunderts wurden Schwerter in vielen Teilen Europas mit geätzten Inschriften und Ornamenten verziert55; ein besonders reicher Be-stand geätzter Schwerter ist in Oberitalien ab der Mitte des 15. Jahrhun-derts nachweisbar56. Erst nach dieser langen und fruchtbaren Tradition der Klingenätzung begannen im späten 15. Jahrhundert Plattner, in weiterer Folge auch Druckgraphiker, die Technik der Ätzmalerei zu entdecken57.Zu Daniel Hopfers Lehrjahren sind keine Informationen überliefert, d. h. wir wissen nicht, wo und von wem er die Technik des Stahlätzens bzw. die Herstellung von Drucken erlernt hat. Diese den Pionier der Radierung betreffende Wissenslücke wiegt besonders schwer, da sie uns hindert, die Anfänge der Radiertechnik und ihre Verbindung zur Waffenätzung präzise zu klären. Angesichts der technischen Experimentierfreudigkeit der Augs-burger Plattner kann es jedoch kein Zufall sein, dass Daniel Hopfer, der produktivste frühe Radierkünstler und talentierteste deutsche Waffenätzer, gerade in Augsburg arbeitete. Die Plattner dieser pulsierenden süddeut-schen Handelsmetropolen, allen voran Lorenz Helmschmid und seine Fa-milie, waren maßgebliche Förderer und Nutznießer der Harnischätzung
60
stefan krause
58 Der Waffenätzer Jörg Sorg d. J. (um 1522 – 1603) war Kolman Helmschmids Enkel; vgl. Charlotte Becher u. a., Das Stuttgarter Harnisch-Musterbuch 1548 – 1563, Sonderdruck aus dem Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 76, 1980, 26 – 45 (Charlotte Becher), bes. 28 und 35. Das Hochzeitsporträt von Kolman Helmschmid und Agnes Breu von Jörg Breu d. Ä. und einem weiteren, anonymen Maler, ca. 1500/05, in Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, Inv.-Nr. 244 (1930.63); vgl. Isolde Lübbeke, The Thyssen-Bornemisza Collection. Early German painting. 1350 – 1550, aus dem Deut-schen übersetzt von Margaret Thomas Will, London 1991, 156 – 161.
59 Alan R. Williams, The metallographic examination of a Burgkmair etching plate in the British Museum, in: Journal of the Historical Metallurgy Society 8, 1974, 92 – 94. Burgkmairs Druckplatte: London, The Bri-tish Museum, Inv.-Nr. 1862,1011.184.
60 Michel Maistetter scheint im Einschreibebuch der Ma-ler, Bildhauer, Goldschläger und Glaser 1480 – 1542 auf; Augsburg, Stadtarchiv, Schätze 72c: „Item meis-ter Danyel Hopffer hat vir gestalt ein knaben Mi-chel Meigstetter v[nd] ein handtwerck hat ein sols genuege[n] v[nd] ist gelt v[nd] wax do gewesen im 93 ior.“; zit. nach Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 547, Q 3.
61 Kaiser Maximilian I. nahm 1510 den Augsburger Plattner „Hanns Maystetter“ in seine Dienste; ein Jahr darauf arbeitete „Hans Maistetter“ in der Innsbrucker Hofplattnerei des Kaisers, wo er bis 1533 nachweisbar ist; vgl. Schönherr 1884 (zit. Anm 38), Reg. 1010, 1028 etc.; Heinrich Zimerman unter Mitwirkung von Joseph Ritter von Fiedler und Johann Paukert (Hgg.), Urkunden und Regesten aus dem k. u. k. Haus-, Hof- und Staat -Archiv in Wien, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 1, 1883, Reg. 279, 435, 446.
62 Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 7; Thomas 1937 (zit. Anm. 37), 146 und 144, Abb. 153, 154 (mit der alten Zuschreibung an Kaiser Maximilian I. und Konrad Seusenhofer) [= Thomas 1977 (zit. Anm. 37), Bd. 1, 626 und 624]; Ortwin Gamber, Der Turnierharnisch zur Zeit König Maximilians I. und das Thunsche Skiz-zenbuch, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Samm-lungen in Wien 53, 1957, 61; Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), 113 f.
63 Die Dekoration ist trotz Verlust der Feuervergoldung an vielen Stellen als eine Art Negativ im gebläuten Grund erkennbar; 2007 wurde die Vergoldung teil-weise rekonstruiert.
und auf vielfältige Art mit den Waffenätzern und Druckgraphikern dieser Stadt verbunden; so bestanden beispielsweise zwischen den Plattnern und den Waffenätzern Augsburgs oft enge verwandtschaftliche Beziehungen58. In zumindest einem Fall lässt sich auch nachweisen, dass die Druckplatte eines Augsburger Künstlers – jene für Hans Burgkmairs Venus, Armor und schlafender Merkur von ca. 1520 (Holl. 834) – wohl von einem Plattner gefertigt wurde59. Möglicherweise war auch Daniel Hopfers erster Lehr-knabe namens Michel Maistetter60 mit dem Augsburger Plattner Hans Maystetter verwandt, der im frühen 16. Jahrhundert in der Innsbrucker Hofplattnerei nachweisbar ist61. Ein Werk aus der Frühzeit der Augsburger Harnischätzung, der Feldhar-nisch König Philipps I., „des Schönen“, von Kastilien (1478 – 1506)62, könnte für die Bearbeitung von Daniel Hopfers frühem Œuvre als Waf-fendekorateur von besonderer Bedeutung sein. Dieser heute in Wien ver-wahrte Harnisch wurde um 1495/1500 von Lorenz Helmschmid gefertigt und ist mit den Symbolen des Ordens vom Goldenen Vlies geschmückt. Die Collane des Ordens sowie die Randbordüren des Harnischs mit spät-gotischem Laubwerk wurden in der bereits erwähnten Technik der Feuer-vergoldung auf gebläutem Grund ausgeführt; das an der Collane hängen-de Vlies sowie die beiden Andreaskreuze auf Brust und Rücken sind geätzt und feuervergoldet. Die feuervergoldete Verzierung dieses Harnischs ist großteils verloren63, doch verraten die wenigen erhaltenen originalen Teile dieser Dekoration (Abb. 4) die Hand eines überaus talentierten Künstlers. Diese Fragmente, in erster Linie Blattranken mit Vögeln, sind in ihrer kraftvollen Gestaltung dem etwas späteren Sonnenberg-Harnisch verwandt und erinnern an manche der frühen spätgotischen Drucke Hopfers, etwa Drei ornamentale Horizontalfriese (M 105) bzw. Distelranke mit drei Vögeln (M 104). In anderen Teilen der Dekoration finden wir Laubwerk, das mit jenem in dem Hopfer zugeschriebenen Weißlinienholzschnitt Ein Mönch (Pelbartus de Temesvár ?) beim Studium im Garten, mit Evangelistensymbolen (M 167a) von 1502 vergleichbar ist. Der fragmentierte Erhaltungszustand der feuervergoldeten Verzierungen des Feldharnischs Philipps I. lässt kein letztgültiges Urteil über die Zuschreibung an einen bestimmten Künstler zu, doch kann sie dennoch mit Vorbehalt als Werk Daniel Hopfers ange-
Abb. 4: Lorenz Helmschmid und Daniel Hopfer (?), Feldharnisch Philipps I., „des Schönen“, Detail der rechten Schulter. Augsburg, um 1495/1500. Wien, Kunsthistorisches Museum, Hofjagd- und Rüstkam-mer, Inv.-Nr. A 7.
61
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
sehen werden. Falls die Zuschreibung sich als korrekt erweist, würden die-se Ornamente eine bislang nicht erkannte spätgotische Frühphase in Hop-fers Werk als Waffendekorateur, fünf bis zehn Jahre vor dem Sonnenberg-Harnisch von 1505/10, dokumentieren.
Die Berner Harnischgarnitur und der Ottheinrich-Harnisch in Wien
Nach den ersten, eher zaghaften Versuchen der Jahre um 1500, mittels der Ätztechnik Plattnerarbeiten zu dekorieren, wurde die Waffenätzung im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts zu einem integralen Bestandteil der Plattnerkunst. Daniel Hopfer spielte in diesem ersten Höhenflug der
Abb. 5: Lorenz Helmschmid und Daniel Hopfer (?), Riefelküriss Ottheinrichs von der Pfalz, Detail des Rückens. Augsburg, 1516. Wien, Kunsthistorisches Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, Inv.-Nr. A 239.
62
stefan krause
64 Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 239; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 530, Kat.-Nr. WZ 26 (mit Lit.); in Ergänzung vgl. Mann 1940 (zit. Anm. 6), 8, Nr. (VI); Bruno Thomas, Der Wiener Ottheinrich-Harnisch von Koloman Colman (recte Helmschmid) – Stilkritik und Waffenkunde, in: Zeitschrift für Historische Kostüm- und Waffenkunde, N. f. 6, 1938, 116 – 123 [= Thomas 1977 (zit. Anm. 37), Bd. 2, 1148 – 1155]. Der Har-nisch zeigt die geätzten Initialen „HA“ (?) und „H“, die als mögliche Signatur Daniel Hopfers („Hopfer Ausgburg“?) diskutiert wurden. Der Wiener Harnisch ist in einer um 1530/40 von Peter Gertner gefertigten Zeichnung wiedergegeben; vgl. Guido Messling unter Mitarbeit von Georg Josef Dietz, Handzeichnungen. Die deutschen und schweizerischen Meister der Spätgo-tik und der Renaissance (Anhaltische Gemäldegalerie Dessau. Kritischer Bestandskatalog, hg. von Norbert Michels, Bd. 4), Petersberg 2011, 118 f. Ich danke Guido Messling für den Hinweis auf diese Zeichnung.
Harnischdekoration eine zentrale Rolle, wie sich anhand zweier herausra-gender ihm zuzuschreibender Werke belegen lässt: des Riefelküriss’ des jungen Ottheinrich von der Pfalz (1502 – 1559) von 1516 in Wien64 und der einige Jahre früher entstandenen Harnischgarnitur für Mann und Ross in Bern65. Die Berner Garnitur trägt die seltene Plattnermarke des Lorenz Helmschmid, der Wiener Küriss kann aus stilistischen Gründen demsel-ben Meister zugeschrieben werden. Beide Werke sind überreich mit ge-schwärzter Ätzmalerei dekoriert, die eng an den Stil der feuervergoldeten Verzierung des Sonnenberg-Harnischs anknüpft, für deren Hopfer’sche Ur-heberschaft wiederum vieles spricht.Die Dekoration des Ottheinrich-Harnischs von 1516 (Abb. 5) erinnert un-vermittelt an Hopfers Motivrepertoire, doch sind im Vergleich mit dem früheren Sonnenberg-Harnisch stilistische Veränderungen festzustellen. Bei letzterem wurden die feuervergoldeten Figuren und Ornamente auf einen unstrukturierten gebläuten Hintergrund gesetzt; auf dem Ottheinrich-Harnisch sind die Szenerien in ein dichtes Netz kurzer Wellenlinien gebet-tet, die der Dekoration einen nervösen und gedrängten Charakter verlei-
Abb. 6: Lorenz Helmschmid und Daniel Hopfer, Harnischgarnitur für Mann und Ross, zwei Details des Halspanzers des Pferdeharnischs. Augsburg, frühe 1510er Jahre. Bern, Bernisches Historisches Museum, Inv.-Nr. 101.
63
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
65 Bern, Bernisches Historisches Museum, Inv.-Nr. 101; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 527, Kat.-Nr. WZ 5 (mit Lit.); ergänzend vgl. H. Kasser, Der Harnisch von Mann und Ross des Lorenz Colman im histori-schen Museum zu Bern, in: Zeitschrift für historische Waffenkunde 1, 1897 – 1899, 84 – 87; Rudolf Wegeli unter Mitwirkung von W[alter] Blum und Rudolf Münger, Inventar der Waffensammlung des Bernischen Historischen Museums in Bern, Bd. I: Schutzwaffen, Bern 1920, 55 – 60, Nr. 81 und Taf. X, XII sowie Abb. 32 – 36.
66 Ein Werk, das dem Stil der Ätzungen des Ottheinrich-Harnischs sehr nahe steht, ist das Fragment eines Pfer-deharnischs (Teil des hinteren rechten Beins), Brüssel, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsge-schiedenis, Inv.-Nr. 10212; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm 3), 527, Kat.-Nr. WZ 6 (mit Lit.); ergänzend vgl. auch Edgar de Prelle de la Nieppe, Un cuissard de cheval, in: Bulletin des Musées Royaux des Arts Décoratifs et Industriels a Bruxelles 4, Nr. 12, 1905, 93 – 95. Vgl. auch die Turnierdilge von Lorenz Helm-schmid, ehem. Paris, Musée de l’Armée, Inv.-Nr. G 536; o. A., Musée d’Artillerie, Paris 1892 – 1896, Bd. II (1895), Taf. 63, Nr. G 536; o. A. [Claude Blair], Spoils of War in the State Historical Museum, Moscow, in: The Conoisseur, Mai 1967, 2, „Musée de l’Armée, Paris“, Nr. 11; 3, Abb. 9.
67 Rudolf Wegeli (Hg.), Das Berner Zeughausinventar von 1687, in: Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums 1930 – 1938, Bern 1939, 35; vgl. auch We-geli 1920 (zit. Anm. 65), 59 f.
68 Wegeli 1920 (zit. Anm. 65), 60; vgl. auch Gottlieb Kipseler, Les Délices de la Suisse. Une des principales Républiques de l’Europe, Leiden 1714, 115; Johann-Rudolph Gruner, Deliciae Urbis Bernae, Merckwürdig-keiten der hochlöbl. Stadt Bern, Zürich 1732, 337.
69 Rossharnisch: Berlin, Deutsches Historisches Muse-um, Inv.-Nr. W 81/5. Mannsharnisch: ehemals mit dem Rossharnisch im Berliner Zeughaus, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschollen. Im Jahr 1966 wurde der Mannsharnisch im Depot des Staatli-chen Historischen Museums in Moskau gesehen; vgl. [Blair] 1967 (zit. Anm. 66), 1 f.; Gerhard Quaas – An-dré König, Verluste aus den Sammlungen des Berliner Zeughauses während und nach dem Zweiten Weltkrieg, Berlin 2011, 126 f., Nr. 444. Zur Liegnitzer Garnitur vgl. Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 526, Kat.-Nr. WZ 1 (mit Lit.).
70 Post 1928 (zit. Anm. 19).
hen66. Diese Besonderheit ist vergleichbar mit Hopfers etwa zeitgleichem Brustbild Karls V. im Profil nach links in Groteskenrahmen (M 94; um oder kurz nach 1516); auch hier, in den Rahmenfeldern dieser Graphik, sind die Figuren und das Blattwerk von kurzen ondulierenden Linien umge-ben. Die Zeichnung der mythologischen Wesen und die starken Schwarz-Weiß-Kontraste der Dekoration des Ottheinrich-Harnischs erinnern dar-über hinaus an eine Gruppe grotesker Titelblattrahmen, die Hopfer in etwa derselben Zeit (1514 – 1518) für die Augsburger Buchdrucker Johann Miller und Silvan Otmar schuf (v. a. M 156, M 159).Die Harnischgarnitur im Historischen Museum in Bern ist seit dem späten 17. Jahrhundert im Städtischen Zeughaus Bern nachweisbar, wo sie zu-nächst als Besitz eines Mitglieds der in Bern ansässigen Familie Luternau67 geführt wurde; später galt sie als Erinnerungsstück an Hans Franz Nägeli (1496 – 1579), den berühmten Eroberer des Waadtlandes68. Der ursprüng-liche Besitzer dieses Harnischs ist zwar unbekannt, die Garnitur selbst ist aber ein herausragendes Meisterwerk der deutschen Plattnerkunst des frühen 16. Jahrhunderts, deren geätzte Dekoration (Abb. 6) eine stilistische Stufe zwischen dem Sonnenberg- und dem Ottheinrich-Harnisch darstellt. Die zumeist in schmale längliche Panele eingefügten Kompositionen der Berner Garnitur ähneln jenen in Hopfers frühem Vorlagenblatt Zehn orna-mentale Horizontalfriese I bzw. II (M 133, M 134); die Blattgesichter mit Knopfaugen sowie die Reihen kurzer gebogener Linien, die Hopfer in sei-nen Horizontalfriesen zur Darstellung von Plastizität und Schattierungen einsetzt, finden sich nicht nur auf dem Sonnenberg-Harnisch von 1505/10, sondern in gleicher Form auch auf der Berner Garnitur. Der stellenweise expressive Charakter der Ätzmalerei dieser Garnitur erinnert an den Son-nenberg-Harnisch, doch sind hier die Formen, vor allem im Laubwerk, ge-rundeter gehalten, wodurch der Grundton der Szenerien beruhigter wirkt. Das üppige Laubwerk erzeugt in vielen Fällen den Eindruck von Überfülle, die wiederum an den späteren Ottheinrich-Harnisch erinnert.Nach dem Ottheinrich-Harnisch von 1516 lässt sich in Daniel Hopfers Waffenätzungen eine erneute Reduktion des durch Blattwerk bzw. Wellen-linien erzeugten Horror vacui beobachten. In den späten 1510er Jahren ersetzte Hopfer das Unruhe erzeugende Ornament der kurzen ondulieren-den Linien durch einen fein punktierten Grund, der es ihm erlaubte, Vor-der- und Hintergrund seiner Szenerien wirkungsvoller zu konstrastieren und dadurch den Hauptmotiven mehr Raum zu geben. Der daraus resul-tierende elegante, Leichtigkeit erzeugende Stil sollte in weiterer Folge Hopfers waffenätzerische Arbeit der 1520er und 1530er Jahre definieren. Bevor wir uns einigen dieser Werke widmen, muss jedoch ein Zuschrei-bungsproblem angesprochen werden, das für das Verständnis der Waf-fenätzungen Daniel Hopfers von großer Bedeutung ist – im Zentrum die-ser Frage steht die Harnischgarnitur Herzog Friedrichs II. von Liegnitz.
Innsbruck und Augsburg – Der Liegnitzer Harnisch
Im Jahr 1928 schrieb, wie bereits erwähnt, Paul Post die geätzte Dekora- tion der Harnischgarnitur für Mann und Ross von Herzog Friedrich II. von Liegnitz (1480 – 1547)69 Daniel Hopfer zu70. Zusätzlich identifizierte er diese Plattnerarbeit als ein etwa 1512 bis 1515 entstandenes Werk des Innsbrucker Hofplattners Konrad Seusenhofer (gest. 1517). Posts These zufolge ist die Liegnitzer Garnitur das Ergebnis einer überregionalen Ko-
64
stefan krause
71 Post erwähnt drei Details im Ätzdekor des Liegnitzer Harnischs – einen Putto nach M 159, einen Vogel nach M 104 sowie zwei Vögel nach M 107; vgl. Post 1928 (zit. Anm. 19), 178 – 180, Abb. 11 – 13.
72 James Mann bezweifelte Posts These; Mann 1940 (zit. Anm. 6), 7 f. Thomas vermutete, der Dekor des Liegnitzer Harnischs stamme von James Manns Hopfer Group-Meister, den er nicht mit Hopfer selbst gleich-setzte; Bruno Thomas, Konrad Seusenhofer. Studien zu seinen Spätwerken zwischen 1511 und 1517, in: Konst-historisk Tidskrift 18, 1949, 64 [= Thomas 1977 (zit. Anm. 37), Bd. 1, 570].
73 Turnierdilge, Paris, Musée de l’Armée, Inv.-Nr. G 535; Musée d’Artillerie 1892 – 1896 (zit. Anm. 66), Bd. II (1895), Taf. 63, Nr. G 535; [Blair] 1967 (zit. Anm. 66), 2, „Musée de l’Armée, Paris“, Nr. 12; 3, Abb. 10. Vgl. auch den Visierhelm (Armet), Leeds, Royal Armouries, Inv.-Nr. IV.412; vgl. Ausstellungs-katalog Graeme Rimer u. a. (Hgg.), Henry VIII. Arms and the Man 1509 – 2009, London (Tower of London) 2009 – 2010, 168 f., Kat.-Nr. 20 (Thom Richardson).
74 Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 109; Thomas – Gam-ber 1976 (zit. Anm. 39), 216 f.; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 530, Kat.-Nr. WZ 24.
operation von Plattner und Waffenätzer; Seusenhofer hätte in Innsbruck den Harnisch geschlagen, Hopfer in Augsburg den geätzten Bildschmuck hinzugefügt. Diese Annahme würde bedeuten, dass Daniel Hopfer als Waffenätzer nicht, wie es sonst den Anschein hat, ausschließlich mit Augs-burger Plattnern, insbesondere mit der Helmschmid-Werkstatt, zusam-menarbeitete, sondern auch Dekorationsaufträge von außerhalb entgegen-nahm. Folglich hieße dies auch, dass Plattnerarbeiten und deren Dekor generell nicht notgedrungen immer am selben Ort geschaffen wurden; die Zuschreibung eines Harnischs an einen bestimmten Plattner würde daher nicht zwangsläufig auch den Entstehungsort der Verzierung festlegen.Die Liegnitzer Harnischgarnitur ist ein ungewöhnliches, reich dekoriertes Meisterwerk der deutschen Renaissance. Der Mannsharnisch kontrastiert in einem vielfigurigen geätzten Programm männliche Tugend- und Laster-vorstellungen des Spätmittelalters (Landsknechte, Aristoteles und Phyllis etc.); der Rossharnisch ist in Form eines hölzernen Zaunes plastisch getrie-ben sowie geätzt und spielt damit auf phantasievolle Art auf jene Holzbar-riere an, die bei einem Lanzenturnier die beiden Kontrahenten trennt. Weiters zeigt die Garnitur spätgotisches Blattwerk und zu jener Zeit nörd-lich der Alpen neuartige mythologische Szenerien. Der Dekor der Liegnit-zer Garnitur ist, wie Post richtig bemerkte, in Teilen von Hopfers graphi-schem Œuvre beeinflusst71 (Abb. 7), doch ist dies im frühen 16. Jahrhun-dert keineswegs ungewöhnlich und entspricht für süddeutsche Plattnerar-beiten des frühen 16. Jahrhunderts sogar eher der Regel. Abgesehen von diesen vereinzelten motivischen Analogien hat der Bildschmuck stilistisch und ikonographisch jedoch nur wenig mit Hopfers eigenen zeitgleichen Arbeiten als Waffendekorateur zu tun; zum Vergleich sei hier auf die Berner Harnischgarnitur und den Ottheinrich-Harnisch verwiesen. Die geätzte De-koration der Liegnitzer Garnitur muss mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem autographen Werk Daniel Hopfers ausgeschieden werden72. Zu disku-tieren wäre darüber hinaus auch, ob die Liegnitzer Garnitur in ihrer seit dem 19. Jahrhundert belegten Form überhaupt der originalen Zusammen-stellung der Renaissance entspricht. Dem Ätzmaler, der den Faltenrock des Mannsharnisch der Liegnitzer Garnitur dekoriert hat, kann zumindest ein weiteres Werk zugeschrieben werden: eine Turnierdilge (Oberschenkel-Schutz), die ehemals im Musée de l’Armée in Paris verwahrt wurde73.Posts These zum Liegnitzer Harnisch basiert nur in zweiter Linie auf den vereinzelt nachweisbaren motivischen Verbindungen zu Hopfers Graphi-ken, sein Hauptargument war vielmehr eine archivalische Quelle, die er jedoch – wie es scheint – überinterpretierte. Es handelt sich dabei um die Auftragskorrespondenz der Innsbrucker Hofkanzlei mit Konrad Seusenho-fer (gest. 1517), dem Leiter der Innsbrucker Hofplattnerei, bezüglich eines Harnischs für den jungen Erzherzog Karl, den späteren Kaiser Karl V. (1500 – 1558); dieser wurde 1512 bis 1514 gefertigt und wird heute in der Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien ver-wahrt74. Der herausragenden Position des Empfängers entsprechend, wurde jener Harnisch nicht nur mit Ätzmalerei verziert, sondern zusätzlich mit Streifen aus vergoldetem Silber, die in Durchbrucharbeit die Embleme des Ordens vom Goldenen Vlies zeigen. In den erwähnten Urkunden zu die-sem Werk heißt es, dass die geplanten Goldschmiedearbeiten von einem „goldsmit zu Augspurgg“75 ausgeführt werden sollten, d. h. Teile der Deko-ration einer Innsbrucker Plattnerarbeit wurden tatsächlich in Augsburg ge-fertigt. Post schloss aus dieser kurzen archivalischen Notiz, dass die gesamte Dekoration von Karls Harnisch – Goldschmiedearbeit und Ätzmalerei – in
Abb. 7: Konrad Seusenhofer (zugeschrieben), Feldharnisch Herzog Friedrichs II. von Liegnitz, Detail. 1510er Jahre. Ehemals Berlin, Zeughaus, verschollen seit 1945.
65
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
75 Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, Oberösterreichi-sche Kammerkopialbücher, Bd. 56, Missiven 1512, fol. 66v – 67v; vgl. auch Schönherr 1884 (zit. Anm. 38), Reg. 1075.
76 Vgl. in diesem Band Stefan Krause, Der Rundschild aus dem Besitz des späteren Kaisers Maximilian I.
77 S. Kapitel „Waffenätzungen nach Ornamentvorlagen Daniel Hopfers“.
78 Schönherr 1884 (zit. Anm. 38), Reg. 1028, 1075, 1076 etc. Zur Diskussion dieser Dokumente und ihrer fälschlichen Verbindung mit dem versilberten Harnisch König Heinrichs VIII. von England, Leeds, Royal Armouries, Inv.-Nr. II.5 (Greenwich, um 1515) vgl. Claude Blair, The Silvered Armour of Henry VIII in the Tower of London, in: Archaeologia XVIX, 1965, 1 – 56, bes. 8 – 20.
79 Jenes Dokument, in dem der „goldsmit zu Augs-purgg“ erwähnt wird (vgl. Anm. 75), enthält einen Hinweis auf den in Innsbruck ansässigen Gold-schmied Hermann: „Goldschmied Hermann zu Inns-bruck, welcher den Harnisch für Herzog Friedrich von Sachsen mit gleich viel Gold und Silber belegt und vergult hat“. Goldschmied Hermann kann mit Hermann Daum identifiziert werden, der in Inns-bruck von 1507 bis 1522 nachweisbar ist; Schönherr 1884 (zit. Anm. 38), Reg. 861, 864 etc.
80 Ein vom Innsbrucker Plattner Stefan Rormoser ge-markter Harnisch für Herzog Albrecht V. von Bay-ern (1528 – 1579), München, Bayerisches National-museum, Inv.-Nr. W 367 (Fragment Kragen und Brust), zeigt die Signatur des in Augsburg nachweis-baren Ätzers Hans Holzmann. Ungeklärt bleibt, ob Holzmann diese Dekoration in Innsbruck oder in Augsburg ausgeführt hat; vgl. Hans Stöcklein, Eine bisher unbekannte Augsburger Ätzerfamilie, in: Zeit-schrift für historische Waffen- und Kostümkunde IV, 1906 – 1908, 383 f.; Ausstellungskatalog Bruno Tho-mas – Ortwin Gamber, Die Innsbrucker Plattnerkunst, Innsbruck 1954, 85, Kat.-Nr. 128.
81 Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 239a, datiert an Vorder- und Rückseite; dazu die Rossstirn A 239b (Abb. 1) (Stirnschildchen nicht zugehörig) sowie die Streitaxt A 298 (Hopfer?); vgl. Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 530, Kat.-Nr. WZ 27 (mit Lit.). Vgl. auch den Sattel (datiert „XXIII“) in Warwick Castle/England, Inv.-Nr. 723 (H012); Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 530, Kat.-Nr. WZ 23 (mit Lit.). Ich danke Pamela Bromley und Adam Busiakiewicz (Warwick Castle) sowie Jonathan Tavares (New York) für ergänzende Informationen zu diesem Werk. Vgl. auch den Sattel (Hopfer?) ehemals auf der Wartburg/Thüringen; vgl. Alfons Diener-Schönberg, Die Waffen der Wartburg. Beschreibendes Verzeichnis der Waffen-Sammlung S.K.H. des Grossherzogs Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach, Berlin 1912, 66, Nr. 118 und Taf. 47.
82 Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 374; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 531, Kat.-Nr. WZ 29 (mit Lit.); ergänzend vgl. Bruno Thomas, Der Wiener Prunkhar-nisch des Wilhelm von Roggendorf, in: Das Antiquari-at 8, 1952, 84 – 86 [= Thomas 1977 (zit. Anm. 37), Bd. 2, 1163 – 1170]; Gamber 1975 (zit. Anm. 37), 32; Schrenck von Notzing 1981 (zit. Anm. 36), Taf. 81; Jahresbericht des Kunsthistorischen Museums Wien 2005, Wien 2006, 96 f. (Christa Angermann). Eine zugehö-rige linke Oberarmröhre mit Ellbogenkachel: London, The Wallace Collection, Inv.-Nr. A 245; Metzger 2009 –
Augsburg ausgeführt worden war und dass es folglich vorherrschende Praxis war, Plattnerarbeiten für jegliche Art der Verzierung von Innsbruck nach Augsburg zu schicken. Dies wiederspricht jedoch den uns bekannten Fak-ten zur Innsbrucker Plattnerkunst. Die Technik der Waffenätzung wurde in Innsbruck von lokal ansässigen Künstlern zumindest seit etwa 150576 ange-wendet; für die folgenden Jahrzehnte sind einige in Innsbruck ansässige Waffenätzer namentlich bekannt, etwa Leonhard Meurl, Paul Dax und Hans Perckhammer, die vereinzelt auch mit bekannten Werken der Hof-werkstatt in Verbindung zu bringen sind77. Goldschmiedearbeiten wie jene auf dem Harnisch Erzherzog Karls von 1512/14 waren ein überaus seltenes Dekorationselement der Plattnerkunst78, dessen Ausführung in dem er-wähnten Fall an einen in Augsburg arbeitenden Künstler vergeben wurde, in anderen, zeitgleichen Fällen aber auch in Innsbruck erfolgen konnte79.Soweit wir wissen, wurden im Spätmittelalter und in der Renaissance im süddeutschen Raum Harnische und Waffen generell von lokal ansässigen Künstlern dekoriert. Nur in Ausnahmefällen kooperierten Plattner bei der Dekoration ihrer Arbeiten mit auswärtigen Künstlern80. Im Kontext der gegenwärtigen Untersuchung ist von Bedeutung, dass Daniel Hopfers eigenhändige Waffenätzungen wohl ausschließlich auf Arbeiten von Augs-burger Plattnern, insbesondere jenen aus der Helmschmid-Werkstatt, zu suchen sind.
Die frühen 1520er Jahre
Durchläuft man das Daniel Hopfer zugeschriebene Œuvre von Waffenät-zungen in chronologischer Reihenfolge, so stößt man in den frühen 1520er Jahren erstmals auf eine größere Werkgruppe. Manche dieser Arbeiten weisen als ein seltenes Detail die Jahreszahl ihrer Entstehung auf; so sind etwa der Sattel Ottheinrichs von der Pfalz81 und der Kostümharnisch des Wilhelm Freiherr von Roggendorf 82, beide in Wien, auf 1523 („XXIII“)
Abb: 8: Kolman Helmschmid (zugeschrieben) und Daniel Hopfer, Fragment eines Feldharnischs, Detail der linken Beintasche. Augsburg, späte 1510er Jahre. New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 38.143b – d.
2010 (zit. Anm. 3), 528, Kat.-Nr. WZ 16 (mit Lit.); ergänzend vgl. Bruno Thomas, Portions of the Roggen-dorf Armour in the Wallace Collection, in: The Burling-ton Magazine 92, 1950, 173 f. [= Thomas 1977 (zit. Anm. 37), Bd. 2, 1159 – 1162]; James Mann, Wallace
Collection Catalogues. European Arms and Armour, London 1962, 174 f.; A. V. B. Norman, Wallace Coll-ection Catalogues. European Arms and Armour. Sup-plement, London 1986, 82. Zu Roggendorf vgl. auch Anm. 129.
66
stefan krause
83 Das Harnischfragment New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 29.150.3b-j zeigt das Da-tum „XXIIII“ (1524); vgl. Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 529, Kat.-Nr. WZ 19 (mit Lit.); ergänzend vgl. Carl Otto von Kienbusch – Stephen V. Grancsay, The Bashford Dean Collection of Arms and Armor in the Metropolitan Museum of Art, Portland/Maine 1933, 86 – 88, bes. 87 f. Zu dem ebenso „XXIIII“ (1524) datierten Küriss, London, The Wallace Collection, Inv.-Nr. A 210 vgl. Anm. 110.
84 Schaller, Kolman Helmschmid (zugeschrieben), Augs- burg, ca. 1522/26, New York, The Metropolitan Mu-seum of Art, Inv.-Nr. 29.153.1; Kienbusch – Granc-say 1933 (zit. Anm. 83), 136, Nr. 52 und Taf. XXXII (mit der alten Zuschreibung an Moritz von Leipzig); Stuart W. Pyhrr, European Armor from the Imperial Ottoman Arsenal, in: Metropolitan Museum Journal 24, 1989, 102 – 111.
85 New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 38.143b-d; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 529, Kat.-Nr. WZ 20 (mit Lit.). Zu den Harpyien auf dem Brustsaum vgl. Hopfers Radierung M 31. Auf Brust und Rücken jeweils drei Heiligenfiguren; Brust: Maria und Kind mit den Heiligen Georg (li.) un. Chr.stophorus (re.), Rücken: Hl. Anna Selbdritt mit den Heiligen Jakob d. Ä. (li.) und Sebastian (re.) – letzere Figur ist eine Kopie nach einem Holzschnitt Hans Baldung Griens (F. W. H. Hollstein, German Engravings, Etchings and Woodcuts ca. 1400 – 1700, Bd. II: Altzenbach – B. Beham, Amsterdam 1955, 120, Nr. 130).
datiert83. Eine Schaller (Helm) in New York84 lässt sich indirekt auf etwa dieselbe Entstehungszeit festlegen: Sie trägt die Initialen „LM“, die auf König Ludwig II. von Ungarn und Böhmen (1506 – 1526) und Maria (1505 – 1558), die Schwester Kaiser Karls V., verweisen; Ludwig und Ma-ria hatten 1522 geheiratet, Ludwig starb 1526 nach der Schlacht von Mohács.Daniel Hopfers Waffenätzungen der frühen 1520er Jahre sind durch eine überaus schwungvolle und elegante Leichtigkeit ausgezeichnet, die das krasse Gegenteil zu den meist energisch-angespannten Arbeiten aus den Jahren davor darstellen. Das Fragment eines Kolman Helmschmid zuge-schriebenen Feldharnischs in New York85 (Abb. 8) zeigt eine geätzte Deko-ration, die diese beiden Stile Hopfers als Zwischenschritt verbindet. Einer-seits begegnen uns hier wieder die kraftvollen, etwas verwachsen anmuten-den Figuren, die wir von Hopfers Arbeiten des ersten und zweiten Jahr-
Abb. 9: Daniel Hopfer, Innenansicht der Augsburger Dominikanerinnenkirche St. Katharina (M 38). Radierung. Augsburg, frühe 1520er Jahre. München, Staatliche Graphische Sammlung.
67
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
86 Vgl. etwa. den Ottheinrich-Sattel in Wien (vgl. Anm. 81).
87 Vgl. Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 362 – 364, Kat.-Nr. 38 (Annette Kranz): wahrscheinlich 1518/20; Erika Tietze-Conrat, Die Vorbilder von Daniel Hopfers figuralem Werk, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, N. F. 9, 1935, 105 f.: 1517/19; Minni Gebhardt (Maedebach), Architekturdarstellun-gen auf Gemälden und Graphiken Augsburger Maler im Zeitabschnitt von 1490 – 1540, Univ.-Diss. Würzburg 1956, 120: nach Hopfer’s Mariae Tempelgang (M 7) von 1522.
88 S. Anm. 82.89 Vgl. auch Kostümharnisch, Kolman Helmschmid, um
1525, New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nrn. 24.179 und 26.188.1/.2; Bashford Dean, Puffed and Slashed Armor of 1525, in: The Metropo-litan Museum of Art Bulletin 21, Nr. 11, Nov. 1926, 260 – 264; Stephen V. Grancsay, The interrelationship of costume and armor, in: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, N. F. 8, Nr. 6, Feb. 1950, 183 bzw. 186 (Abb.). Der Ätzdekor auf diesem Harnisch ist we-sentlich einfacher als jener des Roggendorf-Harnischs; der Dekor auf den Armen wohl von Hopfer, jener auf der Rückenplatte wohl modern überarbeitet. Die zugehörige Brustplatte (nicht von Hopfer dekoriert) mit rechter Beintasche sowie Armzeug und linker Dichling in Paris, Musée de l’Armée, Inv.-Nr. G 45; Gamber 1975 (zit. Anm. 37), 33, Abb. 46; Jean-Pierre Reverseau, Musee de l’Armee Paris. Les armes et la vie, Paris u. a. 1982, 132, Abb. 28.
zehnts des 16. Jahrhunderts kennen; auf der anderen Seite zeigt der Ätz-dekor dieses Harnischs den fein gepunkteten Hintergrund und zum Teil das schwingende Rankenwerk, die beide Hopfers Arbeiten der 1520er Jahre charakterisieren. Die geätzte Verzierung des New Yorker Harnisch-fragments kann aus diesem Grund als Werk Daniel Hopfers aus den spä-ten 1510er Jahren bzw. um 1520 identifiziert werden. In der um 1518 entstandenen Radierung Chorgestühl mit Christus, Maria und Heiligen (M 33) verwendet Hopfer zum einen jene kurzen Wellenlinien, die in seinen Arbeiten von ca. 1516 festzustellen sind; er kombiniert diese aber hier mit dem gepunkteten Grund, der ab etwa 1520 in seinen Waffende-korationen dominieren sollte.In den frühen 1520er Jahren hatte Daniel Hopfer – er war zu dieser Zeit etwa 50 Jahre alt – in seinen Waffenätzungen die Höhe seiner Kunst er-reicht. Es findet sich hier die fantastische Motivik der Frühzeit, zugleich kündigt sich die Eleganz seiner kommenden Jahre an. In keiner anderen Periode seiner Karriere ist in Hopfers Werken ein vergleichbarer Reichtum mythologischer Szenerien und Kreaturen zu erkennen; so erhält etwa die stupsnäsige Meerjungfrau, die uns die Jahrzehnte hindurch in Hopfers Werken begegnet, in dieser Zeit Gesellschaft durch eine eigenwillige männliche Version ihrerselbst, mit Haube und Ohrlocken und in Ergän-zung mit buschigem Vollbart86. Das schwungvolle Ranken- und Blüten-werk, wie es unter anderem auf der Rossstirn Ottheinrichs von der Pfalz von 1523 zu sehen ist (Abb. 1), übernahm Hopfer in jener Zeit in einzel-nen Fällen auch in sein druckgraphisches Werk; allen voran ist hier eine der Innenansichten der Augsburger Dominikanerinnenkirche St. Kathari-na (M 38; Abb. 9) zu erwähnen, wo das vegetabile Ornament die gesamte Decke der vierjochigen Kirche schmückt. Dieser Druck wurde bisher auf etwa 1518/20 datiert, doch erscheint im Vergleich mit Hopfers Waffenät-zungen von 1523 eine etwas spätere Entstehung (gegen 1523) wahrschein-licher87.Eine der eindrucksvollsten Waffenätzungen Daniel Hopfers aus der ersten Hälfte der 1520er Jahre und eindeutig ein Höhepunkt in seinem Gesamt-werk ist die Dekoration des Kostümharnischs für Wilhelm Freiherr von Roggendorf von 1523 in Wien88. Dieser Harnisch ist ein Werk des Augs-burger Plattners Kolman Helmschmid und wird zu Recht als ein techni-sches und künstlerisches Bravourstück der Plattnerkunst angesehen. Stäh-lerne Rüstungen waren nie nur simpler Körperschutz für den Einsatz in Schlacht oder Turnier, sie reflektieren in Form und Ausstattung auch den Rang des Trägers und waren daher entsprechend eng an der zeitgenössi-schen höfischen Mode orientiert. Der Roggendorfer Kostümharnisch imi-tiert in plastisch getriebenem Stahl und geschwärztem Ätzdekor extrava-gant die gepuffte und geschlitzte Mode, die von der Tracht der Lands-knechte ihren Ausgang genommen hat (Abb. 10). Diese Mode galt im frühen 16. Jahrhundert als Inbegriff des Luxus und der Verschwendung, wurde dabei doch der kostbare Oberstoff des Kleidungsstückes absichtlich mit längeren und kürzeren Schlitzen versehen, um einen ebenso edlen, zumeist gemusterten und farbenfrohen Futterstoff zum Vorschein bringen zu können89. Im Fall des Kostümharnischs für Wilhelm von Roggendorf hat der Plattner diese Schlitze meisterhaft in Stahl getrieben, der Ätzdekor ist hier als der gemusterter Futterstoff zu verstehen, der durch die Schlitze des (stählernen) Oberstoffs hervorblickt. Kolman Helmschmid und Dani-el Hopfer haben hier ihre Zusammenarbeit als Plattner und Ätzmaler weit über das übliche Maß hinaus vertieft und in enger Kooperation eines der
Abb. 10: Kolman Helmschmid und Daniel Hopfer, Kostümharnisch des Wilhelm Freiherr von Roggen-dorf, Ärmel. Augsburg, datiert 1523. Wien, Kunst-historisches Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, Inv.-Nr. A 374.
68
stefan krause
90 Die Harnischgarnitur des Wilhelm Rieter von Bocks-berg (Kolman Helmschmid und Daniel Hopfer, um 1525) zeigt getriebene und geätzte Tritonen, die nach einem Entwurf Hopfers entstanden sein dürften. Die Garnitur: Turin, L’Armeria Reale, Inv.-Nr. B 2; eine zusätzliche linke Schulter: New York, The Met-ropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 14.25.828; eine zusätzliche rechte Schulter: Paris, Musée de l’Armée, Inv.-Nr. G 381; vgl. Bruno Thomas, Der Turiner Prunkharnisch für Feld und Turnier B2 des Nürnberger Patriziers Wilhelm Rieter von Boxberg – Ein Meister-werk von Kolman Helmschmid zu Augsburg um 1525, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 73, 1977, 137 – 154.
91 Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 235; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 530, Kat.-Nr. WZ 25 (mit Lit.); ergänzend vgl. Thomas 1937 (zit. Anm. 37), 149 – 152 und Abb. 158 – 161 [= Thomas 1977 (zit. Anm. 37), Bd. 1, 629 – 632]; Gamber 1975 (zit. Anm. 37), 31.
großen Meisterwerke der deutschen Plattnerkunst der Renaissance ge-schaffen90.In Hopfers Werk als Waffenätzer ist im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts ein ständiges Anwachsen des motivischen Reichtums sowie eine stetige Zunahme der quantitativen Ausdehnung der Ätzmalerei auf den Plattner-arbeiten festzustellen. Ein um 1525 entstandener Harnisch, der Riefelkü-riss des Bernhard Meuting von Kolman Helmschmid (Abb. 11) 91, deutet jedoch einen stilistischen Wandel im Werk Daniel Hopfers an, der in wei-terer Folge das Spätwerk des Künstlers prägen sollte. Die Ätzmalerei dieses Harnischs ist stilistisch den datierten Werken von 1523, etwa der Dekora-tion des Kostümharnischs des Wilhelm von Roggendorf, eng verwandt. Die Gestaltung der Figuren erscheint hier aber kleinteiliger als bei den früheren Werken, bedingt durch die schmalen getriebenen Felder des Rie-felküriss ist darüber hinaus der motivische Reichtum der Verzierungen deutlich verringert. Hopfers Waffenätzungen nach 1525 sind auch auf-grund stilistischer Veränderungen in der Gestaltung von Harnischen im Umfang reduziert, inhaltlich sind sie in den meisten Fällen – mit einigen wichtigen Ausnahmen – auf Laubwerk mit vereinzelten grotesken Kreatu-ren beschränkt.
Abb. 11: Kolman Helmschmid und Daniel Hopfer, Riefelküriss von Bernhard Meuting, Detail der Brust. Augsburg, um 1525. Wien, Kunsthistorisches Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, Inv.-Nr. A 235.
69
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
92 Vgl. u. a. Harald Seiler, Klingenätzungen des Ambrosius Gemlich, in: Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde, N. F. 7, 1940 – 1942, 11 – 19; Ortwin Gamber – Christian Beaufort, unter Mitarbeit von Matthias Pfaffenbichler, Kunsthistorisches Museum, Wien. Katalog der Leibrüstkammer, II. Teil: Der Zeit-raum von 1530 – 1560, Busto Arizio 1990, 64 f. Der Augsburger Waffenätzer Jörg T. Sorg (ca. 1522 – 603) hinterlies ein Musterbuch, in dem seine Arbeiten aus den Jahren 1548 bis 1563 dokumentiert sind; Becher 1980 (zit Anm. 58); Gamber – Beaufort 1990 (wie oben), 98 – 100.
93 Zur Geschichte der Innsbrucker Plattnerkunst vgl. AK Innsbruck 1954 (zit. Anm. 80), 15 – 28; Alan Wil-liams, The Knight and the Blast Furnace. A History of the Metallurgy of Armour in the Middle Ages & the Early Modern Period, (History of Warfare, hg. von Kelly DeVries, Bd. 12), Leiden – Boston, 2003, 451 – 458. Vgl. auch Stefan Krause, Der Rundschild aus dem Be-sitz des späteren Kaisers Maximilian I., in diesem Band.
94 Vgl. dazu das Kapitel „Innsbruck und Augsburg – Der Liegnitzer Harnisch“.
95 Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 107; Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), 214.
96 Wolfgang von Polheim war seit 1501 Ritter des Or-dens vom Goldenen Vlies; vgl. Das Haus Österreich und der Orden vom Goldenen Vlies. Beiträge zum wissenschaftlichen Symposium am 30. November und 1. Dezember 2006 in Stift Heiligenkreuz, hg. von der Ordenskanzlei, Graz 2007, 165, Nr. 109 (16) [22. Jänner 1501].
97 Vgl. Hans von Zwiedineck-Südenhorst, Polheim, Wolfgang Freiherr von, in: Allgemeine Deutsche Biogra-phie, hg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 26, Leipzig 1888, 821 – 823.
98 Carsten-Peter Warncke, Die ornamentale Groteske in Deutschland 1500 – 1650, Berlin 1979, Bd. 2, 10, Nr. 8 (um 1515); Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 453 f., Nrn. 133 und 134 (etwas später als 1515); Leopold Toifl – Peter Krenn, Der Rossharnisch im Lan-deszeughaus Graz. Historie und kunstgeschichtliche Be-trachtung, in: Waffen- und Kostümkunde. Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte 47, 2005, 124 f. (früher als 1515).
99 Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), Appendix.
Waffenätzungen nach Ornamentvorlagen Daniel Hopfers
Daniel Hopfer ist in mehrfacher Hinsicht die große Ausnahme unter den Waffen dekorierenden Künstlern der deutschen Renaissance. Sein Leben ist verhältnismäßig gut dokumentiert und er kann mit einem umfangrei-chen Œuvre an Druckgraphiken und Waffenätzungen in Verbindung ge-bracht werden. Über andere Künstler in derselben Profession sind wir hin-gegen überraschend schlecht informiert; eine Signatur auf einer geätzten Plattnerarbeit oder ein Name, der in Steuer- oder Rechnungsbüchern auf-scheint, ist in den meisten Fällen die einzige Quelle, die uns über sie zur Verfügung steht. Nur selten lässt sich einer dieser urkundlich belegten Künstler mit einem erhaltenen Werk in Verbindung bringen92. Der Groß-teil der wohl zahlreichen süddeutschen Waffenätzer des 16. Jahrhunderts war bei seiner Arbeit auf Vorbilder angewiesen, eigenhändige Skizzen und eine Graphiksammlung waren hoch geschätzte und sorgsam behütete Ar-beitsutensilien der Künstler. In diesen Vorlagensammlungen der Waffenät-zer müssen in nicht wenigen Fällen Graphiken aus der Werkstatt Daniel Hopfers zu finden gewesen sein. Gerade die weitverbreitete Verwendung von Hopfers Graphiken in den Werkstätten der Waffenätzer von Augs-burg, Nürnberg, Innsbruck etc. ist der Grund für viele der Missverständ-nisse, die nach wie vor die Hopfer Group umgeben. In der Handschrift bzw. in einigen Fällen auch in der künstlerischen Qualität sind bei diesen Werken jedoch zumeist deutliche Unterschiede zu den als eigenhändig an-zusehenden Waffendekorationen Hopfers zu erkennen. Exemplarisch soll hier anhand der Plattnerindustrie der Tiroler Residenz-stadt Innsbruck93 die Beeinflussung der süddeutschen Waffenätzkunst der Renaissance durch Hopfers Graphiken vor Augen geführt werden. Inns-bruck weist die unter allen süddeutschen Plattnerzentren wohl am inten-sivsten durch Hopfer beeinflusste Ätzmalerei auf. In Hinblick auf die Pro-blematik der Liegnitzer Harnischgarnitur 94 kommt den in Innsbruck nach-weisbaren Waffenätzungen auch besondere Bedeutung für die Abgrenzung von Hopfers eigenem Œuvre als Waffendekorateur zu. Die früheste nach-weisbare Waffenätzung nach einem motivischen Vorbild Daniel Hopfers ist auf einem in Innsbruck gefertigten und dekorierten Harnisch zu fin-den. Der Küriss des Wolfgang Freiherr von Polheim (1458 – 1512)95, ein um 1510 entstandenes Werk eines anonymen Innsbrucker Plattners, zeigt auf Brust und Rücken jeweils ein großes geätztes Andreaskreuz96. Die gro-tesken Szenerien, die die Arme dieser Kreuze füllen, sind in grober Hand ausgeführt und zeigen exakte bzw. freie Kopien nach Hopfers bereits mehrfach erwähnten Zehn ornamentalen Horizontalfriesen I bzw. II (M 133, M 134). Die Ätzmalerei des Polheim-Küriss ist für die Erforschung von Daniel Hopfers eigenhändigem Œuvre in mehrfacher Hinsicht rele-vant. In Folge des gegebenen terminus ante quem des Harnischs (Polheim starb 151297) müssen die beiden Graphiken Hopfers um einige Jahre frü-her als bisher angenommen datiert werden: um 1510, anstatt wie bisher um 1515 oder sogar später98. Diese Frühdatierung rückt die beiden Blätter in unmittelbare Nähe des Sonnenberg-Harnischs von 1505/10, der in seinen Randbordüren eine stilistisch und motivisch eng verwandte, von Hopfer ausgeführte Dekoration zeigt. Die von Hopfers Graphiken inspi-rierte Verzierung des Polheim-Harnischs ist darüber hinaus signiert; sie zeigt auf Brust und Rücken die Initialen „TA“(?)99.Hopfers Graphiken fanden in der Dekoration von Innsbrucker Plattner-arbeiten bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts in vielfältiger Variation ihre
70
stefan krause
100 Vgl. etwa den Küriss des Matthäus Lang von Wellen-burg von 1511 (Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 244); vgl.: Thomas – Gamber 1976 (zit. Anm. 39), 214 f. Die groteske Dekoration auf dem Brustfeld ähnelt Hopfers grotesker Rahmung M 129. Zu Hopfers Einfluss auf die Innsbrucker Ätzmalerei der 1520er und 1530er Jahre vgl. Petra Andrea Vincke-Koroschetz, Der Platt-ner Michael Witz der Jüngere und seine Werke, Univ.-Diss. Graz 2001, 119 – 147, bes. 132 – 140.
101 Jörg Seusenhofer und Hans Perckhammer, Innsbruck, datiert 1547, Wien, KHM, HJRK, Inv.-Nr. A 638; vgl. Gamber – Beaufort 1990 (zit. Anm. 92), 90 – 92.
102 Die Adlergarnitur zeigt auch den Einfluss von Hopfers Zehn ornamentalen Horizontalfriesen I bzw. II (M 133, M 134).
103 Vgl. Anm. 60.104 Die Radierung M 128 wurde von Lambrecht Hop-
fer signiert („LH“), die groteske Einfassung die-ses Drucks von Daniel Hopfer („D·H“); vgl. auch M 114, M 115, M 130, M 129 (alle Daniel und Lam-brecht Hopfer) bzw. M 95 (datiert 1520/21?) (Hie-ronymus Hopfer); vgl. Tobias Güthner, Von Künstlern und Kaufleuten. Lambrecht und Hieronymus Hopfer, in: Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3).
105 Für den Monogrammisten CB vgl. F. W. Holl-stein, German Engravings, Etchings and Woodcuts ca. 1400 – 1700, Bd. IV: Beischlag–Brosamer, Amsterdam 1957, 132 – 134; vgl. auch Güthner 2009 – 2010 (zit. Anm. 104), 102, Anm. 43.
106 Zur Werkstatt Hopfers vgl. Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 13 f.
107 Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.- Nr. A 93; vgl. Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 34 – 36 und Taf. VIII; Ausstellungskata-log Tapices y Armaduras del Renacimiento. Joyas de las Colecciones Reales, Barcelona (Reales Atarazanas) – Madrid (Palacio de Velázquez) 1992, 146 – 151.
108 Demselben anonymen Meister kann der Visierhelm (Helmschmid-Werkstatt?, um 1530/35), London, The Wallace Collection, Inv.-Nr. A 165, zugeschrie-ben werden; vgl. Mann 1962 (zit. Anm. 82), 136; Norman 1986 (zit. Anm. 82), 61 f.; Tobias Capwell u. a., Masterpieces of European Arms and Armour in the Wallace Collection, London 2011, 90 f. Die Ät-zung auf dem geschlossenen Knabenhelm, Desiderius Helmschmid, 1530er Jahre, New York, The Met- ropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 14.25.621, ist das Werk eines weiteren anonymen Künstlers unter Hopfers Einfluss; vgl. Ausstellungskatalog Stuart W. Pyhrr, European Helmets 1450 – 1650. Treasures from the Reserve Collection, New York (The Metropo-litan Museum of Art) 2000 – 2001, 20, Kat.-Nr. 27. Der Ätzdekor auf der Tartsche Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. A 27, ist ebenso mit Hopfers Werk verbunden (eigenhändig?); Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 20 und Taf. IV.
Anwendung100. Eindrucksvoll demonstriert dies etwa der Dekor der Ad-lergarnitur Erzherzog Ferdinands II. von Tirol101 aus dem Jahr 1547. Der urkundlich für dieses Werk dokumentierte Ätzmaler Hans Perckhammer kombinierte auf dem Helmkamm des Fußkampfharnischs fünf Figuren aus insgesamt drei verschiedenen graphischen Quellen; die zentrale Figur, einen stehenden Putto in Rückenansicht, entnahm er einer Graphik Heinrich Aldegrevers (Bartsch 246, dat. 1532), die zwei sitzenden Putten stammen aus Hopfers Radierung Das Zeichen Hopfers auf ornamentalem Feld (M 154) (Abb. 12), die zwei Drachen an den Rändern dieser Kompo-sition sind Hopfers Vier ornamentalen Horizontalfriesen (M 136) ent-lehnt102. Der große Erfolg von Hopfers Drucker- und Waffenätzerwerkstatt lässt auch die Frage nach Ätzmalern aufkommen, die in Hopfers engerem Um-kreis, etwa direkt in seiner Werkstatt oder in Augsburg selbstständig, je-doch unter seinem Einfluss arbeiteten. Wir wissen, dass in Hopfers Werk-statt seit deren Eröffnung im Jahr 1493 regelmäßig Lehrlinge bzw. Gehil-fen tätig waren; im Jahr 1493 war es der bereits erwähnte Michel Maistet-ter103, um 1520 Daniels Söhne Lambrecht und Hieronymus104, etwa ein Jahrzehnt später der Monogrammist CB105. Abgesehen von diesen in Be-zug auf die Ausführung von Waffendekorationen letztlich begrenzt infor-mativen Fakten wissen wir nichts über die Werkstattpraxis Hopfers106. Ei-nige erhaltene Augsburger Waffenätzungen der ersten Hälfte des 16. Jahr-hunderts lassen jedoch auf Ätzmaler schließen, die dem unmittelbaren künstlerischen Einflussbereich Hopfers angehört haben dürften. Ein Kol-man Helmschmid zugeschriebener Fußkampfharnisch (ca. 1525/30) für Kaiser Karl V. in Madrid107 ist reich mit vergoldeter Ätzmalerei verziert, deren Nähe zu Hopfers ikonographischem Repertoire unbestreitbar ist. Stilistisch ist dieser Dekor jedoch weit von Hopfers eigenen meisterhaften Waffenätzungen entfernt und muss daher einem Waffenätzer im Umkreis Hopfers zugeschrieben werden108. Auch die geätzte Dekoration eines aus den 1510er Jahren stammenden geriefelten Brustpanzers in Berlin109 zeigt die Hand eines von Hopfer inspirierten Künstlers; die Brustplatte trägt die Plattnermarke Kolman Helmschmids, ihre geätzte Verzierung wird daher auch aus dem unmittelbaren Umfeld Hopfers stammen. Ein besonderer Fall ist der in der Wallace Collection in London verwahrte fragmentierte Harnasch von 1524110, dessen überaus reichhaltiger Ätzde-kor seit Manns Hopfer Group als autographes Werk Daniel Hopfers ge-führt wurde. Tatsächlich steht dieses Werk unmittelbar mit Hopfers eige-nen Waffenätzungen in Verbindung111; im Vergleich ist hier jedoch eine abweichende Handschrift festzustellen112. Mit den großen, gedrungenen
Abb. 12: Links: Daniel Hopfer, Das Zeichen Hopfers auf ornamentalem Feld (M 154). Radierung (Detail). Augsburg, undatiert. München, Staatliche Graphische Sammlung. Rechts: Jörg Seusenhofer und Hans Perckhammer, Kempfküriss der Adlergarnitur Erzherzog Ferdinands II. von Tirol, Detail des Helmes. Innsbruck, datiert 1547. Wien, Kunst- historisches Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, Inv.-Nr. A 638.
71
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
109 Berlin, Deutsches Historisches Museum, Inv.-Nr. W 2323, 25.23; Ausstellungskatalog Gerhard Quaas (Hg.), Eisenkleider. Plattnerarbeiten aus drei Jahrhun-derten aus der Sammlung des Deutschen Historischen Museums, Berlin (Deutsches Historisches Museum) 1992, 70, Kat.-Nr. 73; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 526, Kat.-Nr. WZ 3.
110 Harnasch, Kolman Helmschmid zugeschrieben, da-tiert „XXIIII“ (1524), London, The Wallace Collec-tion, Inv.-Nr. A 210; vgl. Mann 1962 (zit. Anm. 82), 159 f.; Norman 1986 (zit. Anm. 82), 76.
111 Vgl. etwa den Ottheinrich-Sattel (zit. Anm. 82) und den Roggendorf-Harnisch (zit. Anm. 82), beide von 1523.
112 Ortwin Gamber schrieb den Ätzdekor auf dem Har-nisch London, The Wallace Collection, Inv.-Nr. A 210, sowie generell die gesamte Hopfer Group ver-suchsweise Hans Burgkmaier zu; Norman 1986 (zit. Anm. 82), 8 (unter A 28).
113 Der Rücken des Harnischs zeigt Herkules-Szenen (Kampf mit Antaeus bzw. mit dem Nemäischen Lö-wen), die sich ähnlich auf dem Nürnberger Harnisch Paris, Musée de l’Armée, Inv.-Nr. G 31 (zit. Anm. 23, WZ 21) finden.
114 Das dünne Ornamentband um die Hüfte des Har-nischs London, The Wallace Collection, Inv.-Nr. A 210 (vgl. Anm. 110) findet sich auch am Nürnber-ger Harnisch Paris, Musée de l’Armée, Inv.-Nr. G 31 (zit. Anm. 23, WZ 21) sowie auf dem Kostümhar-nisch New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nrn. 24.179 und 26.188.1/.2 mit Teilen in Pa-ris, Musée de l’Armée, Inv.-Nr. G 45 (vgl. Anm. 89). Vgl. auch den Harnisch im Porträt eines Mitglieds der Augsburger Familie Rehlinger, Monogrammist LS, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, Inv.-Nr. 629; vgl. Henning Bock u. a., Gemäldegalerie Berlin. Gesamtverzeichnis, Berlin 1996, 80 und 167, Abb. 197; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 531. Die oft zitierte Datierung 1540 kann am Gemälde nicht verifiziert werden; die Datierung des im Gemäl-de dargestellten Harnischs (1527) würde jedoch dem Stil des Gemäldes entsprechen. Ich danke Stephan Kemperdick (Berlin) für diese Auskunft.
115 Vgl. Anm. 91.116 Vgl. Anm. 9.117 Zit. nach Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 549, Q 15;
zu Hopfers Wappenbrief vgl. auch Anm. 9.
Figuren113 und dem kräftigen Rankenwerk geht diese Arbeit weit über Hopfers eigene Waffendekorationen der frühen 1520er Jahre hinaus114 und dürfte einem talentierten anonymen Ätzmaler aus Hopfers näherem Umfeld zuzuschreiben sein. Hopfer hatte in der Mitte der 1520er Jahre in seinem waffenätzerischen Werk eine andere stilistische Richtung einge-schlagen, die wir bereits am Beispiel des Riefelküriss von Bernhard Meu-ting115 kennen gelernt haben. Die kleinteiligen Kompositionen und die in späteren Jahren zunehmend skizzenhafte bzw. unpräzise Handschrift soll-ten die Waffenätzungen Hopfers aus den Jahren um 1530 definieren und diese wurden in vielen Fällen für einen herausragenden Klienten gefertigt – Kaiser Karl V.
Daniel Hopfer und Kaiser Karl V.
Am 28. Jänner 1524 verlieh Kaiser Karl V., vertreten durch seinen Bruder, den deutschen König Ferdinand I. (1503 – 1564), Daniel Hopfer ein Fa-milienwappen116. Der Grund für diese Ehrung waren, dem Wappenbrief zufolge, die „willigenn diennst, so er [Hopfer] vnns vnnd dem Reych ge-tahn hatt, vnnd f8rohin woll thun vnnd mag vnnd solle“117. Diese „willi-genn diennst“ am Kaiser sind wohl, wie aus späteren Wappendiplomen der Familie Hopfer zu schließen ist, mit Daniel Hopfers Pionierarbeit in der Entwicklung des drucktechnischen Verfahrens der Radierung gleich-zusetzen. Von ebenso großer Bedeutung für das hohe Ansehen Hopfers muss aber auch seine Arbeit als Waffendekorateur in Kooperation mit der Helmschmid-Werkstatt gewesen sein. Karl V. bezog wie seine Vorfahren Maximilian I. und Philipp I. seine Rüstungen für Feld und Turnier vor-zugsweise aus der Werkstatt der Familie Helmschmid in Augsburg. Es bie-
Abb. 13: Kolman Helmschmid und Daniel Hopfer, Grand Bacinet Kaiser Karls V. aus der sog. Harnisch-garnitur Hojas de Roble, Detail. Augsburg, um 1530. Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. A 56.
72
stefan krause
118 Zur Geschichte der Real Armería vgl. Ausstellungs-katalog Álvaro Soler del Campo, The Art of Power. Royal Armor and Portraits from Imperial Spain / El arte del poder. Armaduras y retratos de la España imperial, Washington (National Gallery of Art) 2009, 27 – 47. Einige Rüstungsteile der Real Armería wurden im 19. Jahrhundert verkauft; vgl. Stuart W. Pyhrr, “Anci-ent Armour and Arms recently received from Spain” Eu-sebio Zuloaga, Henry Lepage, and the Real Armería in Madrid, in: Gladius. Estudios sobre Armas Antiguas, Armamento, Arte Militar y Vida Cultural en Oriente y Occidente XIX, 1999, 261 – 290; Grancsay 1966 (zit. Anm. 33), 7 f. Vgl. u. a. die Kolman Helmschmid und Daniel Hopfer zuzuschreibenden geätzten Schuhkappen, New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nrn. 41.39.1/2, 42.50.22, 42.102.1/2, 42.102.4, 42.102.6; Valencia de Don Juan 1889 (zit. Anm. 4), Taf. 9.
119 Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nrn. A 49 – A 64; Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 26 – 31, bes. 30, Anm. 1. (Die Gruppierun-gen der Madrider Harnische durch Valencia de Don Juan sind heute überwiegend überholt.)
120 Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.- Nrn. A 65 – A 92; Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 31 – 34.
121 Vgl. Anm. 91.122 Vgl. insbesondere die stilistische und motivische
Nähe zu Hopfers Radierung M 127.123 Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-
Nr. A 65; Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 31 f. Vgl. auch den Rossharnisch Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. A 26; Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 18 – 20 mit Taf. III, sowie den Rossharnisch Madrid, Patrimonio Nacio-nal, Real Armería, Inv.-Nr. A 115; Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 44; AK Washington 2009 (zit. Anm. 118), 122 f., Kat.-Nr. 27 (Álvaro Soler del Campo).
124 Vgl. auch den Sattel Kaiser Karls V., Desiderius Helm- schmid, Augsburg, ca. 1530/35, Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. A 150; Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 54; AK Washington 2009 (zit. Anm. 118), 23 f.
125 Kolman Helmschmid (gemarkt), Augsburg, ca. 1530, Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. A 59; Metzger 2009 – 2010 (zit. Anm. 3), 529, Kat.-Nr. WZ 17 (mit Lit.); ergänzend vgl. Va-lencia de Don Juan 1889 (zit. Anm. 4), Taf. 10; AK Washington 2009 (zit. Anm. 118), 116 f., Kat.-Nr. 25 (Álvaro Soler del Campo). Eine ähnliche zoomorphe Sturmhaube findet sich in Hopfers Radierung M 93; Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 30.
126 Vgl. auch die Sturmhaube Madrid, Patrimonio Na-cional, Real Armería, Inv.-Nr. A 120 (Kolman Helm- schmid, ca. 1530) bzw. den Stechhelm ebenda, Inv.-Nr. A 57 (Desiderius Helmschmid, ca. 1535); Va-lencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 29 und 45. Vgl. auch die Sturmhaube St. Petersburg, Eremitage, Inv.-Nr. 3-O-3943 (alt: I 432); Leon Auguste Asseli-neau, Musée de Tzarskoe-Selo ou Collection d’Armes de SA Majesté l’Empereur de toutes les Russies. Ouvragé compose de 180 planches lithographiées par Asselineau d’après les dessins originaux de A. Rockstuhl, St. Peters-burg – Karlsruhe 1835 – 1853 (Nachdruck: Fridingen 1981), Taf. CLXXII, Nrn. 1 und 1a.
127 Kolman Helmschmid zugeschrieben, Madrid, Patri-monio Nacional, Real Armería, Inv.-Nrn. E 68, E 69,
tet sich daher an, unter den zahlreichen Augsburger Harnischen Karls V. aus dem zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts und neben der bereits er-wähnten Gittertartsche von 1536 nach möglichen weiteren Waffenätzun-gen Daniel Hopfers zu suchen. Ein Großteil der für Karl V. gefertigten Plattnerarbeiten befindet sich seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in der Real Armería in Madrid und ist dort auch heute noch nahezu vollständig erhalten118. Valencia de Don Juan bemerkte im späten 19. Jahrhundert im Ätzdekor einzelner Plattnerarbeiten Karls V. in Madrid motivische Querverbindungen zu Graphiken Daniel Hopfers, den er durch die Signatur auf der Gittertart-sche von 1536 kannte; Conde de Valencia hatte hierbei vor allem Teile der heute unter den Namen Hojas de Roble (ca. 1530)119 und Volutas flordelisa-das (ca. 1530)120 zu Garnituren gruppierten und Kolman Helmschmid zu-zuschreibenden Harnische der Real Armería im Sinn. Der Stil der Ätzma-lerei auf Teilen dieser und anderer Plattnerarbeiten aus den Jahren um 1530 ist eine direkte Weiterentwicklung der früheren Arbeiten Hopfers und verbindet diese mit der bisher isoliert gesehenen Gittertartsche von 1536. Das Œuvre Daniel Hopfers als Waffenätzer kann daher wohl um einige bedeutende Arbeiten aus der Zeit um 1530/35 erweitert werden.Der Ätzdekor auf den zusammengestellten Garnituren Hojas de Roble und Volutas flordelisadas ist überwiegend auf Laubwerk mit eingestreuten grotesken Szenerien, zumeist einzelne Delphine, Vögel oder menschliche Köpfe, beschränkt. In ähnlicher Form sind diese Motive auch in Hopfers zeitgleichen Graphiken festzustellen, etwa in Vier ornamentale Horizontal-friese mit Rüstungsdekor und Drei Panele mit Rüstungsdekor (M 136, M 137, ca. 1530/35). Die Motive auf diesen Harnischen sind in Folge der zumeist sehr schmalen Ätzfelder auf miniaturhafte Größe reduziert, wie wir dies in vergleichbarer Form bereits auf dem Riefelküriss des Bernhard Meuting von ca. 1525121 bemerkt haben. Auf dem Grand Bacinet der Gar-nitur Hojas de Roble findet sich jedoch ein in meisterhafter Linienätzung ausgeführtes Paar kämpfender tritonenähnlicher Wesen (Abb. 13), die ein-deutig als eigenhändige Arbeiten Daniel Hopfers zu identifizieren sind122. Einer der Pferdeharnische Karls V. in Madrid123 dürfte ebenso von Daniel Hopfer mit Ätzungen verziert worden sein; er zeigt geätzte mythologische Szenen (Abb. 14), die aufgrund ihrer unbeschwerten Figuren und der et-
Abb. 14: Kolman Helmschmid und Daniel Hopfer, Rossharnisch für Kaiser Karl V., Detail des Fürbuges. Augsburg, ca. 1530/35. Madrid, Patrimonio Nacio-nal, Real Armería, Inv.-Nr. A 65.
73
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
E 70, E 72 (E 71 nicht zugehörig); Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 167; Valencia de Don Juan 1889 (zit. Anm. 4), Taf. 11.
128 Thomas 1952 (zit. Anm. 82), 84 – 86 [= Thomas 1977 (zit. Anm. 37), Bd. 2, 1164 – 1166].
129 Zum Roggendorf-Harnisch vgl. Anm. 82. Zu Rog-gendorf vgl. [Joseph] Bergmann, Über die Freiherren und Grafen zu Rogendorf, Freiherren auf Mollenburg, in: Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe 7, Wien 1851, 519 – 626, bes. 543 – 564; Schrenck von Notzing 1981 (zit. Anm. 36), Taf. 81. Tobias Cap-well vermutete, der Harnisch London, The Wallace Collection, Inv.-Nr. A 30 (Kolman Helmschmid zu-geschrieben, Daniel Hopfer, Augsburg, ca. 1525/30) könnte ein Geschenk Karls V. an seinen Bruder Ferdi-nand I. gewesen sein; Capwell 2011 (zit. Anm. 108), 86 f.
130 Vgl. Spira 2006 (zit. Anm. 28), 40, Anm. 108; 70, Anm. 53.
131 Vgl. Anm. 5 und 22. 132 Nürnberg, Stadtarchiv, Einwohnermeldekartei (C 21/
IX). 1888 registrierte Rhau eine Blattsilberfabrik in Nürnberg; Nürnberg, Stadtarchiv, Gewerbean- und abmeldungen (C 22/II); dem Stadtarchiv Nürnberg bin ich zu großem Dank für die Unterstützung ver-plichtet. Rhau war seit 1886 Mitglied des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg; im Jahr 1894 war er einer von zwei Revisoren des Kassaberichts des Ver-eins; Jahresbericht des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg über das neunte Vereinsjahr 1886, Nürnberg 1887, 37, Nr. 8; 44, Nr. 185; Jahresbericht des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg über das siebzehnte Vereinsjahr 1884, Nürnberg 1895, 15 f.
133 Ich danke Thomas Eser, Nürnberg, für die Informa-tionen zu der bisher im Detail noch nicht aufgear-beiteten Sammlung von Georg Rhau. 1944 schenkte Rhau dem Museum das Stammbuch des Christoph Wilhelm Kress von Kressenstein (Mitte 18. Jahrhun-dert); vgl. Lotte Kurras, Kataloge des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Die Handschriften des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, Bd. 5: Die Stammbücher, 2. Teil: Die 1751 – 1790 begon-nenen Stammbücher, Wiesbaden 1994, 1, Nr. 97, Hs. 141127.
was skizzenhaften Zeichnung direkt mit Hopfers Dekor der Gittertartsche von 1536 verbunden werden können124. Die von einem technischen Standpunkt aus wohl raffinierteste unter den Daniel Hopfers Werkstatt zuzuschreibenden Waffendekorationen ist jene der von Kolman Helm-schmid gefertigten delphin-förmigen Sturmhaube Karls V. von ca. 1530125. Diese verbindet die meisterhaft ausgeführte zoomorphe Treibarbeit des Plattners mit Dekoration in Ätzung bzw. Feuervergoldung auf gebläutem Grund, die als spätes Werk Hopfers angesehen werden kann. Die Delphin-Sturmhaube Kaiser Karls V. summiert alle Techniken der Waffendekorati-on, die Hopfer im Laufe seiner langen Karriere zum Einsatz gebracht hat, und stellt ein brilliantes Cappriccio der deutschen Renaissance dar126.Die Rüstkammer Kaiser Karls V. in Madrid ist eine überaus reichhaltige und komplexe Sammlung, die eine vollständige Erforschung der darin zu findenden Waffenätzungen zu einem eigenen aufwendigen Forschungs-projekt machen würde; die hier erwähnten Waffenätzungen Daniel Hop-fers in der Real Armería sind keineswegs als vollständige Zusammenstel-lung anzusehen. Ergänzend soll hier dennoch auf eine Gruppe kleinforma-tiger Rüstungsteile hingewiesen werden, da sie wichtig für Hopfers Arbeit im Dienst Karls V. sind; es sind dies vier Kolman Helmschmid zuzuschrei-bende Rüsthaken aus den früheren 1520er Jahren127. Jeder dieser Rüstha-ken ist mit grotesken Figuren wie einem Einhorn oder einer zwei Trompe-ten blasenden Nymphe in geschwärzter Ätzung dekoriert (Abb. 15). Stili-stisch ist die Ätzmalerei dieser Rüsthaken früher als die eben erwähnten Arbeiten von ca. 1530/35 anzusetzen; sie sind unmittelbar mit Hopfers datierten Werken von 1523, etwa dem Roggendorf-Harnisch und dem Ott- heinrich-Sattel, in Verbindung zu bringen. Daraus lässt sich schließen, dass Hopfer bereits Jahre vor der Gittertartsche von 1536, zumindest seit etwa 1523, mit den Plattnern der Helmschmid-Werkstatt an Prunkharnischen für Kaiser Karl V. arbeitete. Interessanterweise vermutete Bruno Tho-mas128, dass der Kostümharnisch des Wilhelm von Roggendorf von 1523 als ein von Karl V. in Auftrag gegebenes Geschenk für Roggendorf, einen seiner engsten Vertrauten, entstanden sei129. Auch wenn es sich dabei nicht um ein Geschenk des Kaisers gehandelt hat, muss Roggendorfs Harnisch doch mit dem Einverständnis des Kaisers in der hauptsächlich von diesem beschäftigten Helmschmid-Werkstatt entstanden sein. Die hohe Meister-schaft Hopfers, die sich unter anderem in den Madrider Rüsthaken, aber vor allem in Werken wie dem Roggendorf-Harnisch verrät, dürfte mit ein Anlass für die Verleihung des Familienwappens an Hopfer im Jänner 1524 gewesen sein – und diese Auszeichnung war, wie es scheint, der Beginn einer langen fruchtbaren Tätigkeit Hopfers für Kaiser Karl V.
Das sogenannte Ottheinrich-Schwert in Nürnberg
Ein Werk, das für Daniel Hopfers Œuvre als Waffenätzer von großer Be-deutung ist, aber aufgrund seiner Provenienz zum Teil kritisch beurteilt wurde130, ist das sog. Ottheinrich-Schwert in Nürnberg (Abb. 16)131. Dieses mit „D HOPFER“ signierte Schwert gelangte 1928 mit einer umfangrei-chen Sammlung historischer Waffen aus dem Eigentum des Nürnberger Geschäftsmannes Georg Rhau (1855 – 1946)132 an das Germanische Na-tionalmuseum in Nürnberg133. Unter welchen Umständen Rhau das Schwert erworben hatte, ist jedoch unbekannt, Angaben zu möglichen Besitzern aus früheren Jahrhunderten fehlen ebenso – Wolfgang Wegner
Abb. 15: Kolman Helmschmid (zugeschrieben) und Daniel Hopfer, Rüsthaken Kaiser Karls V. Um 1525. Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. E 69.
74
stefan krause
134 Vgl. Wegner 1954 (zit. Anm. 22), 129 f. Vgl. das wohl von Hopfer mit geschwärztem Ätzung verzierte Schwert, Turin, Museo Storico Nazionale dell’Arti- glieria, Inv.-Nr. 02.01.0014 (alt: G 9/4547); Metz- ger 2009 – 2010 (zit. Anm, 3), 530, Kat.-Nr. WZ 22 (mit Lit.); ergänzend vgl. Enrico Gonella, Il Museo Nazionale d’Artiglieria a Torino, Rom 1914, 76 (XXX,
Abb. 16: Daniel Hopfer, Jagdschwert, sog. Ottheinrich-Schwert, Detail. Augsburg, um 1534. Nürnberg, Germanisches National- museum, Inv.-Nr. W 2833.
vermutete, das Schwert könnte für Ottheinrich von der Pfalz entstanden sein134. Nun hatte in den Jahren um 1900, als Rhau seine Sammlung zu-sammenstellte, der Handel mit historischen Waffen seinen Höhepunkt erreicht und Sammler in Europa und Nordamerika trieben durch ihre star-ke Nachfrage die Preise für Waffen des Spätmittelalters und der Renais-sance nach oben. Die Folge dieses Interesses an alten Waffen waren in nicht wenigen Fällen Überrestaurierungen originaler Werke, aber auch die Produktion von Repliken und Fälschungen135; die zum Teil kritische Dis-kussion des Nürnberger Schwertes ist nicht zuletzt auf Basis dieser Vor- gänge zu verstehen. In Vorbereitung des vorliegenden Textes konnte nun der Ätzdekor des Nürnberger Schwertes einer eingehenden stilistischen Untersuchung unterzogen werden, die nicht zuletzt zur Klärung der Authentizität dieser Arbeit beitragen sollte136.Die Verzierung des Ottheinrich-Schwerts kann mit großer Wahrscheinlich-keit als originales Werk Daniel Hopfers eingestuft werden. Die Dekora- tion des Schwertes lässt sich in das spätere Werk Hopfers eingliedern und bestätigt damit die von Wegner erkannte137 ikonographische Verbindung zu Hopfers Illustrationen zu Sprüchen Salomons 10,4 – 7 (M 5) von 1534. Das Blattwerk mit eingestreuten Tieren ähnelt stilistisch jenem in Hopfers Vier ornamentalen Horizontalfriesen (M 136) von ca. 1530/35; die mytho-logischen Kreaturen können jenen in Hopfers Gittertartsche von 1536 zur Seite gestellt werden. Selbst die wirren Haarlocken, die wir bereits als Cha-rakteristikum der späten Arbeiten Hopfers identifiziert haben, sind auf dem Schwert an mancher Stelle zu erkennen138. Die zum Teil unpräzise Zeichnung der Figuren erinnert an Hopfers Verzierungen der Gittertart-sche von 1536. Die Klinge des Ottheinrich-Schwerts und mit ihr die Ätz-malerei wurde jedoch zu einem unbekannten Zeitpunkt stark überschlif-fen; dieser Eingriff dürfte im 19. oder frühen 20. Jahrhundert geschehen sein, als das Schwert für den Kunstmarkt aufbereitet wurde139. Die bei diesem Eingriff beschädigten Details des Ätzdekors wurden, wie an vielen Stellen der Verzierung zu erkennen ist140, nachträglich in Kaltnadel und mit ungeübter, zittriger Hand ergänzt.
Prunkvoll dekorierte Harnische und Waffen, wie sie Hopfer vor allem in enger Kooperation mit den Plattnern der Familie Helmschmid schuf, spielten eine zentrale Rolle in der Repräsentation und Propaganda fürstli-cher Höfe des Spätmittelalters und der Renaissance. Hopfers Werke der Waffenätzung haben trotzalledem bisher nicht die ihrer Qualität entspre-chende Aufmerksamkeit erhalten. Zentrale Fragen etwa zu den genauen Umständen seiner Lehrjahre bzw. seiner Zusammenarbeit mit der Helm-schmid-Werkstatt, müssen auch weiterhin unbeantwortet bleiben. Solan-ge keine urkundlichen Belege zur Arbeit Hopfers in den Archiven von Augsburg (oder in einem der ehemaligen habsburgischen Archive in Wien, Innsbruck etc.) auftauchen, bleibt auch weiterhin der einzige Zugang zu Hopfers Arbeit als Waffenätzer der aufmerksame Blick auf diese brillianten Werke selbst141.
75
der augsburger druckgraphiker daniel hopfer (1471–1536) als waffendekorateur
Summary
Daniel Hopfer (1471 – 1536), a printmaker from Augsburg, produced not only countless etchings but also an extensive oeuvre of armour decoration. Although among the finest works from the German Renaissance, they have rarely received the attention their outstanding quality deserves. A re-search project sponsored by the Gerda Henkel Foundation, Düsseldorf, at the Kunsthistorisches Museum studied and reviewed the armour etchings attributed to Hopfer. Some of the etched armour decorations previously attributed to Hopfer have been identified as not by him, but there are also many new attributions. Of particular interest in this context are numerous previously unrecorded seminal works from Hopfer’s late period (c. 1530/ 35) that he executed for Emperor Charles V. In addition, the author pro-poses the attribution to Hopfer of the decoration of Lorenz Helm- schmid’s armour for Philipp the Handsome, made in Augsburg around 1495/1500; this armor possibly features the earliest weapons decoration by Daniel Hopfer.
125). Der Knauf dieses Schwerts (original zugehö-rend?) zeigt die Datierung 1533 sowie das Motto Ottheinrichs von der Pfalz („MDZ“, d. h. „Mit der Zeit“). Ich danke Lucio Leonardo Vinci (Turin) und Marco Merlo (Florenz) für die ergänzenden Informa-tionen zu diesem Schwert. Vgl. das Stirnschildchen mit dem Motto „MDZ“, New York, The Metropoli-tan Museum of Art, Inv.-Nr. 14.25.1654b (Augsburg, frühe 1520er Jahre, Ätzdekor wohl Daniel Hopfer); Ausstellungskatalog Stuart W. Pyhrr u. a., The Ar-mored Horse in Europe 1480 – 1620, New York (The Metropolitan Museum of Art) 2005, 41, Kat.-Nr. 10 (Stuart W. Pyhrr).
135 F. L., Ueber Fälschungen alter Kunstgegenstände, in: Mittheilungen des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie (Monatsschrift für Kunst & Kunstgewerbe) III, 1869 – 1871, 17 – 24, bes. 21: „Alte Waffen, namentlich solche, die mit Aetzun-gen verziert sind, werden erzeugt in Stuttgart, Paris, Nürnberg und München“; Hans Schedelmann, Kon-rad fecit, in: Waffen- und Kostümkunde. Zeitschrift der Gesellschaft für historische Waffen- und Kostüm-kunde 13, 1971, 52 – 61; Paulus Rainer, „Es ist immer dieselbe Melange“. Der Antiquitätenhändler Salomon Weininger und das Wiener Kunstfälscherwesen im Zeit-alter des Historismus, in: Jahrbuch des Kunsthistori-schen Museums Wien 10, 2008, 29 – 95, bes. 33 – 39.
136 Thomas Eser und Roland Schewe (Nürnberg) bin ich für ihre Unterstützung in diesem Zusammenhang zu großem Dank verpflichtet. Weiters danke ich Chris- tof Metzger un. Chr.sta Angermann (Wien) sowie Stuart W. Pyhrr (New York) für die Diskussion dieser Frage.
137 Vgl. Wegner 1954 (zit. Anm. 22).138 Vgl. Anm. 31.139 Der Griff (wohl 17. Jahrhundert) gehört nicht zur
Klinge; Wegner 1954 (zit. Anm. 22), 124, Anm. 2.140 Die Kombination radierter und gravierter Teile
ist insbesondere in der Inschrift zur Personifika- tion von Justitia deutlich zu sehen.
141 Die spätgotische niederländische Schaller Ma-drid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nr. D 18, zeigt Ätzdekor, der eng mit Hopfers späterem Werk in Verbindung zu bringen ist. Die-ser Helm gehörte ursprünglich König Philipp I. von Kastilien (1478 – 1506) und ist im Inventario il-luminado Kaiser Karls V. abgebildet; vgl. Valencia de Don Juan 1889 (zit. Anm. 4), Taf. 2. Karl V. verwahr-te diesen Helm in seiner Rüstkammer offensichtlich als familiäres Erinnerungsstück und als Zeichen dy-nastischer Kontinuität der Habsburger in Spanien; in den 1520er Jahren wurde diese spätgotische Me-morabilie mit ergänzendem Ätzdekor bereichert. Vgl. auch das Paar spätgotischer Handschuhe, ebenso mit späterem Ätzdekor, Madrid, Patrimonio Nacional, Real Armería, Inv.-Nrn. E 88 und E 89; Valencia de Don Juan 1898 (zit. Anm. 16), 168 f.; Javier Cortés, Patrimonio Nacional. Tesoro Artistico. Guia Ilustrada de la Real Armería de Madrid, Madrid 1950, Taf. XIII.