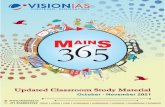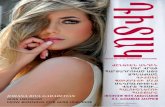D. Meixner, Randnotizen zur kulturellen Beeinflussung des Ingolstädter Beckens im Jungneolithikum....
-
Upload
uni-regensburg -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of D. Meixner, Randnotizen zur kulturellen Beeinflussung des Ingolstädter Beckens im Jungneolithikum....
Vorbemerkung
Das Manuskript für den nachfolgenden Aufsatz wurde ursprünglich im Jahr 2003 für eine
Festschrift zum 50. Geburtstag von Karl-Heinz Rieder eingereicht, die jedoch aus verschiedenen
Gründen nicht zum geplanten Zeitpunkt erscheinen konnte. Die damals gesammelten Beiträge
wurden in unveränderter Form erst zum 60. Geburtstag von Karl-Heinz Rieder in den
Sammelblättern des Historischen Vereins Ingolstadt abgedruckt. Forschungsstand und Literatur sind
daher überholt.
Beim Fußnotensatz des Beitrags sind folgende Fehler zu beachten:
Anm. 12 im Text entspricht Anm. 42 im Fußnotensatz.
Anm. 13 im Text und alle folgenden bis Anm. 36 beziehen sich jeweils auf Anm. x-1 im Fußnoten-
Satz, also:
Anm. 13 (Text) ≙ Anm. 12 (Fußnoten)
Anm. 14 (Text) ≙ Anm. 13 (Fußnoten)
Anm. 15 (Text) ≙ Anm. 14 (Fußnoten)
usw.
Anm. 37 im Text entspricht Anm. 43 im Fußnotensatz.
Anm. 38 im Text und alles folgenden beziehen sich jeweils auf Anm. x-2 im Fußnotensatz, also:
Anm. 38 (Text) ≙ Anm. 36 (Fußnoten)
Anm. 39 (Text) ≙ Anm. 37 (Fußnoten)
Anm. 40 (Text) ≙ Anm. 38 (Fußnoten)
usw.
15.07.2014
Daniel Meixner
Umschlag: Bernstein-Collier im Stadtmuseum Ingolstadt.
ISSN 1619-6074
Historischer Verein Ingolstadt e.V., Geschäftsstelle: D-85049 Ingolstadt,Auf der Schanz 45 (Kavalier Hepp), Telefon-Nr. 0841 / 305 18 80Konto: Sparkasse Ingolstadt, Nr. 7732 BLZ 721 500 00Redaktion: Edmund J. HausfelderLayout: Verlag Dr. Faustus, 91186 BüchenbachDruck: Verlagsdruckerei Schmidt GmbH, 91413 Neustadt/Aisch
5
Inhaltsverzeichnis
Beatrix Schöne-wald
Vorwort 6
Gerd Riedel Lohn der Konsequenz 9
Natascha Mehler Tönerne Aquamanilien aus dem Ingolstädter Donauraum und der Fränkischen Alb
20
Daniel Meixner Randnotizen zur kulturellen Beeinflussung des Ingolstädter Beckens im Jungneolithikum
43
Claus Michael Hüssen,Angelika Wegener-Hüssen
Die römische „Kleinstadt“ Nassenfels 57
Cornelia Schütz Silices aus urnenfelderzeitlichen Gräbern von Ingolstadt-Zuchering
85
Theodor Straub 1230 Jahre Ingoldestat 94
Siegfried Hofmann Ingolstadt und die Donau im Frühmittelalter – Ungelöste Fragen
110
Adrian Vasilache Der Passionsaltar aus dem Stadtmuseum Ingolstadt: Ein Triptychon des Dialogs
127
Edmund J. Hausfelder
Sebastian Denich – Ein Ingolstädter als Generalvikar und Weihbischof von Regensburg
146
Edmund J. Hausfelder
Generalleutnant Johann Streck – Musik-meisterssohn wird Festungsgouverneur
162
Gerd Treffer Der französische Maler Louis Antoni als Kriegsgefangener in Ingolstadt
167
Gerd Treffer Die Erinnerungen des „einfachen Soldaten“ Riou an seine Gefangenschaft im berühmten Kriegsgefangenenlager Ingolstadt
196
Adrian Vasilache Feinsinn, Sensibilität und Farbe beim Maler Otto D. Franz: Das Porträt von August Reuß
211
Beatrix Schöne-wald
Vom Wert der Quelle – Historische Hilfs-wissenschaften
219
Sebastian Enzinger Dorfgeschichten. Der Scheidegger – Die Osterhasen – Beim Wachten
235
Gerd Welker Meine Begegnung mit dem Ingolstädter Archäologen Dr. Karl Heinz Rieder
244
Jahresbericht 2013 247
Verstorbene Mitglieder 250
43
Randnotizen zur kulturellen Beeinflussung des Ingolstädter Beckens im Jungneolithikum
Einige bemerkenswerte Funde aus Burg Nassenfels
Daniel Meixner
Mit ihren hoch aufragenden Türmen bildet die Wasserburg Nassenfels1 einen markanten Blickfang in der weiten Niederung des Schuttertals. Von archäo-logischer Seite ist erwähnenswert, dass die hochmittelalterliche Anlage bereits manches Mal stimmungsvolle Kulisse für unvergessliche Sommerfeste des Grabungsbüros Ingolstadt abgab, zu denen der gastliche Burgherr lud. Abge-sehen davon war der Standort jedoch bereits sehr viel früher von besonderer Attraktivität für den Menschen, wie es sich 1982 eindrucksvoll zeigen sollte. Eine baubegleitende Befunddokumentation anlässlich der Verlegung von Versorgungsleitungen im Burghof lieferte damals derart überraschende Erkenntnisse zur vormittelalterlichen Geschichte des Platzes, dass zur weite-ren Erforschung eine kleinflächige Grabung angeschlossen wurde2.
Es stellte sich heraus, dass die Burg auf erhöhtem, felsigem Untergrund, nämlich einem jurazeitlichen Korallenriff gegründet war (Abb. 1). Diese Erhebung, die von der Ur-Donau als Felsenstock im Flussbett freigelegt wurde und ihr getrotzt hatte, bildete nach der Verlegung des Donaulaufs in das heutige Bett eine Art Insel im Schuttermoos. Bohrungen ergaben eine Ausdehnung von etwa 200 m in ost-westlicher und 100 m in nord-südlicher Richtung. Dieser leicht erhöhte, trockene und geschützte Standort, der einen schnellen Zugang zum fischreichen Gewässer, den Jagdgründen der Talniede-rung sowie zu den gut zu bewirtschaftenden Lößflächen im Hinterland bot, war ausweislich der Grabungen zu allen Zeiten Schauplatz menschlicher Aktivitäten. Geschützt durch die spätere Burganlage und wohl auch durch die zerklüftete Oberflächenstruktur des Kalkriffs, das teilweise bis knapp unter die heutige Oberfläche reicht, hatte sich unter mittelalterlichen Schutt-schichten eine 0,15m bis stellenweise 1 m mächtige, tiefschwarze, anmoorige Fundschicht erhalten (Abb. 2), von deren Basis mittel- und jungpaläolithi-
1 Gelegen am südlichen Ortsrand der Ortschaft Nassenfels, Lkr. Eichstätt, ca. 15 km wnw von Ingolstadt; Höhe über NN ca. 388 m. Zur Geschichte der seit dem 13. Jh. belegten Burg vgl. O. Hanrieder, Die Burg Nassenfels. In: Nassenfels. Beiträge zur Natur- und Kulturgeschichte. Festschrift zur 1900-Jahr-Feier des Marktes Nassenfels (Kipfenberg 1986) 167–192.
2 Vorbericht: K. H. Rieder, Steinzeitliche Fundschichten im Bereich der Burg Nassenfels. Arch. Jahr Bayern 1982, 22 f.; ausführlicher: K. H. Rieder/A. Tillmann, Steinzeitliche Fundhorizonte in der Wasserburg Nassenfels. In: Steinzeitliche Kulturen an Altmühl und Donau. Begleitheft zur Ausstellung im Stadtmuseum Ingolstadt 11. April–17. September 1989 (Ingolstadt 1989) 70–79.
44
sche sowie mesolithische Silex-Artefakte stammen, die aber in der Hauptsa-che Fundmaterial der mittleren und jüngeren Linearbandkeramik erbrachte. Daneben wurden auch Streufunde der späteren Jungsteinzeit, im Vorbericht der Münchshöfener Kultur zugewiesen, sowie der Metallzeiten geborgen. Während die paläo- und mesolithischen3 sowie die bandkeramischen Funde bereits bearbeitet wurden4, erfuhr ein kleines jungneolithisches Keramiken-semble bislang keine Würdigung. Obwohl es sich nur um eine Hand voll Scherben handelt, die überdies keinem engeren archäologischen Kontext, sondern nur allgemein besagter „Kulturschicht“ zugewiesen werden können5, scheint es aufgrund ihres für die kulturellen Verhältnisse der Region bedeut-samen Charakters doch sinnvoll, sie hier kurz vorzustellen und einzuordnen6. Die Randscherbe Abb. 3 stammt von einer Schüssel mit einziehendem Ober-teil, einer der Leitformen der Münchshöfener Kultur7, die in der zweiten
3 Rieder/Tillmann (Anm. 2).4 C. Renner, Die Bandkeramik von Nassenfels (unveröf. Magisterarb. Univ. Marburg
1992).5 Die Funde sind keinesfalls als geschlossenes Ensemble zu betrachten: Zwei der Scherben
sind Lesefunde aus dem Kanalaushub, die restlichen wurden in verschiedenen Quadran-ten der Grabungsläche, jedoch immer im neolithischen Fundstratum („Schicht III“) geborgen. Bei Renner (Anm. 4) 17 f. indet sich die Angabe, die „Münchshöfener“ Funde seien in den oberen Bereichen dieser Schicht angetrofen worden.
6 Für zahlreiche Anregungen und Hinweise beim Verfassen dieses Beitrages sei an dieser Stelle gedankt: A. Zeeb-Lanz, E. Neumair, P. Walther, I. Bürger, L. Kreiner, K. Böhm.
7 Die einzige, allerdings vielfach überholte, umfassende Bearbeitung dieser neolithischen Kultur bietet Lothar Süß mit seiner 1959 abgeschlossenen Marburger Dissertation: L. Süß, Zur Münchshöfener Gruppe in Bayern. In: H. Schwabedissen (Hrsg.), Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Fundamenta A3, Vb (Köln, Wien 1976) 1–121.
Abb. 1. Schematische Darstellung des Untergrundes im Bereich der Burg Nassenfels.
45
Abb. 2. Archäologische Fundschichten im Hof der Burg Nassenfels: Im Vordergrund und an der Basis des Profils die Oberfläche des Kalkriffs, darüber die dunkle neo lithische „Kultur-schicht“; im Hangenden mittelalterliche Horizonte.
46
Hälfte des 5. und im beginnenden 4. Jahrtausend hauptsächlich im Donau-raum zwischen Oberösterreich und Bayerisch-Schwaben verbreitet war8. Wie sich in den letzten Jahrzehnten anhand zahlreicher Fundpunkte im nörd-lichen Oberbayern herausstellte, bildet das Ingolstädter Becken die westliche Grenze der flächendeckenden eigenständigen Besiedlung durch diese Kultur-gruppe9.
Bei der in Nassenfels aufgefundenen Schüssel fallen die umlaufenden sichelförmigen Eindrücke unterhalb des Randes und oberhalb des Umbruchs auf. Während die auch am vorliegenden Exemplar vorhandene Kerbung von Rand und Umbruch regelhaft zu beobachten ist, sind zusätzliche Verzierun-gen auf den Oberteilen dieser Schüsseln im hauptsächlich aus Südost-Bayern stammenden veröffentlichten Bestand nahezu unbekannt, was auch die zahl-reichen unpublizierten Neufunde der letzten Jahrzehnte offenbar nicht ändern können10. Die wenigen in dieser Art verzierten Schüssel- oder Scha-lenoberteile finden sich vor allem im Raum Kelheim-Regensburg11. Zudem dürfte es sich bei einigen der Schüsseln aus dem Altbestand in Wirklichkeit um frühbronzezeitliche Gefäße handeln12. Weiter westlich zeichnet sich ein anderes Bild ab: Zwar stellen verzierte Schüsseloberteile im Ingolstädter Becken ebenso wie andernorts die Ausnahme dar, doch ist eine gewisse Häu-fung auf relativ engem Raum festzustellen. Obwohl für diesen Beitrag nicht sämtliche Münchshöfener Fundkomplexe aus dem oberbayerischen Donau-
8 Die derzeit genaueste Verbreitungskarte bei: M. Nadler, Jungneolithische Importe aus Ost und West am Auer Berg? Münchshöfen und Schussenried im südlichen Mittelfran-ken. Beitr. Arch. Mittelfranken 3, 1997, 15–39 (hier Abb. 7).
9 Eine zusammenfassende Veröfentlichung fehlt bislang; die hier vorgetragenen Erkennt-nisse beruhen auf einer Materialaufnahme des Verf. im Rahmen seiner Dissertation.
10 Frdl. mündl. Mitteilung K. Böhm, Kreisarchäologie Straubing-Bogen und L. Kreiner, Kreisarchäologie Dingoling-Landau.
11 Süß (Anm. 7) Taf. 9,10.11 (Weltenburg, Lkr. Kelheim, Galeriehöhle II und III), 12 (Sin-zing-Waltenhofen, Lkr. Regensburg, Höhle am Schelmengraben 14 (Hienheimer Forst, Lkr. Kelheim, Kastlhänghöhle), 23,5 (Dünzling, Lkr. Kelheim); I. Bürger, Die Doppel-kreisgrabenanlage von Riekofen, Lkr. Regensburg. Ein Beitrag zur Kenntnis der späten Münchshöfener Gruppe (unveröf. Magisterarb. Univ. Erlangen 2000) Taf. 21,1.
12 Für die Publikationserlaubnis der beiden Scherben aus Oberstimm sei hier noch einmal I. Bürger herzlich gedankt, der den Gesamtkomplex im Rahmen seiner Dissertation „Stu-dien zur späten Münchshöfener Kultur“ (Arbeitstitel) bearbeitet.
Abb. 3. Nassenfels. Verzierte Randscherbe der Münchshöfener Kultur. – M 1:3.
47
abschnitt berücksichtigt werden konnten, lassen sich auf Anhieb etliche Stü-cke zusammenstellen (Abb. 4). Die Verzierungen auf diesen Schüsseln sind zwar durchaus variabel, doch scheint aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine in aller Regel unverzierte Gefäßform handelt, eine gemeinsame Betrach-tung zulässig. Ohne näher auf Motive und Technik einzugehen, sind ver-schiedene Verzierungsdispositionen zu erkennen: Rand- und umbruchbeglei-tende umlaufende Stichreihen oder -linien stellen die einfachste Variante dar (Abb. 4,1.4.5.10.11), können jedoch auch mit weiteren Elementen kombi-niert sein. Eine weitere Gruppe bilden komplexere Umlaufmotive, die das Gefäßoberteil mehr oder weniger flächig bedecken und gewissermaßen auch in der Horizontalen gliedern (Abb. 4,2.3.9)13. Schließlich treten isolierte, ver-tikale „Fenstermotive“ auf (Abb. 4,1.6.7). Zur chronologischen Stellung der Schüsseln mit verziertem Oberteil ist mit der gebotenen Vorsicht zu bemer-ken, dass sie – bisherigen Beobachtungen zufolge – in Inventaren der fortge-schrittenen und jüngeren Münchshöfener Kultur auftreten. Zwei der drei Stücke aus Buxheim (Abb. 4,6.7) sowie die Scherben aus Kösching stammen aus Gruben, die auch schlickgeraute und mit Kammfurchenstich verzierte Scherben ergaben. Die Exemplare aus Bergheim14, Bergheim-Attenfeld und Manching-Oberstimm (Abb. 4,1.8.9.11) sind mit Keramik der Art Waller-fing vergesellschaftet15. Lediglich ein weiteres kleines Fragment aus Buxheim (Abb. 4,5) scheint dieser Einordnung entgegen zu stehen, stammt es doch aus einem Befund, der keines der genannten jüngeren Merkmale, dafür aber ver-zierte Schalenfüße enthielt. Die flauere Profilierung einiger Stücke (Abb. 4,1.7.10.11) könnte ein zusätzliches Indiz für eine tendenziell junge Zeitstellung sein und damit auch bei der Datierung unverzierter Schüsseln helfen. Gleiches gilt für gerundete oder verjüngte Randbildungen, die viel-leicht den „klassischen“, schräg nach innen abgestrichenen Rand ablösen. Inwieweit sich hier jedoch wirklich chronologische Entwicklungslinien abzeichnen, oder ob lediglich eine morphologische, möglicherweise auch regional bedingte16 Varianz des Gefäßtyps sichtbar wird, kann nur durch eine
13 Vorbericht: D. Meixner, Ein Erdwerk der jüngeren Münchshöfener Kultur von Berg-heim. Arch. Jahr. Bayern 2001, 20–22.
14 Da die innere Chronologie der Münchshöfener Kultur bislang lediglich in Ansätzen geklärt und gerade in letzter Zeit wieder Gegenstand der Diskussion geworden ist, soll hier auf weitergehende Ausführungen verzichtet werden. Der aktuellste und zuverläs-sigste Stand indet sich bei: K. Böhm, 125 Jahre Münchshöfen. In: K. Schmotz (Hrsg.), Vorträge des 20. Niederbayerischen Archäologentages (Rahden/Westf. 2002) 227–244.
15 L. Süß, Eine jungsteinzeitliche Siedlungsgrube vom Gradhof/Kösching, Lkr. Ingolstadt. Sammelbl. Hist. Ver. Ingolstadt 63, 1954, 3–13, hier 13.
16 Ohne der laufenden Dissertation des Verf. (Arbeitstitel: Das Erdwerk von Buxheim, Lkr. Eichstätt. Studien zur Münchshöfener Kultur im Ingolstädter Becken) allzu sehr vorzu-greifen, scheinen sich die Unterschiede vor allem in der Präsenz/Absenz gewisser Gefäß-formen und Handhabentypen, teilweise auch in der Verzierung, zu manifestieren. Erste Ansätze dazu inden sich bereits bei Süß (Anm. 15). Die von Nadler (Anm. 8) 30 f. unter
48
Vorbehalt postulierte südmittelfränkische Regionalfazies der Münchshöfener Kultur, die nördlich an das hier behandelte Gebiet anschließen würde, kann nicht recht beurteilt werden, solange nicht umfangreichere Fundkomplexe vorliegen.
Abb. 4. Schüsseln mit verziertem Oberteil aus dem nördlichen Oberbayern. 1 Bergheim-Attenfeld, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen (Sammlung Marschalek) – 2 Kösching „Gradhof“, Lkr. Eichstätt – 3 Gaimersheim „Kreppenäcker“, Lkr. Eichstätt – 4 Kösching „InTer-Park“, Lkr. Eichstätt – 5–7 Buxheim „Am Hitzhofener Weg“, Lkr. Eichstätt – 8–9 Manching-Ober-stimm „Auf der Platte“, Lkr. Pfaffenhofen – 10 Neuburg „Donauwörther Straße“, Lkr. Neu-burg-Schrobenhausen – 11 Bergheim „Fuchsberg“, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen. – M 1:4.
49
Gesamtbearbeitung des Münchshöfener Keramikspektrums geklärt werden. Der Verbreitungsschwerpunkt legt die Vermutung nahe, dass die Verzierung von Schüsseloberteilen eine regionaltypische Besonderheit darstellt, was immerhin auch Motive und Anordnung der Verzierung nahe legen, die sicher nicht zum gängigen Münchshöfener Repertoire gehören; doch bedürfte es zur endgültigen Klärung umfassenderer Erhebungen. Als Ausblick sei ange-merkt, dass sich die Münchshöfener Keramik aus dem nördlichen Oberbay-ern auch anderweitig vom südostbayerischen Kerngebiet zu unterscheiden scheint, was u. U. die Abgrenzung einer westlichen Regionalfazies rechtferti-gen könnte17.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die in der beschriebe-nen Art verzierten Schüsseln mit einziehendem Oberteil weit über das Münchshöfener Verbreitungsgebiet hinaus in das benachbarte Kulturmilieu der epirössener Schulterbandgruppen18 streuen, wie etliche Vertreter aus dem oberschwäbischen Aichbühl und ein fast identisches Stück vom Goldberg im Nördlinger Ries belegen (Abb. 5). Die Form der Schüsseln, von denen aus dem genannten Raum übrigens auch unverzierte Exemplare vorliegen, wird von den Bearbeitern eindeutig als „fremd“ und dem Münchshöfener Reper-toire zugehörig angesehen. Während die verzierten Exemplare vermutlich lokale Produkte darstellen, befinden sich unter den unverzierten wohl zum Teil auch echte Importe19. Vor diesem Hintergrund scheint ein Rückblick auf die – wie oben angedeutet „unmünchshöfischen“ – Verzierungen der hier vorgestellten Schüsseln aus dem Ingolstädter Becken notwendig. Parallelen dazu sind zum Teil im Ornamentschatz der Schulterbandgruppen zu finden. Besonders deutlich wird dies am Motiv des ausgesparten Winkelbandes (hier Abb. 4,2.3.9), das allen regionalen Ausprägungen dieses Horizonts gemein-sam ist und sehr häufig auftritt20. Das Blattzweigmotiv der Schüssel aus Bux-heim (Abb. 4,6) findet sich in diversen Varianten vor allem in der Goldberg-Gruppe21, begegnet jedoch auch als isolierte Metope auf einer verzierten Schüssel aus Aichbühl (Abb. 5,3). Ebenso treten dort kreuzschraffierte hän-gende Dreiecke unter dem Rand (vgl. Abb. 4,8 mit Abb. 5,4) und rand- und umbruchbegleitende Bänder (Abb. 5,2.3.5.6) auf. Ein isoliertes Vertikalmo-tiv auf einem Gefäßoberteil, das dem Blattzweigmotiv sehr ähnlich ist, ist
17 A. Zeeb, Die Goldberg-Gruppe im frühen Jungneolithikum Südwestdeutschlands: ein Beitrag zur Keramik der Schulterbandgruppen. Univforsch. Prähist. Arch. 48 (Bonn 1998).
18 Zeeb (Anm. 17) 156 f.; M. Strobel, Die Schussenrieder Siedlung Taubried I (Bad Buchau, Kr. Biberach). Ein Beitrag zu den Siedlungsstrukturen und der Chronologie des frühen und mittleren Jungneolithikums in Oberschwaben (Stuttgart 2000) 334 u. 352.
19 Unter Verzicht auf Einzelbelege sei auf die Zusammenstellung bei Zeeb (Anm. 17) 151 Abb. 85 verwiesen. Vgl. auch Strobel (Anm. 18) 355.
20 Beispiele: Zeeb (Anm. 17) Taf. 1,A1; 44,7; 46,2; 70,5.21 Ebd. Taf. 47,4.
50
auch vom Goldberg bekannt22. Zur Genese der verzierten Schüsseln drängt sich damit folgende, freilich spekulative Schlussfolgerung auf: Die unver-zierte münchshöfen-typische Form wurde von den Schulterbandgruppen
22 Summarische Belege: Zeeb (Anm. 17) 51 Abb. 24 („F 27“); Strobel (Anm. 18) 326; J. Lüning, Eine Siedlung der mittelneolithischen Gruppe Bischheim in Schernau, Ldkr. Kitzingen. Materialh. Bayer. Vorgesch. A44 (Kallmünz/OPf. 1981) Taf. 5,1–3.5.
Abb. 5. Schüsseln mit verziertem Oberteil aus Aichbühl, Gde. Bad Buchau, Lkr. Biberach (1–5) und vom Goldberg, Gde. Goldburghausen, Ostalbkreis (6). – M 1:4.
51
aufgegriffen und – im Gegensatz zur klassischen Münchshöfener Kultur – als Verzierungsträger genutzt. Diese Modifikation wiederum könnte im „Rück-strom“ in das bayerische Donaugebiet gelangt sein, wobei sich die Intensität des Einflusses nach Osten hin immer mehr abschwächte.
Noch engere Beziehungen zu den Schulterbandgruppen offenbaren zwei weitere Gefäßfragmente aus Nassenfels. Die Scherbe Abb. 6,1 stammt wohl von einem Knickwandbecher, wie er in der Goldberg-Gruppe, aber auch in Oberschwaben und im unterfränkischen Schernau vorkommt23. Die umlau-fende Verzierung aus Schräggitter als Hauptmotiv und parallelen Linien als oberem Abschluss auf der Gefäßschulter weist am ehesten in die Goldberg-Gruppe24. Auch das mehr S-förmige Profil der Scherbe Abb. 6,2 ist einem Bechertyp der Schulterbandgruppen zuzuschreiben25. Als Verzierung begeg-net hier wieder das aus schräg schraffierten Dreiecken aufgebaute Winkel-band – in vorliegendem Fall allerdings gekappt und mit mittiger Bandtren-nung –, das bereits oben als zentrales Motiv der Schulterbandgruppen her-ausgestellt wurde. Damit handelt es sich bei beiden Stücken um echte Vertre-ter der Schulterbandgruppen. Da auch die Tonbeschaffenheit nichts mit der Keramik der Münchshöfener Kultur gemein hat, sind sie wohl als Importe anzusehen. Während Importe oder Nachahmungen Münchshöfener Kera-mik im Bereich der Schulterbandgruppen relativ häufig vorkommen und bei-nahe als konstitutives Merkmal dieser keramischen Gruppierungen anzuse-hen sind26, war ein entsprechender „Gegenstrom“ von Keramik der Schulter-bandgruppen in das Münchshöfener Verbreitungsgebiet, der bei wie auch immer gearteten Kontakten eigentlich anzunehmen wäre, bis vor wenigen Jahren unbekannt27. Für das Ingolstädter Becken hat sich dieses Bild inzwi-
23 Zwar indet sich keine exakte Entsprechung, doch ist die Kombination von umlaufenden Linien und einem etwas komplexeren Muster dort geradezu typisch (Zeeb [Anm. 17] 81). Auch treten umlaufende Schräggitter als Hauptmotiv auf (ebd. 91 Abb. 51 [Motiv 136 u. 139]).
24 Vgl. ebd. 51 Abb. 24 („F 72“, bes. „F72-2“).25 Ebd. 156–160; Strobel (Anm. 18) 343 f.26 Zeeb (Anm. 17)163; Strobel (Anm. 18) 356.27 Autopsie der Materialien durch den Verf. im Zuge von Vorarbeiten für seine Dissertation.
Vgl. auch D. Meixner, Zum Übergang vom Mittel- zum Jungneolithikum auf dem Frau-enberg bei Weltenburg, Lkr. Kelheim, und im bayerischen Donauraum (unveröf. Magis-terarb. Univ. Regensburg 1999).
Abb. 6. Nassenfels. Verzierte Becherscherben der Schulterbandgruppen. M 1:3.
52
schen grundlegend geändert. Elemente der Schulterbandgruppen lassen sich dort in etlichen Münchshöfener Fundkomplexen ausmachen28. Dabei kann es sich um wenige Scherben wie in Nassenfels handeln oder um Anklänge in Verzierungsmotiven wie bei den oben behandelten Schüsseln. Der stärkste Einfluss zeigt sich in den Befunden eines Erdwerks mit zugehöriger Siedlung bei Buxheim, Lkr. Eichstätt, am Nordwestrand des Ingolstädter Beckens, wo die Schulterbandkeramik fast die Hälfte des verzierten Materials ausmacht (Abb. 7)29. Allerdings gibt es auch annähernd „reine“ Münchshöfener Inven-tare. Der Gedanke, dass die Schulterbandgruppen eine westliche Ausprägung
28 Vorbericht: K. H. Rieder, Ein Grabenwerk der Münchshöfener Kultur von Buxheim. Arch. Jahr Bayern 1997, 43 f. Die Vorlage von Funden und Befunden dieses Platzes soll den Kern der Dissertation des Verf. bilden.
29 B. Engelhardt, Zwei neue Fundstellen des Jungneolithikums von Teugn, Lkr. Kelheim und Altdorf, Lkr. Landshut. Arch. Jahr Bayern 1980, 62 f.
Abb. 7. Beispiele von Keramik der Schulterbandgruppen aus Buxheim, Lkr. Eichstätt. Ver-schiedene Befunde. – M 1:3.
53
der Münchshöfener Kultur mit geprägt haben, erscheint nicht unzulässig. Weitere Überlegungen zu dem hier skizzierten Phänomen, insbesondere was Art, Ursachen und chronologische Implikationen anbelangt, verbieten sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch, doch wird die im oberbayerischen Donaugebiet zu beobachtende Verzahnung der offensichtlich räumlich und zeitlich sehr zersplitterten epirössener Gruppierungen im Westen mit der „monolithischen“ Münchshöfener Kultur im Osten künftig sicher einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des frühen Jungneolithikums leisten.
Die bisher betrachteten Funde aus Nassenfels entstammen einem chrono-logischen Horizont, der um 4300/4200 v. Chr. anzusetzen sein dürfte. Ten-denziell jünger sind drei weitere Scherben, die es im Folgenden zu behandeln gilt. Zwei der Stücke (Abb. 8,2.3) zeigen eine leistenartige, mit Fingertupfen angedrückte Verstärkung des Randbereiches sowie schlickgeraute Ober-flächen. Diese keramischen Merkmale weisen in einen Horizont des Jung-neolithikums, der in Bayern vor allem mit der Altheimer Kultur des 4. Jahr-tausends v. Chr. gleichzusetzen ist. In dieser Kultur ohne Parallelen ist eine dritte Randscherbe (Abb. 8,1), die unter dem Rand eine Reihe von außen angebrachter Einstiche aufweist. Diese Einstiche wurden offenbar bewusst so kräftig ausgeführt, dass sich auf der Innenseite des Randes flache, linsenartige Buckel bildeten. In Bayern konnte Derartiges bislang nur an einem koni-schen Napf aus Altdorf, Lkr. Landshut, beobachtet werden, der – auch aus-weislich der Beifunde – der Michelsberger Kultur zuzuweisen ist30. Knapp außerhalb Bayerns stellt den nächsten Fundpunkt einer hohlbuckelverzierten Randscherbe im Westen (wie könnte es anders sein?) der auch durch Träger der Michelsberger Kultur besiedelte Goldberg im Nördlinger Ries dar31. Die
30 Unveröfentlicht; freundl. mündl. Mitteilung A. Zeeb-Lanz.31 Die einzigen Belege im Michelsberger Hauptverbreitungsgebiet bilden zwei kalottenför-
mige Schüsseln aus dem belgischen Spiennes: J. Lüning, Die Michelsberger Kultur. Ihre Funde in zeitlicher und räumlicher Gliederung. Ber. RGK 48, 1967, 1 f. hier: 193 f.
Abb. 8. Nassenfels. Keramik der Michelsberger Kultur. – M 1:3.
54
einzigen Entsprechungen für diese ungewöhnliche Verzierungstechnik fin-den sich in der Tat im nördlich und westlich angrenzenden Gebiet, im Bereich der sehr weiträumig vom Pariser Becken bis nach Hessen verbreiteten Michelsberger Kultur. Zwar nicht zum geläufigen Michelsberger Verzierungs-spektrum gehörig, treten „Lochbuckel“ dort ab der Stufe MK III auf32, schei-nen aber ihren Schwerpunkt in der Spät- und Endphase dieser Kultur (MK IV–V) zu besitzen, wie Vergleichsstücke von der spätmichelsberger Höhensiedlung Echzell-Wannkopf in der hessischen Wetterau nahe legen33. Auf dem Wannkopf wird die auch für Michelsberg ungewöhnliche Verzie-rungstechnik als Beeinflussung aus dem mitteldeutschen Trichterbecherkreis gewertet34. Zu einer anderen Auffasung kommen U. Seidel und Chr. Jeu-nesse, die die Lochbuckel – ihre Belege sind allerdings in den meisten Fällen von außen wieder verschlossen – bis in das französische Alt-und Mittelneo-lithikum zurückverfolgen, den Schwerpunkt im Bereich der Gruppe Bisch-heim und der beginnenden Michelsberger Kultur ausmachen und die Aus-breitung der Ziertechnik nach Norden und Osten mit der Expansion der Michelsberger Kultur in Verbindung bringen35. Ohne zu diesen Fragen bei-tragen zu können, bietet die Randscherbe aus Nassenfels immerhin einen weiteren Datierungshinweis: Da die Innenseite gerade noch den Ansatz eines Knicks erkennen lässt, ist das Gefäß wohl als Knickwandschüssel zu ergän-zen, die in dieser Form erst ab MK IV auftritt36. Vor diesem Hintergrund sind die beiden zuvor genannten Stücke mit arkadenleistenartigen Randbil-dungen noch einmal näherer Betrachtung zu unterziehen. Lassen sich die Formen, die wohl zu großen, eimerartigen Vorratsgefäßen gehören, noch einigermaßen im Spektrum der Altheimer Kultur unterbringen, fällt doch die für Altheim untypische Tonbeschaffenheit und vor allem die große Härte der Scherben auf37. Ein weiteres Detail lässt an dem fremdartigen Charakter der Fundstücke keinen Zweifel mehr: Das Fragment Abb. 8,2 besitzt unter der randlichen Tupfenleiste in vermutlich regelmäßigen Abständen extrem tief eingestochene, rundliche Löcher. Die Inspektion der Innenseite zeigt, dass die Gefäßwandung tatsächlich durchstoßen, jedoch durch Verstreichen nachträglich wieder verschlossen wurde. Große, sehr tiefe Einstiche unter
Kat.-Nr. 7 und Taf. 3,1.7. Der Fund von Altdorf (Engelhardt Anm. 29) könnte sogar noch etwas früher datieren, doch ist dies anhand der Fundvorlage schwer zu entscheiden.
32 B. Höhn, Die Michelsberger Kultur in der Wetterau. Univforsch. Prähist. Arch. 87 (Bonn 2000) 110 f. und Taf. 17,3; 28,5.7.
33 Ebd.34 U. Seidel/Chr. Jeunesse, À prpops d’un tesson du Neolithique récent de la vallèe du
Neckar. La technique du bouton au repoussé et la question de la difusion du Michels-berg. Bull. Soc. Prehist. Franç. 97/2, 2000, 229–237.
35 Vgl. Höhn (Anm. 32) 174 Abb. 165 (Schüsselform „KW 3“).36 Z.B. ebd. Taf. 27,7–9.37 Zur absoluten Chronologie: ebd. 190–194.
55
dem Rand und auf dem Umbruch sind in der Spätphase der Michelsberger Kultur durchaus bekannt38, allerdings m. W. bislang nie an Vorratsgefäßen und in Kombination mit einer Tupfenleiste belegt.
Die Michelsberger Scherben von Nassenfels datieren also frühestens um 4200/4000 v. Chr., wahrscheinlicher aber um 3800/3600 v. Chr.39. Der selbst für Michelsberger Verhältnisse exotische Charakter dieses Ensembles macht die Deutung und Einordnung schwierig. Michelsberger Keramik ist bereits seit längerem aus dem bayerischen Donaugebiet und aus Südbayern bekannt; die Zahl der Fundpunkte, die vermutlich um etliche unerkannte Komplexe zu erweitern wäre, ist inzwischen so hoch – zudem liegen etliche unvermischte Inventare vor –, dass ein Import von Einzelstücken nicht mehr in Erwägung gezogen werden kann, sondern von dem Einsickern kleiner Bevölkerungsgrup-pen ausgegangen wird40. Das Verhältnis dieser Migranten zur autochthonen Altheimer Bevölkerung ist allerdings noch weitgehend unklar41.
Aufgrund seiner Grenzlage am Rande des südbayerischen Kulturraumes ent-sprechen Michelsberger Funde im Ingolstädter Becken durchaus der Erwar-tung, waren aber bislang unbekannt. Mit den 20 Jahre alten Funden von Nas-senfels, die um Neufunde aus dem ca. 30 km östlich gelegenen Kösching42 zu ergänzen sind, beginnt sich somit eine Forschungslücke zu schließen.
Mit den vorgestellten Funden werden ausschnittartig Austauschprozesse und erhöhte Mobilität von Personengruppen deutlich, Phänomene, die zu den strukturellen Merkmalen des Jungneolithikums zählen und die im hier behandelten Raum offenbar besonders deutlichen Niederschlag gefunden haben. Die Faktoren, die das Ingolstädter Becken zur Kontakt- und Aus-tauschzone machen, sind vielfältig: Neben der angesprochenen Grenzlage und der Anbindung an überregionale Verkehrswege ist sicherlich auch der Reichtum an Silexlagerstätten43 von besonderer Bedeutung.
38 I. Matuschik, Sengkofen – „Pfatterbreite“, eine Fundstelle der Michelsberger Kultur im Bayerischen Donautal und die Michelsberger Kultur im östlichen Alpenvorland. Bayer. Vorgeschbl. 57, 1992, 1–31.
39 Vgl. ebd.40 Veröfentlichung durch Verf. geplant. Vorbericht zur Fundstelle: G. J. Macher, Ein Sied-
lungsareal mit endneolithischem Erdwerk in Kösching. Arch. Jahr Bayern 2001, 33–35.41 Vgl. J. Weinig, Älter- und mittelneolithische Siedlungen im Ingolstädter Becken: Eine
Untersuchung von Silexkomplexen im rohstofnahen Bereich unter Einbezug demogra-phischer Aspekte (Diss. Univ. Tübingen 1993); ders. Silexrohmaterialien des Ingolstädter Beckens im Alt- und Mittelneolithikum. In: I. Campen/H. Hahn/M. Uerpmann (Hrsg.), Spuren der Jagd – Die Jagd nach Spuren. Festschrift H.-J. Müller-Beck. Tübinger Monogr. Urgesch. 11 (Tübingen 1996) 389 f.
42 Vgl. Süß (Anm. 7) Taf. 9,12,13 mit M. Bankus/O. Neller, Pech gehabt – Älterbronzezeit-liches Handwerk in einer ländlichen Siedlung bei Alpersdorf, Gde. Mauern. Arch. Land-kreis Freising 8, 2002, 67–102, Abb. 18,1.3 und Abb. 16.
43 Lt. Auskunft von Dr. U. Seidel (Konstanz), die die Stücke freundlicherweise begutachtet hat, entsprechen die herstellungstechnischen Merkmale, anders als bei dem Lochbuckel-
56
Fundkatalog Nassenfels:
- Randscherbe einer Schüssel mit einziehender Mündung; Rdm. 20 cm, Handhabe abge-platzt; Oberflächen nicht erhalten; je nach Abrasion dunkel-/mittelgrauer Ton, Mantel rotbraun, Kern hellgrau, stark glimmerhaltig; Rand fein gekerbt; direkt unter dem Rand umlaufende sichelförmige Eindrücke; Umbruch kräftig gekerbt, darüber sichelförmige Eindrücke wie unter dem Rand, jedoch etwas kräftiger ausgeprägt (Abb. 3).
- Wandscherbe eines Knickwandbechers; Oberflächen nicht erhalten; Ton außen dunkel-grau, innen hellgrau, im Kern dunkelgrau; kräftige Magerung mit Feinsand, feiner Scha-motte; Ton schwach glimmerhaltig; auf der Schulter umlaufendes Band aus mindestens sieben horizontalen Furchenstichlinien, darunter zweizeiliges Schräggitter (Abb. 6,2).
- Wandscherbe eines Bechers mit S-Profil; Oberflächen nicht erhalten; Ton dunkelgrau, mittlere Magerung mit Feinsand und Glimmer; auf der Schulter umlaufendes Band aus drei kräftigen Furchenstichlinien (gerundete Einstiche), darunter – bis unter den Umbruch – ausgespartes Winkelband aus schräg schraffierten stehenden und hängenden Dreiecken, Winkelbandtrennung in Form einer mittigen Furchenstichlinie; mindestens zwei horizon-tale Furchenstichlinien als unterer Abschluss (Abb. 6,1).
- Randscherbe einer Knickwandschüssel; Rdm. 20 cm; Oberflächen nicht erhalten; Ton mit-telgrau, im Kern dunkelgrau; mittlere Magerung mit Feinsand, Glimmer und Schamotte; unter dem Rand außen rundliche Einstiche von ca. 3,5 mm Durchmesser, die auf der Innenseite des Gefäßes kleine Tonbuckel modellieren (Abb. 8,1).
- Randscherbe eines Großgefäßes; Ton rotbraun-dunkelgrau, im Kern dunkelgrau; kräftige Magerung mit Grobsand und Schamotte; außen Schlickrauung, innen verstrichen; Rand-leiste mit Fingertupfen, darunter sehr tiefe Einstiche von 6 mm Dm., die ursprünglich die Wandung durchstießen, jedoch nachträglich von innen durch Verstreichen wieder ver-schlossen wurden (Abb. 8,2).
- Randscherbe eines Großgefäßes; Ton außen dunkelgrau, innen rotbraun–dunkelgrau, im Kern dunkelgrau; kräftige Magerung mit Schamotte, Grobsand und Feinkies; außen Schlickrauung, innen verstrichen; Randleiste mit sehr groben und unregelmäßigen Finger-tupfen (Abb. 8,3).
rand Abb. 8,1, nicht dem typischen Michelsberger Erscheinungsbild, was auf lokale Pro-duktion hinweisen könnte.