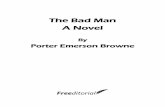Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg
Christine Steiner, Friedrich Hauss, Sabine Böttcher, Burkart Lutz
Evaluation des Projektes Bürgerarbeit im 1. Flächenversuch in der
Stadt Bad Schmiedeberg
Forschungsberichte aus dem zsh 08-1
2
Das Projekt wurde gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit und das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds.
Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autor/innen.
Zentrum für Sozialforschung Halle e. V. an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Emil-Abderhalden-Str. 6 06108 Halle Telefon: 0345 / 552 66 00 Fax: 0345 / 552 66 01 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.zsh-online.de Druck: Druckerei der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Satz: Ingo Wiekert ISSN 1617-299X Alle Rechte vorbehalten
3
Inhaltsverzeichnis
VORWORT .............................................................................................................................................................9
1 DAS PROJEKT BÜRGERARBEIT IN BAD SCHMIEDEBERG...............................................................11
1.1 Ziele des Projektes und der Evaluation ...................................................................................................11
1.2 Aufgabe und Arbeitsschritte der Evaluation ...........................................................................................12
1.3 Die Gliederung des Berichtes..................................................................................................................12
2 IMPLEMENTIERUNG DES MODELLVERSUCHES...............................................................................15
2.1 Beteiligte Akteure und Verfahrensweisen...............................................................................................15
2.1.1 Kooperationsbedingungen...........................................................................................................16
2.1.2 Konkrete Ausgestaltung der Kooperationsstrukturen..................................................................17
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................19
2.2 Die Bürgerarbeitsstellen..........................................................................................................................19
2.2.1 Die Anzahl der Bürgerarbeitsstellen............................................................................................19
2.2.2 Einsatzstellen und Tätigkeitsfelder..............................................................................................20
2.3 Zur Auswahl von Bürgerarbeitern...........................................................................................................22
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................27
2.4 Vom Kandidaten zum Bürgerarbeiter .....................................................................................................27
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................32
3 BÜRGERARBEIT AUS SICHT DER BÜRGERARBEITER.....................................................................33
3.1 Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen der Bürgerarbeiter............................................................33
3.1.1 Zusammenarbeit mit Kollegen ....................................................................................................33
3.1.2 Das Betriebsklima........................................................................................................................33
3.1.3 Arbeitszeit....................................................................................................................................34
3.1.4 Qualifikationsanforderungen und Humankapitaleinsatz..............................................................34
3.1.5 Weiterbildung und Wissenserweiterung......................................................................................35
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................37
3.2 Die Bewertung ihrer Arbeit durch die Bürgerarbeiter.............................................................................38
3.2.1 Der Nutzen für die Bürgerarbeiter ...............................................................................................38
3.2.2 Einschätzung der Belastungen und Anforderungen im Allgemeinen..........................................40
3.2.3 Gesundheitliche und arbeitsorganisatorische Belastungen..........................................................41
3.2.4 Anforderungen an körperliche Leistungsfähigkeit und soziale Kompetenz................................42
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................44
3.2.5 Zufriedenheit mit der Tätigkeit....................................................................................................45
3.2.6 Bewertung des Nettohaushaltseinkommens................................................................................46
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................48
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
4
3.3 Arbeitssuche und Chancen auf dem Arbeitsmarkt ..................................................................................48
3.3.1 Häufigkeit der Stellensuche.........................................................................................................48
3.3.2 Regionale Begrenzung der Stellensuche und Suchwege.............................................................48
3.3.3 Welche Arbeit suchen Bürgerarbeiter?........................................................................................50
3.3.4 Die Arbeitsmarktchancen der Bürgerarbeiter ..............................................................................50
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................52
4 BÜRGERARBEIT AUS SICHT DER EINSATZSTELLEN, DER TRÄGER UND VON
VERTRETERN DER STADT BAD SCHMIEDEBERG.............................................................................53
4.1 Die zweimalige Befragung der institutionellen Akteure .............................................................................53
4.1.1 Die erste Befragung im Frühjahr 2007........................................................................................53
4.1.2 Die zweite Befragung im Winter 2007/2008...............................................................................54
4.2 Aufwand und Nutzen von Bürgerarbeit ..................................................................................................54
4.2.1 Der mit Bürgerarbeit verbundene Aufwand ................................................................................54
4.2.2 Der Nutzen von Bürgerarbeit.......................................................................................................55
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................57
4.3 Kosten und Probleme durch Bürgerarbeit ...............................................................................................57
4.3.1 Unerwartete Kosten.....................................................................................................................57
4.3.2 Schwierigkeiten durch die Begrenztheit der erlaubten Tätigkeitsbereiche..................................58
4.3.3 Das Risiko der Verdrängung von Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt ..........................58
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................60
4.4 Wirkungen von Bürgerarbeit aus Sicht der institutionellen Akteure.......................................................60
4.5 Die Projektmanagementgruppe...............................................................................................................62
4.5.1 Aufgaben des Projektmanagements.............................................................................................62
4.5.2 Zunehmende Differenzen ............................................................................................................62
4.5.3 Einschätzungen im Rückblick nach Auflösung der Projektmanagementgruppe.........................63
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................64
5 MÖGLICHE UMVERTEILUNGSEFFEKTE DURCH DEN AUSWAHLPROZESS................................65
5.1 Grundlagen und Methoden der Berechnung............................................................................................65
5.2 Das Umverteilungsmodell .......................................................................................................................66
5.2.1 Einsparpotenziale.........................................................................................................................66
5.2.2 Mehrausgaben: Die Geldströme zur Bürgerarbeit (alle Kostenträger) ........................................68
5.3 Umverteilungsprozesse...........................................................................................................................69
5.4 Bilanz 71
5.5 Die Nachhaltigkeit der Vermittlungsergebnisse......................................................................................74
Zwischenbilanz .............................................................................................................................................77
6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK ...............................................................................................79
Vorbemerkungen...............................................................................................................................................79
Inhalt
5
6.1 Die wichtigsten Ergebnisse.....................................................................................................................80
These 1: .....................................................................................................................................................80
These 2: .....................................................................................................................................................81
These 3: .....................................................................................................................................................82
These 4 .....................................................................................................................................................83
6.2 Empfehlungen .........................................................................................................................................85
6.2.1 Stabile Rahmenbedingungen als unverzichtbare Voraussetzung flexiblen Handelns..................85
6.2.2 Aufgaben eines umfassenden Initiierungs- und Steuerungskonzeptes........................................86
6.2.3 Sicherstellung ausreichender Kampagnen-, Projekt- und Verhandlungsfähigkeit.......................87
6.3 Offene Fragen..........................................................................................................................................87
6.3.1 Welche Bedeutung haben die lokalen Bedingungen?..................................................................88
6.3.2 Wieweit sind die Bad Schmiedeberger Verfahren zur Gewinnung von Bürgerarbeitsplätzen übertragbar?.................................................................................................................................89
6.3.3 Wie könnte ein schrittweiser Übergang zu längerdauerndem „Normalbetrieb“ gewährleistet werden?........................................................................................................................................90
ANHANG A: DURCHGEFÜHRTE ERHEBUNGEN UND DATENBESTÄNDE.............................................93
1 Die Implementations- und beginnende Etablierungsphase......................................................................93
2. Die Schlussphase.....................................................................................................................................96
ANHANG B: TABELLARISCHER GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN ERHEBUNGSZEITRAUM..........101
ANHANG C: ENTWICKLUNG DER PASSIVEN LEISTUNGEN FÜR DEN RECHTSKREIS SGB II IM
VERGLEICH ...............................................................................................................................103
7
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Regulierung der Bürgerarbeit....................................................................................................15
Abbildung 2: Einsatzstellentypen nach realisiertem Stellenumfang (alle zum Befragungszeitpunkt in Bürgerarbeit Tätigen, März/April 2007, N = 105).....................................................................20
Abbildung 3: Tätigkeitsspektrum der Einsatzstellen (nur befragte Bürgerarbeiter, März/April 2007, N = 97) .........................................................................................................22
Abbildung 4: Wege, auf denen Kandidaten erstmals von Bürgerarbeit erfuhren (einschließlich nicht mehr in Bürgerarbeit befindlicher Personen; März/April 2007, N = 104, in Prozent) .....29
Abbildung 5: Motive für die Aufnahme der Bürgerarbeitstätigkeit (Mehrfachnennungen möglich; März/April 2007, N = 97) .........................................................................................................30
Abbildung 6: Geschlechtsspezifische Zusammensetzung in Tätigkeitsfeldern (März/April 2007, N = 97) ........................................................................................................31
Abbildung 7: Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten und Betriebsklima (N = 97/91)...............................34
Abbildung 8: Einsatz und Erwerb von Kenntnissen durch Bürgerarbeit (N =97/91)......................................37
Abbildung 9: Bedeutung der Bürgerarbeit für die Bürgerarbeiter (N =91).....................................................39
Abbildung 10: Zufriedenheitsindikatoren (N =97/91).......................................................................................40
Abbildung 11: Anforderungen und Belastungen durch Bürgerarbeit (N =97/91).............................................41
Abbildung 12: Arbeitsorganisatorische und gesundheitliche Belastungen der Bürgerarbeiter nach Typ der Einsatzstelle (N =97/91)............................................................................................................42
Abbildung 13: Körperliche und soziale Anforderungen an die Bürgerarbeiter (N =97/91)..............................44
Abbildung 14: Veränderung des Haushaltsnettoeinkommens durch Bürgerarbeit (N =97, in Prozent, März/April 2007) ......................................................................................................................47
Abbildung 15: Region der Stellensuche (in Prozent, N =97/91) .......................................................................49
Abbildung 16: Suchwege nach einem Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt (Mehrfachnennungen, N =97/91) ..................................................................................................................................50
Abbildung 17: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den nächsten 12 Monaten eine neue Stelle finden? (N =97/91).................................................................................................................................51
Abbildung 18: Formen des Nutzens für die Einsatzstellen (Anzahl offener Nennungen, Mehrfachnennungen, November 2007, N =22).........................................................................56
Abbildung 19: Kosten für die Einsatzstelle (November 2007, N =22) .............................................................58
Abbildung 20: Gewinne für die Bürgerarbeiter (Anzahl offener Nennungen, Mehrfachnennungen, November 2007,N =22).............................................................................................................61
Abbildung 21: Statusveränderungen nach dem Auswahlprozess (Angaben in Prozent, N = 455)...................67
Abbildung 22: Mehr- und Minderausgaben pro Fall und Monat nach dem Auswahlprozess...........................68
Abbildung 23: Geldströme zum Projekt (je Fall/Monat)...................................................................................69
Abbildung 24: Leistungsbezüge vor und nach dem Auswahlprozess...............................................................70
Abbildung 25: Leistungsbezüge vor und nach dem Auswahlprozess nach Lebensalter ...................................71
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
8
Tabelle 1: Merkmale der in den Auswahlprozess einbezogenen Personen (N = 455, in Prozent) ............24
Tabelle 2: (Statistische) Chance für den Eintritt in ein Bürgerarbeitsverhältnis (alle einbezogenen Arbeitslosen, N = 455, Odds Ratio) ..........................................................................................26
Tabelle 3: Vermittelte und nicht vermittelte Kandidaten(alle Personen, die ein Bürgerarbeitsangebot erhielten, N = 126)......................................................................................................................28
Tabelle 4: Verteilung der Bürgerarbeiter über die Einsatzstellen (März/April 2007, N = 97)....................31
Tabelle 5: Volumina der Mehrausgaben und Einspareffekte (alle Fälle, gesamter Zeitraum, Bad Schmiedeberg)....................................................................................................................72
Tabelle 6: Volumina der Mehrausgaben und Einspareffekte (nur Bestandsfälle im „Kampagnen-Zeitraum“) (Bad Schmiedeberg) ...............................................................................................72
Tabelle 7: Vergleich der passiven Leistungen für den Rechtskreis SGB II; Kommune Bad Schmiedeberg, Landkreis Wittenberg, Land Sachsen-Anhalt zwischen November 2006 und September 2007.........................................................................................................73
Tabelle 8: Statusentwicklung nach dem Auswahlprozess..........................................................................75
Tabelle I: Realisierter Befragungsumfang.................................................................................................94
Tabelle II: Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der realisierten Befragung.................................95
Tabelle III: Realisierter Befragungsumfang der zweiten Erhebungsphase ..................................................97
Tabelle IV: Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der realisierten Befragung.................................98
9
VORWORT
Im Herbst 2006 beschlossen die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen und die Landesregierung Sachsen-Anhalt in Bad Schmiedeberg ein Pilotvorhaben „Bürgerarbeit“ zu initiieren. Das Zentrum für Sozialforschung Halle, ein Institut an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wurde mit der Evaluation des Vorhabens beauftragt.
Der vorgelegte Bericht liefert einen Überblick über die Implementation, die Etablierung und einen Teil der Schlussphase des Vorhabens „Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg“ mit einem Beobachtungszeitraum von September 2006 bis Februar 2008.
Das Ziel der am Projekt beteiligten institutionellen Akteure, Langzeitarbeitslosen durch eine Tätigkeit im gemeinnützigen Sektor wieder Hoffnung zu geben und ihr Selbstvertrauen zu stärken, war anspruchsvoll. Es erforderte, wie die Ergebnisse der Evaluation zeigen, einen erheblichen und vor allem einen kontinuierlichen organisatorischen Aufwand.
Angesichts der sehr hohen Zufriedenheit aller Beteiligten hat sich dieser Aufwand ohne Zweifel gelohnt:
Die Bürgerarbeiter gewannen nachweislich an Selbstbewusstsein, fühlten sich wichtig und gebraucht. Bei ihrer zweimaligen Befragung zeigten sich erstaunlich hohe Werte von Arbeitszufriedenheit und allgemeiner Lebenszufriedenheit.
Die Träger, die Stadt und die Einsatzstellen berichteten von einem hohen zusätzlichen Nutzen, den sie aus Bürgerarbeit ziehen konnten, was nicht ausschließt, dass in einigen Einsatzstellen auch unerwartete Kosten entstanden. Bürgerarbeit befähigte vor allem die am Vorhaben beteiligten Vereine und Sozialbetriebe, zusätzliche Leistungen anzubieten, die Attraktivität ihrer Angebote zu erhöhen und die Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen zu entlasten. Bürgerarbeit hatte und hat nachhaltig positive Wirkungen in Bad Schmiedeberg sowohl für das öffentliche Leben der Kommune als auch das für Leben der Bürgerarbeiter.
Die wichtigste Grundlage für diesen Erfolg von Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg bildete vor allem die Bereitschaft aller institutionellen Akteure, miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren und dabei neue, durchaus auch unübliche Wege zu beschreiten. Den dazu notwendigen Erstimpuls gab eine von Arbeitsagentur und ARGE geplante und angestoßene Kampagne, aus der sich nunmehr ein Prozess entwickeln sollte, der zwar weiterhin der Steuerung bedarf, aber in einem stabilen Rahmen zunehmend selbständig verlaufen sollte und könnte. Zugleich war es dank der breiten Beteiligung vieler Akteure möglich, die lokalen Bedingungen, die Wirtschaftsstruktur, die wirtschaftliche Lage, die Situation auf dem ersten Arbeitsmarkt sowie die Qualifikationsstruktur und andere sozialdemografische Merkmale der Bürgerarbeiter bei der Planung, Durchführung und Steuerung des Projektes zu berücksichti-gen. Dies erwies sich vor allem bei der Gewinnung zusätzlicher, marktferner Arbeitsplätze für Bürgerarbeiter als ausgesprochen wertvoll.
11
1 DAS PROJEKT BÜRGERARBEIT IN BAD SCHMIEDEBERG
1.1 Ziele des Projektes und der Evaluation
Der im Jahre 2006 initiierte erste Flächenversuch des Projektes Bürgerarbeit geht auf ein von der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit und der Landesregierung Sachsen-Anhalt entwickeltes Konzept zurück. Die Initiatoren gehen davon aus, dass selbst bei einer günstigen konjunkturellen Entwicklung „eine große Zahl an Arbeitssuchenden nicht mehr in den Arbeitsmarkt einmünden wird." Mit dem Konzept Bürgerarbeit wird ein neuer Weg der Sozial- und Arbeitsintegration erprobt, von dem insbesondere Menschen profitieren sollen, die bisher auf dem Arbeitsmarkt chancenlos waren (ebd.).
Mit Bürgerarbeit wird gleichzeitig eine Vielzahl von Zielen verfolgt. Neben dem Nachweis, dass entsprechende Stellen im sogenannten Dritten Sektor bzw. im Non-Profit-Bereich in ausreichendem Maß akquiriert werden können, soll Bürgerarbeit zunächst einmal der sozialen Stabilisierung und der (Wieder-)Heranführung Langzeitarbeitsloser an den Arbeitsmarkt dienen. Letzteres Ziel teilt das Projekt Bürgerarbeit mit anderen Instrumenten der aktuellen aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie etwa den „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwands-entschädigung“ („Ein-Euro-Jobs"). Gleiches gilt für die erhoffte Missbrauchsbekämpfung: Auch Bürgerarbeit soll als Test für die Arbeitsbereitschaft von Leistungsempfängern und als ein Mittel der Bekämpfung von Schwarzarbeit eingesetzt werden. Die Arbeitslosen durchlaufen zu diesem Zweck ein intensives vierstufiges Vermittlungs- und Auswahlverfah-ren. Erst wenn geförderte und ungeförderte Maßnahmen nicht zum gewünschten Ziel führen, wird – als vierte Stufe - Bürgerarbeit angeboten.
Bürgerarbeit unterscheidet sich jedoch von anderen geförderten Arbeitsverhältnissen bzw. Beschäftigungsgelegenheiten vor allem durch die angestrebte Form der Finanzierung. Gemäß der Maxime der Initiatoren, „Arbeit statt Arbeitslosigkeit" zu finanzieren, erhalten Bürger-arbeiter eine Entgeltpauschale, die in Abhängigkeit von den Qualifikationsanforderungen der Bürgerarbeitsstelle für eine wöchentliche Arbeitszeit von 30 Stunden zwischen 675 und 975 Euro Bruttoverdienst im Monat liegt.
Die Finanzierung soll durch eine – aufgrund der geltenden gesetzlichen Regelungen im Regelfall nicht möglichen – Kombination von sogenannten „aktiven“ und „passiven“ Mittel erfolgen, d.h. aus den Mitteln der aktiven Arbeitsförderung und den Mitteln zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Arbeitslosen. Ein wichtiges Ziel des Projektes Bürgerarbeit und damit auch des ersten Flächenversuches in Bad Schmiedeberg ist der Nachweis, dass das Projekt durch eine solche Mittelkombination sowie Einsparungen beim Vermittlungs- und Auswahl-prozess kostenneutral zu finanzieren ist.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
12
Für Bürgerarbeit gilt, wie für alle geförderten Beschäftigungen, das Gebot der Zusätzlichkeit. Substitutions-, Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte sollen durch eine Reihe von Steuerungs- und Kontrollmechanismen weitgehend ausgeschlossen werden.
1.2 Aufgabe und Arbeitsschr itte der Evaluation
Im Februar 2007 wurde das Zentrum für Sozialforschung Halle e.V. (zsh) durch die Bundes-agentur für Arbeit und das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt mit der Evaluation des Projektes Bürgerarbeit im ersten Flächenversuch beauftragt. Da dieses Pilotprojekt in Bad Schmiedeberg zunächst bis zum 31. Dezember 2007 befristet war, erfolgte diese Evaluation weitgehend prozessbegleitend.
Der Evaluation waren zwei Aufgaben gestellt:
• Zum einen sollte die Funktionsfähigkeit und der entsprechende Nutzen für die am Versuch Beteiligten untersucht werden.
• Zum anderen sollte die finanzielle Effizienz des Projektes Bürgerarbeit, insbesondere das Ziel der Kostenneutralität, geprüft werden.
Zur Lösung dieser beiden Aufgaben wurden im Verlaufe der Evaluation der Aufbau und die Funktions- und Wirkungsweise des Flächenversuches auf der Mikro-, Meso- und Makroebene untersucht.
Auf der Mikroebene interessierten in erster Linie die mit der Durchführung der Bürgerarbeit verbundenen Wirkungen auf die Beschäftigten und die Unternehmen bzw. Organisationen.
Auf der Mesoebene standen im Mittelpunkt der Untersuchungen die Art und Weise der Zusammenarbeit der beteiligten institutionellen Akteure und die daraus resultierenden Wirkungen auf die Kommune bzw. das kommunale Umfeld.
Auf der Makroebene war neben der Frage der Finanzierbarkeit zu klären, ob und, wenn ja, welche Voraussetzungen, Umsetzungsprozesse und Ergebnisse des Modellversuches verall-gemeinert werden können und welche Konsequenzen damit aller Voraussicht nach verbunden sind.
Zur Beschaffung der für die Untersuchungen erforderlichen Informationen wurden vom zsh in Absprache mit den Auftraggebern verschiedene Methoden genutzt und Verfahren eingesetzt. Darüber hinaus wurden die prozessgenerierten Daten der Bundesagentur für Arbeit für Analysen herangezogen.
Ein Überblick über die erhobenen Datenbestände sowie die zum Einsatz kommenden Methoden und Verfahren kann dem Anhang entnommen werden.
1.3 Die Gliederung des Ber ichtes
Im Mittelpunkt des vorliegenden Endberichtes stehen die Implementierungs- und die Stabili-sierungsphase des Projektes und die damit verbundenen Evaluationsphasen von „Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg“ .
Das Projekt Bürgerarbeit
13
Im Kapitel 2 werden die beteiligten institutionellen Akteure, ihre Aufgaben und Ziele sowie ihre geplanten Kooperationsbeziehungen vorgestellt. Dabei wird sowohl auf die damit verbundenen Anforderungen als auch auf ihre Aushandlungsprozesse eingegangen. Daneben wird der Prozess der Akquise und Ausgestaltung der Bürgerarbeitsplätze in den Einsatzstelen als auch der Prozess der Auswahl der Bürgerarbeiter ausführlich dargestellt. Auch die sozialdemografischen Merkmale der (potenziellen) Bürgerarbeiter, deren Motive für die Aufnahme einer Bürgerarbeitstätigkeit und ihre Einsatzfelder sind von besonderem Interesse.
Die Sicht der Bürgerarbeiter selbst bildet den Mittelpunkt von Kapitel 3. Im ersten Abschnitt werden dazu die Aussagen der Bürgerarbeiter zu ihren Arbeitsverhältnissen allgemein, zur Qualität ihrer Beziehungen zu den Kollegen sowie zu den mit der Tätigkeit verbundenen Anforderungen an Qualifikationen und möglichen Wissenserweiterungen im Vergleich der beiden Befragungszeitpunkte (März/April und November 2007) dargestellt. Auf die Bewertung ihrer Arbeit wird im zweiten Abschnitt näher eingegangen. Hier werden die persönlichen Nutzenseinschätzungen, die Bewertung der mit Bürgerarbeit verbundenen Belastungen und Anforderungen, die Zufriedenheitswerte als auch die Beurteilungen der Einkommenssituation beschrieben. Der dritte und letzte Abschnitt befasst sich mit der Suche der Bürgerarbeiter nach einem Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt und einer persönlichen Einschätzung ihrer Chancen, einen solchen zu finden.
Im Kapitel 4 wird – in Anlehnung an Kapitel 3 – auf die Sicht der Einsatzstellen, der Träger und der Vertreter der Stadt Bad Schmiedeberg näher eingegangen. Hierbei sind vor allem die Bewertung des Verhältnisses von Aufwand und Nutzen, eine Analyse der entstandenen Kosten und Probleme sowie eine Einschätzung der Wirkungen von Bürgerarbeit auf die Bürgerarbeiter selbst von besonderem Interesse.
Schließlich werden hier auch die Rolle des Projektmanagements, seine Aufgaben und Ziele sowie die im Projektverlauf aufgetretenen und zunehmenden Differenzen beschrieben. Eine rückblickende Einschätzung nach der Auflösung des Projektmanagements komplementiert die Sicht der institutionellen Akteure.
Auf die Kosten- und Leistungsströme, welche u. a. die Grundlage für die Finanzierung des Projektes Bürgerarbeit bildeten, wird in Kapitel 5 näher eingegangen. Es werden einerseits die Einsparpotenziale dargestellt, die sich aus den Statusveränderungen der Arbeitslosen im Rahmen des Umverteilungsprozesses ergeben und andererseits wird näher auf die Nachhaltig-keit dieser Vermittlungsergebnisse eingegangen.
Kapitel 6 bietet zum Einen einen zusammenfassenden Blick auf die wichtigsten Ergebnisse des Projektes „Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg“ und richtet zum anderen seinen Blick auf zukünftige Bürgerarbeitsprojekte und zeigt auf, welche Ergebnisse und Erfahrungen aus dem hier dargestellten Projekt übertragbar und nutzbar sind. Danben wird auch kurz auf die Fragen eingegangen, die sich im Rahmen der Evaluation des Projektes ergaben und auf die bisher keine abschließenden Antworten gefunden werden konnten.
15
2 IMPLEMENTIERUNG DES MODELLVERSUCHES
2.1 Beteiligte Akteure und Ver fahrensweisen
Im Projekt Bürgerarbeit sollen de facto chancenlose Arbeitslose und Arbeitssuchende in sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten des gemeinnützigen Bereiches beschäftigt werden. Um dies zu ermöglichen, waren in der Implementierungsphase mehrere Aufgaben zu bewälti-gen:
Zunächst musste eine Legitimations- und Bereitschaftsatmosphäre geschaffen werden, die die Durchführung eines solchen innovativen Vorhabens überhaupt erst möglich macht. Dies geschah in Bad Schmiedeberg durch eine „Aufklärungs“-Kampagne gegenüber der inte-ressierten Öffentlichkeit, den örtlichen Akteuren und gegenüber der eigenen Verwaltung.
Auf dieser Grundlage mussten Bürgerarbeitsplätze definiert werden. Diese Aufgabe oblag in erster Linie der regionalen Agentur für Arbeit sowie der ARGE in enger Zusammenarbeit mit den Trägern, den potenziellen Einsatzstellen, der örtlichen Wirtschaft und dem sachsen-anhaltinischen Wirtschafts- und Arbeitsministerium.
Abbildung 1: Regulierung der Bürgerarbeit
Legitimations- und Unterstützungsatmosphäre
Arbeitsagentur/ARGE
Projekt-management-
gruppe
Einsatzstellen/Vereine
Träger Kommune
Bürgerarbeiter
Definiert BüA-Plätze
Akquiriert
BüA-Plätze
Wählt aus
leis
ten
Bürg
erar
beit
(informelle) Kontroll- und Gewährleistungsstruktur
kontrolliert/reguliert
kontrolliert/reguliert
Legende: BüA = Bürgerarbeiter
Anschließend mussten Bürgerarbeitsplätze akquiriert werden, die den konzeptionellen Anforderungen entsprachen. Im Rahmen des ersten Flächenversuches in Bad Schmiedeberg wurde dies in einer Kooperation verschiedener regionaler Akteure geleistet, zu welcher die zuständige Agentur und die zuständige ARGE, zwei sogenannte Trägergesellschaften, eine
Einsatzstellen/ Vereine
Kommune
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
16
Projektmanagementgruppe und diverse, sukzessive einbezogene Unternehmen, Organisatio-nen und Vereine (im Folgenden entsprechend der Projektterminologie „Einsatzstellen" genannt) gehörten.
Insbesondere das Finden und Besetzen geeigneter Stellen, also der Kern der Projekt-implementierung, war in hohem Maße durch Prozesse des Vorschlagens und Aushandelns zwischen den genannten Akteuren geprägt. Dies ist den Strukturen im Feld der Beschäfti-gungsförderung inhärent, denn alle Beteiligten sind im Interesse der Umsetzung ihrer jeweils eigenen Ziele auf Commitment sowie die Fähigkeit zur Interessenartikulation und zum Interessenausgleich angewiesen. Das gilt sicherlich nicht nur für das Projekt Bürgerarbeit; die starke Projektförmigkeit, der größtenteils kampagnenhafte Charakter des ersten Flächenversu-ches sowie die zu erprobende neue Form geförderter Beschäftigung lassen aber die Netzwerkförmigkeit des Steuerungsmodus deutlicher zu Tage treten und zu einem verallge-meinerbaren Merkmal werden. Dieser Prozess wird im Folgenden etwas ausführlicher beschrieben.
2.1.1 Kooperationsbedingungen
Die Bundesagentur für Arbeit initiierte und finanzierte gemeinsam mit dem Land Sachsen-Anhalt das Projekt. Sie konnte den Umfang und die Art von Bürgerarbeitsplätzen zwar planen, über die letztlich mögliche Zahl jedoch nicht (allein) entscheiden. Zugleich musste sie sicherstellen, dass das Projekt den gesetzlichen Vorgaben und den intendierten Zielen ent-sprechend umgesetzt wird. Aus diesem Grunde trat die Agentur für Arbeit bzw. die regional zuständige Agentur in Kooperation mit der ARGE gleichzeitig als Partner der beteiligten Akteure und als deren Auftraggeber auf.
Sowohl mit der Stellenakquise als auch mit der Verwaltung der Bürgerarbeitsplätze betraute sie die beiden am Versuch beteiligten Träger. Diese übernahmen im Rahmen des Projektes für die Bürgerarbeiter die Arbeitgeberfunktion mit den damit verbundenen Aufgaben (Erstellung der Arbeitsverträge, Zahlung der Vergütungspauschale, Abführen der Pflichtbeiträge etc.) und erhielten dafür eine sogenannte Trägerpauschale.
Theoretisch entsteht dadurch für die Träger ein Anreiz, möglichst viele Bürgerarbeitsstellen zu akquirieren. Praktisch waren dem jedoch in zweierlei Hinsicht Grenzen gesetzt: Zum einen behielten sich die Bundesagentur und vor allem die durch die regionale Agentur und ARGE gebildete gemeinsame Arbeitsgruppe die Prüfung und Entscheidung über die Projekt-konformität möglicher Bürgerarbeitsstellen vor, ohne dass sich dies in einem allein von bürokratischen Entscheidungsregeln geprägten Akt erschöpfte. Eine weitere Begrenzung wurde gezogen, indem die beiden Träger selbst keine Arbeitsplätze anbieten, d.h. auch nicht (allein) über Art und Umfang von Bürgerarbeitsstellen entscheiden konnten. Dazu waren sie auf die Kooperation potenzieller Einsatzstellen angewiesen.
Die Arbeitsgruppe der Agentur/ARGE initiierte die Bildung einer Projektmanagementgruppe zur Übernahme von Teilaufgaben. Mitglieder dieser Gruppe, die nicht als Bürgerarbeiter angestellt waren (und mit rund 1.700 Euro auch ein wesentlich höheres Gehalt bezogen), sollten die Einhaltung der Marktferne der Arbeit, der Arbeitsschutzvorschriften und der Arbeitsbedingungen vor allem in den Einsatzstellen kontrollieren, in denen die Bürgerarbeiter
Implementierung des Modellversuchs
17
in der Regel „unbeaufsichtigt“ arbeiten mussten. Mitglieder der Projektmanagementgruppe sollten auch Streitigkeiten schlichten, die von jedem Bürgerarbeiter anzufertigenden Arbeitsprotokolle einsammeln und Krankmeldungen entgegennehmen.
Für die Einsatzstellen dürfte, neben sozialmoralischen Motiven, aufgrund der nicht anfallen-den Lohnkosten in erster Linie die konkrete Arbeitsleistung der zu Beschäftigenden von Interesse sein. Dies erhöht jedoch das Risiko negativer Auswirkungen auf die reguläre Beschäftigung. Die Träger haben also nicht nur die Aufgabe, die Teilnahmebereitschaft der Einsatzstellen sicherzustellen, sondern müssen auch gemeinsam mit diesen entsprechend projekt-konforme Arbeitsstellenvorschläge entwickeln. Sie nehmen damit eine Vermitt-lungsposition zwischen der Agentur und den Einsatzstellen ein.
2.1.2 Konkrete Ausgestaltung der Kooperationsstrukturen
Im wesentlichen erfolgte die Vermittlung zwischen Agentur, Träger und Einsatzstellen in zwei Schritten: In einem ersten Schritt erarbeiteten die Träger im Auftrag der Agentur und in Kooperation mit der Kommune konkrete Vorschläge für den Einsatz von Bürgerarbeitern vor Ort. Diese wurden in Bezug auf die Zielsetzungen diskutiert (was kann als zusätzlich gelten; wer soll konkret vermittelt werden u. a.) und eine entsprechende Auswahl aus dem Angebot vorgenommen. Zugleich wurde eine Reihe expliziter Verfahrensregeln für die Stellenakquisition und -besetzung festgelegt:
• Vereinsmitglieder sollten nicht im „eigenen“ Verein tätig werden;
• Wünschen nach konkreten Personen sollte nicht nachgegeben werden;
• eine zeitgleiche Beschäftigung von Ein-Euro-Jobbern und Bürgerarbeitern in dersel-ben Einsatzstelle und in ähnlichen Tätigkeitsfeldern sollte vermieden werden;
• die individuellen Voraussetzungen der Bürgerarbeiter sollten möglichst gut mit den Anforderungen der Stellen in Übereinstimmung gebracht werden;
• in den Einsatzstellen sollten bestimmte infrastrukturelle Mindestvoraussetzungen (ent-sprechende Räumlichkeiten, Arbeitsmaterialien etc.) vorhanden sein.
Die an diesem ersten Schritt beteiligten Akteure betonten, dass sie erst im Zuge dieser Etappe eine „klarere Vorstellung" davon entwickelten, was Bürgerarbeit sein soll. Erst auf Basis dieser Verständigung haben beide Träger in einem zweiten Schritt begonnen, in möglichen Einsatzstellen für Bürgerarbeitsstellen zu werben und dort konkrete Stellenbeschreibungen zu entwickeln. Dies wurde seitens der Arbeitsgruppe von Agentur und ARGE u. a. mittels einer Informationsveranstaltung und (gemeinsamer) Vor-Ort-Besuche unterstützt. Der zweite Schritt war für das Zustandekommen der Bürgerarbeitsstellen entscheidend.
Der überwiegende Teil der von uns befragten Einsatzstellenvertreter gab an, durch einen der beiden Träger auf das Projekt aufmerksam geworden zu sein und mit dessen Unterstützung entsprechende Angebote für Bürgerarbeitsstellen entwickelt zu haben. Zugleich wurde jedoch in Hinblick auf Stellenakquise und Stellenbesetzung auch eine Reihe von Defiziten thematisiert. So blieben die weiter oben genannten Regeln vielfach unverständlich, das heißt in den Einsatzstellen war entweder nicht bekannt, dass es solche Regelungen gab, und/oder es
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
18
blieb offen, warum es sie gab. Die häufig vorkommende Überarbeitung der Tätigkeits-beschreibungen wurde als ineffizient wahrgenommen. Des Weiteren wurden mangelnde Mitsprachemöglichkeiten sowohl hinsichtlich des Stellenbesetzungsverfahrens als auch in Bezug auf das Gesamtprojekt kritisiert.
In der Thematisierung dieser Defizite kommt unseres Erachtens zum Ausdruck, dass Bürgerarbeit für die Einsatzstellen nicht nur eine zum Teil dringend benötigte und willkommene Gelegenheit ist, sondern dass der Einsatz von Bürgerarbeitern sowohl in Hinblick auf mögliche Tätigkeiten als auch auf die Integrationsfähigkeit der Personen für die Einsatzstellen „Sinn machen", sich also lohnen und/oder die eigenen Kapazitäten nicht überfordern sollte.
Auffallend war in diesem Zusammenhang zum Beispiel, dass der Einsatz von Bürgerarbeitern in den Einsatzstellen, in denen reguläre Mitarbeiter beschäftigt sind, diesen gegenüber be-gründet und eine entsprechende Notwendigkeit vermittelt werden musste. Es musste darüber ein wechselseitiges Einvernehmen hergestellt werden.
Diese für die Einsatzstellen funktionalen Erfordernisse werden nicht automatisch durch die im ersten Konkretisierungsschritt festgelegten Verfahrensregeln hergestellt, sondern müssen zwischen Einsatzstellen und Trägern sowie zwischen Trägern und Agentur/ARGE ausgehandelt werden. Dies erscheint dann als langwierig, widersprüchlich oder ineffizient. Ob und inwieweit ein solches Verfahren des zweiten Aushandlungsprozesses in weiteren Projekten aufgegriffen wird, hängt von den konkreten Bedingungen vor Ort ab.
Am Ende der ersten Befragungswelle in Bad Schmiedeberg im März/April 2007 waren sowohl die Stellenakquise als auch die Stellenbesetzung weitgehend abgeschlossen. Im Vergleich zur Implementationsphase ging die unmittelbare Kontaktdichte zwischen den Einsatzstellen auf der einen Seite und den beiden Trägern sowie der Agentur/ARGE auf der anderen Seite bereits deutlich zurück.
Vor Ort diente bis zu ihrer Auflösung zum Jahresende 2007 vor allem die Projektmana-gementgruppe als unmittelbarer Ansprechpartner für alle Beteiligten. Die Beschäftigten dieser Gruppe waren, ebenso wie die Bürgerarbeiter, zeitlich befristet tätig. Wie bereits dargestellt, waren sie an der Erschließung von Einsatzmöglichkeiten für Bürgerarbeiter beteiligt. Eine weitere wichtige Aufgabe bestand in regelmäßigen Kontrollen der Bürgerarbeit in den Einsatzstellen. Hierdurch und durch schriftliche Arbeitsnachweise der Bürgerarbeiter über die von ihnen erledigten Aufgaben wurde der projektkonforme Einsatz der Bürgerarbeiter beobachtet.
Weiterhin haben die Einsatzstellen eine Reihe von qualitätssichernden und -prüfenden Verfahren für den internen Einsatz der Bürgerarbeit entwickelt. Für sie wäre ein missbräuchli-cher Einsatz von Bürgerarbeit bzw. von Bürgerarbeitern vor allem auch eine Infragestellung ihres guten Rufes, denn nicht nur die Träger, sondern auch der überwiegende Teil der Einsatzstellen sind seit Jahren mit der Durchführung geförderter Beschäftigung be- und vertraut und allein schon aus diesem Grund an guten Beziehungen zur regionalen Agentur/ARGE interessiert. Gleiches gilt für langjährige Kooperations- und Geschäftspartner, die durch den Einsatz von Bürgerarbeit bzw. Bürgerarbeitern nicht übervorteilt werden sollen.
Implementierung des Modellversuchs
19
Zwischenbilanz
Was Bürgerarbeit konkret ist bzw. sein kann, hängt vermutlich im Wesentlichen davon ab,
welche sachlichen und sozialen Kooperationsformen die einbezogenen Akteure gemeinsam
ins Leben rufen.
Deshalb ist anzunehmen, dass Projekte wie Bürgerarbeit unter verschiedenen lokalen und
regionalen Bedingungen unterschiedlich erfolgreich sind. Wichtige regionale Faktoren sind
keineswegs nur gegebene Rahmenbedingungen wie Wirtschaftsentwicklung sowie Höhe und
Struktur der Arbeitslosigkeit. Auch die lokal und regional unter-schiedliche Fähigkeit der
beteiligten Akteure zur Kooperation kann erheblichen Einfluss auf den Erfolg haben.
Vieles spricht dafür, dass die für den Erfolg wichtige Kooperationsfähigkeit der Akteure nicht
zuletzt die Bereitschaft voraussetzt, die eigenen Verfahrensroutinen in Frage zu stellen und
immer wieder neu den gegebenen Bedingungen anzupassen. Hierauf wird weiter unten
(Kapitel 6) nochmals eingegangen.
2.2 Die Bürgerarbeitsstellen
Im Ergebnis führte der eben beschriebene Implementierungsprozess zu einem Pool an möglichen Bürgerarbeitsplätzen, deren Umfang und Struktur nunmehr ausführlicher zu beschreiben sind.
2.2.1 Die Anzahl der Bürgerarbeitsstellen
Unterstellt man, dass für jeden Kandidaten, der ein entsprechendes Angebot erhielt, tatsächlich eine Bürgerarbeitsstelle vorhanden war, dann wurden insgesamt 126 Stellen für Bürgerarbeit erschlossen. Hinzu kamen im Jahre 2007 drei zusätzliche Stellen für das Projektmanagement. Das Ergebnis dieser einfachen Rechnung ist allerdings um zwei Positionen zu korrigieren.
Zum Einen sind in der Zahl 126 bzw. 129 auch einzelne Neubesetzungen enthalten. Wenn Bürgerarbeitsstellen frühzeitig wieder frei wurden, war die zeitnahe Nachvermittlung einer anderen Person auf den gleichen Platz möglich.
Zum Anderen sind in der genannten Zahl auch Ein-Euro-Jobs enthalten, die in Bürgerarbeits-plätze umgewandelt wurden. Dies war dann der Fall, wenn in einer der vorgesehenen Einsatzstellen zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung bereits Ein-Euro-Jobber dieselben oder weitgehend ähnliche Tätigkeiten ausübten, die auch die Bürgerarbeiter übernehmen sollten. Die Umwandlung sollte vor allem vermeiden, dass gleiche Tätigkeiten zu unterschiedlichen Bedingungen ausgeübt werden. Die genaue Zahl dieser umgewandelten Stellen kann nur geschätzt werden. Die Interviews mit den Vertretern der Einsatzstellen legen einen Schätzwert von rund 16 Stellen nahe.
Der Umgang mit den Ein-Euro-Jobs indiziert allerdings aus unserer Sicht ein mögliches Problem, das nur auf den ersten Blick mit der Anzahl möglicher Bürgerarbeitsstellen zusammenhängt. Mit Blick auf die Frage der Verallgemeinerbarkeit des Modells Bürgerarbeit stellt sich die Frage, ob hier doppelte Standards für zwei arbeitsmarktpolitische Instrumente
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
20
gesetzt werden, die zumindest eine gemeinsame Schnittmenge an förderungsfähigen Beschäftigungsgelegenheiten besitzen. Hinzu kommt – das wurde in den Gesprächen mit den Vertretern der Einsatzstellen deutlich – dass die Einsatzstellen mit Bürgerarbeit einige Vorteile verbanden, aber zugleich das im Vergleich zur Bürgerarbeit breitere Tätigkeitsspekt-rum der Ein-Euro-Jobs als Vorteil hervorhoben. Werden Bürgerarbeit und Ein-Euro-Job gleichzeitig angeboten, dann könnten beide Angebote leicht zueinander in Konkurrenz geraten.
2.2.2 Einsatzstellen und Tätigkeitsfelder
Die Einsatzstellen sind hinsichtlich ihrer Organisationsstruktur sehr unterschiedlich. Der aus unserer Sicht größte Unterschied besteht im Grad ihrer Betriebsförmigkeit. In dieser Hinsicht lassen sich insgesamt drei Typen von Einsatzstellen unterscheiden, die verkürzt als „Sozialbe-trieb“ , „Verein“ und „Kommune“ bezeichnet werden können und deren Verteilung in Abbildung 2 dargestellt ist.
Abbildung 2: Einsatzstellentypen nach realisiertem Stellenumfang (alle zum Befragungszeitpunkt in Bürgerarbeit Tätigen, März/April 2007, N = 105)
54
2922
0
1020
30
4050
60
Sozialbetr iebe Vereine Kom m une
Sozialbetr iebe
Bei den von uns als Sozialbetrieb bezeichneten Einsatzstellen handelt es sich um Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege, Schulen, Kindertagesstätten und Kirchen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie regelmäßig und unabhängig von geförderter Beschäftigung in erster Linie soziale Dienstleistungen erbringen. Jede dieser Einsatzstellen hat mindestens einen regulär Beschäftigten. Alle Einsatzstellen dieses Typs verfügen über Formen der Mitarbeitervertretung (vor allem Betriebs- und Personalräte). Wie in Abbildung 2 zu erkennen, konnten hier die meisten Stellen geschaffen werden.
Vereine
Des Weiteren findet Bürgerarbeit in einer Reihe von Vereinen statt. Alle Vereine sind gemeinnützig. Im Unterschied zu den Sozialbetrieben finden sich in den Vereinen nur im Ausnahmefall sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, so dass auch keine Formen der Mitarbeitervertretung existieren.
Kommune
Schließlich werden Bürgerarbeiter auch in kommunal ausgerichteten Projekten – in der Abbildung 2 als Kommune bezeichnet – beschäftigt. Charakteristisch für diese Projekte ist,
Implementierung des Modellversuchs
21
dass sie über keinerlei Anbindung an Unternehmen bzw. Vereine verfügen. Ihre Zuordnung zum kommunalen Bereich resultiert aus ihrer Aufgabenstellung, aus dem Arbeitsort, der in der Regel durch die Kommune gestellt wird, sowie aus der Betreuung vor Ort.
Bürgerarbeiter sollen in den Einsatzstellen „zusätzliche Tätigkeiten“ ausüben. Dass die Festlegung dessen, was als „zusätzlich“ gelten kann und darf, trotz gesetzlicher Vorgaben und projektinterner Definitions- und Regulierungsverfahren im Zweifel für jeden Fall einzeln entschieden werden muss, wurde bereits dargelegt.
Die Beschäftigten in Bürgerarbeit gingen oder gehen ganz unterschiedlichen Aufgaben nach: Vom Schreiben der Vereinschronik über die organisatorische Vorbereitung von Veranstaltun-gen bis zur Betreuung älterer Menschen. Zusammengefasst lassen sich in Bad Schmiedeberg vier verschiedene Tätigkeitsschwerpunkte von Bürgerarbeitern ausmachen. (Abbildung 3)
Der erste Tätigkeitsschwerpunkt besteht vorwiegend aus Organisations- und Büroarbeiten (in Abbildung 3 „Organisation“), wozu wir u. a. das bereits erwähnte Schreiben einer Chronik, Bibliotheksarbeit oder Arbeiten in einem Archiv zählen.
Des Weiteren üben Bürgerarbeiter sozialbezogene Tätigkeiten („Soziales“) aus, z. B. in der Alten- bzw. Krankenbetreuung sowie in der Kinder- und Jugendarbeit.
Der dritte Schwerpunkt besteht aus Tätigkeiten mit einem handwerks- bzw. produktions-bezogenen Profil („Handwerk“ ). Hierzu gehören zum Beispiel die Unterstützung eines Hausmeisters, Instandhaltungsarbeiten oder auch Tierpflege.
Schließlich verbleibt noch eine Reihe von eher unspezifischen Hilfs- und Unterstüt-zungsarbeiten („alles, was anliegt“ , in der Abbildung als „Sonstiges“ bezeichnet).
Abbildung 3 informiert über die Aufteilung der Bürgerarbeiter auf Tätigkeitsstrukturen in den drei unterschiedenen Einsatzstellentypen. Wie zu erkennen, gibt es gewisse Zusammenhänge, doch sind die Unterschiede in den Tätigkeitsstrukturen der drei Einsatzstellentypen nicht sehr groß. So üben Bürgerarbeiter in Sozialbetrieben keineswegs nur sozial orientierte Tätigkeiten aus, wenngleich deren Anteil hier deutlich größer ist als in den beiden anderen Typen. In den kommunalen Projekten überwiegen demgegenüber Organisations-, Verwaltungs- und Büro-tätigkeiten; in den Vereinen ist kein ausgeprägter Einsatzschwerpunkt auszumachen.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
22
Abbildung 3: Tätigkeitsspektrum der Einsatzstellen (nur befragte Bürgerarbeiter, März/April
2007, N = 97)
47
21 18
26
3964
1929
188 11
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Sozialbetriebe Vereine Kommune
Soziales Organisation Handwerk Sonstiges
Die Struktur der Tätigkeiten in den Einsatzstellen unterstreicht die beiden Motive, die für die überwiegende Zahl der Einsatzstellen für eine Teilnahme am Projekt sprachen: Ein unmittelbarer Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften und eine sich bietende Gelegenheit. Soweit das zweite Motiv ausschlaggebend war, wurden für den Einsatz von Bürgerarbeitern im Interesse des Unternehmens, des Vereins bzw. der Kommune spezifische Projekte oder Aufgaben geschaffen. Insofern handelt es sich also im wörtlichen Sinn um zusätzlich geschaffene Arbeitsgelegenheiten. Eine gewisse Rolle spielen hierbei auch die als günstig erachteten Bedingungen der Bürgerarbeit (u. a. geringerer bürokratischer Aufwand, Laufzeit der Stellen von einem Jahr).
Demgegenüber spielte eine soziale Verantwortung für die Mitbürger als unmittelbarer Grund für die Teilnahme am Projekt praktisch keine Rolle. Der Ausweitung von Bürgerarbeit sind insofern deutliche Grenzen gesetzt. Dies hat auch erheblichen Einfluss auf das vorhandene Erweiterungspotenzial vor Ort.
Grundsätzlich gibt es wohl zwei Wege, weitere Bürgerarbeitsplätze zu generieren: Einerseits durch die Ausweitung des Spektrums an Einsatzstellen, andererseits durch die Ausschöpfung noch vorhandener Bedarfe in den bestehenden Einsatzstellen und Einsatzfeldern. In Bad Schmiedeberg besteht nach unseren Untersuchungen gegenwärtig nur ein vergleichsweise geringer Spielraum. In Sozialbetrieben und Vereinen beläuft sich die Zahl der in den Interviews (November 2007) mit Vertretern der Einsatzstellen konkret genannten Bedarfe auf 10 zusätzliche Plätze, davon 8 im Vereinsbereich. Für den kommunalen Bereich konnten keine konkreten Angaben ermittelt werden. Ein größerer Bedarf bestünde darüber hinaus jedoch in Einsatzfeldern, die im Rahmen von Bürgerarbeit nicht gefördert werden.
2.3 Zur Auswahl von Bürgerarbeitern
Bürgerarbeit ist in erster Linie für die Menschen gedacht, die bisher auf dem Arbeitsmarkt praktisch chancenlos waren. Die Auswahl des Personenkreises, dem Bürgerarbeit angeboten wurde, erfolgte durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Bürgerarbeit" der Agentur für Arbeit und der ARGE Wittenberg. Für den Auswahlprozess war eine hohe Kontakt- und Beratungsdichte charakteristisch. Nach Angaben der Initiatoren lag das Betreuungsverhältnis
Implementierung des Modellversuchs
23
bei 1:100. Die Auswahl selbst war als vierstufiger Prozess angelegt; einbezogen wurden beide Rechtskreise. Vorrang hatte dabei die Vermittlung in reguläre Beschäftigung und in Qualifikationsmaßnahmen. Erst wenn weder ungeförderte noch geförderte Vermittlungsbe-mühungen und Maßnahmen zum Ziel führten, sollte ein Bürgerarbeitsangebot unterbreitet werden.
Die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit ist allerdings ein dynamischer Prozess. Der Bestand an Arbeitslosen und Arbeitssuchenden verändert sich durch Zu- und Abgänge ständig. Dies steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu einem in erster Linie projektförmig verfassten Vorhaben wie Bürgerarbeit. Infolgedessen kam es im Projektverlauf auch zu Veränderungen der für den Auswahlprozess maßgeblichen Funktionsbedingungen: Während zwischen dem 15. September und dem 30. November 2006 in erster Linie die Bestandsfälle in den Prozess einbezogen wurden, wurden im weiteren Verlauf, wie im Kapitel 5 noch ausführlicher dargestellt wird, zunehmend auch Neuzugänge einbezogen. Da jedoch sowohl für die Personen des Bestandes als auch für Zugänge die Möglichkeit bestand, in Bürgerarbeit zu gelangen, muss die Analyse des Auswahlprozesses alle Personen erfassen, die zwischen dem 15. September 2006 und dem Abschluss der entsprechenden Arbeiten am 1. Mai 2007 in den Auswahlprozess einbezogen wurden. Es handelt sich dabei um insgesamt 455 Personen (Bestand und Zugänge).
In Tabelle 1 sind eine Reihe von Merkmalen der in den Auswahlprozess Einbezogenen aufgeführt. Dabei wurden vor allem die Merkmale berücksichtigt, die als besondere Risiko-faktoren auf dem Arbeitsmarkt gelten. Sie werden sowohl für die Gesamtgruppe als auch nach Rechtskreiszugehörigkeit getrennt ausgewiesen. In der letzten Spalte sind entsprechende Angaben für die Personen verzeichnet, die in Bürgerarbeit eingemündet sind.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
24
Tabelle 1: Merkmale der in den Auswahlprozess einbezogenen Personen
(N = 455, in Prozent)
Merkmal Alle Arbeitslose
SGB I I I -Empfänger
SGB I I -Empfänger
Bürgerarbei-ter
Arbeitslosigkeitsdauer <= 6 Monate < 12 Monate
>= 12 bis <= 24 Monate > 24 Monate
30,7 7,5 14,9 46,9
51,1 11,9 11,9 25,0
17,9 4,6 16,8 60,7
7,2 9,1 22,7 60,9
Alter <= 35 Jahre
>35 bis <= 43 Jahre >43 bis <= 51 Jahre
>51 Jahre
26,4 24,8 23,7 25,0
9,7 25,6 27,8 36,9
36,9 24,4 21,2 17,6
19,1 19,1 23,6 38,2
Schulabschluss keiner
Hauptschule Realschule
Abitur
8,0 24,6 60,2 7,3
2,3 17,0 73,3 7,4
11,6 29,4 51,8 7,3
2,7 20,0 70,0 7,3
Berufsabschluss keiner
Berufsausbildung (Fach-)Hochschule
18,7 73,8 7,6
5,2 87,3 7,5
27,1 65,3 7,6
17,3 74,6 8,2
Letzte Erwerbstätigkeit: Fertigung
Land- & Forstwirtschaft Nahrung & Genuss
Bau Lager/Transport/Verkehr
Hilfsarbeiter Handel
Büro/Organisation/Verwaltung sonstige Dienstleistungen
Gesundheit & Soziales ungenaue/keine Angabe
14,3 3,5 4,8 11,2 8,3 5,1 9,6 7,7 13,4 5,9 16,2
16,5 4,6 5,7 13,1 8,5 2,8 10,8 13,6 11,4 9,7 3,4
12,9 2,9 4,3 10,0 8,2 6,4 8,9 3,9 14,6 3,6 24,3
6,4 4,6 4,6 4,6 10,0 4,6 12,7 13,6 11,8 10,0 17,3
Geschlecht Frauenanteil 49,7 51,1 48,9 71,9
N 455 175 280 110
Im Hinblick auf die Dauer der letzten Arbeitslosigkeit fällt in Tabelle 1 eine ausgesprochen polarisierte Verteilung auf: Die in den Auswahlprozess einbezogenen Personen waren im wesentlichen entweder erst kurz zuvor arbeitslos geworden (was hauptsächlich auf die Zugänge nach dem 1.12.2006 zutrifft) oder sie waren es seit sehr langer Zeit. Fast die Hälfte der Personen war länger als 24 Monate arbeitslos gemeldet.
Erwartungsgemäß zeigen sich zwischen den Personen der beiden Rechtskreise beträchtliche Unterschiede: Während unter den ALG1-Empfängern vor allem auch Kurzzeitarbeitslose vertreten sind, setzt sich die Gruppe der ALG2-Empfänger in erster Linie aus Langzeitar-beitslosen zusammen.
Erklärungsbedürftig ist der Anteil der Personen, die dem Rechtskreis des SGB III zugerechnet werden und 12 Monate oder länger arbeitslos gemeldet waren. Hier dürfte es sich in der Regel
Implementierung des Modellversuchs
25
um sogenannte Nichtleistungsbezieher handeln, also um Personen, die keine Ansprüche geltend machen können, sich aber arbeitssuchend gemeldet haben und aufgrund der geltenden Rechtslage dem SGB III zugerechnet werden. Dieser Personenkreis wurde im Bad Schmiedeberger Projekt explizit in die Vermittlung einbezogen.
Unter den in Bürgerarbeit Eingemündeten befanden sich – entsprechend der intendierten Ziele – in erster Linie Personen, die länger als 24 Monate arbeitslos gemeldet waren. In Anbetracht der Verteilung könnte man auch formulieren: Personen, die weniger als sechs Monate arbeitslos waren, hatten im Prinzip keine Chance (oder kein Risiko), auf einen Bürgerarbeits-platz zu gelangen.
Auch mit zunehmendem Alter nehmen, so wird verbreitet angenommen, die Chancen auf einen (Wieder-)Eintritt in Beschäftigung ab. Diese Annahme lässt sich allerdings in den nach Rechtskreiszugehörigkeit getrennten Angaben nicht wiederfinden. Besonders auffällig ist hier der ausgesprochen hohe Anteil an jüngeren, das heißt bis 35-jährigen ALG2-Empfängern. Demgegenüber gelangten vor allem ältere Personen, insbesondere über 51 Jahre alte Arbeitslose und Arbeitssuchende, in Bürgerarbeit.
Nach wie vor gilt eine gute, besonders eine höhere Bildung als bester Schutz vor Arbeitslosigkeit. Sowohl im Hinblick auf den Schulabschluss als auch in Bezug auf das Vorhandensein eines beruflichen Abschlusses lässt sich der Tabelle 1 zunächst einmal entnehmen, dass das Qualifikationsniveau der Arbeitslosen recht hoch ist und weitestgehend der Struktur der gesamten ostdeutschen Bevölkerung entspricht. Angesichts der Werte in Tabelle 1 lässt sich jedoch allenfalls behaupten, dass ein vergleichsweise gutes Qualifi-kationsniveau im Raum Bad Schmiedeberg vor Langzeitarbeitslosigkeit schützt: Unter den ALG2-Empfängern sind Personen ohne formalen Abschluss bzw. mit Abschlüssen, die eine geringe Marktgängigkeit aufweisen, deutlich überrepräsentiert. Dies gilt jedoch nicht für die Bürgerarbeiter. Sowohl im Vergleich zur gesamten Gruppe als auch bezogen auf alle ALG2-Empfänger zeichnen sich Bürgerarbeiter durch ein höheres formales Qualifikationsniveau aus.
Allerdings werden einmal erworbene Qualifikationen durch unstete Erwerbsbiografien und unspezifische Tätigkeiten (z. B. Hilfs- und/oder Saisonarbeiten) schnell entwertet. Aus diesem Grund wurde anstelle des konkreten Ausbildungsberufes das Berufsfeld der zuletzt ausgeüb-ten Tätigkeit berücksichtigt.
Hierbei wird sichtbar, dass unter den in den Auswahlprozess einbezogenen Personen der Anteil derjenigen recht hoch ist, für deren letzte Tätigkeit sich keine genaue Angabe ermitteln ließ. Solche unspezifischen Arbeitstätigkeiten wurden ebenso wie Hilfsarbeitertätigkeiten vor allem auch von ALG2-Empfängern ausgeübt. Unter den Bürgerarbeitern ist dieser Personenkreis seinem Anteil an der Gesamtgruppe entsprechend vertreten. Dies trifft jedoch keineswegs auf alle Berufsgruppen zu. So sind zum Beispiel Personen, die einen Fertigungs- oder Bauberuf ausüben sowie Personen aus Büro- und Verwaltungs- bzw. aus Sozial- und Gesundheitsberufen unter den Bürgerarbeitern erkennbar überrepräsentiert. Sie haben damit Tätigkeiten ausgeübt, die vergleichsweise gut den Anforderungen der Bürgerarbeitstätigkeiten entsprechen.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
26
Vor allem fällt jedoch auf, dass Frauen deutlich häufiger in Bürgerarbeit einmündeten als das in Anbetracht ihres Anteils an der Gesamtgruppe und auch in Hinblick auf ihren Anteil unter den Arbeitslosen beider Rechtskreise zu erwarten gewesen wäre. (Vergleiche Tabelle 1)
Eine multivariate Schätzung der Chance, in Bürgerarbeit zu gelangen, bestätigt und präzisiert die eben vorgestellten deskriptiven Befunde. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse einer binären logistischen Regression für den Eintritt in ein Bürgerarbeitsverhältnis dargestellt.
Tabelle 2: (Statistische) Chance für den Eintritt in ein Bürgerarbeitsverhältnis (alle einbezogenen Arbeitslosen, N = 455, Odds Ratio)
Unabhängige Var iable Exp( ) Signifikanz
Arbeitslosigkeitsdauer (Referenz: >6 bis 12 Monate)
<= 6 Monate >= 12 bis <= 24 Monate
> 24 Monate
0.185 1.683 1.437
** *
Alter (Referenz: <= 35 Jahre) >35 bis <= 43 Jahre >43 bis <= 51 Jahre
>51 Jahre
1.166 1.571 2.455
** (Lesehilfe)
Schulabschluss (Referenz: Realschulabschluss) keiner
Hauptschule Abitur
0.165 0.687 0.814
**
Berufsabschluss (Referenz: Berufsausbildung) keine
(Fach-)Hochschule
0.927 0.689
letzte Erwerbstätigkeit im Berufsfeld (Referenz: Fertigung) Land- & Forstwirtschaft
Nahrung & Genuss Bau
Lager/Transport/Verkehr Hilfsarbeiter
Handel Büro/Organisation/Verwaltung
sonstige Dienstleistungen Gesundheit & Soziales
ungenaue/keine Angabe
2.342 2.261 1.407 4.160 3.830 1.903 2.996 1.580 3.447 2.951
* * * *
Geschlecht (Referenz: Mann) Frau
2.417
**
Rechtskreis (Referenz: SGB III ) SGB II
1.038
* = Parameter auf dem .05-Signifikanzniveau, **= auf dem .01-Signifikanzniveau, ***= auf dem .003-Signifikanzniveau, McFadden-Pseudo-R2: 0.197, Konstante: -2.608 ***
Lesehilfe: Personen über 51 Jahre haben im Vergleich zu den bis 35-Jährigen (=Referenzgruppe) eine signifikante, fast 2,5fach höhere Chance, einen Bürgerarbeitsplatz zu erhalten.
Im Rahmen der deskriptiven Analyse haben wir bereits darauf aufmerksam gemacht, dass kurzzeitarbeitslose Personen praktisch keine Chance auf einen Bürgerarbeitsplatz hatten, allerdings stellten sie auch nicht die Zielgruppe für Bürgerarbeit dar. Dies bestätigen die Ergebnisse der logistischen Regression. Auffallend ist jedoch, dass Personen mit einer extrem
Implementierung des Modellversuchs
27
langen Arbeitslosigkeitsdauer (über 24 Monate) im Vergleich zur Referenzgruppe keine signifikant höhere Chance auf einen Bürgerarbeitsplatz besaßen.
Deutlich höher war hingegen die Chance für ältere Arbeitslose: Personen über 51 Jahre hatten eine zweieinhalbfach höhere Chance auf einen Bürgerarbeitsplatz als die bis 35-Jährigen.
Mit Blick auf die vorgängig erworbenen Schulabschlüsse bestätigte sich, dass Personen ohne Schulabschluss praktisch keine Chance auf einen Bürgerarbeitsplatz besaßen und von den Einsatzstellen auch gezielt nicht ausgewählt wurden.
Auch die Berufsgruppe, in der die Arbeitslosen zuletzt tätig waren, hat erheblichen Einfluss: Personen, die während ihrer letzten Erwerbstätigkeit einem Fertigungsberuf (z. B. Metall- oder Elektroberuf) nachgingen, hatten eine deutlich geringere Chance auf einen Bürgerarbeitsplatz als alle anderen Berufsgruppen. Eine signifikant höhere Chance hatten vor allem Personen, die zuletzt in einem Beruf im Bereich „Lager & Transport“ und „Soziales & Gesundheit“ tätig waren. Gleiches gilt aber auch für Personen, die aus nicht genau zu bestimmenden Erwerbstätigkeiten kamen; im Vergleich zu Personen aus Fertigungsberufen hatten sie eine drei Mal so hohe Chance auf einen Bürgerarbeitsplatz.
Besonders hervorzuheben ist ein ausgeprägter Gendereffekt: In Bürgerarbeit mündeten in erster Linie Frauen ein. Ihre Chance, einen Bürgerarbeitsplatz zu erhalten, war zweieinhalb Mal so groß wie die der Männer.
Zwischenbilanz
Die dargestellten Befunde sprechen dafür, dass sich Bürgerarbeiter in fachlicher und auch in
sozialer Hinsicht durch ein recht hohes Maß an Employability auszeichnen. Die erworbenen
Qualifikationen und Berufserfahrungen mögen aktuell zwar nur eingeschränkt marktgängig
sein, in Bürgerarbeit kann aber offenkundig in vielen Fällen sowohl unmittelbar auf fachliche
als auch auf extrafunktionale Fähigkeiten zurückgegriffen werden, die früher erworben
wurden.
Da in erster Linie Ältere und Frauen in Bürgerarbeitstätigkeiten gelangten, kann davon
ausgegangen werden, dass es sich auch um einen sozial vergleichsweise stabilen
Personenkreis handelt. Erfahrungsgemäß sind insbesondere Frauen weniger von den
gefürchteten sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit (psychosomatische Störungen, Suchtmit-
telmissbrauch) betroffen als Männer.
Die Befunde können auch als Ausdruck eines gewissen Creaming-Effekts („ Rosinenpicken“ )
bei der Auswahl der Teilnehmer verstanden werden, der für die Funktionsfähigkeit des
Versuches durchaus von Bedeutung ist.
2.4 Vom Kandidaten zum Bürgerarbeiter
Die Möglichkeit von „Rosinenpicker-Effekten“ ist ein guter Beleg dafür, dass es bei der Auswahl und der Besetzung von Bürgerarbeitsstellen durchaus Handlungsspielräume für alle Beteiligten gab. Die Auswahl der potenziellen Bürgerarbeiter wurde durch die Arbeitsgruppe „Bürgerarbeit“ der regionalen Arbeitsagentur und ARGE vorgenommen. Beide Träger gaben übereinstimmend an, dass erst anschließend, nach dieser Auswahl von Bürgerarbeitern,
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
28
gezielt nach möglichen Einsatzstellen gesucht wurde. Die Einsatzstellen hatten ihrerseits ein Mitspracherecht bei der Auswahl ihrer Kandidaten, von dem sie durchaus Gebrauch machten. Gleiches gilt jedoch auch für die Bürgerarbeiter selbst.
Angesichts ernstzunehmender Kritik mehrerer Einsatzstellenvertreter am Verfahren der Ermittlung und Besetzung von Bürgerarbeitsplätzen gingen wir in den Interviews mit den Einsatzstellen insbesondere auch der Frage nach den Einstellungskriterien nach. Im Grunde wurden hierbei zwei für die Rekrutierung von Mitarbeitern durch Unternehmen typische Kriterien genannt.
Zum Einen sollten potenzielle Mitarbeiter über soziale Kompetenzen (Vertrauenswürdigkeit, Integrationsfähigkeit) verfügen; Alkoholkonsum und befürchtete „Arbeitsbummelei“ galten als Ausschlusstatbestände. Zum Anderen sollten die Kandidaten zumindest einige qualifi-katorische Mindestvoraussetzungen erfüllen.
Trafen diese Kriterien nicht zu, lehnten zumindest einige Einsatzstellen den betreffenden Kandidaten ab. Der größte Teil der nicht zustande gekommenen Bürgerarbeitsverhältnisse geht auf solche Ablehnungen seitens der Einsatzstellen zurück.
Da in die Befragung der Bürgerarbeiter in Bad Schmiedeberg auch die Personen einbezogen wurden, die ein Angebot für einen Bürgerarbeitsplatz erhalten, aber keine Bürgerarbeitstätig-keit aufgenommen hatten, konnten zumindest einige Merkmale dieses Personenkreises ermittelt werden, die in Tabelle 3 dargestellt sind.
Tabelle 3: Vermittelte und nicht vermittelte Kandidaten(alle Personen, die ein Bürgerarbeitsangebot erhielten, N = 126)
Merkmal in Bürgerarbeit vermittelt nicht vermittelte Kandidaten
Durchschnittsalter 46,4 Jahre 41,7 Jahre
Frauenanteil 72% 53%
Anteil SGB II 57% 84%
N 107 19
Unter den Nichteingemündeten sind vor allem Personen aus dem Rechtskreis des SGB II zu finden. Auch fiel der Zugang zu Bürgerarbeitsstellen Männern und jüngeren Personen offenkundig schwerer als Frauen und älteren Personen.
Die Wege, auf denen die Bürgerarbeiter erstmals von Bürgerarbeit erfuhren, sind in Abbildung 4 zusammenfassend dargestellt: Hierbei wird sichtbar, dass die Arbeitsagentur bzw. die ARGE zwar eine wichtige, aber keineswegs eine allein ausschlaggebende Rolle spielten.
Implementierung des Modellversuchs
29
Abbildung 4: Wege, auf denen Kandidaten erstmals von Bürgerarbeit erfuhren (einschließlich
nicht mehr in Bürgerarbeit befindlicher Personen; März/April 2007, N = 104, in
Prozent)
20
56
2436
18
46
0
20
40
60
80
100
durch Medien durch Agentur/ARGE durch Gespräche im Ort
Agentur/ARGE eigene Initiative
„Eigeninitiative“ bedeutet hier, dass sich Bürgerarbeiter von sich aus in der Agentur bzw. ARGE um einen Bürgerarbeitsplatz bemühten, bevor sie ein Angebot von der Agentur/ARGE erhielten. Zum Zeitpunkt ihrer eigenen Bemühungen wussten sie überwiegend noch nicht, dass sie zum potenziellen Bürgerarbeitskreis gehörten.
Über eine solche Eigeninitiative beim Zugang zu Bürgerarbeit berichteten 36 Prozent der potenziellen Bürgerarbeiter, die erstmals durch Medien von Bürgerarbeit erfuhren. Noch höher liegt der Wert bei denen, die ihre ersten Informationen durch Gespräche im Ort erhielten. Selbst von den Bürgerarbeitern, die nach eigenen Angaben erstmals durch die Agentur bzw. die ARGE von Bürgerarbeit erfuhren, berichten 18 Prozent von eigener Initiative, um einen Bürgerarbeitsplatz zu erhalten.
Sicherlich sind die Werte in Abbildung 4 auch durch die hohe Medienpräsenz in der Startphase und die regionale Konzentration auf Bad Schmiedeberg beeinflusst. Dennoch spricht das Bild, das sich in der Abbildung zeigt, recht eindeutig dafür, dass Bürgerarbeit von den potenziellen Bürgerarbeitern selbst durchaus als interessantes Angebot und nicht (nur) als arbeitsmarktpolitisches Zwangsinstrument wahrgenommen wurde und wird.
Unterstrichen wird dies auch durch die seitens der Bürgerarbeiter genannten Motive für die Annahme des Angebotes, die in Abbildung 5 dargestellt sind:
Für den überwiegenden Teil der Bürgerarbeiter bot Bürgerarbeit die Chance, endlich wieder einer Arbeit nachgehen zu können. Keine Wahl gehabt zu haben, weil ansonsten mit Sanktionen zu rechnen gewesen sei, gab demgegenüber nur ein vergleichsweise kleiner Personenkreis im Interview an. Selbst bei den Motiven, die die Bürgerarbeiter selbst ins Spiel brachten (in Abbildung 5 grau hervorgehoben), dominieren in erster Linie positive Aspekte.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
30
Abbildung 5: Motive für die Aufnahme der Bürgerarbeitstätigkeit (Mehrfachnennungen
möglich; März/April 2007, N = 97)
Insbesondere zu Beginn der Stellenbesetzung konnten die Kandidaten konkrete Wünsche im Hinblick auf die auszuübende Tätigkeit bzw. die Einsatzstelle äußern.
In den Interviews mit den Trägern und den Vertretern der Einsatzstellen sowie bei den Befragungen der Bürgerarbeiter erhielten wir Hinweise darauf, dass es vereinzelt auch zu einem Wechsel von Bürgerarbeitern zwischen den Einsatzstellen gekommen war. Allerdings konnte deren Zahl nicht ermittelt werden.
Die teilweise ausgesprochen gezielten Bemühungen verschiedener Akteure um adäquate Stellenbesetzung spiegeln sich deutlich in der Verteilung der Bürgerarbeiter über die Einsatzstellenbereiche und Tätigkeitsfelder wider.
In Tabelle 4 sind die Verteilung der Bürgerarbeiter über die zuvor unterschiedenen drei Typen von Einsatzstellen und wichtige Merkmale der Bürgerarbeiter je Typ dargestellt.
Hierbei zeichneten sich zum Teil sehr deutliche Unterschiede zwischen den Einsatzstellen-typen ab, von denen zwei vor allem hervorzuheben sind: Zum Einen gelangten ALG2-Empfänger deutlich häufiger auf einen Bürgerarbeitsplatz in einem Sozialbetrieb als auf Plätze in Vereinen oder in kommunalen Projekten.
Zum Anderen fällt auf, dass vor allem in den Sozialbetrieben, aber auch in Vereinen im Vergleich zu den kommunalen Projekten ein hoher Anteil der Beschäftigten über vorgängige Erfahrungen mit der dort als Bürgerarbeiter ausgeübten Tätigkeit verfügt, die entweder im
7
3
4
4
11
11
27
51
58
64
84
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
sonstige
chancenlos am Markt
organ. /rechtl. Aspekte
Ortsnähe
Gefallen an der Tätigkeit
keine Wahl
mehr Chancen auf dem AM
finanzielle Verbesserung
Bürgerarbeit ist wichtig
fühle mich gebraucht
endlich wieder Arbeit
Implementierung des Modellversuchs
31
Rahmen einer früheren Erwerbstätigkeit oder eines ehrenamtlichen Engagements erworben wurden.
Tabelle 4: Verteilung der Bürgerarbeiter über die Einsatzstellen (März/April 2007,
N = 97)
Merkmal Sozialbetr iebe Vereine Kommune Alle Einsatzstellen
Frauenanteil 72% 61% 82% 72%
Alter
<= 35 Jahre
> 51 Jahre
26%
34%
4%
50%
9%
45%
15%
41%
Anzahl der arbeitslosen Jahre in den vergangenen 10 Jahren
5 3 4,5 4
Anteil SGB II 74% 43% 27% 55%
Vertraut mit der Tätigkeit (Beruf und/oder Ehrenamt)
47% 39% 14% 37%
Offenkundig kann zumindest ein nennenswerter Teil des Humankapitals der Bürgerarbeiter genutzt und hierdurch erhalten werden, wenn entsprechende Auswahlprozesse zugelassen werden. Dies bekräftigt die These, dass Ausmaß ebenso wie Art und Weise des Humanka-pitalerhaltes in Projekten wie Bürgerarbeit wesentlich von deren Steuerungsformen abhängen.
Abschließend ist noch auf einen Zusammenhang hinzuweisen, der sich zeigt, wenn man die Verteilung der Bürgerarbeiter über die Tätigkeitsbereiche nach Geschlecht betrachtet, wie sie in Abbildung 6 dargestellt ist.
Abbildung 6: Geschlechtsspezifische Zusammensetzung in Tätigkeitsfeldern (März/April 2007, N = 97)
91 81
44 43
9 19
56 57
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Soziales Organisation Handwerk unspezifischeTätigkeiten
Frauen Männer
Trotz der starken Überrepräsentanz von Frauen im Projekt und einer überwiegenden Orientierung auf Einsatzbereiche, die als frauentypisch gelten, fällt die geschlechtsspezifische Verteilung der Bürgerarbeiter recht konventionell aus: Frauen sind in „ frauentypischen“ Bürgerarbeitstätigkeiten deutlich überrepräsentiert, in männertypischen Tätigkeiten hingegen unterrepräsentiert. Da nur etwas mehr als ein Drittel der Befragten angab, seine aktuelle Tätigkeit bereits zuvor ausgeübt zu haben, kann dies nicht (allein) auf geschlechtsspezifische
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
32
Qualifikationsprofile zurückgeführt werden. Zu vermuten ist vielmehr, dass sowohl seitens der Einsatzstellen als auch seitens der Bürgerarbeiter geschlechtsspezifische Orientierungen und extrafunktionale Qualifikationen eine Rolle spielten.
Zwischenbilanz
Bürgerarbeit wird zumindest von dem dafür ausgewählten Personenkreis in erster Linie als
willkommenes Angebot gesehen. Für Effekte von Sanktionsmacht lassen sich kaum Indizien
finden. Häufiger sind ganz im Gegenteil Hinweise darauf, dass ein Bürgerarbeitsangebot
unter bestimmten Bedingungen durchaus zur Aktivierung von Personen beiträgt.
Eine solche Aktivierung ist allerdings ambivalent: Einerseits wird sie seitens des Gesetzge-
bers gefordert, andererseits besteht gerade bei kampagnehaften und regional konzentrierten
Projekten die Gefahr, dass auch größere Teile der sogenannten Stillen Reserve dazu
veranlasst werden, eine Rückkehr zur Erwerbstätigkeit zu versuchen. In Bad Schmiedeberg
waren beispielsweise unter den Personen, die angaben, sich aus eigener Initiative um einen
Bürgerarbeitsplatz gekümmert zu haben, eine ganze Reihe von Nichtleistungsbeziehern zu
finden.
Im Projekt kombinierten sich verschiedene Auswahlprozesse. Dies trug mit Blick auf einige
Ziele des Projektes durchaus Früchte, so beispielsweise hinsichtlich des Erhalts von Human-
kapital. Die nennenswerte Zahl von Ablehnungen deutet indes darauf hin, dass Personen mit
ausgeprägten Vermittlungshemmnissen auch bei diesem innovativen Verfahren nur bedingt
zum Zuge kamen.
33
3 BÜRGERARBEIT AUS SICHT DER BÜRGERARBEITER
3.1 Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen der Bürgerarbeiter
Bürgerarbeit ist so angelegt, dass sie in vielen Punkten „normaler“ , das heißt regulärer Erwerbsarbeit ähnlich ist. So erhielten Bürgerarbeiter u. a. einen Arbeitsvertrag; sind sozialversicherungspflichtig und mussten sich in den meisten Fällen vor der Arbeitsaufnahme in den Einsatzstellen als Kandidat vorstellen. Auch in ihrer konkreten Durchführung gleicht Bürgerarbeit in vielerlei Hinsicht „normaler“ Beschäftigung.
Die Bürgerarbeit kann insofern auch nach den üblichen Merkmalen von Beschäftigungs-verhältnissen beschrieben werden.
3.1.1 Zusammenarbeit mit Kollegen
Bürgerarbeiter sind in der Regel in ein Team von Mitarbeitern der Einsatzstellen bzw. anderen Bürgerarbeitern eingebettet. Bei der ersten Befragung der Bürgerarbeiter im März/April 2007 gab die Mehrheit an, regelmäßig (71 Prozent) oder zumindest gelegentlich (12 Prozent) mit anderen zusammenzuarbeiten. Nur in 16 Prozent der Fälle arbeiteten Bürgerarbeiter allein bzw. gaben an, dass es in der Einsatzstelle keine weiteren Kollegen gäbe.
Dieses Bild hat sich bis zur Zweitbefragung der Bürgerarbeiter im November 2007 allerdings etwas verändert. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten 21 Prozent der Bürgerarbeiter allein bzw. ohne Kollegen und nunmehr 55 Prozent regelmäßig bzw. 24 Prozent gelegentlich mit Kollegen zusammen.
Auch gibt es praktisch in allen Einsatzstellen einen konkreten Ansprechpartner für arbeits-bezogene Belange. Diese Ansprechpartner nehmen auch die Prüfung und Kontrolle der durchgeführten Arbeiten vor.
3.1.2 Das Betr iebsklima
Ihr Verhältnis zu den Kollegen und den unmittelbaren Vorgesetzten sowie das Betriebsklima insgesamt schätzten, wie Abbildung 7 zeigt, die Bürgerarbeiter anhand einer (absteigenden) Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht) schon bei der ersten Befragung durchgängig als zumindest „gut" ein.
Bis zur zweiten Befragung im November 2007 haben sich offensichtlich das Verhältnis zu den Kollegen und das allgemeine Betriebsklima insgesamt noch leicht verbessert: Die Einschätzung des Betriebsklimas verbesserte sich von 1,79 auf 1,67.
Die Bewertung des Verhältnisses zu den Kollegen lag im März/April 2007 bei 1,73 und im November 2007 bei 1,69. Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung zeigte sich in den Interviews mit den Verantwortlichen in den Einsatzstellen. So äußerten einige von ihnen, dass es in den ersten Monaten von Bürgerarbeit unter den Vereinsmitgliedern zu einer Art
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
34
Neiddiskussionen gegenüber den Bürgerarbeitern gekommen sei. Dies hat sich seither offenkundig verändert.
Abbildung 7: Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten und Betriebsklima (N = 97/91)
1,73
1,78 1,79
1,69
1,82
1,67
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
Verhältn is zu Ko llegen Verhäl tnis zu Vorgesetzten Betr iebskl ima al lgemein
März/Apr il 2007
November 2007
Legende: 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = eher gut, 4,0 = eher schlecht, 5,0 = schlecht, 6,0 sehr schlecht
Nur das Verhältnis zu den Vorgesetzten verschlechterte sich leicht von 1,78 im März/April 2007 auf 1,82 im November 2007, doch liegt seine Bewertung noch immer im eindeutig positiven Bereich.
3.1.3 Arbeitszeit
Bürgerarbeiter haben eine vertraglich festgelegte wöchentliche Arbeitszeit von 30 Stunden. Einsatzstellen und Bürgerarbeiter konnten jedoch vereinbaren, wie sich diese Stunden auf die Woche verteilen. 90 Prozent von ihnen hatten sich im März/April 2007 auf den üblichen Wochenrhythmus von fünf Arbeitstagen geeinigt. Im November 2007 arbeiteten alle Bürger-arbeiter fünf Tage pro Woche.
Die tägliche Arbeitszeit betrug im März/April 2007 bei 90 Prozent und im November 2007 bei 93 Prozent der Bürgerarbeiter sechs Stunden.
Des Weiteren zeigen Bürgerarbeiter ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität, was sich im Projektverlauf kaum verändert hat. So berichtete knapp die Hälfte (47 Prozent) der Befragten, regelmäßig (12 Prozent) oder nach Bedarf (35 Prozent) auch am Abend, also zwischen 19 und 22 Uhr, zu arbeiten. Nachtarbeit kommt hingegen nur gelegentlich, z. B. anläßlich von Veranstaltungen, vor (5 Prozent).
Hinzu kommt, dass Bürgerarbeiter auch in erheblichem Umfang Überstunden leisten. Über die Hälfte der Befragten gibt mit von der ersten zur zweiten Befragung leicht steigender Tendenz (52 Prozent im März/April 2007 und 55 Prozent November 2007) an, regelmäßig Mehrarbeit zu verrichten. Diese zusätzlichen Arbeitsstunden werden mit der vereinbarten Arbeitszeit verrechnet, das heißt die Überstunden werden „abgefeiert“ .
3.1.4 Qualifikationsanforderungen und Humankapitaleinsatz
Obwohl mit der Festlegung, im Rahmen der Bürgerarbeit nur marktferne Aufgaben zuzulas-sen, nicht zwangsläufig auch das Anforderungsprofil der Tätigkeiten definiert ist, handelt es sich bei Bürgerarbeit doch in aller Regel um Einfach- bzw. Jedermanns-Tätigkeiten.
Bürgerarbeit aus Sicht der Bürgerarbeiter
35
Außerdem wurde bei der Auslegung der Bürgerarbeitsplätze auch eine möglicherweise vorhandene „Entwöhnung“ der Bürgerarbeiter von „ regulärer“ Arbeit berücksichtigt. Diese Auslegung korrespondiert mit der Einschätzung der Bürgerarbeiter selbst, nach deren Meinung für den überwiegenden Teil der Beschäftigungen kein Berufsabschluss und keine oder nur eine kurze Einarbeitung notwendig ist (jeweils 72 Prozent).
Allerdings liegt das durchschnittliche Qualifikationsniveau sehr vieler Bürgerarbeiter, wie bereits weiter oben ausgeführt, mit recht hoher Wahrscheinlichkeit über dem durchschnittli-chen Anforderungsniveau der ihnen zugewiesenen Arbeitsstellen. Die meisten Tätigkeiten werden von Personen mit einer recht guten formalen Vorbildung ausgeübt.
Auch die Ergebnisse der Bürgerarbeiterbefragungen weisen in die gleiche Richtung. Im Verlaufe ihres bisherigen Lebens haben fast alle befragten Bürgerarbeiter (92 Prozent) einen Schulabschluss unterschiedlichen Niveaus erworben, 12 Prozent von ihnen besitzen sogar einen Fachschul- oder Hochschulabschluss.
Wegen ihres Alters verfügt ein großer Teil der Bürgerarbeiter auch über beträchtliche Berufs- bzw. Erwerbserfahrungen. Von den von uns befragten Bürgerarbeitern wechselten immerhin 40 Prozent im Verlaufe ihres Erwerbslebens mehr als zweimal die Arbeitsstelle.
70 Prozent haben mindestens einmal in ihrem Leben den Beruf gewechselt.
Wenngleich diese Qualifikationen und Erfahrungen zwar offenkundig kaum (mehr) markt-gängig sind, legen sie die Vermutung nahe, dass sehr viele der Bürgerarbeiter nach wie vor bestimmte fachliche und soziale Fähigkeiten besitzen. Dies kann beispielsweise erklären, warum die Integration der Bürgerarbeiter in den Arbeitsalltag nach Aussagen der Einsatz-stellenvertreter als vergleichsweise problemlos geschildert wurde.
3.1.5 Weiterbildung und Wissenserweiterung
Ein explizites Ziel von Bürgerarbeit besteht darin, zum Erhalt und zur Erweiterung von Fähigkeiten und Wissensbeständen beizutragen. Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen.
Wir haben bereits weiter oben darauf aufmerksam gemacht, dass im Rahmen der Auswahl und Stellenbesetzungsprozesse in gewissem Umfang auch vorgängig erworbene Qualifikatio-nen berücksichtigt wurden. So konnten insbesondere in der Routinephase des Projektes, nachdem dieses bereits angelaufen und das Projektmanagement aktiv war, die Bürgerarbeiter qualifikationsgerechter eingesetzt werden als in der Startphase. Hierbei spielte vor allem das Projektmanagement mit seiner guten Kenntnis der spezifischen Anforderungen in den Einsatzstellen und der persönlichen Qualifikationen und Fähigkeiten der potenziellen Bürgerarbeiter eine wichtige Rolle. Dies äußerte sich vor allem darin, dass der ARGE bzw. der Agentur passgenauere Vorschläge zur Besetzung neu aquirierter Bürgerarbeitsstellen unterbreitet werden konnten.
Dass auf diese Weise im Projekt ein nicht unerheblicher Beitrag zu Erhalt und Erweiterung von Humankapital geleistet wurde, ergibt sich nicht zuletzt auch aus den Aussagen der Bürgerarbeiter selbst. So schätzten diese die Möglichkeiten zum Einsatz ihrer Kenntnisse auf einer Skala von 1 (sehr niedrig) bis 6 (sehr hoch) mit einem Wert von 3,48 (März/April 2007) bzw. 3,58 (November 2007) als recht hoch ein.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
36
Diese qualifikatorischen Anpassungen können als Indiz für die erhebliche Gestaltbarkeit der Bürgerarbeit gewertet werden, deren Ausschöpfung freilich eine sehr projektnahe Beobach-tung und Steuerung voraussetzt.
Die Erweiterung von Wissensbeständen erfolgte in erster Linie informell, durch eine umfassende Einarbeitung und durch learning-by-doing. Allerdings gaben immerhin 28 Prozent der Befragten im März/April 2007 an, dass für ihre Bürgerarbeitstätigkeit eine Weiterbildung nötig wäre. Eine formale Weiterbildung fand bis zum März/April 2007 nicht oder nur in Ausnahmefällen statt. In der Zeit zwischen erster und zweiter Befragung (März/April bzw. November) nahmen immerhin 13 Prozent der Bürgerarbeiter an einer Weiterbildung teil, die ihnen in fast allen Fällen von ihrer Einsatzstelle angeboten wurde. Diese Weiterbildungen fanden vorrangig in Form von internen (7 Prozent) bzw. externen (6 Prozent) Lehrgängen, Seminaren oder Vorträgen statt.
Inhaltlich orientierten sich die Angebote an Weiterbildung erwartungsgemäß sehr stark an der täglichen Arbeit der Bürgerarbeiter. Typisch hierfür sind Vorträge und Seminare zum „Umgang mit Demenzerkrankten“ für einige Bürgerarbeiter in den Pflegeeinrichtungen oder diverse Formen von Sägescheinen für die Bürgerarbeiter, die u. a. mit der Pflege von Bäumen und Sträuchern beschäftigt sind.
Diese unterschiedlichen Effekte für das Humankapital der Bürgerarbeiter werden auch in Abbildung 8 deutlich: Nur die Bürgerarbeiter aus den Sozialbetrieben mit Alten- und Krankenpflege sowie aus dem kommunalen Bereich können darauf verweisen, dass sie in der Projektlaufzeit seit der ersten Befragung neue Kenntnisse erworben und eingesetzt haben.
Das Ausmaß der erworbenen neuen Kenntnisse und Fähigkeiten schätzten die Bürgerarbeiter insgesamt, über alle Einsatzstellenbereiche hinweg, mit einem Wert von 4,18 als recht hoch ein. Dies gilt für beide Befragungszeitpunkte (März/April und November 2007). Allerdings fallen die Bewertungen bei der zweiten Befragung, im November 2007, nur bei den Bürgerarbeitern aus Sozialbetrieben ohne Alten- und Krankenpflege und aus kommunalen Projekten etwas besser aus; bei allen anderen hat sich die Bewertung leicht verschlechtert.
Bürgerarbeit aus Sicht der Bürgerarbeiter
37
Abbildung 8: Einsatz und Erwerb von Kenntnissen durch Bürgerarbeit (N =97/91)
3,683,52
2,64
4,174,033,95
3,73
3,06
3,85 3,73
4,654,50
4,004,004,30
3,40
1
2
3
4
5
6
SB1 SB2 V K SB1 SB2 V K
Einsatz von Kenntnissen Erwerb neuer Kenntnisse
März/April 2007November 2007
Abkürzungen: SB1 = Sozialbetriebe ohne Alten- und Krankenpflege, SB2 = Sozialbetriebe mit Alten- und Krankenpflege, V = Vereine, K = kommunale Projekte
Legende: 1 = sehr niedrig, 2 = niedrig, 3 = eher niedrig, 4 = eher hoch, 5 = hoch, 6 = sehr hoch
In der Perspektive der Bürgerarbeiter stehen allerdings der Erwerb und die Nutzung neuer Kenntnisse nicht an erster Stelle. Die Bürgerarbeiter selbst schätzen an der Bürgerarbeit an erster Stelle die Möglichkeit, überhaupt wieder einer Arbeit nachgehen zu können. Zugleich gibt zirka die Hälfte der Befragten im März/April 2007 an, Bürgerarbeit sei gesellschaftlich wichtig. Das Gefühl, wieder gebraucht zu werden, spielt in ihrer Einschätzung der Bürgerar-beit eine wichtige Rolle.
Die hier aus der Perspektive der Bürgerarbeiter dargestellte Bedeutung der mit Bürgerarbeit verbundenen gesellschaftlichen Anerkennung wurde in der zweiten Befragungswelle von November 2007 bis Februar 2008 auch von den Vertretern der Einsatzstellen, der Träger und der Stadt Bad Schmiedeberg deutlich hervorgehoben. Hierauf ist in Kapitel 4 noch detaillier-ter einzugehen.
Zwischenbilanz
Die Durchführung von Bürgerarbeit in den Einsatzstellen ist „ normaler" Erwerbsarbeit
weitgehend ähnlich. Bürgerarbeiter sind insofern in den Einsatzstellen und durch sie sozial
integriert. Die Erfahrung einer stärkeren sozialen Teilhabe resultiert jedoch nicht nur aus der
Möglichkeit, einer konkreten Tätigkeit nachgehen zu können. Zumindest ein Teil der
Bürgerarbeiter hatte bzw. hat zudem das Gefühl, etwas sozial bzw. gesellschaftlich Sinnvolles
tun zu können.
Weniger unmittelbar auf die Bürgerarbeiter bezogen, jedoch durchaus ebenfalls als wichtiger
Aspekt sozialer Integration zu bewerten, ist ferner die Tatsache, dass Langzeitarbeitslose
durch das Projekt in der Kommune selbst wieder sichtbar und anerkannt wurden. In Bad
Schmiedeberg hat sich offenkundig eine ganze Gemeinde mit der Lage „ ihrer“
Langzeitarbeitslosen beschäftigt und nach Lösungen für sie gesucht, wobei zahlreiche
Akteure einbezogen wurden. Wie Vertreter der Träger, der Einsatzstellen und der Gemeinde
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
38
bestätigten, hat dies auch zur sozialen Integration in der Gemeinde beigetragen. Zugleich
erwies sich die in Bad Schmiedeberg bereits bestehende hohe soziale Integration als eine
wesentliche Erfolgsvoraussetzung des Projektes.
3.2 Die Bewer tung ihrer Arbeit durch die Bürgerarbeiter
3.2.1 Der Nutzen für die Bürgerarbeiter
Der größte Nutzen von Bürgerarbeit für die Bürgerarbeiter selbst ergibt sich unmittelbar aus dem überragenden Teilnahmemotiv, endlich wieder einer Beschäftigung nachgehen zu können. Dabei beschränkt sich der Nutzen von Bürgerarbeit jedoch nicht auf die bloße bessere Integration bisher Ausgeschlossener in die Arbeitsgesellschaft. Fast alle Bürgerarbei-ter haben angesichts der Art ihrer jeweiligen Tätigkeit, aber auch angesichts der damit verbundenen finanziellen Vorteile das Gefühl, wieder nützlich und gebraucht und deshalb sozial anerkannt zu sein.
Dies zeigt sich sehr deutlich in den beiden Befragungen, in deren Rahmen die Bürgerarbeiter gebeten wurden, auf einer sechsstufigen Skala Zustimmung oder Ablehnung zu einer Reihe von Aussagen über Bürgerarbeit zu äußern. 95 Prozent stimmten der Aussage zu, „Durch Bürgerarbeit fühle ich mich nützlich/gebraucht.“ 90 Prozent äußerten Zustimmung zu der Aussage: „Durch Bürgerarbeit fühlen sich die anderen Bürgerarbeiter nützlich/gebraucht.“
Etwas differenzierter, aber immer noch deutlich positiv, fällt die Stellungnahme der Bürgerarbeiter zu der Frage aus, wie die Bevölkerung von Bad Schmiedeberg Bürgerarbeit sieht: 52 Prozent der Bürgerarbeiter stimmten der Aussage, „Die Leute aus Bad Schmiedeberg denken, dass Bürgerarbeiter etwas nützliches tun.“ zu. Berücksichtigt man auch die abge-schwächte Aussage „stimme eher zu“ , so erhöht sich der Zustimmungswert auf 79 Prozent.
Bürgerarbeit besitzt erhebliche Bedeutung für die Lebensplanung und das Selbstwertgefühl. Auch verhilft sie den Bürgerarbeitern zu Kontakten, die ihnen unter anderem bei der Arbeitssuche weiterhelfen könnten, gibt ihnen (wieder) eine sinnvolle Perspektive und hilft auch, einen scheinbar verlorenen Platz im Leben wiederzufinden.
Dies belegen nicht zuletzt die teilweise ausgesprochen hohen Zustimmungswerte der befrag-ten Bürgerarbeiter zu mehreren Aussagen, die in Abbildung 9 veranschaulicht sind.
Darüber hinaus lassen sich Momente des Humankapitalerhaltes feststellen, wenngleich die Potenziale hierbei aus unserer Sicht noch nicht ausgeschöpft sind. Durch eine gezielte Steuerung ließen sich möglicherweise weitere Verbesserungen erzielen. Auf alle Fälle sollten die – in den Einsatzstellen durchaus vorhandenen – Möglichkeiten zur Weiterbildung genutzt werden.
Bürgerarbeit aus Sicht der Bürgerarbeiter
39
Abbildung 9: Bedeutung der Bürgerarbeit für die Bürgerarbeiter (N =91)
20,69
9,3
15,48
49,43
31,4
44,05
6,9
23,26
21,43
13,79
18,6
11,9
6,9
16,28
5,95
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Durch BüA habe ich neue Kontakte, die mir eventuellweiterhelfen.
Durch BüA habe ich meinen Platz im Leben gefunden.
Die meisten BüAer sehen nun wieder eine Perspektivefür sich.
Stimme voll zu. Stimme zu. Stimme eher zu.
Stimme eher nicht zu. Stimme nicht zu. Stimme überhaupt nicht zu.
Legende: BüA = Bürgerarbeit BüAer = Bürgerarbeiter
Ein beträchtlicher Teil der Bürgerarbeiter hatte des Weiteren einen finanziellen Nutzen durch Bürgerarbeit, der weiter unten (Kapitel 3.2.6) detaillierter dargestellt ist. Das betrifft vor allem jene Personen, die vor Aufnahme der Bürgerarbeit ALG2 oder keine Leistungen bezogen. So stimmten 83 Prozent der Bürgerarbeiter der Aussage zu: „Durch Bürgerarbeit geht es mir finanziell besser.“ . Der auf die anderen Bürgerarbeiter bezogenen Aussage „Durch Bürgerar-beit geht es anderen Bürgerarbeitern finanziell besser.“ , stimmten 86 Prozent zu.
Deutlich sichtbar wird dieser Nutzen von Bürgerarbeit, wenn die Bürgerarbeiter gebeten werden, auf einer zehnstufigen aufsteigenden Skala den Grad ihrer Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen zu markieren. Hierbei ergeben sich Durchschnittswerte, die durchgängig im positiven Bereich liegen und teilweise, vor allem bei Partnerschaft und Arbeit, ausgesprochen hoch sind.
Der Vergleich zwischen den Befunden aus beiden Befragungen belegt, dass das Zufrie-denheitsniveau in der Zeit zwischen März/April und November 2007 im Hinblick auf keinen Sachverhalt gesunken, bei einigen Bereichen jedoch deutlich gestiegen ist. Am stärksten stieg – sicherlich in engem Zusammenhang mit den vielfach positiven Veränderungen des Einkommens – die Zufriedenheit mit dem Lebensstandard, wie Abbildung 10 zeigt.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
40
Abbildung 10: Zufriedenheitsindikatoren (N =97/91)
8,63
5,56
5,81
8,09
9,01
6,68
8,72
5,56
5,82
8,38
9,08
7,06
7,72
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arbeit
Haushalts eink om m en
Individualeink om m en
Wohnung
Par tners chaft
Lebens s tandard
Leben allgem ein*
Novem ber 2007
März/Apr il 2007
* Nach diesem Indikator wurde im März/April 2007 nicht gefragt.
Die meisten Bürgerarbeiter würden sich – „auf jeden Fall“ – wieder für eine Bürgerarbeits-stelle entscheiden. Dies galt im März/April für 92 Prozent und im November 2007 sogar für 96 Prozent der Befragten.
3.2.2 Einschätzung der Belastungen und Anforderungen im Allgemeinen
Eine wichtige Aufgabe der Befragungen und Gespräche, die im Rahmen der Evaluation in Bad Schmiedeberg stattfanden, war es, zu ermitteln, wie die Bürgerarbeiter und die Einsatzstellen die gesundheitlichen, körperlichen und sozialen Belastungen ihrer Arbeit einschätzten. Die Ergebnisse werden in mehreren Schritten dargestellt.
Bürgerarbeit verbindet sich, folgt man ihrer Beurteilung sowohl durch die Beschäftigten als auch durch die Vertreter der Einsatzstellen, kaum mit größeren Belastungen und Anforderun-gen. Dies gilt insbesondere im Vergleich zu den im Ort üblichen Ein-Euro-Jobs.
Wie Abbildung 11 erkennen lässt, stuften die Bürgerarbeiter die für sie relevanten körperli-chen Anforderungen, gesundheitlichen Belastungen und Belastungen durch die Organisation in der Einsatzstelle im Mittel der beiden Befragungen als „gering“ , allenfalls als „eher gering“ ein. Diese Einschätzung wird von den Vertretern der Einsatzstellen, der Kommune und der Träger weitgehend geteilt. Sie nahmen Bürgerarbeit, auch im Vergleich zu den Ein-Euro-Jobs, als weniger körperlich anstrengend wahr.
Bürgerarbeit aus Sicht der Bürgerarbeiter
41
Abbildung 11: Anforderungen und Belastungen durch Bürgerarbeit (N =97/91)
2,33
2,06
2,95
4,75
2,58
2,06
3,32
4,82
1 2 3 4 5 6
GesundheitlicheBelastungen
ArbeitsorganisatorischeBelastungen
KörperlicheAnforderungen
Soziale Anforderungen
März/April 2007 November 2007
Legende: 1 = sehr niedrig, 2 = niedrig, 3 = eher niedrig, 4 = eher hoch, 5 = hoch, 6 = sehr hoch
Dieses Ergebnis ist durchaus überraschend, weil von den Bürgerarbeitern offenkundig in einem beachtlichen Maße zeitliche Flexibilität gefordert wird, und zudem angesichts des vergleichsweise großen Umfangs von sozial orientierten Tätigkeiten, insbesondere im Bereich der Alten- und Krankenpflege, nicht ganz unerhebliche gesundheitliche und speziell auch psychische Belastungen zu erwarten waren. Um dem Rechnung zu tragen, wurde bereits im Zwischenbericht zwischen Sozialbetrieben unterschieden, die sich der Alten- und Krankenpflege widmen, und solchen, deren Tätigkeit vorrangig in der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Gästen der Einsatzstellen besteht.
Betrachtet man die Bewertung der Belastungen und Anforderungen nach Typ der Einsatz-stelle, so werden in den beiden Befragungswellen März/April und November 2007 deutliche Unterschiede sichtbar, vor allem im Hinblick auf gesundheitliche Belastungen und auf Belastungen, die aus der Arbeitsorganisation resultieren. Dies legt es nahe, die Belastungsar-ten getrennt zu behandeln – gesundheitliche und organisatorische Belastungen auf der einen sowie körperliche und soziale Anforderungen auf der anderen Seite.
3.2.3 Gesundheitliche und arbeitsorganisator ische Belastungen
Die gesundheitlichen Belastungen werden vor allem von Bürgerarbeitern in der Alten- und Krankenpflege im März/April 2007 signifikant höher eingeschätzt als in den anderen Einsatzbereichen, wobei allerdings der von ihnen auf einer sechsstufigen Skala im Durchschnitt angegebene Wert lediglich 2,84 („eher niedrig“ ) beträgt.
Insgesamt ist im Projektverlauf bei allen Einsatzstellentypen eine deutliche Erhöhung der Werte zu den gesundheitlichen Belastungen zu vermerken. Die stärkste Zunahme verzeichnen dabei die Bürgerarbeiter in den Sozialbetrieben ohne Alten- und Krankenpflege (+0,42 Punkte auf einen Wert von 2,35). In der Alten- und Krankenpflege stieg der bereits schon bei der ersten Befragung relativ hohe Wert bis zum November 2007 auf 3,17 („eher hoch“ ) und stellt damit den höchsten Belastungswert unter den Einsatzstellentypen dar.
Wenngleich gute Gründe dafür sprechen, dass dieser Anstieg unmittelbar als Indiz für eine Erhöhung der gesundheitlichen Belastungen an den Arbeitsplätzen gewertet werden kann, so
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
42
äußern sich Beanspruchungen in aller Regel erst mit einer bestimmten Latenzzeit als Belastungen. Weiterhin führt auch die im Zeitverlauf zunehmende Integration in die Arbeitsabläufe dazu, dass sich die individuell wahrgenommenen Belastungen und Beanspruchungen auf das „Normalmaß“ im jeweiligen Tätigkeitsbereich einpendeln. Dieses ist, wie die jährlichen Krankenstandsberichte der Krankenkassen belegen, in den Kranken- und Altenpflegeberufen im Vergleich zu anderen Berufs- und Tätigkeitsfeldern ausgespro-chen hoch.
Auch bei den arbeitsorganisatorischen Belastungen sind erhebliche Unterschiede zwischen den Typen von Einsatzstellen zu verzeichnen. Am höchsten werden diese von den Bürgerarbeitern eingeschätzt, die in Vereinen beschäftigt sind. Dies dürfte recht eng damit zusammenhängen, dass ihre Arbeitszeit am häufigsten in den Abendstunden, das heißt zwischen 19 und 22 Uhr, liegt; 65 Prozent von ihnen arbeiten mehrmals in der Woche, wochenweise oder bei Bedarf am Abend. Offensichtlich wird die Notwendigkeit, familiäre Verpflichtungen und abendliche Arbeitszeiten zu vereinbaren, als erhebliche Belastung empfunden.
Abbildung 12: Arbeitsorganisatorische und gesundheitliche Belastungen der Bürgerarbeiter nach Typ der Einsatzstelle (N =97/91)
1,562,04 2,04
2,361,93
2,84
2,22 2,052,53 2,35
3,17
2,532,17
1,90 2,062,30
1
2
3
4
5
6
SB1 SB2 V K SB1 SB2 V K
März/Apr il 2007
Novem ber 2007
Abkürzungen: SB1 = Sozialbetriebe ohne Alten- und Krankenpflege, SB2 = Sozialbetriebe mit Alten- und Krankenpflege, V = Vereine, K = kommunale Projekte
Legende: 1 = sehr niedrig, 2 = niedrig, 3 = eher niedrig, 4 = eher hoch, 5 = hoch, 6 = sehr hoch
Die Bürgerarbeiter, die in erster Linie im Bereich der Kinder-, Jugend- und Besucherbetreu-ung eingesetzt waren, stuften hingegen die arbeitsorganisatorischen Belastungen niedriger ein als die Angehörigen der anderen Einsatzstellenbereiche, einschließlich der im Bereich der Alten- und Krankenpflege Tätigen.
Belastungen, die als Folge der Arbeitsorganisation auftreten, haben im Projektverlauf bei den Bürgerarbeitern in den beiden Typen von Sozialbetrieben und den Vereinen zugenommen (oder werden zumindest als gestiegen wahrgenommen).
3.2.4 Anforderungen an körper liche Leistungsfähigkeit und soziale Kompetenz
Die körperliche Leistungsfähigkeit und soziale Kompetenz wurde von den Bürgerarbeitern ebenfalls auf einer Sechser-Skala von 1 (sehr niedrig) bis 6 (sehr hoch) eingeschätzt.
Arbeitsorganisator ische Belastungen Gesundheitliche Belastungen
Bürgerarbeit aus Sicht der Bürgerarbeiter
43
Betrachtet man in Abbildung 13 die Einschätzung der körperlichen Anforderungen, so zeigt sich in der ersten Befragung, März/April 2007, ein alles in allem recht ausgeglichenes Bild. Die Mittelwerte variieren lediglich von 2,75 (Sozialbetriebe ohne Alten- und Krankenpflege) bis 3,09 (Kommune). Beim Vergleich der Ergebnisse der ersten und der zweiten Befragung werden allerdings drei interessante Sachverhalte sichtbar.
Nach Angabe der Bürgerarbeiter zeigt sich erstens insgesamt, also im Mittel über alle Typen von Einsatzstellen, eine leichte Zunahme der Einschätzung körperlicher Anforderungen von 2,95 (März/April 2007) auf 3,13 (November 2007).
Zweitens nehmen aber auch die Unterschiede zwischen den Einsatzstellentypen deutlich zu, wobei die Bürgerarbeiter aus Sozialbetrieben der Alten- und Krankenpflege im November mit 3,65 eine eindeutige Spitzenposition einnahmen, während die Bürgerarbeiter aus den übrigen Sozialbetrieben die körperlichen Anforderungen mit einem Mittelwert von 2,65 deutlich niedriger einschätzten als alle anderen Bürgerarbeiter.
Drittens sind schließlich auch innerhalb der Einsatzstellentypen erhebliche Unterschiede in der Entwicklung von März/April bis November 2007 zu beobachten. Während der Mittelwert der Bürgerarbeiter, die in Sozialbetrieben der Alten- und Krankenpflege beschäftigt sind, bezüglich der an sie gestellten körperlichen Anforderungen bei der ersten Befragung mit 3,00 nur knapp über dem Durchschnitt lag, schätzten sie diese im November 2007 mit 3,65 um mehr als 20 Prozent höher ein. Hingegen ist bei den Sozialbetrieben ohne Pflege und den kommunalen Projekten von der ersten zur zweiten Befragung sogar eine leichte Abnahme der Einschätzung der körperlichen Belastungen zu verzeichnen.
Schon in Abbildung 9 hatte sich gezeigt, dass die Anforderungen an die soziale Kompetenz von einem großen Teil der Bürgerarbeiter als hoch wahrgenommen wurden. Im Durchschnitt aller Bürgerarbeiter errechnet sich im Mittel der beiden Befragungen ein Wert von knapp 4,80 Punkten, was einem „hohen“ Wert entspricht. Die Werte der beiden Befragungen lagen bei 4,75 (März/April) und 4,82 (November), differieren also mit leicht ansteigender Tendenz nur sehr wenig.
Diese Werte können, da sie, wie aus Abbildung 13 ersichtlich, im Wesentlichen für alle vier Typen von Einsatzstellen gelten, nicht auf Merkmale der konkret ausgeübten Tätigkeit zurückgeführt werden. Auch die zum Zeitpunkt der ersten Befragung an sich naheliegende und durch Einschätzungen seitens der Einsatzstellenvertreter gestützte Annahme, dass der hohe Wert Ausdruck der damals noch nicht abgeschlossenen Einarbeitung in eine neue Tätigkeit, in einen neuen Betrieb bzw. eine neue Organisation und des Einübens der Zusammenarbeit mit neuen Kollegen sei, ist angesichts der geringen Differenz zwischen den Ergebnissen der beiden Befragungen nicht haltbar.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
44
Abbildung 13: Körperliche und soziale Anforderungen an die Bürgerarbeiter
(N =97/91)
2,752,98 3,09
4,634,96
4,71
3,27
4,45
5,13
4,584,90
3,00
4,60
2,653,00
3,65
1
2
3
4
5
6
SB1 SB2 V K SB1 SB2 V K
März/April 2007
November 2007
Abkürzungen: SB1 = Sozialbetriebe ohne Alten- und Krankenpflege, SB2 = Sozialbetriebe mit Alten- und Krankenpflege, V = Vereine, K = kommunale Projekte
Legende: 1 = sehr niedrig, 2 = niedrig, 3 = eher niedrig, 4 = eher hoch, 5 = hoch, 6 = sehr hoch
Die von den Bürgerarbeitern wahrgenommenen und im Interview bewerteten sozialen Anfor-derungen entspringen offenkundig nicht allein der Umstellung auf ein wieder fest strukturier-tes Arbeitsleben sowie der Einstellung auf neue Vorgesetzte und Kollegen. Vielmehr scheinen hier Faktoren eine Rolle zu spielen, die sich u. a. aus dem Projekt Bürgerarbeit selbst ergeben. Hierzu gehören z. B. die bis in den Sommer hinein hohe publizistisch-mediale Beachtung des Pilotvorhabens, die öffentliche Wahrnehmung von Bürgerarbeit in der Region selbst, Gespräche in die die Bürgerarbeiter verwickelt oder einbezogen wurden, aber auch das Anfertigen der Tätigkeitsnachweise und die Kontrollen zur Einhaltung der Tätigkeitsbereiche sowie die hieraus entstehenden Differenzen.
Schließlich muss auch bedacht werden, dass Bürgerarbeiter Erwartungen zu erfüllen haben, die über das Bild normaler Erwerbstätigkeit hinausgehen: Sie sollen – aus Sicht der Einsatzstellenleiter – selbstständig, flexibel und verantwortungsbewusst arbeiten, dabei aber nicht die Grenze der zwischen Agentur/ARGE und Träger festgeschriebenen Tätigkeitsberei-che ihres Arbeitsplatzes überschreiten, selbst wenn dies in der Praxis manchmal schwer einzuhalten ist und wenn sich daraus sehr wohl auch Diskussionen und Auseinandersetzungen ergeben können. Gleichzeitig sind sie verpflichtet, sich weiterhin regelmäßig zu bewerben und diese Bemühungen gegenüber der Agentur/ARGE nachzuweisen. Endlich kann natürlich auch die zum Ende des Jahres 2007 erwartete Entscheidung, ob und in welchem Rahmen Bürgerarbeit ab Januar 2008 weitergeführt wird, von den Bürgerarbeitern als soziale Belastung empfunden worden sein.
Zwischenbilanz
Aus Sicht der Bürgerarbeiter ist Bürgerarbeit im Mittel über alle Einsatzstellentypen nur mit
relativ geringen Belastungen und Beanspruchungen verbunden. Differenziert nach dem Typ
der Einsatzstelle zeigen sich aber doch erhebliche Unterschiede, die durchaus mit den
Belastungseinschätzungen „ normaler“ Erwerbstätigkeit in den entsprechenden Wirtschafts-
bereichen vergleichbar sind.
Körper liche Anforderungen Soziale Anforderungen
Bürgerarbeit aus Sicht der Bürgerarbeiter
45
Bürgerarbeiter in der Alten- und Krankenpflege erfahren die höchsten gesundheitlichen
Belastungen, gleichwohl liegt ihre (verbale) Einschätzung zur Höhe dieser Werte zwischen
„ eher niedrig“ bis „ eher hoch“ .
Die höchsten arbeitsorganisatorischen Belastungen werden von den Bürgerarbeitern aus den
Vereinen angezeigt. Diese ergeben sich offensichtlich aus der, mit solchen Einsatzstellen
scheinbar eng verbundenen, notwendigen Flexibilität der Arbeitszeit und den daraus
resultierenden Anforderungen an die Organisation der Vereinbarkeit von Familie und
Erwerbstätigkeit. Zwei Drittel der Bürgerarbeiter aus den Vereinen arbeiten mehrmals in der
Woche oder bei Bedarf in den Abendstunden.
Wie die gesundheitlichen und arbeitsorganisatorischen Belastungen scheinen sich auch die
körperlichen Anforderungen, die sich aus der Tätigkeit ergeben, erhöht zu haben. Auf die
höchsten Belastungen und auf eine Zunahme dieser im Projektverlauf verweisen die
Bürgerarbeiter aus den Sozialbetrieben mit Alten- und Krankenpflege und aus den Vereinen.
Die Anforderungen an die soziale Kompetenz werden von den Bürgerarbeitern aller
Einsatzstellentypen als relativ hoch wahrgenommen und können somit kaum auf die konkret
ausgeübte Tätigkeit zurückgeführt werden. Vielmehr scheinen sich hier Prozesse und
Faktoren niederzuschlagen, die mit dem Projekt Bürgerarbeit selbst verbunden sind. Dazu
zählen einerseits äußere Faktoren wie eine hohe publizistisch-mediale Beachtung des
Projektes und die öffentliche Wahrnehmung in der Region und andererseits innere Faktoren
wie (öffentliche) Gespräche, in die die Bürgerarbeiter involviert sind, das Anfertigen der
Tätigkeitsnachweise und das Einhalten der Tätigkeitsbereiche sowie die hieraus durchaus
manchmal auch entstehenden Differenzen.
3.2.5 Zufr iedenheit mit der Tätigkeit
Wie bereits erwähnt, bewerteten die befragten Bürgerarbeiter sowohl das Verhältnis zu den Kollegen als auch die Beziehung zu den unmittelbaren Vorgesetzten bzw. den Ansprechpart-nern durchweg als gut.
Die Vertreter der Einsatzstellen hoben ebenfalls die aus ihrer Sicht weitgehend unproblematische Integration der Bürgerarbeiter in den Alltag der Einsatzstellen hervor, was vor allem im Vergleich zu den Beschäftigten in anderen Maßnahmeformen, insbesondere in Ein-Euro-Jobs, gelte. Die Einsatzstellenverantwortlichen betonten dabei jedoch, dass dies nicht nur eine Folge der Sozialauswahl sei, sondern vor allem auch ein Resultat der „Maßnahmegestaltung“ . Da die Ein-Euro-Jobs in der Regel auf sechs Monate befristet sind und der Erfahrung nach weitaus seltener Tätigkeiten im sozialen Bereich umfassen, sei es schwieriger und vielleicht auch nicht sinnvoll, die dort Beschäftigten in die Einsatzstelle zu integrieren.
Angesichts der als vergleichsweise gering empfundenen Belastungen und Anforderungen und angesichts des durchweg positiven Feedbacks von den Einsatzstellen wundert es nicht, dass 60 Prozent der Bürgerarbeiter auf die Frage, was man denn unbedingt an ihrer aktuellen Tätigkeit verändern sollte, antworteten, es gäbe momentan nichts zu ändern. Wurden Änderungswünsche genannt, dann bezogen sie sich in erster Linie auf Verbesserungen der
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
46
Arbeitsplatzausstattung und der Arbeitsorganisation. Die Tätigkeiten, die die Bürgerarbeiter ausüben, aber auch das Projekt an sich sollten nach Ansicht der Teilnehmer so bleiben, wie bisher.
Dies bestätigt auch das Ergebnis der im Interview gestellten Frage nach der Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit. Der Zufriedenheitswert liegt – auf einer Skala von 0 (sehr unzufrie-den) bis 10 (sehr zufrieden) – bei sensationellen 8,8 Punkten. Ein höherer Mittelwert war nur bei der Einschätzung der Partnerschaft zu verzeichnen.
Unterschiede zwischen den beiden Befragungszeitpunkten zeigten sich hierbei nicht.
3.2.6 Bewertung des Nettohaushaltseinkommens
(a) Methodische Bemerkungen
Mit der Aufnahme einer Bürgerarbeit können sich sehr unterschiedliche positive wie negative Konsequenzen für das Nettoeinkommen des Haushaltes verbinden. Während sich das individuelle Einkommen nach den geltenden gesetzlichen Regelungen durch den Eintritt in Bürgerarbeit nicht verringern kann, sind erhebliche Veränderungen im Nettoeinkommen des Haushaltes möglich. Diese Veränderungen ergeben sich vor allem aus dem vorhergehenden Leistungsstatus als ALG1-Empfänger, als ALG2-Empfänger und als Nichtleistungsempfän-ger. Sie hängen demzufolge vor allem mit Veränderungen in der jeweiligen Bedarfsgemein-schaft zusammen.
Bei der Befragung und ihrer Auswertung zeigte sich allerdings, dass die hier wirksamen Regelungen und Zusammenhänge nicht immer vollständig verstanden wurden. Dies legt es nahe, vorwiegend das jeweilige Nettoeinkommen des Haushalts zu betrachten.
(b) Das Nettoeinkommen der Bürgerarbeiter und ihrer Haushalte
Wie weiter vorn schon angeführt, wird für Bürgerarbeit eine Entgeltpauschale gewährt, die je nach Anforderungsniveau zwischen 675 Euro und 975 Euro Brutto liegen kann. Tatsächlich zeichneten sich die gezahlten Pauschalen in Bad Schmiedeberg durch eine deutlich geringere Spannweite aus. Sie lagen nach Angaben der Bürgerarbeiter zwischen 800 und 900 Euro (vgl. hierzu auch Kapitel 5). Im Mittel bezog ein Bürgerarbeiter 825 Euro (arithmetisches Mittel).
Erwartungsgemäß variiert das aus Bürgerarbeit bezogene Nettoeinkommen stärker. Es lag durchschnittlich bei 643 Euro (März/April 2007) bzw. 652 Euro (November 2007). Etwas über die Hälfte der befragten Bürgerarbeiter gab an, eine Verbesserung ihrer finanziellen Situation sei ein Motiv für die Aufnahme der Bürgerarbeitstätigkeit gewesen.
Die Angaben zur Veränderung des Haushaltsnettoeinkommens durch Bürgerarbeit legen die Annahme beträchtlicher Verbesserungen nahe. So gaben bei der ersten Befragung, im Frühjahr 2007, rund 67 Prozent der Bürgerarbeiter an, ihr Haushaltseinkommen habe sich verbessert; jeweils 12 Prozent der Bürgerarbeiter berichteten, das Haushaltseinkommen sei gleich geblieben bzw. gesunken.
Aus Abbildung 14 geht hervor, dass hierbei deutliche Unterschiede zwischen den Angehöri-gen der beiden Rechtskreise des SGB zu vermerken sind.
Bürgerarbeit aus Sicht der Bürgerarbeiter
47
Abbildung 14: Veränderung des Haushaltsnettoeinkommens durch Bürgerarbeit
(N =97, in Prozent, März/April 2007)
35
100
20 154
45
75
96
0
20
40
60
80
100
ALG1 ALG2 NLB
geringer
gleich
größer
Legende: NLB = Nichtleistungsbezieher
Eine Verbesserung ihres Haushaltseinkommens wird vor allem von (ehemaligen) ALG2-Beziehern und, aus naheliegenden Gründen, von Nichtleistungsbeziehern berichtet. Diese Einkommensverbesserungen spiegeln sich auch in der Zufriedenheit mit der Einkommenssituation wider.
(c) Die Einkommenszufriedenheit
Insgesamt lag im März/April 2007 die Zufriedenheit der Bürgerarbeiter mit dem Haushaltseinkommen auf einer zehnstufigen Skala bei 5,62 Punkten. Bei den Personen, die angaben, dass sich ihr Haushaltseinkommen durch die Teilnahme an Bürgerarbeit verbessert habe, erreichte der Mittelwert sogar 6,19 Punkte. Demgegenüber waren die Personen, die angaben, ihr Haushaltseinkommen habe sich nicht verbessert bzw. sogar verschlechtert, mit 4,58 Punkten deutlich weniger zufrieden.
Ähnlich variiert im Übrigen auch die Zufriedenheit mit dem individuellen Einkommen: Insbesondere waren im März/April 2007 bisherige Nichtleistungsbezieher mit ihrem persönlichen Einkommen deutlich zufriedener (6,71 Punkte) als Personen, die vor der Aufnahme von Bürgerarbeit ALG1 oder ALG2 bezogen (5,74 bzw. 5,63 Punkte).
Im November 2007 sind diese Unterschiede noch deutlicher ausgeprägt: Ehemalige Nichtleis-tungsbezieher sind mit einem Mittelwert von 7,14 Punkten mit ihrem persönlichen Einkommen aus Bürgerarbeit wesentlich zufriedener als Bürgerarbeiter, die vorher ALG1 oder ALG2 erhielten (5,43 bzw. 5,36 Punkte). Von der ersten zur zweiten Befragung nahm damit die Zufriedenheit der vormaligen Nichtleistungsbezieher mit dem Einkommen weiter zu, während sie bei Personen, die ehemals ALG1 oder ALG2-Bezieher waren, eher gesunken ist.
Festzuhalten ist, dass die Zufriedenheit mit dem individuellen Einkommen und mit dem Haushaltseinkommen zu beiden Befragungszeitpunkten erkennbar unter der (geäußerten) Zufriedenheit mit der aktuell ausgeübten Tätigkeit lag. In Anbetracht der außerordentlich hohen Zufriedenheit mit der ausgeübten Tätigkeit sollte man diesen Befund allerdings nicht überbewerten. Er belegt vor allem, dass Bürgerarbeiter über eine ausgesprochen hohe Arbeitsorientierung verfügen, der durch Bürgerarbeit entsprochen wird. Im November 2007
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
48
widersprachen 67 Prozent der befragten Bürgerarbeiter der Aussage „Arbeit ist nur ein Mittel zum Geldverdienen“. 94 Prozent der Befragten betonten, dass sie auch dann gern berufstätig wären, wenn sie das Geld nicht bräuchten. Ebenso erfährt die Aussage „berufliche Arbeit ist die wichtigste Tätigkeit des Menschen“ mit 76 Prozent eine ausgesprochen hohe Zustim-mung.
Zwischenbilanz
Bürgerarbeit führte zu einer Verbesserung der finanziellen Situation der Einzelnen bzw. ihres
Haushaltes, und zwar speziell bei Personen, die vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit ALG2 oder
keine Leistungen bezogen. Dies ist insbesondere mit Blick auf die sogenannten Nichtleis-
tungsbezieher nicht unproblematisch, erhielten sie ja vor allem aufgrund des Einkommens
ihrer Bedarfsgemeinschaft keine Leistungen.
Bürgerarbeiter zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsorientierung aus, welcher mit
Bürgerarbeit entsprochen wird. Vor allem aus der Befriedigung dieser Arbeitsorientierung
ziehen Bürgerarbeiter ihre hohe Motivation und Leistungsbereitschaft sowie die Steigerung
ihres Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins.
3.3 Arbeitssuche und Chancen auf dem Arbeitsmarkt
3.3.1 Häufigkeit der Stellensuche
Bürgerarbeiter sollen dem ersten Arbeitsmarkt weiter zur Verfügung stehen und sind deshalb aufgefordert, sich regelmäßig auf in Frage kommende Stellen zu bewerben. Die Bewerbungsaktivitäten werden durch die zuständige Agentur bzw. ARGE überprüft. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass bis auf sehr wenige – altersbedingte – Ausnahmen alle Bürgerarbeiter weiter nach einer regulären Erwerbstätigkeit Ausschau halten.
Vergleicht man die Ergebnisse der ersten und der zweiten Befragung, März/April und No-vember 2007, so ist sogar eine leichte Verstärkung der Bewerbungsaktivitäten zu verzeich-nen: Bei der ersten Befragung, im März/April 2007, gaben drei Viertel der Befragten (74 Prozent) an, sie würden sich ebenso häufig wie vor Aufnahme der Bürgerarbeitstätigkeit bewerben. 18 Prozent erklärten, dies nach Beginn der Bürgerarbeit sogar häufiger zu tun als bisher. Nur acht Prozent berichteten, sich nunmehr seltener zu bewerben als vor Beginn der Bürgerarbeit. Bei der zweiten Befragung, im November, befanden sich sogar 95 Prozent der Bürgerarbeiter nach eigener Aussage auf Arbeitssuche.
3.3.2 Regionale Begrenzung der Stellensuche und Suchwege
Bei unseren Gesprächen vor Ort hörten wir häufig, dass die Bewerbungsaktivitäten in gewisser Weise an eine „natürliche“ Grenze stoßen würden, da es an geeigneten Angeboten mangele. Dies ist ohne Zweifel richtig, aber erklärt doch sicherlich nicht alles.
Offenkundig konzentrieren sich, wie Abbildung 15 erkennen lässt, die Suchbemühungen der Bürgerarbeiter ausgesprochen stark auf Bad Schmiedeberg und die unmittelbare Umgebung.
Bürgerarbeit aus Sicht der Bürgerarbeiter
49
Abbildung 15: Region der Stellensuche (in Prozent, N =97/91)
72,22
15,563,33 8,88
67,44
16,274,65
11,62
0
20
40
60
80
100
Bad Schm iedeberg/Um gebung
Sachs en-Anhalt Os tdeutschland Deuts chland/überall
März/Apr il 2007
Novem ber 2007
Diese starke Konzentration auf den eigenen Wohnort bzw. die unmittelbare Heimatregion kann verschiedene Ursachen haben. So könnte unter anderem erwartet werden, dass die Stellensuche vor allem anhand lokaler oder regionaler Medien oder mit Hilfe örtlicher Kontakte erfolgt, was den Suchraum nachdrücklich einschränken würde.
Diese Annahme hat sich jedoch in den Befragungen nicht bestätigt. Vermutlich spielt vielmehr die erhebliche Schwierigkeit, eine Arbeitsstelle in größerer Entfernung regelmäßig zu erreichen, eine wichtige, oftmals vielleicht sogar ausschlaggebende Rolle.
Etwas anders ist das Bild, das sich aus den Angaben über die Suchwege ergibt.
Praktisch werden, wie Abbildung 16 zeigt, von den Bürgerarbeitern alle in Frage kommenden Wege beschritten und Medien genutzt, auch wenn modernere Formen wie Internetrecherchen weniger häufig und ungewöhnliche Vorgehensweisen wie die Einschaltung privater Vermitt-ler oder die Aufgabe von Inseraten eher selten genannt wurden.
Alles in allem dominieren doch die klassischen Formen der Stellensuche wie Initiativ-bewerbungen und das Durchsehen von Inseraten.
Vergleicht man die Angaben der Bürgerarbeiter im ersten und zweiten Interview, so zeigen sich erhebliche Veränderungen zwischen März/April und November 2007. Drei dieser Veränderungen sind hervorzuheben:
Die beiden Suchwege, die im Frühjahr weitaus am häufigsten genannt wurden, Initiativbewerbung und Durchsehen von Inseraten, lagen im November zwar noch an erster Stelle, aber mit deutlich weniger Nennungen: 60 Prozent statt 80 Prozent bei Initiativ-bewerbungen und 63 Prozent statt 72 Prozent beim Durchsehen von Inseraten.
Deutlich an Bedeutung gewonnen haben hingegen zwei andere Suchwege. Dies gilt in erster Linie für den Weg über die Agentur bzw. ARGE, der im Frühjahr nur von 32 Prozent hingegen im November von 45 Prozent der Befragten genannt wurde. Auch persönliche Kontakte gewannen etwas an Bedeutung.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
50
Abbildung 16: Suchwege nach einem Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt
(Mehrfachnennungen, N =97/91)
15
9
13
44
32
51
72
80
3
2
7
40
45
54
63
60
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sons tiges
Schalten von Ins eraten
Pr ivate Arbeits verm itt ler
Internetrecherche
Agentur /ARGE
Bek annte/Freunde/Angehör ige
Durchs ehen von Ins eraten
Init iat ivbew erbung
Novem ber 2007
März/Apr il 2007
Die „unkonventionellen“ Suchwege werden im November wesentlich weniger genannt als im Frühjahr. Mit Ausnahme der Internetrecherche (Rückgang von 44 Prozent auf 40 Prozent) spielen sie im November praktisch keine Rolle mehr.
3.3.3 Welche Arbeit suchen Bürgerarbeiter?
Die Suche der Bürgerarbeiter richtet sich auf sehr unterschiedliche Formen von Arbeit und Beschäftigung. Hier sind vor allem zwei kontrastierende Orientierungen zu nennen. Diese markieren ein deutlich polarisiertes Suchraster, Zwischenformen zwischen beiden Orien-tierungen sind eher selten.
Zum Einen sucht ein nennenswerter Teil der Bürgerarbeiter nach einer „klassischen“ unbefristeten Vollzeitbeschäftigung (im Sinne eines „Normalarbeitsverhältnisses“), die den bisherigen Erfahrungen entsprechen sollte.
Zum Anderen gibt es eine kleinere Gruppe von Bürgerarbeitern, denen praktisch jede Tätigkeit recht wäre. Von ihnen werden konkrete Regelungen, wie die Zahl der zu leistenden Stunden, Befristung sowie die angebotenen Tätigkeitsinhalte, eher als nachrangig betrachtet.
3.3.4 Die Arbeitsmarktchancen der Bürgerarbeiter
Allerdings wird die Suche nach einem Arbeitsplatz überschattet durch die als sehr gering eingeschätzten Chancen, überhaupt in eine Beschäftigung zu gelangen. Sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Befragung wurden die Bürgerarbeiter gefragt, für wie wahrscheinlich sie es halten, in den nächsten zwölf Monaten eine neue Stelle zu finden.
Der großen Mehrheit der Bürgerarbeiter (jeweils 86 Prozent bei beiden Befragungen) erscheint es „ausgeschlossen“, „sehr unwahrscheinlich“ oder „unwahrscheinlich“ , dass ihnen dies gelingen wird.
Diese pessimistische Bewertung ihrer Arbeitsmarktchancen durch die Bürgerarbeiter hat sich im Projektverlauf, wie Abbildung 17 zeigt, deutlich verstärkt: Bei der ersten Befragung im März/April 2007 stimmten nur 14 Prozent von ihnen der Ansicht zu, dass es für sie praktisch
Bürgerarbeit aus Sicht der Bürgerarbeiter
51
„ausgeschlossen“ sei, eine neue Stelle zu finden, im November 2007 waren es bereits 27 Prozent.
Offensichtlich haben viele Bürgerarbeiter unter dem Einfluss ihrer eigenen, (weiterhin) negativen Bewerbungserfahrungen gelernt, ihre Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt realistisch, und dies heißt, als schlecht bis sehr schlecht, einzuschätzen. Zwar hatte sich durch die Bürgerarbeit und den Weg vom Arbeitslosen zum Bürgerarbeiter ihre eigene Position spürbar verbessert, dennoch blieben ihre Stellenbewerbungen nach wie vor erfolglos.
Die Gefahr, dass man bei den Bürgerarbeitern durch zu starken Druck bezüglich einer Verstärkung der Suchaktivitäten genau die (wie bereits mehrfach gezeigt) beträchtlichen psycho-sozialen Wirkungen von Bürgerarbeit – im Sinne hoher Arbeitsmotivation, gestiegenem Selbstbewusstsein und gefestigtem Selbstwertgefühl – wieder zerstört, sollte im Zusammenhang mit der Forderung nach und der Kontrolle von Bewerbungsaktivitäten nicht unbeachtet bleiben.
Abbildung 17: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den nächsten 12 Monaten eine neue Stelle finden? (N =97/91)
13,48
27,16
33,71
27,16
39,33
32,1
13,48
9,88
0% 20% 40% 60% 80% 100%
März/April 2007
November 2007ausgeschlossen
sehr unwahrscheinlich
unwahrscheinlich
wahrscheinlich
sehr wahrscheinlich
praktisch sicher
Die Einschätzung der Arbeitsmarktchancen wird im Wesentlichen von den Vertretern der Einsatzstellen geteilt: Zwar äußern die Einsatzstellenleiter eine recht hohe Zufriedenheit mit der Tätigkeit und der Leistung der Bürgerarbeiter, dennoch sind sie fast durchgängig der Auffassung, dass Bürgerarbeit in erster Linie eine sozial stabilisierende Funktion für die Betroffenen habe.
In den Gesprächen wurden vor allem zwei Gründe für diese Einschätzung genannt: Zum Einen könne man generell nur mit geringen Beschäftigungszuwächsen rechnen. Zum Anderen seien Beschäftigungsgewinne insbesondere im sozialen Bereich eher unwahrscheinlich. Dies gelte auch für den Bereich der Alten- und Krankenpflege, obwohl diesem seit einigen Jahren eine wachsende Bedeutung als Beschäftigungsfeld zugesprochen werde.
Das Problem liege dabei weniger im fehlenden Bedarf als in der Finanzierungsmöglichkeit. Die kommunalen Haushalte hätten keine Spielräume. Die Vereine seien im Grunde auf ehrenamtliche Tätigkeit ausgerichtet und könnten kaum reguläre Beschäftigungsmöglichkei-ten anbieten. Dennoch wurden zumindest in einigen Einsatzstellen durchaus Möglichkeiten gesehen, die jetzigen Bürgerarbeiter nach Auslaufen des Pilotvorhabens weiter zu beschäfti-gen, wobei Bürgerarbeit ähnlich wie ein Praktikum den Einsatzstellen die Möglichkeit bieten würde, mögliche Kandidaten kennenzulernen und ihr Potenzial zu bewerten.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
52
Zwischenbilanz
Ähnlich wie die Projektinitiatoren teilen sowohl die Bürgerarbeiter selbst als auch die
Vertreter der Einsatzstellen die Ansicht, dass es für die Bürgerarbeiter in näherer Zukunft
kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt geben wird. Damit droht die Aufforderung, sich
permanent zu bewerben, zur leeren Übung zu werden.
Im Hinblick auf Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen scheint vor allem
eine detaillierte Analyse der Gründe für die starke Konzentration der Suchbemühungen auf
die Heimatregion vordringlich. Gute Gründe sprechen dafür, dass die hierbei bekannten
Faktoren wie z. B. ein fortgeschrittenes Lebensalter nur für einen Teil der Bürgerarbeiter
zutreffen. Dies könnte es z. B. nahe legen, der vorhandenen Orientierung auf die
Heimatregion durch systematische Erschließung von Möglichkeiten regionaler Mobilität
entgegenzuwirken.
53
4 BÜRGERARBEIT AUS SICHT DER EINSATZSTELLEN, DER TRÄGER UND VON VERTRETERN DER STADT BAD SCHMIEDEBERG
4.1 Die zweimalige Befragung der institutionellen Akteure
Wesentliches Ziel des Pilotvorhabens Bürgerarbeit war es, den Interessen der Bürgerarbeiter und den Interessen der Einsatzstellen, in denen die Bürgerarbeiter beschäftigt waren bzw. noch sind, im Sinne einer win-win-Konstellation soweit als möglich entgegenzukommen. Deshalb waren die Meinungen, Informationen und Einschätzungen der Verantwortlichen der Einsatzstellen sowie der beiden Träger und der Kommune Bad Schmiedeberg ein wichtiger Bestandteil der Vorhabensevaluation. Die instistutionellen Akteure wurden zweimal befragt, einmal im März/April 2007 und einmal zwischen November 2007 und Februar 2008.
4.1.1 Die erste Befragung im Frühjahr 2007
Bei der ersten Befragung im März/April 2007 stand die Absicht im Vordergrund, den zum Befragungszeitpunkt teilweise bereits beendeten, teilweise noch laufenden Implemen-tationsprozess zu beschreiben und detaillierte, möglichst umfassende Informationen über die Struktur des Vorhabens zu sammeln. Befragt wurden insgesamt 25 Experten, davon 21 Verantwortliche von Einsatzstellen, je ein Verantwortlicher der beiden Träger und zwei Vertreter der Stadtverwaltung.
Die Interviews wurden anhand eines offenen Leitfadens geführt. Sie trugen angesichts des unterschiedlichen Reflexionsgrades der Gesprächspartner teilweise ausgesprochenen Ge-sprächscharakter, der es insbesondere erlaubte, auf Hinweise und Meinungsäußerungen der Befragten einzugehen und fallweise bestimmte Fragen vertieft zu behandeln, zu denen die jeweils Interviewten offenbar besonders sachkundig waren. Bei diesen Interviews ging es vor allem um den institutionellen Hintergrund der Einsatzstelle.
Wichtige Fragen waren u. a.:
• Welcher Art sind die Einsatzstellen?
• Was erwarten sie sich von Bürgerarbeit?
• Welche Erfahrungen haben sie mit anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen?
Die Ergebnisse dieser ersten Befragung lieferten damit auch eine wesentliche Grundlage für die Darstellungen und Analysen des Kapitel 2, insbesondere zur Organisations- und Vorhabensstruktur, aber auch zu den Vorteilen, die sich die beteiligten institutionellen Akteure (Einsatzstellen, Träger, Agentur/ARGE, Kommune) aus ihrer Teilnahme am Pilotvorhaben versprachen.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
54
4.1.2 Die zweite Befragung im Winter 2007/2008
Die zweite Befragung fand in der Zeit zwischen November 2007 und Februar 2008 statt. Dabei konnten alle schon im Frühjahr 2007 befragten Experten wieder einbezogen werden. Auch gelang es, ein Interview mit dem Einsatzstellenleiter zu führen, der im März/April aufgrund von Terminproblemen nicht erreicht wurde, so dass die zweite Befragung insgesamt 26 Experten erfasste.
Diese zweite Befragung folgte einem wesentlich detaillierteren Leitfaden. Der Schwerpunkt lag nun vor allem auf einem rückblickenden Fazit zum Vorhaben und seiner Organi-sationsstruktur, auf einer Analyse von Aufwand, Kosten und Nutzen für die Einsatzstellen, Träger und Kommune einerseits und für die Bürgerarbeiter aus Sicht der Vertreter der Einsatzstellen, Träger und der Stadt andererseits. Ein wichtiges Ziel der Befragungen war es nicht zuletzt, im Projektverlauf aufgetretene Probleme in den Einsatzstellen zu eruieren, Vor- und Nachteile von Bürgerarbeit aus der Sicht der Einsatzstellen zu ermitteln und gegebenenfalls Hinweise auf Verdrängungseffekte zu gewinnen.
Wichtigstes Ergebnis der zweiten Befragung war die Feststellung, dass zum Jahreswechsel 2007/2008 der Rückblick auf das Projekt Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg überwiegend positiv ausfiel. Alle Befragten betonten den Nutzen für die Bürgerarbeiter, für die Einsatzstel-len sowie für die Stadt Bad Schmiedeberg. Gleichzeitig wurden aber auch Probleme angesprochen, Konfliktfelder aufgezeigt und Ideen zu Verbesserungen geäußert.
Nahezu alle Befragten hoben hervor, dass sie sich für das Projekt jederzeit wieder engagieren und dass sie anderen Vereinen und Städten bei sich bietender Gelegenheit die Empfehlung geben würden, sich an einem solchen Projekt zu beteiligen, da der Nutzen den damit verbundenen Aufwand in jeder Hinsicht übersteige.
4.2 Aufwand und Nutzen von Bürgerarbeit
Von den Einsatzstellenverantwortlichen sagten alle bis auf zwei, dass der Nutzen von Bürgerarbeit für die Einsatzstellen und die Kommune den damit verbundenen Aufwand überwiegt. Der Vertreter einer Einsatzstelle sah trotz des schon erreichten hohen Nutzens noch Reserven für weitere Steigerungen.
4.2.1 Der mit Bürgerarbeit verbundene Aufwand
Einen mit Bürgerarbeit einhergehenden, zusätzlichen Aufwand für die Einsatzstellen benennen nur zehn Einsatzstellenvertreter, sieben von ihnen beurteilen ihn als „klein bzw. gering“ . Dabei handelt es sich ausschließlich um den Zeitaufwand für die Einarbeitung neuer Bürgerarbeiter sowie um die bürokratischen und organisatorischen Anforderungen des Projektes Bürgerarbeit, insbesondere bei der Kontrolle der Arbeitsberichte.
Der zeitliche Aufwand begründete sich dabei vor allem aus der Notwendigkeit einer umfassenden Anleitung einiger Bürgerarbeiter, die sich aus ihrer fehlenden oder nicht passfähigen Qualifikation, aus ihrer langen Arbeitslosigkeit und aus einer offensichtlich damit verbundenen Abnahme der Fähigkeit ergibt, den Tag selbst zu strukturieren oder sich in feste Ablaufstrukturen einzuordnen. Dieser Zeitaufwand nimmt aber, so berichteten die
Bürgerarbeit aus Sicht der Einsatzstellen, Träger und Stadtvertreter
55
Einsatzstellenvertreter, mit zunehmender Dauer des Projektes ab. Aus ihrer Sicht zeigt sich ein deutlich positiver Zusammenhang zwischen einer festen Eingebundenheit in definierte Tagesstrukturen und der Fähigkeit, diese einzuhalten und selbst zu kontrollieren.
Wir werten dies als Beleg für die positive Sozialisationswirkung, die Bürgerarbeit auf die Employability der Bürgerarbeiter haben kann.
4.2.2 Der Nutzen von Bürgerarbeit
Interessant ist, dass bei der Nutzeneinschätzung der Einsatzstellenvertreter, wie Abbildung 18 sehr klar erkennen lässt, überwiegend nicht finanzielle Vorteile im Vordergrund stehen, sondern verschiedene Formen eines eher sozialen Nutzens, der neben den Bürgerarbeitern und den Einsatzstellen auch der Stadtgemeinde in Form einer Verbesserung des öffentlichen Lebens zu Gute komme. Einer der Einsatzstellenverantwortlichen formuliert im Interview diese vielfach geäußerte Überzeugung besonders plastisch:
„ Wer keine Arbeit hat, fühlt sich gedemütigt. Ein solcher Arbeitsentzug ist wie eine Strafe. Es
fehlt der tagtägliche Kontakt zu anderen Menschen, bei dem sich der Mensch weiterentwi-
ckelt. Dies sehe man bei den Bürgerarbeitern ganz deutlich. Sie haben an Selbstwertgefühl
gewonnen, sind offener geworden. Vor der Bürgerarbeit haben sie kaum die Vorstellung
gehabt, dass sie etwas wert sind. Heute können sie sogar nach außen sicher auftreten.“
(ES18)
Diesen überwiegend immateriellen Nutzen sahen die Vertreter der Einsatzstellen, der Träger und der Stadt aus ihrer Perspektive vor allem in einer Erweiterung des Leistungsspektrums, das sie anbieten können, in einer spürbaren Arbeitsentlastung und (immerhin mit fünf Nennungen) in einer Zeitersparnis für ihre Mitarbeiter bzw. bei Vereinen für ihre Mitglieder. Weitere Vorteile oder Formen von Nutzen für die Einsatzstellen wurden, wie Abbildung 18 zeigt, jeweils von vier oder fünf Einsatzstellenverantwortlichen genannt.
Diese durchgehende Tendenz schließt allerdings Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen von Einsatzstellen keineswegs aus. Die Arbeits- und Zeitentlastung für die Beschäftigten und die Vereinsmitglieder als wichtiger Nutzen für die Einsatzstellen wird zwar von Vereinen ebenso angeführt wie von Sozialbetrieben. Sie scheint allerdings für die Sozialbetriebe besondere Bedeutung zu haben, da diese zum Teil kaum über personelle Ressourcen verfügen. Die anfallenden Arbeitsaufgaben mussten bereits in den vergangenen Jahren als Folge von unvermeidlichen Personaleinsparungen auf einen verkleinerten Mitarbeiterkreis verteilt werden oder konnten zum Teil nur noch eingeschränkt bewältigt werden. Der Einsatz von Bürgerarbeitern erlaubte auch in diesen Fällen ein weniger strenges Zeitregime für die Erledigung von zusätzlichen Arbeitsaufgaben, eine Konzentration der Beschäftigten auf ihre "eigentlichen“ Aufgaben und/oder eine Verbesserung des Leistungs-spektrums durch die Wiederaufnahme von zuletzt nicht mehr oder nur eingeschränkt angebotener Leistungen. Insgesamt wurde auf diese Weise durch Bürgerarbeit in mehr als der Hälfte der Einsatzstellen das Leistungsspektrum erweitert.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
56
Abbildung 18: Formen des Nutzens für die Einsatzstellen (Anzahl offener Nennungen,
Mehrfachnennungen, November 2007, N =22)
4
4
5
5
5
9
12
0 2 4 6 8 10 12 14
Sonstiges
Bessere Öffentlichkeitsarbeit
Finanzielle Entlastung
Verbesserung des Stadtbildes
Zeitersparnis für MA und VM
Arbeitsentlastung für MA und VM
Erweiterung des Leistungsspektrums
Legende: MA = Mitarbeiter VM = Vereinsmitglieder
Als finanzielle Entlastung wurde das Projekt Bürgerarbeit vor allem von Vertretern der Einsatzstellen wahrgenommen, in denen aufgrund von zu geringer Mitgliederzahl oder mangelnder Zeit das Vereinsleben oder auch die Vereinsanlagen nicht mehr gepflegt und gewartet werden konnten. In den Interviews betonten die Vertreter dieser Einsatzstellen, dass der Verein die von den Bürgerarbeitern erbrachten Leistungen aus eigenen Kräften nicht bezahlen könne oder dass ohne Bürgerarbeit ein Vereinsleben nicht möglich sei.
Einige Einsatzstellenvertreter hoben den möglichen Zusammenhang von immateriellem und finanziellem Nutzen hervor: Wenn es dank Bürgerarbeit möglich sei, das Leistungsspektrum zu erweitern, so könnten sich hieraus durchaus auch materielle Vorteile für den Verein ergeben. So könne z. B. mit der Erhöhung der Attraktivität des Vereinslebens auch die Anzahl der Vereinsmitglieder steigen. Eine höhere Qualität der Veranstaltungen würde mehr Besucher anlocken. Auch könne man sich dank der Bürgerarbeiter nunmehr aktiv an Veranstaltungen beteiligen, an denen sonst eine Teilnahme nicht möglich gewesen wäre.
Aus der externen Sicht der Evaluation sind zumindest noch zwei weitere Vorteile zu nennen, die sich für die Einsatzstellen aus Bürgerarbeit ergeben können:
Zum Einen wurde Bürgerarbeit in einigen Fällen als Test für den Einsatz neuer Beschäfti-gungsformen genutzt. Dies betrifft insbesondere den Einsatz fachlich nicht einschlägig qualifizierten Personals in den Sozialbetrieben.
Zum Anderen kann und sollte Bürgerarbeit auch als Investition in das regionale Sozialkapital bewertet werden. Die Einsatzstellen demonstrieren nicht nur, dass sie ein verlässlicher Partner im Feld der Beschäftigungsförderung sind. Ihre Beteiligung am Pilotvorhaben belegt auch, dass sie Willens und dazu in der Lage sind, soziale Verantwortung in der Region zu übernehmen.
Bürgerarbeit aus Sicht der Einsatzstellen, Träger und Stadtvertreter
57
Zwischenbilanz
Bürgerarbeit bewirkt positive Sozialisationseffekte, indem sie die Employability der
Bürgerarbeiter sichtbar und nachhaltig erhöhen kann. Dieser soziale Nutzen von Bürgerar-
beit wurde von der Mehrzahl der Einsatzstellenvertretern hervorgehoben.
Aber auch für die Einsatzstellen selbst betonten die Gesprächspartner vor allem verschiedene
Formen eines eher sozialen Nutzens und stellen nicht potenzielle finanzielle Vorteile aus
Bürgerarbeit in den Vordergrund. Zu solchen Formen sozialen Nutzens gehören vor allem
Arbeits- und Zeitentlastungen für die Mitglieder von Vereinen und die Mitarbeiter von
Sozialbetrieben, aber auch finanzielle Entlastungen, die ein Vereinsleben durch die Bürger-
arbeiter erst wieder möglich machen.
Von einigen Einsatzstellenvertretern wurde auf einen möglichen Zusammenhang von
immateriellem und finanziellem Nutzen hingewiesen: Durch die Erhöhung der Attraktivität
der Vereine dank Bürgerarbeit könnten sich durchaus finanzielle Vorteile für die Vereine
ergeben.
Bürgerarbeit ist auch eine Investition in das regionale Sozialkapital: Die am Projekt
teilnehmenden Einsatzstellen demonstrieren, dass sie bereit und in der Lage sind, soziale
Verantwortung für ihre Region zu übernehmen.
4.3 Kosten und Probleme durch Bürgerarbeit
Trotz der, wie schon gezeigt, ganz überwiegend positiven Bilanz von Aufwand und Nutzen können sich mit dem Engagement in Bürgerarbeit für die Einsatzstellen Kosten und Probleme verbinden, die nicht übersehen werden dürfen. Dies gilt vor allem für drei Sachverhalte: unerwartete Kostenpositionen, Schwierigkeiten beim Einhalten der Grenzen des Tätigkeits-bereiches und das Risiko einer Verdrängung von Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Im Gegensatz zu den fast durchgängig positiven Äußerungen aller Einsatzstellen zum Projekt bei der Erstbefragung im Frühjahr 2007 wurde bei der Zweitbefragung im Winter 2007/2008 zu diesen Sachverhalten eine Reihe von kritischen Punkten hervorgehoben.
4.3.1 Unerwartete Kosten
Im Prinzip ist die Durchführung der Bürgerarbeit für die Einsatzstellen nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. In der Realität berichtet jedoch eine nennenswerte Zahl von Einsatzstellen von unerwartet entstandenen Kosten: Sechs von 22 Einsatzstellenvertretern wiesen im Interview ausdrücklich darauf hin, dass diese Kosten zwar mindestens durch den Nutzen aufgewogen bzw. weniger ins Gewicht fallen würden, dass sie jedoch entgegen den Erwartungen nicht als unwesentlich betrachtet werden könnten. Eine Einsatzstelle betonte sogar, dass sie nicht in der Lage sei, die entstehenden Kosten zu bestreiten; wenn dies von ihr verlangt würde, müsse sie sich aus dem Projekt Bürgerarbeit zurückziehen.
Zu diesen als relativ hoch bewerteten Kosten zählen nicht in erster Linie mit der Tätigkeit verbundene Materialkosten (die zumeist von den Trägern im Rahmen der Gesamtfinanzierung des Projektes übernommen wurden).
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
58
Abbildung 19: Kosten für die Einsatzstelle (November 2007, N =22)
8
8
6Keine Kosten.
Minimale Sachkosten.
Relativ hohe Kosten.
Diese Kosten bestanden vielmehr in erster Linie aus freiwilligen Qualifizierungs- und Fortbildungskosten (1 Einsatzstelle, ca. 400 Euro pro Bürgerarbeiter im Jahr) sowie aus Heiz-, Strom- und Telefonkosten, die mit der täglichen Arbeit der Bürgerarbeiter anfallen (5 Einsatzstellen, 100 Euro pro Bürgerarbeiter im Jahr, bis 1.000 Euro im Jahr insgesamt).
4.3.2 Schwier igkeiten durch die Begrenztheit der er laubten Tätigkeitsbereiche
Wie eingangs dargestellt, ist die Tätigkeit der Bürgerarbeit recht genau umschrieben und die Beschäftigung auf einen erlaubten Bereich begrenzt. Diese Begrenzung wird immerhin von vier Einsatzstellen als hinderlich bzw. nachteilig eingeschätzt. Auch mindert der eingeschränkte Tätigkeitsbereich der Bürgerarbeiter aus Sicht einiger Einsatzstellenvertreter die Möglichkeit, weitere Bürgerarbeitsplätze bereitzustellen, obwohl dies prinzipiell keines-wegs ausgeschlossen sei.
Fünf Vertreter von Einsatzstellen gaben explizit an, dass bei einer Ausweitung des erlaubten Aufgabenfeldes die Anzahl der bei ihnen beschäftigten Bürgerarbeitsplätze erhöht werden könnte.
Ebenso sehen beide Träger Möglichkeiten, jeweils rund 20 bzw. 30 zusätzliche Bürgerarbeits-plätze einzurichten, wenn das bisher strikt auf „Marktferne“ begrenzte Tätigkeitsfeld ausgedehnt werden würde. Für den jetzigen Tätigkeitsbereich schätzten beide Träger ein, dass sie für auslaufende Aufgaben von Bürgerarbeitern in einzelnen Einsatzstellen durchaus noch Bürgerarbeitsstellen in anderen, auch in bisher nicht in das Vorhaben einbezogenen Einsatzstellen akquirieren könnten.
4.3.3 Das Risiko der Verdrängung von Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt
Wie für alle Formen öffentlich geförderter Beschäftigung gilt auch für Bürgerarbeit das Gebot des öffentlichen Interesses an der zu erbringenden Leistung, ebenso wie das Gebot der Zusätzlichkeit bzw. der Marktferne ihrer Erbringung. Zwischen beiden Geboten besteht ein Zielkonflikt, der offensichtlich nicht ex ante und vollständig auflösbar ist: Je strenger durch Vorschriften und Verfahrensregeln die Marktferne der geförderten Tätigkeiten gesichert werden soll, desto größer ist auch die Gefahr geringen öffentlichen Interesses der erbrachten Leistungen. Je höher dieses Interesse ist, desto schwerer dürfte es vielfach sein, Verdrängungseffekte vollständig auszuschließen.
Bürgerarbeit aus Sicht der Einsatzstellen, Träger und Stadtvertreter
59
Dieser Zielkonflikt wird offenkundig, wenn man eine beliebige Liste von Tätigkeiten betrachtet, die in Bad Schmiedeberg im Rahmen des Pilotvorhabens von Bürgerarbeitern ausgeübt wurden bzw. werden:
• „Mitwirkung bei der gesundheitlichen Erziehung im Sinne von Wasseranwendung nach Kneipp“ ,
• „Erfassen des Baumbestandes in der Stadt und den Ortsteilen“ ,
• „Mitwirkung bei der Optimierung des Wegenetzes und Entflechtung von Velostrecken und Fusswegen“,
• „Mitwirkung beim Aufbau einer Ranger-Truppe“,
• „Erhaltung und Aktualisierung des Buchbestandes der Schulbücherei“ ,
• „Mitwirkung und Unterstützung des Trainingsbetriebes bei einem Sportverein“ .
All dies sind Aufgaben, die unbestreitbar in einem mehr oder minder hohen öffentlichen Interesse liegen. Zugleich könnten sie von einer prosperierenden Stadtverwaltung aus ihrem Haushalt oder von Vereinen mit eigenem Vermögen und ordentlichen Beitragseinnahmen aus Eigenmitteln ohne weiteres in Form von Aufträgen über den Markt beschafft werden. Dies würde jedoch Rahmenbedingungen der regionalen Wirtschaft und des regionalen Arbeits-marktes voraussetzen, unter denen wiederum kaum Bedarf an Bürgerarbeit bestünde.
Unter den Bedingungen hoher Langzeitarbeitslosigkeit erscheint es in der Praxis schwierig, eine scharfe Grenze zwischen marktnahen und marktfernen Tätigkeiten zu ziehen. Realistischer ist es wohl, von einer mehr oder minder breiten Grau- oder Übergangszone zwischen reinen marktbezogenen Leistungen und eindeutig auf öffentliches Interesse gerichteten Tätigkeiten zu sprechen.
In Bad Schmiedeberg sollten und sollen Substitutions- und Verdrängungseffekte durch die Begrenzung des Tätigkeitsfeldes und durch geeignete Steuerungs- und Kontrollmechanismen ausgeschlossen werden. Allerdings kann hierdurch weder das Risiko der Verdrängung von potenziellen Arbeitsplätzen gänzlich ausgeschlossen werden noch das Risiko, dass im Rahmen von Bürgerarbeit Tätigkeiten gefördert werden, die allenfalls begrenzt im öffentlichen Interesse liegen.
Diese Problemlage ist auch vielen der Beteiligten bewusst. Immerhin ein Viertel der interviewten Einsatzstellenverantwortlichen sprach dieses Problem ausdrücklich an. Um der Gefahr von Verdrängung zu begegnen, wird von ihnen vor allem die Bedeutung der regelmäßigen Kontrolle der Einhaltung der Tätigkeitsbereiche hervorgehoben, die insbesondere bei den großen Einsatzstellen mit einer ausgeprägten unternehmensinternen Hierarchie gut organisiert sein muss. So berichteten Vertreter solcher Einsatzstellen, dass vor allem am Anfang des Projektes Abteilungsleiter und andere Weisungsberechtigte Bürgerarbeiter anders als im festgelegten Tätigkeitsbereich einsetzen wollten und dass dem deutlich entgegengesteuert werden musste.
Wie ernst in Bad Schmiedeberg diese Kontrollen genommen werden, zeigt sich daran, dass einer Einsatzstelle wegen der „Gefahr der Überschreitung des erlaubten Tätigkeitsbereiches“
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
60
durch den Träger gekündigt wurde. Die dort eingesetzten Bürgerarbeiter wurden in anderen, teilweise neu akquirierten Einsatzstellen untergebracht. Die entsprechende Einsatzstelle wurde aus dem Projekt Bürgerarbeit ausgegliedert.
Zwischenbilanz
Bürgerarbeit sollte im Prinzip für die Einsatzstellen nicht mit Kosten verbunden sein, in der
Realität thematisiert aber eine nennenswerte Anzahl von Einsatzstellenvertretern unerwartet
entstandene Kosten. Zu diesen Kosten zählen einerseits freiwillige Qualifizierungs- und
Fortbildungskosten, andererseits aber vor allem Heiz-, Strom- und Telefonkosten, die sich aus
der täglichen Arbeit der Bürgerarbeiter ergeben.
Der für Bürgerarbeit festgelegte Einsatzbereich der Bürgerarbeiter begrenzt aus Sicht einiger
Einsatzstellenvertreter die Möglichkeiten, weitere Bürgerarbeitsplätze bereitzustellen. Nach
Einschätzungen der Träger könnten aber durchaus noch weitere Bürgerarbeitsstellen, vor
allem als Ersatz für auslaufende Aufgaben, akquiriert werden.
Die Gefahr der Verdrängung von Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt ist bei geförder-
ter Beschäftigung immer gegeben. Diese Verdrängungseffekte sind wahrscheinlicher, je höher
das öffentliche Interesse an den Aufgaben ist. Dieser Zielkonflikt ist kaum lösbar, sondern
bedarf eines regionalen Aushandlungsprozesses unter Einbeziehung aller an Bürgerarbeit
beteiligten instrumentellen Akteure einschließlich den Vertretern der regionalen Wirtschaft.
4.4 Wirkungen von Bürgerarbeit aus Sicht der institutionellen Akteure
Alle Vertreter der Einsatzstellen, der Träger und der Stadt betonten, dass sich Bürgerarbeit aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu „normaler“ Erwerbstätigkeit positiv auf die Bürgerarbeiter selbst und dadurch indirekt auch auf das öffentliche Leben der Kommune auswirkt . So berichteten mehrere der befragten Einsatzstellenvertreter, die Bürgerarbeiter seien selbstbewusster und offener geworden, würden sich vorteilhafter kleiden und frisieren, wieder grüßen und auch mal zu einem kleinen Gespräch stehen bleiben, was in der Zeit vor dem Projekt Bürgerarbeit so nicht (mehr) gewesen sei. Ein Vertreter der Stadt Bad Schmiedeberg hob hervor, dass sich damit auch das Miteinander im öffentlichen Leben verbessert habe. Es sei offener, lockerer und freundlicher geworden.
Dabei steht, wie aus Abbildung 20 ersichtlich, an erster Stelle offensichtlich nicht das Gehalt, welches die Bürgerarbeiter beziehen, sondern die Tatsache, dass ihre Tätigkeiten ihnen das Gefühl von Gebrauchtsein vermitteln. Sie fühlen sich sozial integriert, gehen einer sinnvollen Beschäftigung nach, besitzen einen Arbeitsvertrag (was von vielen Bürgerarbeitern als sehr wichtig hervorgehoben wurde) und erfahren aufgrund ihrer geleisteten Arbeit Wertschätzung innerhalb ihres sozialen Umfeldes.
Bürgerarbeit aus Sicht der Einsatzstellen, Träger und Stadtvertreter
61
Abbildung 20: Gewinne für die Bürgerarbeiter (Anzahl offener Nennungen,
Mehrfachnennungen, November 2007,N =22)
3
3
5
5
6
8
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
leichter vermittelbar
Arbeitsrhythmus
Soziale Integration
Erfahrungen, Kompetenzen, Verantwortung
Selbstbewusstsein, Aufblühen, Wohlgefühl
Sinnvolle Beschäftigung, Schaffen etwasBleibendes
Wertschätzung, Anerkennung, Gefühl desGebrauchtseins
Alle Einsatzstellen bis auf eine verweisen außerdem auf die besonders hohe Motivation und gute Integrationsfähigkeit der Bürgerarbeiter, insbesondere im Vergleich zu anderen Maßnahmebeschäftigten. Als Hintergrund dieser höheren Arbeitsbereitschaft werden vor allem die Chance auf längere Beschäftigung (keine endgültig festgelegte Befristigung wie bei ABM und Ein-Euro-Job), der Charakter der Tätigkeiten und auch die (vermeintlich) bessere Bezahlung angesehen.
Die meisten Bürgerarbeiter würden nach Einschätzung der Einsatzstellenverantwortlichen verantwortungsbewusst, selbstständig und verlässlich arbeiten. Probleme mit der Motivation und/oder der Leistungsbereitschaft von Bürgerarbeitern werden nur vereinzelt, von drei Einsatzstellen, genannt. Von Neid, der den Bürgerarbeitern aufgrund ihrer Tätigkeit seitens der Vereinsmitglieder entgegengebracht wird, berichteten drei Einsatzstellen. Nur in einer Einsatzstelle konnte das Problem bisher nicht zufriedenstellend geklärt werden.
Insgesamt scheinen die Bürgerarbeiter ihre Tätigkeiten als eine besondere Chance zu begreifen, die ihnen nach langer Arbeitslosigkeit geboten wurde und die sie festhalten und nutzen wollen:
„ Bürgerarbeit ist sehr positiv für die Menschen, die darin eine Aufgabe finden und für die
Stadt. Vor allem die sozialen Aspekte stehen im Vordergrund. Das ,wieder arbeiten zu
können’ und ,gebraucht zu werden’ ist besonders wichtig, weniger das Geld.“ (T1)
Dies erklärt dann auch, dass ein Großteil der Bürgerarbeiter selbst auf die Einhaltung der erlaubten Tätigkeitsbereiche achtet und die Ausführung zusätzlicher, nicht genehmigter Arbeiten ablehnt.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
62
4.5 Die Projektmanagementgruppe
Auf Initiative der Projektgruppe der Agentur/ARGE wurde zu Beginn der Projektphase eine Koordinationsstelle eingerichtet, deren Mitglieder zwar aus dem Pool der Bürgerarbeiter ausgewählt, aber nicht als Bürgerarbeiter, sondern als Projektmanager eingestellt wurden. Die Hauptintention war dabei, neben den Trägern eine „unabhängige Gruppe“ vor Ort zu haben. Die drei Mitglieder dieser Gruppe bezogen (mit rund 1.700 Euro) ein wesentlich höheres Gehalt als die Bürgerarbeiter, welches aus einem speziellen Fond der Agentur/ARGE für spezifische Projekte finanziert wurde. Allerdings waren diese drei Mitglieder nicht der Projektgruppe der Agentur/ARGE, sondern den Trägern zugeordnet, die ihnen gegenüber die Aufgabe eines Arbeitgebers vertraten.
An der Tätigkeit und Stellung dieser Gruppe lassen sich exemplarisch Potenziale und Risiken aufzeigen, die vermutlich mit der grundlegenden Intention und Funktionslogik des Vorhabens verbunden sind.
4.5.1 Aufgaben des Projektmanagements
Aufgabe des Projektmanagements war es auf formaler Ebene vor allem:
• neue Bürgerarbeitsstellen ausfindig zu machen und zu akquirieren,
• mit Hilfe der Träger Arbeitsmittel zu organisieren,
• die Bürgerarbeiter in kleinen Einsatzstellen zu betreuen,
• die Einhaltung der Tätigkeitsbeschränkungen zu überwachen,
• die Stunden- und Tätigkeitsnachweise zu kontrollieren.
Faktisch übernahm die Projektmanagementgruppe nicht zuletzt die Funktion eines Ansprech-partners bei Problemen und Konflikten verschiedenster Art – sowohl für Bürgerarbeiter wie für Einsatzstellen. Sie geriet hierbei zusehends in eine Mittlerposition zwischen Bürgerarbei-tern, Einsatzstellen, Stadt, Träger und Agentur/ARGE.
Das Projektmanagement trug zumindest in der Implementationsphase ohne Zweifel durch seine Präsenz vor Ort und seine sehr gute Kenntnis der örtlichen Verhältnisse erheblich zur Tragfähigkeit und Flexibilität der Vorhabensorganisation bei. Seine Tätigkeit in dieser Projektphase wurde deshalb rückblickend von den Vertretern der Stadt Bad Schmiedeberg, von den beiden Trägern und von fast allen Verantwortlichen der Einsatzstellen als positiv und wichtig bewertet.
4.5.2 Zunehmende Differenzen
Im weiteren Verlauf des Vorhabens stellte sich allerdings heraus, dass sich das Projektmanagement in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen Vertrauen, Verantwortung und Kontrolle bewegen musste und dass seine Arbeit durch fehlende Absprachen und unzureichende Konfliktfähigkeit erheblich beeinträchtigt wurde. So zeigten sich schon im Frühjahr 2007 Anzeichen von Differenzen zwischen Agentur/ARGE und dem Projektmanage-ment vor Ort. Beiden Seiten ist es nicht gelungen, die damit verbundenen Fragen und
Bürgerarbeit aus Sicht der Einsatzstellen, Träger und Stadtvertreter
63
Probleme offen anzusprechen, aufzuarbeiten und zu klaren Regelungen zu gelangen. Wichtigsten Konfliktstoff bildeten offensichtlich nicht klar definierte Erwartungen seitens der Agentur/ARGE an die Rolle und Aufgaben des Projektmanagements einerseits und Kompetenzüberschreitungen bei der Erfüllung seiner (zum Teil selbst gewählten) Aufgaben durch das Projektmanagement andererseits.
Die Differenzen scheinen die Mitarbeiter des Projektmanagements überrascht zu haben, da sie ihre Aufgabe genau in dem sahen, was sie taten, und überzeugt waren, hierdurch die Erwartungen der Stadt, der Träger und letztlich auch der Agentur/ARGE zu erfüllen.
Während die Erwartungen der Träger und der meisten Einsatzstellen an das Projektmanage-ment im Wesentlichen erfüllt wurden, sprachen die Verantwortlichen aus drei Einsatzstellen von Problemen mit den Mitarbeitern des Projektmanagements, die auch private Ursachen hatten, sich jedoch teilweise genau aus den Aufgaben des Projektmanagements, insbesondere ihrer Kontrolle der Einhaltung der Aufgabenbereiche, ergaben.
4.5.3 Einschätzungen im Rückblick nach Auflösung der Projektmanagementgruppe
Zum Jahresende 2007 wurde die Projektmanagementgruppe aufgelöst. In den Interviews, die nach dieser Entscheidung durchgeführt wurden, äußerten einige der befragten Experten Kritik an der Struktur und der Arbeitsweise des Projektmanagements. Hierbei ging es vor allem um die Zahl der Mitglieder und die Anzahl der von ihnen geleisteten Arbeitsstunden. In mehreren Interviews wurde deutlich, dass die Verantwortlichen der Einsatzstellen und der Träger ein Projektmanagement mit zwei Mitarbeitern (ein Vertreter je Träger) und mit einer Arbeitszeit von 30 statt 40 Stunden als ausreichend angesehen hätten.
Der Wegfall des Projektmanagements ab Januar 2008 wurde von (nur) drei Einsatzstellen und einem Träger explizit als Nachteil beschrieben, aus dem sich zusätzliche Belastungen ergeben würden. Vor allem der Wegfall einer zentralen Anlaufstelle, die auch als Koordinator fungiert, wurde als Verlust bewertet.
„ Es ist bedauerlich, dass das Projektmanagement nicht fortgeführt wird. Es müsste eine
zentrale Anlaufstelle geben und diese sollte auch vor Ort und nicht in Wittenberg oder sonst
wo sein. Zudem kennen die Leute vom Projektmanagement die Leute aus der Region und
wüssten, wer für welche Aufgabe geeignet ist.“ (ES4)
„ Schade, dass das Projektmanagement-Büro wegfällt. Es waren wichtige Aufgaben, dass sie
die Bürgerarbeit kontrolliert haben und ... immer Anlaufstelle vor Ort waren. Der Weg nach
Wittenberg ... ist doch sehr weit. Außerdem ... (ist) es von Vorteil, dass sie die Leute aus dem
Ort kennen. Ich bin schockiert über diesen Wegfall.“ (ES8)
„ Bürgerarbeit ist ein gutes Projekt, aber eine koordinierende Stelle – das Projektmanagement
– ist wichtig.“ (ES17)
Für die Träger gestalte sich zeitaufwändiger, alle Einsatzstellen regelmäßig zu kontrollieren, da jetzt Mitarbeiter ein- bis zweimal in der Woche nach Bad Schmiedeberg fahren müssen, um die Einsatzstellen zu besuchen, nach Problemen zu fragen und die Einsatzfelder der
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
64
Bürgerarbeiter zu begutachten. Beide Träger haben zudem Anlaufstellen in Bad Schmiede-berg eingerichtet, in denen für die Bürgerarbeiter Post hinterlegt werden kann und diese ihre Krankenscheine abgeben, ihre Lohnzettel erhalten sowie andere organisatorische Dinge erledigen können.
Für die Vertreter der Stadt stellt der Wegfall des Projektmanagements kein Problem dar. Einer von ihnen betont, dass er die Zusicherung der Träger habe, dass diese die Aufgaben des Projektmanagements übernehmen und für einen Weiteren kam diese Entwicklung nicht unverhofft. Er sah das Projektmanagement von Anfang an als befristete Sondermaßnahme innerhalb des Projektes.
Aus den Erfahrungen in Bad Schmiedeberg ergibt sich, dass es bei ähnlich gelagerten Projekten lohnenswert erscheint, bereits vor Projektbeginn Absprachen über die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungsbereiche der am Projekt Beteiligten zu treffen und gemeinsam einen ausreichend stabilen Rahmen für alle notwendigen Tätigkeiten festzulegen.
Hierauf wird in Kapitel 6 nochmals eingegangen.
Zwischenbilanz
Das Projektmanagement bestand aus drei Mitgliedern und wurde auf Initiative der
Projektgruppe der Agentur/ARGE gebildet. Es sollte als „ unabhängige Gruppe“ vor Ort und
damit als Ansprechpartner für Einsatzstellen und Bürgerarbeiter fungieren. Hierbei geriet sie
zunehmend in eine Mittlerposition zwischen Bürgerarbeitern, Einsatzstellen, Träger, Stadt
und Agentur/ARGE.
Während die Erwartungen der Träger und Einsatzstellen im Wesentlichen erfüllt wurden, kam
es im Projektverlauf zu zunehmenden Differenzen zwischen dem Projektmanagement und der
Agentur/ARGE, die nicht offen thematisiert wurden und damit letztlich nicht geklärt werden
konnten. Zum Jahresende 2007 wurde das Projektmanagement aufgelöst.
Die Erfahrungen aus Bad Schmiedeberg legen nahe, einerseits bereits vor, spätestens aber
mit Projektbeginn klare Absprachen über die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tungsbereiche aller am Projekt Beteiligten zu treffen und andererseits einen stabilen Rahmen
zu schaffen, in dem Differenzen und Probleme angesprochen und geklärt werden können.
65
5 MÖGLICHE UMVERTEILUNGSEFFEKTE DURCH DEN AUSWAHLPROZESS
5.1 Grundlagen und Methoden der Berechnung
Die Auswahl der Bürgerarbeiter fand in einem Prozess statt, dem alle Arbeitslosen in Bad Schmiedeberg vom 15.09.2006 bis zum 30.04.2007 unterzogen wurden (siehe vorangegangene Kapitel). Allerdings lagen diesem Auswahlprozess während seiner Dauer unterschiedliche Funktionsbedingungen zu Grunde, die einen erheblichen Einfluss auf die Zusammensetzung der jeweiligen Kollektive von Arbeitslosen zu unterschiedlichen Zeitpunk-ten der Projektlaufzeit zur Folge hatten. Dadurch entstanden auch unterschiedliche Bedingun-gen für die Einspar- und Umverteilungsmöglichkeiten, die dieser Auswahlprozess erzielen konnte.
• Zum 15. September 2006 gab es insgesamt 333 Fälle (28 Prozent ALG1, 72 Prozent ALG2), die in den speziellen Auswahlprozess eingespeist wurden, dessen Hauptak-tivitäten zwischen dem 15. September und dem 30. November 2006 lagen. Diese Fälle bezeichnen wir als Bestandsfälle , für die sich Ergebnisse eines „Kampagnenmodus“ der Bürgerarbeit aufzeigen lassen. Von diesen Bestandsfällen wurden 105 in Bürgerarbeit vermittelt.
• In einer weiteren Gruppe von Arbeitslosen können alle Fälle zusammengefasst werden, die von Dezember 2006 bis einschließlich April 2007 hinzugekommen sind. Auch für die Mitglieder dieser Gruppe bestand die Option, in Bürgerarbeit vermittelt zu werden, sofern sie dafür geeignet und freie Bürgerarbeitsplätze vorhanden waren. Es handelt sich hierbei um 122 Fälle. Von diesen waren 67 Prozent ALG1- und 33 Prozent ALG2-Empfänger, womit hier im Vergleich zu den Bestandsfällen ein annährend umgekehrtes Verhältnis vorliegt. Von diesen 122 Fällen konnten nur noch fünf in Bürgerarbeit vermittelt werden, da die meisten Bürgerarbeitsplätze (105 von 110) durch die Bestandsfälle schon besetzt waren.
Zunächst gehen wir jedoch in diesem Bericht auf die Gesamtgruppe (N = 455) der Arbeitslosen ein, die an diesem Projekt beteiligt war, denn es ist davon auszugehen, dass auch in ähnlichen Projekten zunächst einmal der Bestand abgearbeitet und auf die vorhandenen Bürgerarbeitsplätze verteilt wird, bevor im Laufe der Zeit die weiteren Zugänge am Auswahlverfahren teilnehmen können. Hier werden sie zwar mit einem gleich intensiven Verfahren beraten wie die Bestandsfälle, haben aber geringere Chancen auf einen Bürgerarbeitsplatz. Und zwar nicht nur, weil diese bereits besetzt sind, sondern auch weil es unter den Zugängen weniger ALG2-Empfänger gab, für die eine Tätigkeit in Bürgerarbeit im Regelfall eher zum Tragen kommen würde.
Durch den Auswahlprozess, dem ein sehr günstiger Betreuungsschlüssel von etwa 1:100 zu Grunde lag, konnten nicht nur 110 Arbeitslose (von 455) in Bürgerarbeit vermittelt werden. Vielmehr hatte diese günstige Form der Betreuung auch erheblichen Einfluss auf den „Status“
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
66
der Arbeitslosen, die nicht in Bürgerarbeit vermittelt wurden. 70 Prozent von ihnen fanden sich nach der Betreuung in einem anderen „Status“ wieder (siehe unten). Dadurch konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden, die zur Finanzierung der Bürgerarbeit ausgereicht hätten, wenn diese tatsächlich aus diesen Einsparungen hätte finanziert werden sollen .
Wir arbeiten mit folgenden Kosten und Leistungsarten, um die finanziellen Effekte dieses Auswahlverfahrens zu verdeutlichen:
• Leistungen der Bundesagentur für Arbeit,
• Kosten der Unterkunft,
• Pauschale für aktive Arbeitsmarktpolitik,
• Entgelt für die Bürgerarbeit,
• Verwaltungskostenpauschale für die Träger und
• anteilige Sozialversicherungsbeiträge für die Bürgerarbeiter, die vom Land (EU-Mittel) getragen werden.
Die von der Bundesagentur für Arbeit aufzuwendenden Leistungen für die Sozialversiche-rungsbeiträge der Leistungsempfänger (vor und nach Projektbeginn) werden hier nicht erfasst. Durch die gesetzliche Änderung zum 01.01.2007 und weitere von der Bundesagentur nicht zu beeinflussende Faktoren ist ihre Berücksichtigung methodisch nicht zu rechtfertigen. Gleichwohl ergäben sich bei ihrer Berücksichtigung weitere Einsparpotenziale, da insbeson-dere für Empfänger von ALG1 sehr hohe Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind.
Die realen Mehrkosten der Bürgerarbeit werden als Durchschnitt der Entgelte für die Bürgerarbeiter ausgewiesen. Gleiches gilt für die Sozialversicherungsbeiträge der Bürger-arbeiter (Arbeitgeberanteil) und die Verwaltungskostenpauschale für die Träger, die, wie erwähnt, als Arbeitgeber der Bürgerarbeiter fungieren.
5.2 Das Umver teilungsmodell
5.2.1 Einsparpotenziale
Der Weg zur Bürgerarbeit war im vorliegenden Projekt so angelegt, dass alle Einwohner von Bad Schmiedeberg, die zu einem bestimmten Zeitpunkt (15.09.2006) arbeitslos gemeldet waren (beide Rechtskreise) zu einem Beratungsgespräch eingeladen wurden. In einem Schreiben wurde angekündigt, dass der Status jedes Arbeitslosen überprüft werde. Ziel dieser Überprüfung sei gewesen, Möglichkeiten zu finden, den Status der Arbeitslosigkeit möglichst nachhaltig verlassen zu können. Es wurde deutlich gemacht, dass die Wahrnehmung des Gespräches obligatorisch ist und dass bei Nichterscheinen Sanktionen verhängt werden können. Insofern war mit dem Anschreiben auch eine gewisse Kontroll- und Sanktionsabsicht verbunden, die tatsächlich dazu geführt haben mag, dass eine leider nicht genau quantifizierbare Zahl von Arbeitslosen nicht zu dem Gespräch erschienen ist und sich selbst aus der Arbeitslosigkeit „abgemeldet“ hat bzw. bei fortwährender „Nonresponse“ aus dem Bestand der Arbeitslosen gestrichen wurde. Diese Fälle stellten bereits die erste Quelle von Einsparungen dar, denn für sie mussten keine Leistungen mehr erbracht werden. Sie werden
Umverteilungseffekte
67
jedoch in den weiteren Berechnungen nicht berücksichtigt, da es nicht mehr möglich war, diese Fälle und die durch sie bewirkten Einsparungen zu identifizieren oder zu quantifizieren . Für die verbleibenden 455 Arbeitslosen, die am Auswahlprozess teilnahmen, ergab sich nach dem Auswahlprozess folgende Verteilung auf unterschiedliche Maßnahme- und Statusgrup-pen:
Abbildung 21: Statusveränderungen nach dem Auswahlprozess (Angaben in Prozent,
N = 455)
43,4
22,9
4,617,119,6
8,2 7,1 12,00,0
20,025,020,0
0
20
40
60
80
100
ErsterArbeitsmarkt
AGH Bürgerarbeit SonstigeMaßnahmen
Sonstiges Weiterarbeitslos
vor Auswahl: ALG1 vor Auswahl: ALG2
Legende: AGH = Arbeitsgelegenheiten
Etwa ein Viertel der Arbeitslosen konnte in Bürgerarbeit vermittelt werden. Durch diese entstanden Mehrkosten gegenüber ihren vorherigen Leistungsbezügen von durchschnittlich 620 Euro pro Fall und Monat. Bezogen auf alle Bürgerarbeiter musste somit ein Betrag von monatlich 68.090 Euro zusätzlich aufgebracht werden (siehe unten).
Die deutlichsten Unterschiede zwischen den Rechtskreisen (ALG1- und ALG2-Empfänger) ergaben sich bei der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. So gelang es, 43,4 Prozent der ALG1-Empfänger in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln bzw. fanden diese aus eigener Initiative eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung; von den ALG2-Empfängern konnten so fast 20 Prozent in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Man kann davon ausgehen, dass diese hohe Zahl auch durch die mit oben erwähntem Anschreiben angekündigte nachhaltige Überprüfung und die Aussicht, auf jeden Fall ein Arbeitsangebot zu erhalten, geprägt war. 104 von diesen 131 Arbeitslosen (beider Rechtskreise), die in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten, fielen aus dem Leistungsbezug vollständig heraus. Für diese entstanden keine Kosten mehr. Diese nun nicht mehr entstehenden Kosten konnten dem Grunde nach zur Deckung der Mehrausgaben beitragen, die zur Finanzierung der Bürgerarbeit aufgewendet werden mussten. Aber für die restlichen 27 derjenigen, die in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt wurden, mussten weiterhin Leistungen erbracht werden, so dass im Durchschnitt aller Mitglieder dieser Gruppe noch immer 91 Euro durch die Arbeitsagentur aufgebracht werden mussten. Dieser Beitrag ist jedoch um ca. 610 Euro niedriger als der Betrag, der vor dem Auswahlprozess für jeden dieser Arbeitslosen aufgebracht werden musste. Das heißt, durch eine erfolgreiche Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt konnten in diesem Vorhaben die zusätzlichen Kosten, die ein Bürgerarbeiter erzeugt, nahezu ausgeglichen werden.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
68
Auch für die anderen Kategorien ergab sich (je nach Gesetzeslage und den besonderen Bedingungen der Bedarfsgemeinschaften) eine andere Leistungshöhe in neuen Maßnahme- und Statusgruppen. So müssen für den Durchschnitt aller Arbeitslosen, die infolge des Auswahlprozesses in Arbeitsgelegenheiten (AGH) vermittelt wurden, im Vergleich zur Höhe des Betrages vor dem Auswahlprozess 29 Euro weniger aufgewendet werden. Da zahlreiche Arbeitslose auch in sonstige Maßnahmen vermittelt werden konnten, ergaben sich hier Minderausgaben in Höhe von 541 Euro pro Fall. Hierunter finden sich vor allem Fälle, für die sich Einsparungen aus positiven Veränderungen in der Bedarfsgemeinschaft verzeichnen ließen. 50 Arbeitslose wurden in einen als „Sonstige“ bezeichneten Status verwiesen. Darunter finden sich zum Beispiel Abgänge in den Rentenbezug, Wegzüge oder Personen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus ein Studium aufgenommen haben. Auch hier fallen somit zahlreiche Arbeitslose gänzlich aus dem Leistungsbezug heraus (31 von 50), was sich in erheblichen Minderausgaben von 221 Euro pro Fall niederschlägt. Auch bei den „weiter arbeitslosen“ Personen haben sich (in der Regel durch Veränderung bei der Bedarfsgemein-schaft z. B. durch Arbeitsaufnahme eines Partners) nach dem Auswahlprozess geringere Ausgaben ergeben als vorher (112 Euro).
Die folgende Abbildung zeigt diese Einsparungen in den einzelnen Maßnahme und Status-gruppen.
Abbildung 22: Mehr- und Minderausgaben pro Fall und Monat nach dem Auswahlprozess
-611
-541
-221
-113
-29
619
-110
-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800
Erster Arbeitsmarkt
Sonstige Maßnahme
Sonstiges
Weiter arbeitslos
Arbeitsgelegenheit
Bürgerarbeit
Insgesamt
Beträge in Euro
Diesen Einsparungen, die im Auswahlprozess erzielt werden konnten, stehen die Mehrausgaben gegenüber, die sich durch die Einführung der Bürgerarbeit ergeben.
5.2.2 Mehrausgaben: Die Geldströme zur Bürgerarbeit (alle Kostenträger )
Bürgerarbeiter erhalten ein sozialversicherungspflichtiges Entgelt, das zwischen 675 Euro und 975 Euro liegt; der Großteil der Bürgerarbeiter (etwa 97 Prozent) erhält monatlich 825 Euro.
Umverteilungseffekte
69
Die Träger erhalten für die Wahrnehmung der Arbeitgeberfunktionen (Akquise von Bürgerar-beitsplätzen, Verwaltung der Fälle, Abführung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen u. a.) pro Bürgerarbeiter einen ausgehandelten Pauschalbetrag von 120 Euro.
Die Bruttokosten für die Bürgerarbeit können demnach folgendermaßen berechnet werden: Entgelt + Verwaltungskostenpauschale + Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträ-gen + weitere Leistungen der Bundesagentur für Arbeit + Kosten der Unterkunft . Es ergibt sich daraus im vorliegenden Fall ein Betrag von 1.085 Euro. Die folgende Abbildung veranschaulicht die Geldströme zur Bürgerarbeit.
Abbildung 23: Geldströme zum Projekt (je Fall/Monat)
5.3 Umver teilungsprozesse
Es war die erklärte Absicht in diesem Vorhaben, durch den Auswahlprozess eine (theoreti-sche) Umverteilung der Mittel innerhalb der Gruppe der Arbeitslosen zu erreichen. Das ist in Hinblick auf mehrere Merkmale gelungen.
Differenziert man nun die Bezüge „vor“ und „nach“ dem Auswahlprozess in ihrer Höhe (Vergleiche Abbildung 24), so lässt sich zeigen, dass ein Umverteilungsprozess stattgefunden hat. Niedrige Bezüge (dunkle Linie) werden nach dem Auswahlprozess zuungunsten der vorher hohen Bezüge etwas angehoben.
Agentur
Land/EU
(Kommune)
Träger
Aufwendungen für Bürgerarbeitsmodell pro Fall/Monat = 1.085�
Einsatzstellen
AG-Anteile SV = 17% vom Bruttolohn = 140 �
Verwaltungskosten- pauschale = 120 �������Entgelt für Bürgerarbeit
Arbeitsentgelt = 825 �
(Minderausgaben = -92 ���
Sachkosten, Arbeitsschutz, Mietkostenanteile, Energiekosten (kaum quantifizierbar, aber sehr gering).
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
70
Abbildung 24: Leistungsbezüge vor und nach dem Auswahlprozess
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Bestandsfälle nach Höhe der Leistungen aufwärts sortiert
Sum
men
in E
uro
Summe vor Summe nach Polynomisch (Summe nach)
Aufwärtsverteilung
Abwärtsverteilung
Für jeden Fall lässt sich die Differenz zwischen seinen Bezügen „vor“ und „nach“ dem Auswahlprozess darstellen, indem die Bezüge „vor“ aufsteigend angeordnet und ihnen die Bezüge „nach“ zugeordnet werden. Eine polynomische Trendgerade lässt dann einen Umverteilungsprozess erkennen, der noch deutlicher erscheint, wenn die Bezüge (wie in der nächsten Abbildung) nach dem Lebensalter ausgewiesen werden. Folgende Umvertei-lungsprozesse lassen sich dem Grunde nach ableiten:
• Von höheren Leistungen (vor dem Auswahlprozess) zu den Leistungsbeziehern, die vor dem Auswahlprozess eher niedrige Leistungen bezogen haben (ALG2-Empfänger).
• Das Gesamtvolumen der Leistungen ist durch den Auswahlprozess zurückgegangen. Dies ist zum großen Teil auf die 131 erfolgreichen Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt zurückzuführen, durch die die Zusatzkosten für die 110 Bürgerarbeiter bereits überkompensiert werden konnten. Dabei profitierten vor allem Ältere von dem Auswahlprozess, weil sie eher in Bürgerarbeit vermittelt wurden als Jüngere und hier höhere Bezüge erhielten.
• Es fand ein Umverteilungsprozess von „ jung“ zu „alt“ statt, wobei nach dem Auswahlprozess relativ wenig junge Arbeitslose (26 Prozent der unter 35-Jährigen) die Mehrkosten für relativ viele ältere, die in Bürgerarbeit kamen, ausglichen.
• Es kam ferner zu Ausgleichsprozessen zwischen Fällen, die in den ersten Arbeitsmarkt gelangten, und Fällen, die in Bürgerarbeit vermittelt wurden.
Umverteilungseffekte
71
Abbildung 25: Leistungsbezüge vor und nach dem Auswahlprozess nach Lebensalter
200
300
400
500
600
700
800
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Alter in Jahren
Su
mm
e d
er L
eist
un
gen
Polynomisch (Summe nach Statusänderung) Polynomisch (Summe vor Statusänderung)
Dies sind jedoch nicht die einzigen Umverteilungsprozesse, die durch den Auswahlprozess erfolgt sind. Es fand eine Umverteilung von Männern zu Frauen statt. Dies ist nicht allein dadurch begründet, dass etwas mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer in Bürgerarbeit (79/31) und dagegen fast doppelt so viele Männer wie Frauen in AGH-Maßnahmen (meist Ein-Euro-Jobs; 35/21) vermittelt wurden. Der Anteil der Männer, die in „sonstige Maßnah-men“ gelangten, lag ebenfalls doppelt so hoch wie der Frauen. Ebenfalls wurden erheblich mehr Männer als Frauen in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt (81/50).
5.4 Bilanz
In einem weiteren Schritt betrachten wir nun das Volumen der Einsparungen und Mehrausgaben insgesamt, also die Einsparungen und Mehraufwendungen pro Fall, multipli-ziert mit der Anzahl der jeweiligen Fälle in den einzelnen Verbleibenskategorien.
Stellt man die Einsparungen den Mehrausgaben gegenüber, so konnten im vorliegenden Fall (bezogen auf den Zeitraum vom 15.09.2006 bis zum 30.04.2007) pro Monat mehr als 50.000 Euro „eingespart“ und damit Bürgerarbeit zusätzlich finanziert werden, wie aus Tabelle 5 ersichtlich wird.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
72
Tabelle 5: Volumina der Mehrausgaben und Einspareffekte (alle Fälle, gesamter
Zeitraum, Bad Schmiedeberg)
Status nach
Mittelwert Einsparungen/ Mehrausgaben
Anzahl Mehrausgaben Einsparun-
gen
Bürgerarbeit 619,13 110 68.104,30 Erster Arbeitsmarkt -610,98 131 -80.038,38 Arbeitsgelegenheit -29,10 56 -1.629,60 Sonstige Maßnahmen -541,41 31 -16.783,71 Sonstiges -221,13 50 -11.056,50 Weiter arbeitslos -112,56 77 -8.667,12 Insgesamt 455 -118.175,31
Diese Ergebnisse beziehen sich jedoch auf alle Fälle, die im gesamten Zeitraum in den Auswahlprozess eingegangen sind. Aber wenn die erfolgten Vermittlungen im Zeitverlauf und in Bezug auf die Grundgesamtheit (Bestandsfälle) beobachtet werden, ergibt sich ein wesentlich anderes Ergebnis, wie die folgende Tabelle zeigt.
Tabelle 6: Volumina der Mehrausgaben und Einspareffekte (nur Bestandsfälle im „ Kampagnen-Zeitraum“ ) (Bad Schmiedeberg)
Status nach
Mittelwert Einsparungen/ Mehrausgaben
Anzahl Mehrausgaben Einsparun-
gen
Bürgerarbeit 614,99 105 64.573,95 Erster Arbeitsmarkt -488,93 62 -30.313,66 Arbeitsgelegenheit -26,67 53 -1.413,51 Sonstige Maßnahmen -498,66 21 -10.471,86 Sonstiges -260,94 37 -9.654,78 Weiter arbeitslos -171,06 55 -9.408,30 Insgesamt 333 -61.262,11
Hier ergeben sich Mehrausgaben lediglich in Höhe von 3.300 Euro, weil nur die Bestandsfälle (N = 333) zu Grunde gelegt wurden, die unmittelbar zu Beginn der Kampagne, also vom 15.09.2006 bis zum 30.11.2006 in den Auswahlprozess einbezogen waren. Diese Fälle zeigen den „Kampagneneffekt“ , denn hier mussten durch die Umverteilung von 333 Fällen die Mehrkosten von 105 Bürgerarbeitern ausgeglichen werden, während im Laufe der Zeit von den 122 zusätzlichen Fällen nur fünf Bürgerarbeiter mehr „ finanziert“ werden mussten und sich die Einsparungen durch den Auswahlprozess gewissermaßen als positives Betriebsergeb-nis niederschlagen konnten.
Auch bezogen auf den Landkreis Wittenberg und das Land Sachsen-Anhalt zeigt sich ein sehr eindeutiges Bild. Tabelle 7 verdeutlicht, dass der Rückgang der Leistungssumme in Bad Schmiedeberg ganz überwiegend auf Effekte der Bürgerarbeit (Abgang in Arbeit und Bürgerarbeit) zurückzuführen ist, da im gleichen Zeitraum das Leistungsvolumen im Landkreis Wittenberg nur um fünf Prozent und im Land Sachsen-Anhalt um drei Prozent rückläufig war.
Umverteilungseffekte
73
Tabelle 7: Vergleich der passiven Leistungen für den Rechtskreis SGB II; Kommune Bad
Schmiedeberg, Landkreis Wittenberg, Land Sachsen-Anhalt zwischen November
2006 und September 2007
Regelleistung und Laufende Hilfe für Lebensunterhalt
November
2006
Apr il
2007
September
2007
November 2006 –
September 2007
Summe (in Euro) Veränderung (in Prozent)
Entwicklung in Bad Schmiedeberg
Abgang in Arbeit 26.481,49 12.018,24 9.964,39 -62,37
Abgang in Bürgerarbeit 38.578,33 13.053,10 13.256,77 -65,64
Abgang in AGH mit MAE 30.208,75 30.194,10 29.026,42 -3,91
Abgang in sonstige Maßnahmen
13.868,92 8.062,87 12.172,32 -12,23
Verbleib in Arbeitslosigkeit 24.026,93 22.819,75 20.953,87 -12,79
Sonstiges 19.518,35 12.632,84 13.815,41 -29,22
Summe
Bad Schmiedeberg
152.682,77
98.780,90
99.189,18
-35,04
Landkreis Wittenberg 5.080.397,00 5.133.726,00 4.811.385,00 -5,3
Land Sachsen-Anhalt 99.602.879,00 100.471.733,00 96.867.415,00 -2,75
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen
Legende: AGH = Arbeitsgelegenheiten, MAE = Mehraufwandsentschädigung
Die Sensibilität des Verhältnisses von Mehrausgaben und Einsparungen ist offenkundig abhängig vom jeweiligen Zeitpunkt der Beobachtung und der damit verbundenen Grundge-samtheit. Weiterhin wird sichtbar, dass sich die scheinbar exakt quantifizierbaren Größen im Ergebnis nur ungenau erfassen lassen, da sie stets einer Dynamik von kaum quantifizierbaren sozialen Rahmenbedingungen unterliegen. Je länger dann ein Auswahlprozess durchgeführt wird, je weniger zusätzliche Fälle dabei in Bürgerarbeit vermittelt werden können (etwa weil das Kontingent an verfügbaren Bürgerarbeitsplätzen ausgeschöpft ist) und je mehr Fälle während dieser Auswahlphase in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt wurden, desto höher werden die Einsparungen gegenüber den für die Bürgerarbeit notwendigen Mehrausgaben sein.
Deshalb werden auch die Volumina der Einsparungen, die nach dem Auswahlprozess in diesem Projekt erzielt wurden, in anderen Situationen bzw. Regionen ganz andere Größen und damit andere Deckungsbeiträge aufweisen, denn sie sind abhängig von:
• der Dauer und Intensität, mit der der Auswahlprozess durchgeführt wird. Auch die Ergebnisse des Auswahlprozesses werden sich im Zuge einer „natürlichen“ Dynamik wieder verändern, wobei die Richtung der Veränderung ebenfalls eine Funktion der Dynamik des ersten Arbeitsmarktes im Zeitverlauf ist.
• den Vermittlungsmöglichkeiten, die in einer Region bestehen. Diese ergeben sich zum Beispiel aus:
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
74
• der Dynamik des ersten Arbeitsmarktes (Verhältnis von „natürlichen“ Zugängen und Abgängen),
• der sozialstrukturellen (z. B. Altersverteilung, Verteilung von Berufen und Bildung) und sozialkulturellen (z. B. Ausländeranteil) Zusammensetzung der Arbeitslosen,
• dem Match bzw. Mismatch dieser Faktoren mit den regionalen Arbeitsmarktan-forderungen und
• der Vereinsdichte in einer Region bzw. der Anzahl und Qualität der zur Verfügung stehenden „marktfernen“ Arbeitsgelegenheiten, durch welche das Verhältnis aus der Anzahl potenzieller Bürgerarbeiter und realer Bürgerarbeitsplätze bestimmt wird. Im vorliegenden Fall betrug dieses Verhältnis etwa 1:4,5, das heißt, auf zwei Bürgerar-beitplätze entfielen neun potenzielle „Bewerber“ .
Diese vier Faktoren sind entscheidend für die Anzahl der Vermittlungsmöglichkeiten von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt. Je mehr dieser Vermittlungen zustande kommen können, desto höher wird der Deckungsgrad für die Mehrkosten der Bürgerarbeit ausfallen (eine gegebene Anzahl von Bürgerarbeitern angenommen).
Je weniger freie Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, desto weniger Bürgerarbeitsplätze können „ refinanziert“ werden. Dadurch ist eine widersprüchliche Situation geschaffen: In Regionen mit eher schwacher Dynamik des ersten Arbeitsmarktes, also dort, wo Bedarf an zahlreichen Bürgerarbeitsplätzen besteht, sind deren Finanzierungs-möglichkeiten aus den „ laufenden“ Einsparungen eines Auswahlprozesses weniger gut als dort, wo bessere Bedingungen aber weniger Bedarf besteht. Soll Bürgerarbeit verstetigt und verallgemeinert werden, müsste die Bundesagentur für Arbeit hier Ausgleichsmöglichkeiten vorsehen.
5.5 Die Nachhaltigkeit der Vermittlungsergebnisse
Wir haben gezeigt, dass die Einspareffekte und Mehrausgaben, wenn sie sich auf den Einzelfall/Monat beziehen, eher auf andere Projekte in anderen Regionen übertragen werden können als deren Volumeneffekte, die stark von den jeweils regionalen oder örtlichen Rahmenbedingungen abhängig sind. Eine eingeschränkte Übertragbarkeit ergibt sich auch aus der biografischen und der Arbeitsmarktentwicklung im Zeitverlauf, die bewirkt, dass die Ergebnisse des Auswahlprozesses im Prinzip nur für den Zeitpunkt gelten, zu dem sie erhoben wurden. Es gibt nämlich keine „Garantie“ dafür, dass jemand, der zu einem Zeitpunkt X im Rahmen des Auswahlprozesses in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt wurde und ca. 600 Euro Einsparungen bewirkt hat, zu einem Zeitpunkt Y sich immer noch im ersten Arbeitsmarkt befindet und die gleichen Einsparungen erbringt. In welchem Ausmaß solche Veränderungen stattfinden, ist ebenfalls von der regionalen Dynamik des ersten Arbeitsmark-tes abhängig, die die „natürlichen“ biografischen Verläufe des Wechsels bzw. der Stabilität von Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit und Maßnahmen bestimmt. Im vorliegenden Fall konnten die Mehrkosten der Bürgerarbeit durch die erzielten Minderausgaben in anderen Leistungs-kategorien mehr als gedeckt werden, und dieser Zustand hat auch mindestens sieben Monate angehalten. Dies zeigt die folgende Tabelle.
Umverteilungseffekte
75
Tabelle 8: Statusentwicklung nach dem Auswahlprozess
Erster Arbeitsmarkt
Arbeits- gelegenheit Bürgerarbeit Sonstige
Maßnahme Sonstiges Weiter arbeitslos
Erster Arbeitsmarkt 112 1 0 0 2 16 131 Arbeitsgelegenheit 5 6 0 0 1 44 56 Bürgerarbeit 3 0 101 1 1 4 110 Sonstige Maßnahme 14 1 0 5 0 11 31 Sonstiges 3 4 0 1 35 7 50 Weiter arbeitslos 15 7 0 6 9 40 77 Insgesamt 152 19 101 13 48 122 455
Status nach Auswahlprozess
weiterer Status (30.11.2007) Insgesamt
Von den 131 Fällen, die in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten, sind zum 30.11.2007 immerhin noch 112 (85 Prozent) im ersten Arbeitsmarkt, das heißt, die anfänglich erzielten Einspareffekte haben sich hier in 85 Prozent der Fälle über einen Zeitraum von mindestens sieben Monate als stabil erwiesen. Zu diesen 112 im ersten Arbeitsmarkt verbliebenen Fällen sind jedoch im Laufe der Zeit noch 40 aus anderen Kategorien dazugekommen, so dass sich allein aus diesen Positionen größere Einsparungen ergaben als un-mittelbar nach dem Auswahlverfahren (92.886 Euro gegenüber etwa 80.000 Euro) . Auf der anderen Seite sind allerdings von den 56 Fällen, die im Zuge des Auswahlprozesses in eine Arbeitsgelegenheit vermittelt wurden, 44 wieder arbeitslos geworden, so dass diese nun wieder etwas höhere Kosten verursachen (dies kann sich nur aus Veränderungen innerhalb der Bedarfsgemeinschaft erklären, da die Kosten während der AGH nicht geringer sind als außerhalb). Von den 77 Fällen, die nach dem Auswahlprozess weiterhin arbeitslos waren, sind am Ende des Beobachtungszeitraums nur noch 40 arbeitslos, 15 von ihnen konnten dagegen im ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen. Hier ergeben sich somit zusätzliche Einsparpotenziale.
Im vorliegenden Projekt lag die monatliche Summe der Einsparungen nach dem Auswahlpro-zess am 30.04.2007 bei insgesamt mehr als 50.000 Euro. Zum 30.11.2007 betrug die Summe (bezogen auf die Relationen vom 30.04.2007) sogar über 62.000 Euro. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass doch verhältnismäßig viele Arbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden bzw. sich dort halten konnten. Aber auch dieses günstige Verhältnis von Einsparungen und Mehrausgaben nach mindestens sieben Monaten spricht nicht dafür, die Einsparungen durch ein Auswahlverfahren als alleinige Quelle der Finanzierung zu wählen, weil, wie gezeigt wurde, durch den Auswahlprozess selbst die Dynamik der zukünftigen Entwicklung erheblich beeinflusst wird und damit die Situation vor dem Auswahlprozess mit der nach dem Auswahlprozess nicht vergleichbar ist, da die „natürlichen“ und die durch den Auswahlprozess bewirkten Faktoren der Dynamik nicht sauber isoliert werden können. Obwohl der Vergleich auf einer rein ökonomischen Ebene nahe liegen mag: empirisch und logisch ist er nicht zulässig.
Auch diese Veränderungen der Ergebnisse des Auswahlprozesses werden von Region zu Region unterschiedlich sein. Aber sie zeigen, dass die (theoretisch erzielbaren) Einsparungen des Auswahlverfahrens prinzipiell eher ein Einmaleffekt sind, weil sie sofort nach dem Auswahlprozess wieder einer anderen „natürlichen“ Dynamik – der des Arbeitslosenverlaufs und der Arbeitslosigkeit einer Region – unterliegen und daher als stabile Finanzierungsgrund-lage wenig geeignet scheinen.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
76
Aber auch andere, regional bedingte Faktoren machen es problematisch, die Finanzierung durch die hier gewählte Art des Auswahlprozesses gewährleisten zu wollen.
Das Verhältnis von Bürgerarbeitsplätzen in einer Region und potenziellen Bürgerarbeitern ist nämlich ebenfalls eine fluide Größe, die je nach regionalen Gegebenheiten zu ganz unter-schiedlichen Auslegungen des gesamten Vorhabens führen kann. Ein optimales Verhältnis besteht dann, wenn, wie es in Bad Schmiedeberg offensichtlich der Fall war, die Zahl der Bürgerarbeitsplätze annähernd der Anzahl der potenziellen Bürgerarbeiter entspricht. Es kann jedoch nicht vorausgesetzt werden, dass dies immer der Fall ist. In Bad Schmiedeberg zum Beispiel entfielen allein 47 Bürgerarbeitsplatzstellen auf nur zwei Sozialbetriebe, eine Häufung, die andernorts nicht immer zu reproduzieren sein wird. Daraus ergab sich in Bad Schmiedeberg aber, im Verhältnis zur Anzahl potenzieller Bürgerarbeiter, eine sehr günstige Relation zwischen Bürgerarbeitern und Einsatzstellen. Je größer die Nicht-Übereinstimmung zwischen beiden Größen ist, desto intensiver und selektiver werden die Auswahlprozesse sein müssen, damit Angebot und Nachfrage „gerecht“ aufeinander abgestimmt werden können.
Die Auswahlprozesse könnten in einem solchen Fall eher wettbewerblich, also marktnah, gestaltet werden. Dann gäbe es einen „Markt“ für Bürgerarbeitsplätze, auf die sich die potenziellen Bürgerarbeiter (deren Kreis allerdings nicht durch Marktmechanismen, sondern eher durch politische Entscheidungen und gesetzliche Normierung festgelegt ist) bewerben könnten oder es gibt einen Markt, auf dem die Einsatzstellen um Bürgerarbeiter konkurrieren, wenn sie Bürgerarbeiter einstellen wollen. Wie die Erfahrungen aus diesem Projekt jedoch gezeigt haben, scheint ein solcher Marktbezug nicht sehr praktikabel zu sein. Einsatzstellen würden lieber ihr Angebot zurückziehen, wenn sie sich um Bürgerarbeiter besonders bemühen müssten. Viele sehen ihr Angebot vor allem als (soziales) Zugeständnis an eine für die Region desintegrierend wirkende Arbeitsmarktlage und handeln nicht aus marktlichen oder aus Wettbewerbsgründen, sondern unter sozialen Gesichtspunkten (siehe auch Kapitel 4). Viele Bürgerarbeiter ziehen auf der anderen Seite die Aufnahme einer Bürgerarbeit einem Verweilen im Arbeitslosenstatus vor. Für sie stellen Bürgerarbeitsplätze ein knappes Gut dar (allerdings hätten sie auch keine Chance, im Status der Arbeitslosigkeit zu verweilen, wenn ein Bürgerarbeitsangebot vorliegt, da jede zumutbare Arbeit angenommen werden muss). Es würden jedoch nicht legitimierbare bzw. kaum auszuhandelnde neue Restriktionen für die Aufnahme von Bürgerarbeit entstehen, wenn für die marktferne Bürgerarbeit marktnahe Auswahlkriterien zum Einsatz kämen. Hier sollte über denkbare Rotationsverfahren hinausge-hende Möglichkeiten nachgedacht werden, wenn es mehr Bürgerarbeiter als Bürgerarbeits-plätze in den Einsatzstellen gibt bzw. wenn mehr Plätze in den Einsatzstellen als Bürgerarbeiter vorhanden sind. Auswahlverfahren, denen durchaus Wettbewerbs- und Marktaspekte angeheftet werden könnten, würden es erleichtern, bei einem Mismatch des Angebotes von Bürgerarbeitsplätzen in den Einsatzstellen und der Nachfrage nach diesen entsprechende Projekte auf Dauer zu stellen.
Umverteilungseffekte
77
Zwischenbilanz
Der sehr günstige Betreuungsschlüssel von 1:100 im Auswahlprozess bewirkte neben einer
stärkeren Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt auch eine veränderte Statuszuweisung bei
der Mehrzahl der Arbeitslosen. Dadurch konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden, die
über den zusätzlichen Kosten von Bürgerarbeit lagen.
Ziel des Auswahlprozesses war auch eine (modellhafte) Umverteilung der Mittel innerhalb
der Gruppe der Arbeitslosen. Dabei kam es vor allem zu Umverteilungsprozessen von jungen
zu älteren Arbeitslosen, von Männern zu Frauen sowie von Beziehern höherer Leistungen zu
Beziehern niedrigerer Leistungen und zu Ausgleichsprozessen zwischen Fällen, die in den
ersten Arbeitsmarkt gelangten und Fällen, die in Bürgerarbeit vermittelt wurden.
Festzuhalten ist, dass die Einspareffekte und Mehrausgaben, bezogen auf den Fall/Monat,
eher übertragbar sind als die Volumeneffekte, die vor allem stark von den jeweiligen
regionalen Rahmenbedingungen abhängen. Zu diesen regionalen Einflussfaktoren zählen
insbesondere die Dynamik des ersten Arbeitsmarktes, die Zusammensetzung der Arbeitslosen,
der Match bzw. Mismatch dieser Faktoren mit den regionalen Arbeitsanforderungen sowie
Anzahl und Qualität der zur Verfügung stehenden marktfernen Arbeitsgelegenheiten.
Es konnte sichtbar gemacht werden, dass die (prinzipiell erzielbaren) Einsparungen, die sich
aus dem Auswahlprozess ergaben, vorrangig Einmaleffekte sind, da sie sofort nach dem
Auswahlprozess wieder einer anderen, von der regionalen Entwicklung der Arbeitslosigkeit
abhängenden Dynamik unterliegen und daher als stabile Finanzierungsgrundlage wenig
geeignet scheinen. Die monetären Ergebnisse des Auswahlprozesses gelten im Prinzip nur für
den Zeitpunkt, zu dem sie erhoben wurden. Seine Umverteilungseffekte innerhalb der
Arbeitslosen (insbesondere Bürgerarbeit, erster Arbeitsmarkt und Abmeldungen) sind jedoch
wesentlich nachhaltiger.
79
6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Vorbemerkungen
Das Pilotvorhaben „Bürgerarbeit“ in Bad Schmiedeberg, über dessen Evaluation hier berichtet wird, ist nur vor dem Hintergrund der allgemeinen Arbeitsmarktlage und ihrer Perspektiven zu erklären und zu bewerten:
Vor diesem Hintergrund spricht, trotz einer deutlichen Wiederbelebung des Arbeitsmarktes während der Projektlaufzeit, sehr vieles für die Annahme, dass es auch in Zukunft einen verfestigten Sockel von schwer vermittelbaren Arbeitslosen und marktfernen Leistungsbezie-hern geben wird, der besonderer Förderung bedarf.
Die wichtigsten Gruppen, aus denen sich dieser Sockel zusammensetzt, lassen sich zumeist recht gut durch biografische Faktoren wie Alter, Grad der Ausbildung, Mobilitätsbereitschaft und Mobilitätsfähigkeit und ihren bisherigen Erwerbsverlauf beschreiben. Mitglieder dieser Sockel-Gruppen sind zwar in der Regel, wie sich in Bad Schmiedeberg bei den Befragungen der Bürgerarbeiter und der für ihren Einsatz verantwortlichen Personen sehr eindeutig zeigte, arbeitsbereit. Dennoch gelten sie bei vielen potenziellen Arbeitgebern wegen ihrer Eigenschaften als wenig geeignet.
Auch in Bad Schmiedeberg kristallisierte sich nach einem vierstufigen Auswahlprozess aus einer Gesamtheit von 455 Arbeitslosen eine Gruppe von etwa 100 immobilen, älteren Arbeitslosen, überwiegend Frauen, mit langer Arbeitslosigkeits-Historie heraus, die längst aus der fördernden Betreuung der Arbeitsämter und Arbeitsgemeinschaften entlassen waren, um die sich, so ein Akteur aus der Arbeitsagentur, „keiner mehr gekümmert hat“ und die deshalb besonderer Fördermaßnahmen bedürfen, wenn sie je wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zurückkehren wollen.
Diesen Langzeitarbeitslosen sollten, so das Ziel des Pilotvorhabens, ausdrücklich als „markt-fern“ ausgewählte Arbeitsplätze angeboten werden. Das – sozialversicherungspflichtige – Entgelt für diese Tätigkeiten sollte nicht über den Bezügen liegen, die auch vor der Aufnahme der Bürgerarbeit der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft zustanden. Es gab insofern – mit Ausnahme der Nichtleistungsbezieher - keinen finanziellen Anreiz, die angebotene Bürgerar-beit zu akzeptieren (die allerdings als „zumutbar“ definiert war).
Dem Pilotvorhaben lag die These zugrunde, dass eine wirksame Förderung dieser Gruppe von Langzeitarbeitslosen Innovationen in der Arbeitsmarktpolitik erfordert, die stärker als bisher möglich dem Grundsatz entsprechen, Leistungen nicht nur für Nicht-Arbeit, sondern auch für sinnvolle Tätigkeiten zu gewähren und die insofern die Grenze zwischen passiver und aktiver Arbeitsmarktpolitik zugunsten letzterer verschiebt. Die Evaluation dieses Vorhabens wirft eine Reihe von Fragen auf:
• Inwieweit ist das Pilotvorhaben als gelungen zu bezeichnen?
• Welche Lektionen lassen sich aus dem Projekt in Bad Schmiedeberg ziehen?
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
80
• Inwieweit sind die hier gewonnenen Erfahrungen übertragbar und auch anderswo nutzbar?
• Welche Fragen mussten bisher noch offen bleiben?
Das abschließende Kapitel des Berichtes will in drei Teilen erste Antworten auf Fragen dieser Art geben.
Ein erster Teil fasst die wichtigsten Befunde der Untersuchung zusammen.
In einem zweiten Teil werden einige Empfehlungen zur Steuerung von Bürgerarbeit oder vergleichbaren Experimenten vorgestellt, die sich offenkundig aus den Befunden ergeben.
Im dritten Teil werden Fragen formuliert, die noch offen sind und deren Beantwortung weiter-führende Untersuchungen erfordert.
6.1 Die wichtigsten Ergebnisse
Die wichtigsten Ergebnisse der Evaluation, die in den vorstehenden Kapiteln ausführlicher erläutert sind, können in vier Thesen zusammengefasst werden.
These 1:
Es ist in einer eher kleinen Gemeinde möglich, eine erhebliche Zahl von Arbeitsplätzen für „Bürgerarbeiter“ zu gewinnen. Dies gilt auch dann, wenn das Gebot der Markt-ferne dieser Arbeitsplätze sehr ernst genommen wird.
Bürgerarbeit ist als Instrument der Arbeitsmarktpolitik, wie nahezu alle Formen von geförderter Tätigkeit, als marktfern definiert. Es ist evident, dass marktferne Arbeitsplätze nur durch marktferne Verfahren eingeworben werden können. Eine ausreichende Zahl von Bürgerarbeitsplätzen zu gewinnen, setzte deshalb voraus, dass eine größere Zahl von „Einsatzstellen“ , Einrichtungen verschiedener Art aufgrund wirtschaftlicher, organisatorischer und/oder sozialer Überlegungen bereit war, Bürgerarbeiter einzustellen.
Das Pilotvorhaben Bad Schmiedeberg zeigt, dass dies mit rund 100 Bürgerarbeitsplätzen in erheblichem Umfang möglich ist.
Sicherlich lag in Bad Schmiedeberg, einem mit 4.150 Einwohnern eher kleinen und überschaubaren Ort, mit einem eher schwachen Arbeitsmarkt, jedoch mit geringer Abwanderungstendenz und mit Zuwachsraten des Haushaltseinkommens, die dem Landes-durchschnitt entsprechen, auch eine günstige Situation für die Akquise von Bürgerarbeitsplät-zen vor. Diese Situation gestattete es den Einsatzstellen aufgrund der großen sozialen Integration in der Gemeinde, die sozialen Aspekte der Bürgerarbeit stärker zu gewichten als ihre Skepsis im Hinblick auf die zu erwartenden organisatorischen und finanziellen Bedingungen.
Dank der Überschaubarkeit der lokalen Verhältnisse sind auch die Kommunikations-, Aus-tausch- und Handlungsstrukturen der wichtigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Akteure relativ transparent. Sie konnten für die Initiierung und Durchführung des Pilotvorhabens offensichtlich gut genutzt werden. Es war infolgedessen nicht notwendig, für das Projekt Bürgerarbeit neue Parallelstrukturen aufzubauen.
Zusammenfassung und Ausblick
81
Der Erfolg des Pilotvorhabens in Bad Schmiedeberg gründet nicht zuletzt auf der Bereitschaft aller institutionellen Akteure, zu kommunizieren, zu kooperieren und dabei neue, durchaus auch unübliche Wege zu betreten. Auf diese Weise konnte auch deren hohe Vertrautheit mit den lokalen Bedingungen von Wirtschaftsstruktur, wirtschaftlicher Lage und Situation auf dem ersten Arbeitsmarkt bis zur Qualifikationsstruktur und den sozialdemografischen Merkmalen der Erwerbstätigen und der Arbeitslosen, frühzeitig in die Planung, Implementa-tion und Steuerung des Projektes eingebracht werden.
These 2:
Die Zufriedenheit aller Beteiligten, die bereits in der Start- und Implementierungsphase hoch war und sich im Projektverlauf teilweise noch deutlich erhöht hat, darf als wichtiges Erfolgskriterium des Pilotvorhabens gewertet werden.
Sowohl in der Perspektive der Bürgerarbeiter als auch in der Sicht der für ihren Einsatz verantwortlichen Akteure ist das Vorhaben „Bürgerarbeit“ in Bad Schmiedeberg heute – mehr als ein Jahr nach Projektstart – als ausgesprochener Erfolg zu bewerten.
Der Anspruch der am Projekt beteiligten institutionellen Akteure, Langzeitarbeitslosen durch eine Tätigkeit im gemeinnützigen Sektor wieder Hoffnung zu geben, sie wieder an Erwerbsarbeit heranzuführen und ihr Selbstvertrauen zu stärken, war hoch und erforderte, wie die in den vorangehenden Kapiteln dargestellten Detailergebnisse zeigen, einen erheblichen, vor allem auch kontinuierlich zu erbringenden Aufwand. Doch lohnte sich dieser Aufwand, wie sich an der allgemeinen Zufriedenheit ermessen lässt, die im Projektverlauf deutlich gestiegen ist.
Die Träger, die Stadt und letztlich auch die Einsatzstellen selbst sehen einen beträchtlichen zusätzlichen Nutzen in der Bürgerarbeit, auch wenn durchaus in einigen Einsatzstellen un-erwartete Kosten entstanden sind.
Bürgerarbeit ermöglichte es vor allem den Vereinen und Sozialbetrieben, zusätzliche Angebote zu unterbreiten, die Attraktivität ihrer Angebote zu erhöhen und die ehrenamtlich Tätigen zu entlasten. Bürgerarbeit hat somit, gerade im kleinen regionalen Umfeld von Bad Schmiedeberg, sowohl auf das öffentliche Leben der Kommune als auch auf das individuelle Leben der Bürgerarbeiter nachhaltig positiven Einfluss.
Sicherlich gab es Probleme, punktuelle Kritik und Konflikte, die diskutiert, aufgearbeitet und soweit möglich gelöst werden mussten. Die hiermit verbundenen Aushandlungsprozesse könnten überwiegend selbst Teil der Erfolgsgeschichte werden, wenn es gelingt, aus ihnen für andere, nachfolgende Bürgerarbeitsprojekte zu lernen.
Das hohe Engagement der Verantwortlichen (Träger, Stadt und Einsatzstellen) findet seinen Ausdruck auch in einer ganzen Reihe praktischer Verbesserungsvorschläge, die nach einem Jahr rückblickend formuliert wurden.
Noch ausgeprägter ist – verständlicher Weise – die Zufriedenheit der Bürgerarbeiter selbst. Diese haben, hierin sind sich die Bürgerarbeiter und die Verantwortlichen der Einsatzstellen einig, an Selbstbewusstsein gewonnen, fühlen sich gebraucht und zeigen eine nachgerade
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
82
erstaunlich hohe Zufriedenheit, sowohl mit ihrer Arbeit als auch mit ihren Lebensverhältnis-sen.
These 3:
Das Risiko von Verdrängungseffekten vom ersten Arbeitsmarkt kann nicht a priori ausge-schlossen werden. Vielmehr ist mit Konflikten zwischen weitgehend gleichrangigen Zielen zu rechnen, die nicht administrativ, sondern nur durch fallbezogene Verhandlungen und Vereinbarungen vor Ort gelöst werden können.
Bürgerarbeit ist subventionierte Tätigkeit, ihre Preisbildung unterliegt allenfalls mittelbar einer Marktregulierung (z. B. durch Festlegung des jeweiligen Bürgerarbeitslohnes in einer Region). Die Nutzer der Bürgerarbeit müssen für den Nutzen keine Gegenleistung erbringen. Insofern ist ein Missbrauch von Bürgerarbeit möglich, insbesondere indem Bürgerarbeiter für Tätigkeiten eingesetzt werden, die zu Marktpreisen auf dem ersten Arbeitsmarkt bezogen werden könnten.
Hieraus resultierte dann auch die Forderung, dass Bürgerarbeit grundsätzlich marktfern sein müsse, da nur dann, wenn Bürgerarbeit strikt auf Aufgaben und Leistungen begrenzt bleibe, die nicht auch am Markt angeboten bzw. beschafft werden können, ausgeschlossen sei, dass öffentlich geförderte Arbeit aufgrund ihrer günstigeren Kostenstruktur normale Tätigkeiten vom Markt verdrängt.
Allerdings ist für das Projekt „Bürgerarbeit“ eine wesentlich komplexere Zielkonfiguration charakteristisch. Die Aufgabenstruktur des Projektes kennt zumindest zwei weitere, wichtige Ziele, die mit dem Ziel der Marktferne in Konflikt geraten können:
Zum Einen sollen die Tätigkeiten der Bürgerarbeiter einen sichtbaren und nachprüfbaren Nutzen für die Gemeinschaft erbringen. Durch die Erreichung dieses Zieles wird sowohl die Legitimität von Bürgerarbeit gesichert wie die Gewinnung einer ausreichenden Zahl von Bürgerarbeitsplätzen erleichtert.
Zum Anderen sollen sich diese Tätigkeiten im Interesse sozialer Integration der Bürgerarbei-ter und der Erhöhung (Wiedergewinnung) von Beschäftigungsfähigkeit möglichst wenig von normalen, also marktnahen Tätigkeiten unterscheiden.
Die Möglichkeit von Konflikten zwischen dem Ziel der Marktferne auf der einen Seite und den Zielen sichtbaren gemeinschaftlichen Nutzens und ausreichender Ähnlichkeit mit markt-nahen Tätigkeiten auf der anderen Seite ist evident. Fragt man, wie in Bad Schmiedeberg mit dieser Möglichkeit umgegangen wurde und was sich hieraus lernen lässt, so sind zwei Etappen zu unterscheiden.
(1) Auswahl der ins Vorhaben aufzunehmenden Bürgerarbeitsplätze
Erstmals wurde der Zielkonflikt in einem sehr frühen Stadium, im Zuge der Auswahl der für Bürgerarbeit zuzulassenden Arbeitsplätze, manifest. Im Rahmen einer sehr intensiven Mobilisierungskampagne wurden alle in Frage kommenden Einrichtungen aufgefordert, entsprechende Angebote zu unterbreiten.
Zusammenfassung und Ausblick
83
Im Zuge einer sorgfältigen, durch mehr oder minder informelle Gespräche und Verhandlun-gen begleiteten Prüfung der Marktferne und des öffentlichen Nutzens der zu leistenden Arbeit wurden von den insgesamt fast 200 eingegangenen Angeboten etwa 100 als ausreichend marktfern eingestuft und in das Programm aufgenommen.
(2) Aufbau eines Systems regelmäßiger Kontrolle der Marktferne
Mit Beginn des eigentlichen Projektes wurde versucht, Zielkonflikte vor allem durch Kontrollen der Marktferne zu lösen oder zu vermeiden.
Dies war nur möglich, indem in jedem einzelnen Fall geprüft wurde, ob die aktuellen Tätigkeiten der Bürgerarbeiter nicht auch von Arbeitskräften aus dem ersten Arbeitsmarkt hätten durchgeführt werden können. Diese Kontrollen und Prüfungen erfolgten in erster Linie und bis zu deren Auflösung zum Jahresende 2007 durch die Projektmanagementgruppe. Diese formale Kontrolle wurde offenbar ergänzt durch eine Art informeller Aufsicht: Zumindest anfangs wurde berichtet, dass auch Einwohner der Gemeinde bestimmte Einsatzstellen beobachteten.
Diese Kontrollen waren durchaus sinnvoll. So wurden durch sie einige wenige, teilweise ernstzunehmende Verstöße gegen das Prinzip der Marktferne der Tätigkeit festgestellt, was zur umgehenden Untersagung der weiteren Beschäftigung und im Falle einer Einsatzstelle zu ihrem Ausschluss aus dem Projekt führte.
Allerdings mehrten sich im Laufe die Zeit Hinweise auf die Grenzen und Schwächen dieses Kontrollsystems. Die Tätigkeit der (immerhin dreiköpfigen) Projektmanagementgruppe wurde nicht mehr von allen Beteiligten gut geheißen. Nach ihrer Auflösung mussten die beiden Träger nicht ganz unerhebliche zusätzliche Aufgaben übernehmen. Einige Verant-wortliche von Einsatzstellen bedauerten explizit, dass die Gruppe seit Beginn des Jahres 2008 nicht mehr besteht.
Parallel hierzu zeigten sich auch Bestrebungen, die Kontrolldichte zu reduzieren bzw. (im Falle großer Einsatzstellen) in eigene Regie zu übernehmen. Gleichzeitig scheint im Laufe der Zeit in einem Teil der Einsatzstellen die Neigung zu steigen, die Grenzziehung zwischen marktfernen und marktnahen Tätigkeiten weniger streng zu nehmen als bisher.
Hinweise dieser Art sprechen dafür, dass die in Bad Schmiedeberg praktizierte Kontrolle keine optimale Lösung des Verdrängungsrisikos bietet. Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte sind demzufolge auch bei relativ dichter (und entsprechend aufwendiger) Kontrolle möglich. Offenbar können Effekte dieser Art, die gleichbedeutend sind mit einem zumindest partiell missbräuchlichen Einsatz von Bürgerarbeitern, nur auf der Ebene der Projektsteuerung vermieden oder doch wenigstens weitgehend zurückgedrängt werden.
These 4
Der Erfolg von Bürgerarbeit setzt eine intensive Kampagne zur Mobilisierung von Ressour-cen und zur Gewinnung von Zustimmung in der Startphase und eine handlungs- und verhandlungsfähige projektbegleitende Öffentlichkeit voraus.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
84
Bad Schmiedeberg belegt, dass der Erfolg eines Projektes wie Bürgerarbeit von der aktiven Beteiligung möglichst aller relevanten Akteure abhängt. Dies galt vor allem beim Start und in der Implementationsphase, wird jedoch unserer Einschätzung nach auch im „Normalbetrieb“ notwendig sein.
Beim Beginn von Bürgerarbeit und in der Implementationsphase der entsprechenden Struktu-ren und Verfahren sind zumindest vier Aufgaben – im wesentlichen zeitgleich – zu erfüllen:
• die Gewinnung von Bürgerarbeitsplätzen,
• die Definition und Prüfung ihrer Qualität, insbesondere im Hinblick auf ausreichende Marktferne,
• die Auswahl der Teilnehmer und
• die Besetzung der Stellen.
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben kam es in Bad Schmiedeberg zu einem intensiven Prozess der Diskussion, Kommunikation und Kooperation, an dem sich eine größere Zahl von lokalen bzw. regionalen Akteuren beteiligte. Dieser Prozess trug zumindest zeitweilig durchaus den Charakter einer Mobilisierungskampagne, die von einem Hauptakteur (hier Arbeitsagentur bzw. ARGE) angestoßen und gesteuert wurde.
Sowohl die Formen als auch die Folgen dieses Prozesses unterschieden sich deutlich von dem normalen hierarchisch-bürokratischen Handlungsmodell, das Einrichtungen wie der Bundesagentur für Arbeit gewöhnlich zugrunde liegt. Dies ergab sich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass die Bundesagentur allein weder über die Anzahl, noch über die Art der angebotenen Bürgerarbeitsplätze entscheiden konnte, sondern auf die aktive Mitwirkung dritter Akteure angewiesen war und ist. Hierbei stand eine ausschließlich hierarchische Regulierung außer Frage. Gleichzeitig konnte jedoch auch eine reine Marktregulierung mit einer durch Angebot und Nachfrage bestimmten Preisbildung nicht wirksam werden.
Deshalb musste die Bürgerarbeit mit einem neuen Satz von Routinen geregelt werden, die ihrem marktfernen Charakter entsprachen. Dass dies in einem sehr frühen Stadium des Projektes gelang, war sicherlich eine wichtige, vielleicht sogar die entscheidende Voraussetzung für das Gelingen des Projektes.
Ein solches Vorgehen setzt jedoch auf der Entscheidungs- und Handlungsebene aller Akteure die Bereitschaft zu einer flexiblen und dem Problem angemessenen Vorgehensweise voraus.
(1) Die Bundesagentur für Arbeit musste sich in diesem Fall am deutlichsten von ihren alten Vorgehensweisen lösen. So war es notwendig, dass sie von dem ihr vertrauten, allein durch Recht, Zuständigkeiten und Haushalt bestimmten Vorgehen, das sonst ihren Alltag prägt, erheblich abweicht. Sowohl nach innen (die Projektgruppe von Agentur und ARGE) als auch nach außen (Gewinnung von Bürgerarbeitsplätzen und Regulierung der Bürgerarbeit) mussten dabei Kommunikations- und Regulierungsformen entwickelt werden, die eher auf Austausch und Konflikt als auf Anweisung und Vollzug beruhten. Insofern entsprach das Projekt durchaus den neuen Intentionen der Bundesagentur, eine „ flexibel auf den Kunden zugehende“ Einrichtung zu werden.
Zusammenfassung und Ausblick
85
(2) Die Einsatzstellen mussten mit einem für sie ungewohnten Typ von Angestellten umgehen, der ihnen zwar Nutzen zu bringen versprach, dafür aber möglicherweise nicht qualifiziert war und oftmals alle Arbeitsroutinen verloren hatte. Zudem fand der Auswahl- und Entscheidungsprozess offenbar unter einem gewissen sozialen Druck statt. Auch waren zumindest zu Beginn die Bedingungen, unter denen Bürgerarbeit stattfinden sollte, unklar; trotzdem wurden schnelle Entscheidungen verlangt.
(3) Die bisher nur schwach involvierten Gewerkschaften und Arbeitgeber(-vertreter) haben die Etablierung des Versuches trotz der Abweichungen von der Marktregulation (meist wohl-wollend) toleriert.
Inwieweit es gelingt, die zum Teil weit reichenden neuen Erfahrungen, die in Bad Schmiede-berg gewonnen wurden, auf Dauer zu stellen, muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt, weniger als eineinhalb Jahr nach dem förmlichen Vorhabensbeginn, offen bleiben. Immerhin liefert Bad Schmiedeberg der Vermutung eine gute Begründung, dass die neue Regulierung dann gut funktioniert, wenn alle unmittelbar Beteiligten für sich einen Nutzen in einem entsprechenden Verhalten erkennen können. Gleichzeitig sind hierfür Rahmenbedingungen erforderlich, die es jedem Akteur erlauben, mit der Realisierung des eigenen Nutzens zugleich die Realisierung des Nutzens für andere Akteure zu ermöglichen. Hierauf ist im Folgenden noch einzugehen.
Mit dem Instrument Bürgerarbeit kann sich offenkundig ein erhebliches Potential dafür
verbinden, im geförderten Arbeitsmarkt längerfristige Beschäftigungsmöglichkeiten für
Arbeitslose aus sogenannten Problemgruppen zu schaffen. Wenn dieses Potential unter
Beachtung der dargestellten Rahmenbedingungen genutzt wird, könnte Bürgerarbeit als ein
neues Instrument öffentlich fördernder Arbeitsmarktpolitik etabliert werden. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass hierdurch auch ein ernstzunehmender Beitrag zur Überprüfung und
Neuausrichtung des bisherigen Instrumentenkataloges öffentlich geförderter Beschäftigung
geleistet werden kann.
6.2 Empfehlungen
Die Ergebnisse des Pilotvorhabens in Bad Schmiedeberg und die hier gemachten – ganz überwiegend positiven – Erfahrungen legen einige Empfehlungen für zukünftige Vorhaben ähnlicher Art nahe. Von diesen dürften drei von besonderer Wichtigkeit sein:
6.2.1 Stabile Rahmenbedingungen als unverzichtbare Voraussetzung flexiblen Handelns
Projekte wie Bürgerarbeit, die lokale Ressourcen zu wirksamen Problemlösungen mobilisie-ren wollen, erfordern ein flexibles, nicht exakt im Voraus planbares Vorgehen. Sie sind deshalb auch anfällig für Schwierigkeiten und Widerstände verschiedener Art. Je offener und unbestimmbarer zu Beginn und während der Laufzeit der Projekte das zur Erreichung des Vorhabensziels notwendige Vorgehen ist, desto dringlicher ist ein stabiler Rahmen, in den die jeweiligen Vorhaben eingebettet sind.
Das kann an vier Sachverhalten illustriert werden:
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
86
Die Unterstützung des jeweiligen sozialen, politischen, administrativen und ökonomischen Umfeldes ist von hoher Bedeutung. In diesem Sinne stellte die Öffentlichkeitskampagne des Vorhabens in Bad Schmiedeberg sicherlich eine wichtige Erfolgsvoraussetzung dar.
Von hoher Bedeutung ist zweifellos auch eine gesicherte finanzielle Grundlage, die möglichst wenig von nicht beeinflussbaren Faktoren wie der Dynamik des ersten Arbeitsmarktes in der Region, der Vereinsdichte oder der sozio-kulturellen Zusammensetzung der potenziellen Bür-gerarbeiter beeinflusst werden kann.
Außerdem benötigt Bürgerarbeit eine transparente, schlanke und belastbare Kontrollstruktur, die verhindert, dass Bürgerarbeit zu Erwerbszwecken missbraucht wird.
Schließlich erfordert der Erfolg von Bürgerarbeit eine verlässliche Zukunftsperspektive, die insbesondere den Übergang von der Mobilisierungskampagne des Starts zu einem mehr oder minder dauerhaften Normalbetrieb regelt und eine brauchbare Lösung für die Frage enthält, wie in längerfristiger Perspektive Zugangsmöglichkeiten für neue Teilnehmer geschaffen werden können.
6.2.2 Aufgaben eines umfassenden Initiierungs- und Steuerungskonzeptes
Ein stabiles Rahmenkonzept muss, so lässt sich sehr gut am Beispiel Bad Schmiedeberg zeigen, praktikable Lösungswege für eine Reihe von Problemen beinhalten, die – von Anfang an oder auch erst im Laufe der Zeit – mit Bürgerarbeit verbunden sind. Drei Probleme und aus ihnen entspringende Aufgaben sind vor allem zu nennen:
(a) Eine transparente Zielformulierung zur Akquise von Bürgerarbeitsplätzen
Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für einen effizienten Umgang mit den Konflikten zwischen wichtigen Zielen des Vorhabens, insbesondere dem Ziel der Marktferne auf der einen Seite, sozialer Nutzen von Bürgerarbeit und ausreichende Ähnlichkeit mit „normaler“ Erwerbstätigkeit auf der anderen Seite.
(b) Vorgehensweisen zur Mobilisierung von Ressourcen nach innen und außen
Die erfolgreiche Durchführung von Bürgerarbeit erfordert die ausreichende Fähigkeit dazu, die benötigten Ressourcen zu mobilisieren. Ressourcen dieser Art, die bei konkreten Vorhaben frühzeitig identifiziert werden müssen, sind insbesondere Personen und deren Kompetenzen, die finanziellen Grundlagen, die rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen und formale wie informelle Kommunikationsstrukturen.
(c) Eine zweckdienliche und effiziente Gestaltung der vorhabensinternen Kontroll- und Bewertungsprozesse
Bürgerarbeitsvorhaben können nur dann gelingen, wenn die vorhabensinternen Formen von Kontrolle und Bewertung so angelegt sind, dass sie die Projektdurchführung nicht behindern, sondern fördern. Diese Bedingung war im Falle Bad Schmiedeberg nicht in jeder Hinsicht erfüllt.
Zusammenfassung und Ausblick
87
6.2.3 Sicherstellung ausreichender Kampagnen-, Projekt- und Verhandlungsfähigkeit
Ob die Einführung von Bürgerarbeit in einer umgrenzten lokalen Konstellation erfolgreich ist oder nicht, hängt in erheblichem Umfang davon ab, ob in der Gruppe der Verantwortlichen in Arbeitsagentur bzw. ARGE, in der Kommunalpolitik und bei den potenziellen Trägern und Einsatzstellen spezifische Kompetenzen vorhanden sind und dass den Personen, die diese Kompetenzen besitzen, Gelegenheit geboten wird, sich aktiv an der Konzeption, der Implementation und der Steuerung des Vorhabens zu beteiligten.
Für diese eher ungewöhnliche Anforderung gibt es zwei Gründe:
Zum Einen können Bürgerarbeitsplätze nicht durch einfache Anordnung oder durch einen behördlichen Beschaffungsauftrag gewonnen werden, sondern nur in einem sozialen Prozess mit breiter Beteiligung. Dies bedeutet insbesondere:
• bei den Zuständigen und Verantwortlichen muss eine ausreichende Fähigkeit zur Wahrnehmung und Analyse der spezifischen sozialen, ökonomischen, regional-strukturellen und infrastrukturellen Bedingungen vorhanden sein;
• innerhalb des Projektes müssen gut funktionierende Rückmelde- und Kontrollprozesse etabliert sein und
• zumindest einige Verantwortliche müssen über eine Überzeugungs- und Mobilisie-rungsfähigkeit verfügen, die sie befähigt, eine nennenswerte Zahl von örtlichen Akteuren für eine aktive Teilnahme an dem Vorhaben zu gewinnen.
Zum Anderen scheint es bei der Einrichtung von Bürgerarbeit nahezu unvermeidlich zu Widersprüchen zu kommen, vor allem in Form von Zielkonflikten. Diese Zielkonflikte lassen sich nicht selten nur durch gewisse Uminterpretationen der ursprünglich definierten Ziele und durch Anpassung des Mitteleinsatzes lösen.
Der Erfolg des Vorhabens kann infolgedessen sehr wohl davon abhängen, ob zumindest einige der am Vorhaben verantwortlich mitwirkenden Akteure diese Fähigkeiten (die in ihrem beruflichen Alltag nicht selten nur wenig gefragt sind) besitzen und dass sie dazu bereit und in der Lage sind, sie in das Vorhaben einzubringen.
6.3 Offene Fragen
Mit dem Pilotvorhaben „Bürgerarbeit“ in Bad Schmiedeberg wurde, wie in den vorstehenden Kapiteln gezeigt, in mehrfacher Hinsicht Neuland beschritten. Es versteht sich damit wohl von selbst, dass auch der Bericht über die Evaluation des Vorhaben nicht nur gut abgesicherte Aussagen und Bewertungen bringt, sondern eine ganze Reihe von Fragen aufwirft, denen zwei Eigenschaften gemeinsam sind:
• Es kann gegenwärtig auf sie noch keine bündige Antwort geben.
• Es besteht ein hohes Interesse daran, diese Antworten möglichst bald geben zu können, am besten Zug um Zug mit der Realisierung anderer Vorhaben gleicher Art und ihrer vergleichenden Untersuchung.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
88
Dies sei – abschließend – an drei Fragen illustriert, deren Wichtigkeit wohl außer Zweifel steht: Die Frage nach der Bedeutung von lokalen Faktoren und ihren Auswirkungen auf die Übertragbarkeit der Erfahrungen aus Bad Schmiedeberg, die Frage nach der Übertragbarkeit der Verfahren zur Auswahl von Plätzen für Bürgerarbeiter und die Frage nach Bedingungen eines friktionsfreien Übergangs in den „Normalbetrieb“ .
6.3.1 Welche Bedeutung haben die lokalen Bedingungen?
Lokale Bedingungen und Konstellationen waren und sind in Bad Schmiedeberg von erheblicher Bedeutung für das optimale Vorgehen und die Erfolgschancen des Vorhabens Bürgerarbeit. Dies gilt insbesondere für die Zusammensetzung der Arbeitslosen am Ort, für die Dynamik des ersten Arbeitsmarktes, für den Grad der örtlichen sozialen Integration (messbar z. B. an der Anzahl der Vereine) und für die sozialdemografischen, infrastrukturel-len und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Zielgruppe.
In Bad Schmiedeberg lag offenkundig eine sozial günstige Situation für die Akquise von Bür-gerarbeitsplätzen vor. Eine solch günstige Situation kann jedoch nicht überall vorausgesetzt werden. So ist beispielsweise in Gemeinden, in denen Wohnen, Leben und Arbeiten auch räumlich getrennt sind („Schlafstädte“), mit einer deutlich geringeren Vereinsdichte und mit wesentlich geringerer Bereitschaft zu rechnen, durch die Entwicklung von Bürgerarbeit zur Verbesserung des sozialen Klimas in der Gemeinde beizutragen. Insofern hatte die relativ geringe Gemeindegröße von Bad Schmiedeberg ohne Zweifel einen positiven Einfluss. In größeren Gemeinden oder in Gemeinden mit weniger überschaubaren Kommunikations- und Handlungsstrukturen könnten Konzeptionen, die vor allem mit örtlichen und regionalen Be-zügen arbeiten, schwieriger umzusetzen sein, obwohl hier die Mehrheit der Personen leben dürfte, für die (wie beispielsweise Jugendliche mit Migrationshintergrund) spezielle und auf ihre Situation zugeschnittene Arbeitsmarktprogramme entwickelt werden müssten.
Damit stellt sich die Frage, ob nicht mehr oder weniger tiefgreifende Veränderungen wesent-licher Parameter notwendig wären, um das Modell Bad Schmiedeberg in wesentlich andere lokale Verhältnisse zu übertragen.
• Wäre es bei einem Bürgerarbeitsprojekt in einem großstädtischen Problembezirk nicht notwendig, statt des in Bad Schmiedeberg sehr wirksamen lokalen Bezuges mit ganz anderen, z. B. institutionellen oder auch sozialkulturellen Identitäten zu operieren?
• Wäre es denkbar, solche gemeinsamen Bezüge an einem großen Krankenhaus, an einer Schule oder an einer anderen quartierprägenden Einrichtung festzumachen?
• Welche Veränderungen in der Gewinnung von Bürgerarbeitsplätzen, in der Auswahl der Bürgerarbeiter und in ihrer Betreuung wären dann gegebenenfalls geboten?
• Könnten nicht bei bestimmten Problemgruppen (z. B. Erwerbspersonen mit Migra-tionserfahrung) auch gemeinsame sozial-kulturelle Bezüge als Grundlage genutzt wer-den?
• Unter welchen Bedingungen wird es empfehlenswert sein, bei neuen Bürgerarbeits-projekten unter anderen örtlichen Verhältnissen auch die formalen Kontrollstrukturen anzupassen, um eine tragfähige Balance zwischen Großzügigkeit als Voraussetzung
Zusammenfassung und Ausblick
89
leichterer Akquise von Arbeitsplätzen und formaler Genauigkeit zur Sicherung von Legitimation des Vorhabens und Vertrauen der Akteure zu finden?
• Inwieweit sind die Definitionen von Marktferne und die Verfahren zur Vermeidung von Missbrauch und Verdrängungseffekten, die sich in Bad Schmiedeberg alles in allem recht gut bewährt haben, auf ganz andere örtliche Verhältnisse übertragbar? Mit welchen – erwünschten oder unerwünschten – Effekten wäre bei ihrer Anwendung in den für diese Verhältnisse charakteristischen Sozialstrukturen zu rechnen?
Antworten auf Fragen dieser Art können nicht an Hand einer einzigen Fallstudie gefunden werden. Dies ist sicherlich nur möglich im Rahmen eines systematischen Vergleichs mehrerer Fälle in möglichst verschiedenen Konstellationen.
6.3.2 Wieweit sind die Bad Schmiedeberger Ver fahren zur Gewinnung von Bürgerarbeitsplätzen über tragbar?
Marktferne Bürgerarbeitsplätze können nur durch marktferne, also nicht von Preisregulativen gesteuerte Verfahren akquiriert werden. Dieser soziale Prozess muss die unterschiedlichen Interessen und Ziele zusammenführen, bündeln und in zureichende Übereinstimmung mit den Maßnahmenzielen bringen. Vieles spricht dafür, dass die Gewinnung und Auswahl einer gemessen an der Bevölkerungszahl großen Zahl von Bürgerarbeitsplätzen eine wesentliche Bedingung für den Erfolg des Pilotvorhabens in Bad Schmiedeberg war.
In Bad Schmiedeberg gelang es innerhalb kurzer Zeit, nahezu 200 Angebote von Bürgerar-beitsplätzen zu mobilisieren und aus ihnen gut die Hälfte aufgrund ihrer Marktferne und ihrer Vereinbarkeit mit unbestrittenen sozialen Zielen in das Projekt aufzunehmen. Dies war nur möglich dank verschiedenartiger Kompromisse zwischen Zielen und Interessen.
Bei den potenziellen Einsatzstellen, die Angebote für Bürgerarbeit vorlegten, spielten sowohl wirtschaftliche, als auch organisatorische und soziale Aspekte eine wichtige Rolle, die keineswegs immer ohne weiteres vereinbar waren, auch wenn letztlich zumeist soziale Überlegungen den Ausschlag für die Einstellung von Bürgerarbeitern gaben.
Vor allem wurden mit der Entscheidung, einen angebotenen Arbeitsplatz in das Vorhaben aufzunehmen oder nicht, auf sehr pragmatische Weise charakteristische Zielkonflikte gelöst (oder zumindest eingedämmt). Dies waren vor allem Konflikte zwischen dem Ziel, auf der einen Seite Verdrängungseffekte zu vermeiden und auf der anderen Seite sozialen Nutzen zu erzielen.
Nun ist wohl unbestritten, dass in Bad Schmiedeberg eine sozial günstige Situation für die Akquise von Bürgerarbeitsplätzen vorlag, die es den Einsatzstellen erlaubte, sozialen Überlegungen das Übergewicht zu geben und den Verantwortlichen des Pilotvorhabens die Möglichkeit eröffnete, mit den unvermeidlichen Zielkonflikten in einer Weise umzugehen, die überwiegend Zustimmung fand.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
90
Zu fragen ist allerdings:
• Wird es möglich sein, mit einem gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Vorgehen unter anderen, weniger günstigen Bedingungen vergleichbare Erfolge zu erzielen?
• Wird es auch anderswo gelingen, den Ausgleich von Interessengegensätzen und Ziel-konflikten im Rahmen einer intensiven Mobilisierungskampagne weitgehend in den scheinbar nur technischen Prozess der Auswahl von Bürgerarbeitsplätzen zu integrieren und damit sicherzustellen, dass der Vorhabenserfolg durch sie nicht in Frage gestellt wird?
• Sind nicht z. B. in größeren Gemeinden, insbesondere in Großstädten oder in Ge-meinden mit weniger sozial integrierter Bevölkerung, stärker formalisierte und gere-gelte Verfahren unvermeidlich?
• Welche Konsequenzen hätte dies für die generelle Logik des Konzeptes Bürgerarbeit?
Antworten auf Fragen dieser Art setzen offenkundig sowohl vergleichende Untersuchungen mehrerer Fälle von Bürgerarbeit wie auch eine intensive Beschäftigung mit möglicherweise ähnlichen Programmen in anderen hochentwickelten Gesellschaften voraus.
6.3.3 Wie könnte ein schr ittweiser Übergang zu längerdauerndem „ Normalbetr ieb“ gewähr leistet werden?
Die gegenwärtig laufenden Vorhaben „Bürgerarbeit“ tragen ausgesprochenen Projektcharak-ter. Sie sind auf ein bis zwei Jahre angelegt. Der Bestand an Bürgerarbeitern besteht im Wesentlichen aus Frauen und Männern, die seit der Startphase in Bürgerarbeit tätig sind. Die Zahl von Abgängen ist, soweit feststellbar, gering.
Mit dieser Projektförmigkeit verbinden sich im Laufe der Zeit erhebliche Probleme. Eine kampagnenartige Vermittlung einer größeren Zahl von Langzeitarbeitslosen in Bürgerarbeit kann zu Beginn – abhängig von den regionalen Bedingungen – relativ viele Arbeitslose in Bürgerarbeit bringen und einen entsprechend positiven Effekt auf die statistisch ausgewiesene Arbeitslosigkeit besitzen. Doch kann dieser positive Effekt nicht lange anhalten. Die statistische Arbeitslosigkeit wird sich in dem Maß wieder dem alten Stand vor Einführung der Bürgerarbeit annähern, wie die Zahl der Neuzugänge in Arbeitslosigkeit bzw. die sozialdemografische Entwicklung der Arbeitslosen die Zahl neu hinzugekommener Bürger-arbeitsplätze übersteigt.
Sollte sich in der Arbeitsmarktpolitik die Erkenntnis verbreiten, dass Bürgerarbeit zwar kein Allheilmittel gegen Langzeitarbeitslosigkeit darstellt, jedoch eine sinnvolle Erweiterung des arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums bedeuten würde, so wird mit im Zeitablauf eher wachsender Dringlichkeit zu fragen sein:
• Wie ist es möglich, die positiven Effekte der anfänglichen Kampagne über längere Zeit zu bewahren?
• Wie kann das neuartige Instrument Bürgerarbeit nicht nur projektbezogen eingerichtet, sondern unter der Annahme anhaltenden Bedarfs, auf Dauer gestellt werden?
Zusammenfassung und Ausblick
91
• Wie könnte der Übergang von Projektform zu „Normalbetrieb“ möglichst konflikt- und friktionsarm gestaltet werden?
• Wie kann es gelingen, in einem stabilen Rahmen von Bürgerarbeit vorhandene Flexibilität besser als bisher zu nutzen und zusätzliche Flexibilität zu schaffen?
Hierfür bieten sich zwei Ansatzpunkte an, die gleichzeitig genutzt werden könnten:
(a) Zum Einen wäre zu klären, ob es nicht möglich und wünschbar ist, Bürgerarbeitsplätze nur für ein Jahr befristet zu besetzen.
Nach Ablauf dieses Jahres müssten sich die Bürgerarbeiter erneut und in Konkurrenz zu Neubewerbern aus dem aktuellen Arbeitslosenbestand und anderen, ebenfalls nach Befristungsende ausgeschiedenen Bürgerarbeitern um einen Bürgerarbeitsplatz bewerben.
(b) Zum Anderen könnte es zielführend sein, den zu erwartenden Turnover von Bürgerar-beitsplätzen zu nutzen und zusätzliche Flexibilität auch auf der Angebotsseite aus dem Fortfall bisheriger und der zwischenzeitlichen Entstehung neuer Bürgerarbeitsplätze zu gewinnen.
Es wäre sicherlich lohnend, zu prüfen, ob mit einem derartigen rollierenden Beschäftigungs-status die Bürgerarbeitsstellen nicht auch näher an die Dynamik des ersten Arbeitsmarktes herangeführt werden könnten. Auf diese Weise würden regulierende Marktelemente in der prinzipiellen Marktferne der Bürgerarbeit Einzug halten, ohne dieser doch die vorrangige Orientierung am gesellschaftlichen Nutzen zu nehmen.
93
ANHANG A: DURCHGEFÜHRTE ERHEBUNGEN UND DATENBESTÄNDE
Der erste Flächenversuch in Bad Schmiedeberg war zunächst bis Ende Dezember 2007 befristet. Die wissenschaftliche Begleitforschung erstreckte sich über zwei sehr prozessnah definierte Evaluationsphasen:
1. der Implementations- und beginnenden Etablierungsphase und
2. der Schlussphase.
1 Die Implementations- und beginnende Etablierungsphase
Die empirischen Arbeiten in dieser ersten Phase erfolgten zwischen Mitte Februar und Ende Mai 2007. Ziel aller Erhebungen war es, möglichst schnell breit gefächerte Informationen über die Ausgangssituation und die ersten Erfahrungen mit der Durchführung des Modellpro-jekts "Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg“ von allen unmittelbar beteiligten Akteuren zu erhalten. Nachstehend wird das Material ausführlicher vorgestellt. Die Reihenfolge entspricht dabei dem zeitlichen Ablauf der Erhebungen.
(A) Expertengespräche mit den unmittelbar beteiligten institutionellen Arbeitsmarktakteuren
Am Projekt „Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg“ waren verschiedene institutionelle Arbeitsmarktakteure unmittelbar beteiligt. Im Rahmen dieser Projektphase wurden die zwei Träger und zwei Vertreter der Stadt Bad Schmiedeberg befragt. Ebenso fanden Gespräche mit der Agentur/ARGE statt.
Ziel der Gespräche war es zum Einen, Aufschluss über den Aufbau und die Organisa-tionsstruktur des Projektes zu bekommen. Insbesondere interessierten dabei
• die Aufgaben, die durch die Einrichtungen bzw. die Organisationen übernommen wurden,
• die notwendigen organisationsinternen Voraussetzungen für die Durchführung des Projektes,
• das Funktions- bzw. Rollenverständnis der Gesprächspartner sowie
• die Einschätzung der Zusammenarbeit mit anderen, am Projekt Beteiligten.
Neben diesen organisationsinternen Themen wurden zum Anderen alle Gesprächspartner um eine Einschätzung des bisherigen Projektverlaufes sowie um eine Bewertung des Konzeptes „Bürgerarbeit" vor dem Hintergrund ihrer professionellen Erfahrungen und ihrer genauen Kenntnis der regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung gebeten.
Die Gespräche wurden leitfragengestützt geführt und im Anschluss protokolliert.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
94
(B) Standardisierte Befragung der Personen, die ein Angebot für einen Bürgerarbeitsplatz erhalten hatten
Im Rahmen der Evaluation des Projektes wurden die Bürgerarbeiter selbst befragt. Zugleich war auch der Personenkreis von Interesse, der zwar ein Angebot für einen Bürgerarbeitsplatz bekommen hatte, dieses Angebot jedoch nicht wahrnahm. Aus diesem Grund wurde die Befragung so angelegt, dass nicht nur die Informationen von Bürgerarbeitern, sondern auch die der Personen, die aus Bürgerarbeit ausgestiegen sind bzw. diese nicht angetreten haben, erhoben werden konnten.
Zur Grundgesamtheit der zu Befragenden zählte also jeder, der ein Angebot für einen Bürgerarbeitplatz bekommen hatte, unabhängig davon, ob er zum Befragungszeitpunkt als Bürgerarbeiter tätig war oder nicht (mehr).
In Zusammenarbeit mit der Agentur und der ARGE Wittenberg wurde in der ersten Märzwoche 2007 ein Schreiben an diesen Teilnehmerkreis versandt, worin über die geplante Befragung informiert und um Teilnahme gebeten wurde. Da die Stellenbesetzung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, mussten die neu in Bürgerarbeit eintretenden Personen sukzessive über die Befragung informiert und in diese einbezogen werden. Insgesamt gehörten 129 Personen zum Kreis derjenigen, die ein Angebot für einen Bürger-arbeitsplatz bekommen hatten.
Die Erhebung selbst fand zwischen dem 20. März und dem 2. Mai 2007 statt. Die nachstehende Tabelle I informiert über den Umfang der realisierten Befragung.
Tabelle I: Realisierter Befragungsumfang
Status aktuell in
Bürgerarbeit
aus Bürgerarbeit
ausgeschieden
nie in Bürgerarbeit
gewesen Gesamt
Interview durchgeführt 100 1 10 111
Interview abgelehnt 7 0 4 11
Person nicht erreichbar 1 1 5 7
Gesamt 108 2 19 129
* inklusive der drei Mitarbeiter des Projektmanagements
Insgesamt war die Beteiligung an der Befragung erfreulich hoch und zwar insbesondere unter den Bürgerarbeitern. Immerhin konnte auch etwas mehr als die Hälfte derjenigen, die nicht in Bürgerarbeit gelangten, für ein Gespräch gewonnen werden. Auch in dieser Gruppe fiel die Zahl expliziter Gesprächsablehnungen recht moderat aus; weitaus schwieriger war es, mit den entsprechenden Personen in Kontakt zu treten. Für die zu diesem Zeitpunkt noch ausstehende Befragung im Spätherbst konnte durchaus eine hohe Beteiligung erwartet werden. Lediglich zwei der 111 befragten Personen lehnten eine weitere Beteiligung explizit ab.
Die Tabelle II informiert über die Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der realisierten Stichprobe. Ihr ist zu entnehmen, dass unter den Nichtbefragten fast ausschließlich Personen aus dem Rechtskreis des SGB II vertreten waren. Zudem befanden darunter etwas mehr Frauen und jüngere Personen.
Anhang
95
Tabelle II: Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der realisierten Befragung
Merkmal Alle Nichtbefragte Befragte Bürgerarbeiter
(alle)
Bürgerarbeiter
(befragt)
Frauenanteil 69% 72% 68% 73% 71%
Durchschnittsalter 46 Jahre 40 Jahre 47 Jahre 47 Jahre 47 Jahre
Anteil SGB II 61% 94% 56% 57% 55%
N 129 18 111 108 100
Bei den Bürgerarbeitern waren die Abweichungen zwischen Grundgesamtheit und Stich-probe, wie angedeutet, sehr gering. Insofern repräsentierte die realisierte Befragung der Bürgerarbeiter die Gesamtheit aller in Bürgerarbeit tätigen Personen sehr gut.
Die Erhebung fand als voll standardisierte Face-to-Face-Befragung statt. Die Interviews dauerten in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten. Im Verlauf des Gespräches wurden Angaben über
• die Bürgerarbeitstätigkeit bzw. über den aktuellen Status der Personen, die nicht (mehr) in Bürgerarbeit sind,
• die bisherige Bildungs- und Erwerbsbiografie,
• die Arbeitssuche sowie die Erfahrungen mit der Agentur für Arbeit/ARGE,
• die Haushaltsstruktur, diverse individuelle und haushaltsbezogene Einkommensanga-ben sowie die Alltagsgestaltung,
• die Wahrnehmung und Bewertung von Bürgerarbeit durch Dritte sowie
• die Bewertung der aktuellen Lebenssituation (Lebenszufriedenheit)
gesammelt.
Alle an der Befragung beteiligten Interviewer waren zudem aufgefordert, Informationen, die den standardisierten Fragen nicht zuzuordnen, aber inhaltlich von Relevanz waren, zu protokollieren.
(C) Expertengespräche in den Bürgerarbeiter beschäftigenden Einsatzstellen
Zu Projektbeginn (März/April 2007) gab es im Bad Schmiedeberger Versuch 30 Einsatzstel-len, von denen acht eher projektförmig angelegt waren. In diesen acht Einsatzstellen war Bürgerarbeit nicht in eine Organisation eingebunden. Aus diesem Grund wurden die ausführlichen Expertengespräche nur mit Vertretern der institutionalisierten Einsatzstellen (Vereine, Schulen, Kirchen u. Ä.) geführt. Bis auf eine Ausnahme konnte zur Erstbefragung jede Einsatzstelle für ein Gespräch gewonnen werden, so dass insgesamt 21 Expertengesprä-che stattfanden. In der Regel handelte es sich bei den Gesprächspartnern um Mitglieder des Vereinsvorstandes bzw. der Geschäftsführung oder um die Personalverantwortlichen der Einrichtung.
In den Gesprächen wurden neben den Angaben zur Organisation (u. a. Gründungsdatum, Rechtsform, Anzahl der Mitarbeiter, Alters-, Geschlechts- und Qualifikationsstruktur) vor allem Informationen über:
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
96
• die Motivation zur Teilnahme am Projekt,
• die bisherigen Erfahrungen mit geförderter Beschäftigung,
• die Einbettung in regionale Arbeitsmarkt- und Sozialnetzwerke,
• die Voraussetzungen für den Einsatz von Bürgerarbeitern,
• den konkreten Einsatz von Bürgerarbeitern im aktuellen Projekt,
• die bisher entstandenen und erwarteten Kosten der Bürgerarbeit für die Einsatzstelle,
• den bisher entstandenen und erwarteten Nutzen von Bürgerarbeit für die Einsatzstelle,
• eine erste Zwischenbewertung der Leistungen und Fähigkeiten der Bürgerarbeiter sowie
• die Einschätzung des bisherigen Projektverlaufes und der Projektidee
gesammelt.
Mit den drei Mitarbeitern des Projektmanagements wurde ein gesondertes Interview geführt. Alle Gespräche wurden leitfragengestützt geführt und im Anschluss protokolliert.
(D) Aufbau einer Datenbank mit Angaben zu Struktur und Kosten der in den Auswahlprozess einbezogenen Arbeitslosen
Diese Datenbank wurde in Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thü-ringen der Bundesagentur für Arbeit erstellt. Sie umfasst den Zeitraum zwischen dem 11. September 2006 und dem 1. Mai 2007 und enthält sowohl Angaben zur Struktur der Arbeitslosen (u. a. Geschlecht, Alter, Qualifikation, Arbeitslosigkeitsdauer, Status vor und nach dem Auswahlprozess) als auch zu den Kosten vor und nach dem Auswahlprozess.
2. Die Schlussphase
Die empirischen Arbeiten dieser Phase wurden zwischen November 2007 und Februar 2008 durchgeführt. Die Erhebungen der Schlussphase zielten darauf ab, Informationen über mögliche Veränderungen, Probleme oder Konflikte in der Durchführung des Projektes sowie eine abschließende Bilanz des Modellversuchs "Bürgerarbeit" in Bad Schmiedeberg von allen unmittelbar beteiligten Akteuren zu erhalten. Im Folgenden wird diese Phase wiederum ausführlicher dargestellt.
(A) Expertengespräche mit den unmittelbar beteiligten institutionellen Abeitsmarktakteuren
Im Mittelpunkt der Gespräche während der zweiten Erhebungsphase stand die Effizienz der implementierten Organisationsstruktur. Besonders interessierten dabei
• die Zusammenarbeit bzw. Kooperation der verschiedenen institutionellen Akteure,
• die eigene wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Position der Organisation, die der Gesprächspartner vertritt,
• eine Einschätzung des Flächenversuchs (u. a. Chancen, Risiken, Probleme, Lösungsan-sätze, Perspektiven).
Anhang
97
Als Gesprächspartner für die beiden Träger und die Stadt Bad Schmiedeberg konnten die gleichen Vertreter wie bei der Erstbefragung gewonnen werden. Außerdem fand eine Gesprächsrunde mit den Verantwortlichen der Agentur/ARGE statt. Insgesamt wurden so fünf Gespräche geführt, die alle leitfragengestützt stattfanden und im Anschluss protokolliert wurden.
(B) Standardisierte Befragung der Personen, die ein Angebot für einen Bürgerarbeitsplatz erhalten hatten
Die zweite Befragung der Bürgerarbeiter bezog alle Personen ein, die während der Projekt-laufzeit ein Angebot für einen Bürgerarbeitsplatz erhalten hatten, unabhängig davon, ob sie zum Befragungszeitpunkt noch in Bürgerarbeit beschäftigt waren oder nicht. Die Grundgesamtheit umfasste somit vier Personengruppen:
• Personen, die kontinuierlich in Bürgerarbeit beschäftigt waren,
• jene, die neu in Bürgerarbeit eintraten,
• diejenigen, die zu verschiedenen Zeitpunkten (vor oder nach der ersten Befragung) aus Bürgerarbeit ausschieden sowie
• auch solche Personen, die nie in Bürgerarbeit waren, aber ein entsprechendes Angebot dazu erhalten hatten.
In Zusammenarbeit mit der Agentur und der ARGE Wittenberg wurden somit auch die Personen erfasst, die bis Anfang November 2007 neu in Bürgerarbeit kamen. Es handelte sich dabei um elf Personen, die den Einsatzstellen überwiegend als Ersatz für zuvor ausgeschiedene Bürgerarbeiter zugewiesen wurden. Mit zehn von ihnen konnte in der Schlussphase noch die Erstbefragung durchgeführt werden, eine Person war im Erhebungs-zeitraum nicht erreichbar. Insgesamt gehörten zum Zeitpunkt der zweiten Erhebungsphase 137 Personen zum Kreis derjenigen, die ein Angebot für einen Bürgerarbeitsplatz bekommen hatten.
Die Erhebung selbst fand zwischen dem 15. November 2007 und dem 9. Februar 2008 statt. Die nachstehende Tabelle III informiert über den Umfang der realisierten Befragung.
Tabelle III: Realisierter Befragungsumfang der zweiten Erhebungsphase
Status aktuell in
Bürgerarbeit1
aus Bürgerarbeit
ausgeschieden
nie in Bürgerarbeit
gewesen
Gesamt
Interview durchgeführt 97 4 4 105
Interview abgelehnt 6 3 4 13
Person nicht erreichbar 3 7 9 19
Gesamt 106 14 17 137
Die Bereitschaft zur Teilnahme an der zweiten Befragung war insgesamt recht hoch. Allerdings gestaltete sich die Erreichbarkeit der Personen, die nie in Bürgerarbeit waren oder 1 Die drei Mitarbeiter des Projektmanagements sind– im Gegensatz zur Erstbefragung – nicht mit eingerechnet.
Steiner, Hauss, Böttcher, Lutz
98
aus Bürgerarbeit ausschieden, jetzt noch etwas schwieriger als in der ersten Evalutati-onsphase.
Tabelle IV: Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der realisierten Befragung
Merkmal Alle Nichtbefragte Befragte Bürgerarbeiter
(alle)
Bürgerarbeiter
(befragt)
Frauenanteil 69% 52% 78% 79% 72%
Durchschnittsalter 46 Jahre 41 Jahre 47 Jahre 47 Jahre 47 Jahre
Anteil SGB II 63% 94% 58% 61% 54%
N 137 31 105 106 97
Hinsichtlich der Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der realisierten Stichprobe sind im Zeitverlauf von der ersten zur zweiten Befragung keine wesentlichen Unterschiede festzustellen. Auffällig ist, wie aus Tabelle IV ersichtlich, dass der Frauenanteil und der Anteil an SGB II - Personen unter den Bürgerarbeitern weiter zugenommen hat.
Die zweite Erhebung fand als voll standardisierte Face-to-Face-Befragung vor Ort statt. Die Interviews dauerten in der Regel zwischen 30 und 45 Minuten.
Inhaltliche Schwerpunkte der Zweitbefragung waren
• Veränderungen in der persönlichen und familiären Situation,
• Veränderungen in der Bürgerarbeitstätigkeit,
• zwischenzeitliche Aktivitäten zur Beschäftigungssuche auf dem ersten Arbeitsmarkt,
• Veränderungen der Haushaltsstruktur, im Alltag und beim Einkommen,
• eine erneute Einschätzung der persönlichen und familiären Situation (u. a. Bewertung der Bürgerarbeit, Bedeutung von Arbeit allgemein),
• eine Bilanz der bisherigen Erfahrungen mit Bürgerarbeit sowie
• eine Einschätzung des Konzeptes „Bürgerarbeit“ selbst.
Alle an der Befragung beteiligten Interviewer waren wiederum aufgefordert, Informationen, die den standardisierten Fragen nicht zuzuordnen, aber inhaltlich von Relevanz waren, zu protokollieren.
(C) Expertengespräche in den Bürgerarbeiter beschäftigenden Einsatzstellen
In der Schlussphase des Projektes fanden parallel zur Befragung der Bürgerarbeiter die Expertengespräche mit den Vertretern der Einsatzstellen statt. Diesmal gelang es, alle Einsatzstellen zu erreichen.
Inhaltliche Schwerpunkte der Gespräche waren:
• die Aktualisierung und Vervollständigung der Angaben zur Organisation,
• Veränderungen in der Einrichtung (personelle, organisatorische etc.),
• eine abschließende Bewertung der Leistungen und Fähigkeiten der Bürgerarbeiter,
• stattgefundene Weiterbildungsangebote an die Bürgerarbeiter,
Anhang
99
• eine Einschätzung der bisher entstandenen Kosten durch Bürgerarbeit für die Einsatz-stelle,
• eine Benennung und Bewertung des entstandenen Nutzens durch Bürgerarbeit für die Einsatzstelle,
• eine abschließende Bilanz der bisherigen Erfahrungen mit Bürgerarbeit sowie eine Einschätzung des Projektes „Bürgerarbeit“ an sich.
Mit den Mitarbeitern des Projektmanagements wurde ein gesondertes Interview geführt. Alle Gespräche fanden leitfragengestützt statt und wurden im Anschluss protokolliert.
(D) Ergänzung der Datenbank mit Angaben zu Struktur und Kosten der in den Auswahlprozess einbezogenen Arbeitslosen
Die in der Implementations- und Etablierungsphase in Zusammenarbeit mit der Regio-naldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesagentur für Arbeit erstellte Datenbank wurde in der zweiten Evaluationsphase fortlaufend gepflegt und bei Bedarf aktualisiert und ergänzt. So mussten die neu hinzugekommenen Fälle nach der bisherigen Struktur aufgenom-men und die bisherigen Fälle auf ihren Verbleib und/oder Wechsel in den verschiedenen Kategorien hin überprüft werden. Die Datenbank umfasst nun den Zeitraum zwischen dem 11. September 2006 und dem 30. November 2007.
101
ANHANG B: TABELLARISCHER GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN ERHEBUNGSZEITRAUM
a) Leitfragengestützte Expertengespräche
Status Agentur /ARGE* Träger Stadt Bad Schmiedeberg
Einsatzstellen Gesamt je Erhebungsphase
Gesamt beide Phasen
I. EP II. EP I. EP II. EP I. EP II. EP I. EP II. EP I. EP II. EP Interview geführ t 2 1 2 2 2 2 21 22 27 28 55
Interview abgelehnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Person nicht erreichbar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Gesamt je Phase 2 1 2 2 2 2 22 22 28 28 56 Legende: EP = Erhebungsphase * Hierbei handelte es sich vor allem um Gesprächsrunden mit mehreren Mitgliedern. Zeitraum: 1. Erhebungsphase: 15. Februar – 21. Mai 2007
2. Erhebungsphase: 7. November 2007 – 6. Februar 2008
b) Standardisier te Befragung der Bürgerarbeiter
Status Aktuell in Bürgerarbeit Aus Bürgerarbeit ausgeschieden
Nie in Bürgerarbeit gewesen
Gesamt
je Erhebungsphase
Gesamt
beide Phasen I. EP II. EP I. EP II. EP I. EP II. EP I. EP II. EP
Interview geführ t 100* 97** 1 4 10 4 111 105 216 Interview abgelehnt 7 6 0 3 4 4 11 13 24
Person nicht erreichbar
1 3 1 7 5 9 7 19 26
Gesamt je Phase 108 106 2 14 19 17 129 137 266 Zeitraum: 1. Erhebungsphase: 20. März – 2. Mai 2007
2. Erhebungsphase: 15. November 2007 – 9. Februar 2008
103
ANHANG C: ENTWICKLUNG DER PASSIVEN LEISTUNGEN FÜR DEN RECHTSKREIS SGB I I IM VERGLEICH
Kommune Bad Schmiedeberg, Landkreis Wittenberg, Land Sachsen-Anhalt zwischen November 2006 und April 2007
Beginn des Modellprojekts „Bürgerarbeit“ in Bad Schmiedeberg am 15.November 2006
November 2006 Apr il 2007
Regelleistung LfU Summe Regelleistung LfU Summe Veränderung
in Prozent
Entwicklung in Bad Schmiedeberg
Abgang in Arbeit 17.056,28
�
9.425,21
�
26.481,49
�
6.800,89
�
5.217,35
�
12.018,24
�
-54,62
Abgang in "Bürgerarbeit" 24.238,59
�
14.339,74
�
38.578,33
�
5.123,46
�
7.929,64
�
13.053,10
�
-66,16
Abgang in AGH mit MAE 19.215,63
�
10.993,12
�
30.208,75
�
18.595,44 �
11.598,66
�
30.194,10
�
-0,05
Abgang in sonstige Maßnahmen 8.654,95
�
5.213,97
�
13.868,92
�
4.173,43
�
3.889,44
�
8.062,87
�
-41,86
Verbleib in Arbeitslosigkeit 14.299,98
�
9.726,95
�
24.026,93
�
13.630,63
�
9.189,12
�
22.819,75
�
-5,02
Sonstiges 12.073,78
�
7.444,57
�
19.518,35
�
7.283,44
�
5.349,40
�
12.632,84
�
-35,28
Summe Bad Schmiedeberg 95.539,21
�
57.143,56
�
152.682,77 �
55.607,29
�
43.173,61
�
98.780,90
�
-35,30
Landkreis Wittenberg 3.171.462,00
�
1.908.935,00
�
5.080.397,00
�
3.173.547,00
�
1.960.179,00
�
5.133.726,00
�
1,05
Sachsen-Anhalt 59.905.983,00
�
39.696.896,00 �
99.602.879,00
�
60.242.065,00
�
40.229.668,00
�
100.471.733,00
�
0,87
In den Vergleich nicht mit einbezogen wurden die Beiträge zur Sozialversicherung
104
Kommune Bad Schmiedeberg, Landkreis Wittenberg, Land Sachsen-Anhalt zwischen November 2006 und September 2007
Beginn des Modellprojektes „Bürgerarbeit“ in Bad Schmiedeberg am 15. November 2006.
November 2006 September 2007
Veränderung
Regelleistung LfU Summe Regelleistung LfU Summe in Prozent
Entwicklung in Bad Schmiedeberg
Abgang in Arbeit 17.056,28
�
9.425,21
�
26.481,49
�
4.700,72
�
5.263,67 �
9.964,39
�
-62,37
Abgang in "Bürgerarbeit" 24.238,59
�
14.339,74
�
38.578,33
�
4.629,45
�
8.627,32
�
13.256,77
�
-65,64
Abgang in AGH mit MAE 19.215,63
�
10.993,12
�
30.208,75
�
18.164,34
�
10.862,08
�
29.026,42
�
-3,91
Abgang in sonstige Maßnahmen 8.654,95
�
5.213,97
�
13.868,92
�
7.676,86 �
4.495,46
�
12.172,32
�
-12,23
Verbleib in Arbeitslosigkeit 14.299,98
�
9.726,95
�
24.026,93
�
12.449,04 �
8.504,83
�
20.953,87
�
-12,79
Sonstiges 12.073,78
�
7.444,57
�
19.518,35
�
8.076,20
�
5.739,21
�
13.815,41
�
-29,22
Summe Bad Schmiedeberg 95.539
�
57.144
�
152.683
�
55.697
�
43.493
�
99.189
�
-35,04
Landkreis Wittenberg 3.171.462
�
1.908.935
�
5.080.397
�
2.999.272
�
1.812.113
�
4.811.385
�
-5,3
Sachsen-Anhalt 59.905.983
�
39.696.896
�
99.602.879
�
57.576.421
�
39.290.994
�
96.867.415
�
-2,75
In den Vergleich nicht mit einbezogen wurden die Beiträge zur Sozialversicherung
Bisher veröffentlichte „ Forschungsberichte aus dem zsh“ (2008 – 2001)
Christine Steiner, Friedrich Hauss, Sabine Böttcher, Burkart Lutz: Evaluation des Projektes
Bürgerarbeit im 1. Flächenversuch in der Stadt Bad Schmiedeberg
Forschungsberichte aus dem zsh 08-1
Grünert, Holle; Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2007): Betriebliche Ausbildung und
Arbeitsmarktlage - eine vergleichende Untersuchung in Sachsen-Anhalt, Brandenburg
und Niedersachsen
Forschungsberichte aus dem zsh 07-5
Lutz, Burkart (2007): Wohlfahrtskapitalismus und die Ausbreitung und Verfestigung interner
Arbeitsmärkte nach dem Zweiten Weltkrieg. (Preprint)
Forschungsberichte aus dem zsh 07-4
Meier, Heike; Wiener, Bettina; Winge, Susanne (2007): Regionaler Qualifizierungspool
landwirtschaftlicher Unternehmen.
Forschungsberichte aus dem zsh 07-3
Ketzmerick, Thomas; Meier, Heike; Wiener, Bettina (2007): Brandenburg und seine Jugend -
Integrationspfade Brandenburger Jugendlicher in Beschäftigung.
Forschungsberichte aus dem zsh 07-2
Ketzmerick, Thomas; Meier, Heike; Wiener, Bettina (2007): Brandenburg und seine Jugend -
Regionale Mobilität.
Forschungsberichte aus dem zsh 07-1
Steiner, Christine (2006): Integrationspfade von ostdeutschen Ausbildungsabsolventen in
Beschäftigung.
Forschungsberichte aus dem zsh 06-6
Grünert, Holle; Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2006): Zukunftsperspektiven der
Berufsausbildung in den neuen Ländern und die Rolle der Bildungsträger.
Forschungsberichte aus dem zsh 06-5
Wiener, Bettina; Winge, Susanne (2006): Planen mit Weitblick. Herausforderungen für kleine
Unternehmen.
Forschungsberichte aus dem zsh 06-4
Buchwald, Christina (2006): Das Telefoninterview - Instrument der Zukunft?
Forschungsberichte aus dem zsh 06-3
Buchwald, Christina (2006): Studie zur Bildungslandschaft in Aschersleben. Eine
Untersuchung zur Integration einer weiterführenden Schule in freier Trägerschaft in die
Bildungslandschaft der Stadt Aschersleben.
Forschungsberichte aus dem zsh 06-2
Wiener, Bettina; Meier, Heike (2006): Maßnahmen für ostdeutsche Jugendliche und
Jungerwachsene an der zweiten Schwelle. Inventarisierung und Ermittlung von
Erfolgsfaktoren. Abschlussbericht.
Forschungsberichte aus dem zsh 06-1
Böttcher, Sabine (2005): Eignung des Mikrozensus-Panels für Analysen des Übergangs von
der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand.
Forschungsberichte aus dem zsh 05-3
Lutz, Burkart; Wiener, Bettina (Red.) (2005): Ladenburger Diskurs. Personalmanagement
und Innovationsfähigkeit in kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Forschungsberichte aus zsh 05-2
Winge, Susanne (Hg.) (2005): Kompetenzentwicklung in Unternehmen. Ergebnisse einer
Betriebsbefragung.
Forschungsberichte aus dem zsh 05-1
Meier, Heike (Hg.) (2004): Kompetenzentwicklung in deutschen Unternehmen. Formen,
Voraussetzungen und Veränderungsdynamik. Dokumentation zur Fachtagung am 23.
Juni 2004 in Halle.
Forschungsberichte aus dem zsh 04-3
Wiener, Bettina; unter Mitarbeit von Richter, Thomas; Teichert, Holger (2004): Abschätzung
des Bedarfs landwirtschaftlicher Fachkräfte unter Berücksichtigung der demographischen
Entwicklung (Schwerpunkt neue Bundesländer).
Forschungsberichte aus dem zsh 04-2
Steiner, Christine; Böttcher, Sabine; Prein, Gerald; Terpe, Sylvia (2004): Land unter.
Ostdeutsche Jugendliche auf dem Weg ins Beschäftigungssystem.
Forschungsberichte aus dem zsh 04-1
Lutz, Burkart; Meier, Heike; Wiener, Bettina (2003): Personalstrukturerhebung in der
Landwirtschaft 2002.
Forschungsberichte aus dem zsh 03-1
Grünert, Holle; Steiner, Christine (2002): Geförderte Berufsausbildung in Ostdeutschland –
Materialien aus der Forschung.
Forschungsberichte aus dem zsh 02-4
Grünert, Holle; Lutz, Burkart; Wiekert, Ingo (2002): Betriebliche Erstausbildung in Sachsen-
Anhalt.
Forschungsberichte aus dem zsh 02-3
Lutz, Burkart; Meier, Heike; Wiener, Bettina (Red.) (2002): Neue Aufgaben an der
Schnittstelle von Ingenieur- und Sozialwissenschaften – Dokumentation eines Dialogs.
Forschungsberichte aus dem zsh 02-2
Meier, Heike; Pauli, Hanns; Wiener, Bettina (2002): Der Nachwuchskräftepool als
Sprungbrett in Beschäftigung.
Forschungsberichte aus dem zsh 02-1
Meier, Heike; Weiß, Antje; Wiener, Bettina (Red.) (2002): Generationenaustausch in
industriellen Unternehmensstrukturen - Dokumentation zum Forschungs-Praxis-
Kolloqium.
Forschungsberichte aus dem zsh 02-5
Böttcher, Sabine; Meier, Heike; Wiener, Bettina (2001): Alters- und Qualifikationsstruktur in
der ostdeutschen Industrie am Beispiel der Chemie.
Forschungsberichte aus dem zsh 01-3
Lutz, Burkart (2001): Im Osten ist die zweite Schwelle hoch.
Forschungsberichte aus dem zsh 01-2
Ketzmerick, Thomas (2001): Ostdeutsche Frauen mir instabilen Erwerbsverläufen am
Beispiel Sachsen-Anhalt.
Forschungsberichte aus dem zsh 01-1