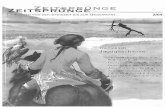Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung: Satzspaltung mit c'est im Französischen der...
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung: Satzspaltung mit c'est im Französischen der...
Aufsätze und Berichte
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung:Satzspaltung mit c’est im Französischen der Gegenwart*
Von Andreas Dufter
1. Einleitung
Viele grammatische Theorien, nicht zuletzt solche generativen Formats, beschrei-ben die Relation zwischen Satzgestalt und Satzbedeutung prinzipiell als komposi-tional. Propositionale Gehalte und möglicherweise sogar Illokutionstypen ergebensich nach dieser Auffassung funktional aus den Bedeutungen der Wörter im Satzsowie allgemeinen syntaktischen Strukturprinzipien. Kompositionalität ist dabeibald als sprachtheoretisches Axiom, bald als empirisches Ergebnis der Gram-matikforschung oder auch als methodologisches Prinzip verstanden worden (vgl.Janssen 1997), in jedem Falle aber als ein Verbot, syntaktischen Strukturen einensemantischen ,Mehrwert‘ zuzuerkennen, der die Ansetzung einer eigenen Struk-turbedeutung rechtfertigen würde. Nicht die atomaren syntaktischen Teile, son-dern Konstruktionen als komplexe Ganzheiten werden dagegen zur Grundlage derSprachbeschreibung in einer Reihe neuerer Ansätze, die unter der BezeichnungKonstruktionsgrammatik zunehmend in den Mittelpunkt der linguistischen Theo-riediskussion gerückt sind (vgl. Goldberg 2006). Konstruktionen sind sprachhisto-risch konventionalisierte und häufig nicht oder nicht mehr kompositionale Zuord-nungen von Form- und Funktionseigenschaften. Diese Konventionalisierungensind dabei keineswegs auf Syntax und Semantik beschränkt, sondern könnenebenso gut prosodische und pragmatische Festlegungen umfassen.
Geradezu als Musterfälle solcher konventionalisierter Konstruktionen werdenvielfach die Satzspaltungen betrachtet (vgl. Davidse 2000; Katz 2000b; Lambrecht2001: 466, 2004: 23; Pavey 2004). Als Minimaldefinition für Satzspaltung oderclefting soll in diesem Beitrag die Bestimmung unter (1) dienen (vgl. auch Lamb-recht 2001: 467):
(1) Ein Spaltsatz ist eine biklausale Struktur mit Kopulaprädikat im Matrixsatzund subordiniertem Satz, welche systematisch mit einer propositional und illo-kutiv äquivalenten monoklausalen Variante korrespondiert.
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 1
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 1
Dabei können aus einem einfachen Satz häufig verschiedene Konstituenten abge-spalten werden, etwa die Sätze (2b) und (2c) aus (2a), und manche Konstituentenauch auf mehrere Weise, wie der Vergleich von (2c) mit (2d) erweist:
(2) a. Pierre adore le poulet à la crème.b. C’est Pierre qui adore le poulet à la crème.c. C’est le poulet à la crème que Pierre adore.d. Ce que Pierre adore, c’est le poulet à la crème.
In diesem Beitrag beschränken wir uns auf Spaltsätze wie in (2b) und (2c), imFolgenden kurz c’est-Spaltsätze genannt (c’est-clefts bei Katz 2000a, 2000b, inAnlehnung an die Begriffsbildung it-cleft im Englischen), mit ce als grammati-schem Subjekt der Kopula être im Matrixsatz1 und einem dem Kopulaverb nach-folgenden2 subordinierten Satz. Diese häufigste Klasse französischer Spaltsätze istin der Literatur unter Bezeichnungen wie mise en relief (Grevisse 1993: 695–698),phrase clivée (Moreau 1976; Tilmant und Hupet 1990; Muller 2002, 2003a,2003b), dispositif à auxiliaire c’est (Blanche-Benveniste et al. 1987: 152–154) oderdispositif d’extraction (Blanche-Benveniste 1991: 59–62; Scappini 2006) bekanntund gilt als strukturelles und funktionales Analogon zu englischen it-clefts wie It’sPierre who loves poulet à la crème. Im Unterschied zu fast allen neueren Untersu-chungen der Funktionen von it-cleft-Strukturen in germanischen Sprachen (vgl.insbesondere Hedberg 1990; Collins 1991; Delin 1992; Johansson 2001; Gundel2002, 2006; Huber 2002, 2006) wird der c’est-Spaltsatz des Französischen weiter-hin nicht selten als ein besonderes, auf Fokusmarkierung festgelegtes Strukturfor-mat beschrieben (vgl. z.B. Muller 2003a; Sleeman 2004). Gegen eine solche An-setzung einer französischen Spaltsatzkonstruktion ist jedoch in den letzten JahrenEinspruch erhoben worden (Clech-Darbon, Rebuschi und Rialland 1999; Doetjes,Rebuschi und Rialland 2004; Ambar 2005). So fällt das Fazit einer neuerenGesamtanalyse der Intonation, Syntax und Informationsstruktur von c’est-Spalt-sätzen eindeutig aus:
Cleft sentences are not instances of a special, focus-related construction type. Thereare no construction specific rules needed in order to account for the properties ofthese sentences. (Doetjes, Rebuschi und Rialland 2004: 549)
Ziel dieses Beitrags ist es, kompositionale und konventionalisierte Aspekte vonc’est-Spaltsätzen im Französischen der Gegenwart genauer voneinander abzugren-zen. Als Datengrundlage dient uns dabei das C-ORAL-ROM-Korpus des gespro-chenen Französisch (COR; vgl. Cresti und Moneglia (Hgg.) 2005)3 sowie für dieSchriftlichkeit FRANTEXT (FR)4. In Kapitel 2 wird zunächst nach ausdrucks-seitigen Besonderheiten von c’est-Spaltsätzen zu fragen sein. In Kapitel 3 gehenwir auf das informationsstrukturelle Profil und damit verbundene satzsemantischeund textpragmatische Eigenschaften dieser Satzklasse ein. Kapitel 4 fasst die Er-gebnisse zusammen.
Andreas Dufter2
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 2
2. Formeigenschaften
Die Literatur zu c’est-Spaltsätzen im Französischen der Gegenwart ist vielfältigund umfasst neben grammatischen Beschreibungen (Moreau 1976: 171–227; Fradin1978; Léard 1992: 25–98) auch stärker pragmatisch orientierte Analysen (Lamb-recht 1994, 2004; Wehr 1984: 61–69, 1994; Katz 2000b; Schöpp 2002, 2003; Scap-pini 2006), Studien zum Erstspracherwerb (Hupet und Tilmant 1989) und Zweit-spracherwerb (Katz 2000a; Hancock 2002; Sleeman 2004), psycholinguistischeUntersuchungen zur Produktion und Verarbeitung (Hupet und Tilmant 1986;Tilmant und Hupet 1990; Holmes 1995; Vion und Colas 1995) sowie sprachver-gleichende Arbeiten (Thome 1978; Lipka 1982; Metzeltin 1989; Smits 1989; Gil2003; Muller 2003b; Miller 2006). Umso mehr erstaunt, dass die uns hier interes-sierende Klasse von Sätzen oft nur durch Beispiele illustriert und vage charakteri-siert wird, eine explizite Definition durch Angabe notwendiger und hinreichenderoder zumindest prototypischer Form- und Funktionseigenschaften jedoch zumeistunterbleibt. Beschreibungen, die eine kompositionale Analyse anstreben, betonen,dass die Grammatik von Spaltsätzen allein aus den Strukturanforderungen fürspezifizierende Kopulasätze5 sowie Relativsätze ableitbar sei (vgl. aus typologi-scher Perspektive Harris-Delisle 1978). So resultiere beispielsweise die Wohl-geformtheit von C’est moi qui suis venu im Gegensatz zu *Ce suis moi qui suis venuim Neufranzösischen lediglich aus dem Kontrast von C’est moi und *Ce suis moi.Dagegen führen Untersuchungen, die im weitesten Sinne einem konstruktions-grammatischen Ansatz verpflichtet sind, Beobachtungen an, nach denen Spalt-sätze von Kopula- und Relativsätzen verschiedene Optionen und Restriktionenaufzuweisen scheinen. So wirkt etwa bei c’est-Spaltsätzen mit extrahierten Adver-bialen wie in C’est ici qu’il mange eine Rückführung auf eine Folge von Ante-zedens und Relativsatz ??ici qu’il mange problematisch.
Auch in der Beschreibung der prosodischen Gestalt von c’est-Spaltsätzen findetsich die Spannung zwischen konstruktionsbezogenen und kompositional angeleg-ten Beschreibungen wieder. Viele Arbeiten weisen auf die intonatorische Promi-nenz abgespaltener Ausdrücke und die Möglichkeit einer prosodischen Phrasie-rung von C’est Pierre qui est venu als [C’est PIERRE] [qui est venu] hin (vgl. z.B.Metzeltin 1989: 191; Krötsch und Sabban 1990: 94–96; Katz 2000b: 254), durchdie sich Spaltsätze von prädikativen Kopulasätzen wie (Pierre,) c’est celui qui estvenu unterscheiden. Nur selten jedoch werden solche phonologischen Struktur-beschreibungen empirisch überprüft. Clech-Darbon, Rebuschi und Rialland (1999:95–101) kommen in ihren phonetischen Messungen zu dem Ergebnis, dass keiner-lei systematische Differenzierung von c’est-Spaltsätzen und oberflächenstrukturellgleichen Sätzen mit prädikativer Semantik feststellbar seien. Nach Doetjes, Re-buschi und Rialland (2004: 549) können die intonatorischen Eigenschaften vonc’est-Spaltsätzen aus allgemeinen Prinzipien der Schnittstellen zwischen Prosodie,
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 3
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 3
Syntax und Informationsstruktur vorhergesagt werden und bilden daher keinenBeleg für die Annahme einer besonderen Konstruktion. Im Folgenden beschrän-ken wir uns daher auf die syntaktischen Eigenschaften von c’est-Spaltsätzen.
2.1 Zur Variabilität von c’est
Die Kurzbezeichnung c’est-Spaltsatz darf nicht dazu verleiten, die Strukturbe-schreibung dieser Satzklasse als trivial zu werten. Hinzuweisen ist zunächst darauf,dass ce hier weder durch il noch durch cela oder ça ersetzbar ist (Moreau 1976: 18;trotz Katz 2000b: 254, Fn. 1). Auch kann natürlich zwischen grammatischem Sub-jekt und Kopula zumindest ne eintreten (3), die Kopula nicht nur als est, sondernauch in pluralischen (4), nicht-indikativischen (5) und nicht-präsentischen (6), jasogar epistemisch modalisierten (7) Formen der dritten Person begegnen undaußerdem der Inversion unterliegen (8):
(3) Ce n’est # que grâce à la volonté des élus de gauche / que cette situation # in-juste / # pourrait être modifiée. [fnatps01, COR]
(4) Ce sont les Aztèques qui l’ont fait découvrir aux conquistadors espagnols.[fmedrp01, COR]
(5) Je veux que ce soit toi qui me remplaces / # au lycée / dans mon poste.[ffammn09, COR]
(6) Ce sera plus ça / qui va nous donner &euh # &euh le nombre de kilomètres quevous comptez faire &euh annuellement. [fnatbu01, COR]
(7) Alors quelque chose de sa naïveté d’antan le quitte à jamais : ce doit être cetteexpérience – eût-on quarante ans – que l’on appelle devenir adulte. [Romilly,Les Oeufs de Pâques (1993), FR]
(8) Peut-être est-ce lui qui m’a d’abord envoyé en Asie. [Malraux, Antimémoires(1976), FR]
Als ungrammatisch gelten nach Van den Eynde und Mertens (2003) in derGegenwartssprache lediglich mit Auxiliar gebildete Tempus-Modus-Formen wiein (9). In der Tat sind im Neufranzösischen Belege für ça / ç’ a été … que / qui, dieals Spaltsatz interpretierbar erscheinen, überaus selten, vgl. (10) sowie das – wohlauch für eine prädikative Lesart offene – Beispiel in (11):
(9) *Ç’avait été lui qui avait perdu le livre. (Van den Eynde und Mertens 2003: 76)(10) Mon fils s’en plaignait l’autre jour, car ç’a été lui qui, au contraire, m’a fait tous mes
maux. [Mme de Sévigné, Correspondances (1696), FR](11) C’est étonnant comme toute ma vie, j’ai travaillé à une littérature spéciale : la littéra-
ture qui procure des embêtements. Ç’a été d’abord les romans naturistes que j’ai écrits ; puis les pièces révolutionnaires que j’ai fait représenter ; enfin, aujourd’hui, lejournal. [Edmond de Goncourt, Journal (1890), FR]
In C-ORAL-ROM und FRANTEXT 1975–2000 scheint das Verbot analytischerKopulaprädikate in c’est-Spaltsätzen jedoch ausnahmslos, wohingegen allein fürça / ç’ a / avait été ansonsten immerhin 30 (COR) beziehungsweise 164 (FR) Be-
Andreas Dufter4
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 4
lege zu verzeichnen sind. Dass Sequenzen wie ç’a été oder ç’avait été grundsätzlich„à la limite de la grammaticalité“ (Moreau 1976: 22) stünden, wird durch die Kor-pusbefunde also nicht bestätigt. Wir kommen in 3.3 auf eine mögliche Erklärungdieser offenbar für c’est-Spaltsätze spezifischen Restriktion zurück.
Als eine weitere Besonderheit, die c’est-Spaltsätze von anderen mit c’est einge-leiteten Strukturen unterscheidet, führen Blanche-Benveniste u.a. (1987: 153) dasVerbot einer pronominalen Dopplung durch ceci, cela oder ça an. Auch dieseBeschränkung ist in den von uns untersuchten Korpora ohne Gegenbeispiel. Insprechsprachlichen Belegen wie unter (12) und (13), die man auf den ersten Blickfür Beispiele von Subjektdopplung halten könnte, bildet ça nämlich einen linksherausgestellten Term, der den durch les pronominalisierten Referenten in (12)beziehungsweise die durch le anaphorisch pronominalisierte Eigenschaft derPünktlichkeit in (13) wieder aufnimmt und somit gerade nicht als koindiziert mitce gelten kann:
(12) A: […] enfin il y a des manifestations quand même à … // je vois que …B: <Non / mais> ça c’est nous / qui les organisons. [ffamdl02, COR]
(13) A: Mais oui / et puis & euh réellement pff / attends / l’autre jour / &t [/] tu esarrivé à huit heures moins dix au lieu d’arriver & euh c’était quoi ? # huitheures <dix>.
B: <Huit heures> dix // # ouais // mais enfin bon // <ça c’est moi qui le veuxaussi quoi. [fpubcv03, COR]
Das Verbot einer Dopplung des grammatischen Spaltsatzsubjekts ist jedoch eben-so wie die Festlegung auf ce keine Besonderheit von c’est-Spaltsätzen, sondernfindet sich genauso bei monoklausalen spezifizierenden Kopulasätzen (vgl. C’esttoi le chef, dagegen *Ça, c’est / Il est / Cela est toi le chef). Auch andere vermeint-liche Spaltsatz-Charakteristika, etwa die Beschränkung auf Kopulaformen der 3. Person im Neufranzösischen (*Ce suis moi qui suis venu), optionale Numerus-kongruenz (Ce sont eux / C’est eux qui sont venus) oder die Fragwürdigkeit plurali-scher Kopulaformen in der 1. und 2. Person Plural (??Ce sont nous qui sommesvenus, ??Ce sont vous qui êtes venus), folgen unmittelbar aus der Grammatik vonKopulasätzen (*Ce suis moi, Ce sont eux / C’est eux, ??Ce sont nous / vous) undkönnen nicht als Evidenz für spezielle Konventionalisierungen bei Satzspaltunggelten (vgl. Moreau 1976: 17–20).
2.2 Zur Position nach c’est
Hinsichtlich der syntaktischen Kategorie des abgespaltenen Ausdrucks be-stehen bei c’est-Spaltsätzen im Unterschied zu anderen Formen der Satzspaltungkaum Restriktionen (Léard 1992: 34–35; Doetjes, Rebuschi und Rialland 2004:530–533). Insbesondere können nicht nur nominale oder pronominale Einheitenextrahiert werden, sondern auch Präpositional- und Adverbialphrasen, Adjektiv-phrasen, infinite Verbalphrasen und bestimmte subordinierte Sätze (die nach gene-
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 5
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 5
rativer Auffassung ebenfalls Phrasen, nämlich Komplementiererphrasen, bilden).Zugelassen und in Mündlichkeit wie Schriftlichkeit attestiert ist ferner die Abspal-tung von quand- (14), lorsque- (15), parce que- (16) und pour que-Sätzen (17)6,wohingegen mit anderen Subjunktionen (18) und Komplementsätzen (19) dieExtraktion misslingt:
(14) C’est quand on escalade le rocher de Ste Anne que l’ensemble du port prendaujourd’hui son vrai caractère et son unité. [Gracq, La forme d’une ville (1985),FR]
(15) C’est lorsque la dernière tranche de pain fut mangée qu’elle découvrit le vé-ritable usage de ces gerbes. [Makine, Le Testament français (1995), FR]
(16) C’est parce que c’est toi et une autre> fille / que ça [/] # que ça l’affecte autant.[ffamcv12, COR]
(17) C’est pour que tu m’aides à la convaincre que je suis passé te voir. [Ormesson,Le bonheur à San Miniato (1987), FR]
(18) *C’est {bien que / puisque} c’est toi et une autre fille que ça l’affecte autant.(19) *C’est que c’est toi et une autre fille que je crois.
Offen erscheinen nach Doetjes, Rebuschi und Rialland (2004) c’est-Spaltsätze inBezug auf die grammatischen Funktionen des abgespaltenen Ausdrucks im subor-dinierten Satz. So zitieren die Autoren nicht nur Belege für extrahierte Subjekte,Objekte und Adverbiale, sondern auch das unter (20) angeführte Beispiel einesextrahierten adjektivischen Prädikativums. Dieser Typus ist zwar grammatisch,allerdings sehr selten; zumindest findet sich weder für adjektivische noch fürnominale Subjekt- oder Objektprädikativa ein Beleg in meinen Korpusdaten (vgl.auch Metzeltin 1989: 201). Auch die Abspaltung infinitivischer Komplemente wiein (21) ist selten, aber entgegen der Aussage bei Smits (1989: 333) nicht gänzlichausgeschlossen. Immerhin begegnet sie einige Male in literarischen Texten, vgl.(22):
(20) C’est verdâtre qu’elle était (, l’eau,) pas limpide du tout !(Doetjes, Rebuschi und Rialland 2004: 531)
(21) C’est manger des frites qu’il préfère.(Doetjes, Rebuschi und Rialland 2004: 531)
(22) C’est rejoindre que je n’aime pas, on ne rejoint jamais personne. [Brisac, Week-end de chasse à la mère (1996), FR]
Kategorisch erscheint eine andere Beschränkung, wonach nur Konstituenten inSatzgliedfunktion abgespalten werden können, nicht jedoch Satzgliedteile wie zumBeispiel Attribute (vgl. das Verbot von „Subextraktion“ bei Doetjes, Rebuschi undRialland 2004: 532 oder das Verbot der Abspaltung von adjonctions bei Van denEynde und Mertens 2003: 76). So erlaubt beispielsweise Pierre habite la maison deson père keine Variante *C’est de son père que Pierre habite la maison.
Von einigen Autoren werden auch Sätze wie unter (23) bis (26), wo die ab-gespaltene Konstituente entweder leer oder aber nur durch eine Negation oder einSatzadverbial besetzt ist, zumindest als Grenzfall von Satzspaltung interpretiert
Andreas Dufter6
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 6
(vgl. Di Tullio 2006: 488–489, vgl. dagegen Lambrecht 2001: 503–504). Auch Gre-visse (1993: 697) führt den Typus in seinem Kapitel zur mise en relief auf. Immer-hin weist diese auch als Inferentialsatz bekannte Struktur (vgl. Delahunty 1995)eine Reihe grammatischer Gemeinsamkeiten mit prototypischen c’est-Spaltsätzenauf, etwa das Verbot von cela und ça als Subjekt (*Cela / Ça est que …), von pro-nominaler Dopplung (*Ça, c’est que …) und von analytisch gebildeten Tempora(*Ç’a été que …). Gegen eine Einordnung von inferentiellem c’est que als einersyntaktisch nicht mehr analysierbaren Diskurspartikel, wie sie etwa für spanisches que vorgeschlagen wurde (vgl. Romera 2004: 144–152 und zur Diskussion Pusch2006), spricht neben ihrer Festlegung auf eine Position unmittelbar vor einem fini-ten Satz auch, dass die Fügung die gleichen morphosyntaktischen Varianten bietet(vgl. (25) und (26)) und den gleichen Beschränkungen unterliegt wie andere c’est-Spaltsätze:
(23) Non // # non // c’est que pour l’instant / j’ai envie de mettre tout &san [/] tousles chances de mon côté // # et que après / effectivement / on verra. [ffamcv01,COR]
(24) […] Quand je dis fraternité, je devrais dire „sororité“, si le mot existait.LUI. C’est peut-être que la chose elle-même est trop rare pour mériter d’êtrenommée.ELLE. C’est surtout que ce sont les hommes qui font le langage. [Tournier, LeMedianoche amoureux (1989), FR]
(25) Mais c’était que Juan et le consul étaient là. [Bianciotti, Le pas si lent de l’amour(1995), FR]
(26) Peut-être est-ce que les spécialistes du traitement de l’information ont uneappréciation de leur santé qui ne repose pas sur les faits. [Jolley, Le traitementde l’information (1968), FR]
Da die Inferentialsätze unter (23) bis (26) jeweils über propositional und illokutiväquivalente monoklausale Entsprechungen ohne eine c’est-que-Matrix verfügen,fallen sie unter unsere Minimaldefinition in (1). Zu erinnern ist daran, dass Grad-partikeln und epistemische Satzadverbien auch in Kombination mit anderen ab-gespaltenen Termini in c’est-Spaltsätzen vorkommen, wie in (27) und (28) (vgl.genauer Nølke 1983):
(27) Cette occupation m’ennuie, c’est surtout mon père qui s’en amusera. [Mohrt,La maison du père (1979), FR]
(28) Ah mais c’est peut-être aussi pour ça / qu’elle fait la gueule. [ffamcv07, COR]
Somit instantiiert der Inferentialsatz das Strukturschema des c’est-Spaltsatzes,ohne dabei jedoch einen Ausdruck abzuspalten, dem innerhalb des subordiniertenTeilsatzes Satzgliedfunktion zukommt (vgl. zur pragmatischen Leistung dieserStruktur Kapitel 3.3). Im Unterschied zu ,kanonischen‘ Spaltsätzen sind Inferen-tialsätze aber semantisch nicht oder zumindest nicht in offensichtlicher Weise alsspezifizierende Kopulasätze analysierbar. Hieraus ergibt sich insbesondere, dass
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 7
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 7
Inferentialsätze keine Ellipse des subordinierten Satzes („truncation“ bei Doetjes,Rebuschi und Rialland 2004) erlauben, selbst dann nicht, wenn dies prosodischmöglich erschiene, wie am Kontrast zwischen C’est peut-être Pierre (qui est venu)und C’est peut-être *(qu’il est venu) sofort deutlich wird. Wir lassen daher dieFrage, ob Inferentialsätze als Grenzfall der Satzspaltung zu werten sind, im Fol-genden offen.
Falls man aber solche nicht-trunkierbaren Extraktionen zulässt, ist auch eineandere Frage neu zu stellen, nämlich die nach der Analyse von Sätzen wie in (29):
(29) C’est ce qui explique que Bruxelles ait préféré créer, dans la limite des créditsdisponibles, des postes de fonctionnaires pour traiter des dossiers hongrois oupolonais plutôt que de renforcer son équipe de vétérinaires. (Schmitt 2004: 370)
Schmitt (2004) führt (29) ohne weitere Diskussion in ihrer Analyse der Informa-tionsstruktur von Spaltsätzen auf. In der Regel wird jedoch implizit oder explizit(Van den Eynde und Mertens 2003: 76, Fn. 20) davon ausgegangen, dass Klitikagrundsätzlich nicht abspaltbar seien, wie die Ungrammatikalität von *Ce est il quiest venu im Neufranzösischen zeige. Auch erweise der Grammatikalitätskontrastetwa zwischen C’est ce qu’il a dit und monoklausalem *Il a dit ce, dass Sätze wie in(29) nicht als Spaltsatz analysiert werden könnten. Zu bedenken ist allerdings, dassauch in anderen Spaltsatzvarianten die korrespondierenden monoklausalen Satz-varianten gewisse minimale „lexical adjustments“ (Lambrecht 2001: 499) erforder-lich machen, C’est moi qui l’ai dit also nicht einem *Moi l’ai dit, sondern (Moi) jel’ai dit entspricht. Somit könnte zumindest in Erwägung gezogen werden, bei Vor-liegen der in (1) geforderten Äquivalenzen C’est ce qu’il a dit als Variante von Il adit cela oder Il a dit ça zu interpretieren, etwa in (30):
(30) A: Oui // # alors vous [/] vous n’êtes pas de l’hôpital ?B: Non / en plus c’est ce qui complique les choses. [ftelpv26 COR]
Dabei muss man ça nicht als Allomorph von ce und cela werten – ebenso wie je,moi je und moi kaum als Allomorphe gelten können –, es genügen systematischeKorrespondenzen zwischen den Spaltsatzvarianten und ihren monoklausalenSatzäquivalenten.
Als Nächstes ist zu fragen, ob neben ,kanonischen‘ Spaltsätzen mit genaueinem abgespaltenen Satzglied (und eventuell Inferentialen mit ,leerer Abspal-tung‘) auch Mehrfachextraktionen möglich sind. In unseren Korpusbelegen findensich nur sehr wenige Beispiele, wo man erwägen könnte, den abgespaltenen Aus-druck nicht als eine einzige Konstituente zu analysieren:
(31) Celles [/] celles-là / c’est Marie hier / # qui me les a portées de Géant Casino laValentine. [COR ffamdl23]
(32) Et c’est un coup franc que va tirer / # Cannavaro // on est pratiquement sur laligne médiane / Cannavaro qui botte ce coup franc / là-bas / pour &euh Vieri /mais bien renvoyé par la défense française // et c’est maintenant / # Paolo Mal-dini qui récupère ce ballon / qui écarte à Del Piero. [fmedsp03, COR]
Andreas Dufter8
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 8
Selbst in solchen Fällen scheint es aber nicht ausgeschlossen, Adverbien wie hier in(31) als Attribute der abgespaltenen Nomina zu interpretieren (vgl. Ausdrücke wieles femmes aujourd’hui). Damit ergibt sich in den von uns betrachteten Spaltsatz-belegen als Generalisierung, dass höchstens (bei Wertung der Inferentialsätze alsSpaltsätze) beziehungsweise genau ein phrasaler Ausdruck in c’est-Spaltsätzenabgespalten werden kann, so wie auch in monoklausalen spezifizierenden Kopula-sätzen immer nur eine einzige Phrase nach der Kopula begegnet.
Als eine weitere Dispräferenz (vgl. Nølke 1983) oder gar grammatische Restrik-tion (Blanche-Benveniste u.a. 1987: 154) wird in der Literatur gelegentlich ver-merkt, dass die Abspaltung mit c’est nicht oder nur schwer mit indefiniten undinsbesondere indefinit quantifizierten Nominal- oder Determinansphrasen im Plu-ral gelingt (33). Ebenfalls marginal erscheinen negativ quantifizierte Terme (34):
(33) *C’est / Ce sont quelques enfants qui ont cassé la fenêtre. (Nølke 1983: 123)(34) *C’est personne que j’ai vu. (Blanche-Benveniste u.a. 1987: 154)
Wiederum ist aber darauf hinzuweisen, dass mit indefinit quantifizierten odernegationshaltigen Ausdrücken auch monoklausale c’est-Kopulasätze gegenüber ily a-Sätzen in den Korpora marginal sind (??C’est quelques enfants; ??C’est per-sonne). Dieser Befund bedarf selbstverständlich einer unabhängigen Erklärung.Entscheidend für unsere Diskussion ist jedoch, dass die Restriktion gerade nichtgegen, sondern für eine kompositionale Analyse der (nicht-inferentiellen) c’est-Spaltsätze als Unterfall spezifizierender Kopulasätze spricht.
2.3 Zur Subordination im c’est-Spaltsatz
Umstritten bei c’est-Spaltsätzen und ihren Entsprechungen in anderen Spra-chen bleibt, ob der subordinierte Satz prinzipiell als Relativsatz zu analysieren ist.In der typologischen Literatur ist diese Auffassung nicht zuletzt deswegen verbrei-tet, weil nicht nur relativische Junktoren, sondern auch andere Relativierungsstra-tegien in den Sprachen der Welt systematisch bei Satzspaltungen im Sinne von (1)wieder begegnen. So verfügt nach Schachter (1973: 22–24) und Harris-Delisle(1978: 428–429) das westafrikanische Kanuri über ein eigenes Relativsatztempus,das Hausa über spezifische Pronomina für Relativsätze, das Akan über eigenetonale Markierungen von Relativsätzen – Besonderheiten, welche regelmäßig auchim subordinierten Teil von Spaltsätzen dieser Sprachen zu finden sind. Auch imFalle des c’est-Spaltsatzes wird die Subordination bis in neuere Publikationen alsRelativierung beschrieben (vgl. Lambrecht 2001, 2004). Dagegen ist von Moreau(1976) bis Muller (2002) der Relativsatzcharakter des subordinierten Satzes immerwieder bestritten worden (vgl. aus typologischer Sicht auch Lehmann 1984: 361–363). Wie zu Beginn von Kapitel 2 bereits erwähnt, wird in diesem Zusammen-hang auf Spaltsätze hingewiesen, wo der abgespaltene Ausdruck kein möglichesAntezedens eines appositiven oder attributiven Relativsatzes darstellt (C’est ici
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 9
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 9
qu’il mange vs. *ici qu’il mange, C’est Pierre / lui qui mange vs. *Pierre / lui quimange). Auch besteht in der Literatur kein Konsens darüber, ob im Französischender Gegenwart bei c’est-Spaltsätzen alle Relativa zugelassen sind (Muller 2003a)oder grundsätzlich nur die beiden häufigsten qui und que (Krötsch und Sabban1990: 94; Léard 1992; Gapany 2004: 65–66; Scappini 2006). Eine Zwischenposi-tion nimmt Smits (1989: 333–335) ein, der neben qui und que bei Abspaltung vonlà als Variante où zulässt sowie in einigen Fällen auch dont, nicht jedoch Formenvon lequel. Unsere eigenen Korpusrecherchen bestätigen zum einen die Marginali-tät von Beispielen wie in (35), mit où und Abspaltung eines von là verschiedenenAusdrucks:
(35) C’est ici où la critique des relativistes a trouvé ample matière à s’exercer et nousapporte une contribution utile. [Marrou, De la connaissance historique (1954),FR]
Allerdings ist diese starke Präferenz für là où gegenüber ici où keineswegs aufSpaltsatzkontexte beschränkt: So finden sich in FRANTEXT 1975–2000 für là oùnicht weniger als 885 Okkurrenzen und immerhin 29 in C-ORAL-ROM, für ici oùdagegen ganze acht (FR) beziehungsweise eine einzige (COR)7. Wie in (36) und(37) zu ersehen, lassen sich für dont und lequel einzelne Belege finden, die nach (1)als Spaltsätze interpretierbar erscheinen.
(36) Allons, me dit verdun [sic], ne te casse pas la tête. Je me renseignerai sur cevieux et, si on peut aider sa famille, je te le dirai. Pense plutôt à pascal [sic].C’est lui dont tu es responsable. C’est lui ton prochain, comme disent les curés.[Bataille, L’Arbre de Noël (1967), FR]
(37) Je suis allée à Dynamo // # &euh non // pas à Dynamo / # Zwickau c’est / &euh„With Full Force“ / mais c’est un festival métal moi # auquel je suis allée.[ffamcv03, COR]
Sowohl dont als auch die Formen von lequel begegnen also gelegentlich in c’est-Spaltsätzen. Allerdings ist, nach der Zahl ihrer Vorkommnisse in FRANTEXTund C-ORAL-ROM zu urteilen, der Einsatz in Spaltsätzen für beide Junktorendispräferiert. Ob und inwieweit derartige statistische Asymmetrien Gegenstandeiner synchronischen grammatischen Beschreibung sein sollten, ist in der Sprach-wissenschaft der letzten Jahre intensiv diskutiert worden. In jedem Fall scheint esaber sinnvoll zu fordern, dass eine solche ,weiche‘ Regularität nicht den gleichenPlatz beanspruchen darf wie eine kategorische, etwa die Ungrammatikalität analy-tischer Kopulaformen in c’est-Spaltsätzen.
Weit verbreitet ist in der grammatischen Literatur die Ansicht, dass in denc’est-Spaltsätzen des Französischen der Gegenwart präpositionale Markierungennur noch im abgespaltenen Ausdruck möglich seien, nicht mehr jedoch unmittel-bar vor dem Relativum. So könne beispielsweise als Variante zu Il pensait à ellelediglich C’est à elle qu’il pensait begegnen, kaum noch aber die sprachhistorischälteren Typen C’est elle à qui il pensait und C’est à elle à qui il pensait (vgl. Metzel-
Andreas Dufter10
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 10
tin 1989: 196). Blanche-Benveniste (2000, 2001) und Muller (2003a) jedoch führeneine ganze Reihe von Belegen für c’est-Spaltsätze an, wo eine Präposition den subordinierten Satz regiert (vgl. (38) aus der gesprochenen Sprache und (39) ausder Literatur). Auch in den von uns untersuchten Korpora begegnen gelegentlichsolche Beispiele (vgl. bereits (37) oben sowie (40)) und sogar ,redundante‘ Markie-rungen, etwa als Kombination von abgespaltener de-Präpositionalphrase und dont(vgl. (41)): 8
(38) C’est sûrement elle à qui il pensait l’offrir. (Blanche-Benveniste 2000: 60)(39) C’est elle à qui tu passes la mission de m’empêcher de parler. [Giraudoux; So-
dome et Gomorrhe (1943), Blanche-Benveniste (2000: 60)](40) Si c’est lui à qui ça arrive, réclame qu’on l’emmène aux Urgences. [Buron,
Chéri, tu m’écoutes ? … alors, répète ce que je viens de dire (1998), FR](41) Valentin se soulève légèrement sur sa chaise pour montrer que c’est de lui dont
il s’agit. [Queneau, Le dimanche de la vie (1952), FR]
Angesichts dieser Befunde erscheint es vorsichtiger, keinen relativischen Anschlussa priori als subordinierenden Junktor auszuschließen. Auch in anderer Hinsicht,etwa der Möglichkeit mehrstufiger Subordination mit Relativierung (42) (vgl.Moreau 1971; Godard 1988: 85–153) oder von Subjektinversion im Sinne der„stylistic inversion“ (43) (vgl. Kayne und Pollock 1978, 2001), finden sich zumin-dest erstaunliche Parallelen zur Grammatik französischer Relativsätze.
(42) Ce ne sont pas les mots qu’on dit qui changent la face des jours. [Aragon, LeRoman inachevé (1956), FR]
(43) C’est notamment en fonction de cette norme de magnificence qu’a pu resplen-dir la vie de cour des États princiers puis des grandes monarchies absolutistes.[Lipovetsky, L’Empire de l’éphémère (1987), FR]
2.4 Gesamtstruktur
Das Strukturschema von c’est-Spaltsätzen lässt sich zusammenfassend wie inder Formel unter (44) beschreiben („{x|y}“ ist zu lesen als „entweder x oder y“):
(44) Strukturschema für c’est-Spaltsätze im Französischen der Gegenwart{CE (NE) (ADV-PT) EST|(ADV-PT) (NE) EST CE} (ADV) (XP) (P) QUIPQU,wobeiCE: c’ | ce,NE: ne | n’,ADV-PT: Satzadverbiale und / oder Gradpartikel,EST: synthetische Form von être in der 3. Person oder Form von devoir
oder pouvoir in der 3. Person Singular mit être,XP: Ausdruck phrasaler Kategorie,P: Präposition,QU: Relativum,
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 11
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 11
IPQU: subordiniertes Satzradikal.
Insgesamt hat die syntaktische Diskussion dieses Kapitels weniger Argumente fürdie Annahme einer konventionalisierten Konstruktion von c’est-Spaltsätzen er-bracht als dies in der Literatur vielfach behauptet wurde. Neben der vieldiskutier-ten Polyfunktionalität von que zur Abspaltung aller Nicht-Subjekte sowie derMöglichkeit der Abspaltung von Ausdrücken, die nicht als Antezedens eines Rela-tivsatzes fungieren können, scheint vor allem die Restriktion von EST auf synthe-tische Tempora im Gegenwartsfranzösischen einen kategorialen Unterschied zuanderen Kopulasätzen wie Ça a été lui darzustellen. Dagegen stimmt die Gram-matik des subordinierten Satzes ungeachtet der starken statistischen Tendenz zum„opaken Anschluss“ (Metzeltin 1989: 201) weitgehend mit der von Relativsätzenim Französischen der Gegenwart überein. Im folgenden Kapitel wenden wir unsder Semantik und Pragmatik von c’est-Spaltsätzen zu.
3. Funktionseigenschaften
3.1 Abspaltung = Fokussierung?
Bereits in Bezeichnungen wie mise en relief kommt zum Ausdruck, dass c’est-Spaltsätze traditionell über ihre informationsstrukturelle Leistung identifiziertwurden, die als Rhematisierung des abgespaltenen Ausdrucks (Muller 2002: 20)oder Fokussierung (Smits 1989; Lambrecht 1994, 2001) qualifiziert worden ist.Aufgrund der vielfältigen phonologischen, morphologischen und syntaktischen Mar-kierungen solcher ,Informationsschwerpunkte‘ einer Äußerung in den Sprachender Welt scheinen dabei Theorien, die Fokus unter Rekurs auf Ausdrucksseitigesbestimmen wollen, bestenfalls für einzelsprachliche Untersuchungen erwägenswert(vgl. Rooth 1996, der Fokus im Englischen wesentlich über intonatorische Promi-nenz zu definieren versucht). Schon Halliday (1967: 240) weist jedoch angesichtsambiger Sätze wie It’s the truth that he confessed darauf hin, dass semantischeMehrdeutigkeiten informationsstrukturelle nach sich ziehen können, die auch imEnglischen keineswegs systematisch durch die Prosodie differenziert werden. Aberauch inhaltliche Definitionen, die Fokus einfach mit „neuer Information“ identifi-zieren möchten, scheitern spätestens in Fällen wie in (45), wo ein unmittelbar zu-vor eingeführter Diskursreferent das fokussierte Argument einer neuen biklausalformulierten Prädikation bildet:
(45) D’accord // # parce qu’il faut bien dire qu’il y a une fleur / # qui va sortir // etc’est elle qui nous intéresse. [fmedrp01, COR]
Mit Gundel (vgl. Gundel 1988 und passim; Gundel und Fretheim 2003) unter-scheiden wir im Folgenden zwischen einer referentiellen, textsemantischen Skalavon Gegeben zu Neu und einer relationalen Gegeben-Neu-Stufung, welche dieStrukturierung der jeweiligen Proposition durch den Sprecher meint, also wesent-
Andreas Dufter12
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 12
lich pragmatisch und einzelsatzbezogen bestimmt werden muss (vgl. schon Halli-day 1967: 204). Zu beachten ist, dass zwischen diesen beiden Dimensionen keinerleiImplikationsbeziehung besteht, da zum einen textuell eingeführte Diskursreferen-ten im weiteren Text oder Gespräch gelegentlich wieder als relational neu begeg-nen, wie wir in (45) gesehen haben. Zum anderen können aber auch im Text oderGespräch neue und kontextuell nicht saliente Referenten ohne erkennbare Fokus-sierung per Akkommodation (Lewis 1979) der Menge der Diskursreferenten hin-zugefügt werden. So kann ein Sprecher auf die Frage seines GesprächspartnersAre you going to lunch? pragmatisch angemessen mit No, I’ve got to pick up mysister reagieren, selbst wenn der Fragende zuvor gar nicht wusste, dass sein Gegen-über eine Schwester hat (vgl. Stalnaker [1974] 1991: 480, Fn. 3).
Nach der hier vertretenen Auffassung bezeichnet Fokus also relationale Neu-heit und Hintergrund relationale Gegebenheit. Der allgemein üblichen Sprech-weise folgend, bezeichnen die beiden Termini aber nicht nur eine Eigenschaftsprachlicher Ausdrücke in Äußerungen, sondern darüber hinaus metonymischauch diese Ausdrücke selbst. Im unmarkierten, ,kanonischen‘ Fall liegt Fokus aufdem Prädikat (Lambrecht 1994) beziehungsweise auf der Verbalphrase (Drubig2003). Andere Fokus-Hintergrund-Gliederungen sind pragmatisch markiert underfordern typischerweise eine Signalisierung mit den jeweils in einer Sprache dafürvorgesehenen Kodierungsmitteln.
Dass nun die Satzspaltung ein wichtiges Mittel der Fokusmarkierung darstellt,ist unbestritten. Unklarheit herrscht jedoch weiterhin hinsichtlich der Frage, obdieses syntaktische Format ausschließlich dazu dient, den abgespaltenen Ausdruckals Fokus und den subordinierten Satz als Hintergrund zu markieren. In manchenformalen wie funktionalen Ansätzen scheint diese Frage so selbstverständlich mitJa beantwortet und Abspaltung so unmittelbar mit Fokussierung identifiziert zuwerden, dass nicht einmal mehr terminologisch zwischen der syntaktisch definier-ten Klasse abgespaltener Konstituenten und einer pragmatisch zu identifizieren-den Klasse relational neuer Ausdrücke unterschieden wird (vgl. Chomsky [1970]1971: 199; Smits 1989; Lambrecht 2001). In gleicher Weise wird auch der Begriff derPräsupposition seit Chomsky (1971) in generativen wie funktionalistischen Ansät-zen nicht nur für das – überaus komplexe – Konzept einer inhaltlichen Vorausset-zungs- oder Setzungsrelation verwendet, sondern außerdem und oft ohne hinrei-chende begriffliche Differenzierung für die syntaktische Einheit des subordiniertenSatzes. Implizit wird dabei Präsupposition nicht nur auf der Ausdrucksseite, son-dern auch auf der Ebene der Pragmatik zu einem komplementären Terminus fürFokus9. Andere Autoren vermerken ausdrücklich die informationsstrukturelleUnterbestimmtheit von c’est …qu-Sätzen, lassen jedoch selbst bei Vorliegen allerKriterien unter (1) nur solche Sätze dieses Strukturformats als Spaltsätze gelten, indenen der abgespaltene Ausdruck den Fokus und der subordinierte Restsatz denHintergrund darstellt (vgl. z.B. Krötsch und Sabban 1990). Wie erwähnt werdenin diesem Zusammenhang prosodische Besonderheiten dieser ,eigentlichen‘ Spalt-
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 13
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 13
sätze gegenüber anderen c’est … qu-Satzvorkommnissen zwar häufig postuliert,nicht jedoch empirisch nachgewiesen. Eine solche Identifikation der Fokusdomänemit dem abgespaltenen Ausdruck scheitert aber meines Erachtens bereits daran,dass in manchen Fällen nur ein echter Teil des abgespaltenen Ausdrucks fokussiertist. So verwendeten die meisten der befragten Sprecher in der Studie von Féry(2001) bei der in (46a) formulierten Korrekturaufgabe c’est-Spaltsätze wie in (46b)und signalisieren durch die prosodische Phrasierung, dass der Fokus allein aufpetite liegt:
(46) a. Marie a deux voitures, une grande et une petite décapotables. Jean conduitla petite décapotable de Marie. On vous dit : „Jean conduit la grande déca-potable de Marie.“ Comment corrigez-vous ?
b. C’est la petite décapotable de Marie que Jean conduit. (Féry 2001: 277)
Spätestens mit Prince (1978) und Lipka (1982) ist aber für das Englische undFranzösische überzeugend dafür argumentiert worden, dass Spaltsätze mit Fokusauf dem abgespaltenen Ausdruck (und nur dort), die bei Prince als stressed-focusclefts bezeichnet werden, nicht die einzigen möglichen informationsstrukturellenProfile von Spaltsätzen im Sinne von (1) darstellen. Vielmehr erscheint bei nichtwenigen Spaltsätzen im Text- oder Gesprächszusammenhang die Annahme zwin-gend, dass der subordinierte Satz ganz oder teilweise neue Information enthält.Beispiel (32), wiederholt als (47), sowie (48) bis (50) illustrieren diese bei Prince(1978) als informative-presupposition cleft (kurz i-p cleft) bezeichnete Satzklasse:
(47) Et c’est un coup franc que va tirer / # Cannavaro // on est pratiquement sur laligne médiane / Cannavaro qui botte ce coup franc / là-bas / pour &euh Vieri /mais bien renvoyé par la défense française // et c’est maintenant / # Paolo Mal-dini qui récupère ce ballon / qui écarte à Del Piero. [fmedsp03, COR]
(48) Elles n’avaient pas les mêmes horaires, mais c’était à l’heure du thé qu’elles ris-quaient de se rencontrer inopinément rue Monsieur-le-Prince, sans compter lesmercredis après-midi et les fins de semaine. [Matzneff, Ivre du vin perdu (1981),FR]
(49) La ville empruntait / # à une compagnie d’assurance / # et s’engageait à luirembourser les annuités // les annuités c’est-à-dire / # le montant de l’amortisse-ment annuel de la dette // # et c’était des prêts qui pouvaient durer dix ans /quinze ans // c’est comme ça que pendant # &euh des années / # &euh desgrandes villes &euh # provinciales / # &euh ont pu se reconstruire. [ffammn06,COR]
(50) J’avais vingt ans quand l’ombre du mancenillier commença de s’allonger surnous : c’est cette année-là que le nazisme explosa et projeta d’un coup cent-dixdéputés au Reichstag. [Gracq, En lisant, en écrivant (1980), FR]
Die pragmatische Taxonomie der Satzspaltung bei Prince (1978) ist seither viel-fach aufgegriffen und weiter ausdifferenziert worden (vgl. insbesondere Declerck1984; Hedberg 1990; Collins 1991; Katz 2000b; Huber 2006). Besonders prägnanteUnterfälle bilden dabei Spaltsätze wie in (47) und (48), in denen aufgrund der rela-
Andreas Dufter14
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 14
tionalen Neuheit sowohl der abgespaltene Ausdruck als auch der subordinierteSatz als fokussiert zu analysieren sind („discontinuous clefts“ bei Declerck 1984;„broad focus clefts“ bei Doetjes, Rebuschi und Rialland 2004; vgl. auch Lamb-recht 2004: 53–57). Solche biklausale Strukturen mit weitem Fokus können dabeials präsentative Spaltsätze der Einführung eines neuen Diskursreferenten dienen(47) (clivées présentationnelles bei Lambrecht 2004; vgl. Wehr 1984: 62), aber aucheinen neuen Sachverhalt wie in (48) mit einem räumlichen, zeitlichen oder situa-tiven Bezugsrahmen im abgespaltenen Ausdruck versehen (clivées événementiellesbei Lambrecht 2004; vgl. auch den von Susumu Kuno geprägten Begriff der scene-setting adverbials bei Prince 1978). Die Sätze in (49) und (50) illustrieren einenweiteren Subtyp, den der kohäsiven Spaltsätze (vgl. die Klasse c’est …que / qui,cohésif ‘ bei Krötsch und Sabban 1990: 93), typischerweise mit anaphorischemabgespaltenen Ausdruck und mit relational neuer Information im subordiniertenSatz. Schließlich könnte man auch Inferentialsätze, in denen der Fokus notwen-digerweise auf dem subordinierten Satz oder zumindest einem Teil von ihm liegenmuss, in naheliegender Weise dem Typ der i-p-Spaltsätze zuordnen.
Dennoch spricht Lambrecht (2001: 483–484) sich dagegen aus, diese i-p-Sätzeals eigene Kategorie zu werten, da diesen Sätzen – beziehungsweise ihren ent-sprechenden Verwendungen – keine prosodischen oder grammatischen Spezifikazugeordnet werden können. Überhaupt, so Lambrecht, sei i-p-Status in entschei-dender Weise vom Wissenskontext des Hörers abhängig und somit kein kategoria-les, sondern lediglich ein graduelles Phänomen. Nach seiner Auffassung sind inc’est-Spaltsätzen ausnahmslos die abgespaltenen Ausdrücke – und nur diese –fokussiert und scheinbare Ausnahmen über universelle pragmatische Mechanis-men der Akkommodation zu erklären.
Gegen eine solche Ineinssetzung syntaktischer Strukturpositionen und infor-mationsstruktureller Kategorien lassen sich aber mehrere Einwände geltendmachen. So sind im Koreanischen nach Hedberg (2006: 391–392) auch Spaltsätzemöglich, wo die abgespaltene Konstituente mit dem -nun-Suffix morphologischnicht als Fokus, sondern eindeutig als Topik markiert ist. Aber auch in Sprachen,in denen i-p-Spaltsätze sich formal nicht von stressed-focus-Spaltungen unterschei-den, lässt sich aus dem Fehlen von Besonderheiten des i-p-Typs noch kein Argu-ment gegen die Existenz von i-p-Spaltsätzen gewinnen, da diese ja bei Prince gerade nicht formal, sondern allein informationsstrukturell definiert sind. Erinnertsei in diesem Zusammenhang daran, dass auch andere pragmatische Kategorisie-rungen, beispielsweise die von Illokutionstypen, nur zum Teil und keineswegs ein-eindeutig mit systematischen Unterschieden auf der Ausdrucksseite einhergehen.Hinzu kommt ein zweites Argument: Da Fokus in der hier vertretenen Sichtweiseeine Kategorie der Präsentation einer Information als neu durch den Sprecheroder Schreiber bezeichnet, spielen die Wissenskontexte des oder der Adressatennur insofern eine Rolle, als sie – genauer: ihre mentale Repräsentation durch denSprecher oder Schreiber – eben auf diese informationsstrukturelle Profilierung in
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 15
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 15
der Formulierung Einfluss haben können. Gleiches gilt aber auch bei der Produk-tion von stressed-focus-Spaltsätzen, so dass weder eine Einbeziehung individuellerWissenskontexte noch eine Theorie des common ground die Generalisierung zu ret-ten vermögen, dass alle und nur die ,echten‘ Spaltsätze besondere Konstruktionenzur Fokussierung des abgespaltenen Ausdrucks seien. Gerade im modernen Fran-zösischen ist überdies eine Reihe von Abspaltungen mit c’est auffällig, wo schondie wenig spezifische lexikalische Semantik des abgespaltenen Ausdrucks nur inSonderfällen diesen als fokussiert brauchbar erscheinen lässt. Zur Veranschau-lichung sind in (51) einige solcher halb formelhafter Wendungen zusammen mitihren absoluten Vorkommenshäufigkeiten im FRANTEXT-Gesamtkorpus aufge-führt:
(51) Absolute Häufigkeiten einiger kohäsionsverdächtiger c’est-Spaltsätze inFRANTEXT––––––––––––––––––––––––––––––––––CE EST alors QUE … 3216CE EST là QUE … 4948CE EST ainsi QUE … 9248CE EST pour cela / ça QUE … 2085––––––––––––––––––––––––––––––––––
Katz (2000b) hält unter Berufung auf Lambrecht zwar daran fest, c’est-Spaltsätzegrundsätzlich als Fokuskonstruktionen im Sinne der stressed-focus clefts zu analy-sieren, versucht aber, die nicht zu übersehenden pragmatischen Unterschiede aufSatz- und Textebene durch Ansetzung von vier verschiedenen funktionalen Typenzu erfassen. Neben dem häufigsten Typus des variable-specifying-Spaltsatzes pos-tuliert Katz (2000b) einen eigenen corrective cleft, der hinsichtlich der syntakti-schen Kategorie des abgespaltenen Ausdrucks freier sei und insbesondere auchAdjektivphrasen erlaube. Nun ist, wie wir gesehen haben, die Abspaltung vonAdjektiven insgesamt höchst selten. Auch Katz (2000b) argumentiert an dieserStelle trotz umfangreicher eigener Korpusarbeiten (vgl. S. 263, Fn. 7) bezeichnen-derweise mit konstruierten Beispielen. Zum anderen räumt Katz selbst ein, dassdie vielfältigeren syntaktischen Möglichkeiten der Tatsache geschuldet seien, dassbei corrective clefts auch metasprachliche Verwendungen der abgespaltenen Aus-drücke vorkommen. Solche Abspaltungen eines metasprachlich angeführten Aus-drucks sind aber auch ohne Korrekturintention möglich, wie unschwer in Beispiel(52) zu erkennen ist, das aus der Seminarbesprechung eines Texts von GeorgeSand stammt:
(52) Donc on voit bien / # qu’il y a deux [/] # enfin qu’il y a dualité / # hein ? dupersonnage // # On voit bien qu’il y a passage / # qu’il y a évolution / # perfec-tion / # maturation // # simplement # &euh je ne devais jamais redevenircomplètement / # hein ? celui de la Roche-Mauprat // # mais &euh # c’est&euh le complètement qui importe &euh ici. [fnatco03, COR]
Selbstverständlich können c’est-Spaltsätze zur Markierung eines Kontrasts oder
Andreas Dufter16
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 16
für Selbst- oder Fremdkorrekturen verwendet werden. Nichtsdestotrotz sprichtnach meiner Auffassung nichts dafür, diese Verwendungen als besondere Konstruk-tion innerhalb einer Familie von c’est-Fokuskonstruktionen zu werten. Ähnlichverhält es sich mit dem dritten Typus bei Katz (2000b), den causal c’est-clefts:Dass kausale Adverbiale, und ganz besonders häufig pour ça, in c’est-Spaltsätzenbegegnen, ist zwar richtig, die Ansetzung eines eigenen Konstruktionstyps da-gegen mit der folgenden Begründung wenig überzeugend:
The CAUC [causal c’est-cleft, AD] differs syntactically from the VSC [variable-specifying c’est-cleft, AD] and the CC [corrective c’est-cleft, AD] because the focuss-ed element usually contains the two words: pour ça, ,for that‘, although occasionallyone finds either à cause de ,because of‘, or grâce à ,thanks to‘, followed by a nounphrase or parce que ,because‘, followed by an independent clause. (Katz 2000b: 268)
Der vierte vorgeschlagene Typus der factual c’est-clefts, dessen Funktion darinbesteht, „to assert a given proposition as a fact“ (S. 271), entspricht der präsenta-tiven Subklasse von i-p clefts, wo nach Katz die Information im subordiniertenSatz „accommodated but not truly presupposed“ (S. 269) sei. Um eine Informa-tion im Sinne von Stalnaker und Lewis akkommodieren zu können, ist es abergerade notwendig, dass diese allein über eine Präsupposition eingeführt wurde.Auch führt die Bezugnahme auf Akkommodation dazu, dass bei diesem Typusnicht die Sprecherintention, sondern der Wissensstand des Hörers entscheidendfür die Spezifik der Konstruktion wird, was zumindest eingehender zu begründenwäre. Offenbar will Katz mit der Ausgrenzung solcher ,kausaler‘ und ,faktiver‘c’est-Spaltsätze als besonderer Konstruktionen wenigstens für ihre ersten beidenSpaltsatztypen die Generalisierung aufrechterhalten, nach der im subordiniertenSatz nur relational alte Information erscheinen dürfe. Dass die Typen sich von denanderen c’est-Spaltsätzen auch prosodisch abheben, wird zwar behauptet, wieder-um aber nicht belegt. Insgesamt erscheint somit die Unterscheidung von vier ver-schiedenen Spaltsatzkonstruktionen bei Katz (2000b) nur unzureichend motiviert,wogegen der nach der hier vertretenen Auffassung zentrale Unterschied zwischenSpaltsätzen mit alter und solchen mit relational neuer Information im subordinier-ten Satz gerade nicht systematisch erfasst wird.
Grundsätzlich sollte nach Katz (2000b) und Lambrecht (2001) i-p-Satzspal-tung wie in (47) bis (51) lediglich als okkasionelle (alltags)rhetorische Ausbeutungeiner Konstruktion gelten, die grammatisch auf die Fokussierung des gesamtenabgespaltenen Ausdrucks mit der subordinierten Proposition als Hintergrund fest-gelegt ist. In dem Maße aber, in dem rhetorische Strategien in universellen Prinzi-pien menschlicher Interaktion begründet sind, ist zu erwarten, dass jede Sprachemit Spaltsatzstrukturen auch solche uneigentlichen, rhetorischen Verwendungendieser Fokuskonstruktion kennt. Für das Englische kann Ball (1994) jedoch zei-gen, dass i-p it-Spaltsätze mit abgespaltenem Adverbial erst im 14. und solche mitAbspaltung von Nominal- oder Determinansphrasen erst im 15. Jahrhundert aus
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 17
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 17
einer Amalgamierung von Spaltsätzen mit anderen unpersönlichen syntaktischenKonstruktionen entstehen. Auch im Französischen ist der i-p-Typus historischsekundär und tritt erst im Laufe des 16. Jahrhunderts in Erscheinung, wobei dannallerdings präsentative und kohäsive c’est-Spaltsätze (wie übrigens auch Inferen-tialsätze) zugleich begegnen (vgl. Dufter im Druck). Im Italienischen bleibt da-gegen nach Schöpp (2005) bis heute der Typus des präsentativen Spaltsatzes mitrahmenbildenden (scene-setting) Adverbialen ungebräuchlich. Nicht auf der axio-matischen Ansetzung einer monofunktionalen Fokuskonstruktion, sondern aufeiner Feinanalyse der vielfältig einzelsprachlich konventionalisierbaren Fokus-Hintergrund-Gliederungsmöglichkeiten sollte eine pragmatische Beschreibung derSatzspaltung gründen.
Diese und ähnliche Befunde sprechen auch gegen Hypothesen, nach denenc’est-Spaltsätze zwar in ihrer Grundfunktion stressed-focus-Spaltsätze darstellen,also Fokus auf dem abgespaltenen Ausdruck markieren, jedoch im Neufranzösi-schen, und hier vor allem in sprechsprachlichen Registern, eine allmähliche Locke-rung der informationsstrukturellen Beschränkungen zu konstatieren sei (vgl. Sorni-cola 2006: 408, die von „demarking“ spricht). Auch Gil (2003) vertritt mit Bezugauf das Französische die Annahme, dass „sich der obligatorische Spaltsatz seman-tisch und diskursiv abnutzt“ (S. 206). In diesem Zusammenhang weist er daraufhin, dass die spezifizierende Semantik nicht selten noch durch zusätzliche, Iden-tität oder Faktizität signalisierende Adverbien unterstrichen werde. In der Tat fin-den sich hierfür nicht wenige Belege:
(53) Mais c’est bien Juninho / # &euh / qui &euh touche beaucoup de ballons là / ence début de match. [fmedsp01, COR]
(54) Mais c’est précisément / # parce qu’il y a du mal / # que nous devons discerner[…] le bien qui est aussi / # en nous. [fnatpr02, COR]
(55) Je ne voyais pas ses yeux, mais c’est exactement ça que j’aurais pu y lire. [Izzo,Chourmo (1996), FR]
Allerdings zeigt ein Blick in historische Korpora, dass solche semantisch als re-dundant zu qualifizierenden Verstärkungen keineswegs auf die Gegenwartsspra-che beschränkt sind:
(56) Rien moins que tout ce que vous dictes (dist Eutrapel) c’est bien à luy ques’adressent telz propos. [Du Fail, Les Baliverneries d’Eutrapel (1548), FR]
(57) C’est a vous mesme que je parle. [Pathelin (1456–1459), Base de Français Mé-diéval 1 (http://bfm.ens-lsh.fr/)]
(58) Ce est voirement Blyoblerys que vous veés ici. [Tristan en prose (nach 1240),Base de Français Médiéval 1 (http://bfm.ens-lsh.fr/)]
Im Lichte von Belegen wie (56) bis (58) ist somit die Beobachtung von Gil zurelativieren und kann nicht länger als Argument dafür gelten, dass c’est-Spaltsätzeeinem graduellen rhetorischen ,Verschleiß‘ ihrer Fokussierungsleistung unterliegenwürden. Dass in Sprachen wie dem Neufranzösischen nicht alle c’est-Spaltsätze
Andreas Dufter18
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 18
die Fokus-Hintergrund-Gliederung der stressed-focus-Spaltsätze aufweisen, bedeu-tet natürlich nicht, dass diese überhaupt keinen informationsstrukturellen Motiva-tionen und Beschränkungen mehr unterliegen (vgl. auch Delin und Oberlandereingereicht). Der semantische oder pragmatische Status zweier typischer Motiva-tionen soll Gegenstand des nächsten Unterabschnitts sein.
3.2 Kontrast und Exhaustivität
Wehr (1984: 61–69, 1994: 623–625) betrachtet neben „all-new“ und kohäsivenc’est-Spaltsätzen als eine Hauptfunktion dieser Satzklasse die der Kontrastierungdes abgespaltenen Ausdrucks, welche einen Unterfall der Fokussierung darstelle.Allerdings scheint ohne explizite Gegenüberstellung („nicht X, sondern Y“) häufigkaum entscheidbar, ob ein Spaltsatz den abgespaltenen Ausdruck mit kontextuelloder situativ salienten Alternativen kontrastiert – man vergleiche etwa die Beispieleunter (53) bis (55). Daher verwundert es nicht, dass die Diskussion darüber, ob eineDichotomie von kontrastiven und anderen Fokussierungen anzusetzen ist, bis heuteandauert (vgl. Molnár und Winkler 2006: 5–6), und immer häufiger Kontrastivitätals eine sowohl von der Fokus-Hintergrund- wie auch von der Topik-Kommentar-Gliederung unabhängige, graduelle pragmatische Eigenschaft betrachtet wird (Mol-nár 2006).
Die zweite Hauptfunktion der c’est-Spaltsätze bezeichnet Wehr (1984) mit Su-sumu Kuno als „exhaustive listing“ („X und niemand anderes / nichts anderes“).Nach É. Kiss (1998: 256–260) ist das Merkmal „exhaustive identification“ sogardefinitorisch für Spaltsätze im Englischen, da der abgespaltene Ausdruck in einesyntaktische Strukturposition trete, die semantisch auf diese Interpretation festge-legt sei. Wertet man aber mit É. Kiss Exhaustivität als festen Bedeutungsbestand-teil der Spaltsatzstruktur, ist nicht mehr zu verstehen, weshalb diese immer wiederzusätzlich durch restriktive Fokuspartikeln im abgespaltenen Ausdruck kodiert(59) und sogar explizit verstärkt (60) werden kann:
(59) À l’hôpital, ce n’est que mon mari qui est rentré dans la pièce avec le docteur.[Halimi, La cause des femmes (1992), FR]
(60) Mais où qu’il tourne les yeux, c’est cela qu’il verra et rien d’autre et c’est celaseul qui sera vrai. [Perec, W ou le souvenir d’enfance (1975), FR]
Konventionalisierte Bedeutungsaspekte zeichnen sich aber gegenüber aufhebbarenpragmatischen gerade dadurch aus, dass sie keine Verstärkung erlauben, wie amBeispiel der Ungrammatikalität von *nur ausschließlich, *ce n’est seulement quecela usw. und anderen Dopplungen semantischer Exhaustivitätsmarker sofortdeutlich wird. Umgekehrt kann durch additive Fokuspartikeln die Exhaustivitäts-andeutung auch als in ihrer Gültigkeit offen (61) oder sogar ausdrücklich alsunzutreffend (62) markiert werden (vgl. auch (28) in 2.2 sowie Hedberg 2006:390–391):
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 19
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 19
(61) Le CO2 est porteur &euh de l’acidité etc. / donc &euh # c’est peut-être ça aussiqu’on sent en bouche &euh un léger CO2. [fpubmn03, COR]
(62) Et c’est ça aussi qui nous rapproche. [Dorin, Les Vendanges tardives (1997), FR]
Kontrast wie auch Exhaustivität sind angesichts der Möglichkeit von Verstärkung(60), Suspendierung (61) und Aufhebung (62) nicht als konventionalisierteBedeutungsaspekte, sondern als generalisierte konversationelle Implikaturen imSinne von Grice zu werten (vgl. Levinson 2000). Dass auch ohne konstruktions-grammatische Zusatzannahmen wie in einigen funktionalistischen Ansätzen undohne die Ansetzung einer designierten funktionalen Fokusprojektion wie in derneueren ,kartographischen‘ Syntax (vgl. É. Kiss 1998; vgl. allgemein Rizzi 1997und zur Diskussion Dufter 2005) entscheidende semantische und pragmatischeLeistungen unmittelbar aus der syntaktischen Grundstruktur ableitbar sind, sollim nächsten Unterabschnitt aufgezeigt werden.
3.3 Biklausalität, Stativierung und Präsupposition
Spaltsätze enthalten per definitionem zwei Prädikate und eröffnen dadurch zweiklar voneinander abgegrenzte semantische Bereiche für Operatorenskopus (vgl.auch Delin und Oberlander 1995, eingereicht). Bei Negation, restriktiver (,nur X‘)oder additiver (,auch X‘) Fokussierung, aber auch bei epistemischen Qualifikatio-nen erlaubt Satzspaltung somit eine eindeutige syntaktische Signalisierung desintendierten Skopus, wogegen bei monoklausaler Kodierung insbesondere in derSchriftlichkeit Ambiguitäten oft kaum zu vermeiden sind (vgl. (63b) und (64b)):
(63) a. C’est pas moi qui vais payer. [ftelpv26, COR]b. Je vais pas payer.
(64) a. C’est peut-être cela que j’ai guetté, cours Albert-Ier, soir après soir et chaquefois avec le même serrement de cœur : le changement d’époque, l’irruptiondu calcul, de la prudence dans les rêves, la fabrication d’un président surmesure. [Orsenna, Grand amour (1993), FR]
b. Peut-être que j’ai guetté cela cours Albert-Ier, soir après soir et chaque foisavec le même serrement de cœur.
Besonders für die gesprochene Sprache beschreibt die Theorie präferierter Argu-mentstrukturen (Du Bois 1987, 2003) außerdem eine universelle Tendenz, nichtmehr als ein einziges lexikalisch gefülltes neues Argument pro klausaler Einheiteinzuführen. Satzspaltungen bieten hier wiederum durch ihre Biklausalität einStrukturformat an, in dem eine solche dispräferierte Kookkurrenz zweier nomina-ler Argumente innerhalb einer Prädikation vermieden werden kann (65). Insbe-sondere ist die biklausale Aufspaltung von Propositionen auch dann von Vorteil,wenn mehr als ein lexikalischer Ausdruck, etwa zwei Argumente eines Prädikats,zugleich fokussiert werden sollen (vgl. la terre und du soleil in (66)). Aber auch beipronominalen Argumenten können diese nicht nur als kontrastive Topiks mitanderen pronominalen (67) oder nominalen Ausdrücken (68) in Bezug gesetzt,
Andreas Dufter20
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 20
sondern auch die ihnen jeweils zugeordneten Prädikationen neu eingeführt undebenfalls kontrastiert werden:
(65) C’est le riche qui demande au pauvre maintenant. [fnatpr03, COR](66) Avez-vous remarqué que le soleil paraît changer de place dans la journée ? À
midi, il est au-dessus de nous, le soir il est couché, on dirait qu’il tourne autourde la terre. En réalité c’est la terre qui tourne autour du soleil à une vitesse deplus de 100 000 kilomètres à l’heure, et sur elle-même en vingt-quatre heures ![Prévert, Spectacle (1951), FR]
(67) Au fond, c’est toi qui fais les conneries, et c’est moi qui suis puni. [Clavel, LaMaison des autres (1962), FR]
(68) Un petit homme à moustache brune portait sur sa tête un plateau plein deconfiseries, et circulait au milieu de la foule en chantonnant : C’est moi qui lesfais, c’est moi qui les vends, et c’est ma femme qui me bouffe l’argent … [Le Clé-zio, Le Déluge (1966), FR]
Als spezifizierende Kopulasätze sind c’est-Spaltsätze darüber hinaus auch aspek-tuell markiert: Da nämlich ihr Matrixprädikat das Zutreffen oder Nichtzutreffeneiner Identitätsbeziehung ausdrückt, denotieren c’est-Spaltsätze grundsätzlich Zu-stände, auch dann, wenn ihre monoklausalen Varianten Handlungen oder andereGeschehnisse bezeichnen10. Diese Stativierung durch Satzspaltung kann dabeinicht nur die Integration der Proposition in den temporalen Einordnungsrahmender Diskursrepräsentation beeinflussen (vgl. Delin und Oberlander 1995), sondernauch als formelhafte Eröffnung von Briefen dienen (69), ein einleitendes setting fürWitze (vgl. Lambrecht 2004: 56–57) oder die Narration von Geschehnissen (70)bieten oder aber das Ende einer Handlungssequenz mit resümierender Kommen-tierung signalisieren (71), insgesamt also als Ressource zur Textorganisation fun-gieren.
(69) Paris, le 4 novembre 1954Monsieur le Président,C’est avec regret que j’ai reçu votre lettre du 31 octobre. [Mendès-France, Gou-verner, c’est choisir 1954–1955 (1986), FR]
(70) C’est Tintin et le capitaine Haddock qui sont à Mouilinsart ils veulent partir enAlgérie … (Rouget und Salze 1985: 137, Fn. 2; „énoncé produit en situation de,conte‘ „)
(71) – Émilie !– Non, non ! Va-t’en ! Je te hais ! Va-t’en ! Adieu ! Tu ne me reverras plus !Elle le repoussa, elle sortit et s’enfuit. C’était ainsi que les choses devaient sedérouler. [Van der Meersch, Invasion (1935), FR]
Auch Schmitt (1993) kommt in seiner Untersuchung präverbaler nicht-klitischerObjekte im Französischen zu dem Ergebnis, dass Abspaltung mit c’est vor allembei „Abschluss einer inhaltlichen Einheit“ oder „Einführung einer neuen (auchunbekannten) Einheit“ (S. 516) begegnet. Schließlich liegt in der Stativierungdurch Abspaltung mit c’est auch der Schlüssel zur Erklärung der in 2.1 festgestell-
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 21
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 21
ten Tempusrestriktionen. Analytisch gebildete Tempora wie passé composé oderplus-que-parfait leisten eine relative Zeitreferenz, sind also nicht allein hinsichtlicheines point of the event im Sinne von Reichenbach (1947) zu interpretieren, son-dern perspektivieren diese von einem Betrachtzeitpunkt aus. Eben ein solcher eige-ner Betrachtzeitpunkt wird aber in Spaltsätzen bereits durch die Zeitreferenz derKopula konstituiert, so dass analytische Tempora von être im Matrixprädikat vonc’est-Spaltsätzen nicht zu erwarten sind.
Neben Biklausalität und Stativierung sei abschließend noch eine dritte, eben-falls schon bei Delin und Oberlander (1995, eingereicht) diskutierte Eigenheit vonSpaltsätzen erwähnt, die wiederum bereits aus ihrem syntaktischen Struktur-format folgt, nämlich die Beschränkung der illokutiven Kraft auf den Matrixsatzund die Rückstufung des subordinierten Restsatzes zur Präsupposition. Hierbei istnicht entscheidend, ob man den subordinierten Satz als restriktiven Relativ- oderanders, etwa als Komplementsatz, analysiert. Insbesondere bei definitem Ante-zedens ist mit restriktiven Relativsätzen wie auch mit vielen anderen que-Komple-mentsätzen konventionell eine existenzielle oder faktive Präsupposition verbunden(vgl. Kleiber 1987: 58–59). Ein relativisches Attribut wie in (l’homme) qui étaitvenu ebenso wie das sententiale Objekt in Elle (ne) savait (pas) qu’il était venupräsupponieren, dass es ein x gibt, auf das die Prädikation ,x war gekommen‘zutrifft. Ebenso ergibt sich auch bei Abspaltung von Adverbialen und sogar vonPrädikaten durch geeignete Existenzabschlüsse jeweils die Präsupposition, ausC’est rejoindre que je n’aime pas in (22) beispielsweise „Es gibt ein x, für das ,Ichliebe x nicht‘ gilt“. Dass der subordinierte Teilsatz in c’est-Spaltsätzen nicht vonIllokutionen erfasst wird, zeigt sich etwa daran, dass ein Sprecher mit der FrageC’est Pierre qui est venu ? voraussetzt, dass jemand gekommen ist, wohingegenkeine solche Voraussetzung bei Pierre est venu ? besteht (vgl. Moreau 1976:24–33). Wie nach der Diskussion in 3.1 deutlich geworden sein sollte, kann aus derTatsache, dass der subordinierte Teilsatz in c’est-Spaltsätzen präsupponiert ist,jedoch nicht auf die Fokussierung des abgespaltenen Ausdrucks geschlossen wer-den, denn Präsupposition und Hintergrund sind nicht notwendigerweise koexten-sional. Nicht die Fokussierung des abgespaltenen Ausdrucks, sondern die Präsup-position des subordinierten Satzes stellt somit ein Definiens von c’est-Spaltsätzendar. Dieses Merkmal bildet keineswegs eine Besonderheit einer Spaltsatzkonstruk-tion, sondern ergibt sich unmittelbar aus der Tatsache, dass Relativsätze (außer beiindefinitem Antezedens) ebenso wie nicht-relativische que-Sätze typische Präsup-positionsauslöser sind. Die Präsentation relational neuer Information als Präsup-position – genau darauf zielt der glücklich gewählte Terminus informative-pre-supposition cleft bei Prince ab – bildet dabei eine konventionalisierte Option imNeufranzösischen, deren diskursive Implikationen eine eigene Studie erfordernwürden. So könnte der Präsuppositionsstatus des subordinierten Satzes nichtunwichtig für die von Stempel (1981: 356) aufgeworfene Frage sein, warum auchbei Fokus auf Ausdrücken in Objektfunktion eine Abspaltung mit c’est in Fällen
Andreas Dufter22
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 22
wie (72) fragwürdig erscheint (Stempel selbst spricht von „Überpointierung“):
(72) a. Et un pain bien cuit tu peux me rapporter aussi.b. ?Et c’est un pain bien cuit que tu peux me rapporter aussi.
(Stempel 1981: 354 und 356)
Möglicherweise besteht ein Grund für die zweifelhafte Akzeptabilität von (72b)darin, dass in der durch die Äußerung evozierten Situation – der Sprecher ergänztseine ,Bestellung‘ um ein weiteres Element – gerade nicht davon auszugehen ist,dass die im subordinierten Satz ausgedrückte Proposition (mit Existenzquantifi-zierung der offenen Variable paraphrasierbar als ,Du kannst mir auch etwas (wei-teres) mitbringen‘) als präsupponiert dargestellt werden soll. Schließlich erscheintnunmehr auch der Gebrauch von Inferentialsätzen als eine kommunikative Strate-gie verständlich, in der ein Sachverhalt im Gesprächszusammenhang im Statuseiner Präsupposition eingeführt und somit als diskursiv nicht verhandelbar prä-sentiert wird. Grundsätzlich ist also nicht nur die Identität des abgespaltenenTerms, sondern auch die pragmatische Angemessenheit des subordinierten Satzesals Präsupposition für eine genauere Analyse der Verwendungsbedingungen vonc’est-Spaltsätzen zu berücksichtigen.
4. Zusammenfassung
Die vorgestellten Untersuchungen von Form- und Funktionseigenschaften derc’est-Spaltsätze konnten insgesamt nur wenig Evidenz für Konventionalisierungerbringen. Einige vermeintliche Besonderheiten der Satzklasse, etwa die fehlendeKommutierbarkeit von ce mit cela und ça, das Verbot pronominaler Doppelungenvon ce (vgl. 2.1), die geringe Akzeptabilität von Mehrfachabspaltungen sowie vonAbspaltungen indefinit quantifizierter oder negationshaltiger Ausdrücke (vgl. 2.2)führen auf allgemeinere Restriktionen spezifizierender Kopulasätze zurück. Anderetraditionell für Satzspaltung mit c’est postulierte Besonderheiten wie das Verbotvon bestimmten relativischen Junktoren sowie von präpositionaler Rektion (vgl.2.3) scheinen angesichts der Korpusbefunde lediglich statistische Tendenzen dar-zustellen. Wieder andere als Besonderheit gewertete Eigenschaften, insbesonderedas Verbot analytischer Tempusformen von être, ergeben sich kompositional ausallgemeineren Struktureigenschaften von spezifizierenden Kopulasätzen, relativi-scher Subordination oder sententialer Komplementation. Auffällig bleibt die kate-goriale Unterbestimmtheit der Abspaltungsposition sowie die Generalisierung vonque, beides Phänomene, die zwar Ähnlichkeiten aufweisen mit anderen aggrega-tiven Strukturen – insbesondere Freien Themen und absoluten Rahmensetzungen(Stark 1997) sowie „relatives à décumul“ (Blanche-Benveniste 1991: 76) und „rela-tives enchâssées“ (Moreau 1971: 79) –, jedoch aus diesen wohl nicht ohne weiteresabzuleiten sind. Die Untersuchung von Variabilität und invarianten Eigenschaftenbei c’est-Spaltsätzen führte in 2.4 schließlich zu einer expliziten Bestimmung der
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 23
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 23
Oberflächenstruktur als eines regulären Ausdrucks.Bei der Analyse der Funktionseigenschaften wurde in 3.1 zunächst gegen die
Auffassung argumentiert, wonach c’est-Spaltsätze grundsätzlich eine Fokussierungdes abgespaltenen Ausdrucks leisten. Diese These liegt nicht selten gleichsam axio-matisch Untersuchungen zu Spaltsätzen zugrunde, führt jedoch entweder zueinem apriorischen Ausschluss einer nicht unerheblichen Zahl von ,informations-strukturell unpassend‘ erscheinenden Sätzen des Strukturformats in (1) oder aberzu zirkulären Argumentationen („Abspaltung weil Fokus, Fokus weil Abspal-tung“). Kontrast und Exhaustivität bilden zwar typische mit Abspaltung verbun-dene Interpretationspräferenzen, jedoch, wie in 3.2 dargelegt, nach Ausweis prag-matischer Standardtests keine konventionalisierten Bedeutungsaspekte, sondernlediglich generalisierte konversationelle Implikaturen. In 3.3 wurden sodann einigegrundlegende Einsichten, die insbesondere Delin und Oberlander (1995, einge-reicht) für die Satzspaltung im Englischen entwickelt haben, auf den c’est-Spalt-satz übertragen. So ist für eine vollständigere Theorie der Verwendungsbedin-gungen bereits die Biklausalität von Bedeutung: denn Satzspaltung ermöglicht imUnterschied zu monoklausalen Kodierungen eindeutige Skopusmarkierungen undpräferierte Argumentstrukturen im Sinne von Du Bois (1987, 2003) und erlaubtumgekehrt, komplexe Mehrfachfokussierungen innerhalb einer einzelnen Prädika-tion zu vermeiden. Des Weiteren bilden Spaltsätze prinzipiell stativische Prädika-tionen und sind durch ihre geringere semantische Transitivität dadurch in besonde-rer Weise geeignet, beispielsweise Briefe oder mündliche Erzählungen zu eröffnenoder aber umgekehrt am Ende von Inhaltsabschnitten zusammenzufassen und zukommentieren. Schließlich ist auch die Tatsache, dass durch die Subordination beiSatzspaltung das eingebettete Satzradikal aus dem Skopus der Assertion oderFrage ausgenommen und präsupponiert wird, für ein Verständnis der Anwen-dungsmöglichkeiten und -tendenzen von c’est-Spaltsätzen nicht unerheblich.Kompositionale Struktureigenschaften spielen nicht nur für die Semantik, son-dern auch für die Informationsstruktur und Textorganisation eine entscheidendeRolle.
München, im Februar 2007
Literatur
Ambar, Manuela (2005): „Clefts and tense asymmetries.“ UG and External Systems. Lan-guage, brain and computation, Anna Maria Di Sciullo (Hg.), 95–127. Amsterdam undPhiladelphia: Benjamins.
Ball, Catherine N. (1994): „The origins of the informative-presupposition it-cleft.“ Journalof Pragmatics 22: 603–628.
Bernini, Giuliano, und Marcia L. Schwartz (Hgg.) (2006): Pragmatic Organization of Dis-course in the Languages of Europe. Berlin und New York: Mouton de Gruyter.
Blanche-Benveniste, Claire (1991): Le français parlé. Études grammaticales. Paris: CNRS.
Andreas Dufter24
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 24
Blanche-Benveniste, Claire (2000): „Présence et absence de prépositions dans les clivées etles pseudo-clivées.“ Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et de PhilologieRomanes, Bruxelles, 23–29 juillet 1998, Annick Englebert (Hg.), Bd. 6, 55–65. Tübingen:Niemeyer.
Blanche-Benveniste, Claire (2001): „Prépositions à éclipses.“ Travaux de Linguistique 42 / 43:83–95.
Blanche-Benveniste, Claire, José Delofeu, Jean Stefanini und Karel van den Eynde (1987):Pronom et syntaxe. L’approche pronominale et son application au français, 2ème éditionaugmentée. Paris: SELAF.
Campione, Estelle, Jean Véronis und José Deulofeu (2005): „The French corpus.“ Cresti undMoneglia (Hgg.), 111–133.
Clech-Darbon, Anne, Georges Rebuschi und Annie Rialland (1999): „Are there cleft sen-tences in French?“ The Grammar of Focus, Georges Rebuschi und Laurice Tuller (Hgg.),83–118. Amsterdam und Philadelphia: Benjamins.
Chomsky, Noam [1970] (1971): „Deep structure, surface structure, and semantic inter-pretation.“ Semantics, Danny D. Steinberg und Leon A. Jakobovits (Hgg.), 183–216.Cambridge: Cambridge University Press.
Collins, Peter C. (1991): Cleft and Pseudo-Cleft Constructions in English. London: Routledge.Cresti, Emanuela, und Massimo Moneglia (Hgg.) (2005): C-ORAL-ROM. Integrated refer-
ence corpora for spoken Romance languages. Amsterdam und Philadelphia: Benjamins.Davidse, Kirsten (2000): „A constructional approach to clefts.“ Linguistics 38: 1101–1131.Declerck, Renaat (1984): „The pragmatics of it-clefts and WH-clefts.“ Lingua 64: 433–471.Delahunty, Gerald P. (1995): „The inferential construction.“ Pragmatics 5: 341–364.Delin, Judy L. (1992): Aspects of Cleft Constructions in Discourse. Stuttgart: Wissenschaft-
liches Zentrum der IBM Deutschland.Delin, Judy L., und Jon R. Oberlander (1995): „Syntactic constraints on discourse structure.
The case of it-clefts.“ Linguistics 33: 465–500.Delin, Judy L., und Jon. R. Oberlander (Eingereicht): „Cleft constructions in context. Some
suggestions for research methodology.“Den Dikken, Marcel (2006): „Specificational copular sentences and pseudoclefts.“ The
Blackwell Companion to Syntax, Martin Everaert und Henk van Riemsdijk (Hgg.), Bd. 4,292–409. Oxford: Blackwell.
Di Tullio, Ángela (2006): „Clefting in spoken discourse.“ Encyclopedia of Language and Lin-guistics, second edition, Keith Brown (Hg.), Bd. 2, 483–491. Amsterdam u.a.: Elsevier.
Doetjes, Jenny, Georges Rebuschi und Annie Rialland (2004): „Cleft sentences.“ Handbookof French Semantics, Francis Corblin und Henriëtte de Swart (Hgg.), 529–552. Stanford,CA: CSLI.
Doherty, Monika (2001): „Discourse functions and language-specific conditions for the useof cleft(-like) sentences. A prelude.“ Linguistics 39: 457–462.
Drubig, H. Bernhard (2003): „Toward a typology of focus and focus constructions.“ Lin-guistics 41: 1–50.
Du Bois, John W. (1987): „The discourse basis of ergativity.“ Language 63: 805–855.Du Bois, John W. (2003): „Argument structure. Grammar in use.“ Preferred Argument
Structure. Grammar as architecture for function, John W. Du Bois, Lorraine E. Kumpfund William J. Ashby (Hgg.), 11–60. Amsterdam und Philadelphia: Benjamins.
Dufter, Andreas (2005): „Fokus als funktionale Kategorie im Französischen und Spani-
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 25
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 25
schen.“ Deutsche Romanistik – generativ, Georg A. Kaiser (Hg.), 67–86. Tübingen: Narr.Dufter, Andreas (Im Druck): „On explaining the rise of c’est-clefts in French.“ Erscheint in:
The Paradox of Grammatical Change. Perspectives from Romance, Ulrich Detges undRichard Waltereit (Hgg.). Amsterdam und Philadelphia: Benjamins.
É. Kiss, Katalin (1998): „Identificational focus versus information focus.“ Language 74:245–273.
Féry, Caroline (2001): „Focus and phrasing in French.“ Audiatur vox sapientiae. A fest-schrift for Arnim von Stechow, Caroline Féry und Wolfgang Sternefeld (Hgg.), 153–181.Berlin: Akademie-Verlag.
Fradin, Bernard (1978): „Les phrases clivées en français. Propositions pour une réanalyse.“Recherches Linguistiques de Vincennes 7: 87–134.
Gapany, Joël (2004): Formes et fonctions des relatives en français. Étude syntaxique et séman-tique. Bern u.a.: Lang.
Geurts, Bart, und Rob vs Sandt (2004): „Interpreting focus.“ Theoretical Linguistics 30:1–44.
Gil, Alberto (2003): „Zur Geschichte des Spaltsatzes und seiner strukturellen Varianten imRomanischen.“ Aufgaben und Perspektiven der romanischen Sprachgeschichte im drittenJahrtausend, Alberto Gil und Christian Schmitt (Hgg.), 195–217. Bonn: RomanistischerVerlag.
Godard, Danièle (1988): La syntaxe des relatives en français. Paris: CNRS.Goldberg, Adele E. (2006): Constructions at Work. The nature of generalization in language.
Oxford: Oxford University Press.Grevisse, Maurice (1993): Le bon usage. Grammaire française, 13ème édition. Gembloux:
Duculot.Gundel, Jeanette K. (1988): „Universals of topic-comment structure.“ Studies in Syntactic
Typology, Michael Hammond, Edith Moravcsik und Jessica Wirth (Hgg.), 209–242.Amsterdam und Philadelphia: Benjamins.
Gundel, Jeanette K. (2002): „It-clefts in English and Norwegian.“ Information Structure in aCross-Linguistic Perspective, Bergljot Behrens, Cathrine Fabricius-Hansen, Hilde Hassel-gård und Stig Johansson (Hgg.), 113–128. Amsterdam: Rodopi.
Gundel, Jeanette K. (2006): „Clefts in English and Norwegian. Implications for the gram-mar-pragmatics interface.“ Molnár und Winkler (Hgg.), 517–548.
Gundel, Jeanette K., und Thorstein Fretheim (2003): „Topic and focus.“ The Handbook ofPragmatics, Gregory L. Ward und Laurence R. Horn (Hgg.), 175–196. Malden, MA:Blackwell.
Habert, Benoît (2000): „Des corpus représentatifs : de quoi, pour quoi, comment ?“ Lin-guistique sur corpus. Études et réflexions, Mireille Bilger (Hg.), 11–58. Perpignan: PressesUniversitaires de Perpignan.
Halliday, Michael A. K. (1967): „Notes on transitivity and theme in English. Part II.“ Jour-nal of Linguistics 3: 199–244.
Hancock, Victorine (2002): „L’emploi des constructions en c’est x qui / que en français parlé :une comparaison entre apprenants de français et locuteurs natifs.“ Romansk Forum 16:379–388.[http://www.duo.uio.no/roman/Art/Rf-16-02-2/fra/Hancock.pdf]
Harris-Delisle, Helga (1978): „Contrastive emphasis and cleft sentences.“ Universals ofHuman Language, Joseph H. Greenberg (Hg.), Bd. 4, 419–486. Stanford, CA: Stanford
Andreas Dufter26
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 26
University Press.Hedberg, Nancy A. (1990): Discourse Pragmatics and Cleft Sentences in English. Ph.D. dis-
sertation, University of Minnesota.Hedberg, Nancy A. (2006): „Topic-focus controversies.“ Molnár und Winkler (Hgg.), 373–
397.Holmes, V. M. (1995): „A crosslinguistic comparison of the production of utterances in dis-
course.“ Cognition 54: 169–207.Huber, Stefan (2002): Es-clefts und det-clefts. Zur Syntax, Semantik und Informations-
struktur von Spaltsätzen im Deutschen und Schwedischen. Stockholm: Almqvist & Wik-sell.
Huber, Stefan (2006): „The complex functions of it-clefts.“ Molnár und Winkler (Hgg.),549–578.
Hupet, Michel, und Brigitte Tilmant (1986): „What are clefts good for? Some consequencesfor comprehension.“ Journal of Memory and Language 25: 419–430.
Hupet, Michel, und Brigitte Tilmant (1989): „How to make young children produce cleftsentences.“ Journal of Child Language 16: 251–261.
Janssen, Theo M. V. (1997): „Compositionality (with an appendix by Barbara Partee).“Handbook of Logic and Language, Johan van Benthem und Alice ter Meulen (Hgg.),417–473. Amsterdam: Elsevier und Cambridge, MA: MIT Press.
Johansson, Mats (2001): „Clefts in contrast. A contrastive study of it clefts and wh clefts inEnglish and Swedish texts and translations.“ Linguistics 39: 547–582.
Katz, Stacey L. (2000a): „A functional approach to the teaching of the French c’est-cleft.“French Review 74: 248–262.
Katz, Stacey L. (2000b): „Categories of c’est-cleft constructions.“ Canadian Journal of Lin-guistics /Revue canadienne de linguistique 45: 253–273.
Kayne, Richard S., und Jean-Yves Pollock (1978): „Stylistic inversion, successive cyclicity,and Move NP in French.“ Linguistic Inquiry 9: 595–621.
Kayne, Richard S., und Jean-Yves Pollock (2001): „New thoughts on stylistic inversion.“Subject Inversion in Romance and the Theory of Universal Grammar, Aafke Hulk undJean-Yves Pollock (Hgg.), 107–162. Oxford: Oxford University Press.
Kleiber, Georges (1987): „Relatives restrictives / relatives appositives. Dépassement(s) auto-risé(s).“ Langages 88: 41–63.
Krötsch, Monique, und Annette Sabban (1990): focalisation en français.“ Zeitschrift fürromanische Philologie 96: 80–97.
Lambrecht, Knud (1994): Information Structure and Sentence Form. Topic, focus and themental representations of discourse referents. Cambridge: Cambridge University Press.
Lambrecht, Knud (2001): „A framework for the analysis of cleft constructions.“ Linguistics39: 463–516.
Lambrecht, Knud (2004): „Un système pour l’analyse de la structure informationnelle desphrases. L’exemple des constructions clivées.“ Structure informationnelle et particulesénonciatives. Essai de typologie, Jocelyne Fernandez-Vest und Shirley Carter-Thomas(Hgg.), 21–62. Paris: L’Harmattan.
Léard, Jean-Marcel (1992): Les gallicismes. Étude syntaxique et sémantique. Paris und Lou-vain-la-Neuve: Duculot.
Lehmann, Christian (1984): Der Relativsatz. Typologie seiner Strukturen, Theorie seinerFunktionen, Kompendium seiner Grammatik. Tübingen: Narr.
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 27
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 27
Levinson, Stephen C. (2000): Presumptive Meanings. The theory of Generalized Conversa-tional Implicature. Cambridge, MA: MIT Press.
Lewis, David (1979): „Scorekeeping in a language game.“ Journal of Philosophical Language8: 339–359.
Lipka, Leonhard (1982): „ ,Mise en relief ‘ und ,cleft sentence‘: Zwei Verfahren der Thema /Rhema-Gliederung.“ Fakten und Theorien. Festschrift für Helmut Stimm zum 65. Ge-burtstag, Sieglinde Heinz und Ulrich Wandruszka (Hgg.), 163–172. Tübingen: Narr.
Metzeltin, Michael (1989): „Zur Typologie der romanischen Spaltsätze.“ Variatio linguarum.Beiträge zu Sprachvergleich und Sprachentwicklung. Festschrift zum 60. Geburtstag vonGustav Ineichen, Ursula Klenk, Karl-Hermann Körner und Wolf Thümmel (Hgg.),191–203. Stuttgart: Steiner.
Miller, Jim (2006): „Focus in the languages of Europe.“ Bernini und Schwartz (Hgg.), 121–214.
Molnár, Valéria (2006): „On different kinds of contrast.“ Molnár und Winkler (Hgg.), 197–233.
Molnár, Valéria, und Susanne Winkler (2006): „Exploring the architecture of focus in gram-mar.“ Molnár und Winkler (Hgg.), 1–29.
Molnár, Valéria, und Susanne Winkler (Hgg.) (2006): The Architecture of Focus. Berlin undNew York: Mouton de Gruyter.
Moreau, Marie-Louise (1971): „L’homme que je crois qui est venu. QUI, QUE, relatifs etconjonctions.“ Langue Française 11: 77–90.
Moreau, Marie-Louise (1976): C’EST. Étude de syntaxe transformationnelle. Mons: ÉditionsUniversitaires de Mons.
Muller, Claude (2002): „Clivées, coréférence et relativation.“ Traits d’union, Georges Kleiberund Nicole Le Querler (Hgg.), 17–32. Caen: Presses Universitaires de Caen.
Muller, Claude (2003a): „Naissance et évolution des constructions clivées en «c’est … que …» : de la focalisation sur l’objet concret à la focalisation fonctionnelle.“ La cogni-tion dans le temps : Études cognitives dans le champ historique des langues et des textes,Peter Blumenthal und Jean-Emmanuel Tyvaert (Hgg.), 101–120. Tübingen: Niemeyer.
Muller, Claude (2003b): „Traduire les clivées du français en allemand.“ Aspects linguistiquesde la traduction, Michael Herslund (Hg.), 149–167. Bordeaux: Presses Universitaires deBordeaux.
Nølke, Henning (1983): „Quelques réflexions sur la structure sémantique des phrases clivéesen français moderne.“ Modèles linguistiques 5: 117–140.
Pavey, Emma Louise (2004): The English It-Cleft Construction: a Role and Reference Gram-mar analysis. Ph.D. dissertation, University of Sussex.
Prince, Ellen F. (1978): „A comparison of wh-clefts and it-clefts in discourse.“ Language 54:883–906.
Pusch, Claus D. (2006): „Marqueurs discursifs et subordination syntaxique : La construc-tion inférentielle en français et dans d’autres langues romanes.“ Les marqueurs discursifsdans les langues romanes. Approches théoriques et méthodologiques, Martina Drescherund Barbara Frank-Job (Hgg.), 173–188. Frankfurt a.M. u.a.: Lang.
Reichenbach, Hans (1947): Elements of Symbolic Logic. New York: Macmillan.Rizzi, Luigi (1997): „The fine structure of the left periphery.“ Elements of Grammar. Hand-
book in generative syntax, Liliane M. Haegeman (Hg.), 281–337. Dordrecht: Kluwer.Roubaud, Marie-Noëlle (2000): Les constructions pseudo-clivées en français contemporain.
Andreas Dufter28
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 28
Paris: Champion.Romera, Magdalena (2004): Discourse Functional Units. The expression of coherence rela-
tions in spoken Spanish. München: LINCOM.Rooth, Mats (1996): „Focus.“ The Handbook of Contemporary Semantic Theory, Shalom
Lappin (Hg.), 271–297. Oxford: Blackwell.Rouget, Christine, und Laurence Salze (1985): „C’est … qui, c’est … que : le jeu des quatre
familles.“ Recherches sur le français parlé 7: 117–139.Scappini, Sophie-Anne (2006): „Étude du dispositif d’extraction en «c’est … qu», différen-
ciation entre un dispositif d’extraction et une relative en «c’est … qu».“ Résumé dethèse, Aix-en-Provence.
Schachter, Paul (1973): „Focus and relativization.“ Language 49: 19–46.Schmitt, Christian (1993): „Objektstellung im Vorfeld: Ein Beitrag zur französischen Text-
grammatik.“ Grammatikographie der romanischen Sprachen. Akten der gleichnamigenSektion des Bamberger Romanistentages (23.–29.9.1991), Christian Schmitt (Hg.), 489–521. Bonn: Romanistischer Verlag.
Schmitt, Uta (2004): Diskurspragmatik und Syntax. Die Funktionale Satzperspektive in derfranzösischen und deutschen Tagespresse unter Berücksichtigung einzelsprachlicher, presse-typ- und textklassenabhängiger Spezifika. Frankfurt a.M. u.a.: Lang.
Schöpp, Frank (2002): „Funktionen der Cleft-Konstruktion im Französischen (Teil I).“Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 40: 47–68.
Schöpp, Frank (2003): „Funktionen der Cleft-Konstruktion im Französischen (Teil II).“Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 41: 37–53.
Schöpp, Frank (2005): „Fokus-Konstruktionen im Italienischen – mit Vergleichen zumFranzösischen.“ Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 43: 85–105.
Sleeman, Petra (2004): „Guided learners of French and the acquisition of emphatic con-structions.“ IRAL – International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 42:129–151.
Smits, R. J. C. (1989): Eurogrammar. The relative and cleft constructions of the Germanic andRomance languages. Dordrecht u.a.: Foris.
Sornicola, Rosanna (2006): „Interaction of syntactic and pragmatic factors on basic wordorder in the languages of Europe.“ Bernini und Schwartz (Hgg.), 357–544.
Stalnaker, Robert C. [1974] (1991): „Pragmatic presuppositions.“ Pragmatics. A reader, Ste-ven Davis (Hg.), 471–482. Oxford: Oxford University Press.
Stark, Elisabeth (1997): Voranstellungsstrukturen und „topic“-Markierung im Französischen.Mit einem Ausblick auf das Italienische. Tübingen: Narr.
Stempel, Wolf-Dieter (1981): „«L’amour, elle appelle ça», «L’amour tu ne connais pas».“Logos Semantikos. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, 1921–1981, Bd. 4,351–367. Berlin: Mouton de Gruyter.
Thome, Gisela (1978): „La mise en relief und ihre Wiedergabe im Deutschen.“ Translation,Gerhard Nickel (Hg.), 107–119. Stuttgart: Hochschulverlag.
Tilmant, Brigitte, und Michel Hupet (1990): „Effets du degré de conviction de l’interlocu-teur sur l’usage de phrases clivées.“ L’ annee psychologique 90: 213–229.
Valli, André (1981): „Note sur les constructions dites «pseudo-clivées» en français.“ Recher-ches sur le français parlé 3: 195–211.
Van den Eynde, Karel, und Piet Mertens (2003): „La valence : l’approche pronominale etson application au lexique verbal.“ Journal of French Language Studies 13: 63–104.
Zwischen Kompositionalität und Konventionalisierung 29
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 29
Van Peteghem, Marleen (1991): Les phrases copulatives dans les langues romanes. Wil-helmsfeld: Egert.
Vion, Monique, und Annie Colas (1995): „Contrastive marking in French dialogue: whyand how.“ Journal of Psycholinguistic Research 24: 313–331.
Wehr, Barbara (1984): Diskurs-Strategien im Romanischen. Ein Beitrag zur romanischen Syn-tax. Tübingen: Narr.
Wehr, Barbara (1994): „Topic- und Focus-Konstruktionen im Französischen.“ SprachlicherAlltag. Linguistik – Rhetorik – Literaturwissenschaft. Festschrift für Wolf-Dieter Stempel,7. Juli 1994, Annette Sabban und Christian Schmitt (Hgg.), 611–633. Tübingen: Nie-meyer.
Andreas Dufter30
A 01 Dufter Aufsatz 04.06.2007 13:55 Uhr Seite 30



































![[2014-10-08] Demografischer Wandel als gesellschaftliche Krise – Deutsche Alterungsdiskurse der Gegenwart und die wachsende Kritik an deren Demografisierung und Dramatisierung (37.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63233d71807dc363600accc0/2014-10-08-demografischer-wandel-als-gesellschaftliche-krise-deutsche-alterungsdiskurse.jpg)