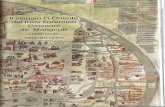Perspectivismo lingüístico y otredad en Corsarios de Levante
Zum Werdegang des Antitrinitariers Jacobus Palaeologus bis 1561, 1. Teil: Frate Jacobo da Scio und...
Transcript of Zum Werdegang des Antitrinitariers Jacobus Palaeologus bis 1561, 1. Teil: Frate Jacobo da Scio und...
3
Acta Comeniana26
Archiv pro bádánío životě a díle
Jana Amose KomenskéhoL
Founded 1910 by Ján Kvačala
International Reviewof Comenius Studies
and Early Modern Intellectual History
Internationale Revuefür Studien über J. A. Comenius
und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit
FILOSOFIA–PRAHA 2012
7
ACTA COMENIANA 26 (2012)
ARTICLES / STUDIEN
Martin Rothkegel (Theologisches Seminar Elstal)
Werdegang des Antitrinitariers Jacobus Palaeologus bis 1561
1. Teil: Frate Jacobo da Scio und seine Anhänger in der Levante*
Růžena Dostálová gewidmet
Der auf der Insel Chios um 1520 geborene, 1585 in Rom als Ketzer hingerichtete Ex-Dominikaner Jacobo da Scio alias Jacobus Palaeologus ist einer der Hauptvertreter des radikalen, nonadorantistischen (die Gottheit Jesu Christi verneinenden) Unitaris-mus des 16. Jahrhunderts.1 Palaeologus verbrachte von Oktober 1562 bis Sommer 1571 fast neun Jahre seines Lebens in Prag. 1567 stiftete er mit dem Gedenkstein für den
* Der vorliegende Beitrag ist der erste Teil einer zweiteiligen Studie. Der zweite Teil folgt im nächsten Band der Acta Comeniana und geht den theologischen Auff assungen des frühen Palae-ologus nach. Die Studie ist eine Vorarbeit zu einem bio-bibliographischen Dossier über Jacobus Palaeologus, das 2014 in der BIBLIOTHECA DISSIDENTIUM (Répertoire des non-conformis-tes religieux des seizième et dix-septième siècles, Baden-Baden & Bouxwiller: Éditions Valentin Koerner) erscheinen wird. ‒ Prof. Dr. Růžena Dostálová (Prag) und Prof. Dr. Massimo Firpo (Turin) danke ich für die Möglichkeit zur Benutzung der von ihnen angelegten Quellensamm-lungen über Jacobus Palaeologus. Für Hinweise und Auskünfte danke ich Prof. Dr. Mihály Balázs (Szeged), fr. Andreas Fieback OFM Conv. (Archivum Generale Ordinis Fratrum Mi-norum Conventualium, Rom), Dr. Emrah-Saff a Gürkan (Istanbul), P. Dr. Wolfram Hoyer OP (Augsburg), Dr. Timoty Leonardi (Archivio Capitolare, Vercelli), Dávid Molnár M.A. (Szeged), Prof. Dr. Giovanna Paolin (Trieste), Dr. Daniel Ponziani (Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano) und Prof. Dr. Ioannis Zelepos (München). Dr. Daniela Durissini (Trieste) danke ich für die Transkription und sprachliche Erläuterung eines stark dia-lektalen Dokuments (Archivio di Stato di Venezia, Sant’Uffi zio, b. 14, fasc. proc. 14). Den Pas-toren Andrea und Walter Klimt (Wien) und Carlo Guerrieri (Rom und Genua) und dem Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione (Padova) danke ich für ihre Gastfreundschaft. Ein besonderer Dank geht an die Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf) für die fi nanzielle Förderung der Archivforschungen, die dieser Studie und dem Palaeologus-Dossier der BIBLIOTHECA DIS-SIDENTIUM zugrundeliegen.1 Zur Biographie des Palaeologus vgl. die auf ausgedehnten Quellenrecherchen beruhenden Bei trä ge von Lech SZCZUCKI, Jakub z Chios-Paleolog (Zarys biografi i) [Jacobus Palaelogus. Eine biographische Skizze], Odrodzenie i Reformacja w Polsce 11, 1966, S. 63–91, 13, 1969, S. 5–50; ID., W kręgu myślicieli heretyckich [Im Kreis der häretischen Denker], Warszawa 1972, S. 11–121, 199–244; ID., Paleologo, Giacomo, in: Adriano PROSPERI (Hrsg.), Dizionario storico dell’Inquisizione,
8
Gräzisten Matthaeus Collinus im Collegium Carolinum auch sich selbst ein bleibendes Denkmal. Das Reliefmonument mit der auff älligen griechischen Inschrift, das bis 1875 in einem Innenhof stand und später in der alten Aula aufgestellt wurde, ist seither wohl kaum jemandem entgangen, der an der Karlsuniversität zum Magister oder Doktor pro-moviert wurde oder an anderen akademischen Festakten teilnahm. Daher verwundert es nicht, daß der gräko-italienische Nonkonformist in der Prager lokalen Überlieferung präsent blieb und in der tschechischen Forschung immer wieder Beachtung fand. Nach-dem bereits im 18. und 19. Jahrhundert einschlägige Publikationen böhmischer Ver-fasser erschienen waren,2 betrieb an der Wende zum 20. Jahrhundert der Brünner Hi-storiker Bohumil Navrátil (1870–1936) ausgedehnte Forschungen in italienischen und mitteleuropäischen Archiven zu Person und Lehre des Palaeologus, deren Ergebnisse allerdings unveröff entlicht blieben.3 Einen Höhepunkt erreichte die tschechische Palae-ologus-Forschung mit den Arbeiten der Prager Byzantinistin Růžena Dostálová, die im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts mehrere grundlegende Studien und Texteditionen vorlegte.4 Ihr ist der vorliegende Beitrag in Dankbarkeit und Respekt gewidmet.
Bd. 3, Pisa 2010, S. 1159–1161. Aus der älteren Literatur sei genannt: Gerhard RILL, Jacobus Palaeologus (ca. 1520–1585). Ein Antitrinitarier als Schützling der Habsburger, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 16, 1963, S. 28–85.2 Es seien genannt: Johannes SEMLER SJ, Animadversiones in Monumentum Sepulcrale, quod Matt-haeo Collino a Iacobo Palaeologo erectum, in Magno Collegio Carolino Pragensi conspicitur, Prag 1756; Wogtěch RUFFER, Kámen pamětnj s nápisem postawený mistru Matauši Kollinowi z Choteřiny od Jakuba Palaeologa w kollegi weliké w Praze [Gedenkstein mit Inschrift, errichtet für Mat-thaeus Collinus de Chotěřina von Jacobus Palaeologus im Großen Kolleg zu Prag], ČČM 5, 1831, S. 441–442; Václav HANKA, Jakob Palaeologus i památník Matouši Kolínu z Chotěřiny po-stavený, Rozbor staročeské literatury II [Jacobus Palaelogus und der für Matthaeus Collinus de Chotěrina errichete Gedenkstein], Praha 1845, S. 28–32; Josef JIREČEK, Jakub Palaeolog. Životo-pisní nástin [Jacobus Palaelogus. Eine biographische Skizze], Časopis Matice moravské 7, 1875, S. 1–9; erwähnt seien auch der Roman von Josef SVÁTEK, Praha a Řím. Román z XVI. století [Prag und Rom. Ein Roman aus dem 16. Jahrhundert], Praha 1872, und der Feuilletonartikel von Egon Erwin KISCH, Der hingerichtete Stifter eines Denkmals, in: ID., Prager Pitaval, Berlin 1931, S. 84–90.3 Navrátils Materialsammlung befi ndet sich im Mährischen Landesarchiv in Brünn: Moravský zemský archiv v Brně (im folgenden: MZA), G 57, Karton ohne Nummer, Faszikel „Paleolog“; zu Navrátil vgl. Jaroslav DŘÍMAL, Bohumil Navrátil a Matice moravská (K stému výročí narození histori-ka) [Bohumil Navrátil und der Mährische Kulturverein (Zum 100. Geburtstag des Historikers)], Časopis Matice moravské 89, 1970, S. 253–274; František KUTNAR – Jaroslav MAREK, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století [Übersicht über die Geschichte der tschechischen und slowakischen Geschichtsschrei-bung von den Anfängen der Nationalkultur bis Ende der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts], Praha 1997, S. 547f.4 Vgl. Růžena DOSTÁLOVÁ, Život a dílo Jakuba Paleologa [Leben und Werk des Jacobus Palaeolo-gus], Zprávy Jednoty klasických fi lologů 5, 1963, S. 108–109; EAD., Jakobus Palaeologus, Berliner byzantinistische Arbeiten 49, 1964, S. 153–175; EAD., Autografy Jakuba Palaeologa v třeboňském archivu [Autographen des Jacobus Palaeologus im Wittingauer Archiv], Zprávy Jednoty klasických fi lologů 6, 1964, S. 150–160; EAD., Ein Beitrag zur Frage der Wirkung des italienisch gebildeten Hellenismus in Mitteleuropa: Eine neugefundene Schrift des Jakob Palaeologus (Bern
9
Ostmitteleuropäische Wirkungsgeschichte und levantinischer Primärkontext der Theologie des Palaeologus
Nachdem Palaeologus 1571 von Prag zunächst nach Krakau übergesiedelt war, be-gann er mit der Abfassung zahlreicher lateinischer theologischer Schriften, von denen ein Teil von den Antitrinitariern in Siebenbürgen handschriftlich überliefert wurde und auf diese Weise erhalten blieb. Durch diese Schriften und durch persönliche Aufent-halte in Siebenbürgen in den Jahren 1572 und 1573–1575 trug Palaeologus zur Formie-rung einer radikal unitarischen, non adorantistischen Strömung innerhalb des sieben-bürgischen Antitrinitarismus bei. Zu deren wichtigstem einheimischen Repräsentanten wurde Franciscus Davidis (Dávid Ferenc), der unitarische Stadtpfarrer von Klausenburg (Kolozsvár, Cluj-Napoca).5 Dávid hatte bereits 1570 mit Palaeologus über die Frage der Gottheit Christi korrespondiert und geriet in den folgenden Jahren immer stärker unter dessen Einfl uß. Es gelang Dávid jedoch nicht, den nonadorantistischen Standpunkt in-nerhalb des entstehenden Kirchentums der siebenbürgischen Unitarier durchzusetzen. In den Jahren 1578 und 1579 wurde Dávids Lehre von unitarischen Synoden verurteilt, er selbst wurde 1579 verhaftet und starb im selben Jahr im Gefängnis.
Trotz der mit der Verurteilung Dávids einsetzenden Maßnahmen gegen den Nona-dorantismus wirkte die Theologie des Palaeologus auch in den folgenden Jahrzehnten im siebenbürgischen Unitarismus nach. Erst nachdem die siebenbürgischen Stände auf dem Landtag von Desch (Dés, Dej) 1638 strenge Maßnahmen zur Bekämpfungen radi-
MS 558), in: Johannes IRMSCHER – Marika MINEEMI (Hrsg.), Ὁ ἑλληνισμὸς εἰς τὸ ἐξωτερικόν. Über Beziehungen des Griechentums zum Ausland in der neueren Zeit, Berlin 1968, S. 35–44; EAD., Traktát Jakuba Paleologa „An omnes ab uno Adam descenderint“ [Der Traktat des Jacobus Palaeologus „An omnes ab uno Adam descenderint“], LF 92, 1969, S. 281–288; EAD., Tři doku-menty k pobytu Jakuba Paleologa v Čechách a na Moravě [Drei Dokumente zum Aufenthalt des Jacobus Palaeologus in Böhmen und Mähren], Strahovská knihovna 5–6, 1970–71, S. 331–360; EAD (Hrsg.), Iacobi Palaeologi Catechesis Christiana dierum duodecim. Editio princeps, Warszawa 1972 (= Biblioteca pisarzy reformacyjnych 8); EAD., K jedné chybně zařazené archiválii (Vložka v listu J. Scribonia A. Brusovi z 22. března 1562 v SÚA Praha) [Zu einer fehlerhaft eingeordneten Archivalie (Die Einlage im Schreiben des J. Scribonius an A. Brus vom 22. März 1562 im Staat-lichen Zentralarchiv Prag)], in: Josef ČEŠKA, Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata, Brno 1976, S. 253–256; EAD., Der Traktat des Jakobus Palaeologus “De anima”. Ein Beitrag zur Diskussion über die Unsterblichkeit der Seele im 16. Jahrhundert, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2, Graecolatina Pragensia 7, 1976 (1980), S. 81–89; EAD., Ein Beitrag zur Diskussion über die Unsterblichkeit der Seele im 16. Jahrhundert (Paleologs Traktat „De anima“), in: Róbert DÁN – Antal PIRNÁT (Hrsg.), Antitrinitarianism in the Second Half of the 16th Century, Budapest – Leiden 1982 (= Studia humanitatis, 5), S. 35–46; EAD., Jacques Paléologue et son idéal tolerantiste d’une seule foi universelle, LF 105, 1982, S. 240–247. Vollständige Bibliographie der Publikationen Růžena Dostálovás bis einschließlich 2008 in: Markéta KULHÁNKOVÁ – Katěřina LOUDOVÁ (Hrsg.), ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ. Růženě Dostálové k narozeninám [Růžena Dostálová zum Geburtstag], Brno 2009, S. 16–36.5 Zu den Impulsen, die von Palaeologus auf den siebenbürgischen Nonadorantismus ausgingen, vgl. Mihály BALÁZS, Early Transylvanian Antitrinitarianism (1566–1571): From Servet to Palaeo-logus, Baden-Baden – Bouxwiller 1996 (= Bibliotheca dissidentium, scripta et studia 7).
10
kaler Strömungen innerhalb des Unitarismus angeordnet hatten, geriet Palaeologus auch in Siebenbürgen in Vergessenheit. In den folgenden beiden Jahrhunderten herrschte in der Siebenbürgischen Unitarischen Kirche (Erdélyi Unitárius Egyház) eine an der so-zinianischen, adorantistischen Lehre orientierte Theologie vor. Diese wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts durch eine rationalistische, vom modernen angelsächsischen Uni-tarismus beeinfl ußte Tendenz abgelöst. Die moderne unitarische Theologie kann nicht in direkter Kontinuität vom Nonadorantismus des 16. und frühen 17. Jahrhunderts ab-geleitet werden, weist aber signifi kante theologische Analogien mit diesem auf. Mit der „nonadorantistischen“ Neuorientierung der Siebenbürgischen Unitarischen Kirche im 19. und 20. Jahrhundert ging die historiographische Rehabilitation der Gestalt Dávids einher, dem seither die Rolle eines Kirchengründers und Märtyrers zugemessen wird.6
In der Konstruktion der modernen unitarischen konfessionellen Erinnerungskultur spielte Palaeologus gegenüber Dávid nur eine nachgeordnete Rolle. Erst durch eine grundlegende Veröff entlichung von Antal Pirnát von 1961 wurde die Existenz der – be-reits von Bohumil Navrátil in extenso exzerpierten – handschriftlichen Werke des Palae o -logus in der Bibliothek des Klausenburger Unitarischen Kollegiums einer breiteren Öff entlichkeit bekannt.7 Zumindest einen Teil dieser Texte hatte Palaeologus bewußt als Beitrag zum Aufbau eines unitarischen Kirchentums in Siebenbürgen verfaßt. So bezeugte er selbst, daß er mit seinen (verlorenen) Institutiones Christianae ein theolo-gisches Handbuch für die entstehende unitarische Kirche schaff en wollte und daß er hoff te, daß das Werk eine entsprechende Bedeutung erlangen würde wie die Institutio Calvins bei den Reformierten.8
Allerdings traten Siebenbürgen und die dortige antitrinitarische Bewegung erst spät in das Bewußtsein des gräko-italienischen Theologen. Als dieser 1572 zum ersten Mal
6 Zu Dávid vgl. Mihály BALÁZS, Ungarländische Antitrinitarier, Bd. IV: Ferenc Dávid, Baden-Baden – Bouxwiller 2008 (= Bibliotheca Dissidentium, Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles, 26); das Nachwirken des Palaeologus ist auch bei mehreren weiteren führenden Theologen der siebenbürgischen unitarischen Kirche deutlich, vgl. die In-dices s.v. „Palaeologus“ zu den Bänden János KALDOS – Mihály BALÁZS, Ungarländische Anti-trinitarier, Bd. II: György Enyedi, Baden-Baden – Bouxwiller 1993 (= Bibliotheca Dissidentium, Répertoire 15); Mihály BALÁZS (Hrsg.), Ungarländische Antitrinitarier, Bd. III: Demeter Hunyadi, Pál Karádi, Máté Toroczkai, György Válaszúti, János Váfalvi Kósa, Baden-Baden – Bouxwiller 2004 (= Bibliotheca Dissidentium, Répertoire 23).7 Vgl. Antal PIRNÁT, Die Ideologie der Siebenbürger Antitrinitarier in den 1570er Jahren, Budapest 1961, S. 54–116, 188–193, 199–206. Die Signaturen der Codices lauten: Cluj, Biblioteca Aca-demiei Romane, MSU 474, 966, 968, 1669; siehe auch: Elemér LAKÓ, The Manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-Napoca, Szeged 1997, Bd. 1, S. 100f, 187–190, 347–352.8 Vgl. Palaeologus’ Äußerung in seinem fi ktiven Dialog Catechesis Christiana (1574): „Quid, si nostrum aliquis cum aliquo ex populo de praescientia Dei, de peccato, de vita aeterna disputare vellet, mutus esset piscis?’ ‚Minime. Habemus Institutiones Christianas ad Lydium lapidem proba-tas, conformes fi dei de Deo, quam tuemur, in his legere quis potest, quid ista ecclesia omnibus de quaestionibus, quae controvertuntur, credat. Illae et evertunt Institutiones Calvini et aliud nihil sunt quam apostolica et vera theologia.“ Růžena DOSTÁLOVÁ (Hrsg.), Iacobi Chii Palaeologi Catechesis Christiana dierum duodecim, Varsoviae 1971 (= Biblioteca pisarzy reformacyjnych 8), S. 110f.
11
Siebenbürgen betrat, war er längst kein unbeschriebenes Blatt mehr, sondern war ein verurteilter Haeresiarch, dessen Lehre bereits seit anderthalb Jahrzehnten die Behörden der Römischen Inquisition beschäftigte. Seit 1557 war er mehrere Male den Gefängnis-sen des Sant’Uffi zio entronnen. Am 5. März 1561 war er in Rom in Abwesenheit als Ket-zer verurteilt worden.9 Während des folgenden Jahrzehnts ließ Palaeologus nichts un-versucht, um eine Aufhebung des Ketzerurteils zu erreichen und so die Voraussetzung für eine Rückkehr nach Chios zu schaff en. Im Januar 1562 tauchte er im französischen Poissy auf, um eine Revision des Urteils durch den dort anwesenden Legaten Ippolito d’Este, Kardinal von Ferrara, zu erwirken. Als sich dies nicht erreichen ließ, ließ er sich überreden, im Mai 1562 nach Trient zu reisen, wo ihm die Überprüfung seiner Angelegenheit in Aussicht gestellt wurde. In Trient konnte sich der exkommunizierte Mönch aufgrund eines Geleitbriefs des Kardinals d’Este bis Herbst 1562 aufhalten. Zur Irritation seiner ‒ teilweise durchaus wohlwollenden ‒ Gesprächspartner weigerte sich Palaeologus, auf das Angebot einer Rekonziliation durch Widerruf oder Gnaden-akt einzugehen, sondern forderte seine volle Rehabilitierung. Als Grund gab er an, es gehe bei der Frage seiner Rechtgläubigkeit nicht allein um das Schicksal seiner Person, sondern auch um das seiner Anhänger in der Levante.10 Als er die Vergeblichkeit sei-
9 1561 III 5, Rom, Siebenundvierzigste Sitzung der Kardinalskongregation der Römischen Inqui-sition: „Fratris Jacobi de Chio ordinis Sancti Dominici in qua re producta citatione ad sententiam per Magistrum Dominum Petrum Belum citati pro hac die et petente concludi et pronuntiari Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Cardinalis Alexandrinus in huiusmodi causa conclusit et pronuntiavit † prout in cedula excommunicationis.“ Città del Vaticano, Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (im folgenden: ACDF), Decreta S.O. 2 (1559–1563), Bl. 61(41)r. Zu Pietro Belo, Fiskal des Sant’Uffi zio, vgl. Vincenzo LAVENIA, Belo, Pietro, in: Adriano PROSPERI (Hrsg.), Dizionario storico dell’Inquisizione, Bd. 1, Pisa 2010, S. 170f; zum Cardinalis Alexandrinus, i.e. Michele Ghislieri (1504–1572, seit 1566 Papst Pius V.), vgl. Simona FECI, Pio V, papa (Michele Antonio Ghislieri), in: Adriano PROSPERI (Hrsg.), Dizionario storico dell’Inquisizione, Bd. 3, Pisa 2010, S. 1213–1215. Die im Sitzungsprotokoll erwähnte cedula excommunicationis wurde als Pla-kat gedruckt, eingefügt ist ein schriftlicher Widerruf des Palaeologus aus der Haft in Genua vom 8. August 1558 mit einer Aufzählung der widerrufenen Lehraussagen: 1561 III 5, Sententia lata contra quendam Jacobum de Chio Apostatam, Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, Urkunden I 3495. Bei dem aufgrund von Notizen Bohumil Navrátils (vgl. oben Anm. 3) aufgefundenen Innsbruk-ker Exemplar des bislang verschollenen Textes handelt es sich vielleicht um dasjenige, welches der Prager Erzbischof Anton Brus im Frühsommer 1563 an die böhmische Regierung in Prag sandte, vgl. 1563 VI 18, Trient, Anton Brus von Müglitz an Erzherzog Ferdinand, Statthalter in Prag, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 5636, Bl. 62r–v, Samuel STEINHERZ (Hrsg.), Briefe des Prager Erzbischofs Anton Brus von Müglitz 1562–1563, Prag 1907, S. 106–109, Nr. 74. Eine Analyse dieser interessanten neuen Quelle folgt im zweiten Teil des vorliegenden Beitrags.10 1562 IX 10, Trient, Schreiben eines unbekannten venezianischen Prälaten: „Fra Jacomo alias di Chio, per quanto fedelmente m’è stato referto, […] ha havuto […] lunghi raggionamenti et discorsi con molti Signori Prelati […] Hor da questi Signori ho inteso lui esser più altiero che mai, superbo, ostinato et maldicente, et con niuna recognitione de gli errori suoi, dando la colpa a malignità di questo et di quello, li quali hanno falsifi cato et accomodato la cosa al’hor modo, et un giorno convinto da le ragioni di questi Signori […] disse queste subsequenti parole: ‚S’io fussi una sol persona, persuaso de le ragioni vostre, forse mi lasciarei ridur al’abiuratione, ma rappresentando altri non bisogna pensarvi.’ […].“ Fra Giacomo fordert Gelegenheit, seine Unschuld zu beweisen. Ginge man jedoch auf die von ihm
12
ner Bemühungen in Trient erkannte, faßte er den Plan, mithilfe seiner Kontakte zu habsburgischen Diplomaten bei nächster Gelegenheit im Gefolge einer habsburgischen Delegation nach Konstantinopel abzureisen und von dort nach Chios zurückzukehren. Zu diesem Zweck wollte er von Trient zunächst nach Wien gehen, änderte dann aber wegen einer Warnung vor der Pest in Wien seinen Reiseweg und traf im Herbst 1562 in Prag ein.11
Auch wenn die Hoff nung auf eine Revision des Ketzerurteils mit der Zeit immer aussichtsloser erscheinen mußte, war Palaeologus auch während seines Aufenthalts in Prag darauf bedacht, sich durch seine Kontakte zu evangelisch gesinnten Utraquisten in Böhmen und zu Protestanten im benachbarten Deutschland nicht in einer Weise zu kompromittieren, die eine Rekonziliation mit der römischen Kirche und eine Rück-kehr nach Chios endgültig ausschließen würde.12 Noch im Sommer 1568, mehr als zwei
geforderten Bedingungen ein, „actum esset da tutte le bande, et massime in Levante egli trionfarià, et le scole segrete havriano quello che desiderano.“ Milano, Biblioteca Ambrosiana (im folgenden: BA), I 141 inf., Bl. 84r–v, hrsg. in Josef ŠUSTA, Die römische Kurie und das Konzil von Trient unter Pius IV. Aktenstücke zur Geschichte des Konzils von Trient, Bd. 3, Wien 1911, S. 11.11 Zu den Umständen, die Palaeologus nach Prag führten, vgl. [1577, Mähren] Palaeologus an Kaiser Rudolf II.: „Cum essem in Graecia, quo veneram ex Italia, contigit anno circiter 1561, ut Reverendissimus et Illustrissimus Alexandrinus Cardinalis me Romae proscriberet pro haeretico […] Quare monitus a mihi carissimis, qui ad me scripserant, quid mihi esset faciendum et ut in Gallias diverterem, ex Graecia in Gallias navigavi. Ibi querelas meas exposui ante Illustrissimum et Rever-endissimum Cardinalem et Principem, Dominum Hippolitum Estensem, legatum a latere Sanctitatis Pii Quarti, et Reverendissimum Dominum Prosperum a Sancta Cruce, nuncium Suae Sanctitatis in Gallia, et accepta fi de publica Parisiis a dicto Illustrissimo Cardinale et literis ex Roma a Sanctitate Pii Quarti Pontifi cis Romani, veni Tridentum ad legatos Concilii Tridentini. Ibi fui per sex ferme menses hospitatus apud legatum Reverendissimi Salsburgensis Archiepiscopi, qui et ipse episcopus erat. Cum autem nihil promovere pro causa mea Tridenti in synodo possem, ut proscriptio illa, qua fueram proscriptus a Cardinale Alexandrino Romae, ut dixi, de iure tolleretur, sed strui mihi insidias intellexissem, accepta venia discedendi a Reverendissimis et Illustrissimis quinque Cardinalibus, le-gatis Concilii Tridentini, cum per Italiam propter pericula reverti in Graeciam non possem, veni cum Illustribus et Magnifi cis Comitibus Lodroniis, Hieronymo et Paride, ex Tridento Lincium eo animo, ut reverterer in Graeciam cum legatis Caesaris Ferdinandi, quos mitti Constantinopolin contigisset. Erat autem pestis Viennae, quare dicti comites hortati sunt me, ut Pragam venirem, ubi erat Caesar, Pragae facturus melius pro negotio meo quam Viennae.“ Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (im folgenden: HHStA), StAbt, Italienische Staaten, Rom Varia 3 (alt 2), Bl. 165–183, dort 165r.12 Seine Lage in Prag beschreibt Palaeologus folgendermaßen: [1563 X, Prag], Palaeologus an Ferdinand I.: Er sitzt in Prag fest. „Si enim ego hinc abeo, ad quos confugiam? Ad hostesne Sanc-tissimi Domini nostri [d.h. zu den Protestanten nach Sachsen]? Apud quos cum fuero, quid aliud fecero, nisi praecidere mihi omnem spem posse componendi [!] litem hanc, quae per totum septen-nium, ex quo coepta est, me divexat, cum his, qui me terra marique petunt?“ Nach Chios könne er ohne kirchliche Rehabilitierung nicht zurückkehren, zu den Protestanten habe er nie gehen wollen, auch wenn ihm dort alle Türen off enstünden, „nec discedere vellem, ut ad meos cives re-verterer, nisi ipsis permittentibus, nec transire ad Summi Pontifi cis hostes (quod nunqum optarim), cum hoc mihi facillimum sit.“ Durch die Nachstellungen der Diplomaten der Kurie ist er in Prag nicht mehr sicher und fürchtet seine Verhaftung. Off enbar will man ihn den Protestanten in die Arme treiben: „Nunc aliud conantur hostes mei, ut fi de publica tuto vivendi et tractandi causam
13
Jahre nach der Besetzung der Insel durch die Türken (Ostern 1566), äußerte er die Absicht, durch eine Rechtfertigungsschrift seine Rehabilitierung zu erreichen, um nach Griechenland zurückkehren zu können.13 Im Frühjahr 1573 konnte Palaeologus von Siebenbürgen aus endlich eine Reise nach Konstantinopel und Chios unternehmen. Die Kreise von Anhängern, die er zwischen 1554 und 1561 in der osmanischen Hauptstadt und auf seiner Heimatinsel aufgebaut hatte, fand er nicht mehr vor. Die Verhältnisse auf Chios hatten sich in den sieben Jahren türkischer Herrschaft in einer für Palaeologus unerträglichen Weise verändert.14 Wenn damit auch die Hoff nung auf eine dauerhafte Rückkehr in die Heimat verloren war, verfolgte Palaeologus weiterhin intensiv die Ent-wicklung in der Levante. Während er sich in den Jahren von 1575 bis zu seiner Verhaf-tung im Dezember 1581 in Mähren aufhielt, suchte er sich durch Schreiben an den böh-mischen Oberstburggrafen Vilém z Rožmberka und an die Kaiser Maximilian II. und Rudolf II. als Türkei-Experte, der über wertvolle Informationen für die habsburgische Türkenpolitik verfüge, anzudienen.15
Soweit die erhaltenen Dokumente Mutmaßungen über die Absichten des Palaeolo-gus erlauben, scheint also der Plan, nach Chios zurückzukehren, in den Prager Jahren eine bestimmende Rolle gespielt zu haben. Gegen Ende seiner Prager Zeit, spätestens 1570,16 trat Palaeologus in den theologischen Diskurs der ostmitteleuropäischen Antitri-
meam sublata cogar transire ad eos, ad quos cum venero, non erit amplius spes res mei componendi posse [!]. Si hic enim manere voluero, sublata fi de, et capiar, quis mihi feret opem? Quis loquetur pro captivo, cum pro libero nullus audeat libere loqui? Si hinc discessero ad illosque transiero et cum illis habitavero, quibus tantum scribere piaculare est, quis amplius de mea iustifi catione aut absolutione loquetur? Quis non dicet esse vera omnia, quae in me in proscriptionis tabula [d.h. der gedruckten Bulla excommunicationis von 1561] coniecta sunt, cum audiet apud illos, illos inquam, me vivere?“ Ibid., Bl. 159r–160v.13 1568 VIII 5, Wien, Melchiorre Biglia, Nuntius am Kaiserhof, an Kardinal Michele Bonelli gen. Alessandrino: „Intendo da persona molto intrinsica del Paleologo, come egli ha deliberato di passarsene in Grecia alle parti sue et che va tuttavia seguitando di scriver il libro che scrive in gius-tifi cation sua, per mostrare al mondo, chi egli sia.“ Torino, Archivio di Stato (im folgenden: ASt), Archivio Alfi eri, Mazzo 59, No. 8/1, Bl. 42r, Ignaz Philipp DENGEL (Hrsg.), Nuntiaturberichte aus Deutschland 1560–1572 nebst ergänzenden Aktenstücken, Bd. 6: Nuntius Biglia 1566 (Juni) – 1569 (Dezember), Commendone als Legat bei Kaiser Maximilian II. 1568 (Oktober) – 1569 (Jänner), Wien 1939 (= Nuntiaturberichte aus Deutschland II 6), S. 131 Anm.14 EPISTOLA IACOBI PALAEOLOGI, DE REBVS CONSTANTINOPOLI ET CHII CVM EO actis, lectu digna. Anno 1573, s. l. 1591 (Exemplar: Praha, Strahovská knihovna, CU III 28), Bl. A2r–B1r.15 1579 IV 28, Hluk, Palaeologus an Vilém z Rožmberka, Třeboň, Státní oblastní archiv, Histo-rica 5034 A; 1581 VI 6, Hluk, ders. an dens., ebd. 5107; hrsg. in DOSTÁLOVÁ, Autografy Jakuba Pa-laeo loga, S. 152–156. ‒ [1576], Palaeologus an Maximilian II., Wien, HHStA, Hungarica 110/3, Bl. 29; [1577], Palaeologus an Rudolf II., ebd., Rom Varia 3 (alt 2), Bl. 165, 177–183. 16 Daß Palaeologus bereits in Prag eine nonadorantistische Christologie vertrat, läßt sich aus dem Brief erschließen, den Franciscus Davidis am 29. XI. 1570 aus Alba Iulia an diesen richtete. Der Text des 1927 beim Brand des Wiener Justizpalastes vernichteten Originals ist (fehlerhaft) abgedruckt in: Karl LANDSTEINER, Jacobus Palaeologus. Ein Studie, mit noch nicht gedruckten Ur-kunden und Briefen aus dem Archive des k.k. Ministeriums des Innern, Wien 1873, S. XXIII. Jahres-bericht über das k.k. Josefstädter Ober-Gymnasium für das Schuljahr 1873, S. 1–54, dort 33f.
14
nitarier ein. Dabei vertrat er von Anfang an sehr eigenständige Positionen, die in ihren theologischen Grundsätzen in den folgenden Jahren konstant bleiben sollten und die in vieler Hinsicht im Widerspruch zu den Auff assungen der zeitgenössischen polnischen und siebenbürgischen Antitrinitarier standen:17 Während die Polen und anfangs auch die Siebenbürger an der Anbetung Christi und an einer solafi deistische Rechtfertigungs-lehre protestantischer Herkunft festhielten, lehnte Palaeologus nicht nur diese beiden entscheidenden Lehrartikel ab, sondern wandte sich auch gegen die von den Polnischen Brüdern praktizierte Taufe der Gläubigen und gegen deren Pazifi smus. Er strebte, trotz seiner Kritik an der Inquisition der römischen Kirche und an der Unduldsamkeit der Protestanten, keinen toleranten religiösen Pluralismus, sondern eine inklusivistische Einheits- und Staatsreligion an.18
Off enbar hatte Palaeologus im Verlauf des knappen Jahrzehnts in Prag gründlich an seinem theologischen System gearbeitet, während er gleichzeitig seine Rückkehr in die Heimat betrieb. Es legt sich die Hypothese nahe, daß zwischen Lebensplanung und the-ologischem Denken des Palaeologus ein Zusammenhang bestand und daß seine Son-derstellung im frühen ostmitteleuropäischen Antrinitarismus dadurch zu erklären sei, daß die Hintergründe und Wirkungsabsichten seiner Theologie nicht in Ostmitteleuro-pa, sondern in der Levante zu suchen seien, seine Lehre sich mithin auf die religiösen, kulturellen und politischen Problemkonstellationen beziehe, denen der Dominikaner Frate Jacobo da Scio zwischen 1554 und 1561 in Konstantinopel und auf Chios begeg-net war. Triff t dieser Interpretationsansatz zu, dann stellt die Rezeption der Lehre des Palaeologus im siebenbürgischen Unitarismus nur die sekundäre, den biographischen Zufällen geschuldete Wirkung eines primär für den Kontext der Levante entworfenen, umfassenden theologisch-politischen Projekts des gräko-italienischen Exulanten dar.
Neue Quellen zum Itinerar des Frate Jacobo da Scio in der Levante 1554–1561
Unter der Überschrift „Itinerar“ soll in diesem Abschnitt ein orientierender narrativer Überblick über die Geschicke des Palaeologus in der Levante in den Jahren 1554–1561 versucht werden, die aufgrund neuer Quellenfunde vollständiger als bisher rekonstru-iert werden können. Es hat übrigens tatsächlich einmal eine tagebuchartige autobiogra-phische Schrift des Palaeologus mit dem Titel „Itinerario“ gegeben, die mindestens bis zum Jahr 1557 zurückreichte und in der Palaeologus unter anderem berichtete, wie er im Laufe des Lebens sechs oder sieben Mal aus dem Gefängnis gefl ohen sei. Sie wurde im Dezember 1581 bei der Verhaftung des Palaeologus mit weiteren seiner Schriften im
17 Zum theologischen System des Palaeologus sei hier lediglich auf die beiden älteren zusam-menfassenden Darstellungen hingewiesen: PIRNÁT, Die Ideologie der siebenbürgischen Antitrinita-rier, S. 54–134; SZCZUCKI, W kręgu myślicieli heretyckich, S. 83–121 (italienische Fassung: Lech SZCZUCKI, Le dottrine ereticali di Giacomo da Chio Paleologo, Rinascimento 22, 1971 [erschienen 1973], S. 27–75). Der Frage, inwiefern die Genese von Palaeologus’ radikalem Unitarismus bis in die Zeit vor 1561 zurückverfolgt werden kann, wird im zweiten Teil des vorliegenden Beitrags nachgegangen.18 Anders akzentuiert DOSTÁLOVÁ, Jacques Paléologue et son idéal tolerantiste.
15
mährischen Hluk beschlagnahmt und gelangte im März 1582 in Wien in die Hände des apostolischen Nuntius Giovanni Francesco Bonomini, der umgehend eine Abschrift anfertigen und an das Sant’Uffi zio nach Rom senden ließ.19 Dorthin gelangten im Som-mer 1582 auch die konfi szierten Originalhandschriften der Werke des Palaeologus. Alle diese Schriften wurden nach der Hinrichtung des Palaeologus am 23. März 1585 zu-sammen mit dessen Leiche auf dem Campo de’ Fiori in Rom verbrannt.20 Ebenfalls verloren sind die Palaeologus betreff enden Akten der Inquisitionstribunale von Ferrara (Sommer 1557), Genua (September 1557 bis Oktober 1558) und Rom (Dezember 1558 bis August 1559 und Sommer 1582 bis Anfang 1585). Ebensowenig sind aus dem in Frage kommenden Zeitraum Archivalien der Dominikanerkonvente von Pera (Konstan-tinopel) und Chios überliefert. Lediglich in einem der Registerbücher im römischen Zentralarchiv des Ordens fi ndet sich die knappe Notiz, daß Frater Iacobus de Chio am 1. Juli 1545 zum Besuch des Ordensstudiums von Bologna freigestellt wurde.21
Für die Rekonstruktion der Biographie des Palaeologus vor der Ankunft in Poissy im Januar 1562 standen daher den Biographen bisher nur die ‒ apologetisch verschlei-ernden ‒ Angaben zur Verfügung, die Palaeologus selbst in einigen seiner 1571–1581 entstandenen Schriften22 und in seinen von Karl Landsteiner (1873) und Gerhard Rill (1963) entdeckten Briefen aus den Jahren 1562–158123 machte, ferner die Korrespon-
19 1582 III 20, Wien, Giovanni Francesco Bonomini, Nuntius am Kaiserhof, an Kardinal Tolo-meo Gallio gen. Como in Rom: „Hò procurato co’l vescovo di Vienna di haver qualche copia di libri et scritti di quello sciagurato, ma Soa Signoria mi ha pregato ad aspettare al quanto sin che se ne sia fatta relatione all’Imperatore, che poi mi communicarà ogni cosa. In tanto mi ha dato l’Itinerario, è com’un diario di questo tristo, ma come sotto sigillo di segreto, del quale però ho fatto cavar subito copia, et la mando qui alligata, qual credo non sarà discara di vedere à Vostra Signoria Illustrissima et alli Illustrissimmi del Santo Offi cio.“ Archivio Segreto Vaticano (im folgenden: ASV), Segretaria di Stato, Germania 104, Bl. 88v–89v, dort Bl. 89v. ‒ 1582 V [22–27], Wien, Cesare dell’Arena, Sekretär der Nuntiatur am Kaiserhof, an Bonomini: „[…] egli è huomo sagacissimo et […] com Vos-tra Signoria Illustrissima può haver visto nel suo Itinerario, è sei o sette volte scampato di pregione“. Ebd., Bl. 126r–127v, dort Bl. 126v.20 1585 III 23, Rom, Journal der mit der Delinquentenseelsorge betrauten Confraternità di S. Gio-vanni Decollato: „La mattina il corpo del sopradetto Jacobo con molte sue scritture furno portati dalli ministri dela giustitia sula Piazza di Campo di Fiore et ivi abruciati.“ Roma, ASt, Confraternità di S. Giovanni Decollato, b. 6, Reg. 12, Libro del Provveditore, 1581–1585, Bl. 186r.21 1545 VII 1, Regesta actorum procuratorum ac vicariorum OP: „F. Iacobus de Chio per patentes removetur de quacuncque assignatione pro studio in conventu Bononiensi.“ Rom, Archivium Gene-rale Ordinis Praedicatorum, IV 28, Bl. 45v.22 Vgl. oben, Anm. 7, ferner die Handschrift Bern, Burgerbibliothek, MS 558, deren autobiogra-phische Nachrichten bei DOSTÁLOVÁ, Eine neu gefundene Schrift, zusammengestellt sind.23 Die von LANDSTEINER, Jacobus Palaeologus, S. 33–54, veröff enlichten Briefe befanden sich in Wien im Archiv des Ministeriums des Innern und wurden 1927 beim Brand des Wiener Justiz-palastes vernichtet; die von Landsteiner mit zahlreichen Fehlern abgedruckten Texte liegen Verf. auch in einer von Massimo Firpo sorgfältig emendierten Textfassung als Typoskript vor. Weitere, von RILL, Jacobus Palaeologus, und SZCZUCKI, Jakub z Chios-Paleolog, ausgewertete Briefe des Palaeologus befi nden sich in Wien, HHStA, Hungarica 110, Konv. C; Hungarica 111, Konv. B; Polonica 13/8; Rom Varia 3 (alt 2). Dazu kommen die von DOSTÁLOVÁ, Autografy Jakuba Pa-laeologa, edierten Briefe in Třeboň, Státní oblastní archiv, Historica; ferner ein von Antonio
16
denz zwischen dem römischen Inquisitor Michele Ghislieri (seit 1566 Papst Pius V.) und kirchlichen und weltlichen Stellen in Genua aus den Jahren 1557–1562,24 der im Staats-archiv Genua überlieferte, teilweise von Philip Pantelis Argenti (1941) veröff entlichte Briefverkehr zwischen den Behörden auf Chios und der Regierung in Genua aus den Jahren 1555–156625, ein Protokoll des Inquisitionsgerichts in Venedig von November und Dezember 1558 mit Zeugenaussagen über die Durchreise des Palaeologus durch die Lagunenstadt26 und schließlich einige von Massimo Firpo entdeckte Schreiben des Ludovico Beccadelli, Bischofs von Ragusa, vom Dezember 1558 und Frühjahr 1559.27 Die meisten dieser Dokumente wurden bereits von Szczucki (1966) sorgfältig ausge-wertet.28 Weitere, von Szczucki nicht berücksichtigte Quellen machte Massimo Firpo Anfang der 1970er Jahre bei seinen ausgedehnten Archivrecherchen zur Biographie des Palaeologus ausfi ndig, wertete jedoch nur einen kleinen Teil dieser Dokumente in Publikationen aus.29
Zu einer bedeutenden Erweiterung der Quellenbasis für die Rekonstruktion der Geschicke des Palaeologus in der Levante führte die Öff nung der Aktenbestände der Römischen Inquisition im Archiv der Glaubenskongregation (Città del Vaticano, Archi-vio della Congregazione per la Dottrina della Fede) für die Forschung im Jahr 1998. Dort befi ndet sich ein Faszikel von Briefen aus dem östlichen Mittelmeerraum an das Sant’Uffi zio in Rom, der neben zahlreichen anderen Schriftstücken 35 Briefe von In-quisitoren und anderen kirchlichen Amtsträgern aus Chios, Pera und Ragusa aus den Jahren 1557–1562 enthält, die mehr oder weniger ausführlich über Jacobo da Scio und dessen Anhänger in der Levante berichten. Die Adressaten der Texte sind Michele Ghislieri und der Inquisitionskommissar Thomas Scoto. Schreiben des Sant’Uffi zio an
ROTONDÒ, Studi e ricerche di storia ereticale italiana del Cinquecento, Torino 1974, S. 493–495, veröff entlichtes Schreiben aus dem ASt di Modena, Regolari, Cassetta 87. Die übrigen, verstreut überlieferten Überreste der Korrespondenz des Palaeologus enthalten keine die Jahre 1554–1561 betreff enden biographischen Nachrichten.24 Sammlung von Schreiben Ghislieris (off enbar aus dem Bestand des Sant’Uffi zio in Genua stammend): Genova, Biblioteca Universitaria (BU), E. VII. 15; weitere relevante Schreiben von und an Ghislieri: Genova, Ast, Archivio Segreto, b. 1401; b. 1406 A; b. 2799; b. 2831.25 Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B; hrsg. in Philip Pantelis ARGENTI, Chius Vincta, or The Occupation of Chios by the Turks (1566) & their Administration of the Island (1566–1912), De-scribed in Contemporary Diplomatic Reports and Offi cial Dispatches, Cambridge 1941, S. 54–117. Weitere relevante Schriftstüc ke befi nden sich ebd., Archivio Segreto, b. 2169; b. 2774 A; Senato-Senarega, b. 1283 (festgestellt von Massimo Firpo).26 Venezia, ASt, Sant’Uffi zio, b. 14, fasc. proc. 14 (Fra Giacomo da Scio).27 Parma, Biblioteca Palatina, Fondo Palatino, MS 1010, vgl. die Einleitung zu: Juliusz DOMAŃSKI – Lech SZCZUCKI (Hrsg.), Iacobus Palaeologus, Disputatio Scholastica, Utrecht 1994 (= Bibliothe-ca Unitariorum 3), IX Anm. 2.28 Vgl. SZCZUCKI, Jakub z Chios-Paleolog (I).29 Vgl. Massimo FIRPO, Antitrinitari nell’Europa orientale del ’500. Nuovi testi di Szymon Budny, Niccolò Paruta e Iacopo Paleologo, Firenze 1977. Firpos unveröff entichte Materialsammlung ent-hält in Reproduktionen und maschinenschriftlichen Transkriptionen umfangreiche Vorarbeiten zu einer Gesamtausgabe der Schriften des Palaeologus und der zeitgenössischen Testimonia. Die Sammlung gelangte im Frühjahr 2012 als Schenkung an das Theologische Seminar Elstal.
17
die Inquisitoren in Chios und Pera sind nicht erhalten.30 Diese neuen Quellen wur-den erstmals von Elena Bonora (2007) in einer Monographie über den Häresieprozeß des letzten lateinischen Erzbischofs von Zypern vor der türkischen Eroberung, Filippo Mocenigo,31 und von Simona Feci (2008) in einer Studie über die Einführung der Rö-mischen Inquisition auf Chios32 ausgewertet.
Nimmt man die bisher bekannten und die neu erschlossenen Nachrichten zusam-men, läßt sich folgendes „Itinerar“ des Palaeologus bis zum Winter 1561/62 rekon-struieren: Auf Chios als Sohn eines Griechen mit dem Familien- oder Berufsnamen Ma xi laras (griech. μαξιλαρᾶς, „Kissenmacher“)33 und einer Italienerin geboren, erhielt Ja co bo nach seinem Eintritt in den Orden die Anfangsgründe der wissenschaftlichen Aus bildung und ging dann zum Studium nach Italien nach Bologna34 und Ferrara35. Bereits damals soll er, wie ein ebenfalls aus Chios stammender Ordensmann später berichtete, als theologischer Querulant aufgefallen sein, der sich allzu freimütig über die vielen von ihm gelesenen theologischen Autoren, katholische wie häretische, äu-ßerte, wobei er an allen katholischen etwas auszusetzen hatte, insbesondere daß sie nicht der Heiligen Schrift gemäß seien.36 Aus Italien in die Levante zurückgekehrt, ge-hörte Fra Jacobo 1554 oder 1555 dem Dominikanerkonvent SS. Pietro e Paolo in Pera an, denn im Dezember 1558 gab ein Zeuge vor der Inquisition in Venedig an, er habe vor drei oder vier Jahren Lateinunterricht bei Fra Jacobo im Kloster in Pera genom-
30 ACDF, Fondo Santo Offi cio, Stanza storica, Q3b, Lettere di vescovi della Dalmazia e del Medio Oriente, 1557–1629 (St. st., Q3b).31 Vgl. Elena BONORA, Giudicare i vescovi. La defi nizione dei poteri nella Chiesa postridentina, Roma – Bari 2007, S. 13–26.32 Vgl. Simona FECI, „Su le estreme sponde del christianesimo“. L’isola di Chio, la Repubblica di Genova e l’inquisi zione romana alla metà del Cinquecento, in: Carlo LONGO (Hrsg.), Praedica-tores, inquisitores III: I domenicani e l’inquisizione romana. Atti del III seminario internazionale su „I domenicani el l’inquisizione”, 15–18 febbraio 2006, Roma 2008 (= Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum Romae, Dissertationes Historicae, 33), S. 131–204.33 Zu Lebzeiten Jacobos ist dieser Name an zwei Stellen bezeugt: 1562 III 18, Chios, Giovanni de Baro OP, Prior des Dominikanerkonvents von Chios, an Thomas Scoto OP, Kommissar des Sant’Uffi zio in Rom: „fra Jacomo di Sio Maxillara”. ACDF, St.st., Q3b, Bl. 186r. ‒ 1562 I 24, Poissy, Prospero Santa Croce, Nuntius in Frankreich, an Kardinal Carlo Borromeo: „fra Jacomo Chio Paleologo chiamato per sopranome Mascellara”. ASV, Fondo Pio 62, Bl. 60r; Segr. Stato, Nunziature diverse 274 I, Bl. 91r, hrsg. in ŠUSTA, Die römische Kurie, Bd. 2, S. 382. Zur Deutung des Namens vgl. DOSTÁLOVÁ, Eine neu gefundene Schrift, S. 35.34 Vgl. oben Anm. 21.35 1562 VI 8, Trient, Palaeologus an Fürst Alfonso II. d’Este: „All’ultimo conchiusi di chiedere il salvocondotto da Vostra Eccelenza di poter stare in Ferrara […] sarò contento che almeno ritruoverò porto di salute in quella città a cui debbo tutti li miei studi, che in quella consonsi tutta la mia giova-nile età.“ Hrsg. in ROTONDÒ, Studi e ricerche, S. 494f. 36 1561 V 23, Genova, Angelo Giustiniani Garibaldo da Chio OFM Oss. an Michele Ghislieri: „[…] a punto nel primo nostro congresso quando prima li parlai e lo vidi fare raggionando da novi scrittori cossì catholici come heretici mi dede fastidio et non poca ammiratione perché pareva che nesun de nostri li sodisfacessi et ad ogniuno trovava qualche gran deff etto e massime che non si fon-dassero nella scrittura secondo lui.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 165r–166v.
18
men.37 Aus Pera siedelte er (spätestens im Spätsommer 1555) nach Chios über, wobei er von einem seiner in Pera gewonnenen Anhänger, Giovanni Battista Zeff o, General-kommissar des Minoritenordens für den Orient, begleitet wurde. Zeff o kehrte erst nach fünf oder sechs Monaten aus Chios nach Pera zurück.38
In der Stadt Chios wirkte Fra Jacobo als Lektor, vielleicht auch als Prior39 des Do-minikanerkonvents und erfreute sich großer Popularität als Prediger. Bereits kurz nach seiner Ankunft wurde er in einen Konfl ikt zwischen den beiden genuesischen Kommis-saren Giovanni Battista Gentile und Baldassare Giustiniani, die zu dieser Zeit das va-kante Amt des Podestà der Insel vertraten, und dem Bischof von Chios, Paolo Fieschi, hineingezogen.40 Der Bischof hatte 1555 seine Kompetenzen überschritten und in die Zuständigkeit der weltlichen Obrigkeit eingegriff en, indem er eine Streitsache zwischen zwei Juden vor einem kirchlichen Gericht zugelassen hatte (Gegenstand des Prozesses war ein Streit darüber, welchem der beiden das Vorrecht zustehe, in der Synagoge als Vorbeter zu singen41). Die Kommissare gingen im Namen der Republik gegen die Usur-
37 1558 XII 10, Venedig, Zeugenaussage des Piero di Pare vor der Inquisition: „Interrogato se cognosce un fra Jacomo da Scio respondit: ‚Sior sì.‘ Interrogatus de che ordine è fra Jacomo, come el conosce et da quanto tempo in qua respondit: ‚È de l’ordine de San Domenico, l’ò conossuto in Pera in el monasterio de San Piero in Pera per via de un fra Savoya et non mi ricordo de che ordine et me lo havea proposto aziò che mi insegnasse lettere et puol esser da tre in 4 anni in circa.‘ […] Interrogatus in quel tempo che è stato suo preceptore che doctrina li insegnava respondit: ‚Mi insegnava gramatica et Cicerone,‘ et interrogatus respondit: ‚De le cose de la fede non me ne parlava niente.‘“ Venezia, ASt, Sant’Uffi zio, b. 14, fasc. proc. 14 (Fra Giacomo da Scio). In den von Bohumil Navrátil in extenso exzerpierten Einträgen zu den Dominikanerkonventen von Pera und Chios der Regesta actorum procuratorum ac vicariorum des Generalarchivs des Ordens (Rom, Archivio Generale dell’Ordine dei Predicatori, IV.21–31, IV.34) fi nden sich keine Angaben über Jacobos Aufenthalt in Pera, vgl. die Abschriften in Brno, MZA, G 57, Karton ohne Nummer, Faszikel „Paleolog“.38 1559 X 13, Chios, Antonio Giustiniani OP, Inquisitor von Chios, an Michele Ghislieri, ACDF, St. st., Q3b, Bl. 34r–v; zu der im Original schwer lesbaren Stelle vgl. FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 184.39 In den Schreiben der weltlichen Behörden wird Frate Jacobo wiederholt als Prior bezeichnet, vgl. 1555 X 18 – XI 12, Chios, Giovanni Battista Gentile und Baldassare Giustiniani, Kommis-sare in Chios, an Doge und Governatori der Republik Genua: il priore e lettor de Santo Dominico, fra Jacobo de Sio, Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B, hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 56–64, Nr. 24, dort S. 60; 1556 III 27, Chios, dies. an dies.: fra Jacobo da Scio, priore e lettore del convento de Santo Dominico, ebd., Senato-Senarega, b. 1283. Dies scheint jedoch ein Mißver-ständnis zu sein, denn in anderen Dokumenten wird 1555/56 Paolo da Medole (de Medulis) als Prior des Dominikanerkonvents von Chios erwähnt, vgl. FECI, Su le estreme sponde del christia-nesimo, S. 140.40 Zum folgenden vgl. ARGENTI, Chius Vincta, S. lxxii–lxxxvi; FECI, Su le estreme sponde del chris-tianesimo, S. 136–144. Zu Paolo Fieschi, Bischof von Chios 1550–1560, vgl. Philip Pantelis AR-GENTI, Diplomatic Archive of Chios, 1577–1841, Bd. 2, Cambridge 1954, S. 840 (Abdruck einer handschriftlich überlieferten Kurzvita Fieschis aus dem 17. Jh.); FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 137.41 1558 V 11, Chios, Baldassare Giustiniani, Kommissar in Chios, an Doge und Governatori der Republik Genua, Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B, hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 71–76, dort S. 72.
19
pation der zivilen Rechtsprechung durch den Bischof vor, indem sie im Oktober 1555 eine Zusammenkunft von Vertretern des bischöfl ichen Gerichts, der Mahona und wei-teren Rechtskundigen einberiefen. Bei der erregten Auseinandersetzung trat Frate Ja-cobo, Lektor des Dominikanerkonvents, als Wortführer für den Standpunkt der beiden Kommissare auf, dagegen wurde die bischöfl iche Partei von den Franziskanern und dem Anwalt der Mahona unterstützt. Nachdem die Verhandlung ohne Ergebnis ange-brochen worden war, beschuldigte die bischöfl iche Partei mit der Hilfe des Inquisitors von Chios, Antonio Giustiniani OP, die beiden Kommissare und ihre Unterstützer der Häresie.42
Der adlige Dominikaner Antonio Giustiniani43, der vom Sant’Uffi zio mit der schwie-rigen Aufgabe betraut worden war, auf Chios die Römische Inquisition einzuführen, galt auf der Insel selbst bei den Gegnern des Frate Jacobo als inkompetent.44 Dazu kam, daß seine Tätigkeit von den weltlichen Behörden nicht oder nur zögerlich mit dem „weltlichen Arm“ unterstützt wurde, sondern tendenziell als störende Neuerung und zusätzliche Destabilisierung der ohnehin komplizierten administrativen Strukturen der Insel wahrgenommen wurde. Die Kommissare klagten gegenüber der Regierung in Genua, der Inquisitor habe alles durcheinandergebracht und danach getrachtet, nicht nur lateinische Christen, sondern auch orthodoxe Griechen, Juden, wen immer er wol-le, einzukerkern, zu foltern und zu verurteilen und das Eigentum der Einwohner der Insel zu konfi szieren, ohne dafür von der Regierung in Genua bevollmächtigt zu sein.45
42 1555 X 18 – XI 12, Chios, Giovanni Battista Gentile und Baldassare Giustiniani an Doge und Governatori der Republik Genua: Nachdem die Vertreter der bischöfl ichen Partei ein Schreiben des Bischofs verlesen hatten, „gli risposse il priore e lettor de Santo Dominico, fra Jacobo de Sio, che, se il vescovo haveva scritto tale cosa, doveva essere perchè non era stato dritamente informato del caso, pensava che haria detto altramente, e manteneria con asai bone ragioni che la cosa spettava al foro nostro. Di tale sententia erano tutti li altri frati del suo convento; prese in questo lo Gioanbattista Morrone, advocato delli Mahonesi, il quale publicamente dice essere venuto per advocare la parte della chiesa, e cominciò con certi argumenti a uscire fuora delli termini, alligando il Corsetto [Anto-nio Corsetto (1489–1501), juristischer Handbuchautor] e certi altri suoi dottori, e così venne con il detto lettore in alchuni contrasti dicendo che lui era dottor laureato, e che il padre lettore non era stato adottorato, e altre pazie.“ Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B, hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 56–64, Nr. 24, dort S. 60.43 Zu Antonio Giustiniani (1505/07–1571, seit 1562 Bischof von Naxos) vgl. FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 142, 204.44 1562 III 18, Chios, Giovanni de Baro OP, Prior des Dominikanerkonvents von Chios, an Thomas Scoto: „Non mai lui [Antonio Giustiniani] sarrà huomo di far cosa che voglia, essendo iresolutissimo e senza judicio, et quantumque sia nato nobile, egli è di vilissimo animo.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 186r–v, 204v.45 1558 V 11, Chios, Baldassare Giustiniani an Doge und Governatori der Republik Genua: „Se era inquisitore con tanta bailia come dice che haveva, perché era venuto senza niun ordine di Vostre Illustrissime Signorie? Era raggionevole che dovesse incarcerare, tormentare, condennare greci et iudei et chi gli piacesse, sì como s’avantava voler fare, in terre vostre senza vostre patenti? Doveva con-fi scare li beni di vostri suditi, como si preparava fare, senza ne far pur un moto a Vostre Signorie, et, non havendo bailia da quelle, come intendeva poner tutta la terra sotosopra?“ Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B, hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 71–76, dort S. 72.
20
Um die Autorität der weltlichen Obrigkeit gegenüber dem Inquisitor zu wahren und um ihrer angedrohten Exkommunikation zuvorzukommen, erklärten die Kommissare, wie bereits im Oktober 1555 angedroht, Antonio Giustiniani und drei Franziskanerpatres von der Partei des Bischofs im Frühjahr 1557 für vogelfrei und verbannten sie von der Insel.
Die Franziskaner begannen nach der turbulenten Konsultation vom Oktober 1555, Frate Jacobo als Ketzer zu verleumden und untergruben auf diese Weise auch die Auto-rität der beiden Kommissare. Diese sahen sich daher veranlaßt, Jacobo im März 1556 in einem Schreiben an die Regierung in Genua das Zeugnis auszustellen, er zeichne sich ebenso durch seine Gelehrsamkeit wie durch seine vorbildliche Frömmigkeit aus und habe weder in Pera noch in Chios irgendwelche Irrlehren gepredigt. Urheber der Ver-leumdungen sei der Franziskaner, der als Bevollmächtigter des Bischofs im Streit über die Jurisdiktion in der Angelegenheit des jüdischen Klägers mit Jacobo aneinanderge-raten war.46 Das Sant’Uffi zio in Rom und sogar Papst Paul IV. persönlich reagierten auf die eingehenden Nachrichten, daß nunmehr auch der äußerste Vorposten der Chri-stenheit im östlichen Mittelmeerraum von der Häresie infi ziert sei, mit höchster Be-
46 1556 III 27, Chios, Giovanni Battista Gentile und Baldassare Giustiniani an Doge und Gover-natori der Republik Genua: „Et per il fare cognoscere a Vostra Signoria che essi agenti non studiano ad altro, salvo quanto ponno a tenderci insidie, intendiamo che chostì appresso il vescovo di questo loco habbino molto calunniato fra Jacobo da Scio, priore e lettore del convento de Santo Dominico, dicendo che habbi predicato dottrina heretica et non buona, e questo non procede da altro eccetto dal-la malignità de un certo Raff aello dalla Questa, commessario pur di esso vescovo, persona tanto piena de ambitione e sensualità quanto altra persona che habbiamo forse mai cognosciuto, e per l’odio che egli ha concitato vedendolo che, quando è occorso, ha diff eso, per quanto ricerca la giustitia, la aut-horità e giurisditione di questo magistrato e di quella Illustrissima Signoria, e specialmente sopra la causa del giudeo; et perciò, non pottendosene vendicare altramente, cerca de farlo con calunnie, e de questo ne pare che non solum ne venirebbe carico al detto fratte, ma, se fusi la verità, molto magiore sarebbe sopra di noi quali, tenendo il loco che tegniamo, dovesimo comportare che sia predicata dottri-na non christiana. Il che è falsissimo perchè, ultra che il detto predicatore è persona e molto dotta et essemplare et da pottere comparere et a paragon de qual si voglia altro predicatore in qual si voglia famossa cità de christiani, non ha mai predicato eccetto dottrina evangelica e christianissima, né ha detto cosa senza la aprobatione della Sacra Scrittura, et piacesi a Dio che chostì et in ogni altro loco di christiani fusino sempre tali predicatori, perché tegniamo per certo che non se ne potrià aspettare salvo bonissimi frutti. Ma come che li detti fratti socolanti che sono adeso qui tutti ignoranti et non hanno huomo che sappi pur legere lo evangelio, vedendo che costui ha predicato e letto in satisfatione de tutta la cità, ne moreno de invidia et con poco zelo dello honor di Dio, et questa è la pura verità […] Et perché anche Vostre Signorie si posino avedere in che modo sia stato calunniato il detto predicatore, non essendogli bastato l’animo di calunniarlo de cose che ha predicato qui, parendogli che qui non se gli basteria a oscurare la verità delle sue prediche e della sua dottrina, perché vi seriano testimonii asai, quali farebeno fede di essa verità, lo hanno imputato de cose che ha detto in Pera, non ostante che quelli medesimi articuli che ha predicato in detto loco di Pera gli ha tutti reiterati qui; ma hanno fatto questo perché non se gli possa così apurare la loro iniquità, e con testimonii mendicati e ignoran-ti, li quali siamo certi che non sapino nè quello che hanno testifi cato, nè quello che si vogliano dire, nè anche che cosa sia evangelio, ma, se accadesi, esso predicatore in ogni loco dove serà lo tegniamo per persona quale si saperà ben defendere e dare bon conto della dottrina sua e che haverà poca paura de’ falsi calunniatori.“ Genova, ASt, Senato-Senarega, b. 1283 (Materialsammlung Massimo Firpo).
21
sorgnis.47 Obwohl die Staatsraison für eine Verteidigung der Kompetenz der weltlichen Obrigkeit gegen die Anmaßung des Bischofs sprechen mußte, scheute die Regierung in Genua einen Konfl ikt mit der Kurie48 und mißbilligte das Vorgehen ihrer Kommissare. Im Laufe des Jahres 1556 ließ sie auf Betreiben des Sant’Uffi zio in Rom einen Haftbe-fehl gegen den „abtrünnigen Dominikaner“, d.h. Jacobo, nach Chios ausgehen.49 Als der Kommissar Giovanni Battista Gentile im Herbst 1557 nach Ablauf seiner Amtszeit nach Genua zurückkehrte, wurde er dort verhaftet.50 Obwohl sein ehemaliger Amtskol-lege Baldassare Giustiniani gegenüber der Regierung in Genua beteuerte, die angebliche lutherische Häresie der beiden Kommissare sei in Wirklichkeit nichts anderes als ihre Loyalität gegenüber der Republik,51 ließ die Regierung es zu, daß Gentile von der Inqui-sition zum öff entlichen Widerruf seiner angeblichen häretischen Meinungen verurteilt
47 Vgl. die folgenden (allerdings erst nach der Verhaftung des Frate Jacobo und des nach Ablauf seiner Amtszeit in die Mutterstadt zurückgekehrten Kommissars Giovanni Battista Gentile ver-faßten) Schreiben: 1557 XI 11, Rom, Michele Ghislieri an die Protettori della Santa Inquisizione in Genua: „Perché la causa di fra Giacomo di Syo et di messer Gian Battista Gentili patisce per molti degni rispetti qualche dilatione di tempo all’espeditione, et massime che da quella depende una larga notitia di molti paesi infetti di pestifero veneno di heresie et massimamente dell’isola di Syo, che con qualche tempo si paleserà, le Signorie Vostre voglino avertire di non accelerarla, ma che si procedi maturamente“, Genova, BU, E. VII. 15, Bl. 80r. ‒ 1557 XI 11, Rom, ders. an Girolamo de’ Franchi OP: „La causa di fra Giacomo da Syo et di messer Giovan Battista Gentile è molto a cuore a Sua San-tità et a questi altri mei Signori Illustrissimi et Reverendissimi della Congregatione […]“ Mahnt zu einem langsamen und umsichtigen Vorgehen, „[…] atteso che con tale tardità si potranno scoprire infi niti mali che hanno ammorbati varii paesi et particolarmente l’isola di Syo.“ Ebd., Bl. 82r.48 Zum Verhältnis Genuas zur Kurie und zur Tätigkeit der Römischen Inquisition in der Republik vgl. Michele ROSI, La Riforma religiosa in Liguria e l’eretico Umbro Bartolomeo Bartoccio. Ricerche storiche condotte dall’apparire dell’eresia in Liguria nella prima metà del secolo XVI all’anno 1567, Atti della Società Ligure di Storia Patria 24, 1892, S. 555–726; ID., Storia delle relazioni fra la Re-pubblica di Genova e la Chiesa romana specialmente considerate in rapporto alla Riforma religiosa, Atti della Reale Accademia dei Lincei. Memorie della classe di Scienze Morali, Storiche e Filo-logiche V/6, 1899, S. 170–231; Carlo BRIZZOLARI, L’Inquisizione A Genova e in Liguria, Genova [1974], S. 15–24; Salvatore CAPONETTO, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, Torino 19972, S. 378–384; Romano CANOSA, Storia dell’Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fi ne del Settecento, Bd. 3: Torino e Genova, Roma 2002, S. 131–155.49 Vgl. FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 143 (verweist auf Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 1401, fasc. 10, wo das betreff ende Dokument allerdings im März 2012 von Verf. nicht aufgefunden werden konnte). Das Sant’Uffi zio in Rom bestätigte im Herbst 1556 den Eingang zweier Berichte über die Lage auf Chios: 1556 XI 7, Rom, Michele Ghislieri an Girolamo de’ Franchi OP, Inquisitor in Genua: „Per due di Vostra Reverentia di XVI et XXVIII del passato ho visto quanto ella mi scrive circa la lettera che ha ricevuto in risposta da la isola di Sio, et ho anche inteso per lo sumario mandatomi il tenor di essa et l’altre particolarità che mi avisa, a che rispondo, che di tutto parlerò co’l Reverendissimo P. Generale, co’l quale già cominciai, ma fossemo interrotti et impediti.“ Genova, BU, E. VII. 15, Bl. 68r.50 Zur Haft von Frate Jacobo und Giovanni Battista Gentile in Genova vgl. oben, Anm. 47, und FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 145.51 1558 V 11, Chios, Baldassare Giustiniani, Kommissar der Republik Genua, an Doge und Go-vernatori der Republik Genua: „Come può dire che siamo heretici o lutherani? […] L’offi cio, l’offi cio
22
wurde.52 Im April 1558 erhielt der neue Podestà Giovanni Battista Giustiniani den Be-fehl, den Inquisitor wieder auf die Insel zuzulassen.53
Um einer Verhaftung zuvorzukommen, wich Frate Jacobo spätestens im Frühjahr 1557 nach Konstantinopel aus und schiff te sich dort im April 1557 mit der fi nanziellen Unterstützung des habsburgischen Diplomaten Antonio Veranzio (Verancsics), Bischof von Fünfkirchen,54 nach Ancona55 ein. Im Juni 1557 hielt er sich in Venedig auf.56 Wie Palaeologus selbst später berichtete, stellte er sich, mit Empfehlungsbriefen der in Kon-
è il lutheranismo in noi, il zelo della dignità e maiestà vostra, et la defensione del vostro imperio sono l’heresie nostre.“ Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B, hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 71–76, dort S. 71 und 76.52 Die Anordnung der Inquisition in Genua, den Widerruf des Giovanni Battista Gentile öf-fentlich auf den Kanzeln von Chios zu verlesen, stieß bei den dortigen Dominikanern auf Wi-derstand, vgl. 1559 II 8, Chios, Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri: „Il predicatore frate Antonino da Chio ha recusato di fare la predica per publicar’ l’abiuratione di Giovanbatista Gentile per non farsi de li inimici.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 32r–v, 64r–v, 65r, 66v.53 1558 IV 2, Genua, Doge und Governatori der Republik Genua an Giovanni Battista Giustini-ani, Podestà von Chios, und Gubernatores Mahonae in Chios: Befehlen die Wiederzulassung des Inquisitors und der verbannten Ordensleute, Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B, hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 68f, Nr. 26; 1558 IV, Rom, Papst Paul IV., Breve an Podestà und Gu-bernatores Mahonae in Chios: Befi ehlt die Wiederzulassung des Inquisitors auf die Insel, ASV, Armadio XLIV, t. 2, Bl. 177r–v; 1558 IV 2; ders., Breve an Doge und Governatori der Republik Genua in derselben Sache, ebd., Bl. 178r–v; 1558 IV 20, Genua, Doge und Governatori der Re-publik Genua an Giovanni Battista Giustiniani, Podestà von Chios, und Gubernatores Mahonae in Chios: Haben das Breve Pauls IV. erhalten und befehlen der Obrigkeit in Chios, die Tätigkeit der Inquisition gemäß der beiliegenden, vom Inquisitor von Genua verfaßten Vorschriften zu unterstützen, Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B und b. 1401 fasc. 116 (Kopie), hrsg. in ARGENTI, Chius vincta, S. 69f, Nr. 27; 1558 IV 20, Genua, Girolamo DE’ FRANCHI OP, Inquisitor in Genua, Relatione di quello si osserva nel tribunale della Santa Inquisizione di Genova mandata dal padre inquisitore all’inquisitore dell’isola di Scio (Anordnungen über die Unterstützung der Tätig-keit der Inquisition durch die weltliche Obrigkeit auf Chios), ebd., b. 1401 und b. 1406 A.54 1557 IV 12, Konstantinopel, Antonio Veranzio an Jacobus Palaeologus: „Nihil esse in me quod tibi usuique tuo non sit expositum, primum pro virtute tua et pro his dotibus, quae in te divino munere lucent, deinde pro mea in te benevolentia, qua tibi ita affi cior pluribus nominibus, ut nequeam non aeque tuus ac meus esse. Igitur quicquid fuit illud viatici, quo te sum in Italiam discedentem prose-quutus, hinc factum esse existimes tantique metiaris, quanti non aurum aut argentum ponderat, sed quanti animum meum erga te facias.“ László SZALAY (Hrsg.), Verancsics Antal összes munkái, IV: Elsö portai követség, 1555–1557, Pest 1859 (= Monumenta Hungariae Historica), S. 168f, Nr. 74.55 1558 XII 2, Venedig, Aussage des Domenico de Gayano vor der Inquisition: „Interrogatus a chi ha mandato lettere de fra Jacomo et dove respondit: ‚A nissuno ma quando lui era qui mi dette una lettera che andava in Anchona ad Alexandro Maurodi da Constantinopoli che li debia mandar algune sue robe zioè vestimenti che li havea lassate l’anno passato quando el vene qui la prima volta speran-do che le dovesse gionger fi n che lui stesse qui ma non essendo gionte mi ha lassato ordine che come le giongerà io ghele mandi o a Scio o a Costantinopoli dove el serà.’“ Venezia, ASt, Sant’Uffi zio, b. 14, fasc. proc. 14.56 1558 XII 2, Venedig, Aussage des Domenico de Gayano vor der Inquisition: „Fo questo jugno un anno che esso fra Jacomo venne in casa mia per visitar un mio parente che era amalato a casa mia, qual mio parente ha nome Jacomo de Draperii da Pera et è ritornato in Pera.“ Ebd.
23
stantinopel anwesenden europäischen Diplomaten und angesehener Bürger von Pera versehen,57 im August 1557 in Ferrara spontan der Inquisition58 und erhielt von dieser ein Zeugnis seiner Rechtgläubigkeit, wurde aber im September 1557 in Genua, wohin er sich unvorsichtigerweise begeben hatte, verhaftet und im Dominikanerkonvent ein-gekerkert. Aus der Haft in Genua konnte er im Oktober 1558 mit Unterstützung zweier Ordensbrüder fl iehen.59
Nach einem zwanzigtägigen Aufenthalt in Venedig brach er Mitte November 1558 nach Ragusa auf, um nach Chios weiterzureisen. Die Inquisition in Venedig erfuhr zu
57 1568 nach II 15, Wien, Palaeologus an Papst Pius V.: „Rediens in Italiam a patria litteris gravis-simis et honestissimis a Constantinopolitanis omnium ordinum civibus et omnium gentium legatis fui, litteris amantissimis et benevolentissimis, illustrissimis et reverendissimis cardinalibus inquisitoribus diligentissime commendatus. In illis litteris erant de causa mea luculentissima testimonia.“ Wien, HHStA, Rom Varia 3 (alt 2), Bl. 85r–115v, dort 92r, hrsg. in SZCZUCKI, W kręgu myślicieli heretyc-kich, S. 199–229, dort S. 206.58 Zum Verfahren der comparitio spontanea vgl. Elena BRAMBILLA, Spontanea comparizione (Pro-cedura sommaria), in: Dizionario storico dell’Inquisizione, Bd. 3, S. 1474f.59 1568 II, Wien, Palaeologus an Kaiser Maximilian II.: „Dico igitur me anno 1557 Ferrariae ab octo iudicibus fuisse auditum et absolutum. Deinde mensi sequenti, cum Genuam venissem ad acci-piendam pecuniam et Romam profi ciscerer, fuisse mandato Reverendissimi et Illustrissimi Cardinalis Alexandrini captum permittente Pontifi ce Romano Paulo 4° decepto, abs quo non dico: pluribus ex-plicavi alias. Hoc dico, Illustrissimum et Reverendissimum Cardinalem Alexandrinum ab hac culpa non abesse. Genuae fui in carcere per menses 13, a mense Septembri anni 1557 ad mensem Octobrem 1558 […] Liberatus per vim sum ex carcere Genuensi mense Octobri.“ Wien, HHStA, Rom Varia 3 (alt 2), Bl. 139r–148v, dort 147r. 1568 nach II 15, Wien, ders. an Papst Pius V.: „Audierat Sanctitas Vestra me ex Chio, ex Byzantio mediam transiens Turciam libere iudicio Ferrariensi obiecisse. Audi-erat me ex carcere Genuensi die sequenti ex quo fuissem in illum demissus, libere potuisse discedere […] Audierat Sanctitas Vestra ex illis […] quos tandem ipsis se prodentibus, ne ego torquerer, ad triremes damnasti, me ante multos menses fugere potuisse, sed noluisse, quod sperarem in causa mea cognoscenda mitiora tempora. Audierat haec Sanctitas Vestra et intelligere poterat, qualia erant animi mei iudicia, Christiani scilicet et nulla falsa opinione laborantis, qui, ut a se omnem male suspicandi occasionem omnibus praecideret, ex Turcia, libero et tuto sibi loco, in Italiam pervenisset.“ Ebd., Bl. 85r–115v, dort 89r, hrsg. in SZCZUCKI, W kręgu myślicieli heretyckich, S. 199–229, dort S. 203. Bei den zwei Dominikanern, die Frate Jacobo zur Flucht aus dem Inquisitionsgefängnis in Ge-nua verholfen hatten und dafür zu Galeerenstrafen verurteilt wurden, handelte es sich um zwei Assistenten des Inquisitors von Genua, Girolamo de’ Franchi, namens Pantaleone da Genova und Battista da Genova. Battista da Genova hatte zuvor versucht, Frate Jacobo durch ein gün-stiges theologisches Gutachten zu entlasten. Die Galeerenstrafen wurden vor dem 8. Mai 1560 aufgehoben. Zu ihnen vgl. ebd., Bl. 87v, ed. in SZCZUCKI, W kręgu myślicieli heretyckich, S. 201; 1559 I 27, Rom, Michele Ghislieri an Girolamo de’ Franchi, Genova, BU, E. VII. 15, Bl. 84r; 1559 VII 22, Gregorio Boldrini, Prior des Dominikanerkonvents in Bologna, an das Sant’Uffi zio in Rom, ACDF, St. St., EE1a, Bl. 242; 1559 VII 25, Bologna, Lodovico da Lovere, Privinzial OP, an dass., ebd., Bl. 299v; 1560 V 8, Genua, Girolamo de’ Franchi an Thomas Scoto: „quelli due frati condannati alla gallera in Civittavecchia et hora liberati, quando forno authori della fuga da San Domenico di frate Giacopo da Sio“, ebd., GG5a; FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 177–179; Massimo FIRPO – Dario MARCATTO (Hrsg.), Il processo inquisitoriale del Cardinal Gio vanni Morone. Nuova edizione critica, Bd. 1: Processo d’accusa, Roma 2011 (= Fontes Archivi Sancti Offi cii Romani, 6), S. 1307–1318.
24
spät von der Durchreise des Gesuchten, ließ aber einige Zeugen vernehmen. Der in Ve-nedig ansässige perotische Kaufmann Domenico de Gayano berichtete, Frate Jacobo, den er erst seit dem Vorjahr kenne, sei bei ihm zweimal zu Tisch gewesen. Er habe in der Stadt das Ordensgewand getragen, sei bei der Abreise aber mit Jacke und Mantel wie ein Laie bekleidet gewesen. In Venedig habe er gemeinsam mit einem Jüngling aus Pera und dem Adligen Giorgio Giustiniani aus Chios den venezianischen Patrizier Le-onardo Emo (off enbar denselben Leonardo Emo, 1532–1586, der von Andrea Palladio die berühmte Villa Emo in Fanzolo di Vedelago errichten ließ und der zeitweise vene-zianischer Gouverneur von Zakynthos60 war) besucht. Sowohl der Jüngling als auch Gayano hatten Jacobo Geld auf Wechsel geliehen.61 Bei dem Jüngling handelte es sich um Piero di Pare, der 1554 oder 1555 von Jacobo in Pera Lateinunterricht erhalten hat-te. Dieser gab vor, kaum etwas über Jacobo zu wissen, dagegen seien Emo und Gayano dessen vertraute Freunde.62 Emo wurde, der üblichen Diskretion der venezianischen Inquisition gegenüber dem Patriziat entsprechend, nicht befragt. Stattdessen wurde der Gastgeber des inzwischen nach Kreta abgereisten Giorgio Giustiniani, der in Venedig ansässige genuesische Adlige Battista Giustiniani, als Zeuge vorgeladen. Dieser wollte zunächst die Aussage verweigern, da er Giorgio Giustiniani versprochen hatte, Still-schweigen über Jacobos Angelegenheiten zu bewahren, gab dann aber recht bereitwillig zu Protokoll, er kenne den Mönch aus Genua. In Venedig sei er selbst nur im Vorjahr mit ihm zusammengetroff en. Jedoch habe Giorgio Giustiniani jüngst im November mit
60 Vgl. Martin CRUSIUS, Turcograeciae Libri Octo: Quibus Graecorum Status Sub Imperio Turcico, in Politia et Ecclesia, Oeconomia et Scholis, iam inde ab amissa Constantinopoli, ad haec usque tempora, luculenter describitur, Basileae 1584, S. 270.61 1558 XII 2, Venedig, Aussage des Domenico de Gayano vor der Inquisition: „Interrogatus quanto tempo è che non ha veduto el detto fra Jacomo respondit: ‚Puol esser 15 over 16 giorni et l’ò visto in casa mia che mi venne a visitar do volte‘ […] Interrogatus in che habito l’ha visto, quanti dì stette in Venettia, quanto tempo sese fi rmato in casa sua, respondit: ‚La prima volta venne vestito da frate […] L’ultima volta lo vitti vestito da mundano con una casachina et tabarro, credo sia stà 20 dì in Venettia et in casa mia è stato solum una volta a disnar et poi una sera a cena quando ch’el volse an-dar via.‘ […] Interrogatus per qual causa questo fra Jacomo era carcerato a Genoa, come se ne fugì, in casa de chi se redusse, che strata ha fatto da Genoa a Venettia respondit: ‚[…] era passato per la via de Pavia et da Pavia in qua vene in Venettia con un burchio con alguni scolari, et non mi disse chi erano quelli scolari et non so dove si allogiava si non a San Moisè et poi dallà andò a casa de un Gasparo Criello gioyelier che sta a San Jeronimo dove stette 4 over 5 zorni et fo per amor de un jovene da Pera che havea conossuto lì in Pera et stava in casa de questo Gasparo Criello […] Io non l’ho conossuto né in Pera né in Scio perché son 20 anni che io sto in sta cità […]‘ Interrogatus con chi pratticava mentre stette in Venettia, […] chi li ha dato danari per viagio, respondit: ‚Io so che andò a visitar el magnifi co messer Lunardo Emo una o do volte et con quel jovene Peroto […] et con un Georgio Justiniano Scioto […] Del danaro ditto jovene Peroto li inprestò ducati 10 et io li ho dato ducati 10 a cambio che siano pagati in Constantinopoli ...‘.“ Venezia, ASt, Sant’Uffi zio, b. 14, fasc. proc. 14.62 1558 XII 10, Venedig, Zeugenaussage des Piero di Pare vor der Inquisition: „Interrogatus in che modo è fugito fra Jacomo dale persone di Genoa respondit: ‚Con me non ne ha ragionato niente de questo ma l’à de i altri amici più intrinsechi de mi che è il magnifi co messer Lunardo Emo et messer Domenico de Gayano‘ […] ‚A mi non me ha lassato ordine alcuno né de robe né de lettere ma è più verisimile che habia lassato qualche ordine a messer Lunardo Emo o al Gayano più presto che a mi che son jovene.‘“ Ebd.
25
Jacobo zu tun gehabt, wobei dieser jenen vergeblich zu überreden suchte, gemeinsam über Konstantinopel nach Chios zu reisen. Briefe des Gesuchten habe er keine, aber Ende Oktober oder Anfang November habe ihm Gayano einen Brief Jacobos an Paolo da Ferrara, Lektor am Dominikanerkonvent in Genua, übergeben, den er weiterbeför-dert habe. In Venedig habe Jacobo die meiste Zeit bei einer Frau gewohnt.63
Von Venedig aus sandte Frate Jacobo Briefe an seine Freunde in Pera, in denen er seine Ankunft in Konstantinopel ankündigte, von wo aus er nach Chios weiterreisen wollte. Die Nachricht wurde aus Pera nach Chios weitergeleitet, wo sie am 20. De-zember 1558 eintraf und spontane Freudenkundgebungen auf den Gassen auslöste. In ihrem Freudentaumel jubelten die Anhänger in Sprechchören, Christus sei den Ju-den zum Trotz auferstanden, jetzt kehre dem Lump von Inquisitor zum Trotz Frate Jacobo zurück.64 Der Inquisitor hatte die Bevölkerung der Stadt Chios in den wenigen Monaten seit seiner Rückkehr vollends gegen sich aufgebracht, indem er seine Amts-
63 1558 XII 10, Venedig, Zeugenaussage des Battista Giustiniani vor der Inquisition: „Dum pete-retur ab eo iuramentum dixit: ‚Vi prego che mi disobligate di ogni sacramento che io havesse scritto di non revelar quello che mi fosse stà ditto.‘ […] Interrogatus se conosce un fra Jacomo da Scio de che ordine è et dove lo conosce respondit: ‚Io conosco un fra Jacomo de l’ordine de San Domenico observante greco ma non so donde ch’el sia ma stava in Scio et l’ò conossuto a Genoa et non mi re-cordo de che tempo et mi par anche haverlo visto qui in Venettia a San Domenico de Castello già un anno e più.‘ […] Interrogatus si ha saputo ch’el sia stato in Venettia questi dì passati da chi et in casa de chi è stato respondit: ‚Sior sì che l’ho saputo da messer Zorzi Justiniano fi o de messer Julian da Scio con el qual ragionando dele cose de Scio mi disse che questo fra Jacomo era fugito da la Genoa et credo dale presone dove havea inteso lui esser stato retenuto da lo inquisitore et non so in casa de chi sia stato ma questo messer Georgio mi disse haverli parlato.‘ Interrogatus se fu questo Georgio Justiniano che li inposse a non dover dir ad alcuno quello che li haverebbe ditto et che cosa li disse et dove et chi era presente respondit: ‚Sior sì che detto messer Georgio mi disse ragionando de la fuga de detto fra Jacomo che resti in mi questo ragionamento de fra Jacomo et mi diceva che fra Jacomo era fugito da le preson di Genoa et lo invitava ad andar con lui per passar a Scio per terra per via de Ragusa et el frate li deceva che era meglio andar per via de Constantinopoli […]‘ […] Interrogatus a chi lui ha mandato lettere del detto fra Jacomo dove et chi ghele ha date respondit: ‚Io non so haver mandato lettere del detto fra Jacomo salvo che da messer Domenico de Gayano habitante qui. A la fi n de ottobre o principio de novembrio in circa mi fu data una lettera sigillata col soprascripto per il padre fra Paulo di Ferrara lettore in San Domenico di Genoa et me instò la mandasse a Genoa […] Poi inteso che era del ditto fra Jacomo […]‘ […] Post relectum dixit: ‚Mi par che esso messer Georgio mi disse che esso fra Jacomo stava in casa de una donna et non so dove.‘“ Ebd.64 1559 II 8, Chios, Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri: „Li giorni passati mi fu detto ch’il P. frate Jacobo da Scio stava in Venetia nascosto, et la Vigilia di San Thomaso Apostolo [1558 XII 20] capitorono quivi littere soe per via die Pera scritte a Pietro Giustiniano Garibaldo quondam Fran-cisci et ad Angelo Giustiniano da Campi quondam Pauli soi sviscerati nele quali scrivea che era libera-to et che aspettava passagio per andare in Pera et poi venir in Scio. La gran festa, la grande alegresa, il gran jubilo che s’è fato in questa cità per cotal nova egli è quasi incredibile. Li suoi seguaci tanto lo favoriscono, quanto dir si può, et per insino alle donne pren dono la soa protetione, non volendo cre-dere che habbi errato. Ha scritto anche (seconde che m’è stato detto) che io gli ho fatto gran fortuna, et che la patria di Scio mi ha da haver pocco obligo perché io l’ha carricata […] et tutta la cità s’era commosta, et molti erano lì alegri et alcuni si tristavano.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 32r–v, 64r–v, 65r, 66v. ‒ 1559 X 14, Chios, Nicolò Bracelli OP, Prior des Dominikanerkonvents von Chios, an
26
vollmachten dazu ausnutzte, um sich an den Verantwortlichen für die Verbannung im Frühjahr 1557 und für die vielerlei Demütigungen aufgrund der mangelnden Unterstüt-zung seiner Tätigkeit durch den „weltlichen Arm“ zu rächen. Selbst gegen den neuen Podestà Giovanni Battista Giustiniani sammelte er belastende Aussagen und sandte sie nach Rom.65 Ende August hatten die über Chios nach Konstantinopel durchreisenden genuesischen Gesandten Giovanni Franchi und Nicolò Grillo nach einer gründlichen Untersuchung der Verhältnisse in der Inselhauptstadt der Regierung in Genua sogar empfohlen, die Abberufung des Unruhestifters Antonio Giustiniani vom Amt des In-quisitors zu erwirken und diesen durch eine neutrale, gut qualifi zierte Person ersetzen zu lassen, zumal Chios in der türkischen Machtsphäre liege und dort Tag für Tag Re-negaten, Juden und andere Nationen, die von den katholischen Dogmen und Riten abweichen, verkehren. Der Ort sei im übrigen weitaus weniger von der Häresie befl eckt, als allerorten behauptet werde.66 Die nüchternen Ratschläge der Gesandten blieben je-doch folgenlos, denn ihnen stand der für die Republik Genua wesentlich empfi ndlichere Vorwurf des Sant’Uffi zio in Rom entgegen, die genuesischen Beamten in Chios hätten ein an sie ergangenes päpstliches Breve67 und andere kirchliche Anordnungen igno-riert und damit großes Mißfallen beim Papst erregt, sie seien zumindest schismatisch, wenn nicht gar häretisch, und behinderten aus Rücksicht auf einige einfl ußreiche Per-sonen auf der Insel, deren Häresie immer off enbarer werde, die Tätigkeit der Inquisi-tion.68
Michele Ghislieri: „Se vostra signoria illustrissima fusse stata qua in Sio quando venne la nova che fra Iacobo era fugito da Santo Dominico di Genova et che ritornava a Sio, hare sti visto far una gran festa et grandissima allegressa. Dicevanno li suoi descepoli: ‚È pur resuscitato Christo al despecto de’ Giudei,‘ altri dicevanno: ‚Ritorna pure fra Iacobo al despecto de quello cornuto dello inquisitore.‘ Et in nocte venero essi amici et descepoli di fra Iacobo, a darli la nova come fra Iacobo era fugito, al P. fra Paulo de Medulis.“ Ebd., Bl. 44r–v, 51r–v. 65 1559 X 13, Chios, Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri, ebd., Bl. 34r–v, 61r–62v; 1560 III 16, Chios, ders. an Thomas Scoto, ebd., Bl. 90r–91v, 131r–132v; vgl. FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 169f.66 1558 VIII 29, Chios, Giovanni de’ Franchi Tortorino, genuesischer Gesandter, und Nicolò Grillo, genuesischer Bailo in Konstantinopel, an Doge und Governatori der Republik Genua: „Ci è parso avvisare le Signorie Vostre Illustrissime di quello occorre et dirli che a giuditio nostro non conviene, per lo pacifi co et conservatione di questo luogo, la inquisitione in persona del suddetto frate Antonio per le oggettioni, quali concorrono in lui, come amplamente saranno le Signorie Vostre Illustrissime forse informate, non perché si debba, né che qui si ricusi la inquisitione, ma bisogna, a giudicio nostro, tale auttorità commetterla in persona neutrale et ben qualifi cata; in che, tanto più, si ha d’haver consideratione per esser questo luogo sotto le ali del turco, et dove ogni giorno concor-rono rinegati, giudei, et altre nationi, diversi dalli dogmati et instituti ecclesiastici et apostolici […] reff erendogli, per quanto havemo potuto investigare et conoscere, non essere tanto maculato d’heresia questo loco quanto è stato costì et altrove vociferato.“ Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2169.67 Vgl. Anm. 53.68 1558 XII 30, Rom, Michele Ghislieri an Doge und Governatori der Republik Genua: „Si mandò già un breve apostolico al reggimento dell’Isola et città di Scio, dove intendendosi hora il puoco rispetto usato alle lettere di questa Santa Sede da quel reggimento in non curarsi di leggere tal breve, et in ritardar l’essecutione d’alcune altre commissioni di questo sacratissimo tribunale della Santa Inquisitione per conservatione di quei popoli nella fede catholica, è molto dispiacciuto tel fatto
27
Unterdessen war Frate Jacobo Anfang Dezember 1558 von Venedig per Schiff in Ragusa eingetroff en, um von dort auf dem Landweg69 nach Konstantinopel weiterzurei-sen. Am Abend vor der geplanten Abreise erreichte den Bischof von Ragusa ein Bote mit einem Haftbefehl des römischen Sant’Uffi zio gegen Jacobo, so daß dieser noch im letzten Augenblick am 9. Dezember 1558 früh vor Tage verhaftet werden konnte. Von Ragusa wurde der Gefangene am Tag nach der Festnahme per Schiff nach Ancona in den Gewahrsam des dortigen Dominikanerkonvents und zur Weiterleitung an den Hauptsitz der Inquisition in Rom überstellt.70 Durch die Ereignisse überholt war der Haftbefehl gegen Jacobo, den die Regierung in Genua auf Betreiben des Sant’Uffi zio in
a Nostro Signore et a tutto questo sacratissimo tribunale, parendo che i ministri di quel reggimento si dimostrino, se non heretici, almeno schismatici, benché anche non si dubiti che tutta tal diffi coltà et renitentia circa le lettere et commissioni di questa Santa Sede risulti apertamente in favore d’alcuni che sono in quella isola, i quali oltre il resto che di lor si ha, essi da se medesimi con la loro contu-macia vanno dimostrandosi heretici.“ Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2779, lettere di cardinali, fasc. 3, Nr. 1; Antwort darauf: 1559 II 10, Doge und Governatori der Republik Genua an Michele Ghislieri, die Schwierigkeiten ergäben sich aus der Entfernung zwischen Genua und Chios, aber die Republik werde es nicht an Fleiß fehlen lassen, die Bewohner der Insel in der ortodossa chri-stiana religione zu bewahren, ebd., b. 2831, lettere a cardinali, fasc. 2.69 Über die im 16. Jahrhundert üblichen Reiserouten auf dem Landweg von Ragusa nach Kon-stantinopel vgl. den Exkurs in Marianna D. BIRNBAUM, The Long Journey of Gracia Mendes, Bu-dapest – New York 2003, S. 125–127.70 1558 XII 9, Ragusa, Ludovico Beccadelli, Bischof von Ragusa, an Michele Ghislieri: „Posso certamente dire ch’un angelo del cielo ha portato la lettera di Vostra Signoria Reverendissima di XII. di Novembre, per la quale mi commette la captura di fra Jacomo da Chio, imperò che la lettera giunse hier sera al tardi portata da uno, che veniva per terra, havendo lasciata la nave lontana di qui cento miglia, che non può venir innanzi rispetto al tempo contrario; et fra Jacomo, che tre dì prima era capitato con brigantini di Vinetia, s’era meso in certi alberghi fuor della città per partir questa matina a buon’ hora per terra alla volta di Constantinopoli. Onde fu necessario co’l favore di questi signori, che non fu poco, far aprire le porte et mandar la sbirraria a cercarlo, che fi nalmente lo trov-orno a cinque hore di notte; et questa matina fu condotto dentro, et incarcerato; et perché domani deve partire un navilio per Ancona, havemo operato il padre Vicario di San Domenico, et io, ch’l detto navilio lo porti; et così questa sera in ferri lo facemo mettere in nave, et lo indrizziamo secondo che Vostra Signoria Reverendissima ha scritto in Ancona al priore di San Domenico. Et perché venga sicuro, li mandiamo due soldati per guardia, i quali bisogna pagare secondo il tempo, che staranno fuora, che è incerto; et per questa et per altre spese occorse scrivemo al padre priore in Ancona, che rimborsi un mercante Ragusano habitante in quella città, di scudi venticinque d’oro, de quali si terrà fi delissimo conto dalli frati e da me. Le robbe c’havemo trovate a fra Jacomo sono di poco momento, et non bastano a sodisfare certi debiti fatti qui, c’haveva promesso di pagar in Levante. Le scritture, che sono in parecchi quinternetti, tutte messe insieme, et cucite in una tela sigillata, si mandano in mano del dotto padre priore in Ancona; al quale Vostra Signoria Reverendissima et del prigione, et di quelle ordinarà quanto le piacerà.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 10r–v, 13r–v (Kopie: Parma, Biblioteca Palatina, Fondo Palatino, MS 1010, Bl. 269r–270r). ‒ 1558 XII 9, Ragusa, Beccadelli an den Prior des Dominikanerkonvents in Ancona, in derselben Sache, Parma, MS 1010, Bl. 268v–269r. ‒ 1559 I 29, Ragusa, Augustinus Helianus OP an Michele Ghislieri: „Frate Jacomo essendo escito dalla cità di Ragusa per incaminarsi in verso la Turchia, e le porte della cità essere chiuse, e come portorno letere che lo dovesse prehendere, Idio per la sua gracia ita direxit gressus nostros, che la cità a dua hore fu aperta, e lui fu preso a cinque hore de note. Hoc ascribendum omnino est divine boni-
28
Rom Ende Dezember nach Chios sandte, da sie der Meinung war, dieser befi nde sich bereits auf dem Weg dorthin.71 Nach einer schweren Haftzeit im Inquisitionsgefängnis am Ripetta-Ufer in Rom gelang Jacobo während der Unruhen nach dem Tod Pauls IV. am 18. August 1559 ein weiteres Mal die Flucht.72
tati, non humano ingenio. Laudetur Deus.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 38r, 57v. ‒ 1559 II 12, Ragusa, Beccadelli an dens.: „La spesa di condurre Jacomo da Scio in Ancona non fu molta, perché Dio benedetto, che no’l fece prendere, lo portò ancho presto di là, et credo fussero tre scudi, come si scris-se a padre inquisitore d’Ancona. Penso ch’ a quest’ hora il detto Jacomo sia in Roma; et havrò caro sapere, che le scritture sue, che mandai ben ligate in Ancona, siano venute in mano di Sua Signoria Reverendissima.“ Ebd., Bl. 21r–v, 77v (Kopie: Parma, MS 1010, Bl. 282r–283r). ‒ 1559 IV 29, Ra-gusa, ders. an dens.: „Della spesa per fra Jacomo da Sio, sono parecchie settimane che’l Reverendo Padre Inquisitore d’Ancona satisfece questi padri di San Domenico per quanto m’hanno detto, siche non accade pensarvi piu.“ Ebd., Bl. 28r, 70v (Kopie: Parma, MS 1010, Bl. 302r–v). Zu Beccadelli vgl. Sandro LANDI, Beccadelli, Ludovico, in: Dizionario storico dell’Inquisizione, Bd. 1, S. 165–166.71 [1558 XII], Genua, Doge und Governatori der Republik Genua an Giovanni Battista Giusti-niani, Podestà von Chios (Regest): „Lettera scritta al magnifi co Giobattista Giustiniano, podestà nell’isola di Scio e città, tratta di fra Giacomo da Scio dell’ordine di San Domenico, carcerato nel con-vento di San Domenico per ragion d’heresia e fugito a Scio, si dà ordine che, arrivando, sia fatto pri-gione e mandato a Genova o a Roma.“ Genova, ASt, Ms. 338, Antica pandecta actorum, Bl. 43v (Materialsammlung Massimo Firpo). ‒ 1558 XII 23, Genua, dies. an dens. und Gubernatores der Mahona von Chios: „Un fra Giacobo di Scio dell’ordine di San Domenico, il quale per causa d’heresia era statto posto in priggione nel convento di San Domenico di Genova di commissione delli Reverendissimi et Illustrissimi Cardinali sopra la Santa Inquisitione, sen è fuggito di preggione e si intende che viene verso Scio, dove che noi, pregati da essi Reverendissimi et Illustrissimi Cardinali etc., vi ordinemo e commettemo che usiate ogni diligenza, sollecitudine e studio di haverlo per ogni modo nelle mani e, pottendolo conseguire, lo mandarette con partecipatione del Reverendo Inquisitor die Scio a Genova (o vero a Roma) sotto bona custodia, et in tal causa darete etiandio ogni favor, aggiuto e braccio al detto Reverendo Inquisitor di Scio.“ Ebd., Archivio Segreto, b. 2774 B, hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 79f, Nr. 32. ‒ 1559, Genua, dies. an dens. (Regest): „Lettera scritta al magnifi co Giovanni Battista Giustiniano, commissario in Scio, che si hanno lettere da Roma dai commissari apostolici sopra la Santa Inquisitione, per le quali siamo avisati ritrovarsi in cotesta città un frate dominicano apostata, quale sii sfratato, er perciò facendone instantia che li sia mandato qui col primo passagio a buona cautela […] e volendo ubbidire a detti commissari appostolici, massime in cose che concernono la fede, vi mandemo le letter loro e vi dicemo, per quel sarà in man vostra, che osserviate e facciate osservare l’ordine che havete da loro circa la cattura di tal huomo.“ Ebd., Archivio Segreto, b. 1401 (Materialsammlung Massimo Firpo). ‒ Beim Inquisitor von Chios traf der Haftbefehl erst am 1. März 1559 ein: 1559 III 3, Chios, Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri: „Sono doi di che ho ricevuto una di Vostra Illustrissima et Reverendissima Signoria, ne la quale m’impone ad usar ogni dilligensa et sforcio per haver frate Jacobo da Scio nele mani et mandarlo da quelle overo a Genova. Io, Monsignore Illustrissimo, non era per mancar in questa impreisa cum tutte le nostre forcie, ancor che da Vostra Illustrissima et Reverendissima Signoria non fussi stati avisato conoscendo di quanta importanza fussi la fuga d’un sì pestifero heretico, ma la bontà divina ha provisto al tutto, dil che doviamo sensa fi ne ringratiarla.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 18r–20v, 78v.72 1568 II, Wien, Palaeologus an Kaiser Maximilian II., Wien, HHStA, Rom Varia 3 (alt 2), Bl. 139r–148v, dort 147r. Diese und die zahlreichen weiteren Nachrichten über Verhöre und Haft des Palaeologus in den Inquisitionsgefängnissen von Genua und von Rom werden im zweiten Teil dieses Beitrags näher untersucht.
29
Die Nachricht von der Verhaftung des Frate Jacobo in Ragusa am 9. Dezember 1558 hatte Chios Anfang Februar 1559 wenige Woche nach dem Brief erreicht, in dem jener seine Rückkehr angekündigt hatte.73 Dem Inquisitor Antonio Giustiniani schien, daß sich Jacobos Anhängerschaft nach anfänglicher Bestürzung in den folgenden Monaten umso widerspenstiger gebärdete.74 In fast allen seinen Schreiben beklagte er die kor-rupten Verhältnisse der örtlichen Verwaltung, die die Tätigkeit der Inquisition in der einen oder anderen Weise behinderten.75 Vollends bedroht schien ihm die Sache der Inquisition jedoch, als sich Anfang 1560 die Brüder Angelo und Vincenzo Giustiniani da Campi in Genua für die anstehende Wahl eines neuen Podestà bewarben. Angelo sei ein notorischer Anhänger Jacobos und sei persönlich an der Ausweisung des Inquisitors (im Frühjahr 1557) beteiligt gewesen.76 Trotz der Intervention des Inquisitors war einer beiden Brüder, Vincenzo Giustiniani, mit seiner Bewerbung erfolgreich.
Nach seiner Flucht aus dem Inquisitionsgefängnis in Rom im August 1559 hatte sich Frate Jacobo einige Monate lang in Rom und an anderen Orten Italiens verborgen
73 1559 II 8, Chios, Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri: „Poi è capitata una nave di Ragusa la quale si ha portata la nova esso frate Jacobo esser stato preiso et menato da vostre Illustrissime Si-gnorie la qual cosa tanto ha contristato li soi amici, ancor che da principio non lo voleano credere, che il gaudio s’è convertito in mestitia et melancolia.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 32r–v, 64r–v, 65r, 66v.74 1559 VII 3, Chios, Antonio Giustiniani an [Thomas Scoto]: „Poi che è stata sentita la captura di frate Jacobo da Scio in Ragusa et menato in Roma hano alcuni in parte abassato il capo, credo ben che nel secreto li siano favorevoli et amici, ma alcuni alla desperata combatevano per lui, non obstante che fussi in Genova in prigione et aff ermando che non era heretico. Vostra Reverentia si degni darmi aviso dil caso suo, et gran benefi tio saria a questa cità che quivi fussero publicati tutti li errori soi perché alcuni sono stati duri et fermi non potendo credere che habbi errato, etiamdio di quelli che non sono machiati, saria molto a proposito et favor de l’Inquisitione publicare li soi errori per fermare li boni et catholici et sbatere li seguaci.“ Ebd., Bl. 42r–v, 53r–v.75 Vgl. außer den Schreiben des Antonio Giustiniani nach Rom (ACDF, St. st., Q3b, passim) auch: 1559 X 12, Chios, Antonio Giustiniani an Doge und Governatori der Republik Genua, Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B, hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 81–83, Nr. 34; 1559 XI 30, Chios, ders. an dies., ebd., hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 85f, Nr. 36; 1560 I 15, Chios, ders. an dies. (klagt, daß ihm nun selbst der Bischof Paolo Fieschi in den Rücken falle), ebd., hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 87f, Nr. 37; 1560 V 15, Rom, Michele Ghislieri an dies., ebd., b. 2799, lettere di cardinali, fasc. 3; 1560 V 24, Doge und Governatori der Republik Genua an Michele Ghislieri, ebd., b. 2831, lettere a cardinali. Vgl. ROSI, La Riforma religiosa, S. 607–609; FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 161–173.76 1560, Chios, Antonio Giustiniani an [Thomas Scoto]: „Il quale Angelo è uno de li cinque citati personaliter, perché egli fu uno de li quatro deputati contra la Santa Inquisitione et personalmente intervenne ne la violentia, che ci fu fata quando ci imbarcorono et bandirono, et esso in persona mi acompagnò al brigantino, oltra di ciò è uno de li sviscerati amici di frate Jacobo da Chio, per quanto ho conosciuto. Et perché la Illustrissima Signoria di Genova non ha notitia di simili disordini, essendo il duce et signori novamente elletti, et havendo li sopradetti Angelo et Vincentio persone in Genova che li favoriscono et procurano per loro, è facillima cosa, che siano elletti al magistrato di questo loco.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 112r–113v. ‒ 1560 III 16, Chios, ders. an dens.: „Oltra che egli [Angelo Giustiniani da Campi] è uno delli citati personalmente dal Santo Tribunale di Roma et uno de’ piu cari et sviscerati amici che havesse frate Giacobo di Scio, le qual cose fanno ch’egli non è a proposito in conto alcuno.“ Ebd., Bl. 90r–91v, 131r–132v.
30
gehalten.77 Im Frühjahr 1560 schiff te er sich nach Alexandrien ein, um von dort aus über Konstantinopel nach Chios zu reisen. Ein Brief, in dem er von Zakynthos aus seinen Freunden in Pera seine Ankunft ankündigte, gelangte am 13. April 1560 in die Hände des Inquisitors von Pera, Antonio da Venezia. Dieser warnte umgehend seinen Kollegen auf Chios, wobei er zugleich dem römischen Sant’Uffi zio anbot, mittels seines Einfl usses bei der Pforte zu erwirken, Jacobo bereits bei dessen Ankunft in Konstanti-nopel umbringen oder auf eine Galeere schmie den zu lassen.78 Der Flüchtling gelangte trotz dieser Vorkehrungen bis Chios. Dort gelang es dem Inquisitor Antonio Giustini-ani, Jacobo am 9. Mai 1560 gleich bei der Einschiff ung im Hafen der Inselhauptstadt festnehmen zu lassen. In seinem Erfolgsbericht an das Sant’Uffi zio in Rom gab er aller-dings sogleich zu bedenken, der Gefangene habe in Chios zahlreiche Unterstützer, so daß eine erneute Flucht zu befürchten sei.79
Den Behörden in Chios lag ein Befehl der Regierung in Genua vor, Palaeologus nach Rom auszuliefern.80 In seinen Berichten schilderte der Inquisitor von Chios die Schwie-rigkeiten, die sich aus der Haft des Frate Jacobo ergaben und die die geplante Überfüh-
77 Vgl. SZCZUCKI, Jakub z Chios-Paleolog, S. 79f.78 1560 VI 17, Pera, Antonio da Venezia an Michele Ghislieri: Wiederholt, was er bereits in einem Schreiben vom April berichtet hatte, „come quel tristo di frate Giacobo da Sio havea scritto in Sio et in questa terra, come lui venea in queste parte liberatto per le mani de Iddio, et le littere sue mi cappitorno nelle mani, come per la coppia Sua Signoria potrà vedere inclussa in questa […]. Notifi cai subbito in Sio mandando la coppia della litera al Reverendo Padre Inquisitor et Sua Reve-rentia ponendo deligentia fu incarceratto in Sio […] Io per nome de tutti questi christiani di Pera con sustantia pregaremo Vostra Signoria Illustrissima, che ci concedesse licentia di far, che fusse o morto overo posto alla galea perpetua, acciò non facesse piu male tra questi puochi christiani, et il Gran Signor subbito lo haverebbe condemnatto secundo la sententia et suplica nostra […] Non dico cosa alcuna di questa licentia, ma la suplico ben per honor de Christo et utilità de tutte le anime che sono in Levante ubediente alla Santa Madre Chiessa Romana, vogliatte opperar che essendo lui tristo sia conosciutto per tale, acciò che li altri temmino.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 104r–v, 121r–v. ‒ 1560 X 8, Pera, ders. an Thomas Scoto: „Il venerdì santo [1560 IV 13] mi comparve una littera scritta al Zante da fra Giacomo, et nottifi cava a questo suo Zeff o la sua andatta in Alessandria, et lo esortava a salutare li amici, quali sono in Pera et Salonichi.“ Ebd., Bl. 83r–v, 143v. 79 1560 V 9, Chios, Antonio Giustiniani an [Thomas Scoto]: „Io cum tutte le diligentie che ho potuto et saputo non guardando né a speisa né a fatica ho posto et procurato che siano poste le spie per havere quel tristo di frate Jacobo da Chio ne le mani, et tandem essendo hogi dì verso Alessandria capitato un vasello che va in Constantinopoli nel quale esso era dentro, l’o fato prendere et incarcerato cum tutte quelle sigurtà et cautele che siano possibili a ciò non scapi […] io temo et tremo che non scampi, essendo in loco ove esso havea tanti favori et amici. Vostra Reverentia mi avisi presto, se io fossi sano, lo acompagnerei in persona in Roma, ma agravato da una infi rmità mortale non posso.“ Ebd., Bl. 95r–v, 127v. ‒ 1560 VI 12, Pera, Antonio da Venezia an Michele Ghislieri: „Fra Giacomo è in Sio nelle forze del Sant’Offi tio della Inquisitione. Mandai una coppia de una littera scritta da esso frate Giacomo, ritrovandosi al Zante, in habbito da vilano, et la mandava in Sio con una che veneva in Pera, mandai ancora la copia in Sio.“ Ebd., Bl. 105r–v, 120v.80 1560 VII 2, Genua, Doge und Governatori der Republik Genua an Michele Ghislieri: „Si darà opportuno ordine perché venga imbarcato il fra Giacomo sfratato, per quanto verrà dalle man nostre, sì come richiede la qualità e delicatezza del crime onde è inquisito.“ Genua, ASt, Archivio Segreto, b. 2831, lettere a cardinali, fasc. 1.
31
rung des Gefangenen verzögerten. Zwar sei dieser im Gefängnis angekettet, aber seine Unterstützer setzten sich bereits beim Sultan dafür ein, die Auslieferung Jacobos nach Konstantinopel zu erzwingen. Den Plan, den Gefangenen im August oder September 1560 nach Kreta (unter der Herrschaft der Republik Venedig) zu bringen, hatte der In-quisitor aufgegeben, nachdem er in Gesprächen mit dem Podestà und anderen sachkun-digen Männern die Risiken des Transports abgewogen hatte. Auf Chios habe Jacobo viele und einfl ußreiche Anhänger, daher habe kaum Aussicht bestanden, einen Kapitän zu fi nden, der bereit gewesen wäre, ihn nach Italien zu überführen.81
81 1560 VIII 11, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „Per l’altre mie ho fato intendere a Vostra Reverentia la captura di frate Jacobo da Chio fugito prima da la prigione di San Domenico di Genova et poi da la prigione di la Ripetta, et tengolo incarcerato et incatenato aspetando risposta da l’Illustrissimo et Reverendissimo Alisandrino mio padrone, al quale ho scritto quatro man di litere dandogli aviso di questo et aspetando l’ordine di Soa Illustrissima Signoria. Novamente il vicario di Pera [Antonio da Venezia] mi scrive haver presentito, che alcuno procura in Pera per meggio di la Porta dil Gran Turco ottenere un commandamento che mi sia tolto da le mani et mandato in Con-stantinopoli. Perché volendo io prendere partito et rimediare sono ricorso dal podestà di questo loco chiedendo il braccio suo per mandarlo via di qua verso Candia cum una barcheta. Et discorrendo soa magnifi centia et io li pericoli grandi, che sono in questo Arcipelago per conto de’ Turchi et altri pericoli assai, gli è parso, che ad ogni modo cum diligensa si debbiamo certifi care, item se l’impreisa diabolica ha fundamento et che habbi a succedere, perché così essendo, subito alla meglio che si potrà si manderà a quello meglior recapito sia possibile. Io, Padre Reverendo, per cotesto negotio vivo cum gran ramarico, perché vedo che mi trovo in un loco privo di quello aiuto soccorso et favore, che richie-derebbe una sì fata impreisa, perché il sopradetto frate Jacobo ha di molti amici et e assai favorito, et l’Uffi tio di la Santa Inquisitione aborrito et mal visto et per insino da alcuni frati et preti pocco aiutato et da alcuno di loro smacato […] Credo fermamente, che si durerà fatica trovare padrone di nave, che vogli prendere il carrico di condurre in Messina overo Ancona o altro loco frate Jacobo, perché fugono questo peso apreso di loro odioso et pericoloso, et maxime che sano li favori grandi, che ha havuto in questo loco, maxime alcuni loro esendo compatrioti. Et forsi temono di non off endere quelli nobili, che sono soi amici, et già uno patrone, che si ha da partire il Settembre, ha havuto a dire parole, per le quali vorrebbe fugire cotal cura di condurlo a Messina. Padre Reverende, noi siamo in un mal paese et che vive troppo alla libera. Questo dico per alcuni, non per tutti, et io mi trovo sensa forcie et sensa aiuto.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 85r–v, 139r–141v. ‒ Ähnlich die rückblickende Rechtfertigung aus dem folgenden Jahr: 1561 VII 8, Chios, ders. an Michele Ghislieri: „Quando si partì la nave ragusea per Messina, io ne hebbe notitia et sapevo molti giorni avanti la soa partensa, et in fede di ciò io negotiai et mi consultai cum doi o tre gentilhuomini da bene di authorità et amici se pareva loro espediente di mandare cum detta nave frate Jacobo, atento che era cosa pericolosa, capitassi ne le mani di le galee di l’armata turchesca che già era inviata. Et furono il nobile Meser Giusepe Giustiniano di Meser Benedetto et il nobile Meser Pietro Giustiniano di Meser Panthaleone, li quali furono del parere il passagio essere molto pericoloso per conto di detta armata, oltra di ciò udendo io il gran favore, che detto frate Jacobo havea in questo loco. Et non havendo singulare et spetiale aiuto di favore col padrone di la nave dubitai, che non recusasi l’impreisa a instantia d’altri secreta. Overo per non farsi mal volere, et quando pur anco l’havessi acctetato, io dubitavo di qualché stratagema considerando il numero de li amici, che il detto frate Jacobo havea et la qualità d’alcuni di loro, che sono potenti in questo loco. Et mi doleva assai per tutte queste ragioni non haverla a mandare come io desiderai molto di fare, essendone anco disuaso da qualché altra persona di authorità et di più, che io stavo suspeso di venir in persona a Roma cum esso per asicurarmi meglio.“ Ebd., Bl. 201r–203v.
32
Am 9. Oktober 1560 mußte der Inquisitor nach Rom melden, daß der Gefangene gefl ohen sei, nachdem er sich mithilfe einer Feile, die ihm von seinen Unterstützern ins Gefängnis gebracht worden war, von seinen Ketten befreit und ein Loch in die Mauer des Gefängnisses gebrochen hatte.82 Antonio da Venezia, der Inquisitor von Pera, kün-digte in einem einige Wochen später abgesandten Schreiben an, er werde beim Sultan die Hinrichtung des Flüchtlings erwirken oder ihn gar nach dem biblischen Vorbild des Pinchas (Num. 25) eigenhändig erschlagen, sollte dieser es wagen, nach Konstan-tinopel zu kommen. Er wolle Jacobo entweder als treuen Sohn der Kirche sehen oder tot.83
In einer Reihe von Schreiben aus dem folgenden Jahr 1561 versuchte Antonio Giusti-niani, die Verantwortung für die Flucht des Frate Jacobo von sich zu weisen. Off enbar hatte Ghislieri Zweifel an der Sorgfalt des Inquisitors geäußert. Dem hielt Giustiniani entgegen, das Gefängnis befi nde sich in einem öff entlich zugänglichen Hof des Domini-kanerklosters und sei angesichts der Sympathien, die Jacobo unter den Mitgliedern der Mahona genoß, völlig ungeeignet gewesen. Ein anderes Gefängnis stehe der Inquisition jedoch nicht zur Verfügung.84 Der Raum hatte ein Fenster, durch das der Gefangene
82 1560 X 9, Chios, Antonio Giustiniani an [Thomas Scoto]: „Vi diedi nova di la captura di frate Jacobo da Chio, hora mi scopia il cuore di dolore dirvi che novamente è fugito da la prigione nostra del convento ne la quale era detenuto cum li ferri alli piedi atacati cum una catena grossa a una machina grossissima, ma, a quel che si vede, è stato aiutato cum una lima. Quivi ha gran favor et ha di li amici sviscerati. Si attenderà a formar und processo per scoprir, et poi se vi manderà la copia, si è scoperto, che alcuni gli hano perlato, così frate come seculare, io ne vivo cum grandissima pena così di la fuga come dil favore che vedo che ha. È stato circa […] meisi in prigione, che mai ho havuto passagio fedele di […] di pensar di mandarlo cum una nave […]. Saria bene a mandar qua tutte le cose, ne le quale ha errato, et publicare, atrimenti non macherà d’essere diff eso, et una scomunica papale contra di tutti quelli gli hano fato aiuto, conseglio, favore, braccio, recapito in qual si vogli modo per farne demostratione. Io non ho mancato di far le scomuniche et procurato il bando publico del magistrato, ma bisognerebe che la bandita del nostro Signore ne facessi particolar demostratione in questo loco, ove è così favorito.“ Ebd., Bl. 136r–v.83 1560 XI 12, Pera, Antonio da Venezia an Thomas Scoto: „Hoggi son stato certifi cato che fr. Giacobo da Sio è fuggitto dalla carcere, sono già 27 giorni, con aver rotto muro, cathene, et fuggitto. Il Reverendo Padre Inquisitor con il Podestà hanno fatto il bando et promeso cento [scudi] a chi lo presenta, cosa che asai mi dole, perché temo assai, che non venghi in Pera. Et certo è grandissimo scandolo, che uno tristo pertinace già la terza volta sia fuggitto del Sant’Uffi tio […] Certo, Padre Reverendo, se lui venerà in Pera, credo che questi christiani lo faranno punir con il darlo nelle mani de Turchi. Subbitto che sia provatto, che lui tenga contra Christo o contra lo evangelo, sarà piccatto o aff ogatto. Io prego Christo, che non capiti, perché temo di far come fecce Finees. Dessidero vederlo buono fi gliolo della Santa Madre Giesa o fuori del mundo, acciò non dia scandolo piu alli buoni.“ Ebd., Bl. 160r–v, 171v.84 1561 VII 8, Chios, Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri: „Non già perché io vogli presu-mere di contradire a quanto mi scrive Vostra Illustrissima et Reverendissima Signoria le cui parole accetto cum ogni humilità et riverensa, ma per manifestare la mia innocentia al’incontro di quegli che contra di me a Vostra Illustrissima et Reverendissima Signoria per loro ogietti overo passioni hano procaciato di dare sinistra informatione per conto di la fuga di frate Jacobo […] Signore Illustrissimo, nel principio che fu incarcerato io cum tutta quella dilligensa et avertimento che mai fu possibile gli deputai un padre di casa, che ne havessi bona custodia. Poi in processo di tempo agravandosi si
33
nicht nur mit den Mönchen, sondern auch mit Laien Gespräche führen konnte.85 Der Inquisitor hatte, trotz der ihm dafür erwiesenen Anfeindungen von Seiten der Mönche und der Inselbewohner, den Gefangenen anketten lassen und sorgte für die Bewachung des Fensters und der Tür. Unter der Arrestzelle befand sich jedoch eine Werkstatt, und es sei nicht möglich gewesen, zu kontrollieren, wer dort ein- und ausgeht. Von diesem Raum aus seien Jacobo die Fluchtwerkzeuge zugespielt worden. Chios sei eben nicht Italien, wo ein Inquisitor über die Möglichkeit verfüge, ein Gefängnis nötigenfalls um-bauen zu lassen.86 Bei der auf die Flucht folgenden Untersuchung der mutmaßlichen
volse scaricare […] Per quella parte che io ho potuto ho usato tutte le mie forcie facendo fortifi care le porte de la pregione et le fi nestre, et ordinando stretissimamente non gli fussi dato cosa alcuna dal cibo ordinario in fuori, et avertendo tutti li frati non gli parlassino, né si acostassino alla pregione […] et occorendo che alcuno per contrabando contra facessi, me ne fussi dato notitia. Ma essendo la pregione dil convento in propatulo et non havendo modo di tenere una guardia continua, aciò che nessuno si acostasi alla porta de la pregione et ad una offi cina che restava sotto la fi nestra di essa pregione, non era in mano mia né in mio puotere prohibire et impedire, che furtivamente non gli fussi parlato, come di fato è ocorso, che ne l’hora che li frati erano in choro, in diversi tempi doi secolari sono stati trovati, uno sotto la fi nestra, l’altro a la porta de la pregione, la qual cosa hano confes-sato doi frati astretti da la scomunica, le cui depositioni juridice per mano di notario holle mandate questo Aprile proximo passato per via di Messina al Reverendo Commissario, et in Messina si sono divisate a Meser Giovanni Lommellino consule dei Genovesi, aciò siano citati li sopradetti secolari, de quali uno è di quelli gentilhuomini, che altre volte furono citati personalmente, chiamato Angelo Giustiniano da Campi quondam domini Pauli, et l’altro è il suo fi glio chiamato Paulo. Et si sono portati molto male quelli doi anco tre frati, che hano scoperto et confessato questo, a non darmene al’hora subito notitia esendo cosa di tanta importansa. Perché quando havessi havuto simili inditii, si sarebbe potuto chiuder in tutto la fi nestra de la pregione, et che restassi sensa luce più presto che stare in simil pericolo. Ma mai mi hano detti cosa alcuna, ma stretti doppo la fuga hano deposto. L’haverne dato poi cura a un giovane che solamente gli portassi da mangiare et non altro, io confesso a Vostra Illustrissima Signoria di haverlo fato non puotendo havere altro, che fussi più a proposito et volessi acetare l’impreisa. Et quando alcuno fussi stato forciato l’harebe acetata, se gli fussi parso stimando di non puoter essere astreto a questo […] Io suplico, Vostra Reverendissima et Illustrissima Signoria vogli comandare al padre frate Giovanni Barri priore nostro moderno overo a chi piace a Vostra Il-lustrissima et Reverendissima Signoria, che debba fare dilligente inquisitione a vedere, se per colpa mia frate Jacobo è fugito, overo se per quella parte, che si spetava a me haverne cura et custodia cum ogni dilligensa, se ho mancato et se io bastavo a prohibire et provedere, che nessuno furtivamente non gli parlassi essendo la pregione nel loco, ove è, eccetto se giorno et notte non fussi stato io personaliter alla guardia overo un’altra persona fedele. Né mai mi piaque simil pregione, massime per meterli simil persona tanto favorita, ma non puotendo haverne altra megliore fu judicato da tutti li magistrati si dovessi metere in essa.“ Ebd., Bl. 201r–203v.85 1561 II 20, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: Von Angelo Giustiniani „è stato commesso un disordine di venire ascostamente a parlare a frate Jacobo stando sotto la fi nestra di la prigione.“ Ebd., Bl. 153r, 177v.86 1561 IV 12, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „Circa la fuga di frate Jacobo, io ne ho havuto quella estrema cura che ho saputo et potuto, etiam publicamente si diceva che io era crudele. Ma alcuni frati si sono portati malissamente, non già per malitia forsi, io non haveva potestà di prohibire, che non si andassi a una stantia, che restava sotto la fi nestra di la prigione […] L’adiuto non l’ha havuto né dal fi nestrino di la porta di la pregione né per via di la porta, ma da quel maga-
34
Unterstützer und Fluchthelfer weigerten sich die Ordensleute unter Berufung auf ein ihnen verliehenes Privileg, sich ohne eine besondere Vorladung durch das römische Sant’Uffi zio befragen zu lassen.87 Auch für Mitglieder der Mahona und für den Podestà Giovanni Battista Giustiniani Garibaldo, dem der Inquisitor eine Mitverantwortung für die Flucht zuschrieb, mußten aus Rom Vorladungen angefordert werden. Die Haupt-verdächtigen waren Angelo Giustiniani da Campi, der Bruder des designierten neuen Podestà Vincenzo Giustiniani, und Angelos Sohn Paolo.88
Im Sommer 1561 kam es zu einer weiteren schweren Blamage für den vom Pech verfolgten Inquisitor. Es gelang Frate Jacobo, die Insel am 10. Juli 1561 auf einem ra-gusanischen Schiff in Richtung Marseille zu verlassen, nachdem er sich mithilfe seiner Freunde acht Monate lang auf der Insel versteckt gehalten hatte. Für das Entweichen des Gesuchten machte der Inquisitor den Podestà und die Governatori mitverantwort-lich, die nicht für eine ausreichende Bewachung der Anlegestellen gesorgt hätten.89
zeno, che restava sotto la fi nestra di essa pregione. Né io poteva stare continuo a fare la guardia, che nessuno entrassi in detto magazeno, ma di le fenestre di la prigione et de le porte io ne ho tenuto bonis-sima cura, et cum tenerlo in cathena et in ferri. Se io overo l’Uffi tio fussi respetato et tenuto come in Italia, forsi harei havuto autoritate di murare quel magazeno.“ Ebd., Bl. 178r–180v.87 1561 I 21, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „È necessario che Vostra Reverentia mi mandi iuridicamente una patente amplessima et chiara di poter comandare et procedere, quando fussi bisogno, contra de tutti li ordini mendicanti, perché novamente è occorso un gran disordine in vergogna et scorno dil Santo Uffi tio, nupero che havendo io volsuto, per debito mio, examinare alcuni frati nostri dil convento per havere qualche inditio di la fuga di frate Jacobo da Chio. Alcuni di loro si sono ristretti insieme, et uniti sono venuti a oponermi cum dire, che loro sono privilegiati et che non gli posso comandare, se non gli mostro l’autorità dil Santo Uffi tio essere tale, che revochi i loro privilegii, facendone spetial mentione de verbo ad verbum […]“ Bittet, Ghislieri unterrichten, „al quale ho scritto il tutto circa la fuga di frate Jacobo da Chio per il grandissimo favore, che ha in questo loco. Io l’ho custodito cum tutta quella dilligensa et vigilantia che mai sia stato possibile, ma da li ministri et alcuni frati sono stato male obedito, et si sono deportati malamente, et manderò quando potrò alcune depositioni.“ Ebd., Bl. 147r–151v, 152v. ‒ 1561 VII 8, Chios, ders. an Michele Ghislieri: „Nel volere examinare alcuni padri per la fuga, mi hano oposto cum dire, che sono privilegiati et che gli mostri havere authorità di comandarli.“ Ebd., Bl. 201r–203v.88 1561 I 21, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „Et il podestà et il governo non hano fato loro debito circa la soa fuga, ma io sono stato reputato crudelissime, et se il contrario da alcuni passionati fussi scritto a Vostra Reverentia o ad altri, non dia fede […] Suspico assai che alcun di quelli citati personalmente, cioè Angelo Giustiniano da Campi, sia complice de la fuga di frate Jaco-bo.“ Ebd., Bl. 147r–151v, 152v. 89 1562 II 3, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „Ho già scrittovi come frate Giacomo sendo fugito d’Ottobre fuori della prigione è stato qui in Chio in sino alli 10 di Giulio (sì come ho compreso havendoli parlato uno sopra la nave ch’era quivi) et di qua si può conoscere il gran favor ch’egli ha […] Andò in Marsiglia con quella nave sopra della quale g’ha parlato uno che me n’ha datto motto il detto frate Giacomo.“ Ebd., Bl. 194r–v, 199v. ‒ 1561 II 20, Chios, ders. an dens.: „Il podestà et li governatori non hano usato la dilligensa che doveano ne la fuga, perché essendo noi in isola, se il podesta se fussi posto al forte di metere le guardie, non basterebbe a partirsi da una isola, ma se ne passato così la, et quel pocco che ha fato di far un bando sensa meter guardie l’ha fato ad instantia mia, ma bisognava che metessi le guardie per l’isola, il che non l’ha fato, et li governatori non si sono mosti, havea troppo favore esso frate Jacobo in questo loco.“ Ebd., Bl.154r–v, 176r–v.
35
Komplize sei wiederum Angelo Giustiniani gewesen.90 Mit der Wahl Frankreichs als Fluchtziel folgte Jacobo off enbar dem Ratschlag gewisser Kardinäle, bei denen er 1559 nach seiner Flucht aus dem Kerker von Ripetta in Rom Unterschlupf gefunden hatte.91 Ende 1561 hieß es, er wolle in Lyon als Prediger gegen die Hugenotten wirken,92 womit er off enbar seine Rechtgläubigkeit erweisen wollte. Im Januar 1562 begab er sich nach
90 1561 XI 19, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „Desidero molto di haver risposta d’alcune mie lettere che vi ho scritto di gran importansa et se Vostra Reverentia ha ricevuto alcune depositioni che gli ho mandato contra d’alcuni che hano errati et l’inditio per frate Jacobo che è fugito […] Vostra Reverentia procuri ad ogni modo la citatione dil podestà Givanbatista Justiniano Garibaldo quondam Francisci, che presto presto de giorno in giorno si aspeta il novo podestà, il medesimo procuri per Angelo Giustiniano da Campi quondam Pauli per haver notitia di frate Jacobo fugito, perché io sono di parere che per meggio suo si haverà notitia etiam di complici, per tanto fatelo citare ad ogni modo per l’inditio che havete.“ Ebd., Bl. 187r–189v. ‒ 1561 XI 26, Chios, ders. an dens.: „Per le cose che alla giornata intendo, più mi fermo et stabilisco di pensare, che per meggio di Angelo Giustiniano da Campi quondam domini Pauli si può havere notitia di la fuga di frate Jacobo da Chio da questa isola, per tanto havendovi mandato quello inditio che è contra di detto Angelo et del suo fi gliuolo Paolo. Juridico è molto espediente et necessario, che ordiniate, che sia citato, perché credo, che si scoprirano ancora alcuni altri complici de la soa fuga.“ Ebd., Bl. 190r–v. ‒ 1561 XII 2, Chios, ders. an dens.: „Io credo che alcuno de li citati [die Namen der Vorgeladenen waren in der Anlage zu einem der vorangehenden Briefe genannt] sia complice in haver dato aiuto a frate Jacobo a imbarcarsi et che alcuni di loro, cioè de detti citati, siano consapevoli de la soa partensa, et tra li altri il detto Angelo et un’altro, che ha havuto nome d’esser macchiato.“ Ebd., Bl. 191r–192v. ‒ 1562 III 31, Chios, ders. an dens.: „Partì di qua cum una nave verso Marseglia d’un Raguseo che si chiamava Michele Sparlento […] Ho procurato et procuro di haver inditii per la fuga di quello Jacobo et aviserò Vostra Reverentia, a quello che si può compreendere probabilmente è stato tenuto ascosto qua otto meisi doppo la fuga de la pregione, e son di parere che per meggio di quello Angelo si basterà a scoprire per la soa fuga.“ Ebd., Bl. 193r–v, 200r–v.91 Vgl. den Bericht des Nuntius Bonomini über ein Gespräch mit Palaeologus nach dessen Ge-fangennahme im Dezember 1581 während der Haft des Palaeologus bei Wien: 1582 I 16, Preß-burg, Giovanni Francesco Bonomini an Kardinal Tolomeo Gallio gen. Como: „Interrogandolo io di diverse cose, non mi volse mai rispondere, salvo che mi disse esser fuggito di pregion di Roma a sede vacante di Paolo IIII e che fu ricovrato in casa d’alcuni cardinali e di lor consiglio ancora fatto uscir da Roma e andar in Francia.“ ASV, Segr. Stato, Nunz. Germania 104, Bl. 28r–30v, dort 28r–v. Vgl. SZCZUCKI, Jakub z Chios-Paleolog, S. 80.92 1562 II 3, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „Da Marsiglia ha scritto qui un Filippo Flores Marsigliano che se gl’evangelisti prevalerano, il detto frate Giacomo anderà a predicare in Li-one.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 194r–v, 199v (die Nachricht dürfte noch im Spätherbst von Marseil-le abgegangen sein). ‒ Auf die Nachricht über die Pläne des Palaeologus, sich nach Lyon zu be-geben, bezieht sich vermutlich auch die Antwort Michele Ghislieris auf ein verlorenes Schreiben des Inquisitors von Genua, in dem off enbar von protestantischen Einfl üssen aus Lyon auf Genua die Rede war: 1562 II 13, Michele Ghislieri an Girolamo de’ Franchi: „È superfl uo che quella Ilu-strissima Signoria [die Republik Genua] mi ringratii di quanto Vostra Reverentia gl’ha detto in mio nome, perché s’ha da rendere certa che in amarla et desiderarli ogni vero contento non cedo a nesuno, ma ben temo per l’aff ettione che li porto che Lione non sia causa di macchiare quella sì catholica città, il che saria rovina di essa repubblica. Fra Jacomo non mancherà come buono instromento del demonio di aiutarli ad ammorbare quanto potrà.“ Genova, BU, E. VII. 15, Bl. 146r.
36
Poissy, um mit dem päpstlichen Nuntius Prospero di Santa Croce und dem Legaten in Frankreich, Kardinal Ippolito d’Este, die sich dort wegen des Religionsgesprächs zwi-schen Katholiken und Hugenotten aufhielten, über die Aufhebung des römischen Ver-dammungsurteils vom 5. März 1561 zu verhandeln. Von diesem Zeitpunkt an sind seine Geschicke in den Depeschen der päpstlichen Diplomatie, die angewiesen war, den so viele Male Entronnen nicht mehr aus den Augen zu lassen, ausführlich dokumentiert. So sind aus den Jahren 1562–156393, 1566–157194 und 1581–158395 nicht weniger als 133 Schreiben päpstlicher Diplomaten überliefert, die teilweise oder ganz Palaeologus betreff en.
Frate Jacobos Anhänger auf Chios
Der Überblick über den Verlauf der Ereignisse im vorangegangenen Abschnitt läßt erkennen, daß Frate Jacobo sowohl im Dominikanerkonvent der Inselhauptstadt Chios als auch unter den Mahonesi und den (in der Regel selbst der Mahona angehörenden) Repräsentanten der Republik Genua Sympathisanten und Unterstützer hatte. Kontext seiner Wirksamkeit in Chios waren die gefährliche äußere politische Lage, in der sich die Insel befand, und die in den komplexen sozialen und administrativen Strukturen des chiotischen Mikrokosmos angelegten internen Konfl ikte, die unmittelbar vor der türkischen Eroberung (1566) zu geradezu anarchischen Zuständen führen sollten.
Die vor der kleinasiatischen Küste gelegene Insel Chios96, die durch ihre Fruchtbar-keit, vor allem ihr Monopol auf das begehrte Mastixharz, und durch ihren für den mit-
93 Korrespondenz des Prospero Santa Croce, Nuntius in Frankreich, mit Kardinal Carlo Bor-romeo (ASV, Fondo Pio, 62; ebd., 116; Paris, Bibliothèque Nationale, Département des manu-scrits, Italien 2182, olim Ms. Béthune 8679); Korrespondenz der päpstlichen Legaten beim Tri-enter Konzil mit Carlo Borromeo (ASV, Conc. Trid., 51; ebd., 54; ebd., 60; ebd., Segr. Stato, Nunz. Germania 4; Milano, BA, I 140 inf.; ebd., I 141 inf.).94 Korrespondenz des Melchiorre Biglia, Nuntius am Kaiserhof, mit Kardinal Michele Bonelli gen. Alessandrino, (Milano, BA, Trotti 22; ASV, Segr. Stato, Nunz. Germania 67; Torino, ASt, Archivio Alfi eri, Mazzo 59, No. 8), Kardinal Giovanni Francesco Commendone (ASV, Segr. Stato, Nunz. Germania 66) und Kardinal Giovanni Morone (Biblioteca Apostolica Vaticana [im folgenden: BAV], Cod. Vat. Lat. 6405).95 Korrespondenz des Giovanni Francesco Bonomini, Nuntius am Kaiserhof, mit Kardinal Tolo-meo Gallio gen. Como (ASV, Segr. Stato, Nunz. Germania 12; ebd., 103; ebd., 104; ebd., 105), Kardinal Carlo Borromeo (Milano, BA, F 66 inf.; ebd., F 68 inf.; BAV, Cod. Ottob. Lat. 3171) und anderen (Vercelli, Archivio Capitolare, Sign. Nr. 158); Korrespondenz des Kardinals Ludo-vico Madruzzo, Fürstbischof von Trient, mit Tolomeo Gallio (ASV, Segr. Stato, Nunz. Germa-nia 9; ebd., 107; BAV, Cod. Barb. Lat. 5743); Korrespondenz des Don Luigi de Torres mit Carlo Borromeo (Milano, BA, F 69 inf.).96 Zur Lage von Chios in den Jahrzehnten vor der türkischen Eroberung vgl. ARGENTI, Chius Vinc-ta, S. lxxii–xcii; ID., The Occupation of Chios by the Genoese and their Administration of the Island, 1346–1566. Described in Contemporary Documents & Offi cial Dispatches, Bd. 1, Cambridge 1958; Gian Giacomo MUSSO, Genovesi in Levante nel secolo XVI. Fonti archivistiche, in: Raff aele BELVEDERI (Hrsg.), Atti del Congresso Internazionale di studi storici. Rapporti Genova – Mediterraneo – Atlan-
37
telmeerischen Ost-West-Handel wichtigen Hafen große ökonomische Bedeutung besaß, war 1346 von einer privat fi nanzierten Flotte für die Republik Genua erobert worden. Da die Republik die Schiff sherren nicht auszahlen konnten, bildeten diese eine Gesell-schaft (Mahona) von Anteilseignern, welchen die Republik Verwaltung und Einkünfte der Insel überließ. Aus dieser Regelung wurde ein dauerhafter Zustand. Die Anteile konnten weiterverkauft werden, wobei alle neuen Anteilseigner (Mahonesi) den Namen des zum größten Teil nach Chios übergesiedelten genuesischen adligen Familienver-bandes (albergo) der Giustiniani als Übernamen annahmen.97 Die auf Chios lebenden Mahonesi bildeten eine privilegierte Gruppe innerhalb des katholischen bzw. latei-nischen Bevölkerungsanteils, der hauptsächlich in der Inselhauptstadt Chios ansässig war. Die Mahonesi wählten aus ihrer Mitte zwölf oder dreizehn Gubernatores Mahonae, die gemeinsam mit dem von der Regierung in Genua eingesetzten Podestà die weltliche Obrigkeit der Insel repräsentierten. Auch die im Mutterland lebenden Anteilseigner wurden durch ein Gremium von Governatori mit Sitz in Genua repräsentiert. Durch die Privilegien, die die Mahonesi auf Chios genossen, waren die Befugnisse des Podestà in vielerlei Weise beschränkt.98
Die Souveränität der Republik Genua über die Insel war somit schon aufgrund der inneren Verhältnisse eher nomineller Natur. Dazu kam, daß die Republik angesichts der immensen Entfernung vom Mutterland kaum in der Lage gewesen wäre, die Insel militärisch zu verteidigen. Die Mahonesi entrichteten daher seit 1409 als Schutzgeld einen jährlichen Tribut (carachio, haraç) an die Osmanen, der in dem Jahrhundert seit der Eroberung von Konstantinopel 1453 immer weiter erhöht worden war, so daß er in der Mitte des 16. Jahrhunderts nur noch unter großen Schwierigkeiten aufgebracht wer-den konnte. Es kam zu Rückständen bei der Tributleistung, die von den Türken durch eine Reihe von Willkürakten noch vorsätzlich vergrößert wurden. Der unregelmäßige Zahlungseingang lieferte 1566 den Türken den Anlaß dazu, die Insel zu besetzen, die Herrschaft der Mahona zu beseitigen und Chios als sancak direkt der osmanischen Ver-waltung einzugliedern. Auch vor der Besetzung sahen die Türken die Chioten aufgrund von deren Tributpfl ichtigkeit als Untertanen des Sultans an und griff en gegebenenfalls in die inneren Verhältnisse der Insel ein. Vor allem bestanden sie darauf, daß das Amt des Podestà nur durch Einheimische, also osmanische Untertanen, ausgeübt werden
tico nell’età moderna, Genova 1983 (= Pubblicazioni dell’Istituto di Scienze Storiche, Università di Genova, 5), S. 355–380; Kenneth M. STETTON, The Papacy and the Levant (1204–1571), Bd. 4: The Sixteenth Century from Julius III to Pius V, Philadelphia 1984, S. 893–899; Michel BALARD, The Genoese in the Aegean (1204–1566), Mediterranean Historical Review 4, 1989, S. 158–174; Geo PISTARINO, Duecentocinquant’anni dei Genovesi a Chio, in: ID., Genovesi d’Oriente, Genova 1990 (= Civico Istituto Colombiano, Studi e testi, 14), S. 243–280; ID., Chio dei Genovesi nel tempo di Cristoforo Colombo, Roma 1995 (= Nuova Raccolta Colombiana); Enrico BASSO, „L’ochio drito de la cità nostra de Zenoa“: il problema della difesa di Chio negli ultimi anni del dominio genovese, Ligures 8, 2010, S. 67–76 (auch Online: http://www.giustiniani.info).97 Vgl. Carl Hermann Friedrich Johann HOPF, Les Giustiniani, dynastes de Chios. Étude historique, trad. par Étienne A. Vlasto, Paris 1888; ARGENTI, Chius Vincta, S. xli–xliv; ID., The Occupation of Chios, S. 106–146; PISTARINO, Chio dei Genovesi, S. 79ff .98 Vgl. ARGENTI, Chius Vincta, S. xlvii–xlix; ID., The Occupation of Chios, S. 370–390; PISTARINO, Chio dei Genovesi, S. 509–569.
38
dürfe. Kurz vor Frate Jacobos Wirksamkeit auf Chios hatte die Pforte 1552 die Ab-setzung des Podestà Franco Sauli, eines nicht der Mahona angehörenden Genuesen, erzwungen, dessen Amt daraufhin bis 1558 von den oben mehrfach erwähnten Kom-missaren Giovanni Battista Gentile und Baldassare Giustiniani ausgeübt wurde.99
Zusätzlich belastet wurde die Lage der Insel dadurch, daß Genua 1528 seine politische Koalition mit Frankreich aufgekündigt hatte und die genuesische Flotte unter Andrea Doria seither für Spanien die Seekriege im Mittelmeer gegen Frankreich und die seit den 1530ern mit den Franzosen verbündeten Osmanen führte. Um nicht als Vorposten einer feindlichen Macht zu gelten und die Konsequenzen der Feindschaft zwischen Spa-nien und den Türken tragen zu müssen, waren die Mahonesi tendenziell darum bemüht, sich gegenüber der Pforte von Genua zu distanzieren. Umgekehrt sollten sie allerdings auch nicht davon profi tieren, daß die Republik 1557/58 diplomatische Verhandlungen mit der Pforte aufnahm und günstige Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des genuesischen Levantehandels erreichte, der durch die politischen Verhältnisse und durch die zunehmende Bedeutung des Atlantikhandels in eine lange Rezession geraten war.100 Daß Genua bei den Verhandlungen mit den Osmanen off enbar keinerlei Vorkeh-rungen für die Sicherheit von Chios anstrebte, ist um so auff älliger, als der Hafen von Chios nach wie vor einen bedeutenden Vorteil für den genuesischen Handel darstell-te.101 Geo Pistarino stellte daher die Frage, ob Genua nicht vielleicht bereits 1557/58 die Insel aufgegeben hatte, so daß die endgültige Besetzung durch die Türken nur noch eine Frage der Zeit war.102 Die allenthalben spürbaren Schwierigkeiten, die sich aus der Ver-bindung Genuas mit Spanien für Chios ergaben, ließen es den Herren der Insel gebo-ten erscheinen, jede Provokation gegenüber Frankreich, dem gefährlichsten Feind der Mutterstadt, zu vermeiden. Einzelne Mahonesi unterstützten Frankreich sogar aktiv, ohne daß jedoch von dort Hilfe für die bedrängte Insel zu erwarten gewesen wäre, war doch den Franzosen die bloße Existenz dieses letzten Restes des einstigen genuesischen Seereichs im östlichen Mittelmeerraum ein Dorn im Auge.103
99 Vgl. ARGENTI, Chius Vincta, S. xliv–xlvii, l–lxxii; ID., The Occupation of Chios, S. 273–328, 329–369. Mehrere von Argenti nicht berücksichtigte Schriftstücke über die Absetzung Saulis und die Amtszeit der beiden Kommissare 1552–1558 befi nden sich in Genova, ASt, Senato-Senarega, b. 1283, Atti 1552.100 Vgl. Filippo CASONI, Annali della Repubblica di Genova del secolo Decimo Sesto, Genova 1708, S. 253–255; Camillo MANFRONI, Le Relazioni fra Genova, l’Impero Bizantino e i Turchi, Parte II: Relazioni di Genova coi Turchi, Atti della Società Ligure di Storia Patria 28, 1898, 3, S. 753–858. Zu den Krisen und Rezessionen, die sich für den mittelmeerischen Ost-West-Handel des 16. Jahr-hunderts aus der Entdeckung Amerikas und der zunehmenden Bedeutung der atlantischen Handelswege ergaben, vgl. das klassische Werk von Fernand BRAUDEL, Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II., Bd. 3, Frankfurt am Main 1990. ‒ Zahlreiche größere und kleinere Fehler enthält die Veröff entlichung von Manfred PITTIONI, Korrespondenz mit dem Sultanshof. Dokumente genuesischer Gesandter des 16. Jahrhunderts, Wien – Berlin 2010 (= Mit-telmeerstudien, 2).101 Vgl. BASSO, „L’ochio drito de la cità nostra de Zenoa“.102 Vgl. PISTARINO, Chio dei Genovesi, S. 71.103 Vgl. den Bericht über die Überwinterung einer französischen Flotte im Jahr 1552 bei Philip PANTELIS ARGENTI (Hrsg.), Hieronimo Giustiniani’s History of Chios, Cambridge 1943, S. 16f: „[…]
39
Die Aufenthalte des Frate Jacobo auf Chios in den Jahren 1555 bis 1557 und 1560 bis 1561 fi elen in eine Zeit, in der der Bevölkerung von Chios ihre prekäre Lage deutlich bewußt sein mußte. Daß Jacobo 1561 nach Frankreich fl oh, dürfte, wie im vorangegan-genen Abschnitt angedeutet, anderen Motiven als einer Parteinahme für Frankreich geschuldet sein.104 Vielmehr scheint er schon im hier behandelten Zeitabschnitt zu der Überzeugung gelangt zu sein, daß der Habsburger Ferdinand I., seit 1556 römischer Kaiser, als Hoff nungsträger für die bedrängten lateinischen Christen der Levante zu gelten habe, und übertrug diese Erwartungshaltung später auf dessen Nachfolger Ma-ximilian II. Für eine frühe Orientierung an den österreichischen Habsburgern spricht jedenfalls die herzliche Freundschaft, die der habsburgische Diplomat Verancsics im Frühjahr 1557 gegenüber Palaeologus äußerte.105 Welcher Art diese Hoff nungen gewe-sen sein könnten, wird nicht ganz deutlich. Ferdinand strebte im Gegensatz zu seinem Bruder Karl V., der bis zu seinem Abtritt von der politischen Bühne den Traum von einem Kreuzzug gegen die Türken nie ganz aufgegeben hatte, eine pragmatische Ko-existenz mit den Osmanen an. Die Anfang 1555 in Konstantinopel aufgenommenen Bemühungen der Gesandten Ferdinands um einen langfristigen Waff enstillstand mit den Türken verliefen jedoch schwierig und sollten erst 1562 zum Ergebnis führen.106
l’armata dil Re di Francia, mandatta contro l’imperatore Carlo quinto l’anno 1552, la quale elesse quell’isola per la migliore e più comoda de’ porti et beni ove s’invernò lo spacio de otto o nove mesi continui, aspetando quella del turcho. Onde per la providenza, facultà et magnanimità della famiglia de’ Gustiniani, signori del luogo, et particolarmente di Signor Vincenzo Giustiniano, fu mantenutta soccorsa et nutritta tutto quello spatio. Il qual Vincenzo doppo la perditta dell’isola morse in servitio dil detto Re di Francia, honorato d’honori et dignità.“ Der genannte Vincenzo Giustiniani, Vater des Girolamo, des Verfassers der (von Argenti als historische Quelle überbewerteten) Istoria di Scio, ist (gegen Argenti) nicht mit dem gleichnamigen letzten Podestà der Insel zu identifi zieren, son-dern war während der Amtszeit des letzteren als französischer Agent in Konstantinopel tätig, vgl. Ernest CHARRIÈRE, Négociations de la France dans le Levant, Bd. 2, Paris 1850, S. 604f (1559), S. 735f (1563), S. 755–774 (1565); HOPF, Les Giustiniani, S. 151. ‒ Über die aufwendige Begrüßung und Bewirtung einer französischen Gesandtschaft, die 1551 zur Erneuerung des französisch-osmanischen Bündnisses gegen Spanien nach Konstantinopel reiste, bei ihrem Zwischenhalt in Chios berichtet Nicolas de Nicolay, Geograph des Königs von Frankreich: Nicolas DE NICOLAY, Der erst Theyl von der Schiff art und Rayß in die Türckey unnd gegen Oriennt, Nürnberg 1572, Bl. XXVv–XXVIr (l. II. cap. 5). ‒ Im Mai 1563 landete der von Frankreich unterstützte korsische Rebell Sampiero, der bei den Türken um die Unterstützung seiner Rebellion gegen die Republik Genua warb, für drei Tage im Hafen von Chios an und erhielt währenddessen Höfl ichkeitsbesu-che von mehreren Gubernatores der Mahona, die sich von diesem Verhalten vielleicht eine Ver-besserung der Situation von Chios gegenüber der Pforte erhoff ten, vgl. Raff aele DI TUCCI, Il sog-giorno di Sampiero Corso a Scio, Archivio Storico di Corsica 9, 1933, S. 416–421; Carlo BORNATE, La missione di Sampiero Corso a Costantinopoli, Archivio Storico di Corsica 15, 1939, S. 472–502; ARGENTI, The Occupation of Chios, S. 362f; BASSO, „L’ochio drito de la cità nostra de Zenoa“.104 Vgl. oben, Anm. 91.105 Vgl. oben, Anm. 55.106 Vgl. Johann Wilhelm ZINKEISEN, Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Bd. 2, Gotha 1854, S. 879–895; Nicolae JORGA, Geschichte des Osmanischen Reiches, Bd. 3, Gotha 1909 (Re-print Darmstadt 1990), S. 46 –55.
40
Die inneren Verhältnisse von Chios waren davon bestimmt, daß die aus den Familien der Mahonesi, aus nichtadligen Genuesen und sonstigen Italienern und aus mehr oder minder italianisierten Levantinern griechischer Herkunft zusammengesetzte Gruppe der lateinischen Christen nur eine kleine Minderheit gegenüber der orthodoxen grie-chischen Bevölkerung darstellte. Die Lateiner lebten fast ausschließlich in der Stadt Chios.107 Dort befand sich auch der Sitz des lateinischen Bischofs.108 Im 15. Jahrhun-dert gab es in der Stadt und in deren näherem Umland nicht weniger als fünf Men-dikantenklöster, jedoch ist es unklar, ob außer den Konventen der Dominikaner und der Franziskaner die übrigen Ordensniederlassungen in der Mitte des 16. Jahrhunderts noch eine nennenswerte Rolle spielten.109
Unter den orthodoxen Griechen, deren Klerus dem Patriarchen von Konstantinopel unterstand, hatte ein eingesessener Adel byzantinischen Ursprungs in seinen befestigten Landsitzen seine Privilegien bewahrt. Einige Vertreter des griechischen Adels lebten im 16. Jahrhundert wie ihre genuesischen Standesgenossen in der Stadt, waren teilweise auch zum lateinischen Ritus übergetreten.110 Solche adligen griechischen Familien hatte Frate Jacobo off enbar vor Augen, als er später vorgab, er sei väterlicherseits ebenfalls vornehmer Abstammung, ja den Anschein zu erwecken suchte, er stamme von der letz-ten byzantinischen Kaiserdynastie der Palaiologoi ab.111 Wie einige in der Turcograecia des Martin Crusius abgedruckte Briefe aus Chios erkennen lassen, gab es unter den orthodoxen Griechen von Chios eine Reihe von gebildeten Ärzten, Schulmeistern und Mönchen.112 In der Stadt Chios gab es ferner eine jüdische Gemeinde mit mehreren Synagogen. Während sich in der Muterstadt Genua keine Juden niederlassen durften, bestand die chiotische Gemeinde aus einheimischen Romanioten und Familien italie-nischen Ursprungs, aber auch aus Sepharden, die seit der Mitte des 15. Jahrhunderts aus Spanien nach Chios einwanderten und im 16. Jahrhundert die Mehrheit der Ge-
107 Vgl. ARGENTI, The Occupation of Chios, S. 582–590.108 Vgl. ibid., S. 651–655; ID., Diplomatic Archive of Chios, S. 805–846; ID., The Religious Minorities of Chios: Jews and Roman Catholics, Cambridge 1970, S. 205–218.109 Vgl. Michele GIUSTINIANI, La Scio sacra del rito latino, Avellino 1658, S. 21; ARGENTI, The Occupation of Chios, S. 656–658; ID., The Religious Minorities, S. 218–222; das im folgenden meh-rfach erwähnte Dominikanerkloster lag vermutlich innerhalb der Festung von Chios (Kastro), vgl. F. W. HASLUCK, The Latin Monuments of Chios, Annual of the British School at Athens 16, 1906–1910, S. 137–184; Χαράλαμπος ΜΠΟΎΡΑΣ, Η αρχιτεκτονική των γενουατικών εκκλησιών της πόλεως Χίου [The architecture of some Genoese churches in the city of Chios], Χιακά χρονικά 18, 1987, S. 3–16.110 Vgl. ID., The Occupation of Chios, S. 582–615.111 Vgl. unten, Anm. 174. 112 Vgl. CRUSIUS, Turcograeciae Libri Octo, S. 216–219, 238–246, 253–256, 283–285, 303–309, 311–315, 479–481; zu diesem Personenkreis vgl. Κωνσταντίνος Ι. ΆμΑΝΤΟΣ, Τα γράμματα εις την Χίον κατά την Τουρκοκρατίαν 1566–1822 [Die Literatur auf Chios während der Türkenherrschaft], Athen 1976, S. 43–59; Paul DEMONT, Le Tub. Mb 23 et quelques médecins grecs de Chios en rela-tion avec le patriarcat de Constantinople dans les années 1560–1580, in: Sylvie DAVID – Évelyne GENY (Hrsg.), Troïka. Parcours antiques. Mélanges off erts à Michael Woronoff , Besançon 2007, S. 323–330.
41
meinde darstellten. Die Juden von Chios unterhielten enge Verbindungen nach Rhodos, Konstantinopel und Alexandrien.113
Angesichts der heterogenen Zusammensetzung der Bevölkerung ist die Beobachtung festzuhalten, daß es sich bei den in den Briefen des Inquisitors Antonio Giustiniani und einiger anderer chiotischer Kleriker an das Sant’Uffi zio in Rom erwähnten Personen aus dem Umfeld Jacobos ausschließlich um Angehörige der überschaubaren Bevölke-rungsgruppe der lateinischen Christen in der Stadt Chios handelte. Die Berichte des Inquisitors sind deutlich tendenziös, da dieser hinter jedem Widerstand gegen seine Tä-tigkeit Häresie witterte und zuletzt sogar mit dem Bischof und den Orden auf der Insel zerstritten war. Es ist daher schwer einzuschätzen, in welchem Maß die von Antonio Giustiniani genannten „Freunde“ Jacobos tatsächlich mit dessen spezifi schen Lehrmei-nungen vertraut waren.
An erster Stelle seien die Freunde und Anhänger Frate Jacobos aus den Reihen sei-ner Ordensbrüder in den Blick genommen. Zu der Zusammenkunft der Rechtskun-digen anläßlich des Streits zwischen dem Bischof und den Kommissaren im Oktober 1555, infolge welcher die Ermittlungen der Inquisition gegen Jacobo einsetzten, waren gemeinsam mit diesem mehrere Dominikaner erschienen, die ihn gegen den Vertreter des Bischofs unterstützten, einen Franziskaner, der ebenfalls von seinen Ordensgenos-sen sekundiert wurde.114 Daher scheint es, daß bei der Formierung der in den folgenden vier Jahren hervortretenden Gruppe von Anhängern Jacobos im Dominikanerkonvent von Chios auch die alte Rivalität zwischen den beiden Mendikantenorden eine Rolle gespielt haben könnte.
Zu den namentlich bekannten Unterstützern Jacobos gehörte der im Jahr 1555 am-tierende Dominikanerprior Paolo da Medole. Dieser ging im Frühjahr 1557, als Jacobo im Begriff stand, über Konstantinopel nach Italien abzureisen, um sich dort durch spon-tanes Erscheinen vor der Inquisition von dem Verdacht der Häresie reinzuwaschen, in der Stadt Chios mit einem Notar von Tür zu Tür und ließ Zeugenaussagen von Män-nern und Frauen aufnehmen, die die Rechtgläubigkeit der Predigten Jacobos beweisen sollten. Frate Paolo fi el auch bei den Freudenkundgebungen nach dem Eintreff en der Nachricht, Jacobo sei nach seiner Flucht aus Genua im Oktober 1558 auf dem Weg nach Chios, besonders auf. Die Untersuchungen, die Antonio Giustiniani nach seiner Rückkehr aus der Verbannung durchführte, ergaben, daß Frate Paolo und ein Frate Tomasso da Ferrara zu den eifrigsten Unterstützern Jacobos gehörten. Sie bildeten, so berichtete der Inquisitor im Februar 1559, eine untereinander eng verbundene Gruppe, die mit ihrem Meister in Kontakt stand, der die Rückkehr nach Chios sehnlich anstrebe.
113 Vgl. David JACOBY, The Jews in Chios under Genovese Rule (1346–1566), Zion 26, 1960–61, S. 180–197 [hebr., engl. Zusammenfassung]; ARGENTI, The Occupation of Chios, S. 442f; ID., The Religious Minorities, S. 100–146.114 1555 X 18 – XI 12, Chios, Giovanni Battista Gentile und Baldassare Giustiniani, Kommissare in Chios, an Doge und Governatori der Republik Genua: „[...] fra Jacobo de Sio [...] manteneva con asai bone ragioni che la cosa spettava al foro nostro. Di tale sententia erano tutti li altri frati del suo convento.“ Genova, ASt, Archivio Segreto, b. 2774 B, hrsg. in ARGENTI, Chius Vincta, S. 56–64, Nr. 24, dort 60 (vgl. oben, Anm. 46).
42
Im Oktober 1559 war Frate Paolo bereits nach Italien ausgewichen. Antonio Giustini-ani und der inzwischen amtierende Prior Nicolò Bracelli baten Kardinal Ghislieri, zu erwirken, daß Paolo da Medole und Tomasso da Ferrara die Rückkehr nach Chios auf Lebenszeit untersagt würde.115
Vier weitere Dominikaner waren bei den Untersuchungen, über die in den Schrei-ben vom Februar und Oktober 1559 berichtet wird, aufgefallen. Zwei der Brüder, Sisto da Caravonica und Benedetto da Scio, hatten unstatthaft freundlich mit verdächtigen und bereits exkommunizierten Personen verkehrt. Sie waren bereits vor dem 8. Februar 1559 nach Italien abgereist. Es sei zu befürchten, daß Frate Sisto, der ein Benefi zium in Rom erhalten habe, sich dort für die betreff enden Personen einsetzen werde. Die beiden noch in Chios verbliebenen Anhänger Jacobos im Kloster seien der Prediger Antonino da Scio und Ambrosio Paterio da Scio. Auch sie sollten möglichst verbannt werden, wenn man die Aufregung, die die Angelegenheit des Frate Jacobo in der Bevölkerung ausgelöst hatte, wieder zur Ruhe bringen wolle. Frate Antonino hatte sich geweigert, den Widerruf, zu dem der nach Genua zurückgekehrte ehemalige Kommissar Giovan-ni Battista Gentile verurteilt worden war, von der Kanzel zu verlesen. Er galt bei der Bevölkerung als der „zweite Evangelist“ der Insel, der nun in Abwesenheit des ersten Evangelisten, Jacobo, das Evangelium weiterpredige. So habe er im Februar 1559 über die Prädestination ganz im Sinne Jacobos gepredigt. Vor allem weigere er sich, gegen die Lutheraner zu predigen. Bei der Durchsuchung von Antoninos Zelle im Oktober 1559 stießen der Inquisitor und der Prior auf die Predigten und die Dialoge des Bernardino Ochino. Frate Ambrosio (ein Angehöriger des Adelsgeschlechts der Paterio) sei ein
115 1559 II 8, Chios, Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri: „Mando al P. Inquisitore di Genova uno exame contra di frate Paulo di Meduli et frate Thomaso di Ferrara svisceratissimi amici di frate Jacobo da Scio, che lo mandi al P. Generale; et per nessun modo stano bene qua, cercavano da me justifi catione, ma per non meterli in fuga ho gli risposto non essere costume di farsi. Di Genova mandai a Vostra Illustrissima Signoria alcune cose contra il sopra detto frate Thomaso, le quali non acade replicare, ma adesso mando quelle che di novo ho trovato, cioè che doppo il nostro ritorno è stato deposto nel’Uffi tio. Quanto poi a frate Paulo, oltre la depositione fata nel’Uffi tio contra di lui, egli è stato troppo aff ettionato et deff ensor dil sopradetto frate Jacobo mentre che era qua, et troppo ha comendato la soa dottrina, credo bene che procedessi da ignorantia, perché hora dice che non l’havea conosciuto per heretico, potria essere che venendo in Italia cercassi di tornare, vostra Illus-trissima Signoria provedi et per lui et per il Ferrarese. Li amici di frate Jacobo et svicerati maxime s’anche cum esso s’intertengono: io so che desidera di far qua la soa vita.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 32r–v, 64r–v, 65r, 66v. ‒ 1559 X 14, Chios, Nicolò Bracelli OP, Prior des Dominikanerkonvents von Chios, an dens.: „[...] quando venne la nova che fra Iacobo era fugito da Santo Dominico di Genova [...] in nocte venero essi amici et descepoli di fra Iacobo a darli la nova come fra Iacobo era fugito al P. fra Paulo de Medulis, il quale fu quello che in la partenza di fra Iacobo di Scio, esso fra Paulo ando di casa in casa et cun il notaro a far testifi care a huomini et done come esso fra Iacobo havea predicato catholicamente. Penso che esso fra Paolo sia in Italia et che forsi è in luoco che rende conto di quanto ha fatto per deff endere fra Iacobo et de quello ha detto conforme alle sua doctrina, et credo che lo Reverendo Inquisitore habbi mandate le depositione che ha contra di lui. Dio grazia, Vostra Illustrissima Signoria lo bandisse, lui et fra Thomaso da Ferrara, da questa insula che mai piu la vedino, perché se o l’un o l’altro gli ritornasse sarebbono il refugio et apogio de’ discepoli di fra Iacobo.“ ebd., Bl. 44r–v, 51r–v.
43
enger Freund Jacobos und geradezu dessen Spion im Kloster. Er habe bei der Falsch-meldung über die bevorstehende Rückkehr Jacobos noch ausgelassener seiner Freude Lauf gegeben als die Laien.116
116 1559 II 8, Chios. ― Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri: „Monsignor Illustrissimo, li frati medesimi, alcuni sono quelli che poco favore et aiuto dano all’Uffi tio et atendono a star in gratia di quelli che l’hano in odio et perseguitano, come per altre nostre apieno ho suplito. Il P. frate Sixto de Caravonica lettore ne la soa partensa di qua è andato a visitare alcuni de li citati personaliter et è stato benefi ciato da alcuno et s’è detto che viene loro procuratore in Roma, la qual cosa è molto dispi-aciuta alli fi gliuoli di la Santa Chiesa et che desiderano il bene di questa cità. Il P. frate Benedetto da Scio ancora ne la soa partensa per Italia si dice che ancora esso è andato a visitare alcuno di essi ci-tati, di modo che unus edifi cat, alius destruit, perché essendo cosa publica che sono citati et dechiarati excommunicati, li timorati che vedono simil cose si maravigliano, et essi citati prendono magiore orgo-glio. Il predicatore frate Antonino da Chio ha recusato di fare la predica per publicar’ l’abiuratione di Giovanbatista Gentile per non farsi de li inimici. Quando si disse che frate Jacobo da Scio ritornava da noi, m’è stato detto che frate Ambrosio Paterio di Scio pareva che si ralegrassi et discorreva per chiesa parlando cum li soi amici, et di, che venne la nova che esso frate Jacobo ritornava.“ Ebd., Bl. 32r–v, 64r–v, 65r, 66v. ‒ 1559 X 13, Chios, ders. an dens.: „Visitando il P. Priore nostro le celle deli frati in presentia mia et di dio altri padri ha trovato nele bolze [sic] dil P. frate Antonino da Chio che erano dentro ne la soa cassia serrata alcune prediche di Bernardino Ochino che fu capucino et sette dialogi di esso Bernardino, et ho preiso cotal libro apresso di me, essendo da la Santa Inquisitione Romana dannato cum l’autore.“ Ebd., Bl. 34r–v, 61r–62v. ‒ 1559 X 14, Chios, Nicolò Bracelli OP, Prior des Dominikanerkonvents von Chios, an dens.: „Oltra questi dua fratti [Paolo da Medole und Toma-sso da Ferrara] ve ne sono restati doi altri li quali seria benissimo fatto che anche loro si partisseno da Sio per essere amicissimi di fra Iacobo et di tutti suoi amici cun li quali di continuo conversano, et questo non perché siano solum amici di fra Iacobo et de’ suoi amici, et perché conversano cun essi, ma per li cativi uffi cii che fanno contra la Santa Inquisitione et Reverendo padre inquisitore. Et a ciò Vostra Illustrissima Signoria sapi li suoi nomi: Uno fra Antonino de Sio predicatore, il quale per non off endere li secolari non volse aceptare de fare la predica il giorno che si dovea far la abiuratione di Messer Iohan Baptista Gentile, così disse a tal, che il P. inquisitore la facesse lui. Poi, quando io gunsi a Sio priore, assai presto uno gentilhomo de importanza catholico mi avizò che si dicevva che si era partito uno evangelista, cioè, fra Iacobo, et che ne era venuto uno altro, cioè frat’ Antonino sopradetto, ita lo chiamano il 2° evangelista, la causa predicando la XLa [Quadragesima] il giorno di Santo Matthia de predestinatione, mi disse una persona secolare, che havea detto come fra Iacobo (io non gli era), asai a questa persona li dispiacque il suo predicare quel giorno. Fu appresso un giorno il P. inquisitore caritativamente fra loro doi soli, che facesse bene il suo uffi cio et che dovesse reprendere li Lutherani et fare il debito suo a similia, et lui in la seguente predicatione quando respirò la prima volta, cominciò e disse: ,Io ho predicato in tale et tale cità, in Bologna, Genova et alle mie predicationi sonno state persone docte, honorate, maestri in theologia, padri inquisitori, li quali mai mi hanno riprenso che non riprendi li Lutherani, et sonno venuto a Sio per acquistare amicitia, gratia, reputatio-ne et credito cun li miei compatrioti et sonno stato riprenso che non riprendo li Lutherani‘ etc. Et sopra questo si sfogò et andò in grandissima colera et disse tanto pazie et parole mordace contra l’inquisitore (non che lo nominasse per nome ma tutti intesero contra de chi parlava), che ogniuno lo giudicò pazo, et io non me ritrovai alla predica et poco manchò che io il non facesse discendere del pulbito, ma mi ritieni ritrovando me in questo luoco tanto lontano. Et per de le materie che havia detto cun furia disse: ,Però non voglio predicare,‘ e voltò le spale al populo et si partì et cessò di predicare. Consideri Vostra Illustrissima Signoria, che favore dette al’uffi cio della Santa inquisitione, oltra che scandalizò la religione et questo povero convento! Io dil tutto ho avizato li nostri superiori. Lasso la intrinsecha
44
Mit den Untersuchungen des Inquisitors vom Oktober 1559 war die Gruppe der no-torischen Anhänger Frate Jacobos im Dominikanerkonvent unschädlich gemacht wor-den. Allerdings gab es während der Haft Jacobos in der Arrestzelle des Dominikaner-klosters von Mai bis Oktober 1561 wieder Anzeichen dafür, daß einige Ordensbrüder mit dem Gefangenen verbotenerweise gesprochen und möglicherweise dessen Flucht begünstigt hatten. Die Brüder verweigerten diesmal aber unter Berufung auf ein Privi-leg der Mendikanten von Chios, wonach diese nur ordensintern diszipliniert werden dürften, die Aussage.117 Von Kontakten zwischen Jacobo und Angehörigen anderer Or-densgemeinschaften während seiner Tätigkeit auf Chios 1555–1557 erfahren wir nur, daß dem Großinquisitor Michele Ghislieri in Rom 1561 eine Aussage vorlag, wonach der Franziskaner Angelo Giustiniani Garibaldo, Bruder des Podestà Giovanni Battista Giustiniani, Jacobo auf Chios einmal ein lutherisches Buch geliehen habe. Der wies diesen Vorwurf jedoch entrüstet zurück: Jenem Mann hätte er bestimmt nie ein Buch geliehen, nicht einmal ein katholisches und erst recht kein lutherisches, wenn er denn überhaupt solche Bücher besäße.118
amicitia ch’a cun li amici de fra Iacobo et longi ragionamenti loro. L’altro è fra Ambrosio di Sio il quale similmodo è amico caro di fa Iacobo et amico de suoi amici, il quale quando venne la nova che fra Iacobo ritornava a Sio fece piu festa che li secolari. Di lui mi disse uno gentilhomo queste formali parole: ,Padre priore, Vostra Reverentia ha in convento un spione che dice tutto, et dalle nove di fra Iacobo.‘ Trovò questo un giorno una falsa inventione et la sparse per la città in favore di fra Iacobo, cioè che era liberato et come haveano conosciuto che quelli li quali lo haveano accusato haveano detto il falso, et trovò et fi nse che il P. fra Sixto di Genova [Sisto da Siena OP, Hebraist, wirkte am Prozeß gegen Palaeologus in Genua mit] qual è tenuto huomo da bene, gli havesse scritto simil cosa, il quale mai scrive. Stando questi doi in questo convento sempre serà memoria di fra Iacobo. Io iudico che non siano ben qua, perché sempre serano doi apogi delli amici di fra Iacobo, la memoria dil quale, se voler ridur il grege al pristino stato, bizogna estinguere, altrimente sempre gli serà che dire. Et non bizogna rimediarli cun farli simplicamente assignare via da Sio, perché li ritorneriano cun il tempo, ma bizogneria fussono banditi di qua per cento et uno anno, et al fra Antonino predicatore privarlo della predica cun qualche altra giunta.“ Ebd., Bl. 44r–v, 51r–v.117 1561 I 21, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „È necessario che Vostra Reverentia mi mandi iuridicamente una patente amplessima et chiara di poter comandare et procedere, quando fussi bisogno, contra de tutti li ordini mendicanti, perché novamente è occorso un gran disordine in vergogne et scorno dil Santo Uffi tio, nupero che havendo io voluto, per debito mio, examinare alcuni frati nostri dil convento per havere qualche inditio di la fuga di frate Jacobo da Chio. Alcuni di loro si sono ristretti insieme, et uniti sono venuti a oponermi cum dire che loro sono privilegiati et che non gli posso comandare se non gli mostro l’autorità dil Santo Uffi tio essere tale che revochi i loro privilegii, facendone spetial mentione de verbo ad verbum.“ Ebd., Bl. 147r–151v, 152v.118 1561 V 23, Genova, Angelo Giustiniani Garibaldo da Chio OFM Oss. an Michele Ghislieri: „Ben mi son dolsuto che quel huomo perduto e [...] desperato fra Iacomo fra le molte sue iniquità non habbi anchor mancato di sforzarsi di incaricarmi dicendo che io a Sio gli havessi prestato non so che libro lutherano, Monsignor Illustrissimo, anchor che io potessi allegarlo per nemico mio capitale per l’odio grandissimo, qual non solamente a me havea conceputo, ma etiamdio a mio fratello Giovanni Battista, qual oggi è podestà a Sio [...] Non dimeno confi datomi nella bontà di Sua Signoria Illustris-sima, che debba credere semplicamente, lo dico con ogni verità, ch’egli disse la gran bugia con animo pessimo d’off endermi overo si allucino perché io non li prestai mai libro suspetto, e credo né tampoco catholico, e quando havessi havuti non gli h’harei dati.“ Ebd., Bl. 165r–166v. Vgl. FECI, Su le estreme
45
Größeren Widerstand als die Ordensleute vermochten die Anhänger des Frate Jaco-bo unter den Laien, die in den nun folgenden Absätzen behandelt werden sollen, der Tätigkeit des Inquisitors entgegenzusetzen. Bei dem Konfl ikt vom Oktober 1555 hatte Jacobo für die beiden Kommissare Giovanni Battista Gentile und Baldassare Giustinia-ni Stellung bezogen. Jacobos Argumentation bei diesem lokalen Streitfall ging anschei-nend bereits in dieselbe Richtung wie die in seinen späteren Schriften erhobene For-derung nach einer konsequenten Unterordnung der Kirche unter die weltliche Gewalt. Der Umstand, daß der Anwalt der Mahona bei dem Streit auf der Seite des Bischofs gegen die Kommissare stand, läßt vermuten, daß bei der Konfl iktkonstellation auch der grundsätzliche Interessengegensatz zwischen der oligarchischen Mahona und dem Sou-veränitätsanspruch der Republik Genua eine Rolle spielte. Daraus darf man allerdings wohl nicht die Schlüsse ziehen, Jacobo habe als Parteigänger der Kommissare von der Regierung in Genua die Lösung der Probleme der Insel erwartet oder womöglich als Wortführer sozialer Gegensätze in Opposition zur Mahona gestanden, gehörten doch die eifrigsten Anhänger Jacobos selber zu den privilegierten Mahonesi.
In den Schreiben aus Chios an das Sant’Uffi zio in Rom werden mehrere „Freunde des Frate Jacobo“ oder „Lutheraner“119 namentlich genannt, wobei letzterer Begriff im Sprachgebrauch der Inquisitoren sehr unspezifi sch für ein breites Spektrum von Abwei-chungen von der kirchlichen Lehre verwendet wurde. Die ersten, die der Häresievor-wurf traf, waren die beiden Kommissare selbst. Hierin könnte man einen bloßen stra-tegischen Schachzug des Inquisitors zur Stärkung der bischöfl ichen Partei vermuten, wenn nicht aus der Feder der beiden Beamten das von Massimo Firpo aufgefundene Schreiben vom 27. März 1556 vorläge, in welchem diese in signifi kant philoprotestan-tischer Diktion die Rechtgläubigkeit des Dominikaners verteidigten: Dieser habe stets die evangelische und allerchristlichste Lehre („dottrina evangelica e christianissima“) gepredigt und habe nichts ohne Grund in der Heiligen Schrift gelehrt („né ha detto cosa senza la aprobatione della Sacra Scrittura“). Gäbe es an allen Orten der Christenheit solche Prediger, wäre reiche Frucht zu erwarten. Seine Gegner seien so unwissend, daß nicht einer unter ihnen das Evangelium lesen könne („non hanno huomo che sappi pur legere lo evangelio“), ja daß sie gar nicht wüßten, was Evangelium sei („non sapino [...] che cosa sia evangelio“).120 Es erscheint also durchaus plausibel, daß die beiden Kommis-sare nicht nur die juristische Schützenhilfe Jacobs zu schätzen wußten, sondern auch in theologischer Hinsicht seine Verkündigung billigten.
Die Überlieferung der Briefe des Inquisitors setzt im Februar 1559 ein. In ihnen wird Baldassare Giustiniani nicht mehr erwähnt (Gentile war seit Herbst 1557 wieder in Genua und wurde nach Haft im Inquisitionsgefängnis im folgenden Jahr zum Widerruf verurteilt). Den Kern der Anhängerschaft Jacobos in Chios bildeten Pietro Giustinia-
sponde del christianesimo, S. 197f. Zu Angelo Giustiniani OFM (1520–1596) vgl. Gualberto MAT-TEUCCI, Scio Francescana e due illustri minoriti del sec. XVI: Mons. Angelo Giustiniani vescovo die Ginevra. P. Francesco Mauri da Spello poeta, Verna (Arezzo) 1946, S. 13–19.119 Vgl. 1559 X 14, Chios, Nicolò Bracelli OP, Prior des Dominikanerkonvents von Chios, an Mi-chele Ghislieri: „[...] membri di sathanas [...] essendo loro machiati della peste delli errori lutherani et per dir miglie heresie d’ogni sorta.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 44r–v, 51r–v.120 Vgl. oben, Anm. 46.
46
ni di Garibaldi quondam Francisci, Angelo Giustiniani da Campi quondam Pauli und Andrea Giustiniani di Forneto, von denen es hieß, sie seien Lutheraner. Sie standen in Briefkontakt mit dem Kreis der Anhänger Jacobos in Pera und verbreiteten am 20. De-zember 1558 die Nachricht von Jacobos vermeintlich bevorstehender Ankunft.121 Von den drei genannten wird Angelo Giustiniani noch mehrfach erwähnt. Er hatte bei dem im Anschluß an die Konferenz vom Oktober 1555 ausgebrochenen Konfl ikt zwischen der weltlichen Obrigkeit und dem Inquisitor einem vierköpfi gen Ausschuß der Mahona angehört, der die Tätigkeit der Inquisition unterbinden sollte. Bei der Verbannung des Inquisitors und der drei Franziskanerpatres im Frühjahr 1557 hatte er den Inquisitor persönlich abgeführt und war dabei sogar handgreifl ich geworden. Nach der Rückkehr des Inquisitors wurden gegen Angelo Giustiniani und vier weitere Personen (darun-ter der Podestà Giovanni Battista Giustiniani, den Antonio Giustiniani der Behinde-rung der Tätigkeit der Inquisition beschuldigte) durch persönliche Vorladung durch das Sant’Uffi zio in Rom Inquisitionsverfahren eingeleitet. Der Inquisitor zweifelte nicht daran, daß Angelo Giustiniani und dessen Sohn Paolo für die Flucht Jacobos aus der Haft im Dominikanerkloster in Chios am 9. Oktober 1560 verantwortlich zu machen seien.122 Sie seien es auch gewesen, die dem Flüchtigen während der folgenden acht Mo-nate Unterschlupf gewährt und ihm zu der Flucht nach Marseille verholfen hatten.123 Trotz der Warnungen des Inquisitors wurde Angelos Bruder Vincenzo 1560 in Genua zum neuen Podestà ernannt und trat sein Amt 1561 an.124
Möglicherweise gehörte auch Vincenzo Giustiniani da Campi, der letzte Podestà der Insel vor der türkischen Besetzung, zu dem von Frate Jacobo beeinfl ußten Per-sonenkreis, auch wenn die Briefe des Antonio Giustiniani, der 1562 zum Bischof von Naxos ernannt wurde und Chios verließ, keine ausdrücklichen Häresievorwürfe gegen ihn enthalten. Während Vincenzos Amtszeit kam es im April 1564 zu einem Wechsel im Bischofsamt von Chios. Der neue Bischof, der Dominikaner Timotheo Giustiniani, erhielt vom Sant’Uffi zio in Rom umfassende inquisitorische Vollmachten, um gegen die Häresie vorzugehen, die auf der Insel in höchstem Maße verbreitet sei.125 Zur Bekämp-fung der Häresie trafen im Herbst 1564 neun Dominikaner aus Genua in Chios ein. Im November 1564 wurden feierlich die Dekrete des Tridentinischen Konzils in der Kathe-drale verkündet. Durch die Maßnahmen des Bischofs brach der Streit um die Grenzen
121 1559 II 8, Chios, Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri: „[...] la Vigilia di San Thomaso Apostolo capitorono quivi littere soe per via di Pera scritte a Pietro Giustiniano Garibaldo quondam Francisci et ad Angelo Giustiniano da Campi quondam Pauli soi sviscerati nele quali scrivea che era liberato et che aspettava passagio per andare in Pera et poi venir in Scio [...] M’è stato detto che alla porta dil convento Petro Giustiniano Garibaldo et Andrea Giustiniano de lo Forneto de li magiori amici di frate Jacobo et hano fama d’esser Lutherani secondo che è stato deposto, et feceno chimare il sopradetto frate Paulo de Meduli mostrandoli la lettera overo dandoli nova di esso frate Jacobo, et si pensa che l’habbino chiamato per questo perché quel dí medesimo erano venute le littere di frate Jacobo.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 32r–v, 64r–v, 65r, 66v.122 Vgl. oben, Anm. 84, 88.123 Vgl. oben, Anm. 90.124 Vgl. oben, Anm. 76.125 Vgl. FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 204.
47
der kirchlichen und weltlichen Kompetenzen auf der Insel wieder aus. Der Podestà sprach dem Bischof die Berechtigung zur Ausübung der Inquisition ab, solange kein entsprechender Befehl der Regierung in Genua vorliege. Ein solcher Befehl traf jedoch nicht ein, da die Republik 1565 aus unbekannten Gründen den amtlichen Briefver-kehr mit Chios völlig eingestellt hatte. Eine Anordnung des Podestà über Formalitäten bei Eheschließungen (entgegen dem Anspruch des Tridentinums, wonach das gesamte Eherecht ausschließlich in die kirchliche Kompetenz fi el) führte im Februar 1566 zur Eskalation des Konfl ikts zwischen Bischof und Podestà, der schließlich so erbittert ge-führt wurde, daß sich in der Bevölkerung zwei gegnerische Parteien, vescovani und prae-toriani, formierten. In seinem letzten erhaltenen Schreiben an die Regierung in Genua vom 2. März 1566 forderte Vincenzo die Regierung in Genua auf, ihn angesichts der Unversöhnlichkeit der Faktionen in der Bevölkerung von seinem Amt zu entbinden.126 Die Vermutung liegt nahe, daß bei der Unnachgiebigkeit Vincenzo Giustinianis gegen-über seinem bischöfl ichen Rivalen der Einfl uß Jacobos nachwirkte. Eine Reminiszenz an die zerrütteten Zustände auf Chios am Vorabend der Katastrophe liegt in der von Palaeologus elf Jahre später erhobenen (die Tatsachen verzerrenden) Behauptung vor, es bestünde ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Einführung der Römischen Inquisition auf Chios, für die er seinen Erzfeind Michele Ghislieri (Pius V.) persönlich verantwortlich machte, und den Zahlungsschwierigkeiten der Insel gegenüber der Pfor-te, die zu der Besetzung der Insel am 15. April 1566 und der anschließenden Deporta-tion der Mahonesi nach Kaff a und Konstantinopel führten.127
Welche theologischen Akzente, abgesehen von der in zwei Dokumenten anklingenden Betonung der Heiligen Schrift als Grundlage der Lehre,128 Frate Jacobo bei seinen öf-fentlichen Predigten in Chios gesetzt hatte und in welchem Maße er seine Anhänger darüber hinaus in sein Denken eingeweiht hatte, wird aus den Berichten nicht deutlich. Jedenfalls verteidigten die Anhänger Jacobos ihren Meister eifrig gegen den Vorwurf
126 Vgl. ARGENTI, Chius vincta, S. lxxxviii–xcii, 94–108; ID., The Occupation of Chios, S. 362–366.127 1577 [Mähren], Palaeologus an Kaiser Rudolf II.: „Nam deponere omnem cogitationem redeun-di in patriam meam me coegerat infelicitas, quae patriam meam in postremas miserias praecipitavit, siquidem iussu Solimani circiter annum 1564 [!] patria mea, maior regno uno, capta est a Turcis et direpta et in provinciam Turcicam redacta, et tota nobilitas inde eiecta et in exilium in Scythiam missa relictis senibus et vetulis. Adolescentes autem et pueri nobiles per vim facti sunt Turci et in aulam regiam recepti. Causa tanti mali fuit, praeter alia, quod inquisitionis offi cium conatus erat Reverendissimus Cardinalis Alexandrinus [Michele Ghislieri] in patria mea ita ponere, sicut erat in Italia. Et cum fulminibus ecclesiasticis [i.e. censuris ecclesiasticis, excommunicatione] ageret et concitaret principes alios Christianos contra nostros cives, interclusa est navigatio, sine qua nulla urbs maritima consistere potest, et venit in angustias aerarium publicum, ita ut tributum Regi persolvi unum et alterum non potuerit. Intervenit etiam intercalaris annus, qui adhuc est in usu apud Turcos, ut magna vis auri signato deberetur Regi, cuius urbs solvendo non erat. Parebat autem Pontifi ci Ro-mano in patria mea sola arx, quae est paulo minor tota Vienna. Reliqua omnia, suburbium, civitates, oppida, villae, regio tota, sunt sub obedientia Pontifi cis Constatinopolitani in rebus ecclesiasticis. Hunc in modum Solimanus [...] lumen civitatis, patriae, opum, libertatis, magnifi centiae nostrae, quod erat admirandum apud omnes Christianos, in media Turcia lucens, extinxit.“ Wien, HHStA, Rom Varia 3 (alt 2), Bl. 179r–183v, dort 180r.128 Vgl. oben, Anm. 36, 46.
48
der Häresie. Selbst der ehemalige Prior Paolo da Medole behauptete, er habe an Jaco-bos Lehre nichts Häretisches erkennen können.129 Verständlicherweise wäre von den Anhängern des Beschuldigten auch dann nichts anderes zu erwarten gewesen, wenn sie sich über eventuelle Abweichungen der Lehre Jacobos von der offi ziellen kirchlichen Lehre bewußt gewesen wären. Antonio Giustiniani hatte jedoch den Eindruck, daß die Bevölkerung tatsächlich nicht wisse, was an Jacobo Lehre falsch gewesen sei; man ge-winnt den Eindruck, daß der Inquisitor es möglicherweise selbst nicht so genau wußte. Daher bedrängte er seit 1559, also lange bevor das Verfahren abgeschlossen und Jacobo am 5. März 1561 tatsächlich als Ketzer verurteilt wurde, in mehreren seiner Schreiben das Sant’Uffi zio, ihm eine Aufstellung der häretischen Lehrmeinungen Jacobos zuzu-senden. Die Artikel wollte der Inquisitor öff entlich bekanntmachen, damit die Bevöl-kerung die Wahrheit über Jacobo erfahre.130 Als er Anfang Februar 1562 endlich eine Sendung mit Exemplaren des als Plakat gedruckten Verdammungsurteils131 erhielt, ließ er einen Teil davon an den belebten Gassen der Stadt anschlagen und sandte weitere Ex-emplare nach Pera, damit sein dortiger Amtskollege ähnlich verfahren könne.132 Wie der
129 1559 II 8, Chios, Antonio Giustiniani an Michele Ghislieri: „Quanto poi a frate Paulo [...] egli è stato troppo aff ettionato et deff ensor dil sopradetto frate Jacobo mentre che era qua, et troppo ha comendato la soa dottrina, credo bene che procedessi da ignorantia, perché hora dice che non l’havea conosciuto per heretico.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 32r–v, 64r–v, 65r, 66v.130 1559 VII 3, Chios, Antonio Giustiniani an [Thomas Scoto]: „[...] alcuni alla desperata com-batevano per lui, non obstante che fussi in Genova in prigione et aff ermando che non era heretico. Vostra Reverentia si degni darmi aviso dil caso suo, et gran benefi tio saria a questa cità che quivi fussero publicati tutti li errori soi perché alcuni sono stati duri et fermi non potendo credere che habbi errato, etiam di[c]o di quelli che non sono machiati, saria molto a proposito et favor de l’Inquisitione publicare li soi errori per fermare li boni et catholici et sbatere li seguaci.“ Ebd., Bl. 42r–v, 53r–v. ‒ 1559 X 15, Chios, ders. an dens.: „[...] saria di gran profi tto a questa cità che si publicassino li soi errori [Randbemerkung des Thomas Scoto: Non video modo tempus oportunum talia facere], perché alcuni non potevano credere che havessi errato ma che per passione sia stato castigato; saria anche depressione de li machiati li quali sono tanto passionatio che lo diff endono, et e stato quasi un stupore a vedere il gran favore che havea in questa cità.“ Ebd., Bl. 39r–v, 56v. ‒ 1560 III 20, Chios, ders. an dens.: „Vostra Reverentia potrà conferire questo caso importante cum l’Illustrissimo Monsi-gnore Alisandrino et darli quello oportuno rimedio che a voi parra di manifestare a tutto il populo la verità [...] saria necessario che in questo loco si publicassi di frate Jacobo da Chio tutto quello, che ha confessato per la persona soa, a confusione di quelli che lo mantengono, et alevar dil errore queli, che falsamente sono persuasi esso non haver errato; saria di gran frutto questo et benefi tio di questo loco.“ Ebd., Bl. 94r–v. ‒ 1560 X 9, Chios, ders. an dens.: „[...] saria bene a mandar qua tutte le cose ne le quale ha errato et publicare, altrimenti non macherà d’essere diff eso, et una scomunica papale contra di tutti quelli gli hano fato aiuto, conseglio, favore, braccio, recapito in qual si vogli modo per farne demostratione. Io non ho mancato di far le scomuniche et procurato il bando publico del magistrato, ma bisognerebe che la bantita del nostro Signore ne facessi particolar demostratione in questo loco, ove è così favorito.“ Ebd., Bl. 136r–v. ‒ 1561 II 20, Chios, ders. an dens.: Bittet das Sant’Uffi zio „di publicare li errori di frate Jacomo da Chio acciò fusseri disinganati quelli che li sono aff etionati.“ Ebd., Bl. 153r, 177v.131 Vgl. oben, Anm. 9.132 1562 II 3, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „Ho ricevuto quelle de Vostra Reve-rentia con le sententie di f. Giacomo [...] Io dele sententie del su detto fr. Giacomo ne ho mandato
49
Prior des Dominikanerkonvents von Chios im März 1562 in einer Beschwerde an das Sant’Uffi zio berichtete, führte diese Maßnahme jedoch dazu, daß die Lehre Jacobos nun erst recht in aller Munde sei, vor allem bei den jungen Leuten. Der Inquisitor habe die Plakate nur deshalb aushängen lassen, weil er zu feige gewesen sei, die Verurteilung Jacobos persönlich von der Kanzel abzukündigen.133 Die Bemühungen des Inquisitors, die Stadtbevölkerung und die Anhänger Jacobos davon zu überzeugen, daß dessen Leh-re häretisch sei, werfen ein wichtiges Licht auf Jacobos Wirksamkeit als Prediger und Lektor in Chios. Off enbar war Jacobo bedacht gewesen, in der Öff entlichkeit den An-schein kirchlicher Rechtgläubigkeit zu wahren und sich vor dem Ruch der Ketzerei zu hüten. Noch 1572 zeigte sich der alte Diener eines inzwischen verstorbenen Angehöri-gen der Mahona und Sympathisanten Jacobos, den es nach Pera verschlagen hatte, be-trübt über das Gerücht, Paleologus sei der heiligen römischen Kirche ungehorsam. Die ehemaligen Freunde des Palaeologus aus Chios, von denen einige noch in Pera lebten, seien jetzt fast dessen Feinde. Christus und Maria mögen ihn auf der geplanten Reise nach Chios bewahren, das schreibe er als Landsmann und Glaubensgenosse im Gehor-sam der heiligen römischen Kirche.134 Als Palaeologus Ende Mai 1573 in Chios eintraf, löste das Geschrei, er sei ein Ketzer, Lutheraner und Ungläubiger, eine solche Unruhe in der Stadt aus, daß er um sein Leben fürchtete.135 Welcher Art auch immer die Lehre war, mit welcher Jacobo es in den Jahren 1555–1561 zu solcher Popularität in Chios gebracht hatte, sein dortiges Wirken war off enbar mit dem Anspruch der Rechtgläu-bigkeit und der Treue zur katholischen Kirche verbunden gewesen. Von daher wird die Beharrlichkeit plausibel, mit der Palaeologus bis mindestens 1568 seine Rehabilitierung zu erreichen suchte, ohne die ihm die Rückkehr in die Heimat unmöglich schien.
Frate Jacobos Anhänger in Pera
Die Briefe, die Frate Jacobo an seine Anhängern in Chios richtete, als er sich 1558 und 1559/60 auf der Flucht vor der Inquisition in Italien aufhielt, erreichten ihre Adres-saten über Kontaktpersonen in Konstantinopel.136 Diese gehörten zu einer Gruppe von Anhängern Jacobos in der ehemaligen genuesischen Kolonie Galata, dem gegenüber der Kaiserstadt am Zusammenfl uß von Bosporus, Propontis und Goldenem Horn gele-
in [Per]a al vicario di San Pietro, che le publichi nei lochi più publici, et io qui in Chio le publicarò questa Quadragesima.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 194r–v, 199v.133 1562 III 18, Chios, Giovanni de Baro OP, Prior des Dominikanerkonvents von Chios, an Tho-mas Scoto: „[...] non li ha bastato l’animo di publicare il processo di un fra Jacomo di Sio Maxillara, ma solum li ha atacato alli quatro cantoni della città, dove il giorno d’hoggi sono. È stato lui richiesto sì da me come da molti altri signori che li levi, perché la gioventù non fa altro che leggerli e si dubita che non si cazzano nella memoria quelli articuli, e puoi non ne succeda qualche gran male, ma lui egli è ostinato li vol tenir al dispeto del mondo.“ Ebd., Bl. 186r–v, 204v.134 1572 V 12, Pera, Vincenzo N. an Palaeologus, hrsg. in LANDSTEINER, Jacobus Palaeologus, S. 36f.135 Epistola Iacobi Palaeologi de rebus Constantinopoli et Chii cum eo actis, Bl. A2r–v.136 Vgl. oben, Anm. 64, 79.
50
genen Hafenort, der in den Quellen des 16. Jahrhunderts gewöhnlich Pera genannt wur-de.137 Einstmals stolzer Vorposten italienischer Stadtkultur in der Levante, war Pera ein Jahrhundert nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken nach wie vor ein profi tabler Handelsplatz und zugleich Dreh- und Angelpunkt der europäischen Spiona-ge gegen das Osmanische Reich. Die politischen Institutionen der perotischen Genue-sen hatten nach 1453 ein Ende genommen, die osmanische Verwaltung der Stadt unter-stand einem kadı. Die Magnifi ca Comunità di Pera bestand noch dem Name nach fort, war aber lediglich für die Instandhaltung der lateinischen Kirchen zuständig. Die Ge-nuesen und die übrigen lateinischen Christen stellten in der Mitte des 16. Jahrhunderts eine Minderheit innerhalb der perotischen Bevölkerung dar, der eine aus orthodoxen Griechen, Armeniern, Juden portugiesischer Herkunft, Türken (darunter viele Rene-gaten) und einer in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts durch Einwanderung stark an-wachsenden Gemeinde spanisch-arabischer Muslime oder Moriscos zusammengesetzte Mehrheit gegenüberstand. Pera war auch der bevorzugte Wohnort der westlichen, „frän-kischen“ Ausländer, die vorübergehend oder dauerhaft in Konstantinopel ansässig wa-ren, und Sitz der meisten europäischen Gesandtschaften. Für die lateinischen Christen, Ausländer wie Einheimische, waren die Gesandtschaften, vor allem der venezianische Bailo, wichtige Anlaufstellen. Sie waren die Instanz, die am ehesten die Interessen von Angehörigen der lateinischen Gemeinde gegenüber den staatlichen Behörden vertreten konnte, da jene im Osmanischen Reich im Unterschied zu den orthodoxen und orien-talischen Christen und den Juden nicht den Rechtsstatus eines millet besaß. Der seit 1558 in Pera residierende Bailo der Republik Genua war dagegen ausschließlich für Fragen des genuesischen Handels zuständig. Ihm war es ausdrücklich untersagt, sich der Angelegenheiten der lateinischen Peroten oder der in Pera anwesenden Chioten anzunehmen, selbst wenn diese genuesische Bürger waren.138
Kopf der Gruppe von Anhängern Frate Jacobos in Pera war der Generalkommissar des Minoritenordens für den Orient, Giovanni Battista Zeff o. Im Januar 1557 heißt es in einem Bericht des Vikars der Societas Fratrum Peregrinantium des Dominikanerordens,
137 Vgl. Stéphane YERASIMOS, Galata à travers les récits de voyage (1453–1600), in: Edhem ELDEM (Hrsg.), Première Recontre Internationale sur l’Empire Ottoman et la Turquie Moderne (18–22 jan-vier 1985), Istanbul – Paris 1991 (= Varia Turcica, 13), S. 117–129, dort 117. Im engeren Sinne bezeichnet Galata die befestigte Unterstadt, die sich vom Ufer bis zum Hang der ansteigenden Hügel erstreckte, das eigentliche Pera war die auf den Hügeln gelegene angrenzende off ene An-siedlung. 138 Zur Pera im 16. Jahrhundert vgl. Luigi Tommaso BELGRANO, Documenti riguardanti la colo-nia di Pera, Genova 1888; Louis MITLER, The Genoese in Galata, 1453–1682, Journal of Middle East Studies 10, 1979, S. 71– 91; Charles H. FRAZEE, Catholics and Sultans. The Church and the Ottoman Empire 1453–1923, London u.a. 1983, S. 5–7, 28–30; Geo PISTARINO, The Genoese in Pera – Turkish Galata, Mediterranean Historical Review 1, 1986, S. 63–85 (zur Geschichte 1453–1490); Halil İNALCIK, Ottoman Galata, 1453–1553, in: ELDEM (Hrsg.), Première Recontre In-ternationale, S. 17–116; Φάνη ΜΑΥΡΟΕΊΔΗ, Ο Ελληνισμός στο Γάλατα (1453–1600). Κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες [Die Griechen in Galata (1453–1600). Soziale und ökonomische Wirklichkeiten], Ioannina 1992; Eric R. DURSTELER, Venetians in Constantinople. Nation, Identity, and Coexistence in the Early Modern Mediterranean, Baltimore 2006. Zum genuesischen Bailo vgl. MANFRONI, Le Relazioni fra Genova, l’Impero Bizantino e i Turchi, Bd. II, S. 766f.
51
Cosmo da Tirano, Zeff o habe in Pera eine „lutherische Synagoge“ um sich gesammelt. Der Gruppe gehöre auch der Laie Giacomino Drapero an, der nach Italien abgereist sei, um beim Generalminister der Minoriten für Zeff o die Verlängerung der Beauftragung als Generalkommissar zu erwirken.139 Der Text läßt nicht erkennen, ob man sich die von Zeff o gesammelte „Synagoge“ als privaten Konventikel vorzustellen hat oder als eine informelle Hörergemeinde, die zu öff entlichen Predigten Zeff os zusammenzukom-men pfl egte, also vermutlich in der (heute nicht mehr existierenden) Minoritenkirche S. Francesco, der damals größten lateinischen Kirche oder „Kathedrale“ von Pera.140 Die Entstehung der ‒ nach Einschätzung des Berichterstatters philoprotestantisch ori-entierten ‒ Gruppe ging off enbar auf die Jahre 1554–1555 zurück, als Jacobo dem Dominikanerkonvent SS. Pietro e Paolo in Pera141 angehört hatte. Jedenfalls standen
139 1557 I 29, Pera, Cosmo da Tirano OP, Vikar der Congregazione dei Pellegrinanti, an Michele Ghislieri: „Già è passato un’ anno che son qua, e mi dispiace assai l’haver trovato questa cittade non pocco infetta dalla secta Lutherana, et al mio giuditio è molto nutrita da un frate Giovanni Battista Zeff o, conventuale di San Francesco e commissario generale di suoi frati in queste bande. Ho voluto scrivere queste poche parole a Vostra Reverentia et advertirlo per scarigho della conscienza mia, acciò se a quelle parerà dir’ una parola al suo Reverendissimo Generale, faccia quello gli parerà espedi-ente. A me pare che quanto più siamo fra infi deli, tanto più i christiani doveriamo essere megliori, e maxime li religiosi. È partito da Pera per costì un secolare detto Jacomino Drapero, il quale è della medema sinagoga, con animo di operar’ apreso del suo Reverendissimo Generale, acciò sia raff er-mato nel detto offi cio habbiendo compito il tempo suo.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 4r, 5v. Cosma da Tirano war 1555 zum Vikar der Societas Fratrum Peregrinantium ernannt worden und gehörte seit dem 4. April 1555 dem Dominikanerkloster von Chios an, vgl. FECI, Su le estreme sponde del christianesimo, S. 184, Anm. 190. Die Societas Fratrum Peregrinantium bestand in der Mitte des 16. Jahrhunderts wohl nur noch dem Namen nach, vgl. Raymond-Joseph LOENERTZ, La société des frères pérégrinants: Etude sur l’Orient dominicain, Roma 1937 (= Institutum historicum FF. Praedicatorum Romae ad S. Sabinae, Dissertationes historicae, 7); Claudine DELACROIX-BESNI-ER, Les Dominicains et la chrétienté grecque aux XIVe et XVe siècles, Rome 1997 (= Collection de l’École française de Rome, 237); Wolfram HOYER, Die Provinzen und Kongregationen des Domini-kanerordens (Teil 1), Dominican History Newsletter 10, 2001, S. 248–288, dort 285–287.140 Knappe Angaben zur Geschichte des Konvents der Minoriten (OFM Conv.) von S. Frances-co in Pera im 16. Jahrhundert (ohne Erwähnung Zeff os) fi nden sich bei François Alphonse BE-LIN, Histoire de la Latinité de Constantinople, Arsène de CHATEL (Hrsg.), Paris 1894, S. 187–212; Gualberto MATTEUCCI, Un glorioso convento francescano sulle rive del Bosforo. Il San Francesco di Galata di Costantinopoli, c. 1230–1697, Firenze 1967 (= Biblioteca di Studi Francescani, 7); ID., La missione francescana di Costantinopoli, I: La sua antica origine e primi secoli di storia (1217–1585), Firenze 1971 (= Biblioteca di studi francescani, 9); MITLER, The Genoese in Galata, S. 88; Alfonso M. SAMMUT, I francescani nel cuore dell’Impero Ottomano, in: Viviana NOSILIA – Marco SCARPA (Hrsg.), I francescani nella storia dei popoli balcanici nell’VIII centenario della fondazione dell’Ordine. Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 13–14 novembre 2009, Bologna 2011 (= I Balcani tra Oriente e Occidente), S. 1–14.141 Zur Geschichte des Dominikanerkonvents in Pera (SS. Pietro e Paolo, in den Quellen bis ins 16. Jh. hinein auch als S. Domenico bezeichnet) vgl. BELIN, Histoire de la Latinité de Constantinop-le, S. 213–231; Raymond-Joseph LOENERTZ, Les établissements dominicains de Péra-Constantinople, Echos d’Orient 34, 1935, S. 332–349; MITLER, The Genoese in Galata, S. 88f; DELACROIX-BES NIER, Dominicains, S. 9–11. Neben den Patrozinien S. Domenico, S. Pietro und S. Paolo begegnet auch
52
Jacobo und Zeff o bereits damals in enger Verbindung, denn Jacobo wurde von Zeff o begleitet, als er 1555 von Pera nach Chios wechselte. Zeff o blieb damals fünf oder sechs Monate bei Jacobo auf Chios, bevor er wieder nach Pera zurückkehrte.142
Der Häresieverdacht gegen Zeff o mag dazu beigetragen haben, daß die Ordensleitung am 16. Juli 1558 den Franziskaner Franciscus Venetus als ordensinternen Inquisitor in die Provincia Orientis, der das Kloster in Pera angehörte, entsandte.143 Ob dieser tat-sächlich gegen Zeff o vorging, ist jedoch unklar. Im November 1558 berichtete Antonio da Venezia, vom Sant’Uffi zio in Rom beauftragter Inquisitor von Pera und zugleich Nachfolger des Cosmo da Tirano als Vikar der Societas Peregrinantium, von Gerüchten über ketzerische Umtriebe des Zeff o. Dieser sei ein enger Vertrauter des Jacobo da Scio. Der Inquisitor begnügte sich zunächst damit, einige Predigten in der Minoriten-kirche zu halten.144 In den folgenden Monaten erregte Zeff o jedoch weiter Ärgernis, so daß Frate Antonio aufgrund von Zeugenaussagen über Zeff os häretische Lehrmei-nungen und unordentlichen Lebenswandel diesen am 1. März 1559 unter Androhung der Exkommunikation von seinem Amt im Orden und von der Ausübung priesterlicher Funktionen suspendierte und ihm auferlegte, sich in Rom seinem Ordensgeneral oder dem Sant’Uffi zio zu stellen. Aus dem Schreiben geht hervor, daß Zeff o sich nicht im Kloster aufhielt. Die übrigen Brüder wurden daher verpfl ichtet, ihm den Inhalt bei er-ster Gelegenheit mitzuteilen. Zusätzlich wurde ein Briefbote des fl orentinischen Bailo an Zeff o gesandt.145
Als Zeff o am 2. März 1559 trotz des Verbots eine Messe feiern wollte, kam es in Pera zu Unruhe auf den Straßen. Um sich der drohenden Verhaftung durch die Türken zu
die Bezeichnung S. Nicolò, vgl. LOENERTZ, Les établissements dominicains, S. 344–346; Gian Gia-como MUSSO, Genovesi in Levante nel secolo XVI: fonti archivistiche, in: Raff aele BELVEDERI (Hrsg.), Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell’età moderna. Atti del Congresso internazionale di studi storici, Genova 1983, S. 355–380, dort 378–380 (1565 VI 2, „in civitate Pere et conventu sive mon-asterio Sanctorum Petri et Pauli et Sancti Nicolai in civitate Constantinopoli in loco qui dicitur Caff am Macalam“).142 Vgl. oben, Anm. 38.143 1558 VII 16, Rom, Register des Generalministers OFM Conv.: „Frater Franciscus Venetus Or-dinis sancti Francisci Osservantium comendatur omnibus nostris provinciae Orientis, eique praestent omne auxilium, quod ad suum offi cium Sanctissimae Inquisitionis spectare videbitur.“ Rom, Archi-vio Generale OFM Conv., RO 5, Bl. 37r (Mitteilung von fr. Andreas Fieback, Rom).144 1558 XI 22, Pera, Antonio da Venezia OP, Vikar des Dominikanerkonvents von Pera und der Congregazione dei Pellegrinanti des Dominikanerordens, Inquisitor in Konstantinopel, an Miche-le Ghislieri: „Circa la Inquisitione non mancharò in conto alcuno, non sento cosa alcuna che sia de importanza. Il commissario di San Francesco è par[s]o molto intrinsico di fra Iacomo da Sio, si dice cose assai, ma non da gente che sia di fede. Non ho fatto cosa alcuna perché questi padri dicono esser stato scritto in Roma per conto suo. Poi dicono esser molto rimesso, et mi ha concesso il pulpitto come comissario della Santa Inquisitione et essortado, che io opperi, ma con destrezza, et questo si farà con il predicar assiduamente. Non intendo de altri cosa alcuna. Di questo commissario non farò altro, si Vostra Signoria Illustrissima non mi avisa quello che io debbo fare. Il padre Cosmo, vicario passatto, è benissimo informatto del tutto.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 7r–v und 15v.145 1559 III 1, Pera, Antonio da Venezia, Androhung der Exkomunikation gegen Zeff o, ebd., Bl. 37r–v.
53
entziehen, suchte Zeff o in der kaiserlichen Gesandtschaft Schutz. Am 12. März wurde er dennoch von den Türken verhaftet. Der Inquisitor erreichte, daß der Kadi ihm den Gefangenen übergab. Durch vier Bürgen wurde dafür gesorgt, daß Zeff o am 4. April im Dominikanerkonvent zur Vernehmung durch den Inquisitor erschien. Die Türken hatten zugesagt, so berichtete der Inquisitor am Tag der Vernehmung, Zeff o aus Pera zu entfernen, sofern dieser für schuldig befunden würde. Während es sich bei dem Verfah-ren aus türkischer Sicht lediglich um die Einholung eines Gutachtens handelte, befolgte der Inquisitor die Form eines Inquisitionsprozess, soweit ihm dies ohne die Möglich-keit, den Angeklagten zu foltern, möglich war. Die Vernehmung ergab, daß Zeff o über die Lehrmeinungen des Frate Jacobo hinaus (die Antonio da Venezia demnach konkret bekannt waren oder schriftlich vorlagen146) noch weitere Ketzereien lehre und prakti-ziere: Er sei „nach Türkenart“147 verheiratet, bete kein Brevier, beichte nicht, leugne die die Gegenwart der göttlichen Natur Christi in der konsekrierten Hostie, leugne die Existenz des Fegefeuers und esse Fleisch an Fastentagen.148 Antonio da Venezia schloß
146 Es ist denkbar, daß die Aufstellung von (angeblichen) Lehrartikeln, die in dem schriftlichen Widerruf, den Jacobo am 8. August 1558 in der Haft in Genua unterzeichnet hatte und der in dem gedruckten Verdammungsurteil vom 5. März 1561 abgedruckt ist (vgl. oben, Anm. 9), wäh-rend des noch schwebenden Verfahrens nach Konstantinopel gesandt worden war. 147 Dies bezieht sich auf die bei lateinischen wie orthodoxen Christen weit verbreitete Praxis der kiambin-Ehe, die vor dem muslimischen kadı geschlossen wurde, wenn aufgrund kanonischer Ehe-hindernisse oder aus anderen Gründen eine Eheschließung vor einem christlichen Geistlichen nicht möglich oder erwünscht war, dazu vgl. Ioannis ZELEPOS, Multi-denominational interaction in the Ottoman Balkans from a legal point of view: the institution of kiambin-marriages [Abstract], in: Eliezer PAPO – Nenad MAKULKEVIC (Hrsg.), Common Culture and Particular Identities: Christians, Jews and Muslims on the Ottoman Balkans (15th–20th Century), Abstracts of Papers, Belgrade 2011, S. 54f (die vollständige Fassung der Studie erscheint im angekündigten Konferenzband). 148 1559 IV 4, Pera, Antonio da Venezia an Michele Ghislieri: „Piu volte così a Vostra Signoria Illustrissima come al Reverendo Padre Comissario ho scritto circa il comissario di San Franceso di Pera, il padre fra Gioanbaptista di Pera, per il quale molti giorni et messi mi ritrovo molto tribulatto, et sono, massime per non haver mai havutto uno aviso di quanto debba fare, lodatto sia Iddio. Signor Mio Illustrissime, quando io haverò fatto quelo che io sapperò et che io potrò, sarò escusatto a Dio et al mondo: Doppoi molte despossitione in materia de heresia et di mala vita et il rumore grande della cattiva fama del preditto fratte, io lo suspessi dal suo uffi tio et administratione de sacramenti per non poter venir a questo atto di impreggionarlo. Ma egli, superbe, in disprezo, il giorno ibi seguitto volse celebrare, per la qual cosa provocò la città a sdegno contro di se a tal che andorno dal bassa, et fu grandissimo pericolo che fusse per via de’ Turchi giusticiatto. Vedendo questo il fratte ricorse in casa dello imbassator del Re de’ Romani, il quale certo tien nome di buono christiano. Io lo avisai del caso del fratte, mi nottifi cò di non lo favoreggiare come tale. Io lo suspesse il primo di marzo. Et perché temeva che lo imbassator di Franza venesse alle mani con questo del Re de’ Romani overo novo Imperatore, alli 12 il fratte per via de Turchi fu mandato alla [p]reggione turchescha. Ma ve-dendo molti pericoli io levai il fratte delle mani del Turcho, da loro adimandato il chiaus. Et fu fatto d’acordo de tutti uno scritto, prima che il padre parebbe alle mie essamine, et pigliarebbe per loco di preggione quel loco il quale io li consegnarebbe, et 4 huomini da bene ma facevano segurtà, che lui non fugerebbe. Hora è quivi presente nel nostro convento per questo fi ne. Io son certissimo che lui non risponderà a suffi cientia per non potter farli forza. Nella suspensione li comandava che tra uno messe vel circa pigliasse la via per venir a Roma alla Santa Inquisitione, non posso farli forza eccetto per via
54
den begonnenen Prozeß nicht ab, denn am 12. November 1559 wurden Zeff o und ein weiterer Minorit aus Pera, Frate Giovanni de Campis, sub anathematis pena nach Rom vor den General zitiert. Wie es scheint, leisteten sie der Vorladung nicht Folge, so daß die Sache schließlich im Sande verlief.149
Die Nachrichten über Zeff o, die sich zusätzlich zu den Erwähnungen in den Briefen des Inquisitors zusammentragen lassen, deuten an, daß er eine umtriebige Person mit vielfältigen Kontakten in der osmanischen Hauptstadt war. Giovanni Battista Zeff o und sein Bruder, der Dolmetscher Domenico, stammten aus Chios, waren also Landsleute des Frate Jacobo.150 Über die Beauftragung Zeff os als Generalkommissar für den Orient fi nden sich in den Akten des römischen Generalats des Minoritenordens keine Einträ-ge, so daß zu vermuten ist, daß die wenigen Angehörigen der Ordensprovinz Orient ihn zu ihrem provisorischen Geschäftsträger gewählt hatten, wofür Giacomino Drapero (Giacomo Draperio) in Italien eine nachträgliche Bestätigung erwirken sollte.151 Zeff o pfl egte enge Verbindungen zu habsburgischen Diplomaten, und dies off enbar seit dem ersten Jahr der Anwesenheit einer ständigen Gesandtschaft Ferdinands I. Bereits aus dem Jahr 1555 sind zwei Briefe des Veranzio erhalten, die dessen Freundschaft mit Zeff o bezeugen. Der erste der beiden Briefe bestätigt152, daß Zeff o sich im Juli 1555 auf Chios befand. In Konstantinopel wütete zu dieser Zeit die Pest. Veranzio beteuert, daß
di scomunica. Ma lui con tutti li suoi assai si dolevava con dire che senza che lui sapesse de che fusse accusatto non dovea essere fato questo, che fusse publicatto escomunicato non volendo venir in Roma. Io sarò fi nalmente constretto di farlo, ma ho fatto questo per non poter far altro, acciò non dicano che si procede senza giustitia. Siamo tra gente legiera, niente di meno sono andatti alla [p]regione turchescha et il giudice adimandato da loro, il cadi, rimisse la essamina del caso suo a me, con dire che io lo essaminasse, et se io giudicava, che non dovesse star in Pera, lo mandarebbe via. Non potrò far de mancho, che non li comandi, che venghi in Roma, ma non vorà ubedire. Tengo per certo, che una cittatione et scomunica della Santa Inquisitione lo farebbe almeno partire di questa terra. Li suoi articoli depositadi sono che in tutte le cose contra la Santa Madre Giessia convien con fra Giacobo da Sio, et ha questo di piu per il comodo, che lui è maridato alla turchesca, mai dice uffi tio, non si confessa, ha detto nel hostia consecratta non vi essere la divinità, non esserli purgatorio ma quando si more ò in paradiso o allo inferno, magna carne ogni tempo etiam il venerdi et tempori et simile, come io farò vedere a Vostra Signoria Illustrissima per il suo processo, quando io haverò fenitto di formarlo piu giuridico che sia possibile.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 29r–v, 69r–v.149 1559 XI 12, Register des Generalministers OFM Conv.: „Die 12. citati fuerunt ad presentiam Reverendissimi Patris Generalis fratres Joannes Baptista Zeff us et frater Joannes de Campis sub anathematis pena, sunt enim de Pera.“ Rom, Archivio Generale OFM Conv., RO 6, Bl. 10r (Mit-teilung von fr. Andreas Fieback, Rom).150 Vgl. Samuel GERLACH (Hrsg.), Stephan Gerlachs deß Aeltern Tage-Buch der von zween glorwür-digsten Römischen Kaysern, Maximiliano und Rudolpho, beyderseits den Andern dieses Nahmens [...] an die Ottomanische Pforte zu Constantinopel abgefertigten [...] Gesandtschaff t, Frankfurt am Main 1674, S. 331, wo der von Gerlach häufi g erwähnte Domenico in einem Eintrag vom April 1577 als „Dominic von Chio“ bezeichnet wird. Eine seit byzantinischer Zeit auf Chios ansässige adlige Familie Ziff o (Zyphos, Ziphos, Zyvos u.ä.) erwähnt Philip P. ARGENTI, Libro d’oro de la noblesse de Chio, Bd. 1: Notices historiques, London 1955, S. 134f.151 Mitteilung von fr. Andreas Fieback, Archivio Generale OFM Conv., Rom.152 Vgl. oben, Anm. 38.
55
er die vertrauten Gespräche mit dem Adressaten vermisse, doch möge dieser angesichts der Pest nicht übereilt zurückkehren. Veranzio ziehe es vor, sich nach einem Freund zu sehnen, der auf Chios in Sicherheit sei, als nach einem, der schon im Jenseits weile wie der gemeinsame Freund Baldisera di Cagnolini.153 In einem zweiten Brief vom Sep-tember 1555 erwähnt Veranzio weitere gemeinsame Freunde, den Dominikaner Frate Teofi lo von SS. Pietro e Paolo in Pera und den Minoriten Frate Tomasso, und bittet Zef-fo, ihm vor der Rückkehr nach Konstantinopel eine Reihe genau bezeichneter antiker Münzen zu beschaff en, die dem gebildeten Humanisten off enbar noch in seiner Samm-lung fehlten.154 Laut einer Abrechnung des Gesandten Ferdinands I., Ogier Ghiselin de Busbecq, erhielt der padre commissario von Oktober 1557 bis Juli 1559 insgesamt 85 Dukaten ausgezahlt,155 was vermuten läßt, daß er bereits damals als Kaplan bei der Gesandtschaft angestellt war. Diese hatte ihren Sitz nicht in Pera wie die übrigen eu-ropäischen Vertretungen, sondern war im „Deutschen Haus“, einer geräumigen Kara-vanserei am Tavuk Pazarı (Hühnermarkt) oberhalb des Çemberlitaş-Platzes, mitten in einem muslimischen Stadtviertel, interniert.156
Trotz der 1558–59 vom Inquisitor Antonio da Venezia gegen ihn eingeleiteten Maß-nahmen konnte Zeff o anscheinend seine Reputation innerhalb der lateinischen Ge-meinde von Pera wahren. Aus drei undatierten Dokumenten des Vatikanischen Archivs geht hervor, daß er nach 1560 Vermögensverwalter (procurator) der leerstehenden157 Abtei S. Benedetto in Pera war. Die Gärten des umfangreichen Gebäudekomplexes wa-ren, wie die Texte beklagten, wegen der schönen Aussicht inzwischen ein beliebter Ort für die Gartenparties reicher Türken. Das Amt hatte Zeff o bis zu seinem Tod inne.158 Daneben diente Zeff o, wie vermutlich bereits in den Jahren zuvor, als Kaplan im „Deut-schen Haus“.159 Dort trug er sich am 21. Dezember 1567 im album amicorum des habs-
153 1555 VII 10, Konstantinopel, Antonio Veranzio an Giovanni Battista Zeff o in Chios, hrsg. in SZALAY (Hrsg.), Verancsics Antal összes munkái, Bd. 4, S. 69–71, Nr. 32. Aus einem anderen Brief Veranzios (1555 VII 7) geht hervor, daß es sich bei dem erwähnten Baldisera di Cagnolini um den Neff en der venezianischen Kaufl eute Pietro und Antonio Della Vecchia handelte, vgl. ebd., S. 69.154 1555 IX 12, Konstantinopel, Antonio Veranzio an Giovanni Battista Zeff o, ebd., S. 93–96.155 Vgl. Michele LESURE, Michel Černović “explorator secretus” à Constantinople (1556–1563), Tur-cica 15, 1983, S. 127–154, dort 134.156 Zum „Deutschen Haus“ vgl. Karl TEPLY (Hrsg.), Kaiserliche Gesandtschaften ans Goldene Horn, Stuttgart 1968, S. 208–245.157 Vgl. das undatierte Schreiben der Magnifi ca Comunità di Pera an den Papst, ed. Belgrano, Documenti riguardanto la colonia genovese di Pera, 403f, Nr. 26: „la chiesa [...] di San Benedetto che è in Pera, dove non risiede monaco alcuno.“ ‒ Die fi ktive, aber in manchen Einzelheiten gut informierte Beschreibung einer Reise nach Konstantinopel um 1556, die Cristóbal de Villalón zugeschrieben wird, behauptet, es gebe in S. Benedetto noch einen alten Mönch, vgl. Antonio G. SOLALINDE (Hrsg.), Viaje de Turquía, bearb. von Enrique Suárez Figaredo, Barcelona 2006 (on line: http://users.ipfw.edu/jehle/wcotexts.htm), S. 305: „Sant Benito, en éste no hay mas de un fraire viejo“; zum Quellenwert der Viaje de Turquía: Goyita Núñez ESTEBAN, La Constantinopla del Viaje de Turquía, Minerva 2, 1988, S. 333–351. 158 Vgl. BELGRANO, Documenti, S. 405, 408f, Nr. 27–29.159 Der habsburgische Gesandtschaftsprediger Stephan Gerlach berichtet in einem Tagebuchein-trag vom Oktober 1573 anläßlich einer Erwähnung des Domenico Zeff o beiläufi g: „Dieses Domi-
56
burgischen Gesandten Christoph von Teuff enbach ein.160 Zeff o konnte sich im Unter-schied zu den Angehörigen der Gesandtschaft frei in der Stadt bewegen. Da die Türken vermuteten, daß er neben seinem geistlichen Dienst auch eine Agententätigkeit ausübte, wurde er im Juni 1570 von Janitscharen verhaftet und zu Tode gebracht.161
Obwohl sein Name in den Quellen nicht im direkten Zusammenhang mit Frate Ja-cobo erscheint, sei auch der Bruder des padre commissario, Domenico Zeff o (Zeff y) in den Blick genommen. Domenico stand seit spätestens 1557 als Dolmetscher im Dienst der in Konstantinopel weilenden habsburgischen Diplomaten und war von 1560–1567 als Dragoman der kaiserlichen Gesandtschaft fest angestellt, hatte also ständigen Um-gang mit Busbecq, Veranzio, Teuff enbach und David Ungnad, während diese sich jeweils in Konstantinopel aufhielten.162 Domenico war ein Vertrauter des habsburgischen Ge-heimagenten Michael Černović. Černović, der behauptete, aus einem alten serbischen Fürstengeschlecht zu stammen, verfügte über beste Verbindungen zum Sultanshof und beschaff te seit Juli 1556 unter dem Vorwand, Handel mit Venedig zu betreiben, für Fer-dinand I. Informationen über die militärischen Planungen der Osmanen und über die Möglichkeiten eines Bündnisses zwischen Ferdinand und dem persischen Schah gegen die Türken. Seit 1558 stand Černović zugleich als Großdragoman im Dienst des venezia-nischen Bailo in Pera, bis er Anfang 1563 von den Venezianern als habsburgischer Agent enttarnt wurde. Nachdem er sich mit Not aus der Gefahr gerettet hatte, blieb Černović in den folgenden Jahren weiter als Informant in habsburgischen Diensten und verfolgte den Gedanken eines habsburgisch-persischen Bündnisses. Er starb 1576 in Ragusa.163 Wegen
niks Bruder ist ein Mönch und ein Capellan unsers Hauses gewesen, der allerley Sprachen erfahren können und dem Herrn Gesandten angezeiget, aber von denen darzu verordneten Janitscharen, als er des Abends aus unserm Hause gegangen, auff gehebt und verzuckt worden, daß kein Mensch weiß, wo er hingekommen.“ GERLACH (Hrsg.), Stephan Gerlachs deß Aeltern Tage-Buch, S. 32f.160 Der Eintrag lautet: Padre Io. Battista Zeff o de Pera 1567 adi 21 Decembre in Constantinopoli nel grande Carvasara, zit. Richard G. SALOMON, The Teuff enbach Copy of Melanchthon’s ‚Loci Communes‘, Renaissance News 8, 1955, S. 79–85, dort 83. Der von Salomon beschriebene Band (University of Oklahoma), eines der frühesten bekannten Stammbücher, stammt aus der Berliner Sammlung Warnecke, vgl. den Auktionskatalog von A. HILDEBRANDT, Stammbücher-Sammlung Friedrich Warnecke Berlin, Leipzig, C.G. Boerner, 2. Mai 1911, Nr. 1.161 Vgl. Josip ŽONTAR, Obveščevalna služba in diplomacija avstrijskih Habsburžanov v boju proti Turkom v 16. stoletju. Der Kundschafterdienst und die Diplomatie der österreichischen Habsburger im Kampf gegen die Türken im 16. Jahrhhundert, Ljubljana 1973 (= Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede, Dela 18, Inštitut za občo in narodno zgodovino, 5), S. 156.162 Zu Domenico Zeff o (Zeff y) vgl. Ralf C. MÜLLER, Prosopographie der Reisenden und Migranten ins Osmanische Reich (1396–1611). Berichterstatter aus dem Heiligen Römischen Reich, ausser burgundische Gebiete und Reichsromania, Leipzig 2006, Bd. 10, S. 310–314 (mit ausführlichen Quellenverweisen); ID., Franken im Osten. Art, Umfang, Struktur und Dynamik der Migration aus dem lateinischen Westen in das Osmanische Reich des 15./16. Jahrhunderts auf der Grundlage von Reiseberichten, Leipzig 2005, S. 263, 270, 408, 490; häufi g erwähnt der 1573 nach Konstantin-opel gekommene Stephan Gerlach den Dolmetscher Domenico, vgl. Gerlach (HRSG.), Stephan Gerlachs deß Aeltern Tage-Buch, S. 32–33, 131, 154, 159, 255, 283, 331, 375, 426, 506.163 Zu den Beziehungen zwischen Domenico Zeff o und Černović vgl. MÜLLER, Prosopographie, Bd. 2, S. 174–183; ŽONTAR, Obveščevalna služba, S. 156; LESURE, Michel Černović, S. 134, 145.
57
seiner Mitwisserschaft an den geheimen Machenschaften des Černović fi el Domenico Zeff o beim Sultanshof in Ungnade. Im April 1566 stand er gemeinsam mit seiner Familie und seinem Bruder unter Hausarrest,164 1567 wurde er nach Kaff a verbannt. Da sich die kaiserliche Gesandtschaft für ihren langjährigen Dragoman verwandte, durfte Domeni-co 1570 nach Konstantinopel zurückkehren. Bis 1578 werden seine Dolmetscherdienste für habsburgische Diplomaten erwähnt. Als Anerkennung für die Loyalität des Vaters wurde nach dessen Tod dem Sohn Augerio 1579 vom kaiserlichen Botschafter Joachim von Sinzendorff eine Dolmetscherausbildung ermöglicht.165
Der in dem Bericht des Cosmo da Tirano vom 29. Januar 1557 genannte Giacom(in)o Drapero da Pera wurde auch in der Zeugenaussage des Kaufmanns Domenico Gayano vor der Inquisition in Venedig vom Dezember 1558 erwähnt. Demnach besuchte Jacobo im Juni 1557 (während er sich auf der Durchreise nach Ferrara befand) in Venedig den im Haus des Gayano krank liegenden „Jacomo de Draperiis“ aus Pera, einen Verwand-ten des Gayano.166 Giacomo war ein Angehöriger der perotischen Kaufmannsfamilie Draperio, die bereits vor 1453 eine bedeutende Rolle in der genuesischen Kolonie Galata gespielt hatte und die es unter den neuen Herrschern verstanden hatte, ihren Reichtum weiter zu mehren.167 Auch Drapero, der mit Ragusa und Venedig Handel trieb und als kapitalstarker Finanzier den habsburgischen Gesandten Busbecq (1560) und Albert de Wijs (1562) größere Darlehen gewährte, gehörte zum Umfeld des habsburgischen Ge-heimagenten Michael Černović. Als unter Maximilian II. 1566/67 der Plan des Černović für ein habsburgisch-persisches Gegenbündnis gegen die osmanisch-französische Allianz wieder aufgenommen wurde, wurde Giacomo Drapero als habsburgischer Gesandter mit einer Mission an den Schah von Persien betraut, die jedoch nicht zustandekam.168 Auch
164 1566 IV 29, Konstantinopel, Adam de’ Franchi, Geheimagent, an Maximilian II., Wien, HHStA, Turcica 17, Berichte 1566, hrsg. in ARGENTI, Chius vincta, S. 135f, N. 53.165 Vgl. MÜLLER, Prosopographie, Bd. 10, S. 310–311; ID., Franken im Osten, S. 207.166 1558 XII 2, Venedig, Aussage des Domenico de Gayano da Pera: „Fo questo jugno un’anno che esso fra Jacomo venne in casa mia per visitar un mio parente, che era amalato a casa mia, quel mio parente ha nome Jacomo de Draperiis da Pera et è retornato in Pera.“ Venezia, ASt, Sant’Uffi zio, b. 14, fasc. proc. 14 (Fra Giacomo da Scio), vgl. Anm. 61.167 Zur Geschichte der Familie Draperio vgl. Michel BALARD, La société pérote aux XIVe et XVe siècles: autour des Demerode et des Draperio, in: Nevra NECIPOGLU (Hrsg.), Byzantine Constantino-ple. Monuments, Topography and Everyday Life, Leiden 2001 (= The medieval Mediterranean, 33), S. 299–311; Thierry GANCHOU, Autonomie locale et relations avec les Latins à Byzance au XIVe siècle: Ioannes Limpidarios / Libadarios. Ainos et les Draperio de Pera, in: Damien COULON et al. (Hrsg.), Chemins d’outre-mer. Études d’histoire sur la Méditerranée médiévale off ertes à Michel Balard, Paris 2004 (= Byzantina Sorbonensia, 20), S. 353–374. Bekanntester Angehöriger der Familie im 15. Jahrhundert war der Finanzmagnat Francesco Draperio, vgl. Laura BALLETTO, Draperio (Drape-rius, de Draperio, De Draperiis), Francesco, in: Dizionario Biografi co degli Italiani 41, Roma 1992, S. 681–684. Nach der Familie war eines der Quartiere des osmanischen Galata benannt, vgl. İNALCIK, Ottoman Galata, S. 34. Im späten 16. Jahrhundert stiftete die Familie die Kirche Sta Ma-ria Draperis, deren Name auch nach der Verlegung der Kirche in die Oberstadt von Pera bis in die Gegenwart bewahrt blieb, vgl. MITLER, The Genoese in Galata, S. 89. Zu den Geschäftsbeziehungen der Draperio nach Chios vgl. PISTARINO, Chio dei Genovesi, Index, s.v. Draperio, Drapoza.168 Zu Giacomo Draperio vgl. MÜLLER, Prosopographie, Bd. 2, S. 174–183, 256f; zu dessen Be-ziehungen zu Černović vgl. Josip ŽONTAR, Michael Černović, Geheimagent Ferdinand I. und Maxi-
58
der in Venedig ansässige Verwandte des Draperio, der Perot Domenico Gayano, scheint mit dem Netzwerk des Michael Černović in Verbindung gestanden zu haben, denn nach dem Scheitern der Pläne des Černović bot sich im Januar 1567 einer von dessen tür-kischen Kontaktleuten, ein Dragoman des Sultans, in Venedig einem spanischen Diplo-maten als Agent an, wobei er Gayanos Kontor in Venedig als Kontaktadresse angab.169
Außer Giovanni Battista Zeff o und Giacomo Draperio, die off enbar als enge Ver-trauten des Frate Jacobo in Pera gelten können, gab es in Pera noch weitere Anhänger. Laut einem Bericht vom Juni 1560 (während Jacobo bereits in Chios inhaftiert war, was in Konstantinopel zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war) breitete Zeff o ge-meinsam mit vier oder fünf Gesinnungsgenossen in Pera Jacobos Lehre aus und unter-hielt Kontakte mit einem weiteren Kreis von Anhängern in Saloniki. In der Hoff nung, möglichst viele der von der Häresie befl eckten Personen bekehren zu können, bat der Inquisitor Antonio da Venezia seine römischen Vorgesetzten im Juni 1560 um die Ge-währung eines Plenarablasses für die Widerrufswilligen.170
Während die Berichte des Antonio Giustiniani über Frate Jacobos Anhänger in Chios kaum konkrete Hinweise auf den theologischen Charakter der Irrlehre Jacobos enthalten, ordnete der Inquisitor von Pera die Gruppe um Zeff o aufgrund der Verhöraussagen vom März 1559 anhand konkreter theologischer Lehraussagen dem philoprotestantischen Spektrum zu. Wie bereits in Chios, gehörten Jacobos Anhänger, soweit sie namentlich bekannt sind, der lokalen Elite an. Außer den theologischen Interessen verband die pe-rotische Gruppe eine gemeinsame politische Orientierung an Ferdinand I. Einige ihrer Mitglieder waren aktiv an den geheimen Aktivitäten des Michael Černović beteiligt. Ob letzteres auch für Jacobo selbst zutriff t, muß off enbleiben. Jedenfalls verkehrte auch er, wie der herzliche Abschiedsbrief von Veranzio vom 12. April 1557 zeigt,171 mit den Angehörigen der kaiserlichen Gesandtschaft, um welche sich seit 1555 ein Kreis von Personen gesammelt hatte, die ihre Sprachkenntnisse und Kontakte (Gebrüder Zeff o), ihre weltpolitischen Phantasien (Černović) und ihr Kapital (Draperio) den Diplomaten anboten. Dies waren keine alltäglichen, beiläufi gen Kontakte, denn während man den Angehörigen der übrigen Gesandtschaften und der italienischen Bailate auf den Gassen von Pera begegnen konnte, bedurfte es eines gewissen Aufwands, um in die Kaiserstadt überzusetzen und das Deutsche Haus aufzusuchen.
Veranzios Schreiben vom April 1557 ist zugleich das früheste erhaltene Dokument, in dem Jacobo mit dem vornehmen byzantinischen Zunamen Palaeologus bezeichnet
milians I., und seine Berichterstattung, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 24, 1971, S. 169–222, dort 219; ID., Obveščevalna služba, S. 152, 159; LESURE, Michel Černović, S. 135.169 Vgl. BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 203f.170 1560 VI 17, Pera, Antonio da Venezia an Michele Ghislieri: „Quel fra minore [Zeff o] suo amicissimo resta ancora in quela foggia piu atra che mai. Mi doglio, che tengono la rispondentia con Salonichi. Questi con quatro o cinque [am]morbano questa terra, et tanto piu hanno ardire, quanto hanno vidutto queste littere di frate Giacomo [...] Quando Vostra Signoria Illustrissima volesse far poi uno summo favor a questo populo, sarebbe di mandargli uno giubileo et che fussa perdonatto a tutti quelli, chi havessero tenutte oppinione heretice et favoreggiatto frate Giacomo da Sio.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 104r–v, 121r–v.171 Vgl. oben, Anm. 53.
59
wird. Nach seinen eigenen Angaben in einer Rechtfertigungsschrift an Pius V. (1568) hatte Jacobo bereits während des Studiums in Italien diesen Namen geführt, zunächst anscheinend als wohltönenden Humanistennamen und nicht in ausgesprochen be-trügerischer Absicht. Auch in Konstantinopel (wo angeblich noch echte Nachfahren der letzten byzantinischen Kaiserdynastie lebten,172 aber auch Emporkömmlinge wie der Finanzmagnat Michael Kantakuzenos173 sich mit kaiserlichen Familiennamen schmückten) habe niemand daran Anstoß genommen, daß er sich Palaeologus nann-te.174 Tatsächlich redete ihn auch der alte Diener eines Giustiniani aus Chios, von dem Palaeologus 1572 den oben erwähnten Brief erhielt, mit diesem Namen an.175 Der Traum von vergangener Größe, der das lateinische Milieu von Pera prägte, vielleicht auch das Beispiel der angeblich fürstlichen Herkunft des Černović, mögen Jacobo dazu bewegt haben, sich die Legende einer imperialen Abstammung zuzulegen. Mit der Zeit wurde diese Legende zu einem wichtigen Baustein seines maßlosen politisch-theologischen Sendungsbewußtseins.176
Frate Jacobo und die Marranen von Saloniki und Pera
Daß es Jacobo und Giovanni Battista Zeff o um mehr ging als die lokale Predigttätig-keit und die religiöse Erbauung ihrer Gemeinden in Chios und Pera, wird daran erkenn-bar, daß in den Berichten an das Sant’Uffi zio in Rom noch ein weiterer Kreis von Sym-pathisanten des Frate Jacobo erwähnt wird. In dem Antonio da Venezia vorliegenden Schreiben Jacobos aus Zakynthos vom Frühjahr 1560 hatte dieser Zeff o gebeten, auch die Freunde in Saloniki von seiner bevorstehenden Rückkehr zu benachrichtigen.177
172 Vgl. CRUSIUS, Turcograeciae Libri Octo, S. 67, 497: „Vivebant adhuc [1576] duo fratres Palaeolo-gi; unus, nomine Constantinus, metu Michaelis Cantacuzeni ad Tartarum profugus, alter, cum fi liis trans sinum in oppido Galata, seu Pera, degens. Quidam Constantinopoli, inquit Gerlachius 1578, se Palaeologum vocat, sed non est. Pragae Bohemiae ante aliquot annos etiam quidam Pseudopalaeolo-gus fuit, e Chio oriundus, qui Graecum epitaphium professori Graeco scripsit.“173 Vgl. ebd., 67f; GERLACH (Hrsg.), Stephan Gerlachs deß Aeltern Tage-Buch, S. 55, 60, 223; BRAU-DEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 471–473.174 1568 nach II 15, Wien, Palaeologus an Papst Pius V. Wien, HHStA, Rom Varia 3 (alt 2), Bl. 85r–115v, dort 92r, hrsg. in SZCZUCKI, W kręgu myślicieli heretyckich, S. 199–229, dort 206. – Emilia Sarou-Zolota fand in der mit dem Jahr 1580 beginnenden Taufmatrikel der lateinischen Gemeinde von Chios (jetzt im römisch-katholischen bischöfl ichen Ordinariat auf Tinos) Belege für die Familiennamen Lampadarios und Palaeologus (1581 ein Manuil Paliologo sowie des-sen Tochter Angela) und nahm daher an, die von Frate Iacobo angenommenen Familiennamen Olympidarios (als humanistische Veredlung von Lampadarios) und Palaeologus könnten auf Überlieferung beruhen, vgl. Αιμιλία ΣΆΡΟΥ-ΖΟΛΏΤΑ, Το αρχείον της Λατινικής επισκοπής Χίου [Das Archiv des lateinischen Bistums von Chios], Πρακτικά της Χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας 1936–39, per. 3, tom. 4, 1939, S. 175–200, dort 195f.175 Vgl. oben, Anm. 134.176 Vgl. RILL, Jacobus Palaeologus, S. 33–36.177 1560 VI 17, Pera, Antonio da Venezia an Michele Ghislieri: „Quel fra minore suo amicissimo resta ancora in quela foggia piu atra che mai. Mi doglio, che tengono la rispondentia con Salonich.“
60
Nach dem Bekanntwerden der Inhaftierung Jacobos durch den Inquisitor von Chios am 9. Mai 1560 wurden die „Freunde des Fra Giacomo in Saloniki und Pera, sowohl Häre-tiker als auch Marranen“, umgehend tätig und veranlaßten noch vor dem 12. Juni „eine gewisse marranische Dame“, den Sultan zu bitten, er möge den Behörden auf Chios die Freilassung und Auslieferung Jacobos nach Konstantinopel befehlen. Einem solchen Befehl würden sich diese sich kaum verweigern können. Der Inquisitor von Pera riet da-her seinem Kollegen auf Chios, den Gefangenen schnellstmöglich nach Kreta und von dort weiter nach Italien zu bringen.178 Am 8. Oktober 1560 (einen Tag vor der Flucht Ja-cobos aus dem Gefängnis in Chios) berichtete Antonio da Venezia aus Pera erneut von den Bemühungen der Marranen und Häretiker von Saloniki beim Großherrn um die Freilassung Jacobos. Die Behörden von Chios würden einem solchen Befehl nur allzu gerne gehorchen. Eine Überführung Jacobos auf dem Seeweg erscheine ihm inzwischen allzu riskant, zu groß sei die Gefahr, daß Jacobo fl iehen und sich durch einen Übertritt zum Judentum oder zum Islam endgültig der Inquisition entziehen könnte.179 Aus Pera erreichte die Warnung, daß am Hof des Sultans die Freilassung Jacobos betrieben wer-de, im August 1560 auch den Inquisitor von Chios.180
Die „Marranen und Häretiker“ von Saloniki und Pera waren ein neues Phänomen der 1550er Jahre. Nachdem die portugiesische Inquisition 1536 begonnen hatte, Neuchristen jüdischer Abstammung systematisch zu verfolgen, war es zu einer starken Auswanderung portugiesischer Marranen nach Italien gekommen. Dort entstand unter den Migranten eine Rückkehrbewegung zur jüdischen Religion, deren Zentrum in den Jahren 1552–1555 Ferrara war. Finanziell gefördert wurde das humanistisch-gelehrte Projekt der bewußten Wiederaneignung der Religion der Väter von der wohlhabenden Mäzenin Donna Gracia Mendes. Judaisierende Tendenzen zeigten sich auch bei den portugiesischen Zuwanderern in Ancona, dem wichtigsten Adriahafen des Kirchen-
ACDF, St. st., Q3b, Bl. 104r–v, 121r–v (vgl. oben, Anm. 170). ‒ 1560 X 8, Pera, Antonio da Vene-zia an Thomas Scoto: „Il venerdì santo [1560 IV 13] mi comparve una littera scritta al Zante da fra Giacomo, et nottifi cava a questo suo Zeff o la sua andatta in Alessandria, et lo esortava a salutare li amici, quali sono in Pera et Salonichi.“ Ebd., Bl. 83r–v, 143v (vgl. oben, Anm. 78).178 1560 VI 12, Pera, Antonio da Venezia an Michele Ghislieri: „Fra Giacomo è in Sio nelle forze del Sant’Offi tio della Inquisitione [...] Di novo son stato certifi cato, che una certa Signora Marana a instantia delli amici di fra Giacomo chi sono in Salonich et in Pera, così heretici come Marani, vogliono cavar uno comandamento dal Gran Signor che li Siotti gli diano questo fra Giacomo, et che venghi in Pera. Audendo questo comandamento li Siotti sarano sforzatti consegnarlo nelle sue mani. Di questo o datto nova in Sio essortandoli che lo mandino in Candia, ma cauttamente per molti ris-petto quali gli o detto.“ Ebd., Bl. 105r–v, 120v.179 1560 X 8, Pera, Antonio da Venezia an Thomas Scoto: „Non son manchatto avisar poi in Sio il grande pericolo nel qual è fra Giacomo, che sia un’altra volta liberatto. Li Marani et heretici da Salonichii fanno forza, che per denari il Gran Signor lo dimandi alli Siotti, li qualli ubidirano molto volentiera [...] Credo che quando lo facessi condur da Sio in Roma, sarà in grandissimo pericolo che non fugga et farsi Marano o Turcho.“ Ebd., Bl. 83r–v, 143v.180 1560 VIII 11, Chios, Antonio Giustiniani an Thomas Scoto: „Novamente il vicario di Pera mi scrive haver presentito, che alcuno procura in Pera per meggio di la Porta dil Gran Turco ottenere un commandamento che mi sia tolto da le mani et mandato in Constantinopoli.“ ACDF, St. st., Q3b, Bl. 85r–v, 139r–141v (vgl. oben, Anm. 81).
61
staats. Zu dem wiederaufl ebenden Interesse an der Religion der Vorfahren als einer al-ternativen religiösen Identität mögen sowohl krypto-jüdische Traditionen, die in einigen der (bereits seit mehreren Generationen katholischen) Familien noch lebendig waren, als auch die Erfahrung, von Seiten der Römischen Inquisition pauschal judaisierender Tendenzen verdächtigt zu werden, beigetragen haben.181 Eine andere mögliche Reaktion der Neuchristen auf die Erfahrung der Verdächtigung und Ausgrenzung war die Suche nach innerchristlichen Alternativen. Die Hypothesen der älteren Forschung, es habe bei den Marranen eine besondere Affi nität zu nonkonformistischen, spiritualistischen und reformatorischen Strömungen gegeben und es bestünde ein spezifi scher Zusam-menhang zwischen den Marranen und der Entstehung des Antitrinitarismus,182 wurden in neueren Beiträgen in diff erenzierter Form aufgegriff en und für konkrete lokale und regionale marranische Milieus präzise belegt.183
Um 1550 setzte die Emigration portugiesischer Neuchristen aus Italien ins Osma-nische Reich in, die sich infolge der Judengesetzgebung Papst Pauls IV. von 1555 weiter verstärkte. In der Levante hatten ein halbes Jahrhundert zuvor bereits die 1492 aus Spanien gefl ohenen Juden Zufl ucht gefunden und in Saloniki und Konstantinopel öko-nomische und kulturell bedeutende Gemeinden gebildet. Für die portugiesischen Neu-ankömmlinge bot die Konversion zum Judentum die Möglichkeit, einen gesicherten Rechtsstatus im Osmanischen Reich zu erwerben. Die Integration der marranischen Konvertiten ins jüdische millet war jedoch ein komplexer Prozeß. Während es sich bei den seit 1492 eingewanderten spanischen Sepharden um Personen handelte, de-ren jüdische Identität religionsgesetzlich unumstritten war, da sie entweder nie zum Christentum konvertiert waren oder als Zwangskonvertiten (anusim) galten, denen die Rückkehr zum Judentum ohne Erschwerungen off enstand, wurden die nach 1497 in Portugal verbliebenen und dort zum Christentum konvertierten Juden sowie ihre Nach-fahren von den Rabbinen des Osmanischen Reichs als Apostaten (meschummadim) oder Nichtjuden angesehen. Sie mußten daher eine formale (Re-)Konversion zum Ju-dentum vollziehen. Diese Rechtspraxis konnte für die Betroff enen zwar von Vorteil sein (alle Verpfl ichtungen aus vor der Konversion geschlossenen Ehen wurden hinfällig),
181 Vgl. Renata SEGRE, La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento, in: Corrado VIVANTI (Hrsg.), Gli ebrei in Italia, I.: Dall’ alto Medioevo all’età dei ghetti, Torini 1996 (= Storia d’Italia, Annali, 11), S. 709–778, dort 714–733; ID., La formazione di una comunità marrana: i portoghe-si a Ferrara, in: VIVANTI (Hrsg.), Gli ebrei in Italia, Bd. 1, S. 781–841; Maria Teresa GUERRINI, New Documents on Samuel Usque, the Author of the Consolaçam as tribulaçoens de Israel, Sefarad 61, 2001, S. 83–90; Gabriella ZAVAN, Gli ebrei, i marrani e la fi gura di Salomon Usque, Treviso 2004; Claude B. STUCZYNSKI, Art. „Marranesimo“, in: Dizionario storico dell’Inquisizione, Bd. 2, S. 989–997.182 Vgl. George Huntston WILLIAMS, The Radical Reformation, 3. Aufl ., Kirksvill (MO) 2000, S. 35–41, 802f; Richard H. POPKIN, Marranos, New Christians and the beginnings of modern anti-Trinitarianism, in: Yom Tov ASSIS (Hrsg.), Jews and Conversos at the Time of the Expulsion, Jeru-salem 1999, S. 143–161.183 Vgl. zu marranischen Milieus in Spanien: Stefania PASTORE, Un’eresia spagnola: spiritualità conversa, alumbradismo e inquisizione (1449–1559), Firenze 2004; zu Italien: Luca ADDANTE, Ere-tici e libertini nel Cinquecento italiano, Roma – Bari 2010.
62
war aber, wie Minna Rozen aufzeigte, auch Ausdruck eines religiös begründeten Über-legenheitsgefühls der bereits ansässigen Juden gegenüber den Neuankömmlingen.184
Die Marranen waren in Portugal und Italien kulturell in ihre christliche Umwelt in-tegriert gewesen und hielten an westlicher Bildung, Kleidung und Alltagskultur auch in der Türkei fest, wodurch sie sich von den dort ansässigen Juden augenfällig abho-ben. In Konstantinopel ließen sie sich nicht nur in den traditionellen Judenvierteln nieder, sondern lebten bevorzugt im europäisch geprägten Pera.185 Off enbar vollzogen nicht wenige Marranen die rabbinischen Konversionsriten nur unter inneren Vorbehal-ten, andere vollzogen diesen Schritt gar nicht oder hielten trotz des Übertritts auf die eine oder andere Weise an christlichen Vorstellungen und Praktiken fest.186 Im mar-ranischen Immigrantenmilieu von Saloniki fanden auch christliche Nonkonformisten nichtjüdischer Herkunft Zufl ucht, so seit 1552 eine Gemeinde antitrinitarischer Täufer aus dem Veneto.187 Die Wahl Salonikis als Fluchtziel venezianischer christlicher Dis-
184 Vgl. Benzion NETANYAHU, The Marranos of Spain from the Late 14th to the Early 16th Century according to Contemporary Hebrew Sources, 3. Aufl ., Ithaca (NY) 2004, S. 211–215; Minna ROZEN, A History of the Jewish Community in Istanbul. The Formative Years, 1453–1566, Leiden – Boston 2010 (= The Ottoman Empire and its Heritage, 26), S. 95–98, 356f.185 Vgl. ROZEN, A History of the Jewish Community, S. 49, 60; siehe auch DURSTELER, Venetians in Constantinople, S. 105–112.186 Vgl. Pier Cesare Ioly ZORATTINI (Hrsg.), Processi del S. Uffi zio di Venezia contro ebrei e gi-udaizzanti, Bd. 1 (1548–1560), Firenze 1980, S. 225–246, Prozeß gegen den portugiesischen Marranen Odoardo Gomez, 1555, dort 228 über portugiesische Zuwanderer in Saloniki und Konstantinopel, die zwischen Christentum und Judentum schwankten; siehe auch Joseph NEHA-MA, Histoire des Israelites de Salonique, Bd. 5: Période de Stagnation – La Tourmente Sabbatéenne (1593–1669), Salonique 1959, S. 9–20, dort 19, ein Zwischenfall von 1597, bei dem spanische Sephardim Juden portugiesischer Herkunft beschimpften: „Kistiano [„Christ“], hijo de Kistiano, y todos los Portugueses son Kistianos“; zur Einwanderung portugiesischer Marranen nach Salo-niki vgl. Joseph NEHAMA, Histoire des Israelites de Salonique, Bd. 3/1: L’Age d’or du Sefaradisme Salonicien (1536–1593), Paris – Salonique 1936, S. 8–49, 57–64; Bd. 3/2–4, S. 96–121. Zur kul-turellen Sonderstellung und religiösen Ambivalenz der portugiesischen Marranen innerhalb des Judentums in der Levante vgl. Jonathan I. ISRAEL, Diasporas within a Disapora: Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (1540–1740), Leiden – Boston – Köln 2002 (= Brill’s Series in Jewish Studies), S. 41–65, dort der Hinweis auf den Bericht eines portugiesischen Franziskaners von einer Reise ins Heilige Land in den Jahren 1563–1566, der behauptete, er sei zahlreichen Bei-spielen für krypto-christliche Praktiken und Vorstellungen bei den zum Judentum konvertierten Marranen begegnet: Pantaleão DE AVEIRO, Itinerario da Terra Sancta, e suas particularidades, Lis-sabon 1593, Bl. 234r, 235v, 240r, 251r–252v. 187 Vgl. Emile POMMIER, L’itinéraire religieux d’un moine vagabond italien au XVIe siecle, Melanges d’archeologie et d’histoire de l’École française de Rome 66, 1954, S. 293–322 (Aussagen des ehemaligen Mönchs Giovanni Laureto di Buongiorno vor der Inquisition in Venedig, der unter Busales Einfl uß Täufer und Antitrinitarier geworden war, 1552 nach Saloniki auswanderte, dort von der Täufergemeinde exkommuniziert wurde und zum Judentum konvertierte, um schließlich zur katholischen Kirche zurückzukehren, indem er über Chios nach Venedig zurückreiste und sich dort der Inquisition stellte); Aldo STELLA, Dall’anabattismo al socinianesimo nel Cinquecento veneto. Richerche storiche, Padova 1967, S. 96, 100, 134; ID., Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo. Nuove ricerche storiche, Padova 1969, S. 90, 94, 167.
63
sidenten steht anscheinend im Zusammenhang mit der Schlüsselrolle des ehemaligen neapolitanischen Abtes Girolamo Busale, eines Marranen, für das italienische Täufer-tum. Er hatte um 1550 maßgeblich zur Wendung des norditalienischen Täufertums zum Antitrinitarismus beigetragen.188 Busales weitverzweigte spanisch-jüdische Familie war auch in Saloniki vertretenen, auch er selbst soll 1552 ins Osmanische Reich emigriert sein.
Die von den „Marranen und Häretikern“, Anhängern des Frate Jacobo, um Fürspra-che beim Sultan gebetene signora marana ist zweifellos mit der bereits erwähnten Gra-cia Mendes alias Nasi (um 1510–1568) zu identifi zieren, der Chefi n des international agierenden Finanz- und Handelshauses Mendes-Nasi, die 1553 nach ihrer Hinwendung zum Judentum von Italien nach Konstantinopel übergesiedelt war und sich in einem Palast oberhalb von Pera niedergelassen hatte. 189 Sie war eine notorische und ernstzu-nehmende Gegenspielerin des Sant’Uffi zio. Bereits in Italien hatte sie wiederholt zugun-sten der von der Inquisition bedrängten Marranen interveniert und 1556 von Konstan-tinopel aus einen Handelsboykott gegen Ancona initiiert, nachdem dort eine Gruppe judaisierender Marranen von der Inquisition hingerichtet worden war.190 1554 traf auch der Neff e der Donna Gracia, João Miques alias Joseph Nasi (um 1524–1579), in Kon-stantinopel ein und konvertierte dort im April 1554 in aufsehenerregender Weise zum Judentum. Dank seiner Finanzkraft erlangte er großen Einfl uß am Hof der Sultane Süleyman I. und Selim II. Einen Höhepunkt erreichte die Karriere des Joseph Nasi, als ihm der Sultan nach der osmanischen Eroberung von Naxos 1566 den Titel eines Herzog von Naxos zugestand.191 Palaeologus lernte Nasi erst bei seiner Reise nach Kon-stantinopel im Jahr 1573 persönlich kennen. Er behauptete in seinem Reisebericht, Nasi sei ihm einst sehr gewogen gewesen, als er noch Christ war. Zwar sei er ihm damals noch nicht von Angesicht bekannt gewesen, aber es habe allgemein geheißen, daß er Palaeologus sehr schätze.192 Bei dieser vagen Andeutung mag es sich um eine Remi-niszenz an die Gerüchte von der Intervention Donna Gracias zugunsten Jacobos han-deln.
Da wir über die Identität der Freunde Frate Jacobos unter den „Marranen und Hä-retikern“ von Saloniki und Pera aus den Briefen des Inquisitors nichts weiter erfahren, müssen wir uns mit der Vermutung begnügen, es habe sich um Personen gehandelt,
188 Vgl. ADDANTE, Eretici e libertini, S. 76–85.189 Vgl. Franz BABINGER (Hrsg.), Hans Dernschwam’s Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien (1553/55). Nach der Urschrift im Fugger-Archiv, München – Leipzig 1923, S. 115–116; BIRNBAUM, The Long Journey of Gracia Mendes, S. 75–105.190 Vgl. SEGRE, La formazione di una comunità marrana, S. 819–823; BIRNBAUM, The Long Journey of Gracia Mendes, S. 93–103.191 Vgl. BABINGER, Hans Dernschwam’s Tagebuch, S. 83, 116; Paul Frédéric Jean GRUNEBAUM-BAL-LIN, Joseph Naci duc de Naxos, Paris – La Haye 1968 (= Études juives, 13), S. 67–98.192 Epistola Iacobi Palaeologi de rebus Constantinopoli et Chii cum eo actis, Bl. B1v: „Hic Ioannes Michael, nunc nominatus Iosephus Naason, Dux Naxi et Princeps septem insularum Aegaei maris, nondum ex facie, sed ex celebri fama eius amoris erga me mihi notus, nunc Iudaeus est, me convenit, pluries allocutus est, off erebat multa, et alimenta et opes et unam insulam ex suis septem, se apud se habitare aut ibi remanere voluissem.“
64
denen sich nach ihrer Emigration in die Türkei die Frage der Konversion zum Judentum stellte. In diesem Zusammenhang ist auf eine Nebenargumentation der 1572 entstande-nen Schrift des Palaeologus De tribus gentibus hinzuweisen, wonach Paulus und die üb-rigen Apostel den christusgläubigen Nachkommen des Volkes Israel die Beschneidung und die Befolgung des jüdischen Religionsgesetzes keineswegs verboten habe. Nicht nur ihnen, sondern auch Nichtjuden stehe es frei, sich beschneiden zu lassen und nach dem jüdischen Gesetz zu leben. Solange man an dem Bekenntnis festhalte, Jesus sei der Christus, sei der Vollzug einer Konversion zum Judentum dem Heil in keiner Weise abträglich. Das Beschneidungsverbot, das die Papisten durch die Inquisition mit Feuer und Schwert durchzusetzen suchen, sei eine falsche Lehre, die erst von Augustinus eingeführt worden sei.193 Angesichts der in den neuen Quellen bezeugten Kontakte er-scheint es plausibel, daß Palaeologus bei dieser Argumentation die Situation der Mar-ranen in der Levante vor Augen hatte.
Hauptthema der Schrift De tribus gentibus, der eine Schlüsselrolle für das Verständ-nis des theologischen Systems des späten Palaeologus zukommt, ist jedoch eine neue Verhältnisbestimmung von Christentum und Islam, mit welcher Palaeologus das Mas-senphänomen der Renegaten in der Levante194 theologisch zu entschärfen suchte, in-dem er nicht nur den Übertritt zum Islam für unbedenklich für das Seelenheil erklärte, sondern sogar den Beweis verfolgte, die Muslime (Turci Christiani) insgesamt seien dem Christentum zuzurechnen. Auf Chios könnte Jacobo mit der Renegatenseelsorge in Berührung gekommen sein, da die Insel die Hauptanlaufstelle für Flüchtlinge aus dem Osmanischen Reich war, die wieder in den Westen zurückzukehren suchten.195 Auch während seines Aufenthalts in Konstantinopel 1573 traf Palaeologus mit zahlreichen Renegaten zusammen.196 Die Briefe des Inquisitionsarchivs bieten zu möglichen Kon-takten Jacobos zu Muslimen keine aussagekräftigen Nachrichten. Daß hinter der Be-fürchtung des Inquisitors, Jacobo könnte zum Islam übertreten,197 konkrete Informati-onen über eine Neigung Jacobos zum Islam stehen, ist unwahrscheinlich. Der Übertritt von Christen zum Islam war gerade in Konstantinopel ein so alltäglicher Vorgang, der in vielen Fällen nicht primär mit religiösen Motiven verbunden war, daß es für den Inquisitor naheliegend erscheinen mochte, Jacobo könnte sich durch diesen Schritt der Verfolgung entziehen.
Nur ein einziger Muslim wird in direktem Kontakt mit Jacobo erwähnt, allerdings ist es unklar, ob er zum Kreis seiner Anhänger zu zählen ist. Es handelte sich um einen
193 PALAEOLOGUS, De tribus gentibus (dat. Krakau, 1572 IX 28), hrsg. in SZCZUCKI, W kręgu myślicieli heretyckich, S. 229–241, dort 233–236, 241.194 Zur großen Häufi gkeit von Übertritten lateinischer Christen zum Islam im 16. Jahrhundert vgl. Bartolomé BENNASSAR – Lucile BENNESSAR, Les chrétiens dʼAllah. L’histoire extraordinaire des renégats XVIe et XVIIe siècles, Paris 1989; MÜLLER, Franken im Osten, passim; Andrea DEL COL, L’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano 2006, S. 468–476; DURSTELER, Venetians in Constantinople, S. 112–129.195 Vgl. ARGENTI, Chius Vincta, S. cxviif.196 Epistola Iacobi Palaeologi de rebus Constantinopoli et Chii cum eo actis, Bl. B2v, B3v–B4r.197 1560 X 8, Pera, Antonio da Venezia an Thomas Scoto, ACDF, St. st., Q3b, Bl. 83r–v, 143v (vgl. oben, Anm. 179).
65
Reisegefährten, der Jacobo im November und Dezember 1558 von Venedig nach Ra-gusa begleitete und gemeinsam mit ihm nach Konstantinopel weiterreisen wollte. Bei der Verhaftung in Ragusa am Morgen des 9. Dezember 1558 trug dieser Diener oder persönlichen Vertraute eine Anzahl von Briefen Jacobos bei sich und gab sich zunächst als Spanier aus. Beim Verhör entpuppte sich der vermeintliche Spanier jedoch als Turco,198 also als muslimischer Untertan des Sultans oder allgemein als Muslim. Der Begleiter war bereits Mitte November 1558 einem Zeugen in Venedig aufgefallen, der ihn als Greis von kleiner Statur, mit gestutztem grauem Bart und brauner Hautfarbe, beschrieb. Der Sprache nach sei er ein Spanier gewesen. Der Mann habe vorgegeben, auf der Suche nach seinem Sohn zu sein, der in türkische Sklaverei geraten war.199 Bei diesem spanischsprachigen Muslim könnte es sich entweder um einen Renegaten oder um einen der von der Inquisition bedrängten iberischen Moriscos gehandelt haben, die seit 1529 in großer Zahl ins Osmanische Reich auswanderten und in Pera eine große iberisch-arabische Gemeinde bildeten.200
Den Nachrichten, wonach Frate Jacobo Anhänger unter den Marranen von Saloniki und Pera hatte, erscheinen im Licht seiner späteren Schriften, in denen er die Grenzen des Christentums neu defi nierte und radikal ausweitete, besonders interessant. Es ist damit zu rechnen, daß die ambivalente Situation der in die Levante ausgewanderten Marranen zwischen christlicher und jüdischer Identität, ferner das Renegatenproblem, welchem Palaeologus insbesondere in der osmanischen Hauptstadt begegnen mußte, zu den lebensweltlichen Hintergründen des großen religionspolitischen Projekts des Jacobus Palaeologus zu zählen sind.
198 1559 IV 28, Ragusa, Luca de Michelis OP, Prior des Dominikanerkonvents von Ragusa, an Michele Ghislieri: „In questa mia seconda do aviso a la sua Illustrissima Signoria, qualmente vi mando frate Ioseph nostro comissario, il qual acompagna fra Giacomo da Chio da Rausi sino in Ancona, et per mano di quello vi mando certe lettere di fra Giacom su detto, le quali erano nelle mani d’un suo fameglio, qual diceva lui essere suo servitore, et diceva che’l era Spagnolo. Tandem all’ultimo trovossi et palesossi essere un Turco, et cussi havendo queste lettere nelle sue mani gli dete ad uno di nostri frati, et quello tal frate doppo alquanti giorni me le diede a me, et io adesso le mando alla Sua Illustrissima Signoria, et se alcuna cosa in quelle sarra al proposito di quella, quelle tenerà seco, et farà quelle piacerà a quella, et se caso non saranno propicie a la Santa Matre Giesa, quello facite, che ragion riciede, pur non manco di fare et manco cessare di fare in quelle cose, che sono nel onor de Dio et favore della Santa Matre Giesa.“ Ebd., Bl. 30r, 68v. 199 1558 XII 2, Venedig, Aussage des Domenico de Gayano da Pera: Bei seinem Aufenthalt in Venedig Mitte November 1558 war Frate Jacobo „in compagnia con un vechietto mundano, qual io non conobbi, ma al parlar mi parea spagnolo, vestito da povero, con barba grisa et curta, de statura basso, magro, de color bruno, et diceva de andar a cerchar un suo fi o in Levante che era schiavo de Turchi.“ Venezia, Ast, Sant’Uffi zio, b. 14, fasc. proc. 14 (Fra Giacomo da Scio).200 Zu den Moriscos vgl. BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 2, S. 585–604; Mercedes GARCÍA-ARENAL, Moriscos, in: Dizionario storico dell’Inquisizione, Bd. 3, S. 1075–1081; zum Gebrauch der spa-nischen Sprache bei den Moriscos vgl. Leonard Patrick HARVEY, The Political, Social and Cultural History of the Moriscos, in: Salma KHADRA JAYYUSI (Hrsg.), The Legacy of Muslim Spain, Leiden 1992 (= Handbuch der Orientalistik, I, 12), S. 201–234, dort 212–220; zu Moriscos in Pera vgl. İNALCIK, Ottoman Galata, S. 67–70.
66
Zwischenergebnis
Frate Jacobo da Scio alias Jacobus Palaeologus stand zwischen 1554 und seinem Gang ins Exil im Sommer 1561 an der Spitze einer religiösen Bewegung in zwei be-deutenden Zentren des lateinischen Christentums in der Levante, Chios und Pera. Im Hinblick auf das theologische Anliegen der Bewegung lassen die untersuchten Quellen erkennen, daß sie von den lokalen Inquisitoren dem Spektrum des zeitgenössischen italienischen Philoprotestantismus zugeordnet wurde. In Chios verbreitete Palaeologus seine Lehre zum einen durch öff entliche Predigten als Angehöriger des Dominikaner-ordens, zum andern sammelte er um sich einen engeren Kreis von Anhängern, dem mindestens sechs Ordenleute und eine etwas größere Anzahl von Laien, durchweg An-gehörige des Adels, angehörten. Haupt der Anhängerschaft in Pera war Palaeologus’ Landsmann, der Minorit Giovanni Battista Zeff o. Auch in Pera wurde die Lehre des Palaeologus durch öff entliche Predigten verbreitet und zugleich ein engerer Kern von Anhängern aufgebaut, dem mit dem Kaufmann Giacomo Draperio mindestens ein Ver-treter der eingesessenen ökonomischen Elite angehörte. Die Kerngruppen in Chios und Pera standen untereinander in Briefkontakt, über den perotischen Kreis wurde auch eine Korrespondenz mit einer weiteren Gruppe in Saloniki aufrechterhalten.
Palaeologus war in Chios bemüht, den Anspruch auf kirchliche Rechtgläubigkeit zu wahren, vermutlich aus Rücksicht auf seine Anhänger in der lokalen politischen Eli-te, die der Republik Genua rechenschaftspfl ichtig waren. Zeff o, den anders gelagerten Machtverhältnissen von Pera entsprechend weniger an solcherlei Rücksichten gebunden, verbarg Diff erenzen von den kirchlichen Normen weniger. Sowohl in Chios als auch in Pera waren mit der Lehre der Gruppe politische Implikationen verbunden. In Chios trat Palaeologus für die Stärkung der weltlichen Obrigkeit gegenüber kirchlichen Juris-diktionsansprüchen auf, seine Anhänger leisteten Widerstand gegen die Einführung der Römischen Inquisition auf der Insel. In Pera bestanden enge Kontakte zwischen dem Kreis um Zeff o und der Gesandtschaft Ferdinand I. Diese Beobachtungen liegen auf einer Linie mit den politischen Anliegen der späteren Schriften des Palaeologus.
Auf ein Schlüsselmotiv der späteren Theologie des Palaeologus, die inklusivistische Neudefi nition der Grenzen des Christentums, könnte auch die Existenz einer Grup-pe von Anhängern im Immigrantenmilieu der portugiesischen Marranen in Saloniki vorausweisen. Auch in Pera hatte Palaeologus Unterstützer unter den Marranen. Wie Palaeologus mit diesem Teil seiner Anhängerschaft in Berührung gekommen war, ist unbekannt. Ein Aufenthalt des Palaeologus in Saloniki ist nicht bezeugt. Gelegenheit zu persönlichen Kontakten mit Marranen hatte er entweder während seines Studiums in Ferrara oder während seiner Tätigkeit in Konstantinopel 1554/55. Die untersuchten Quellen überliefern keinerlei Aussagen über das Verhältnis des Palaeologus zur ortho-doxen Mehrheitsbevölkerung auf Chios. Auch über Kontakte mit Muslimen oder Rene-gaten sind, bis auf die Erwähnung eines muslimischen Reisgefährten des Palaeologus Ende 1558, keine aussagekräftigen Nachrichten enthalten.
Palaeologus und die von ihm ausgelöste lokale Bewegung in Chios standen im Mit-telpunkt der Tätigkeit des Inquisitors der Insel, Antonio Giustiniani, von 1555 bis zu dessen Abberufung im Jahr 1562. In den Berichten des Inquisitors von Pera, Antonio da Venezia, erscheinen die Anhänger des Palaeologus als einzige Häresie in der Hafen-
67
stadt, die als fest umrissene Gruppe oder Bewegung auftrat. Die von Palaeologus aus-gelöste Bewegung wurde vom Sant’Uffi zio in Rom als so besorgniserregend eingestuft, daß die Kardinalskongregation ihren Schriftwechsel mit der Regierung in Genua durch päpstliche Brevia unterstreichen ließ und daß die Republik 1557/58 einen Inquisitions-prozeß samt anschließender Verhängung einer kirchlichen Zensur gegen ihren Reprä-sentanten auf Chios hinnehmen mußte.
Die Popularität und die Anhängerschaft des Palaeologus in der Levante, über die er nur in Andeutungen sprach, solange er noch auf eine Rückkehr hoff te, und die längst Opfer der Zeitläufte geworden war, als er sich ihrer in seinem Reisebericht von 1573 brü-stete, gewinnen durch die neu erschlossenen Quellen konkrete Konturen. Das befremd-lich übersteigerte politische und intellektuelle Selbstbewußtsein, das die Spätschriften des alternden Exulanten durchzieht, hat off enbar in der hier beschriebenen Bewegung seinen biographischen Hintergrund.
SUMMARY
On the Career of the Anti-Trinitarian Jacobus Palaeologus up to 1561, Part 1: Frate Jacobo da Scio and His Followers in the Levant
This essay on Jacobus Palaeologus, born c. 1520 on the Island of Chios and executed as a heretic in Rome in 1585, explores the biographical experience of the Greek-Italian theologian in the Levant as a possible context for his journey towards a radical form of Unitarianism which went as far as rejecting the dogmatic boundaries between Christianity, Islam and Judaism. Based on documents from the Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (Città del Vati-cano) and the Archivio di Stato di Genova, section II of the article delineates the “itinerary”, or the whereabouts and activities, of Palaeologus in Constantinople and Chios between 1554 and 1561. Reports sent to Rome by the inquisitors of Constantinople and Chios mention at least three circles of adherents of Palaeologus in the Levant which are studied in the following sections of the essay. Section III deals with Palaeologus’s followers among the Dominican friars and the aristocracy of the island capital of Chios. Section IV explores another such circle in Pera (the traditional Latin Christian quarter of Constantinople) that was in close contact with the em-bassy of Ferdinand I in the Ottoman capital. Section V examines some references in the inquisi-tors’ reports about supporters of Palaeologus among the Marrano (or converso) immigrants of Portuguese-Jewish descent in Salonica and Constantinople. The essay argues that Palaeologus’s experience with the precarious situation of the Levantine Latin Christians in the realm of Islam and with the ambivalent religious situation of part of the Marrano migrants between Judaism and Christianity, contributed to the development of the radically Unitarian, inclusivist redraft of the Christian religion that he elaborated on in his later writings. Since no relevant theological writings of Palaeologus written prior to 1571 are preserved, however, this cannot be more than a hypothesis. In the second part of the essay, which will follow in one of the next issues of Acta Comeniana, the puzzling problem of Paleologus’s theological development prior to 1561 will be re-examined in greater detail.
68
RESUMÉ
K životní dráze antitrinitáře Jakoba Paleologa před rokem 1561. Část 1: Frate Jacobo da Scio a jeho následovníci v Levantě
Tato studie zkoumá životní zkušenosti řecko-italského teologa Jakoba Paleologa (nar. asi r. 1520 na ostrově Chios, popraven r. 1585 jako heretik v Římě) z doby jeho pobytu v Levantě, jež tvoří možný kontext pro lepší porozumění jeho cestě k radikálním formám antitrinitářství odmítajícího dogmatické hranice mezi křesťanstvím, islámem a judaismem. Druhý oddíl studie, vycházející z dokumentů uložených v Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (Vatikán) a v Archivio di Stato di Genova, popisuje itinerář Paleologa mezi léty 1554 a 1561, kdy se zdržoval v Konstantinopoli a na Chiu. Zprávy zasílané do Říma inkvizitory z Konstantinopole a Chiu, jež studie analyzuje, zmiňují nejméně tři okruhy Paleologových přívrženců v Levantě. Třetí oddíl se zabývá Paleologovými následovníky z řad dominikánského řádu a aristokratických kruhů na ostrově Chios. Čtvrtý oddíl zkoumá jiný takový okruh, působící v tradiční latinské křesťanské čtvrti Konstantinopole – Peře, který byl v úzkém kontaktu s vyslanci Ferdinanda I. v otomanském hlavním městě. Patý oddíl se zaměřuje na zmínky ve zprávách inkvizitorů o Paleologových podporovatelích mezi marranskými portugalsko-židovskými imigranty v Soluni a Konstantinopoli. Studie přichází s tezí, že Paleologovy zkušenosti s nejistou situací levantských latinských křesťanů v muslimském státě a s ambivalentní náboženskou situací části marranských migrantů, setrvávajících na pomezí mezi židovstvím a křesťanstvím, přispěly k jeho radikálně antitrinitářskému a inklusivnímu přepsání křesťanského náboženství, jež formuloval ve svých pozdějších spisech. Tato teze však zůstává jen hypotézou vzhledem k tomu, že z období před rokem 1571 se nedochovalo žádné relevantní Paleologovo teologické dílo. Pro jedno z dalších čísel Acta Comeniana je plánovaná druhá část studie, jež bude znovu detailně zkoumat kompli-kovanou problematiku vývoje Paleologových teologických názorů před rokem 1561.































































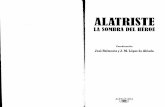



![[081] Mauné et al. 2014: Stéphane Mauné, Enrique García Vargas, Oriane Bourgeon, Séverine Corbeel, Charlotte Carrato, Sergio García-Dils de la Vega, Fabrice Bigot y Jacobo Vázquez](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6344899a03a48733920aeeef/081-maune-et-al-2014-stephane-maune-enrique-garcia-vargas-oriane-bourgeon.jpg)