Ungarn und die Türkenkriege im Spiegel der Briefe des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó aus den...
Transcript of Ungarn und die Türkenkriege im Spiegel der Briefe des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó aus den...
108
Ungarn und die Türkenkriege im Spiegel der Briefe des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó aus den Jahren 1501–1540
von Martin Rothkegel
Der glanzvolle Aufstieg der Familie Thurzó, der um die Mitte des 15. Jahrhun-
Jahrhundert mehreren Familienangehörigen höchste staatliche und kirchliche Ämter in den böhmischen und ungarischen Ländern einbrachte, war vom 12.–14. Oktober 2009 Gegenstand einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz
schiedener historischer Disziplinen werden demnächst in slowakischer Sprache in einem Sammelband erscheinen, den die slowakische Historikerin Tünde Len-
Wissenschaften der beiden Länder herausgeben. Das ausgesprochen reichhaltige Quellenmaterial, das in den Familienarchiven der Thurzó und in einigen weite-ren Beständen überliefert ist, erlaubt es, eine erstaunliche Bandbreite von Frage-stellungen der politischen Geschichte, der Wirtschafts-, Kultur-, Religions-, Lite-ratur- und der Kunstgeschichte des östlichen Mitteleuropa der frühen Neuzeit exemplarisch zu untersuchen. Der folgende Beitrag, der in leicht abweichender
-bereiteten Sammelband erscheinen wird, stellt mit dem Olmützer Bischof Stanis-laus Thurzó einen Angehörigen der Familie in den Mittelpunkt, dessen lateinische Korrespondenz ein lebhaftes Interesse an der politischen Lage in Ungarn und an den Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich erkennen läßt.
1. Stanislaus Thurzó und die Humanisten im jagiellonischen Ungarn
-
Hof in Buda, einen Brief an seinen alten Freund aus gemeinsamen Studienzeiten
eine Unterredung mit dem Breslauer Bischof Johannes Thurzó und dessen Bruder Stanislaus, dem Bischof von Olmütz (Olomouc), die sich mehrere Jahre zuvor bei einem Besuch der Brüder auf der Burg von Buda zugetragen hatte:
einmal zu mir zu einem Besuch, wie er unter Gebildeten üblich ist. Auf dem Tisch
109
lagen einige (ich weiß nicht mehr, welche) von deinen Büchern. Und während sie die durchblätterten und genauer ansahen, fragten sie plötzlich gleichzeitig, was ich von Erasmus hielte. Ihre Nachfragen wurden noch eindringlicher, als sie ver-nahmen, daß ich früher viel Zeit mit dir verbracht hatte. Davon erzählte ich ihnen nicht nur, sondern zeigte ihnen auch den Brief, den du mir einmal aus Siena nach Rom sandtest und den ich wie ein güldenes Kleinod aufbewahre. Den liebkosten die beiden hochwürdigen Bischöfe nicht nur mit den Händen, sondern gar mit Küssen, und lasen ihn mit höchstem Eifer ein ums andere Mal. Da war es nicht mehr schwer, sie zu überreden, mit dir einen Briefwechsel aufzunehmen, was sie
-gigen Weise, wie ich es gar nicht gewagt hätte, ihnen nahezulegen, denn sie haben dich ja nicht nur mit Briefen, sondern auch mit allerlei Geschenken bedacht.“1
Der Besuch der beiden Bischöfe in der Residenz des böhmisch-ungarischen
Halbruder Alexius (1490–1543) seine Karriere bei Hofe begann. Wie es scheint, war dies nicht die erste und einzige Begegnung des Stanislaus Thurzó mit Ange-hörigen des Ofener Humanistenkreises. Der böhmische Humanist Jan Šlechta ze
Zeit in der böhmisch-ungarischen Kanzlei zurück. Er habe „vor zwanzig Jahren“, also um 1502, als er „noch bei dem erhabenen Fürsten, dem seligen Ladislaus, König von Ungarn und Böhmen, dem Amt des Sekretärs nachging, eine Abhand-lung in Dialogform mit dem Titel ‚Microcosmus‘“ geschrieben und mit der Bitte um eine strenge gelehrte Kritik an Thurzó geschickt. Er habe das Manuskript jedoch nicht mit den erwarteten Asterisken und Obelisken an den Rändern, son-dern mit einem sehr wohlwollenden Glückwunschschreiben zurückerhalten. 1522 widmete Šlechta das inzwischen noch mehrfach umgearbeitete (uns leider nicht überlieferte) Werk erneut Thurzó.2
Im Jahr 1505 verfasste der aus Olmütz gebürtige Augustinus Käsenbrot (alias Augustinus Olomucensis oder Moravus), königlicher Sekretär in Buda, Stanislaus Thurzó eine handschriftliche Sammlung von Viten der Olmützer Bischöfe. Dieser „Catalogus episcoporum Olomucensium“, der 1511 auch im Druck erschien,3 be-
-stolarum Des. Erasmi Roterodami denuo recognitum et auctum. Tom. 6 (1525–1527). Oxonii 1926, 255, Nr. 1662.
2 Johannes Šlechta an Stanislaus Thurzó, Kosteletz a.d. Elbe, 30. 4. 1522. In: Martin Rothkegel (Hg.): Der lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó. Eine ostmitteleuropäische Huma-nistenkorrespondenz der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Hamburg u.a. 2006 (Hamburger Beiträge zur
Seitenzahlen und Nummern beziehen sich auf diese Veröffentlichung.3
110
daß Stanislaus Thurzó während der zweieinhalb Jahrzehnte vor der Schlacht von -
gehörigen des Humanistenkreises der Residenzstadt Buda beziehungsweise Ofen
für persönliche Beziehungen Stanislaus Thurzós zu den übrigen Humanisten im -
ten Vetter Sigismund Thurzó (1503 Bischof von Neutra, 1505 von Siebenbürgen, 1509 von Großwardein, gestorben 1512)4 oder zu Humanisten aus dem Umfeld des Alexius Thurzó wie Hieronymus Balbi (um 1450 bis nach 1522) oder Valentin Eck (1494–1550).5
Was die Ebene der der von Stanislaus Thurzó kultivierten humanistischen Amicitia-Beziehungen betrifft, soweit sie sich in seiner – nur fragmentarisch er-haltenen – Humanistenkorrespondenz widerspiegelt, scheint also die königliche Kanzlei des böhmisch-ungarischen Jagiellonenreiches der hauptsächliche An-knüpfungspunkt für Beziehungen des Olmützer Bischofs nach Ungarn gewesen zu sein.6 Dieser Befund überrascht möglicherweise, denn man möchte eigentlich vermuten, daß sich Stanislaus Thurzó von klein auf vielfältige Gelegenheiten zu Kontakten mit den Ländern der ungarischen Krone geboten hatten.
OLOMVCENSIVM.||, Wien 1511 (Verlag: Hieronymus Vietor und Johann Singriener).4
richtet, das wegen eines Druckfehlers des Erstdrucks irrtümlich als Dedikation an Stanislaus Thurzó gilt,
-nes Winterburger). Bl. g
5v–g
6r: Ad dominum Stanislaum Thurzo, praepositum
Vardiniensem.
5 Court and career in the writings of
Rudolf Agricola Junior, Valentin Eck, and Leonard Cox. Memoria. Eine Leutschauer Stiftung im Dienste der Bildungsförderung in der Zips des 16. Jahrhunderts. München 2011 (Buchreihe der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, 41), 13–32.
6 Neben den bereits erwähnten Texten sind bei Rothkegel, Der lateinische Briefwechsel, folgende la-Neben den bereits erwähnten Texten sind bei Rothkegel, Der lateinische Briefwechsel, folgende la-
(an dens., 4. 10. 1530), Nr. 58 (an dens., 11. 10.1530), Nr. 59 (an dens., 23. 11. 1530), Nr. 66 (an Alexius
75 (an Johannes Weeze, 23. 2.1538), Nr. 96 (an Alexius Thurzó, nach 17. 3.1539), Nr. 101 (an Franciscus
1540]), Nr. 114 (an Alexius Thurzó, undatiert). Außer diesen überlieferten Briefen muß es noch wesentlich umfangreichere Korrespondenzen gegeben haben, denn Stanislaus Thurzó erwähnt in Briefen an Dritte
111
2. Familiäre Beziehungen nach Ungarn
Der zukünftige Olmützer Bischof, geboren 1471/72 in Krakau (Kraków) als Sohn des Montanunternehmers Johann Thurzó (1473–1508), wuchs in einer Familie auf, die ihren Reichtum Unternehmungen in den mittelslowakischen Bergstädten verdankte, ja die vielen Zeitgenossen als ungarisch beziehungsweise ungarlän-disch galt.7 In der vom Königreich Ungarn an die polnische Krone verpfändeten Zips besaßen die Thurzó unweit von Leutschau, wo in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts der wirtschaftliche Aufstieg der Familie seinen Anfang genommen hatte, das Landgut Bethlensdorf (Betlanovce, Bethlenfalva) und konnten daher die Zugehörigkeit zum ungarischen Adel beanspruchen. Jedenfalls heißt es in der polnischen Chronik des Jodocus Ludovicus Decius (1485–1545) unter Verweis auf den Besitz von Bethlensdorf vom Vater Johann Thurzó, dieser sei ein ungar-ländischer Edelmann gewesen. Dabei schloß die Zugehörigkeit zur natio Hun-
garica nicht notwendigerweise die Kenntnis der ungarischen Sprache ein, denn
Latein beherrscht, erwähnt aber das Ungarische nicht.8
In Bezug auf Stanislaus Thurzó liegt kein Beleg dafür vor, daß dieser sich selbst als Hungarus bezeichnete oder von seinen Zeitgenossen als solcher be-zeichnet wurde, ebenso wenig gibt es Hinweise darauf, daß er Kenntnisse der ungarischen Sprache besaß. Im Krakauer Elternhaus wuchs er offenbar mit den
1485 und 1488 war er an der Universität seiner Heimatstadt immatrikuliert, er-hielt eine Krakauer Domherrenpfründe und wurde 1497, vier Jahre vor Erreichen des vom kanonischen Recht vorgeschriebenen Mindestalters von dreißig Jahren, durch päpstliche Ernennung Bischof der Diözese Olmütz. In der Verwaltung
vor,9
7 Zum Aufstieg der Familie Thurzó vgl. den Überblick bei Karen Lambrecht, Aufstiegschancen und Handlungsräume in ostmitteleuropäischen Zentren um 1500. Das Beispiel der Unternehmerfamilie Thurzó.
-ria, 8–13.
8
1521 (Verlag: : Hieronymus Vietor), LXIII (zum Jahr 1508): Sub Octobre vero die decima Ioannes Thurzo
de Betlemvalva apud Novam Civitatem Hungariae febribus correptus supremum clausit diem. Vir cum ho-Vir cum ho-
ab initio in Polonia fortuna adiutus.
-
112
keine Mühe bereitete. In persönlichen Briefen an gebildete Freunde und Verwand-te bediente sich Thurzó des Lateinischen, gelegentlich aber auch des Deutschen. So diktierte der fast siebzigjährige Bischof noch kurz vor seinem Tod 1540 ei-nen Brief an seinen um zwei Jahrzehnte jüngeren Halbbruder Johann Thurzó d.J.
10
Das Deutsche kann daher wohl am ehesten als die eigentliche Muttersprache im Krakauer Elternhaus gelten, während das Ungarische nur von einzelnen Fa-milienangehörigen erlernt wurde. Jodocus Ludovicus Decius hebt besonders die Sprachkenntnisse des älteren Bruders des Stanislaus, Georg Thurzó (1467–1521)
-herrschte.11 Dies hängt wohl im Zusammenhang mit dessen langjähriger Tätig-keit als Kremnitzer Kammergraf zusammen, denn während im Verkehr mit den Bergleuten und den Stadträten der Bergstädte die deutsche Sprache ausreichte, bedeutete die zusätzliche Kenntnis des Ungarischen einen entscheidenden Vorteil bei Begegnungen mit Vertretern des ungarischen Adels auf Landtagen und bei Hofe. Während jedoch Georg sozial und kulturell primär noch am Habitus des bürgerlichen deutschen Kaufmanns orientiert war und seit 1517 wie ein reichs-städtischer Handelsherr in Augsburg lebte, eignete sich der dreiundzwanzig Jahre jüngere Alexius zielgerichtet Lebensformen und Sprache des ungarischen Adels an. Hieronymus Balbi hob 1517 in einem durchaus doppeldeutig formulierten
auch durch seinen geschmeidigen Opportunismus besonders begabt zum Leben bei Hofe.12 In der Tat stieg Alexius dank dieser Talente in den folgenden Jahren rasant auf und fand nicht nur Anschluß an Adelskreise, sondern rückte sogar in den kleinen Kreis der Magnaten auf.
Die Beispiele der drei Brüder Stanislaus, Georg und Alexius zeigen, daß das jeweilige Verhältnis der Angehörigen der Familie Thurzó zum geographischen Raum des Königreichs Ungarn, zur ungarischen Sprache und zum ungarischen
10 Vgl. Ianus Dubravius an Alexius Thurzó, Kremsier, 30. 4. 1540, Nr. 115, 336–338, hier 337.11 Jodocus Ludovicus
zählt die Söhne des Johannes Thurzó aus erster Ehe auf): Georgium, comitem camerarium montium Hun-
gariae Latinae, Germanicae, Polonicae, Hungaricae linguae peritus.
12 Hieronymus Balbi an Jakob Fugger, Buda, 27. 5. 1517. In: Carolus Wagner (Hg.): Analecta Scepu-Hieronymus Balbi an Jakob Fugger, Buda, 27. 5. 1517. In: Carolus Wagner (Hg.): Analecta Scepu-In: Carolus Wagner (Hg.): Analecta Scepu-sii sacri et profani, pars III complectens seriem praecipuorum Scepusii magistratuum ecclesiasticorum et
qui et commercium linguae Hungaricae callet et
in hac aula est admodum versatus, ad uniuscuiusque studia etiam et voluntates facile se accomodare potest.
113
Adel in dieser Generation je nach Lebensentwurf noch sehr unterschiedlich aus-
von Anfang an wenig in das bis 1526 gemeinsam mit den Augsburger Fuggern betriebene Hauptgeschäft der Familie, die Kupferverhüttung und Silberscheidung in den mittelslowakischen Bergstädten, involviert und in entsprechend geringerem Maße mit ungarischen Angelegenheiten befaßt gewesen zu sein. Daß Stanislaus nicht direkt an den Unternehmungen beteiligt war, lassen auch die wenigen ihn be-treffenden Schriftstücke im Dillinger Fugger-Archiv erkennen, die den Olmützer Bischof nur als Bürgen und als Vermittler in einem Erbschaftsstreit erwähnen.13
Das soll allerdings keineswegs heißen, daß den geistlichen Herrn eine so profane Angelegenheit wie der ungarische Bergbau überhaupt nicht interessiert hätte. Als Bischof erwies er sich als ökonomisch ausgesprochen versiert. 1497 hatte er ein wirtschaftlich völlig zerrüttetes Hochstift übernommen und verfolgte über die Jahre umsichtig dessen Sanierung.14 Zudem stand Neugier gegenüber eindrucksvollen Monumenten der Natur und der Technik einem Humanisten gut zu Gesicht. Sicherlich war es Thurzó in seinen Jugendjahren nicht entgangen, daß der „Erzhumanist“ Konrad Celtis während seines Krakau-Aufenthalts (1489–91) den Salzbergwerken von Bochnia und Wieliczka einen Besuch abgestattet hatte.
-
zugunsten der gefangenen Aufständischen.15 Der Halbbruder Johann d.J. sandte ihm 1540 sogar Erzstücke aus einer oberungarischen Mine, in die er investieren
-te aber auch den Rat, sich vor den Betrügereien der Bergleute zu hüten, die die Investoren durch unrealistische Versprechungen und gefälschte Gesteinsproben
16 Allerdings gibt es keinen Hinweis darauf, daß Stanislaus Thurzó während seines langen Episkopats selber Investitionen auf un-garischem Boden tätigte.
Von Alexius Thurzó ließ er sich regelmäßig Wein aus Oberungarn zur bischöf-lichen Residenz nach Kremsier liefern. Auch die Weinlieferungen an Johann
13 --
te), Bd. 1, 554, Anm. 38 (27. 3. 1531: Stanislaus Thurzó bürgt für Schulden des Alexius Thurzó bei den
14 15
16 Stanislaus Thurzó an Johannes Thurzó d.J., Kremsier, 13. 2. 1540, 320f., Nr. 103.
114
Thurzó d.J. nach Schlesien gingen über Kremsier. Umgekehrt sorgte Stanislaus dafür, daß die Gemahlin des Alexius von Johann mit Lachs (der in oberschlesi-
17 Insgesamt aber -
en, in dessen politisches Territorium die Olmützer Bistumsgrenzen hereinragten, ungleich intensiver als die nach Ungarn.18 Die stärkere Ausrichtung nach Schle-sien hin, die auf der Ebene der ökonomischen Beziehungen zu beobachten ist, hat eine tendenzielle Entsprechung in Thurzós lateinischer Korrespondenz, deren wichtigster Nachrichtenweg die Fernhandelsroute Breslau-Olmütz-Wien war und in welcher der Briefverkehr mit humanistisch gebildeten Schlesiern einen wesent-lich größeren Raum einnahm als derjenige mit ungarischen beziehungsweise un-garländischen Humanisten und Adligen.19
im Spiegel der Korrespondenz Stanislaus Thurzós
Während die gelehrten und die geschäftlichen Beziehungen des Olmützer Bi-schofs nach Ungarn weniger intensiv waren als die nach anderen Nachbarländern der Diözese, galt Thurzós Aufmerksamkeit seit der doppelten Königswahl von 1526 in einem ganz besonderen Maße dem politischen Geschick Ungarns und der Abwehr der Türkengefahr.20 -ge Äußerung Thurzós, in der er gegen die auf Vermeidung eines Krieges bedachte Türkenpolitik König Wladislaws eine offensive Linie forderte.21 In der Abwehr
17
1540, 320f., Nr. 103 (Johann soll unverzüglich Lachse an Alexius liefern).18
19 Vgl. Rothkegel, Der lateinische Briefwechsel, 64–69.20
aufhalten, enthalten folgende bei Rothkegel, Der lateinische Briefwechsel, edierte Briefe Nachrichten über die Vorgänge in Ungarn und die Kämpfe gegen die Türken: Nr. 62 (an Erasmus von Rotterdam, 8. 8. 1532),
-nus], März 1533), Nr. 67 (an Jakob von Salza, 11. 5. 1533), Nr. 80 (an Georg von Logau, Dezember 1538), Nr. 86 (an dens., 24. 2. 1539), Nr. 94 (an dens., März 1539), Nr. 95 (an dens., 17. März 1539), Nr. 98 (an dens., 1. 6. 1539).
21 An Konrad Altheimer, Kapitelsdekan in Olmütz, Kremsier, April 1501, 97f, Nr. 4, hier 98: Ora-
cionem coram regia maiestate a Venetis habitam
ornata, sed aliis opus est contra Turchas quam vis. Prout inquit Marcialis: ‚Carne opus est, si satur esse
velis‘
115
des Osmanischen Reiches sah Thurzó die vornehmste Aufgabe der christlichen
Ausdruck höchst engagierter Anteilnahme, wenn Thurzó sich 1539 bei dem schle-
Iesum Christum“ (Wien 1539), eines poetischen Aufrufs zur Offensive gegen die Türken, bedankte:
„Wir billigen daher eifrig dein heilsames und heiliges Vorhaben, alle Fürsten der Christenheit und alle anderen Mächtigen mit dieser frommen und heiligen Rede zu ermahnen, zu ermuntern und zu drängen, daß sie nach all den Niederla-gen, die sie erlitten haben und trotz all der Nöte, in die sie geraten sind, endlich Buße tun und sich wieder bewußt machen, was es bedeutet, ein christlicher Fürst und auf den Namen Christi vereidigt zu sein, auf daß sie durch ein einheitliches Vorgehen und tatkräftige Hilfe diesen gemeinsamen, überaus grausamen Feind und Tyrannen der gesamten Christenheit von ihren Rücken und denen ihrer Nach-kommen abschütteln.“22
epochalen Zäsur, wie im folgenden darzulegen ist, ohnehin nicht wahr. Die Ereig-
verwandelt wurde, sollte er nicht mehr erleben. Zwar äußerte er wenige Mona-te vor seinem Tod im Frühjahr 1540 die düstere Ahnung, daß der Sultan, wenn er Ungarn und Mähren besetzen wollte, auf keinen nennenswerten Widerstand stoßen würde, sondern eher von den durch die Steuerlast erschöpften Bauern be-grüßt würde.23 Dennoch rechnete Thurzó offenbar bis zuletzt damit, daß das seit
-barer Zeit unter habsburgischer Herrschaft wiedervereinigt würde, sei es durch siegreiche Kriegszüge, sei es durch Diplomatie.
Im Gegensatz zu seinem Halbbruder Alexius war Stanislaus Thurzó nicht an den Diskussions- und Entscheidungsprozessen, die der Ungarn- und Türkenpo-
22 An Johannes Langus, Olmütz, Olmütz, 4. 3.1539, 296–298, Nr. 88, hier 296, dankt Langus für die Zusendung von dessen Elegie, in der Langus zu einer Offensive gegen die Türken aufruft: Probamus igitur
vehementer hoc salutare et sanctum institutum tuum, qui universos Christiani nominis principes atque alios
primates omnes mones, hortaris atque hac pia et divina oracione urges, ut iam tandem post tot acceptas
clades et calamitates perpessas aliquando resipiscant atque principes Christianos se esse et in nomen Chri-
suis atque posterorum suorum cervicibus uno omnium concordi consilio atque presidio presenti deturbent.
23 An Alexius Thurzó, Kremsier, 28. 11. 1539, 318–320, Nr. 102, hier 319: Imperator Turcarum ne-
-
nos pervenerint, Turcarum rabies late et longe interea diffundetur, ferro, igne et solita crudelitate obvia
omnia devastantes. Sera sunt nimis nostra ista consilia: Ubi sunt nostri comeatus, ubi equi, arma, duces,
Coloni preterea nostri anteactis annis omnibus spoliati
facultatibus porrigent pocius manus hosti, quam cum ultimo suo atque suorum periculo cum illis decertent.
116
litik Ferdinands I. zugrundelagen, beteiligt. Entsprechend sind seine Briefe im Hinblick auf Ereignisgeschichte und politische Geschichte höchstens für einige Details als Quelle von Interesse. Vielmehr erweisen sie sich als bemerkenswerte Zeugnisse der subjektiven Wahrnehmung eines Zeitgenossen der Jahrzehnte vor
oder über Ungarn erhielt, in seinen als epistolae ad familiares stilisierten Schrei--
näher in den Blick genommen.
3.1 Die ungarische Thronfolge Ferdinands I.
--
24 war Thurzó während des Interregnums von 1526 aktiv daran beteiligt, auf dem mährischen Landtag vom 18. November 1526 in Olmütz einen Beschluß herbeizuführen, wonach Anna Jagiello und ihr Gemahl Ferdinand von Habsburg aufgrund ihres Erbrechts als mährische Landesherren anerkannt wurden. Außenpolitische As-pekte wie etwa die Lage in Ungarn waren für die Anerkennung Ferdinands als Erbherr nicht ausschlaggebend. Vielmehr legten sich die mährischen Stände auf diese Interpretation des Thronfolgemodus fest, um angemessen auf die von den böhmischen Ständen ohne Beteiligung der Nebenländer (Mähren, Schlesien und Lausitzen) durchgeführte Königswahl zu reagieren.25 Der im November 1526 an
Schlesien, der zu einer erneuten Teilung der Länder der Böhmischen Krone wie
24 Zu Thurzós Mitwirkung an symbolischen Akten des Staatsgefüges der Böhmischen Krone vgl. -
mützer Bischofs Stanislaus Thurzó. In: Martina Fuchs / Orsolya Réthelyi (Hg.), Maria von Ungarn. Eine Renaissancefürstin. Münster 2007 (Geschichte in der Epoche Karls V., 8), 283–291.
25 Die mährischen Stände hatten das Recht, bei einem Dynastiewechsel an der Königswahl beteiligt zu werden (während bei Vorhandensein eines Thronerben die Wahl durch die böhmischen Stände ausreich-te). Um mit der (faktisch unumgänglichen) Anerkennung der böhmischen Königswahl vom Oktober 1526 nicht auf dieses Recht zu verzichten, interpretierten die Mährer den Herrscherwechsel als erbliche Thron-folge (obwohl dies offensichtlich nicht der Fall gewesen war, denn die böhmischen Stände hatten ein Erb-
(ebd., Bd. 1, 98) erwähntes Schreiben Stanislaus Thurzós an Ferdinand I. vom 3. 11. 1526 (Abschrift ehe-mals in Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv), in dem Thurzó über seine Rolle im Vorfeld der Annahme Fer-dinands als Erbherr durch die mährischen Stände Rechenschaft ablegt, konnte von Verf. im Haus-, Hof- und Staatsarchiv nicht aufgefunden werden.
117
in den Jahren 1469/79–90 geführt hätte, stieß bei den mährischen Ständen auf Ablehnung.26
Während somit Ferdinands Anspruch auf die Böhmische Krone einschließlich der Nebenländer bei den mährischen Ständen unumstritten war, war die Haltung in Bezug auf die ungarische Thronfolge weniger eindeutig. Grundsätzlich war es durch die Anerkennung des Erbrechts Annas und Ferdinands nahegelegt, auch im Hinblick auf Ungarn ein Erbrecht des Habsburgers aufgrund der Wiener Erb-verbrüderung von 1515 und seiner Ehe mit Anna zu postulieren. In diesem Sinne sandten die Mährer vom Landtag in Olmütz eine Gesandtschaft an den ungari-
Wahl Ferdinands zusammentreten sollte.27 Andererseits schien es in denselben Ta-gen einem Beobachter, daß der mährische Herrenadel durchaus „dem Wayda wol gewandt und gefreundt“,28
einverstanden und wenig geneigt sei, Ferdinand bei der Durchsetzung seiner un-29 Dagegen konnte
es für Stanislaus Thurzó keine akzeptable Alternative zur habsburgischen Thron-folge in Ungarn geben. Ausdrückliche Äußerungen des Bischofs zur Frage der ungarischen Thronfolge aus den entscheidenden Herbstmonaten des Jahres 1526 sind zwar nicht überliefert, und die fragmentarische Überlieferung der Briefe des Stanislaus an Alexius setzt gar erst im April 1533 ein. Es liegt aber nahe, daß der Olmützer Bischof allein schon wegen seiner familiären Beziehungen und insbe-
30 von Anfang an für Ferdinand als Nach-folger Ludwigs II. eintrat.
Außer den familiären Motivationen und dem auf das Erbrecht Königin An-nas gegründeten Legitimationsargument mögen noch weitere Aspekte eine Rolle gespielt haben. Thurzó war trotz seines hohen kirchlichen Amtes ein homo no-
26 mährischen Stände darauf. In: Königlich Böhmisches Landarchiv (Hg.): Die böhmischen Landesversamm-
27 28 Wilhelm von Riesenberg an Herzog Ludwig von Bayern, Bericht über die Reaktionen in den Böh-Wilhelm von Riesenberg an Herzog Ludwig von Bayern, Bericht über die Reaktionen in den Böh-
-
dass ihm gen Ungern, dem Wayda, niemand us der Kron und zugehörige land zuziehen soll in dienst wider Sein Gnad, als dann als heunt solich brief ausgesandt worden zu allen Ständen. Aber Gott weiss, wie man sich in dem halten wird, dann die Marher und Slezy sein dem Wayda wol gewandt und gefreundt. Gebs Gott, dass ein gut end nehm.“
29 über entsprechende Bedenken der böhmischen Stände gegen Ferdinands ungarische Ansprüche.
30 Zu den Interessenkonstellationen, die Alexius von vornherein an Ferdinand und das Haus Habsburg -
latok történetéhez). Bd. 1: 1526–1532. Budapest 2005, 449f. (deutsche Zusammenfassung).
118
vus, dem das ständestaatliche Verfassungsideal und der Landespartikularismus der mährischen Herrengeschlechter von Haus aus fernliegen mußten. Der politische, ökonomische und kulturelle Lebensraum, der Thurzó geprägt hatte, war nicht Mähren, sondern das böhmisch-ungarische Jagiellonenreich in seiner Gesamt-heit. Während die Interessen der adligen Ständepolitiker primär auf die jeweiligen Einzelländer ausgerichtet waren,31 läßt sich bei den Humanisten des böhmisch-ungarischen Jagiellonenreichs, von denen nicht wenige ihre Karriere der könig-
-kovic (1461–1510), der mit der Kanzlei in Buda in enger Verbindung stand, und
in Kremsier lebte, wurde eine politische Gesamtlinie für das Jagiellonenreich pro-pagiert, deren Eckpfeiler die Wiederherstellung der durch das böhmische Schisma zerrissenen kirchlichen Einheit und die Stärkung der königlichen Zentralgewalt waren.32 Sofern wir aufgrund dieser Indizien voraussetzen dürfen, daß Thurzós po-litisches Denken auf die böhmisch-ungarische Raumordnung Ostmitteleuropas be-zogen und an den Idealen der einheitlichen Regierung und einheitlichen Religion orientiert war, dann kam für ihn nur Ferdinand als Garant der Kontinuität in Frage.
Während Thurzós Loyalität gegenüber dem Haus Habsburg über die Jahre kon-stant blieb, ist, der Entwicklung der Beziehungen zwischen Ferdinand I. und des-
--
lya bereits in der Regierungszeit der Könige Wladislaw und Ludwig wiederholt
seiner späteren Briefe zum Ausdruck brachte, noch eine Kränkung nach, die er von dem Zipser Grafen im Jahr 1510 erlitten hatte. Der Bischof hatte am 11.
31 Grundsätzlich dazu vgl. Joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619). München
-defreiheit und Fürstenmacht 1522–1699. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, 2 Bde. Wien 2003.
32 (Hg.), Bohuslai Hassensteinii a Lobkowicz epistulae. Bd. 1: Epistulae de re publica. Leipzig 1969 (Biblio-
119
Familie im April 1510 für einige Tage bei Thurzó in Kremsier zu Gast. Ianus Du-bravius, Thurzós langjähriger Sekretär, erinnerte sich noch viele Jahre später an den hohen Besuch:
-dislaw, d. Verf.] auf der üblichen Route durch Mähren auf den Heimweg. Dabei kehrte er in Kremsier bei Bischof Stanislaus ein und blieb dort bis zum dritten
Kinder dieser Gefahr nicht aussetzen wollte. Ich war persönlich anwesend, als Stanislaus dem bedrückten König in seiner Kammer folgenden Vorschlag unter-breitete: ‚Ich sehe, daß euer Majestät wegen des Risikos, das den Kindern von der verseuchten Luft in Ungarn droht, besorgt ist. Dabei ist diese Sorge eurer Maje-
oder auf der Burg im nahen Wischau, wo es direkt neben der Burg auch einen sehr schönen Garten gibt. Es wäre mir ein Vergnügen, eine dieser beiden Residenzen zur Verfügung zu stellen, damit euer Majestät dort wohnen kann, solange es ihr beliebt.‘ Der König seufzte tief und dankte. Auch vielen vom Hofstaat kam die-ses großzügige Angebot sehr recht. Aber Graf Johann von der Zips vereitelte die
zweihundert Reitern heranpreschte und dem König von Angesicht zu Angesicht die Drohung der ungarischen Stände vorlegte, daß man ihn in Buda aussperren werde, sollte er die Heimreise nach Ungarn ohne die Kinder antreten. Da ist er dann lieber mit den Kindern zurückgefahren.“33
In den erhaltenen Resten von Thurzós Humanistenbriefwechsel ist erst ab
-scha von Belgrad und Semendria (Smederevo), in Zentralungarn angerichteten Verwüstungen:
33 Ianus Dubravius, HISTORIAE || Regni Boiemiae, || DE REBVS MEMORIA || DIGNIS, IN ILLA Urgentibus reditum Hungaris itine-
re per Moraviam solito progrediebatur, divertitur Cremsirium ad Stanislaum praesulem et usque in tertium
diem ibidem substitit, non sine cura, quae animum illius angebat ob pestem in Hungaria pululantem, cui li-
beros committere nolebat. Aderam praesens ego, cum regem ita affectum Stanislaus in cubiculo istis verbis
ob morbum suspecta imminere videatur. Nihil maiestatibus vestris opus est hac cura, maneant ambo cum
suis in Moravia aut hic Cremsirii aut in vicina arce Viscoviensi, cui hortus satis amoenus adiunctus est.
Libentissime ego illis de altero loco concedam, ut, quoad maiestati vestrae placuerit, in illo commoretur.‘
-
hibitio grata fuit. Sed disturbavit totam rem Ioannes comes Sepusiensis e Trencinio Cremsirium ducentis
equitibus superveniens regique coram minas proponens, quibus Hungari minarentur se illum Budam non
intromissuros, si absque liberis in Hungariam redeat. Cum liberis itaque reversus est.
120
„Die Frevelhaftigkeit jenes Woiwoden Janosch kennt kein Maß. Ach, wäre er doch nie geboren, zu nichts ist er gut als zum Vergießen von Christenblut und zur
wert wäre, sein eigenes Leben opfern müßte! Aber eines Tages wird er ohne Zwei-fel für das unschuldige Blut die angemessene Strafe empfangen.“34
Die Bestrafung „jener beiden Bestien, Janosch Waida und Gritti“ rückte ver-
seinem Statthalter Ludovico Gritti verteidigte Budaer Burg belagerten. Ange-sichts der langwierigen Belagerung (die Ende Dezember erfolglos abgebrochen wurde) schrieb Thurzó am 23. November 1530 an Révai ins Heerlager vor Buda, er möge auf ein göttliches Wunder vertrauen, habe man doch jüngst noch viel grö-ßere Wunder erleben dürfen.35 Damit spielt Thurzó offenbar auf den überraschen-den Abbruch der Belagerung Wiens durch Süleyman I. am 15. Oktober 1529 an. Vielleicht hatte gerade jenes Ereignis entscheidend zu Thurzós auffälliger Wun-dergläubigkeit im Zusammenhang mit der Türkengefahr beigetragen.
-licheren Ton. In Briefen Thurzós vom 28. Februar und 2./7. März 1533 ist, aus habsburgischer Sicht amtlich-korrekt, von „Jan, Graf der Zips“36 und vom „Herrn
34 An Franciscus Révai, Kremsier, 4. 10. 1530, 237f., Nr. 57, hier 238: Nimia impietas est in Iano isto
suam propriam patriam, quam vita propria, si probus esset, redimere pocius deberet. Sed dabit haud dubie
innocentis sanguinis dignas penas.
35 An dens., Kremsier, 23. 11. 1530, 240f., Nr. 59: Generose domine, fautor et amice noster honoran-
-
bis gratissime, longe tamen accepciores iucundioresque fuissent, si in illo uno saltu et venacione benignis-
hucusque fuissent feliciter. Nihil tamen adhuc neglectum est, si modo Domini Dei presidium voluntasque
accesserit. Multo enim maiora et impossibiliora etate nostra vidimus et audivimus accidisse, cui clementis-
simus Deus et tota celestum curia subscribere dignetur.
36 Hodie agitur vigesimus
Iano comite Cepusiensi. Arbitramur te non ignorare, quinam a maiestate regia nuncii et a Iano similiter huc
Omnia enim, quae hic transigi debebant, aiunt iam
-
mat hec ita esse certissima. Pervenerunt eciam nudius tercius pecculiares littere ab eodem Hieronimo ad epis-
pacem habeant omnibus modis integerrimam. Propterea non est, cur hic diucius immoremur, si quidem hec
vera sunt, quae passim hic per ora hominum decantantur.
121
Waywoda“37 die Rede. In den vorausgehenden drei Wochen hatte der Bischof auf
38 In einem Schrei-ben an die böhmische Kanzlei in Wien machte Thurzó keinen Hehl daraus, daß er sich ohne jede Begeisterung in diesen Befehl fügte, zumal er gesundheitlich angeschlagen war.39 Thurzó war nicht in den Umstand eingeweiht, daß Ferdinand
-
sollen, unter allerlei Vorwänden bis zum Monatsende hingezogen worden waren, wurden sie am 26. Februar nach Bekanntwerden des zwischen Ferdinand und dem Sultan erreichten Friedensschlusses abgebrochen. Vom Inhalt der Geheimverein-
zwei „Königen von Ungarn“, erfuhr Thurzó erst zwei Monate später durch eine Indiskretion seines Halbbruders Alexius.40
handelt sich um ein Schreiben Thurzós vom 23. Februar 1538, in welchem er den schwedischen Bischof Johannes Weeze, den in Großwardein (Oradea, Nagy-
für zwei junge Männer aus dem mährischen Herrenstand zu leisten, die im Sep-tember 1537 bei Esseg (Osijek, Eszék) von den Türken gefangen worden waren.41
Dieses Schreiben belegt, daß Stanislaus Thurzó auch von den Verhandlungen, die
37 An Johannes Magnus, Kremsier, 2./7. 3. 1533, 252–255, Nr. 65, hier 255: Dum enim essemus
Turcarum imperatore et rege nostro, et eius rei gracia quod mittitur insignis satrapa ab imperatore Tur-
carum ad regem nostrum. Neque hoc eciam iam negat maiestas regia, quod eundem Hieronimum miserit
38 von Zara in Konstantinopel vgl. auch die Briefe des Chefunterhändlers der habsburgischen Delegation,
25), 295–305.39 40 Vgl. unten, Anm. 60.41 An Johannes Weeze, Kremsier, 23. 2. 1538, 269–271, Nr. 75, hier 270: Cum igitur reverendissima
dominacio vestra ad presens dignetur agere oratorem Cesareum apud regem Iohannem, obsecro, quantum
gratia per oblatam oportunitatem cum rege Iohanne colloqui, ut dignaretur Christiana religione permotus
-
trapam aut apud quendam alium inveniri possent vivi, atque ut possint tolerabili precio redimi.
122
zum Großwardeiner Friedensschluß vom 24. Februar 1538 führten, genau unter-richtet war. Mit dem Frieden von Großwardein war scheinbar sichergestellt, daß Stanislaus Thurzós Hoffnung auf eine Wiedervereinigung Ungarns in nicht allzu ferner Zeit erfüllt würde. Am selben Tag, an dem in Wardein der Friedensschluß besiegelt wurde, fordert Thurzó sogar seinen Freund Georg Logau, dem er 1527
42 -
43
-
Epistolographie seine Adressaten teilhaben ließ, hatte eine eher komödiantische Nebenhandlung, nämlich die sich langsam entfaltende Freundschaft zwischen
(gestorben 1543), Erzbischof von Kolotschau (Kalocsa) und Bischof von Erlau
richtete Thurzó an Georg von Logau die launige Bitte, ein Gedicht für seinen al-
kein Hirn steckt“, der sei nicht nur ein notorischer Zecher, sondern auch sehr großzügig, besonders möge er es, wenn man ihm als Musikkenner schmeichle, er singe auch gar nicht übel.44 Im folgenden Frühjahr erkundigt er sich bei Logau,
Er möchte den Mann wiedersehen, er habe ihn schon immer sehr geschätzt, vor allem sei er ein überaus angenehmer Gesprächspartner, sowohl in ernsten wie in scherzhaften Unterhaltungen.45
bestätigt hatte, ließ Thurzó am 17. März seiner Freude Lauf:
42 Vgl. Georg von Logau, Turso, meae columen, pater, et spes certa Thaliae
46.43 An dens., Kremsier, 4. 2. 1539, 291–293, Nr. 86, hier 293: Cum per ocium liceret, describes ap-
paratum nupciarum Iohannis regis. Erunt plures, qui tibi singula recensebunt, quid istic viderint.
44 An dens., Dezember 1538, 279–282, Nr. 80, hier 282: Colocense caput illud, quod olim versuta et
callida vulpecula pulchrum esse commendabat, verum tamen carere cerebro, mero solito, lapsus sum, more
intus et foris recte novisti, elicies haud dubie, quod forsan non erit ingratum. Gaudet commendari a musica,
novit sane numeros atque articulos musices ad cantum aptissimos neque est ultime note cantor, oblectatur
45 An dens., Olmütz, März 1538, 305f., Nr. 94, hier 306: -
divertisse. Si sic est, gaudemus, vir nobis semper visus est integer et bonitate singularia preditus et, qui
pleno sapit pectore , horis omnibus humanissimus, sive seria sive ludicra
recenseat.
123
uns. Du brauchst dich nicht zu wundern, daß er aussieht wie ein Faß, er hält je-den Tag ein Festmahl und wacht darüber, daß an seiner Tafel niemand Wasser trinkt, es sei denn, er hat eine attestierte Alkoholunverträglichkeit, schließlich sei es eine Mahlzeit für Menschen und nicht für Hunde. Ansonsten ist er mit seinem fröhlichen, angenehmen, gebildeten und kugelrunden Gesicht leutselig gegenüber allen, die ihm über den Weg laufen.“46
Daß hinter diesem ausgelassenen, freundlichen Spott tatsächlich eine beson-
Thurzó in einem Brief vom selben Tag seiner Hoffnung Ausdruck gab, Alexius 47
Begleitschreiben, mit dem der Bischof am 28. November 1538 einen Brief des Alexius an den inzwischen in Krakau weilenden Diplomaten weiterleitete, ist zwar herzlich und freundschaftlich, läßt aber von der frivolen Diktion der Äuße-rungen in den Briefen an Logau nichts ahnen. Vielmehr preist er die Frömmigkeit
der Christenheit nachdrücklich ans Herz:„Ich bin mir wohl bewußt, daß Hochwürden stets gern und mit ganzem Ver-
mögen umsichtig danach strebt, den Frieden in der Christenheit zu befördern. So hat es nämlich unser Heiland Christus jedermann befohlen, daß wir einander lie-ben und untereinander brüderlichen und christlichen Frieden halten sollen. Aber ach, alles ist aus dem Lot geraten! Der grausame, übermächtige und unersättliche Tyrann, der gemeinsame Feind der Christenheit, triumphiert angesichts unserer Zerstrittenheit. Während wir uns gegenseitig niedermetzeln, bekämpfen und un-sere Schwerter in unsere eigenen Eingeweide stoßen, erobert und erbeutet er straf-los alle umliegenden König- und Kaiserreiche, die einst christlichen Königen und Fürsten unterworfen waren.“48
46 An dens., Olmütz, 17. 3. 1539, 306–308, Nr. 95, hier 307: Franciscum illum staturosum Francopa-
nibus gaudemus rediisse incolumem. Ne mireris doliarem factum esse, vescitur quottidie splendide et cavet,
ne in sua mensa quispiam aquam bibat, nisi sit natura abstemius. Humanum enim vult habere, non caninum
prandium Proinde hilari, iucundo, humanissimo
ac subrubicundo vultu affatur passim omnes, qui illum invisant.
47 Archiepiscopum Colocensem
pleno pectore sapit, dicat seria aut ludicra, scit se ad omnia accomodare scite, eleganter et apposite. Prop-
terea faverem optimo et humanissimo homini omnia fausta et iucunda, et dignus est, ut nepos suus hanc
primigenam vestram, honestam atque optimis moribus institutam consequatur puellam, que olim, dum esset
parvula, puerili sua dicacitate concinna, suavissima et modesta oblectabat omnes convivas vestros, immo
parte placeat et pareat.
48 Novi quippe reverendissimam dominacionem
vestram libenter et toto conatu illa semper agere atque diligenter curare, quae ad pacem reipublice Christi-
124
Wenn Thurzó hier wenige Monate vor seinem Tod auch einen versöhnten Ton -
nen seine Worte doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß der greise Bischof nur deshalb Frieden und Einheit der Christenheit beschwor, weil diese Vorbedingung für die Vernichtung des Osmanischen Reiches waren, die er mit einer nach Worten ringenden, in mythische Metaphern gehüllten Aggressivität herbeisehnte.
3.3 Die Türkenpolitik Karls V.
Obwohl Ferdinand I. im Streit über die Herrschaft im ungarischen Raum die Hauptlast der militärischen und diplomatischen Auseinandersetzungen mit den Türken zu tragen hatte, war in der Wahrnehmung Thurzós dessen Bruder, Kaiser Karl V., der eigentliche Gegenspieler des Sultans. Aus Thurzós Sicht entschied sich das Schicksal Ungarns im Mittelmeerraum. Dort hatte der Kaiser nach dem 1528 erfolgten Wechsel des genuesischen Admirals Andrea Doria aus dem fran-
können. Thurzó gab sich zuversichtlich, der Kaiser sei politisch gewillt und in der Lage, für die Sicherung der ungarischen Königsherrschaft seines Bruders die militärischen Ressourcen des Reiches und der spanischen Länder zu mobilisieren. Tatsächlich hatte Karl V. bereits im November 1526 den ungarischen Ständen ein entsprechendes Versprechen geleistet, um die Königswahl Ferdinands zu beför-dern. Bis auf die Aufstellung einer kaiserlichen Streitmacht gegen den gen Wien ziehenden Sultan 1532, die jedoch nicht zum Einsatz kam, da sich die osmani-
49 im August 1532 wieder zurückzogen, machte Karl V. jedoch keine Anstalten, seine Zusage von 1526 einzulösen.50 Mit umso größerer Spannung verfolgte Thurzó alle Neu-igkeiten über militärische und politische Unternehmungen des Kaisers, die sich irgendwie als Vorzeichen des sehnsüchtig erwarteten entscheidenden Schlags ge-gen die Türken interpretieren ließen.51
ane conferunt. Sic enim Christus, salvator noster, precepit universis, ut invicem diligamus et pacem am-
plectamur fraternam et Christianam. Sed, proh dolor, omnia prepostero sunt ordine! Crudelissimus enim et
atque interea, dum nos mutuo dimicamus, contendimus et in nostra propria viscera gladios nostros conver-
timus, ille rapit et eripit impune vicina regna et imperia universa Christianis regibus et principibus olim
subiecta.
49 Von der Belagerung von Güns berichtet Thurzó in einem Brief an Erasmus von Rotterdam, 8. 8.
recognitum et auctum. Bd. 10. Oxonii 1941, 78f., Nr. 2699 (mit der fehlerhaften Lesart l. 35 , zu emendieren in = Steiermark).
50 Vgl. Alfred Kohler, Ferdinand I. 1503–1564. Fürst, König und Kaiser. München 2003, 166f., 211–217.
51 Zum Widerhall der Auseinandersetzungen mit den Türken in der „öffentlichen Meinung“ im Reich
125
Im Sommer 1530 erschien Thurzó das zeitliche Zusammentreffen der (im Ok-tober desselben Jahres ohne Erfolg abgebrochenen) diplomatischen Bemühungen des Gesandten Ferdinands I. in Konstantinopel52 mit der Anwesenheit Karls V. auf dem Augsburger Reichstag als besonders günstige Gelegenheit zur Wiedervereini-gung Ungarns, da die Anwesenheit des Kaisers die habsburgische Verhandlungs-position gegenüber den Türken stärke.53 Als kurz darauf, noch während der Dauer
vorrückten, hoffte Thurzó, daß der Kaiser vom Reichstag ein Heer zur Rücker-oberung von Gran und Buda senden würde.54 Während er sich über die Reichs-
In: Transactions of the Ameri-
Jahrhundert und die deutsche öffentliche Meinung. In: Ernst Schulin (Hg.): Gedenkschrift Martin Göhring. --
frage in der öffentlichen Meinung Europas im 16. Jahrhundert.
Literature. In: Bodo Guthmüller / Wilhelm Kühlmann (Hg.): Europa und die Türken in der Renaissance. --
ropäisches Wissen über das Osmanische Reich 1450–1600. Frankfurt am Main–New York 2003 (Campus Historische Studien, 35). Zu tschechischen Türkendrucken, deren Überlieferung allerdings erst mit den
52 Vgl. Anton von Gévay (Hg.): Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen
1. Teil 1: Gesandtschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman I. 1530. Wien 1838.53 An Franciscus Révai, Kremsier, 7. 7. 1530, Nr. 56, 235–237, hier 236f: Cuperemus itaque
vere et recte essent. Nihil posset omnibus incolis regni Ungarie, quin imo vicinis omnibus provinciis, salu-
promissis onusti iam propemodum in ultimam perduci possent desperacionem, verum his omnibus malis
dignabitur cum diuturna et suavissima consolacione. Ita enim nobis adhuc certissime persuademus, Cesa-
nec re-
felicissimisque auspiciis inauguret; Cesarea maiestas nulla racione persuadi poterat
in Augsburg, d. Verf.], negocio feliciter transacto tandem eciam alia reipublice Christiane negocia tractanda susciperentur.
54 An Franciscus Révai, Kremsier, 11. 10. 1530, 239f., Nr. 58, hier 239, hofft nach dem jüngsten Ein-fall der Türken nach Zentralungarn auf kaiserliche Truppen zur Eroberung von Gran und Ofen: Terruit nos
Quapropter hortamur dominacionem vestram,
tes sintve processuri ad capiendum Strigonium et Budam.
126
fürsten demonstrativ geringschätzig äußerte,55 -
1539 nahelegen, wertete Thurzó die Anwesenheit des Kaisers im Reich nicht nur pragmatisch-politisch als Indikator für dessen Interesse an der Lage an der Türken-front, sondern erhoffte von einem adventus Caesaris, von der physischen Nähe des Kaisers, auf geradezu numinose Weise Schutz und Rettung für die Christenheit.56
Auch die Nachrichten von den Erfolgen beziehungsweise Scheinerfolgen der kaiserlichen Armada unter Andrea Doria gegen die Osmanen im Mittelmeerraum verfolgte Thurzó mit Spannung, da er hier einen zweiten Ansatz zur Überwindung der Teilung Ungarns sah.57 Im April 1533 erfuhr er von Alexius, daß die Geheim-bedingungen für den im Februar 1533 in Konstantinopel von einer Gesandtschaft Ferdinands I. ausgehandelten Waffenstillstand58 die Anerkennung Ferdinands
-sel sah Stanislaus nicht etwa einen Verhandlungserfolg, sondern lehnte sie als Festschreibung der Teilung Ungarns empört ab. Stattdessen legte er Alexius seine eigene Sicht der Dinge dar: Er hatte sich (offenbar mithilfe einer Landkarte) eine anschauliche Vorstellung von den jüngsten Erfolgen Dorias (der Besetzung der
55 Zum Beispiel an Georg von Logau, Anfang Januar 1539, 282–286, Nr. 81: Germani principes mag-
auctiores facti Deum contempnunt
et homines. Perierunt olim maiores eorum, longe superiores ac diciores istis recencioribus, posset iis quo-
que idem accidere, nisi resipuerint
„Sic volo, sic iubeo, sit pro racione voluntas“
56 1539, 318–320, Nr. 102, hier 319: Hofft inständig, der Kaiser werde nach Deutschland kommen und die Wende der Lage herbeiführen. Nova de futuro adventu Cesaree maiestatis in Germaniam essent quidem
admodum iucunda. Si modo Dominus Deus annueret, ut confestim inicio veris sine multa cunctacione ad-
volare dignaretur.
57 Zu den Briefschreibern, von denen er Nachrichten über den Seekrieg im Mittelmeer erhielt, zählte auch der Wiener Bischof Johannes Fabri (1478–1541). Stanislaus Thurzó leitete diese Nachrichten an Brief-
-De Gritto adhuc non
audimus, quorsum ibit. Scriptum enim nobis est, quod multi, qui Ianussio adhaerebant, ad Caesarem pro
gratia tamquam ad asilum confugerunt, quos benigne suscipiens pollicitus est eos non deserere. Scriptum
Habuimus
etiam litteras a Viennensi episcopo reverendissimo Olomucensi scriptas eandem testantes materiam, his
additis, quod circa Bad
58 Vgl. Anton von Gévay (Hg.): Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen
2. Teil 1: Gesandtschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman I. 1532–1533. Wien 1838.
127
bis zum 1. April 1534 von habsburgischen Truppen gehalten werden konnte)59 verschafft. Bei seiner gelehrten geographischen Analyse war er zu der Erkenntnis gelangt, daß diese Erfolge so bedeutend seien, daß sie ein klares Anzeichen für ein göttliches Eingreifen zugunsten der Christenheit seien. Nun sei nicht nur die Wiedervereinigung Ungarns, sondern gar die Wiedereroberung Konstantinopels für die Christenheit in greifbare Nähe gerückt.60 Zwei Wochen später schrieb er, etwas bescheidener, an den Bischof von Breslau, er habe erfahren, Karl V. werde
über ganz Ungarn einschließlich des von den Türken 1522 eroberten Belgrad (Beograd) eintauschen.61
Nach Karls V. erfolgreichem Tunis-Feldzug von 1535 war die Hoffnung auf die Eroberung Konstantinopels durch den Kaiser wieder in aller Munde. Im Winter 1538/39 steigerte sich Stanislaus Thurzós Erwartung einer vollständigen Beseiti-gung der osmanischen Herrschaft im historisch-legitimen geographischen Raum der Christenheit zu einem religiös artikulierten Enthusiasmus. Als entscheiden-den Faktor erwartete er ein wundersames göttliches Eingreifen. Thurzós in Wien bei Hofe weilender Schützling und Freund, der Dichter Georg von Logau (um 1500–1553), unterrichtete den Bischof regelmäßig und detailliert über die Kämp-
Kaiser zusammengeschlossen hatten (wobei uns nicht Logaus Briefe, sondern nur
59 Geschichte des Osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven.
Höhe seiner Entwickelung 1453–1574. Gotha 1854, 735–748.60 An Alexius Thurzó, Kremsier, 24. 4. 1533, 255–257, Nr. 66, hier 256: Reddite mihi sunt littere
vestre
-
que quietem afferre poterit. Preterea si illa vera sunt, que passim predicantur de Andrea Dorea, habet
-
in potestatem suam idem Andreas
redigerit. Multas enim hec insignis et nobilissima insula preclaras vetustas et populosissimas urbes habet est quoque adiuncta Macedonia,
Proinde nihil mirabile nobis videri debet, quum Turca adeo sit modo blandus, mansuetus et placabilis. No-
vit enim multum sibi interesse in hac insula natura munitissima
Constantinopolis.
61 An Jakob von Salza, Kremsier, 11. 5. 1533, 257–259, Nr. 67, hier 258f.: Aiunt preterea suam maie-
statem annuisse, si Turcarum imperator restituerit totum regnum Ungarie nostro principi una cum illa Alba
reddi debere.
128
Thurzós Antworten erhalten sind).62 Der notorisch trinkfreudige Bischof feierte die eingehenden Siegesmeldungen ausgiebig in der Runde seiner Freunde und
63 Wie schon 1533 sah er überall deutliche Anzeichen einer unmittelbar bevorstehenden, wundersamen Vernichtung des Feindes der Chri-stenheit. Als Logau ihm berichtete, daß ein Teil der türkischen Flotte bei einem Sturm vernichtet worden sei,64 setzte Thurzó eine hymnische, mit Jubelrufen und
-rao im Meer ersäuft habe. Nun werde Gott gewiß den Weg nach Konstantinopel freimachen.65 Möglicherweise nährte Logau bewußt die Euphorie des Bischofs durch eine entsprechende Berichterstattung. Noch am 24. Februar 1539, keinen
-
62 Zur Ereignisgeschichte der Kämpfe 1538/39 im Spiegel zeitgenössischer Nachrichten vgl. Ham-Zur Ereignisgeschichte der Kämpfe 1538/39 im Spiegel zeitgenössischer Nachrichten vgl. Ham-
des osmanischen Reiches. Bd. 2, 769–786.63 An Georg von Logau, Dezember 1538, 279–282, Nr. 80, hier 281f.: Barba Enobarbus, homo ille
-
quantumvis rebus bellicis et comeatibus probe onustas atque provisas. Deus optimus annuere dignetur, ut
istis beluis eripiant pro perpetua consolacione tocius reipublice Christinane. De strenuis et felicissimis
gradibus ingentis leticie totam hanc diem iucundissimis colloquiis absolveremus Baccho et Libero admi-
nistrante leticie fomenta. Agunt igitur omnes communibus votis tibi magnas gracias pro his iucundissimis
64 Logau veröffentlichte auch im Druck den Brief eines gewissen Eleutherius Magnesius Epidaurius
TVRCICA=||RVM ET BARBAROSSAE || Triremium naufragio nuper in || sinu Hadriatico facto,|| Episto-la.|| ... ||, s.l., 1538, VD16 M 216.
65 An Georg von Logau, Anfang Januar 1539, 282–286, Nr. 81: Reddite nobis sunt littere tue ,
nequiverimus
et suo divino et inscrutabili iudicio hostes tocius Christianismi communes ad neces et interitum nostrorum
properaturos sola potenti virtute sua, nullo mortalium accedente presidio, debellare, conterere ac delere
dignatus est et in terminis Neptuni salsis admodum et frigidis demergere. Ipse certe ille angelus Dei presens
huic plorato certamini preerat diis omnibus celestibus spectantibus, qui olim crudelem et impium Pharao-
nem in pelago et sinu Rubri Maris cum omni cohorte superba sua ita demersit. Dignum igitur est, ut
-
Sunt
igitur iterum atque iterum clementissimo Deo et servatori nostro eterne et iustissime gracie, qui quottidie
tentissimum Deum possibilia, si modo a nobis miseris vermiculis quesitus fuerit et rogatus. Macedonia et
129
handelten Waffenstillstandes, war Thurzó nicht nur im Glauben, die Liga stehe vor einer neuen Offensive, sondern nahm sogar an, Frankreich würde an der Seite des Kaisers in den Seekrieg gegen die Türken eintreten.66 In einem Brief an Logau vom 17. März 1539 sah Thurzó in Karl V. geradezu den „Engel Gottes“, der im Begriff stehe, am Feind der Christenheit das Urteil zu vollziehen.67 An Alexius, der in einem seiner (verlorenen) Briefe offenbar versucht hatte, den Enthusiasmus des greisen Bischofs zu dämpfen, richtete dieser in der zweiten Märzhälfte 1539 eine Art geistliche Ermahnung:
„Seid doch getrost, was die bevorstehende Vernichtung der Türken angeht. Gott der Herr wird ohne Zweifel mit uns sein, hat er doch mit seinem allerheilig-sten Munde selbst versprochen: In welcher Not ihr mich auch anruft, ich werde
-hen. Christus sprach: Marta, Marta, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit
daß ihr Bruder Lazarus nicht sofort, sondern erst zum Jüngsten Gericht von den Toten auferstehen werde. So müssen auch wir ohne allen Zweifel glauben, daß die Türken noch in diesem Jahr völlig zugrunde gehen werden. Kaiser Karl, der Engel Gottes, ist erfüllt und gewappnet mit göttlicher Macht, er wird all das Wüten jener Bestien überwinden, und sie werden nicht bestehen können aus eigenen Kräften und Versuchen angesichts der Größe der göttlichen Macht. Sie müssen entweder sterben oder alles wieder hergeben, was sie mit Schwert, Lüge, List und aller Art von Bosheit an sich gerissen haben. Lang genug haben sie gegen alles Recht auf fremdem Gut gesessen.“68
66 An dens., Kremsier, 24. 2. 1539, 291–293, Nr. 86, hier 293: -
solacione faciens nos cerciores Cesaream maiestatem, regem Gallie atque Venetos perstare solide et inte-
communem tocius Christianitatis hostem divino accedente presidio hac presente estate agrediantur atque
-
barent, locum iis beluis sanguinariis aptissimum, unde amplius nec redire neque nocere nobis poterunt. Sint
clementissimo Deo eterne gracie. Vehementer, crede nobis, his novitatibus sumus consolati.
67 An dens., Olmütz, 17. 3. 1539, 306–308, Nr. 95, hier 307: Quid actum sit cuperemus certio-
-
tis communi ac potentissimo omnium passim Christianorum hosti atrocissimo totis viribus atque conatibus
occurrere paratissimis. Admovebat illos haud dubie presencia divine maiestatis suo sanctissimo numine,
neque deerunt alii quam plurimi probi Christiani principes, quominus advolent ad hoc vere Christianum
simum malum ac presens omnium interitus memorabilis! Quod faustum sit et fortunatissimum!
68 An Alexius Thurzó, Olmütz, 17. 3. 1539, 308–310, Nr. 96, hier 310: -
carum spem habeatis, oro, meliorem. Dominus Deus erit haud dubie nobiscum, cum ipse ore suo sanctis-
et factum erit. Aiebat olim Christus: ‚Marta, Marta, si credideris, videbis gloriam Dei‘. Non credebat enim
Et nos quoque sine
omni hesitacione credere debemus Turcas hoc anno ad intericionem perituros. Cesar Carolus, angelus Dei,
130
Ins Auge springt der Rekurs auf die christliche Glaubenslehre und biblisches Formelgut. Diese Stilebene begegnet in der privaten Korrespondenz des (trotz
--
manischen Reiches. Als Thurzó im Juni 1539 klar wurde, daß Karl V. keinerlei
„heilige“ Liga war zerbrochen, die Venezianer führten Verhandlungen für einen
Bischof eine tiefe Enttäuschung, die er gegenüber dem inzwischen ins heimatli-che Neiße zurückgekehrten Logau offen aussprach:
Sommer Byzanz den Türken entreißt, doch all unsere Hoffnung und Erwartung ist
verwickeln, war nur ein geringer Trost.69 Dennoch gab er, wie er dem Gesandten
Hoffnung, durch eine besondere Gnade Gottes die Vernichtung der Türken noch erleben zu dürfen, nicht auf.70 Bei Gott allein, so schrieb er am selben Tag an Alexius Thurzó in einer geradezu lutherischen Diktion (allerdings in einem Kon-text, der mit dem Kontroversartikel von der Rechtfertigung denkbar wenig zu tun hatte), sei angesichts der Türkengefahr Rettung zu erwarten, bei ihm allein müsse
71
divina potestate fulcitus atque armatus superabit omnem rabiem istarum beluarum, nec poterunt subsistere
viribus et conatibus suis tante divine potestatih. Aut moriendum illis erit aut cedendum bonis vi et ferro,
fraude, dolo et omni nequicia ereptis, satis sit hucusque iniquissime possedisse aliena bona.
69 An Georg von Logau, 1. 6. 1539, 311–313, Nr. 98, hier 313: -
pedicione altum est modo silencium. quid Cesarea
mutuis vulneribus concidant!
70 Utinam liceat
adhuc etate nostra (non nostris meritis, que sane nulla sunt, sed sola plane bonitate divina) Christianitati
consequi et videre consolacionem illam, ut hanc beluam impiissimam et supra modum ferocem cum suis
omnibus deletam et absorptam esse gaudeamus, ad laudem, honorem et gloriam divinae maiestatis, que
lucem valeat prodire iucundissimam.
71 An Alexius Thurzó, Kremsier, 28. 11. 1539, 318–320, Nr. 102, hier 319: Quo tandem nobis miseris
-
nostre, nisi ut humiliemus animulas nostras et ad illud presidium, ad spem eam solidam convertamur, unde
131
Während die zeitliche Koinzidenz der mit den Ereignissen von Belgrad 1522
allem auf protestantischer Seite als Bestätigung eines endzeitlich-irreparablen
als göttliche Bestätigung der Legitimität des eigenen Heraustretens aus dieser Ordnung interpretiert wurde,72 sträubte sich Thurzó gegen die Annahme einer Ir-reversibilität der türkischen Erfolge. Noch am Ende seiner Lebenszeit, als zum einen die türkische Besetzung Zentralungarns bevorstand und zum anderen die
-spondenz ansonsten kaum spirituelle Themen ansprach, mit einer religiös stili-sierten Inbrunst an einem zu diesem Zeitpunkt kontrafaktisch erscheinenden ka-tholisch-habsburgischen Herrschaftsanspruch über den südosteuropäischen Raum fest, soweit dieser „einst christlichen Königen und Fürsten unterworfen“73 war. Die in den Jahren nach der Schlacht am Weißen Berge 1620 einsetzende forcierte Rekatholisierung des östlichen Mitteleuropa und die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einsetzende habsburgische Offensive gegen das Osmanische Reich im ungarischen und südosteuropäischen Raum erwiesen die Langlebigkeit des bei Thurzó beobachteten Legitimitäts- und Raumdenkens, auch wenn der kühne Wunschtraum des gelehrten Bischofs, die Vereinigung Ost- und Westroms unter einem
72 Vgl. Martin Brecht, Luther und die Türken. In: Bodo Guthmüller / Wilhelm Kühlmann (Hg.), Euro-
Wahrnehmung „türkischer Religion“ in Spätmittelalter und Reformation. Göttingen 2008 (Forschungen
und Islam. Eine Untersuchung zum Türken- und Islambild Martin Luthers (1515–1546). Gütersloh 2008 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, 80).
73 Vgl. Anm. 48.



























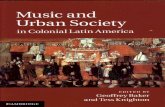




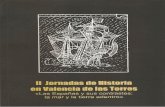



![& MICHAEL KNÜPPEL, “Einige Briefe von Georg Jacob (1862-1937) an Willi Bang Kaup (1869-1934)”, in “Acta Orientalia” 75 (2014) [2015], pp. 59 - 72](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633483172b0dd1e4bf060028/-michael-knueppel-einige-briefe-von-georg-jacob-1862-1937-an-willi-bang-kaup.jpg)








