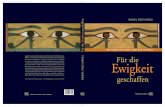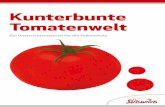Themenkonsolidierung für die Rahmeninitiative „Smart Production“
-
Upload
austrianinstituteoftechnology -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Themenkonsolidierung für die Rahmeninitiative „Smart Production“
Themenkonsolidierung für die Rahmeninitiative „Smart Production“
Erika Ganglberger
Karl-Heinz Leitner
Wolfram Rhomberg
Sabine Schellander
AIT-F&PD-Report Vol. 21, Juni 2010
Themenkonsolidierung für die Rahmeninitiative „Smart Production“
Erika Ganglberger1
Karl-Heinz Leitner2
Wolfram Rhomberg2
Sabine Schellander1
Endbericht zum Projekt Nr. 1.63.00210.0.0
im Auftrag des Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
AIT-F&PD-Report
Vol. 21, Juni 2010
1 ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik
2 Business Unit Research, Technology & Innovation Policy
Inhalt
1 Einleitung und Projektgegenstand 1
1.1 Projektgegenstand und -ziel 1
2 Vorgehensweise im Projekt, Methodik 3
2.1 Vorgehensweise im Projekt 3
2.2 Methodik 4
3 Strukturelle Voraussetzungen 4
3.1 Bedeutung und Größe des Sektors 4
3.2 Stärken und Schwächen 5
3.3 Chancen und Risiken 8
3.4 Wesentliche F&E-Akteure 9
3.5 Förderpolitische Ausgangsbedingungen 10
4 Die Rahmeninitiative – Fokus und Architektur 13
4.1 Gegenstand der Rahmeninitiative „Smart Production“ 13
4.2 Smart Production – Vision 2020 14
4.3 Architektur der Rahmeninitiative „Smart Production“ 15
4.4 Smart Processes - Forschungsschwerpunkte 16
4.5 Smart Materials & Components - Forschungsschwerpunkte 17
4.6 Übergreifende Forschungsschwerpunkte 18
5 Die Forschungsschwerpunkte im Detail: Definition, Zielsetzung und mögliche Forschungsthemen 19
5.1 Forschungsschwerpunkt „Ressourceneffizienz“ 19
5.2 Forschungsschwerpunkt „Leistungsorientierung“ 20
5.3 Forschungsschwerpunkt „Flexibilität“ 21
5.4 Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Werkstoffe“ 22
5.5 Forschungsschwerpunkt „High Tech Werkstoffe“ 23
5.6 Forschungsschwerpunkt „Miniaturisierung von Bauteilen“ 24
5.7 Übergreifende Forschungsschwerpunkte 25
6 Förderprogramme der Produktionsforschung in Deutschland, Schweiz und Finnland: Instrumente und Förderquoten 26
6.1 Deutschland 26
6.2 Schweiz 28
6.3 Finnland 29
7 Instrumente und Maßnahmen für „Smart Production“ 31
8 Anhang 34
8.1 Interviewleitfaden 34
8.2 Liste der befragten Expertinnen (Interviews und Workshops) 36
8.3 Europäische Förderprogramme und Initiativen im Bereich „Ressourceneffizienz“ und „Nachhaltige Werkstoffe“ 37
01
1 Einleitung und Projektgegenstand
Die Zukunft der österreichischen Produktion ist zu einem großen Ausmaß von einer gezielten Mo-dernisierung der Produktionsprozesse, von einer „Smart Production“ für neue, wettbewerbsfähige und nachhaltige Produkte abhängig. Dazu notwendige Forschung, Entwicklung und Technologie wird in Kooperation Industrie/Wissenschaft und Öffentliche Hand bereits vorangetrieben. F&E Programme und Technologieinitiativen auf EU Ebene, aber auch auf nationaler Ebene zeugen von dieser Ent-wicklung (siehe „Strategieinput Smart Production“).
Damit ist Forschung und Entwicklung (F&E) mit dem Ziel der Verbesserung von Produktionstechno-logien und -prozessen für den gesamten produzierenden Sektor essenziell. Die Produktionsfor-schung entwickelt Verfahren, Ausrüstungen und Produktionsstätten. In ihr werden wissenschaftliche Erkenntnisse aus Forschungsgebieten wie Informationstechnologie, Nanotechnologie, Biotechnolo-gie, neue Werkstoffe oder Mikrosystemtechnik für den Bedarf der industriellen Produktion aufgegrif-fen. Sie schafft die Voraussetzungen für die Zukunft der Produktion in Österreich und den techni-schen Vorsprung für mehr Kundenindividualität, Ressourceneffizienz und Zuverlässigkeit sowie neue und bessere Produkte.
Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in Österreich den Handlungsbedarf für entsprechende Förder-maßnahmen auf Seiten der FTI-Politik nochmals gezielt auf die gegenwärtigen Herausforderungen hin zu durchleuchten und vor diesem Hintergrund nachhaltige Schwerpunkte für kommenden Unter-stützungsbedarf zu identifizieren und zu argumentieren. Auch die im Frühjahr 2009 veröffentlichte „Systemevaluierung unterstreicht diese generelle Notwendigkeit. Daraus können folglich öffentliche und kooperative Anreize für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Produktion gesetzt werden, und damit wichtige Schritte in Richtung einer positiven Zukunft der österreichischen Industrie und des österreichischen Produktionsstandortes.
Vor diesem Hintergrund hat das BMVIT das AIT bereits im Herbst 2009 mit der Erstellung eines „Strategieinput Smart Production“ beauftragt. Ziel war es, die Notwendigkeit für FTI-politische Aktivi-täten vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen und Trends prinzipiell zu identifizieren, inter-national und national zu verorten und zu argumentieren. Daraus wurden erste Überlegungen für mögliche inhaltliche wie auch strukturelle Schwerpunktsetzungen in Kooperation mit dem BMVIT und der FFG abgeleitet wie auch erste Maßnahmenvorschläge skizziert.
Zudem wurde erkannt, dass eine mögliche Unterstützung der österreichischen Produktionsforschung und damit des österreichischen produzierenden Gewerbes und der Industrie breit gefasst im Zuge einer so genannten „Rahmeninitiative Smart Production“ umgesetzt werden soll.
Im Jänner 2010 wurden die Ergebnisse und Überlegungen aus diesem Strategieinput im Rahmen eines Workshops mit einer Runde ausgewählter ExpertInnen diskutiert und erste vertiefende und erweiternde Einsichten und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Jedenfalls wurde ersichtlich, dass der erste Entwurf als Grundlage für vertiefende und detailliertere Ausarbeitungen hin zu einem „Stra-tegiekonzept“ dienen kann, jedoch noch entsprechende Recherchen und Verdichtungen notwendig sind.
1.1 Projektgegenstand und -ziel
Zentrales Herzstück dieser notwendigen Ausarbeitungen und Recherchen, und damit des vorliegen-den Projektes war die weitere empirische Konsolidierung der im Strategieinput vorgeschlagenen strategischen Themenschwerpunkte bis hin zu operationalisierbaren Vorschlägen für ausschreibbare Forschungsschwerpunkte bzw. Forschungsthemen. Auch mögliche strukturelle Schwerpunktsetzun-
02 Themenkonsolidierung Smart Production
gen bzw. Handlungsfelder für Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten im Bereich der Produktions-forschung und Humanressourcen wurden dabei sichtbar.
Dabei war es auch Aufgabe des Auftragnehmers, die Architektur einer solchen Rahmeninitiative von Seiten der strategischen Themen und Inhalte (Fördergegenstand und strategische Forschungsberei-che und Schwerpunkte) weiter zu entwickeln (gegenständliches Projekt) sowie national wie auch international in ExpertInnengesprächen und Workshops auf deren Robustheit zu überprüfen. Der Projektnehmer hatte somit auch die Aufgabe, die Vision 2020 des Strategieinputs, und damit mögli-che strategische Zielsetzungen der Rahmeninitiative auf der Makro- und Mesoebene, zu überarbei-ten.
Die konkrete Themenkonsolidierung und -verdichtung selbst erfolgte basierend auf einer „bottom-up“ Befragung einschlägiger österreichischer ExpertInnen aus Forschung und Industrie (Interviews und Workshops). Dabei wurden auch Informationen zu existierenden Rahmenbedingungen sowie zu Stärken und Schwächen im Bereich der Produktionsforschung bzw. industrieller Kompetenzen erho-ben bzw. recherchiert. Weiters wurde erhoben, welche FTI-politischen Instrumente in der Vergan-genheit und welche für die Zukunft als sinnvoll und notwendig von Seiten der potenziellen Förder-nehmer erachtet werden.
Vor dem Hintergrund der strategischen Steuerung einer solchen Rahmeninitiative „Smart Production“ durch das BMVIT sowie der konkreten Umsetzung durch die Förderagenturen wurden auch interna-tionale Aktivitäten und Förderformate im Bereich der Produktionsforschung näher recherchiert (Schweiz, Deutschland, Finnland), um für das Design einer solchen Rahmeninitiative zu lernen.
Die Ergebnisse des Projektes wurden im Juni 2010 entlang dieser Aufgabenstellungen vom Auftrag-nehmer präsentiert und im Managementboard diskutiert.
Folgende zentrale Zielsetzungen und Inhalte hat das gegenständige Projekt (Themenkonsolidierung Smart Production) demnach erfüllt:
– Beitrag zur Weiterentwicklung der Architektur einer Rahmeninitiative „Smart Production“ mit Schwerpunkt Themen und Inhalte
– Konsolidierung der inhaltlichen Themenschwerpunkte bis hin zu operationalisierbaren Vor-schlägen (Forschungsschwerpunkte und -themen).
– Verschriftlichung der Ergebnisse aus dem Projekt in einem Bericht „Themenkonsolidierung für die Rahmeninitiative Smart Production“
Die gewonnen Ergebnisse und Konsolidierungen sowie die daraus abgeleiteten Vorschläge für Operationalisierungen sind somit eine elaboriertere Erweiterung des bereits vorliegenden „Strategie-input Smart Production“ vom Jänner 2010 und stellen mit diesem gemeinsam das „Strategiekonzept Smart Production“ dar.
03
2 Vorgehensweise im Projekt, Methodik
2.1 Vorgehensweise im Projekt
Bereits im Herbst 2009 wurde das AIT (Austrian Institut of Technology) beauftragt einen „Strategie-input Smart Production“ zu erarbeiten. In der Studie wurden unter anderem nationale und internatio-nale Initiativen im Bereich der Produktionsforschung angeführt und eine Vision 2020 für die österrei-chische Sachgüterproduktion erarbeitet. Weiters wurden vier strategische Themenschwerpunkte (Flexible Produktion, High-Tech Produktion, Ressourceneffiziente Produktion, Biobasierte Produkti-on) definiert.
Im Januar 2010 wurden die Vision 2020 sowie die vier definierten Themenschwerpunkte (Strategi-sche Leitlinien) in einem ExpertInnenworkshop reflektiert und inhaltlich vertieft. Als wesentliches Ergebnis des Workshops wurde die thematische Ausrichtung der Rahmeninitiative „Smart Producti-on“ erweitert. Mögliche Forschungsthemen werden nun den beiden Forschungsbereichen „Smart Processes“ (Forschungsschwerpunkte: Ressourceneffizienz, Leistungsorientierung, Flexibilität) bzw. „Smart Materials & Components“ (Forschungsschwerpunkte: Nachhaltige Werkstoffe, High Tech Werkstoffe, Miniaturisierte Bauteile) zugeordnet (siehe Kapitel 4). Darüber hinaus gibt es auch zwei übergreifende Forschungsschwerpunkte (Virtuelle Methoden, Gesamtheitliche Betrachtung der Wertschöpfungskette).
Für diese Forschungsschwerpunkte galt es daher im Folgenden, mögliche Inhalte vertiefend zu defi-nieren (Inhaltliche Definition und Zielsetzung) sowie mögliche für Österreich relevante Forschungs-themen beispielhaft zu identifizieren und zu formulieren. Um aktuelle Forschungsthemen möglichst umfassend abzubilden, erfolgte daher eine breite Einbindung von Unternehmen (Großunternehmen, Klein- und Mittelunternehmen) und Forschungseinrichtungen (universitär, außeruniversitär). 40 nati-onale ExpertInnen aus unterschiedlichen Branchen und Institutionen wurden in Einzelinterviews mit Hilfe eines Leitfadens und in zwei „Smart Production“ Workshops involviert
1, um aktuelle Fragestel-
lungen / Themen im F&E -Bereich und persönliche Einschätzungen zum Förderangebot zu erfassen. Um eine zukünftige Rahmeninitiative „Smart Production“ möglichst bedarfsorientiert zu gestalten, erfolgte neben der empirischen Erfassung zukünftiger Forschungsthemen zudem auch eine Befra-gung zu den bisher verwendeten Instrumenten und eine Bedarfsanalyse hinsichtlich zukünftiger möglicher Maßnahmen und Instrumente.
Neben der Einbindung nationaler ExpertInnen wurden auch Aktivitäten auf internationaler Ebene gesetzt – so wurden Gespräche mit Programmverantwortlichen von thematisch ähnlichen Förder-programmen in Finnland und Deutschland bzw. mit der Manufuture Plattform in der Schweiz geführt.
Zudem wurden ergänzend auch Informationen zu existierenden Rahmenbedingungen sowie zu Stär-ken und Schwächen im Bereich der Produktionsforschung bzw. industrieller Kompetenzen erhoben bzw. recherchiert.
1 siehe Liste mit den befragten ExpertInnen bzw. Organisationen im Anhang
04 Themenkonsolidierung Smart Production
2.2 Methodik
Die empirische Erhebung zur Themenkonsolidierung erfolgte vorwiegend in mehrstündigen leitfa-dengestützten Einzelinterviews (26 Interviews mit 29 ExpertInnen aus unterschiedlichen Bereichen, Branchen, Institutionen, Unternehmen).
2
Für die Forschungsschwerpunkte „Ressourceneffizienz“ sowie „Leistungsorientierung“ wurde ein Workshop mit 7 ExpertInnen durchgeführt bei dem Leitfragen zur Zukunft der österreichischen Sachgüterproduktion, zu ausbaufähigen und zukunftsträchtigen Forschungsthemen, sowie zu In-strumente und Maßnahmen diskutiert wurden. Weiters erfolgte eine Befragung von 4 Experten im Rahmen des BMVIT „Smart Production“ Workshop zu E-Maintenance.
Auch der BMVIT-Workshop zur Energieforschungsstrategie wurde für Befragungen zu „Smart Pro-duction“ genützt.
3
Die Auswertung der ExpertInneninputs erfolgte qualitativ basierend auf Ergebnisprotokollen.
3 Strukturelle Voraussetzungen
3.1 Bedeutung und Größe des Sektors
Die volkswirtschaftliche Leistungskraft Österreichs ist maßgeblich von der Sachgütererzeugung ab-hängig, die rund 20% der Wertschöpfung ausmacht. So erwirtschafteten die Unternehmen der öster-reichischen Sachgütererzeugung (ÖNACE 2003, Wirtschaftszweige 15-37) im Jahr 2007 mit ihren rd. 640 Tsd. Beschäftigten 48,3 Mrd. Euro an Bruttowertschöpfung, was dem langjährigen Anteil von rd. 20 % der gesamten Bruttowertschöpfung Österreichs entspricht.
4 Damit liegt die Sachgütererzeu-
gung in Österreich in ihrer Bedeutung über dem entsprechenden EU Durchschnitt von rd. 17 %. Die reale Wertschöpfung nahm seit 1997 um 43 % zu, je Beschäftigten um 41 %. Im Jahr 2007 waren in der Sachgütererzeugung rd. 1,5 % mehr Personen beschäftigt als ein Jahrzehnt zuvor
5. Dabei
schafft nach Berechnungen der Kommission jeder Arbeitsplatz in der Industrie zwei weitere Arbeits-plätze in der vor- und nachgelagerten Dienstleistung in Europa, womit rd. 50 % der Arbeitsplätze von der Industrie abhängen.
6 Die Sachgüterproduktion trägt auch maßgeblich zur Handelsbilanz bei, die
Exportquote der österreichischen Sachgütererzeugung liegt bei 56 %7.
Darüber hinaus machen die F&E-Aktivitäten der Sachgüterproduktion den Gros der F&E im Unter-nehmenssektor in Österreich aus. Im Jahr 2007 (letzte Vollerhebung zur F&E) investierten Unter-nehmen der Sachgüterproduktion 3,4 Mrd. Euro in F&E, was rund 70% aller F&E-Aufwendungen des Unternehmenssektors ausmacht, die insgesamt 4,8 Mrd. Euro betrugen. Die F&E-Quote der Sach-
2 siehe Liste mit den befragten ExpertInnen bzw. Organisationen sowie Interviewleitfaden im Anhang
3 Rechnet man diesen WS zu den Projekterhebungen dazu, wurden sogar knapp 50 ExpertInnen im Rahmen des Projektes befragt.
4 Diese und die Weiteren hier angeführten statistische Daten zur Sachgüterproduktion basieren auf der ÖNACE Klassifikation 2003.
5 Statistik Austria (2009): Leistungs- und Strukturerhebung 2007. Wien.
6 Europäische Kommission (2009): Work Programme 2010, Cooperation, Theme 4, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Producti
on Technologies - NMP.
7 Statistik Austria (2008): Konjunkturstatistik 2008 im produzierenden Bereich, Band 1, Wien.
05
güterproduktion liegt damit bei 7% der Wertschöpfung. Gemäß der letzten F&E-Vollerhebung sind in Österreich insgesamt 1.391 F&E-betreibende Unternehmen in der Sachgüterproduktion
8, womit die
industriellen Adressaten eines Produktionsforschungsprogramms eingegrenzt werden können. Zu-sätzlich betreiben geschätzt etwa 100 bis 150 Dienstleistungsunternehmen (Bsp. Software) F&E in diesem Bereich.
9
Insgesamt ist der produzierende Sektor in Österreich breit diversifiziert, der Anteil der High-tech Sek-toren (Bsp. Medizintechnik, Instrumente) ist jedoch im internationalen Vergleich unterrepräsentiert. Hingegen haben die traditionellen Branchen wie Metallerzeugnisse, Holzverarbeitung und Papier einen relativ hohen Anteil. Trotz dieser strukturellen Schwäche kommt die Wettbewerbsanalyse der Europäischen Kommission etwa zum Befund, dass die österreichische Industriestruktur einen hohen Anteil an global wettbewerbsfähigen Branchen aufweist.
10
Eine Studie zu jenen Sektoren, die Produktions- und Prozesstechnologien erzeugen bzw. anbieten, illustriert, dass dieser Bereich in Österreich rund 6,9 Mrd. Euro an Wertschöpfung aufweist und dabei 359 Unternehmen rd. 590 Mio. Euro für F&E aufwenden. Der größte Sektor dieses Bereichs ist der Maschinenbau, ein wichtiger Entwickler und Lieferant von Produktionstechnologien, der auch mit 12% Anteil an der Wertschöpfung über dem europäischen Durchschnitt von 10% liegt.
11
Diese erste Bestandsaufnahme zeigt damit tendenziell ein positives Bild über die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden Sektors in Österreich in den vergangenen Jahren, das angesichts der vielfältigen Herausforderungen im Weiteren differenzierter betrachtet werden soll. Die Basis dafür liefern sowohl statistische Daten wie auch Einschätzungen der ExpertInnen aus Industrie und Forschung, die im Rahmen dieses Projekts befragt wurden.
3.2 Stärken und Schwächen
Für die Frage der Innovationsfähigkeit des österreichischen produzierenden Bereichs können eini-ge empirische Informationsquellen herangezogen werden. Zunächst zeigt der Blick in den Innovation Community Survey (CIS), dass Österreich im europäischen Vergleich im oberen Drittel rangiert, was eine Vielzahl von Indikatoren zu Produkt- und Prozessinnovationen betrifft.
12 Insgesamt ist der Inno-
vationspfad mit wenigen Ausnahmen jedoch tendenziell als inkrementell zu beschreiben. Die Innova-tionsaktivitäten zu Produktions- und Prozesstechnologien sind stark auf spezifische Kundenbedürf-nisse ausgerichtet, wobei die Existenz innovativer Kunden und avancierter Nachfrage durch die In-dustrie von großer Bedeutung ist, und hier auch die räumliche Nähe zwischen Produzenten und Anwendern ein Rolle spielt. Österreich hat etwa einige Bereiche, wo innovative Hersteller von Pro-duktionstechnologien und deren Anwender eng interagieren (Bsp. Papiermaschinen, Wälzlager, Kunststoffmaschinen). In diesem Zusammenhang zeigt die F&E-Statistik ebenfalls, dass Unterneh-men nicht nur F&E im gegenständlichen Bereich (Bsp. Maschinenbauer forschen zu Maschinen) durchführen sondern selbst breit gefächerte Themenstellungen adressieren wie die Entwicklung von Software bis hin zu Entwicklungstätigkeiten, die die Anwendungsbereiche von Produktions- und Pro-
8 Statistik Austria (2009): F&E-Erhebung 2007, Wien.
9 Leitner, K. H., Dachs, B., Rhomberg, W., Zahradnik, G. (2009): Ist- und Potenzialanalyse von Forschung und Entwicklung im Bereich Manufacturing,
Produktions- und Prozessmanagement in Österreich. Studie für den RFT, Wien.
10 Europäische Kommission (2008): Communication from the Commission on the European Competitiveness Report 2008.
11 Leitner, K. H., Dachs, B., Rhomberg, W., Zahradnik, G. (2009): Ist- und Potenzialanalyse von Forschung und Entwicklung im Bereich
Manufacturing, Produktions- und Prozessmanagement in Österreich. Studie für den RFT, Wien.
12 Statistik Austria (2008): Innovation 2004-2006. Ergebnisse der Fünften Europäischen Innovationserhebung (CIS 2006), Statistik Austria, Wien.
06 Themenkonsolidierung Smart Production
zesstechnologien einschließen (Bsp. Maschinenbauer forschen zur Metallverarbeitung oder Kraft-fahrzeugen). Auch die befragten ExpertInnen argumentieren, dass die österreichischen Unterneh-men im internationalen Vergleich ein hohes Maß an Anwendungswissen aufweisen. Des Weiteren werden das Systemwissen und das Systemengineering sowie die gesamtheitliche Betrachtung der Prozesskette in der Planung und Durchführung als Stärke der österreichischen Industrie gesehen. In diesem Zusammenhang werden auch ganzheitliche Ansätze, die Produkt, Produktion und Dienstleis-tungen kombinieren, als Chance gesehen.
Häufig sind österreichische Industrieunternehmen Nischenplayer und haben die Kompetenzen, bekannte Technologien gezielt für diese Nischen und Kundenanforderungen anzupassen und wei-terzuentwickeln. Diese erschwert jedoch zugleich teilweise die Möglichkeit zum Wachstum von Un-ternehmen. Dies ist konform mit dem Befund, dass Österreich relativ wenige große multinationale Unternehmen aufweist. Die befragten ExpertInnen aus Wirtschaft und Wissenschaft sehen im Weite-ren eine Schwäche in der eigenständigen Entwicklung und Vermarktung von neuen Produkten, was wiederum durch die starke Zulieferorientierung bedingt ist, die eigenständige Entwicklung und Ver-marktung von Produkten erschwert. Des Weiteren ist bei Entwicklung von grundsätzlich neuen Technologien das Upscaling für die im internationalen Vergleich kleineren Unternehmen häufig schwierig.
Was die Kooperationsintensität mit den unterschiedlichsten Partnern wie Kunden, Lieferanten und Forschungseinrichtungen anbelangt betrifft, liegt die österreichische Industrie im europäischen Mittel-feld, wobei der CIS jedoch nicht zwischen Produkt- und Prozessinnovationen unterscheidet. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass bei einem Gutteil der Unternehmen die Entwicklung und Optimierung von Produktionsanlagen eigenständig im eigenen Haus durchgeführt wird, teilweise ganz bewusst, um einen ungewünschten Wissenstransfer über den Partner, der Produktionstechno-logien entwickelt, zu Wettbewerbern zu verhindern.
Im Allgemeinen hat sich die Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft in den letzten Jahren deutlich intensiviert. Der CIS 4 zeigt in diesem Kontext etwa, dass der Maschinenbau über-durchschnittlich häufig, nämlich zu 64% mit Universitäten oder Fachhochschulen kooperiert (Durch-schnitt über alle Sektoren: 42%).
13 Die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft zu
Themen der Produktionsforschung wurde im Rahmen von neu geschaffenen Einrichtungen wie CD-Labors und Kompetenzzentren in den letzten Jahren stetig ausgebaut und institutionalisiert. Dabei zeigt sich, dass sich ein Großteil der neu geschaffenen Einrichtungen mit Fragen der Produktions-technologien befasst. Diese kooperativen Einrichtungen sind dabei vorwiegend Bottom-up entstan-den und reflektieren daher existierende Stärken und organisatorische F&E-Strategien. Die Koopera-tion und der Wissenstransfer zwischen Industrie und außeruniversitären Forschungseinrichtungen kann als gut bezeichnet werden, analysiert man die Projektfinanzierung von Seiten der Industrie, die einen hohen Anteil der F&E-Finanzierung an den österreichischen außeruniversitären Forschungs-einrichtungen darstellt.
14 Aber auch bei den universitären Einrichtungen gewinnt die Industrie zu-
nehmend an Bedeutung, was den Finanzierungsanteil universitärer Forschung betrifft, wenngleich sie dort im internationalen Vergleich noch relativ bescheiden ist.
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass bei grundlagenorientierteren Forschungstätigkeit in Österreich in vielen Bereichen die kritischen Massen fehlen, um radikale neue Technologien auf breiter Basis zu entwickeln, wenngleich auch konstatiert wird, dass nicht in allen Bereichen kritische Massen notwendig sind. Um mit diesem Tatbestand umzugehen, suchen heimische Unternehmen
13
Statistik Austria (2008): Innovation 2004-2006. Ergebnisse der Fünften Europäischen Innovationserhebung (CIS 2006), Statistik Austria, Wien.
14
Schnabl, A., Müllbacher, S., Dippenaar, S., Skrivanek, I., Weberberger, I., Fessl, K., Bleicher, F., Berger, D. (2009): MANUF UTURE JTI, BMVIT,
Wien.
07
und F&E-Einrichtungen internationale Partner und beteiligen sich zunehmend an europäischen Initia-tiven und Forschungsprogrammen.
Bei der Frage, wer die wesentlichen Treiber für die Produktionsforschung auf Seiten der Industrie sind, kann davon ausgegangen werden, dass ein Teil moderner Produktionstechnologien und -innovationen durch Produzenten entwickelt und angeboten werden, wichtige Innovationen aber auch von den produzierenden Unternehmen selbst im Haus durchgeführt werden. Zugleich verlangt die Akquisition von neuen Produktionstechnologien häufig Anpassungen an die betrieblichen Spezifika, was ebenfalls innovative Anstrengungen erfordert. Der European Manufacturing Survey EMS, der den Einsatz von neuen Produktionstechnologien untersucht, zeigt dabei, dass Österreich im guten europäischen Mittelfeld liegt, was die Diffusion moderner Produktionstechnologien betrifft.
15 Im All-
gemeinen setzen die Branchen Metall, Maschinen, Fahrzeuge und Elektronik häufiger moderne Pro-duktionstechnologien ein als andere produzierende Branchen. Ferner haben exportintensive Unter-nehmen eine größere Notwendigkeit für den Einsatz von Produktions- und Prozesstechnologien. Das internationale Wettbewerbsumfeld verlangt hier entsprechend effiziente und flexible Produktionspro-zesse. Wie zu erwarten, steigt auch mit zunehmender Unternehmensgröße der Einsatz von Produk-tionstechnologien. Vergleichsweise ältere Technologien wie CAD, CAM und PPS (Produktionspla-nungs- und Steuerungssoftware) sind indes bereits weit verbreitet und besitzen kaum mehr Diffusi-onspotenzial. Hingegen haben Bildverarbeitung in der Produktion, Prozessintegrierte Qualitätskon-trolle, Supply Chain Management und die Simulation zur Prozessauslegung noch großes Anwen-dungspotenzial in der österreichischen Industrie. Was die Diffusionsbarrieren für Produktionstech-nologien betrifft, sind diese bei größeren Unternehmen organisatorischer, bei kleineren Unternehmen vor allem finanzieller Natur.
Was spezifische technologische Stärken im Bereich der Produktionsforschung auf breiterer Basis anbelangt, werden diese von den befragten ExpertInnen im Bereich traditioneller Maschinenbau und Automatisierung, Metallerzeugung und -verarbeitung sowie der Kunststoffverarbeitung gesehen. Auch in der mechanischen Bearbeitung und Formgebung werden Stärken verortet, wie auch innova-tive Werkstoffentwicklung (Kunststoff, Sinterwerkstoffe, etc.) und Werkzeugherstellung angeführt werden können. Das Thema der Simulation, eine Art Querschnittstechnologie, hat in den letzten Jahren ebenfalls technologisch an Bedeutung gewonnen. Hier wurden Simulation erfolgreich im Bereich Prozesssimulation (Schweißprozess, Umformprozess, Wärmebehandlungsprozess, Fließ- und Füllprozess, Walzprozess, ...) durch die Industrie eingeführt. Weiters werden ganz allgemein in der Kombination der Maschinentechnologie und Werkstofftechnologie (Einstellung auf veränderte Anforderungen) Stärken gesehen.
Auch die Patentstatistik kann in diesem Zusammenhang herangezogen werden, um technologische Schwerpunkte zu identifizieren. So zeigen sich Stärken im Bereich Papier, Schweißen, Eisenbahn-anlagen, Werkzeugmaschinen, Transportvorrichtungen, Metallurgie, Materialverarbeitung.
16 Schwä-
chen offenbaren Statistiken in den Bereichen Organische Chemie, Informationstechnologie, Phar-mazie, Optik, Chemische Verfahrenstechnik, Telekommunikation.
Insgesamt wird in Österreich bei Forschung, Entwicklung und Innovation vor allem ein ingenieur-wissenschaftlicher Zugang, vielfach getragen von HTL-Ingenieuren, identifiziert, der im Allgemei-nen als angestammte Stärke gesehen wird, nicht selten als „Tüfteln“ bezeichnet wird, während einige
15
Leitner, K. H., Dachs, B., Rhomberg, W., Zahradnik, G. (2009): Ist- und Potenzialanalyse von Forschung und Entwicklung im Bereich
Manufacturing, Produktions- und Prozessmanagement in Österreich. Studie für den RFT, Wien.
16 European Patent Office; Forschungs- und Technologiebericht (2008), Wien.
08 Themenkonsolidierung Smart Production
dies sogar als „höchstqualifiziertes Basteln“ charakterisieren und diesen Pfad kritisch beurteilen.17
Die oben angeführte Simulation ermöglicht hier im Besonderen, einen theoretischen bzw. wissen-schaftlicheren Zugang und wird von ExpertInnen als besondere Chance gesehen.
Qualifiziertes Personal, angefangen von Facharbeitern bis zu hin zu Universitätsabsolventen, wird in Österreich von den ExpertInnen übereinstimmend (noch) als Stärke und Standortvorteil betrachtet. Manager und Wissenschafter sind sich aber bewusst, dass es zukünftig vermehrt Anstrengungen bedarf, um das Niveau im internationalen Wettbewerb zu halten. Im Besonderen wird von einigen ExpertInnen der Rückgang der handwerklichen bzw. technischen Ausbildungskomponenten bei HTLs bzw. Fachhochschulen kritisch gesehen. In der universitären Ausbildung von Technikern und Naturwissenschaftern wird hingegen partiell zu wenig betriebswirtschaftliche und unternehmerische Ausbildung verortet. Des Weiteren wird in einigen Branchen und Bereichen bereits heute ein Mangel an gut ausgebildetem Fachpersonal konstatiert.
Prinzipiell wird auch die notwendige Flexibilität und Bereitschaft der Mitarbeiter, sich mit neuen Technologien, Veränderungen und Innovationen auseinander zu setzen, gesehen. Auch wird im Allgemeinen die Einstellung der Bevölkerung zu „Österreich als Industriestandort“ durchwegs als Stärke betrachtet.
3.3 Chancen und Risiken
Auf Basis von Studien und Einschätzung der im Rahmen dieses Projekts interviewten ExpertInnen können einige Chancen und Risiken der österreichischen Produktion bzw. Produktionsforschung angeführt werden.
Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Wettbewerb und Kostendruck auch zukünftig weiter zunehmen werden und im Besonderen östliche und fernöstliche Länder ihre technologischen Fertig-keiten ausbauen. Für Europa und Österreich besteht die „einzige Möglichkeit und Chance“, hier wei-ter reüssieren zu können, in der Automatisierung der Produktion entlang der gesamten Produktions-kette. Wiewohl hier teilweise (vor allem niedrig qualifiziertere) Arbeitsplätze verloren gehen, steigt der Bedarf in neuen Bereichen, etwa F&E, Engineering, Beratung oder Dienstleistungen. Neben Kostenreduktion und Produktionseffizienz ist die Umsetzungsgeschwindigkeit (time-to-market) durch adaptive, flexiblere Prozesse (Produktionsprozess, Logistik, Dienstleistungen) zu erhöhen. Dazu ist die gesamtheitliche Betrachtung von Prozessketten und Abläufen (inner- und außerbetrieblich) erfor-derlich, worin eine große Chance gesehen wird.
Gelingt es nicht, eine effiziente, adaptive und intelligente Produktion zu realisieren, sehen die öster-reichischen Industrievertreter die Gefahr, dass die Produktion weiterhin abwandern wird, womit nach Einschätzung der ExpertInnen längerfristig auch die F&E abwandert. In diesem Zusammenhang wird auch angeführt, dass ein gewisses Risiko besteht, dass zugleich Fachpersonal abwandert.
Des Weiteren ist die Produktentwicklung (Produktinnovation) in Kombination mit der Einführung neu-er Produktionstechnologien (Prozessinnovation) eine Chance, um längerfristige Wettbewerbsvorteile aufzubauen, die nicht einfach imitiert werden können. Die integrierte Produkt- und Prozessinnovation
17
Tichy, G. (2009): Was ist das „Österreichische“ an der österreichischen FTI-Politik?: in: Leitner, K-H., Weber, M., Fröhlich, J. (2009) (Eds.):
Innovationsforschung und Technologiepolitik in Österreich: Neue Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten, Studienverlag, Innsbruck, S.
255-272.
09
(Bsp. Nanostrukturierte Produkte, Biopolymere, Brennstoffzellen-Komponenten) stellt gleichwohl hohe Anforderungen an unternehmerische Strategien und Kompetenzentwicklung (Marketing, Pro-zess-Know-How, Organisation etc.). Derartige Produkte sollten schwerer imitiert werden können, da ihre Produktion technologisch komplex ist, womit die Produktpiraterie eingedämmt werden kann, die ebenfalls als Risiko eingeschätzt wird.
Wie oben angeführt, ist die Nischenorientierung ein Spezifikum der österreichischen Industrie, was vor allem als Stärke gesehen wird. Dennoch bekräftigen einigen Akteure, dass es einer gewissen Gruppe von Unternehmen gelingen muss, sich auf breitere (und wachsende) Massenmärkte zu posi-tionieren.
3.4 Wesentliche F&E-Akteure
Was F&E Aktivitäten zu Produktions- und Prozesstechnologien im universitären und außeruniversitä-ren Bereich betrifft, so zeigt die aktuelle AIT Studie zu F&E in Manufacturing
18, dass sich im Bereich
der universitären und außeruniversitären Forschungslandschaft rund 3.150 Personen mit der Ent-wicklung oder Verbesserung von neuen Produktionstechnologien befassen bzw. dazu wissenschaft-liche Grundlagen liefern.
19
Neben Universitäten (Technische Universitäten, Universität Linz, Universität für Bodenkultur) und der Akademie der Wissenschaften finden sich auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie die AIT, JR, Profactor, Christian Doppler Labors, Kompetenzzentren sowie private gemeinnützige For-schungsgesellschaften wie die ACR. Alleine neun Kompetenzzentren (u.a. CEST, ACCM, MPPE, CTR, WOOD, MOBILITY, ACIB, XTribology) befassen sich mit Fragen der Produktionsforschung. Aber auch Profactor und das NanoTecCenter Weiz können angeführt werden. Zunehmend führen auch Fachhochschulen F&E durch, die im Rahmen von Studiengängen zu Automatisierungstechnik, Mechatronic, High Tech Manufacturing und dgl. F&E-Projekte abwickeln. Dabei zeigt sich, dass rd. 40% der F&E-Beschäftigten dem außeruniversitären Bereich zuzuordnen sind (13% aus Kompe-tenzzentren), während die verbleibenden 60% in Universitäten und auch Fachhochschulen beschäf-tigt sind.
Die Universitäten haben in jüngster Zeit gezielt Forschungsschwerpunkte definiert, die sich mit Fra-gen der Produktionsforschung befassen. Die Technische Universität Wien hat etwa als fakultäts-übergreifende Kompetenzfelder definiert: „Material Science / industrielle Technologien“; „Computati-onal Science and Engineering“. Die Technische Universität Graz hat „Production Science und Mana-gement“ als Exzellenfeld definiert. Die Montanuniversität Leoben „Sustainable Produktion and Tech-nology“. „Mechatronic“ ist ein Exzellenzschwerpunkt der Universität Linz.
Der Großteil der befragten ExpertInnen geht davon aus, dass es in Österreich im Allgemeinen nicht unbedingt zu wenige F&E-Institute gibt, aber zu wenig Abstimmung und Koordination zwischen den wissenschaftlichen F&E-Akteuren existiert.
18 Leitner, K. H., Dachs, B., Rhomberg, W., Zahradnik, G. (2009): Ist- und Potenzialanalyse von Forschung und Entwicklung im Bereich Manufacturing,
Produktions- und Prozessmanagement in Österreich. Studie für den RFT, Wien.
19
Nicht erfasst wurden dabei Arbeiten in den Natur- und Formalwissenschaften (Bsp. Physik, Mathematik), die jedoch zweifelsohne Grundla-
gen zur Entwicklung von Produktionstechnologien oder Lösungen spezifischer Probleme liefern können.
10 Themenkonsolidierung Smart Production
3.5 Förderpolitische Ausgangsbedingungen
Die FTI-Politik und Förderlandschaft in Österreich, so der Befund von Studien (Forschungs- und Technologieberichte, ERAwatch Monitoring, Systemevaluierung) und den im Zuge dieses Projekts involvierten ExpertInnen, kann insgesamt als durchwegs effektiv und sehr gut ausgebaut bezeichnet werden. Wenngleich es nur in einem sehr eingeschränkten Umfang in der Vergangenheit direkte Maßnahmen bzw. thematische Programme zur Förderung der Produktionsforschung gegeben hat, wie etwas das Programm „Fabrik der Zukunft“, wurden viele thematisch offene Bottom-up Program-me von Seiten der adressierten Akteure für Fragen der Produktionsforschung genutzt. Angeführt werden können hier vor allem die Basisprogramme der FFG, etwa die Basisförderung, BRIDGE, Forschungs-Headquarter, Innovationsscheck, Start up-Förderung, die in der Regel thematisch nicht fokussiert sind und defacto vielfach F&E im Produktionsbereich fördern. Bei den Strukturprogram-men (Kompetenzzentren, Ausbau der Forschung an Fachhochschulen und anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen) werden Schwerpunkte an etablierten Einrichtungen gefördert, die eben-falls größtenteils thematisch offen sind. Auch diese befassen sich zu einem Gutteil mit Fragen der Produktionsforschung. Bei den thematischen Programmen können FIT-IT, die NANO Initiative und die Programmlinie Fabrik der Zukunft (Nachhaltig Wirtschaften) angeführt werden.
Programme der AWS unterstützen ebenfalls durch vielfältige Maßnahmen die Entwicklung, insbe-sondere auch den Einsatz (Diffusion) von neuen Produktionstechnologien. Programme für die Tech-nologieförderung, die Internationalisierung oder das Wachstum von Unternehmen sind hier zu er-wähnen. Auch der Technologietransfer von F&E-Einrichtungen zur industriellen Anwendung wird gefördert (Bsp. aws ProTrans).
Insgesamt sehen einige befragte ExpertInnen einen Mangel an Förderungen im Übergang von der Entwicklung zur Produktion. In dieser Phase sind Entwicklungs- und Innovationsrisiko im Verhältnis zu den hohen Investitionsaufwendungen relativ hoch. Investitionsförderungen für Demonstrations- und Pilotanlagen sind jedoch relativ schwer zu lukrieren.
Auf Ebene der Bundesländer sind in den letzten Jahren ebenfalls eine Reihe von Programmen und Initiativen gestartet worden wie etwa zahlreiche Cluster-Initiativen, die Ko-Finanzierungen zum Aus-bau der F&E-Infrastruktur oder die Etablierung spezifischer Innovationsfördermaßnahmen.
Die Beteiligung Österreichs an europäischen Forschungsprogrammen ist im Bereich Manufacturing als durchschnittlich einzustufen. Die Evaluierung der österreichischen Beteiligungen am 6. Rahmen-programm an den produktionsforschungsrelevanten Programmen NMP und IST-NMP zeigt eine nur geringfügig unterdurchschnittliche Beteiligung und Bewilligungsquote Österreichs.
20 Im Allgemeinen
kann hier von einer leicht unterdurchschnittlichen bis durchschnittlichen Performance im europäi-schen Vergleich gesprochen werden, auch was den Anteil der verschiedenen Akteure wie große Unternehmen, KMU und Universitäten betrifft. Eine Auswertung der bisherigen Beteiligung österrei-chischer Organisationen am 7. RP im NMP-Programm zeigt, dass sich die Performance auf durch-schnittlichem Niveau fortsetzt.
21 Die Studie von IHS und TU Wien, die eine Befragung von F&E-
betreibenden österreichischen Organisationen im Bereich Produktionsforschung durchgeführt hat, kommt hier zu einem kritischeren Befund und illustriert, dass nach Angaben der befragten F&E-Einrichtungen EU-Programme bisher kaum genutzt wurden.
22 Vor allem die höheren Erfolgsaussich-
20
PROVISO Programmbericht 6. Rahmenprogramm der EU (2002-2006). Thematische Priorität 3. Nanowissenschaften und -technologien, Werkstoffe
und neue Produktionsverfahren (NMP), PROVISO Ref.Nr.: PRnmp1272pro150207, April 2007, Wien.
21
PROVISO-Überblicksbericht. 7. EU-Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007–2013), November
2008, Wien.
22 Schnabl, A., Müllbacher, S., Dippenaar, S., Skrivanek, I., Weberberger, I., Fessl, K., Bleicher, F., Berger, D. (2009): MANUF UTURE JTI, BMVIT, Wien.
11
ten und die unbürokratischere Entwicklung werden in dieser Studie als Gründe angeführt, sich bei der Forschungsfinanzierung stärker national zu orientieren.
Im Allgemeinen werden in Österreich Themen und Fragestellungen der Produktionsforschung in Kooperation zwischen Industrie, Wissenschaft und Öffentliche Hand zwar auf breiter Basis, jedoch wenig strategisch und gezielt gefördert und aufgegriffen. Gleichzeitig gibt es erste, relativ junge Akti-vitäten und Initiativen („Manufuture AT“ und „Innovatives Metall“), die das Thema der Produktionsfor-schung und damit der technologischen Basis der Sachgüterproduktion explizit und systematisch adressieren und national und international weiterentwickeln wollen.
In diesem Zusammenhang kann ein Blick auf die europäische Ebene geworfen werden, die das Thema einer wettbewerbsfähigen Produktion (Manufacturing) wieder verstärkt betont, nachdem lan-ge Zeit Fragen der New Economy, wissensbasierten Wirtschaft und der Dienstleistungen die Agenda dominiert haben. Auf internationaler bzw. europäischer Ebene sind entsprechende strategische Netzwerke wie ETP Manufuture und (Förder-)Aktivitäten im FP 7 oder auch nationale Initiativen wie in Deutschland oder auch Finnland am Laufen. Die ETP Manufuture ist dabei das zentrale europäi-sche Netzwerk im Bereich Produktionsforschung und Produktionstechnologie.
Zudem gibt es auf europäischer Ebene zahlreiche Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung und Ener-gie (relevant für die „Smart Production“ Forschungsschwerpunkte Nachhaltige Werkstoffe und Res-sourceneffizienz) wie etwa die ETP SusChem, die ERA-NETs Bioenergy und SUSPRISE oder die Forest-based Sector Technology Platform, die ebenfalls produktionsrelevante Forschung betreiben.
23
Insgesamt zeigt sich damit, dass in Österreich keine spezifische (Dach-)Initiative zur systematischen Förderung und Dynamisierung der Produktionsforschung sowie der dazu notwendigen Schlüssel-technologien und Qualifikationen, bis hin zur Umsetzung in intelligenten Produktions- und Prozess-technologien existiert.
23 siehe den Anhang für einen Überblick über diesbezüglich relevante Programme und Initiativen.
12 Themenkonsolidierung Smart Production
Tabelle 1: Zusammenfassende Darstellung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risken zur industriellen Produktion und Produktionsforschung in Österreich
Stärken Schwächen
– Hohe F&E-Quote und allgemein guter Innova-tionsoutput
– Hohe Exportfähigkeit
– Fähigkeit, für Nischen existierende Technolo-gien anzupassen
– Bei der Diffusion von neuen Produktionstech-nologien im guten europäischen Mittelfeld
– Patentstatistiken zeigt keine großen Unter-schiede zu den starken Nationen Deutschland und der Schweiz Österreich im Bereich der Produktionstechnologien
– Allgemein sehr gut ausgebaute Förderland-schaft im Bereich F&E
– In vielen Bereichen existiert eine enge Interak-tion zwischen Produzenten und Anwender (Bsp. Papiermaschinen, Kunststoffmaschinen) und hohe Kundenorientierung, Unternehmen haben das erforderliche Anwendungswissen
– Systemwissen und Systemengineering
Enge Interaktion und Kooperation zwischen Unternehmen und gemeinnützigen For-schungseinrichtungen
– In vielen Bereichen und Branchen (noch) gut ausgebildetes Facharbeiter, Techniker und Akademiker
– Traditionell etablierte Industriekultur
– Diffusionsbarrieren für neue Produktionstech-nologien vor allem organisatorischer Natur
– Mangel an Qualifikation spezifisches Innovati-onshemmnis bei Maschinenbauunternehmen
– Geringere Anzahl großer Unternehmen, klein-betriebliche Struktur jedoch nicht so stark aus-geprägt wie in anderen Sektoren
– Flexibilität von kleineren Unternehmen im Fall ausländischer Eigentümer geringer
– Interdisziplinäre Zusammenarbeit an Universi-täten teilweise noch schwierig
– Für grundlagenorientierte F&E fehlen die kriti-schen Massen
– Österreichisches Lobbying für Themen auf EU-Ebene schwieriger (z.B. JTIs, Rahmenpro-gramme) als für große Länder
– Nur durchschnittliche Performance bei den re-levanten EU-Rahmenprogrammen zu Manu-facturing
Chancen Risken
– Automatisierung (Trend zu Kostenreduktion hält an)
– Umsetzungsgeschwindigkeit (time-to-market) durch adaptive, flexiblere Prozesse (Produkti-onsprozess, Logistik, Dienstleistungen)
– Stärkere Kombination von Produktentwicklung und Produktion
– Gesamtheitliche Betrachtung von Prozessket-ten und Abläufen (inner- und außerbetrieblich)
– Neben der Nischen-Spezialisierung auch auf Massenmärkte orientieren
– Bessere Abstimmung zwischen den F&E-Instituten
– Abwanderung von Produktion, damit wandert auch F&E längerfristig ab
– Abwanderung des Fachpersonals
– Produktpiraterie
– Auf neue radikale oder disruptive Technolo-gien wird zu langsam reagiert
Quelle: Eigene Darstellung
13
4 Die Rahmeninitiative – Fokus und Architektur
4.1 Gegenstand der Rahmeninitiative „Smart Production“
In Österreich wurden einzelne Bereiche der Produktionsforschung in der Vergangenheit durch ver-schiedene F&E Programme des BMVIT adressiert. Für sehr marktnahe Forschung wurden bei-spielsweise die FFG-Basisprogramme intensiv genutzt. Kompetenzaufbau erfolgte primär durch Strukturprogramme wie COMET. Thematische Schwerpunktsetzungen erfolgten u.a. in den Pro-grammen Fabrik der Zukunft, FIT-IT und Österreichische NANO-Initiative. Mit der Rahmeninitiative „Smart Production“ möchte das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie an exis-tierende Schwerpunktsetzungen anknüpfen und darauf aufbauen.
Basierend auf den Ergebnissen der Systemevaluierung 2009 und der Strategie 2020 des Rates für Forschung und Technologieentwicklung soll die Rahmeninitiative „Smart Production“ das gesamte Thema der Prozess- und Produktionstechnologien abdecken. Die Rahmeninitiative soll mit Fokus Produktionsforschung primär FTI-politische Maßnahmen im Bereich der Projektförderung sowie beim Aufbau von Forschungsnetzwerken und -infrastrukturen umfassen.
„Smart Production“ soll dabei F&E im Bereich der (1) Prozessentwicklung und (2) der Produktions- und Prozesstechnologien (Logistik/Technik/Maschine) entlang der gesamten Produktionskette unter-stützen.
Abbildung 1: Fokus Produktionsforschung
Produktions- und
Prozesstechnologien
Material
Komponenten Produktionsprozess Pro dukt Markt(B2B oder B2C)
Betriebsstätte
Produktionskette
(Produkt- mit) Prozessentwicklung
Darüber hinaus sollen Maßnahmen zur Qualifizierung, internationalen Anbindung, Demonstration und Marktüberleitung mitberücksichtigt werden.
Zielgruppen der Rahmeninitiative „Smart Production“ sind:
1. Die österreichische Sachgüterproduktion, d.h. Ausrüster und Anwender (Abschnitt C „Herstel-lung von Waren“; ÖNACE 2008)
2. Universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
3. Kommerzielle F&E Dienstleister, Ingenieurbüros
14 Themenkonsolidierung Smart Production
4.2 Smart Production – Vision 2020
Die Rahmeninitiative Smart Produktion soll insgesamt darauf abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Sachgüterproduktion im globalen Umfeld zu stärken und Forschungskompetenz im Bereich der Produktionsforschung aufzubauen. Darüber hinaus soll die Rahmeninitiative einen Bei-trag zur Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenprob-lematik leisten.
Übergeordnetes Ziel der Rahmeninitiative „Smart Production“ ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der österreichischen Sachgüterproduktion zu stärken und darüber hinaus die For-schungskompetenz im Bereich der Produktionsforschung auszubauen, sowie gegenüber dem inter-nationalen Markt zu stärken. Mit Hilfe der Rahmeninitiative sollen gezielte und systematische Aktivi-täten gesetzt werden und eine gemeinsame strategische Ausrichtung der aktuellen Produktionsfor-schung geschaffen werden, wobei Industrie und Forschung eng zusammenarbeiten.
Der österreichischen Produktionsforschung in Unternehmen und F&E Einrichtungen muss es dabei verstärkt gelingen, ursprünglich grundlagenorientierte Ergebnisse aus unterschiedlichen, miteinander konvergierenden Forschungsgebieten für den Bedarf der industriellen Produktion aufzugreifen. Be-sonders wichtig sind ihre Ergebnisse im Maschinen- und Anlagenbau, sowie im Bereich Prozess-, Präzisions- und Steuerungstechnik. Zukünftige Chancen werden daher insbesondere in integrierten und intelligenten Produktionsprozessen und -technologien gesehen.
Vor diesem Hintergrund lässt sich folgende Vision 2020 für eine langfristig wettbewerbsfähige und wachstumsorientierte österreichische Sachgüterproduktion ableiten:
Die österreichische Sachgüterproduktion (produzierendes Gewerbe und Industrie) hat im globalen Vergleich einer der höchsten Durchdringungsraten an modernsten und leistungsfähigsten Fertigungstechnologien.
Sie produziert mit Hilfe energie- und ressourceneffizienter sowie flexibler Produktions- und Prozesstechnologien erstklassige, individualisierte Produkte - und begleitende Dienstleistungen - mit einem hochgradigen Kundennutzen und höchster Qualität, sowohl für den privaten wie kommerziellen Kunden.
Die Produktivität des Sektors Sachgüterproduktion sowie dessen Innovationsgrad zählen zur Weltspitze, der Anteil erneuerbarer, sauberer Rohstoffe und Werkstoffe für die industrielle Produktion ist europaweit am Höchsten.
Die CO2 Emissionen der Sachgüterproduktion sind gegenüber 2010 signifikant niedriger.
Der Anteil an der nationalen Wertschöpfung ist mit rd. 20 % über die letzten 15 Jahre zumindest konstant geblieben. Die Anzahl der Beschäftigten in der Sachgütererzeugung (Abschnitt C, ÖNACE 2008) ist mit rd. 640 Tsd. zumindest auf dem Niveau von 2007.
Die Exportquote der Sachgütererzeugung, gemessen am Umsatz, beträgt zumindest knapp 60 %, jene der „Leit-branche“ Maschinen- und Anlagenbau zumindest 75 %.
Dem Sektor Produktions- und Prozesstechnologien ist es gelungen, sowohl Stärken auszubauen (z.B. Werkzeug-maschinen, Werkzeuge, Materialien, „klassische“ Fertigungsverfahren) als auch Kompetenzen in Schlüsselberei-chen der Zukunft (z.B. „Neue Werkstoffe“, Miniaturisierung, Sensorik/Aktorik, Systemische Prozesse und Automati-on, Virtualisierung, Dienstleistungen) auszubauen und damit Marktchancen international zu nutzen.
Der österreichischen Produktionsforschung in Unternehmen und insbesondere F&E Einrichtungen gelingt es gezielt, neue Grundlagenergebnisse zu schaffen, die von den Unternehmen rasch für Anwendungen und Problemlösungen aufgegriffen werden können. Dabei gibt es sichtbare Zentren der Produktionsforschung in Österreich, die internatio-nal vernetzt, anerkannt und von Seiten der Wirtschaft hochgradig nachgefragt sind.
15
4.3 Architektur der Rahmeninitiative „Smart Production“
Um eine mittel- bis langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung im Sinn der „Vision 2020 Smart Production“ zu sichern, sollen österreichische Produktionsbetriebe zwei strategische Stoßrich-tungen verfolgen:
Effizienzstrategie: Die Effizienzstrategie ermöglicht die Reduktion der relativen Produktionskosten (geringere Stückkosten), durch den effizienten Einsatz sämtlicher Ressourcen (Arbeitsaufwand / Rohstoffeinsatz / Energieverbrauch / Kapitalaufwand). Im Vordergrund stehen verbesserte Betriebs-mittel zur Steigerung der Effizienz und damit Produktivität.
Front Running Strategie: Die Front Running Strategie ermöglicht die Entwicklung innovativer Pro-dukte und Dienstleistungen mit hohem Wertschöpfungspotenzial.
Idealerweise gilt es, beide Strategien parallel und ausgewogen in einem Unternehmen zu verfolgen.
„Smart Production“ soll F&E im Bereich der Prozessentwicklung sowie der Produktions- und Pro-zesstechnologien (Logistik/Technik/Maschine) entlang der gesamten Produktionskette fördern (sie-he Abbildungen oben und unten) und dabei die Unternehmen bei der Verfolgung der beiden genann-ten Wettbewerbsstrategien unterstützen.
Thematischer Fokus der Smart Production liegt daher einerseits im gezielten Aufbau der Prozess-kompetenz zur Entwicklung von „Smart Processes“ (Effizienzstrategie), andererseits im Ausbau von zukunftsfähigem Produktions-Know-How für die industrielle Herstellung und Verarbeitung von „Smart Materials & Components“ (Front Running Strategie). Bei F&E Fragestellungen spielen oftmals beide Aspekte eine zentrale Rolle.
Zusätzlich sollen zwei übergreifende Forschungsschwerpunkte der Produktionsforschung (Virtuelle Methoden zur Prozess- und Produktentwicklung, Gesamtheitliche Betrachtung der Wertschöpfungs-kette) aufgegriffen werden.
Die Abbildung bildet die unterschiedlichen Schritte eines produzierenden Unternehmens ab und veranschaulicht die mit Smart Production angestrebten thematischen Forschungsschwerpunkte im Sinne einer Gesamtarchitektur:
16 Themenkonsolidierung Smart Production
Abbildung 2: Architektur der Rahmeninitiative „Smart Production“
Qualifizierung und Kapazitäten in Unternehmen und Wissenschaft
Ko
ope
ratio
nen
und
Pla
ttform
en
Inte
rna
tio
nale
An
bin
dun
g
Smart Production
Material
Komponenten Produktionsprozess Pro duktMarkt
(B2B oder B2C)
Betriebsstätte
Produktionskette
(Produkt- mit) Prozessentwicklung
Produktions- und
Prozesstechnologien
Smart Processes
Ressourcen-
effizienz
Leistungs-
orientierungFlexibilität
Miniatur-
isierte
Bauteile
Smart Materials & Components
Nachhaltige
WerkstoffeHigh – Tech
Werkstoffe
Qualifizierung und Kapazitäten in Unternehmen und Wissenschaft
Ko
ope
ratio
nen
und
Pla
ttform
en
Inte
rna
tio
nale
An
bin
dun
g
Smart Production
Material
Komponenten Produktionsprozess Pro duktMarkt
(B2B oder B2C)
Betriebsstätte
Produktionskette
(Produkt- mit) Prozessentwicklung
Produktions- und
Prozesstechnologien
Material
Komponenten Produktionsprozess Pro duktMarkt
(B2B oder B2C)
Betriebsstätte
Produktionskette
(Produkt- mit) Prozessentwicklung
Produktions- und
Prozesstechnologien
Smart Processes
Ressourcen-
effizienz
Leistungs-
orientierungFlexibilität
Smart Processes
Ressourcen-
effizienz
Leistungs-
orientierungFlexibilität
Miniatur-
isierte
Bauteile
Smart Materials & Components
Nachhaltige
WerkstoffeHigh – Tech
Werkstoffe
Miniatur-
isierte
Bauteile
Smart Materials & Components
Nachhaltige
WerkstoffeHigh – Tech
Werkstoffe
Prozessentwicklung und Entwicklung von Produktions- und Prozesstechnologien für „Smart Proces-ses“ und „Smart Materials & Components“ und deren Verbreitung in der Sachgüterproduktion erfor-dert ihrerseits jedenfalls den Auf- und Ausbau entsprechender struktureller Voraussetzungen und Forschungs-Kapazitäten in Österreich: Das Fundament des „Hauses Smart Production“ ist die Quali-fizierung in Unternehmen und Wissenschaft. Diese gilt es als notwendige Basis für alle Produktions-aktivitäten zu stärken und auszubauen.
Die „Wände des Hauses“ sind einerseits die internationale Anbindung der Forschung, Wirtschaft und Politik als Grundbedingung einer erfolgreichen Behauptung im internationalen Wettbewerb und For-schungskonzert. Andererseits kann eine erfolgreiche internationale Behauptung nur über Kooperati-onen und den Aufbau von Plattformen im Bereich der Produktionsforschung und -kompetenz erfol-gen. Dies gilt sowohl national wie auch international und ermöglicht erst den Aufbau erforderlicher kritischer Größen.
4.4 Smart Processes - Forschungsschwerpunkte
Die Unterstützung der Effizienzstrategie erfordert den Auf- und Ausbau von Prozess-Know-How für Smart Processes, und zwar in drei Forschungsschwerpunkten:
Smart Processes
H ö Ressourcen - effizienz
H ö chste Leistungs - orientierung
H ö Flexibilit ä t
Smart Processes
Ressourcen
effizienz Leistungs - orientierung
Flexibilität
17
4.4.1 Ressourceneffizienz
Unter „Ressourceneffizienz“ sind nicht Sekundäreffekte durch erhöhte Leistung und Robustheit oder gesteigerte Flexibilität bei Produktionsprozessen zu verstehen, die auch auf eine verbesserte Res-sourceneffizienz durchschlagen. Unter „Ressourceneffizienz sind vielmehr gezielte und radikale An-sätze zu verstehen, die langfristig emissionsfreie Produktionsprozesse ermöglichen (Stichwort: Kreislaufwirtschaft, Zero Emission, Cradle to Cradle). Im Fokus stehen demnach weniger einzelne Produktionsprozesse, sondern ganzheitliche Ansätze, die Gesamtprozesse und überbetriebliche Optimierungen ermöglichen.
4.4.2 Leistungsorientierung
Unter Leistungsorientierung“ sind robuste (wenig Standzeiten und Betriebsstörungen), höchst präzi-se arbeitende und qualitätssichernde Produktionsprozesse und -technologien zu verstehen. Auch hier sollen über herkömmliche Herstellprozesse hinausgehende Prozessinnovationen, etwa im Be-reich der Steuerung, Prozessintegration und Regelung, aufgegriffen und weiterentwickelt werden.
4.4.3 Flexibilität
Im Vordergrund stehen Prozessinnovationen zur Flexibilisierung der Produktion, sowohl im Unter-nehmen selbst als auch in Zusammenhang mit flexiblen Produktionsnetzen, Damit soll es möglich werden, zusehends individualisierte Produkte in industriellem Maßstab bei möglichst kurzer „time to market“ und variablen Lösgrößen herzustellen. Selbst lernende und skalierbare Steuerung von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen sowie rasche Umrüstbarkeit der Produktionstechnologien ist dabei auch ein zentrales Thema.
4.5 Smart Materials & Components - Forschungsschwerpunkte
Die gezielte Verfolgung einer Front Running Strategie erfordert es, die Produktionskompetenzen zur Herstellung und Verarbeitung von Smart Materials & Components in drei Forschungsschwerpunkten auszubauen:
4.5.1 Nachhaltige Werkstoffe
Diese Kompetenz ermöglicht die industrielle Nutzung leicht verfügbarer, emissionsarmer und erneu-erbarer Rohstoffbasen. Der Know-How Aufbau betrifft beispielsweise die Entwicklung von Schlüssel-technologien zur Aufbereitung und Behandlung neuer, nachwachsender Rohstoffe, Technologien und Methoden zum Beherrschen bzw. Reduzieren der Rohstoffvariabilität in der Prozesskette, die Definition von Verdichtungsstellen, qualitätserhaltende Lagerbedingungen und Qualitätskennzahlen.
Logistik, Stoffflussmanagement und Interdisziplinarität sind ebenfalls wesentliche Erfolgsfaktoren, denn nachwachsende Rohstoffe sollen im Sinne einer kaskadischen Wertschöpfungskette zu hoch-wertigen Industrierohstoffen verarbeitet (Grundstoffe Chemieindustrie, Wirkstoffe für Pharmaindust-
Mikro - / Nano - Bauteile
Smart Materials & Components
High - Tech Werkstoffe
Nachhaltige High - Tech Werkstoffe
Nachhaltige Werkstoffe
Miniaturisierte
Bauteile
18 Themenkonsolidierung Smart Production
rie, Werksstoffe und Materialien) oder auch in zu Anwendungen (Intelligente Fasern/Textilien, Bio-kunststoffen, Baustoffen, Verbundstoffen) weiterverarbeitet und Reststoffe einer Verwertung (ener-getisch) zugeführt werden.
Neben der Nutzung nachwachsender Rohstoffe ist auch die Substitution schlecht verfügbarer oder umwelt- bzw. gesundheitsbeeinträchtigender Rohstoffe von strategischem Interesse.
4.5.2 High Tech Werkstoffe
Diese Kompetenz ermöglicht die Produktion neuer fortgeschrittener und intelligenter Materialien und Werkstoffe bis hin zu entsprechenden Bauteilen. Solche High-Tech Werkstoffe zeichnen sich ihrer-seits durch komplexe Eigenschaftsprofile mit High-Performance Anwendungseigenschaften (z.B. Härte und Festigkeit, Korosion, Zähigkeit, Oxidation, Absorption, Reibung) sowie Fertigungseigen-schaften (z.B. Umformbarkeit und Knetbarkeit) aus und/oder integrieren funktionale Eigenschaften z.B. durch funktionale Beschichtungen oder auch durch bioinspirierte Konstruktion (Bionik).
Solche Werkstoffe sind (i) Verbundwerkstoffe, (ii) Werkstoffverbünde, (iii) keramische, polymerische und metallische Werkstoffe mit multifunktionalen Eigenschaften auf Mikro-/Nanobene, sowie (iv) funktionale und gezielte Beschichtungen und Oberflächenstrukturierungen.
4.5.3 Miniaturisierte Bauteile
Diese Kompetenz ermöglicht die Produktion miniaturisierter Strukturbauteile (z.B. mechanische Komponenten) und funktionaler Bauteile (z.B. elektronische und mechatronische Bauteile).
Bei letzteren stehen die Methoden des Micro- und Nanomanufacturing im Fokus. Die Konvergenz und Integration unterschiedlicher Technologien (IKT bzw. Nanoelektronik und Photonik, Biotechnolo-gie, Mikrosystemtechnik, Kognitionstechnologien) auf Mikro- und Nanobasis spielen eine wesentliche Rolle, auch um diesen funktionalen Bauteilen neue Eigenschaften und neue Funktionalitäten zu ver-leihen.
Miniaturisierte Bauteile werden ihrerseits in Anwendungen, das heißt in industrielle Technologien (z.B. Umwelttechnologien und Flexible Produktionstechnologien, Roboter) und Endprodukte (z.B. Fahrzeuge, Gebäudekomponenten, Infrastrukturtechnologien, Gebrauchsgüter) eingebaut.
4.6 Übergreifende Forschungsschwerpunkte
Neben den Produktionskompetenzen „Smart Materials & Components “ und dem Prozess-Know-How „Smart Processes“ werden folgende übergreifende Forschungsschwerpunkte als wesentlich für den Bereich der Produktionsforschung erachtet (siehe analog auch Kapitel 5.7)
Virtuelle Methoden/Werkzeuge für integrierte Prozess- mit Produktentwicklung
Virtuelle Technologien sichern die Prozessplanung, unabhängig von der Losgröße. Außerdem sind sie geeignet, Prozesse zu optimieren und die Produktionsauslastung zu modellieren. Dabei wird es zusehends notwendig, durchgängige Simulations- und Modellierungswerkzeuge zur gesamtheitli-chen Planung von Prozessen und Prozessketten zur Verfügung zu stellen. Mit einer Einbeziehung der Fertigungshistorie sowie der Mess- und Prüfprozesse werden Voraussetzungen geschaffen, Produktionsabläufe realitätsnah zu planen. Diese Forschungsfragen gehen Hand in Hand mit dem
19
Rechnereinsatz in der Produktentstehung und der zunehmenden Substitution materieller Objekte durch digitale Modelle.
Strategische Produktentwicklung – Gesamtheitliche Betrachtung der Wertschöpfungskette
Bei der „Strategischen Produktentwicklung“ geht es einerseits um die systematische Ökologisierung von Produkten. In diesem Zusammenhang sind etwa Forschungsaktivitäten zur Entwicklung und Umsetzung von Produkt-Dienstleistungssystemen, Lebenszyklusbetrachtungen und Ecodesign zu sehen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der strategischen Produktentwicklung liegt andererseits beim gezielten Know-How-Aufbau im Bereich Imitationsresistenz, um Produktpiraterie zu vermeiden bzw. zu verzö-gern (siehe auch ein Forschungsthema zu „Leistungsorientierung“).
„Strategische Produktentwicklung“ ist dabei immer in engem Zusammenhang mit der Herstellung dieser Produkte aufzufassen bzw. durchzuführen.
5 Die Forschungsschwerpunkte im Detail: Definition, Zielsetzung und mögliche Forschungsthemen
5.1 Forschungsschwerpunkt „Ressourceneffizienz“
Der sorgsame Umgang mit natürlichen Ressourcen wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor in der Produktion. Geringere Verfügbarkeit und steigende Rohstoffpreise verlangen eine signifikante Stei-gerung der Ressourceneffizienz.
„Ressourceneffiziente Smart Processes“
Definition: Ressourceneffiziente Prozesse arbeiten im Idealfall emissionsfrei und mit minimalem Energie- und Materialverbrauch, wobei das Material in geschlossenen Kreisläufen geführt wird (qualitätserhaltendes Recycling)
Zielsetzung: Prozessentwicklungen in Richtung „Zero Waste & Zero Emission“, Prozessadaptie-rung für geschlossene Kreislaufwirtschaft
Im Projekt erhobene mögliche Forschungsthemen sind:
– Gesamtheitliche Modelle und Ansätze zur Ressourcenoptimierung in betrieblichen und gewerb-lichen Prozessen (Integriertes Stoffstrom-Management, Refeeding der Energie-, Wasser- und Materialflüsse)
– Neue „Zero Waste & Zero Emission“ Ansätze und Konzepte
– Ressourcenoptimierung durch Optimierung von Werkzeugen und Fertigungsverfahren um weni-ger / keinen Ausschuss und Abfall zu erhalten
– Ressourcenoptimierung durch neue Technologien zur Prozess-Steuerung und Qualitätssiche-rung (Konnex zu „Leistungsorientierung“)
– Ressourcenoptimierung durch Fehlerfrüherkennung / Qualitätskontrollierte Intermediärprodukte - „Schrott nicht veredeln“ (Konnex zu „Leistungsorientierung“)
20 Themenkonsolidierung Smart Production
– Gesamtmodellierung der ressourcenintensivsten Prozesse zur Erkennung von Optimierungspo-tenzialen
– Entwicklung alternativer unkonventioneller Prozessverfahren (z.B. wasserfreie Papierherstel-lung, kalte Metallverarbeitung)
– Integrated Maintenance (Lebenszyklusbetrachtung nicht nur für Produkt, sondern für gesamte Produktionskette, also auch Instandhaltung von Maschinen, Gebäuden etc.)
– Verbundstandorte zur Realisierung sektoraler Lösungen der überbetrieblichen Verwertung
– Ressourcenoptimierung entlang der Wertschöpfungskette - Supply Chain Management
– Sekundärressourcen-orientiertes Produzieren (Technologie-Entwicklung um Upcycling zu er-möglichen – Nutzung von Sekundärenergie und Sekundärrohstoffen, z.B. Upcycling von Se-kundärfasern, neue Deinkingtechnologien)
– Qualitätserhaltende Recyclingstrategien / Hochwertiges Recycling mit Qualitätserhalt
– Transparenz der Werkstoffparameter in der Zulieferkette um Rückführbarkeit und Wiederver-wendung von Ressourcen zu ermöglichen
– Bereitstellung des Rohstoffs (Sammellogistik, Trennverfahren, verbesserte Aufreinigung, Quali-tätskennzahlen)
– Prozessintegration – Adaptive Prozessführung um Qualitätsvariabilitäten zu minimieren (Farb-erkennung bei Altglaseinsatz)
– Anpassung von Maschinen und Anlagen zur Verarbeitung von Sekundärrohstoffen
– Urban Mining (Nutzung von in der Stadt gebundenen Ressourcen, z.B. in Gebäuden)
5.2 Forschungsschwerpunkt „Leistungsorientierung“
Robuste (wenig Standzeiten und Betriebsstörungen), höchst präzise arbeitende und qualitätssi-chernde Produktionsprozesse und -technologien sind die Voraussetzung für Effizienz, Produktivität und Qualität und damit neben innovativen Produkten ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbs-fähigkeit des produzierenden Unternehmens wie auch für die Attraktivität des Produktionsstandortes als solches. Kostendruck unter Qualitätsrestriktionen, nicht zuletzt im internationalen Wettbewerb, erfordern jedenfalls leistungsorientierte Produktionsprozesse und -technologien. Damit können Qua-litätsvorteile mit Produktivitätsvorteilen (Kosten und Effizienz), nicht zuletzt auch im Bereich der ein-gesetzten Ressourcen (Energie und Materialien) realisiert werden. Insbesondere im Bereich der Steuerung, Qualitätssicherung, Prozessintegration und Regelung liegt erhebliches Potenzial für Ver-besserungen.
Ein entscheidender Beitrag zur Produktivitätssteigerung ist seinerseits die Voraussetzung für Wert-schöpfung und Beschäftigungssicherung im österreichischen Produktionssektor.
„Leistungsorientierte Smart Processes“
Definition: Robuste, höchst präzise arbeitende und qualitätssichernde Produktionsprozesse und -technologien mit hoher Maschinendynamik
Zielsetzung: minimale bzw. geplante Standzeiten, Ausschussminimierung durch Präzision
21
Im Projekt erhobene mögliche Forschungsthemen sind:
– Verbesserung der Schnittstellen und des Datenaustausches, -managements zwischen Konstruktionsdaten, Qualitätsdaten, Prozessdaten und Fertigungstechnologie - Systemintegra-tion
– Integrierte Qualitätssysteme entlang des Produktionsprozesses – Echtzeit Prozessoptimierung:
Maschinendiagnosesysteme: Integration "intelligenter Komponenten" (Sensoren, Aktoren, Diagnose/Messkomponenten, RFID, etc.) in industrielle Maschinen/Anlagen für die Rück-koppelung des aktuellen Maschinen/Prozesszustandes ins "System" (z.B. für bedarfsori-entierte Steuerung, Wartung) Stichwort: „Embedded systems“
Integration adaptronischer Sensor- und Aktorsysteme im Produktionsprozess (Messen, Regeln, Steuern)
Modellbasierte Diagnosesysteme (z.B. statistische Prozesskontrolle) Ad hoc Korrekturmaßnahmen (z.B. durch automatische Nachjustierung von Maschine und
Werkzeug) Integrierte Qualitätskontrolle für KMU Produktionsprozesse Qualität und Messung - Welche Qualität erfordert welche Messung (Methode und Um-
fang)?
– Minimierung Qualitätsvariabilitäten (z.B. variable Rohstoffqualitäten) durch Prozess-Flexibilisierung
– Verlängerung und Optimierung von Wartungsintervallen z.B. durch antizipative Maintenance
– Kombinierte Fertigungsprozesse mit integrierter Qualitätskontrolle: z.B. Integration Zerspanung, (flexibles) Fügen/Montage, Härtung, Entgratung und Reinigung
– Automation bei Prozessplanung und Maschinenprogrammierung
– Fertigungsprozesse zur Erhöhung der Imitationsresistenz von Produkten und Bauteilen (z.B. durch fertigungsbedingte Produkteigenschaften und tief integrierte Fertigungsprozesse)
– Dezentrale, bedarfsorientierte Logistik und Disposition intern basierend auf Sensoren, Aktoren, RFID Chips etc.: Integration von Energie-, Material-, Informationsfluss und Fertigung
5.3 Forschungsschwerpunkt „Flexibilität“
Märkte werden zunehmend dynamischer und unkalkulierbarer. Kürzer werdende Produktlebenszyk-len, eine steigende Variantenvielfalt bei geringeren Losgrößen, sich ständig ändernde Kundennach-fragen in einem internationalen Umfeld sowie Änderungen in der demografischen Struktur der Kun-den (Alterung) haben direkte Auswirkungen nicht nur auf die Produkte und ihre Gestaltung, sondern auch auf die im Unternehmen einzusetzenden Fertigungsverfahren und die dazu notwendigen Pro-duktionsmittel – und nicht zuletzt auf die im Unternehmen arbeitenden Menschen. Wenn die Produk-tionslebenszyklen kürzer werden, müssen Produktionssysteme schnell umrüstbar und anpassbar sein: Flexibilität bis hin zu Wandlungsfähigkeit der Produktionssysteme und damit „Flexible Smart Processes“ sind gefordert.
„Flexible Smart Processes“
Definition: Produktionstechnologien und -prozesse (inkl. Logistik) sowie Betriebsplanungen die eine rasche Reaktion auf steigende Anforderung der Kunden nach Produkt-Individualisierung, kurzen Lieferzeiten, flexiblen Lieferbedingungen, hoher Mengen-flexibilität und Liefertreue ermöglichen.
22 Themenkonsolidierung Smart Production
Zielsetzung: Hohe, dynamische Flexibilität bei Losgrößen und Produktvarianten bei möglichst kurzer Umrüstzeit.
Im Projekt erhobene mögliche Forschungsthemen sind:
– Modularisierung von Maschinen und Anlagen:
Modulare Nutzung von Handling- und Montagestationen Einfache Maschinen für hohe Arbeitsteilung und schnelle Rekonfiguration der Prozessket-
ten Mehrtechnologie Werkzeugmaschinen (Komplettbearbeitung) Datenmanagement von Maschinen- und Prozessdaten für die Flexibilisie-
rung/Modularisierung von Maschinen und Anlagen
– Standards für (i) technologische und steuerungstechnische Maschinen-Schnittstellen, (ii) modu-lare Integration und Software, (iii) Produkt- und Steuerungsdaten sowie (iv) Maschinenan-schluss
– Reduktion der Rüstzeiten und einfachere Handhabung in der Umrüstung z.B. durch rekonfigurierbare Produktionssysteme, Steuerungssysteme und Software für adaptive Ferti-gung, sowie flexible Träger-, Handhabungs- und Aufspannsysteme
"Plug and Produce" Ansätze für einfache Nachrüstbarkeit
– Flexible Automation für Fertigung, Handhabung und Montage von Bauteilen (Robotik und com-putergesteuerte Maschinen); mit Artificial Intelligence (AI) arbeitende adaptive Produktionssys-teme
– Flexible Maschinenperipherien, Verkettungen, Greifer-/Handhabungssysteme und Vorrichtun-gen
– Flexible und bedarfsorientierte Logistiksysteme (Fahrzeuge, Regale, Unstetigförderer)
– IKT, Logistik und Montage für flexible, regionale Produktionsnetze
Dezentrale, bedarfsorientierte und flexible (Logistik-)Steuerung in KMU Produktionsver-bünden
– Fabriksplanung unter dem Gesichtspunkt der Flexiblilität und Wandlungsfähigkeit (intern und im Netzwerk)
5.4 Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Werkstoffe“
Die Substitution konventioneller Rohstoffe der industriellen Produktion, insbesondere fossiler Roh-stoffe (z.B. „Öl ersetzen“) wird als wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Entwicklung gesehen, da es hinsichtlich Globalisierung, Kostendruck, Ressourcen- und Umweltprob-lematik eine gewisse Entkopplung ermöglicht. Bei einer zukunftsorientierten, vorausschauenden Smart Production erlangt die industrielle Nutzung alternativer Rohstoffe zunehmende Bedeutung.
„Nachhaltige Werkstoffe“
Definition: Substitution konventioneller Rohstoffe durch eine industrielle Nutzung alternativer, nachhaltiger Rohstoffe
Zielsetzung: Ersatz fossiler, schädlicher und / oder schlecht verfügbarer Rohstoffe; möglichst umfassende kaskadische Nutzung nachwachsender Rohstoffe zur Gewinnung hochwertiger Industrierohstoffe und -werkstoffe
23
Im Projekt erhobene mögliche Forschungsthemen sind:
– Logistik zur Bereitstellung des Rohstoffs und Definition von Verdichtungsstellen
– Definition von Qualitätsparametern, qualitätserhaltenden Lagerbedingungen und Prüfmethoden
– Aufbereitung, Behandlung und Verarbeitung der Rohstoffe zu Werk- / Wirkstoffen
Entwicklung hoch effizienter Fermentationsprozesse
Biokatalyseforschung: Neue und verbesserte Enzyme und Prozesse
Entwicklung von Schlüsseltechnologien wie Aufschluss-, Trenntechnologien
Verfahren zur Steigerung der Rohstoffeffizienz in der Umwandlung
– Adaptierung der Verarbeitungsprozesse, insbesondere der Steuerungsmöglichkeiten um mit wechselnden Rohstoffqualitäten des Materials umzugehen (Einsatz von Sensoren zur Quali-tätsprüfung)
– Entwicklung von multifunktionalen Werkstoffen und hochwertigen Spezialprodukten, z.B.:
PLA (Polymilchsäure)
Zellulose als vielseitiges Polymer für neue funktionalisierte Werkstoffe
neue holzbasierte Verbundmaterialien (WPC)
Werkstoffe mit neuen Oberflächeneigenschaften
Recyclefähiges bzw. biologisch abbaubares Packaging Material aus nachwachsenden
Ressourcen
Organic Electronics (Elektronik auf Basis von Polymeren, Plastik oder kleinen Molekülen,
kohlenstoffbasiert, Ersatz von anorganischem Material wie z.B. Kupfer, Silizium)
– Bioraffinerie - Konzepte zur kaskadischen Rohstoffnutzung
Kombinierte Bioraffinerie Konzepte zur Gewinnung hochwertiger Industrierohstoffe und
Energie
(Mobile) Bioraffinerien zur Nutzung nachwachsender Primärrohstoffe (z.B. Holzraffinerie-
Konzepte)
Variable Bioraffinerien, die unterschiedliche Rohstoffe verarbeiten können
Integrierte Bioraffinerien (z.B. in Zucker-, Zellstoff-, Lebensmittel-, Holzindustrie)
– Substitution schlecht verfügbarer, teurer Rohstoffe (z.B. Seltenerden) um Importabhängigkeit zu verringern, z.B. durch Entwicklung Energiespeichernder und -transformierender Polymerstoffe
– Substitution schädlicher Inhaltstoffe (z.B. Bisphenol A)
5.5 Forschungsschwerpunkt „High Tech Werkstoffe“
Die Produktion und Verarbeitung von so genannten „High-Tech Werkstoffen“ zu innovativen Bautei-len und Endprodukten, sei es in industriellen Anlagen, Fahrzeugen, Energietechnologien oder Ge-brauchs- und Konsumgütern eröffnet neue Möglichkeiten in Hinblick auf Funktion und Eigenschaft. Dem entsprechend sind große Marktpotenziale in diesem innovativen Produktbereich zu erwarten.
Dabei gilt es insbesondere, Erkenntnisse aus den Materialwissenschaften nicht nur weiterzuentwi-ckeln, sondern diese in die Produktionsforschung, das heißt in die kostengünstige und effiziente Herstellung und industrielle Verarbeitung solcher Werkstoffe zu transferieren bzw. mit Produktions- und Prozessfragen zu verknüpfen. High-Tech Werkstoffe zeichnen sich ihrerseits durch komplexe Eigenschaftsprofile mit High-Performance Anwendungseigenschaften (z.B. Härte und Festigkeit, Korosion, Zähigkeit, Oxidation, Absorption, Reibung) sowie Fertigungseigenschaften (z.B.
24 Themenkonsolidierung Smart Production
Umformbarkeit und Knetbarkeit) aus und/oder integrieren funktionale Eigenschaften z.B. durch funk-tionale Beschichtungen.
„High-Tech Werkstoffe“
Definition: Werkstoffe mit komplexen Eigenschaftsprofilen (Anwendungs- und Fertigungseigen-schaften) und/oder integrierten Funktionalitäten (Sensoren/Aktoren).
Solche Werkstoffe sind (i) Verbundwerkstoffe, (ii) Werkstoffverbünde, (iii) kerami-sche, polymerische und metallische Werkstoffe mit multifunktionalen Eigenschaften auf Mikro-/Nanobene, sowie (iv) funktionale und gezielte Beschichtungen und Ober-flächenstrukturierungen.
Zielsetzung: Herstellung und Verarbeitung solcher Werkstoffe zu innovativen Bautei-len/Komponenten mit hohem Kundennutzen.
Im Projekt erhobene mögliche Forschungsthemen sind:
– Funktionale und gezielte Beschichtung (z.B. Nanopulverbeschichten, Galvanisieren, Lackieren, Aufbringung von Sensoren) und Oberflächenstrukturierung (z.B. durch Laser-Strukturierungsverfahren, Additive Prozesse, Nano-Imprint-Lithographie)
– (Neue) Produkt- / Bauteileigenschaften aus dem Fertigungsprozess, ausgehend von High-Tech Werkstoffen (z.B. Mikrostrukturierungen, Druckspannungen, Härte, tribologische Funktionen, etc.)
– Industrielle Fertigung und/oder Verarbeitung von Verbundwerkstoffen (Faser/Partikel und Mat-rix) und Werkstoffverbünden
– Industrielle Fertigung und/oder Verarbeitung von keramischen, polymerischen und metallischen Hochleistungswerkstoffen mit komplexen Eigenschaftsprofilen auf Mikro- und Nanoebene
– Fertigungstechnologien für die Bearbeitung gezielt inhomogener Werkstoffe
– Konstruktions- und Prozessmodelle mit Materialdaten: Integration von High-Tech Werkstoffde-sign, Bauteilkonstruktion, Prozessmodell und Fertigungstechnik; ausgehend vom angestrebten Bauteilprofil
– Bionik – Konstruktion und Herstellung von bioinspirierten High-Tech Werkstoffen und Bauteilen
5.6 Forschungsschwerpunkt „Miniaturisierung von Bauteilen“
Die Miniaturisierung von Bauteilen folgt und erfüllt vielseitige Anforderungen an innovative und mo-derne Produkte der Gegenwart und Zukunft.
Im Bereich der Elektronik und damit IKT ermöglicht sie die Integration verschiedener und unter-schiedlicher Funktionen und Speicher- und Prozessorkapazitäten auf immer geringeren Raum, bei gleichzeitig zunehmender Dichte an Funktionalität und erhöhter Kapazität. Damit wird es möglich, elektronische Gebrauchsgüter sowie IKT basierte Systeme (z.B. embedded systems, Sensor-, Aktorsysteme) kleiner und in Systemzusammenhänge leichter integrierbar zu machen. Produkte werden handlicher und zusehends intelligenter, aber auch komplexer. Weiters hat die Miniaturisie-rung von Elektronikbauteilen nicht nur eine funktionale Seite, sondern auch eine unmittelbar produk-tivitätsrelevante Seite. Die Miniaturisierung erhöht die Effizienz der Fertigung durch Erhöhung der gefertigten Einheiten je Fertigungsschritt und damit die Produktivität. Fertigungsverfahren für die Miniaturisierung von Elektronikbauteilen, zusehends im Bereich der Photonik, aber auch für Hand-habung/Montage, spielen dabei eine zentrale Rolle.
25
Auch im Bereich der mechanischen Strukturbauteile hat die Miniaturisierung einen wichtigen Stel-lenwert. Treiber sind hierbei insbesondere der Leichtbau (z.B. im Fahrzeugbau) zur Einsparung von Energie bzw. vor dem Hintergrund von Materialknappheit bzw. -kosten. Hier gilt es insbesondere, bisherige Funktionalitäten und Eigenschaften von mechanischen Strukturbauteilen auch bei geringe-rer Größe zu gewährleisten oder sogar zu verbessern. Neben Fragen der einzusetzenden Werkzeu-ge und Fertigungsverfahren spielen dabei auch der Einsatz neuer/alternativer Werkstoffe für mecha-nische, miniaturisierte Strukturbauteile und deren Verarbeitung in der Fertigung eine wichtige Rolle.
„Miniaturisierte Bauteile“
Definition: Miniaturisierung von Strukturbauteilen (z.B. mechanische Komponenten) und Funkti-onaler Bauteile (z.B. elektronische und mechatronische Bauteile) in der Produktion
Zielsetzung: Strukturbauteile: Gleiche/Verbesserte Eigenschaftsprofile auf geringerem Raum (z.B. Leichtbau und Miniaturisierung mechanischer Bauteile); Funktionale Bauteile: mehr Funktionen auf kleinerem Raum / mehr Funktionen auf demselben Raum / gleich vie-le Funktionen auf kleinerem Raum, (z.B. Leiterplatten, Chipbauteile, mechatronische Bauteile mit Sensor/ Aktoreigenschaften, elektro-(keramische) Bauteile).
Im Projekt erhobene mögliche Forschungsthemen sind:
– Fertigungsverfahren für die Miniaturisierung von Bauteilen (z.B. generative Verfahren wie z.B. 3D-Printing, Laser Sintern, Laser Lithographie)
– Sensorik und Aktorik in miniaturisierten Bauteilen (z.B. mithilfe von 3D-Integrationstechnologien)
– Montage und Handhabung miniaturisierter Bauteile
– Neue/Alternative Werkstoffe und deren Verarbeitung zu miniaturisierten, mechanischen Struk-turbauteilen (bei zumindest Gewährleistung der bisherigen Funktionalität)
5.7 Übergreifende Forschungsschwerpunkte
Neben Produktionskompetenzen für „Smart Materials & Components“ und Prozess-Know How für „Smart Processes“ sind auch folgende übergreifende Forschungsthemen wesentlicher Bestandteil einer „Smart Production“ (siehe analog Kapitel 4.6):
5.7.1 Virtuelle Methoden/Werkzeuge für integrierte Prozess- mit Produktentwicklung
Virtuelle Technologien sichern die Prozessplanung, unabhängig von der Losgröße. Außerdem sind sie geeignet, Prozesse zu optimieren und die Produktionsauslastung zu modellieren. Dabei wird es zusehends notwendig, durchgängige Simulations- und Modellierungswerkzeuge zur gesamtheitli-chen Planung von Prozessen und Prozessketten zur Verfügung zu stellen. Mit einer Einbeziehung der Fertigungshistorie sowie der Mess- und Prüfprozesse werden Voraussetzungen geschaffen, Produktionsabläufe realitätsnah zu planen. Diese Forschungsfragen gehen Hand in Hand mit dem Rechnereinsatz in der Produktentstehung und der zunehmenden Substitution materieller Objekte durch digitale Modelle.
5.7.2 Strategische Produktentwicklung – Gesamtheitliche Betrachtung der Wertschöp-fungskette
Bei der „Strategischen Produktentwicklung“ geht es einerseits um die systematische Ökologisierung von Produkten. In diesem Zusammenhang sind etwa Forschungsaktivitäten zur Entwicklung und
26 Themenkonsolidierung Smart Production
Umsetzung von Produkt-Dienstleistungssystemen, Lebenszyklusbetrachtungen und Ecodesign zu sehen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der strategischen Produktentwicklung liegt andererseits beim gezielten Know-How-Aufbau im Bereich Imitationsresistenz, um Produktpiraterie zu vermeiden bzw. zu verzö-gern (siehe auch ein Forschungsthema zu „Leistungsorientierung“).
„Strategische Produktentwicklung“ ist dabei immer in engem Zusammenhang mit der Herstellung dieser Produkte aufzufassen bzw. durchzuführen.
Im Projekt erhobene mögliche Forschungsthemen im Bereich der übergreifenden Forschungs-schwerpunkte sind:
Forschungsschwerpunkt Virtuelle Methoden/Werkzeuge:
– Handhabbare Methoden und Werkzeuge (Software und Hardware) zur virtuellen, integrativen und funktionalen Simulation und Modellierung. Fokus: Komplexe Produktionsdynamiken und Nischenanwendungen (KMU)
Forschungsschwerpunkt Strategische Produktentwicklung: – Ecodesigned Products – Betrachtung des gesamten Life Cycle der Prozesse und Produkte
(Zielvorgabe z.B. -50% Energie, -20% Ressourcen, Reparatur- und Recyclingoptionen)
– Neue Geschäftsmodelle (Produkt-Dienstleistungssysteme wie Chemical Leasing, Infrastructure Leasing – Ziel: Rohstoff-Rückführung)
– Produktbegleitende Dienstleistungen (Service, (Integrated) Maintenance, Repair)
– Faktor Mensch in der Produktion (Arbeitsplatzbelastung, -gestaltung, Arbeitssicherheit)
6 Förderprogramme der Produktionsforschung in Deutschland, Schweiz und Finnland: Instrumente und Förderquoten
Im Rahmen des Projektes wurden drei Auslandsexkursionen nach Deutschland, die Schweiz und nach Finnland unternommen. Ziel war es, über die einzelnen zentralen Programme und Aktivitäten im Bereich Produktionsforschung zu lernen und neben dem Prozess der Themenfindung und -priorisierung in den jeweiligen Ländern insbesondere über Projektformate und Förderquoten näheres zu erfahren.
6.1 Deutschland
Das zentrale Produktionsforschungsprogramm in Deutschland ist „Forschung für die Produktion von morgen (PROmorgen). Verantwortlich ist das BMBF. Abgewickelt und betreut wird es vom Projekt-träger Karlsruhe (PTKA).
Gestartet wurde das Programm Ende 1999. 2011 wird das Nachfolgeprogramm „Produktionsfor-schung 2020“ implementiert.
27
PROmorgen umfaßt vier Handlungsfelder, die 2007 in einer Überarbeitung des Rahmenkonzeptes24
wie folgt aufgelistet wurden
25:
1. Marktorientierung und strategische Produktplanung
2. Technologien und Produktionsausrüstungen
3. Neue Formen der Zusammenarbeit produzierender Unternehmen
4. Der Mensch und das wandlungsfähige Unternehmen
Innerhalb dieser vier Handlungsfelder wurden Themenfelder definiert innerhalb derer wiederum For-schungsthemen aufgelistet bzw. kurz beschrieben sind. Diese Auflistung dient als Orientierung für die spätere Auswahl an Themenfeldern bzw. Forschungsthemen für Ausschreibungen. Die Priorisie-rung für die Ausschreibungen erfolgt in einem vom Projektträger Karlsruhe koordinierten Diskursver-fahren innerhalb des Programmkomitees, das sich aus VertreterInnen aus Forschung, Industrie, Verbänden, BMBF und PTKA zusammensetzt.
Im Zeitraum von 10 Jahren (1999 bis 2009) wurden 28 Ausschreibungen abgewickelt, also rd. 3 Ausschreibungen pro Jahr. Dabei wurden 51 Themen unterschiedlicher Granularität und Detaillie-rung ausgeschrieben. Dabei wurden 633 Mio. an öffentlichen Förderungen, also im Durchschnitt rd. 63 Mio. € pro Jahr, ausgeschüttet. Pro Ausschreibung sind somit rd. 23 Mio. € an Fördermitteln ge-flossen.
Im Zentrum des Programms steht das Instrument der kooperativen Verbundprojekte. Diese Projekte sind von ihrer Ausrichtung generisch, kooperativ und vorwettbewerblich. Teilnehmer sind Unterneh-men (KMU (51 %) und GU (27 %)), Universitäten und Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (22 %). Der Projektleiter sollte dabei wenn möglich aus einem Unternehmen kommen.
Gefördert wurden in 10 Jahren 407 Verbundprojekte mit 2.648 Partnern. Das bedeutet, dass pro Verbund im Schnitt rd. 6 bis 7 Partner involviert waren. Das durchschnittliche Projektvolumen beläuft sich auf etwas mehr als 3 Mio. € (aber auch bis 5,5 Mio. €), wobei 50 % öffentlich gefördert werden (max. Förderquote). Dazu kommt ein KMU Bonus von 10 % der förderbaren Kosten je KMU. Je nach Förderbudget und Anzahl der zu erartenden Projekteinreichungen wird das Projektvolumen aber auch gedeckelt.
Die Projektanträge werden in einem zweistufigen Verfahren eingereicht. In einem ersten Schritt wird eine Projektskizze eingereicht. Diese wird bewertet. Bei einer positiven Bewertung erfolgt dann die Einladung für eine detaillierte Ausarbeitung im Rahmen eines förmlichen Förderantrages. Dieser wird vom PTKA einer nationalen Jury vorgelegt.
Die Projektlaufzeit der Verbundprojekte beträgt in der Regel 3 Jahre, im Bereich der Ressourceneffi-zienz etwa 4 Jahre. Für den Bereich der Ressourceneffizienz („Forschung für effizientere Produkti-onsmethoden“) wurden 59 Mio. € Förderbudget in 31 Verbundprojekten bereitgestellt. Das durch-schnittliche Gesamtprojektvolumen beträgt somit in diesem Bereich rd. 4 Mio. € bzw. 2 Mio. € För-derbudget.
24 BMBF (1999): Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von morgen. Bonn.
25
Kleiner, M. et. al (2007): Untersuchung zur Aktualisierung der Forschungsfelder für das Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von morgen“.
Dortmund
28 Themenkonsolidierung Smart Production
Forschungseinrichtungen werden bis zu 100 % gefördert, Unternehmen mit max. 35 % (plus 10 % bei KMU; dieser Bonus ist jedoch außerhalb der 50 % der Gesamtprojektförderquote).
Die Projektergebnisse bzw. -fortschritte werden im Rahmen eigener begleitender Workshops unter den Projektnehmern ausgetauscht (Koordinatorensitzung). Als Output der Projekte werden insbe-sondere Patente angestrebt. Der Projektbericht wird veröffentlicht. Dieser begleitende Austausch findet unter der Koordination der PTKA statt, die auch so genannte Industriearbeitskreise (ca. 40 aktiv) initiiert mit dem Ziel „Wissen aus Projekten nutzbar“ zu machen.
Zudem existiert neben den Verbundprojekten noch ein weiteres Projektformat, so genannte Innovati-ons- bzw. Transferplattformen, deren Ziel es ist z.B. Ergebnisse, auch an neue Zielgruppen, zu ver-mitteln, Vernetzung und Austausch herzustellen, praxisgerechte Leitfäden zu erstellen, und mit Hilfe bestehender Cluster und Netzwerke Transfer auf regionaler Ebene zu verstärken. Diese Koordinati-ons- und Transfermaßnahmen werden dabei auch parallel zu den einzelne Ausschreibungen bzw. Themenschwerpunkten etabliert und auch nach den Ausschreibungen weitergeführt. Im besten Fall handelt es sich um einen Anschubfinanzierung seitens der öffentlichen Hand und etwa ein Industrie-verband übernimmt das Netzwerk. Die Förderquoten für ein solches Transferprojekt sind 100% für Forschungseinrichtungen und 50% für Industrieverbände.
Im Rahmen von PROmorgen wurde zudem eine Programmlinie „KMU-innovativ: Produktionsfor-schung“ etabliert. Für diese Programmlinie gelten im Wesentlichen dieselben Förderquoten/-bedingungen wie oben. Im Zentrum der Förderung und des Ergebnisnutzens stehen jedoch explizit KMU. Zudem ist das Antragsverfahren vereinfacht, die Ausschreibungen erfolgen themenoffen, so-lange die Vorhaben dem Bereich der Produktionssysteme und -technologien zuordenbar und für die Positionierung des Unternehmens am Markt von Bedeutung sind. Die geförderte Projektdauer be-trägt in der Regel 2 Jahre.
6.2 Schweiz
In der Schweiz gibt es kein eigenes Produktionsforschungsprogramm. Produktionsrelevante Projekte können jedoch als KTI-Bottom up Projekte (keine Themenvorgabe) bei der Förderagentur für Innova-tion KTI beantragt werden. Die Projekte sind kooperativ, Unternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten zusammen im Projekt. Die Aufwendungen der Unternehmen im Projekt können dabei von der KTI verdoppelt werden, was einer Förderquote von 50% entspricht. Die Fördermittel kommen dabei ausschließlich den Forschungseinrichtungen zugute. Die Unternehmen profitieren somit von der „Gratis“ Dienstleistung der Forschungseinrichtungen. Dabei handelt es sich um Industrielle Ent-wicklungsprojekte wo das Unternehmen beantragt (gemeinsam mit der F&E Einrichtung) und auch Projektziele und Inhalte des Projektes vorgibt. Die F&E Einrichtungen treten als Dienstleister für das Unternehmen auf.
Ergänzend sind Eingangs-, bzw. Machbarkeitsstudien für KTI-Projekte mit bis zu 100.000 CHF, d.h. rd. 70.000 € pro Studie förderbar.
Weiters wurde in der Schweiz erstmals eine Programmkooperation zwischen KTI und SNF (Schwei-zer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) vereinbart, die eine Förderung von Forschungsvorhaben entlang des Innovationszyklus, von der Grundlagenforschung bis hin zur industriellen Überführung befördern soll. Pilotvorhaben in diesem Sinne ist das Nationale For-schungsprogramm „Intelligente Materialien“. Die SNF-Finanzierung erstreckt sich dabei über zwei Phasen; in einer ersten Phase (drei Jahre) werden Projekte unterstützt, die auf Grund ihrer hohen wissenschaftlichen Qualität ausgewählt worden sind. In der zweiten Phase, die höchstens zwei Jah-re dauert, werden nur noch diejenigen Projekte weiter gefördert, die über ein hohes Potenzial für praktische Anwendung verfügen und gute Chancen haben, in ein durch die KTI finanziertes Koope-rationsprojekt mit der Industrie übergeführt zu werden. In der dritten Phase werden die verbleiben-
29
den anwendungsorientierten Projekte nach den Regeln der KTI weitergeführt und durch die KTI und entsprechende Industriepartner finanziert.
Weiters existiert in der Schweiz auf organisatorischer Ebene ein von Forschung und Industrie orga-nisierte Plattform „ManuFuture-CH“, die sich als unterstützendes Netzwerk für den Produktionsplatz Schweiz definiert. Aufgaben von ManuFuture-CH entlang der Wertschöpfungskette sind dabei:
1. Informationen über neue Trends & Technologien
2. Suche und Vermittlung von F&E Projektpartnern
3. Unterstützung bei Beantragung von F&E Fördermitteln
4. Unterstützung bei der Vermarktung
Dabei werden folgende „Formate“ für Mitglieder angeboten:
– Informations- und Networking-Events zu Themen aus dem Fertigungsbereich
– Newsletter und Publikationen zu neunen Trends und Technologien
– Beratungen und Schulungen „erfolgreich öffentliche Fördergelder für F&E beantragen“
– Partnervorschläge für F&E Projekte
– Unterstützung beim Antragsschreiben für F&E Fördermittel
– Gemeinsame Repräsentation von Firmen auf Konferenzen und Messen im Ausland
Auf universitärer Ebene (ETH Zürich) haben sich zudem F&E Dienstleister etabliert, die explizit Pro-duktionsforschung und entsprechende Lösungskompetenz interessierten Unternehmen anbieten.
Zentraler Akteur ist dabei die inspire AG. inspire ist ein hochschulnahes Kompetenzzentrum für die Schweizer Maschinenindustrie und gleichzeitig eine institutsübergreifende Arbeitsgemeinschaft. Die Ein-richtung betreibt Forschung für die Industrie und bietet Problemlösungen in verschiedenen Wissensge-bieten (Methoden, Prozesse und Technologien) an. Das Tätigkeitsfeld von inspire lässt sich in vier Bereiche gliedern:
– Maschinen
– Prozesse
– Methoden
– Virtuelle Realität
Dabei ist dieses Kompetenzzentrum unter zwei Formen mit der Industrie tätig: 1. KTI-Projekte. Dies sind Projekte via die Förderagentur des Bundes für Innovation. Diese zahlt
die Aufwendungen des universitäten Teils, während die beteiligten Firmen für ihren Anteil selbst aufkommen.
2. Projektmandate. Diese werden vollumfänglich durch die Firmen bezahlt.
6.3 Finnland
Das zentrale Produktionsforschungsprogramm in Finnland war „SISU 2010 – Innovative Manufactu-re“. Verantwortlich war TEKES, die Innovationsagentur Finnland. Betreut und in der Industrie und Wissenschaft vermarktet wurde es zudem vom Programmkoordinator, Prof. Tuokko, von der Univer-sität Tampere.
30 Themenkonsolidierung Smart Production
Gestartet wurde das Programm 2005, geendet hat es, wie alle thematischen Programme von TE-KES, nach fünf Jahren 2009. Gegenwärtig sind Nachfolgeprogramme für 2011 bzw. 2012 geplant (Manufacturing, Machine Engineering).
SISU 2010 zielt auf die Herstellung diskreter Güter mit Fokus Fabrik (intern) ab und umfaßt drei Handlungsfelder:
1. Self-organization in production
2. Flexible production solutions
3. Advanced production and manufacturing technologies
Innerhalb dieser drei Handlungsfelder wurden Forschungsthemen laufend erhoben und relativ offen definiert. Die Priorisierung der Forschungsthemen für die insgesamt 5 Ausschreibungen erfolgte in einem von TEKES koordinierten Diskursverfahren innerhalb des Programmkomitees, das sich aus VertreterInnen aus Forschung, Industrie, TEKES und zuständigem Wirtschaftsministerium zusam-mensetzt.
Im Zeitraum von 4 Ausschreibungsjahren (2006 bis 2009) wurden 39 Mio. an öffentlichen Förderun-gen, also im Durchschnitt rd. 10 Mio. € pro Jahr, ausgeschüttet. Pro Ausschreibung sind somit rd. 8 Mio. € an Fördermitteln geflossen, wobei sowohl Bottom-up Projekte als auch kooperative For-schungsprojekte davon finanziert wurden (siehe unten). Das Programmvolumen insgesamt belief sich auf 81 Mio. €.
Dem Programm, wie allen thematischen Programmen von TEKES, stehen zwei F&E-Projektformate bzw. Fördertöpfe zur Verfügung: (i) Bottom up Unternehmensprojekte (entspricht in der Logik im Wesentlichen Basisprogrammprojekten) und (ii) kollaborative Forschungsprojekte.
In beiden Projekttypen gibt es spezifische Förderkonditionen für KMU, Große Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Diese ändern sich auch nicht, wenn die Organisation außerhalb oder in-nerhalb eines thematischen Programms beantragt oder in welchem thematischen Programm sie beantragt.
In den Unternehmensprojekten ist der durchschnittliche öffentliche Förderanteil rd. 40 % (variiert beginnend mit rd. 25 % bei großen Unternehmen bis zu max. 70 % bei KMU High Risk Projekten), bei den Forschungsprojekten 60 %. Die Laufzeit beträgt in der Regel 2 Jahre für Unternehmenspro-jekte und 3 Jahre für kollaborative Forschungsprojekte.
Das Projektvolumen bei den Unternehmensprojekten variiert von 100.000 € bis rd. 3 Mio. €, ist aber prinzipiell nicht limitiert. Das Projektvolumen bei den Forschungsprojekten bewegt sich in der Spannbreite von 500.000 € bis 1 Mio. €. Das bedeutet, dass im Durchschnitt TEKES bis zu 200.000 € pro Jahr pro Projekt öffentlich finanziert (bei einer Laufzeit von 3 Jahren).
Bei den kollaborativen Forschungsprojekten kommen daher 60% der Projektkosten von TEKES, 20% kommt von Unternehmen selbst, wobei mindestens € 10.000,- / Jahr / Unternehmen einge-bracht werden müssen, und 20% kommt von den Forschungseinrichtungen selbst. Die Fördermittel und die direkten Unternehmensmittel kommen der/den Forschungseinrichtung/en zu Gute. Unter-nehmensaufwendungen im Projekt werden in kollaborativen Forschungsprojekten nicht öffentlich finanziert. Die Ergebnisse der Projekte kommen den Unternehmen (mind. 3 beteilige Unternehmen) zu Gute bzw. orientieren sich stark an deren Fragestellungen. Die Unternehmen geben im Regelfall Fragen/Thema vor und lassen diese von den Forschungseinrichtungen bearbeiten.
31
Die Forschungsprojekte sind von ihrer Ausrichtung her generisch, kooperativ und vorwettbewerblich. Gegen Ende der Laufzeit wurden kollaborative Projekte ausgeschrieben, die einen größeren Pilot- bzw. Demonstrationscharakter aufweisen.
Zudem wurden im Rahmen von SISU 2010 auch Begleitstudien (Marktstudien, Evaluierungen, Tech-nologiemonitoring) beauftragt.
Rd. 2 Drittel der Fördermittel von 39 Mio. € floss in Bottom up Unternehmensprojekte, 1/3 in kollabo-rative Forschungsprojekte. Gefördert wurden in den 5 Jahren Programmlaufzeit 40 kollaborative Forschungsprojekte und 95 Unternehmensprojekte mit insgesamt mehr als 300 Unternehmenspart-nern.
Für ihre rd. 20 thematischen Programme mit fixer Laufzeit von jeweils meistens 5 Jahren reserviert TEKES im vor hinein Mittel aus diesen beiden (in der anteiligen Größe jährlich etwas variablen) För-dertöpfen; ändern dabei aber bei den thematischen Ausschreibungen nicht die Förderkonditionen (s.o.), sondern motivieren Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei den thematischen Pro-grammen via Marketing/Beratung/Vernetzung/Bewusstseinsbildung und teilweise höhere Zuerken-nungschancen mitzumachen. TEKES ist bemüht die thematischen Programme wie SISU 2010 zu vermarkten und mit Antragstellern zu „befüllen“.
Vor diesem „Servicehintergrund“ von SISU 2020 fanden zahlreiche Begleit- und Netzwerkaktivitäten statt, die vom Programmkoordinator Universität Tampere organisiert und begleitet wurden und auch einen entscheidenden Mehrwert gegenüber der Einreichung außerhalb einer thematischen Initiative bieten. Dies ist umso entscheidender, als in den nicht-thematischen Projektförderungen ja dieselben Konditionen gelten wie innerhalb eines der rd. 20 thematischen Programme von TEKES.
So wurden 33 Seminare, Workshops bzw. Konferenzen (regional, thematisch, international) veran-staltet. International wurden in 10 Auslandsreisen rd. 100 Destinationen besucht. Rd. 700 internatio-nale und 2.000 nationale Personen waren in den Veranstaltungen bzw. Seminaren involviert, 2007 und 2009 wurde jeweils ein „Tampere Manufacturing Summit“ abgehalten. Nach Japan, Korea, Ita-lien, Deutschland und in die USA wurden so genannte „Technical Tours“ veranstaltet.
Neben den thematischen Programmen existieren in Finnland bereits sechs so genannte „strategic centres for science, technology and innovation“, die öffentliche Fördermittel für ihre Technologiepro-gramme bei TEKES beantragen und von der Industrie getragen werden. Ein Zentrum daraus, das „Metal products and mechanical engineering“ (FIMECC Ltd) widmet sich explizit der Produktionsfor-schung im Metall- bzw. Maschinenbau. Die Firma Andritz ist Mitglied in diesem Kompetenzzentrum.
7 Instrumente und Maßnahmen für „Smart Production“
Im Folgenden wird der FTI-politische Handlungsbedarf operationalisiert und Eckpfeiler für konkrete mögliche Maßnahmen skizziert. Die Ausführungen basieren dabei auf den weiter oben präsentierten Aussagen zu den Stärken und Schwächen der österreichischen Produktionsforschung, den Ergeb-nissen der Workshops und den durchgeführten Interviews mit ExpertInnen aus Industrie und Wis-senschaft.
Grundsätzlich befürworten alle involvierten ExpertInnen die Etablierung eines spezifischen Produkti-onsforschungsprogramms. Dabei wird vor allem folgender Bedarf gesehen:
– Förderung von kooperativen Projekten,
32 Themenkonsolidierung Smart Production
– Unterstützung bei internationalen Projekten und der der internationalen Vernetzung,
– Abstimmung, Vernetzung und Koordination,
– Förderung von Pilot- und Demonstrationsvorhaben,
– Förderung von Ausbildung und Qualifikation.
Im Konkreten wird in der Förderung von kooperativen F&E-Projekten der größte Bedarf gesehen. Die Förderung von kooperativen Projekten zwischen Forschungseinrichtung und Unternehmen wird durchwegs als wichtig erachtet. Jedoch sollte es keine zu restriktiven Regeln bzgl. Typ und Anzahl der Partner geben, also etwa die Notwendigkeit, dass KMU involviert sind oder eine Mindestanzahl von Partnern einzubinden sind etc., - so der einhellige Tenor der befragten Akteure. Dies ist unter anderem getragen von den Erfahrungen mit Beteiligungen an Kompetenzzentren und EU-Projekten, bei denen hoher administrativer und koordinativer Aufwand besteht. Eine ausschließliche Förderung von Forschungseinrichtungen wurde von Seiten der Industrie wie auch Wissenschaft als wenig sinn-voll betrachtet, wenngleich die Industrie unterschiedlich beteiligt sein kann. Kooperative Projekte sollten vor allem den Wissenstransfer und die Umsetzung von Ergebnissen (außer)universitärer For-schung in industrielle Anwendungen fördern. Weiters gab es vereinzelt die Forderung, auch For-schungsdienstleister als wissenschaftliche Partner zu akzeptieren. Das BRIDGE-Programm wurde wiederholt als mögliches Referenzmodell genannt, wie derartige kooperative Projekte aufgesetzt bzw. abgewickelt werden können. Das heißt, es sollte klare Spielregeln aber einen relativ großen Freiraum bei der inhaltlichen und organisatorischen Konzeption und Umsetzung von Projekten ge-ben.
Eine zentrale Frage im Rahmen der Ausgestaltung eines Produktionsforschungsproramms ist jene nach der thematischen Fokussierung bzw. der Frage, in welchem Ausmaß Themen in spezifi-schen Ausschreibungen (Calls) gefördert werden sollen. Dabei ist der Grundtenor der österreichi-schen ExpertInnen, dass Themen nicht zu eng definiert werden und tendenziell Querschnittsthemen ausgeschrieben werden sollten. Des Weiteren wurde empfohlen, dass ausgeschriebene Themen nach Möglichkeit interdisziplinäres Arbeiten unterstützen.
Die Frage, in wie weit durch eine Produktionsforschungsprogramme bzw. einzelne thematische Fel-der der Aufbau kritischer Massen definiert werden soll, wird unterschiedlich beurteilt. Während einige ExpertInnen dafür eine Notwendigkeit sehen, bewerten andere ExpertInnen dies als eher skeptisch bzw. nicht realistisch, was vor allem auf Grund der Größe Österreichs in Frage gestellt wird.
Eine weitere wichtige Frage im Zusammenhang mit der Ausgestaltung von Förderungen für F&E-Projekt ist jene nach der Größe, Laufzeit und Risiko der geförderten Vorhaben. Hier spannt sich die Bandbreite der Empfehlungen von der Förderung einer größeren Anzahl kleinerer Projekte bis hin zu weniger größeren Projekten, wobei letzeres eher die Ausnahme darstellt. Bei der Laufzeit ist eine Tendenz zu kürzeren Projekten mit einem Rahmen von rund 3 Jahren zu identifizieren, wenn-gleich die ExpertInnen, welche größere Projekte einfordern, auch tendenziell längere Laufzeit favori-sieren. In Bezug auf das Risiko variiert die Einschätzung wie zu erwarten ebenso: während einige Vertreter von Industrie und Wissenschaft vor allem risikobehaftete, forschungsintensive Projekte einfordern und die laufende Optimierung nicht in einem möglichen Förderportfolio sehen, erkennen andere ExpertInnen auch die Notwendigkeit der Förderung inkrementeller Projekte an, die nach Ein-schätzung in Summe ebenfalls einen großen Schritt ermöglicht, zumal sich größere Sprünge in der Regel schwer planen oder prognostizieren lassen. Zugleich ist an dieser Stelle aber festzuhalten, dass diese teilweise unterschiedlichen Ansprüche und Forderungen keine Widersprüche darstellen, die Politik hat entsprechend mit verschiedenartigen Instrumenten und Maßnahmen zu agieren.
Alle interviewten ExpertInnen sehen zusätzlich zur Förderung von Produktionstechnologien bzw. Prozessinnovationen die Produktentwicklung als bedeutend und betonen, dass sich ein Produkti-onsforschungsprogramm nicht ausschließlich auf die Entwicklung von Produktionstechnologien kon-zentrieren kann. Häufig liegt die Wettbewerbsfähigkeit in der integrierten Entwicklung von neuen Produkten und Produktionstechnologien. In diesem Zusammenhang wurde auch darauf hingewie-
33
sen, dass der Schutz der Erfindungen und die Durchsetzung von IPRs vor allem für KMUs problema-tisch sind, hier könnte die Errichtung eines IPR-Helpdesks hilfreich sein.
Ein Handlungsbedarf von Seiten der FTI-Politik wird auch in der besseren Integration von Mechanik einerseits und Elektronik und Informationstechnologie andererseits gesehen, ein Ziel, das sich unter anderem die Mechatronik gesetzt haben. Trotz des gestiegenen Bewusstseins für die Kombination beider Felder und bereits erfolgreich gesetzter Initiativen innerhalb der universitären Forschung, werden hier nach wie vor strukturelle und kulturelle Barrieren diagnostiziert, die es gilt zu adressie-ren.
Einige ExpertInnen betonen auch, dass neben dem Aufsetzen eines nationalen Programms, die Beteiligung von österreichischen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen an ausländischen Programmen durch eine nationale Ko-Finanzierung unterstützt werden soll, womit auch bilaterale Projekte einfacher realisiert werden könnten. Ferner kann in diesem Zusammenhang kann auf die Vernetzung auf europäischer Ebene bzw. den Rahmenprogrammsprojekten verwiesen werden. Die internationale Anbindung an F&E-Netzwerke (Bsp. nationale SusChem Plattform), aktive Teilnah-me an ERA-Nets und Joint Calls (Bsp. WoodWisdom 2) sind ebenso anzuführen.
Insgesamt gibt es nach Ansicht der ExpertInnen eine relativ gut ausgebaute Forschungslandschaft, wobei sich zahlreiche Einrichtungen (Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Kompetenzzentren) mit unterschiedlichsten Fragen der Produktionsforschung beschäftigen. Dabei befürwortet der Großteil der ExpertInnen den Ausbau, die Koordination und stärkere Fokussierung existierender F&E-Einrichtungen als vorrangig vor der Neugründung bzw. Errichtung eigenständiger F&E-Einrichtungen. Auch virtuelle Zentren und Verbünde werden hier als sinnvoll erachtet. Zudem wird auch ein paralleler Austausch der geförderten Projekte eines Produktionsforschungsprogramms angeregt, z.B. regelmäßige Workshops etc.
Neben der Förderung von kooperativen F&E-Projekten wird von Industrievertretern in einigen F&E-intensiveren Branchen (Bsp. Halbleiterindustrie, Materialentwicklung, Rohstoffe) auch großen FTI-politischer Bedarf für die Förderung von Pilot- und Demonstrationsanalagen wahrgenommen. Dabei wird argumentiert, dass es in der frühen Innovationsphase vergleichsweise gut ausgebaute Förderangebote gibt, während beim Übergang vom Prototypen zur Serienfertigung (Upscaling), eine Phase, die ebenfalls noch ein relativ hohes Risiko darstellt und einen großen Investitionsbedarf mit sich bringt, kaum Förderungen bzw. spezifische Finanzierungsmodelle angeboten werden. Des Wei-teren wären hier auch verstärkt Anreize zu setzen, damit der Venture Capital Markt dieses Feld ent-deckt.
Im Allgemeinen sind vor allem Ausbildung, Qualifikation und Schulung ein zentrales Thema und gleichzeitig Innovationsbarriere für den Bereich Manufacturing, sowohl was die Entwicklung neuer als auch die Diffusion etablierter Technologien betrifft. Ein weiteres forciertes Vorgehen in Abstim-mung mit der Bildungspolitik ist von Seiten der FTI-Politik erforderlich, was als generische Maßnah-me betrachtet werden kann. Auch Lehrgänge im Bereich Fertigungstechnologie in Kombination mit Werkstoffverarbeitung und -entwicklung (an Universitäten/Fachhochschulen) sollten verstärkt ange-boten werden, so der artikulierte Bedarf der befragten Akteure. Des Weiteren wird die Förderung von Projektarbeiten für Berufseinsteiger als sinnvoll gesehen, damit Absolventen rasch in betriebliche Prozesse integriert werden können.
Schließlich wird auch noch die Notwendigkeit für weitere Awareness-Maßnahmen (Österreich als Produktionsstandort definieren, Technikbegeisterung fördern, Lust am Forschen wecken, Preise (z.B. Staatspreis)) gesehen.
34 Themenkonsolidierung Smart Production
8 Anhang
8.1 Interviewleitfaden
Interview-Leitfaden Smart Production
Status Quo und Zukunftsthemen
1. Was sind österreichische Stärken und Schwächen im Bereich der Sachgüterproduktion? (Mate-rialbeherrschung, Komponentenentwicklung, Produktionstechnologien, Regelungstechnik, …)
2. In welchen Bereichen passiert aktuell F&E – Branche, Technologie, Thematischer Schwer-punkt?
3. Was sind österreichische Stärken im Bereich der Produktionsforschung (kritische Masse)? Wer sind die wichtigsten Player? Wer bearbeitet Forschungsaufträge (extern / intern, in Kooperation mit welchen Institutionen)?
4. Wo sehen Sie explizit F&E-Bedarf? Was wären aus Ihrer Sicht grundlegende Fragestellungen, die sich die Produktionsforschung stellen muss und die außerhalb eines unternehmensspezifi-schen Produktionsproblems liegen?
5. Wohin wollen die Unternehmen (technologisch, wirtschaftlich ...)?
Höchste Ressourceneffizienz
1. Was verstehen Sie unter „Höchster Ressourceneffizienz“ Was gehört zur optimalen Betriebsfüh-rung, wo sind radikale Innovationen möglich?
2. Welche Forschungsthemen treten bei der Realisierung „Höchster Ressourceneffizienz“ auf? Welcher Forschungsbedarf ergibt sich?
Höchste Leistungsorientierung
1. Unter dem Begriff „Höchster Leistungsorientierung“ verstehen wir robuste, präzise arbeitende Produktionsprozesse, die Produkte gesicherter Qualität zu vertretbaren Kosten herstellen. Wel-che Technologien stehen bei einer Realisierung im Vordergrund? Welcher Forschungsbedarf ergibt sich in diesem Zusammenhang?
Höchste Flexibilität
1. Unter der Annahme, dass wir „höchste Flexibilität in Produktionsprozessen“ anstreben, was sind dafür notwendige neue Technologien und Anwendungen? In welchen Bereichen besteht im Be-sonderen Forschungsbedarf (z.B. Systemintegration, Steuerung, Komponenten, Werkzeuge, Automation)?
Nachhaltige Werkstoffe, High Tech Werkstoffe und Miniaturisierung
1. Unter der Annahme, dass wir „Produktionskompetenzen im Bereich der nachhaltige Werkstoffe, der High-Tech-Werkstoffe und der Miniaturisierung“ stärken wollen, was sind dafür jeweils der notwendige neue Technologien und Anwendungen? In welchen Bereichen besteht im Besonde-ren Forschungsbedarf (z.B. Materialforschung, Materialbearbeitung, Beschichtung, Verfahrens-technik, Mechatronik)?
35
Nachhaltige Werkstoffe – Umsetzung in Unternehmen
1. Wie schätzen Sie die Zukunfts- und Entwicklungsfähigkeit nachhaltiger Werkstoffe ein?
2. Welche Forschungsfragen sind für den breiten Einsatz von nachhaltigen Werkstoffen vordring-lich?
3. Welche Maßnahmen / Instrumente / Hilfestellungen müssen geboten werden, dass es für die produzierende Industrie Österreichs attraktiv ist, bei entsprechenden Forschungsaktivitäten ein-gebunden zu sein?
Gezielte Themenfindung
1. Wo liegt der F&E-Bedarf, der von Unternehmen alleine nicht durchgeführt werden kann?
2. Wo sehen Sie große Innovationshürden?
3. Wie schätzen den Bedarf in folgenden Themen ein (vgl. Liste/Grafik)? Für ihr Unternehmen, ihre Branche, für Österreich?
Maßnahmen
1. Welche Rahmenbedingungen und Maßnahmen spielen eine große Rolle für eine zukunfts-fähige Produktionsforschung in Österreich?
2. Welche Maßnahmen und Instrumente sollten ausgebaut werden? - Forschungsförderung Projekte (Grundlagenforschung (GF), Anwendungsorientierte Forschung (AF), Industrielle Entwicklung (IE)) - Forschungsinfrastruktur (Bündelung und Aufbau von Kompetenzen in Zentren, Labors) - Demonstrations- und Investitionsförderung - Industrielle Umsetzung (Kredite, Haftungen) - Gründung und Standortfragen (Venture Capital, ..) - Humanressourcen (Bildung, Ausbildung) - Cluster- und Communitybuilding, Vernetzung - Exportfinanzierung - europäische F&E-Kooperationen (7 RP, CIP, Anbahnungsfinanzierung) - Awareness-Maßnahmen?
3. In welchen F&E-Bereichen (GF, AF, IE; s.o.) sind eher Einzelprojekte (kurzfristig, Basispro-gramme) gefragt, in welchen kooperative Projekte (Wissenschaft/Unternehmen, langfristig, evt. in internationalen Konsortien)
4. Wie können insbesondere KMU unterstützt werden?
36 Themenkonsolidierung Smart Production
8.2 Liste der befragten Expertinnen (Interviews und Workshops)
ExpertInnenliste nach Interviews und Workshops
Interviews
Dr. Andreas Anzel Andritz Hydro
Dr. Mark Beesley AT&S
Prof. Dr. Friedrich Bleicher TU Wien
DI Dr. Markus Brummayer Voestalpine Stahl GmbH
Prof. Dr. Helmut Detter FMMI
Isabell Duckham Voestalpine Stahl GmbH
Prof. Dr. Reinhold Ebner MCL Leoben
Dr. Johannes Fresner Stenum GmbH
DI Dr. Heike Frühwirth BioDiesel International AG
Prof. Dr.-Ing. Detlef Gerhard TU Wien
Dr. Martin Greimel Kooperationsplattform Forst, Holz, Papier
DI Christoph Hinteregger Doppelmayr Seilbahnen GmbH
DI Dr. Christian Hinteregger MAGNA Powertrain
Prof. Dr. Dirk Jodis TU Graz
Dr. Michael Koncar VTU Engineering
Prof. DI Dr. Andreas Kugi TU Wien
Prof. Dr. Reinhold Walter Lang Johannes Kepler Universität
Prof. DI Dr. Emil J.W. List Direktor des NanoTecCenter (NTC) Weiz
Dr. Stefan Pirker Treibacher Industrie AG
Dr. Raimund Ratzi MIBA AG
Dr. Klaus Rissbacher Plansee
Dr. Martin Schrems Austriamicrosystems
Dr. Jürgen Simmerer profactor steyr
DI (FH) Thomas Timmel Austropapier
Dr. Andreas Windsperger Institut für Industrielle Ökologie
DI Christian Wögerer Profactor steyr
DI Dr. Hermann Wolfmeir Voestalpine Stahl GmbH
Prof. Dr. Gerfried Zeichen TU Wien
Prof. Dr. Klaus Zeman Uni Linz
Smart Production Workshops
Workshop e-Maintenance
DI Johann Massoner Infineon
Dr. Josef Affenzeller AVL List
DI Dr. Markus Brummayer Voest
Prof. DI Dr. Andreas Kugi TU Wien
37
Workshop zu Ressourceneffizienz und Leis-tungsorientierung
Dr. Bernd Kopacek Austrian Society for Systems Engineering and Automation
Walter Kodym Jabil Circuit Austria GmbH
Ing. Christian Kunst CD.AUT-KUNST GmbH & Co. KG
Dr. Karl Schwaha VPTÖ
DI Jutta Isopp Messfeld GmbH
Dr. Selma Hansal Happy Plating
Dr. Wolfgang Hansal Happy Plating
8.3 Europäische Förderprogramme und Initiativen im Bereich „Ressourceneffizienz“ und „Nachhaltige Werkstoffe“
8.3.1 Förderprogramme
Im Forschungsschwerpunkt Ressourceneffizienz sind das deutsche Förderprogramm FONA (For-schung für Nachhaltigkeit) und das niederländische Umwelt- und Technologie-Programm interes-sant.
Exkurs: FONA (Forschung für Nachhaltigkeit) – www.fona.de
In diesem vom deutschen BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) initiierte Rahmen-programm wird mit gezielter, handlungsorientierter Forschung Sachfragen nachgegangen, die das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung aufwirft. Das Rahmenprogramm FONA umfasst die vier Themenbereiche Gesellschaft, Wirtschaft, Regionen und Ressourcen.
Insbesondere der Themenbereich Wirtschaft ist auch Produktionsrelevant, denn „Forschung für Nachhaltigkeit soll globalisierte Wertschöpfungsketten und Produktionssysteme auf Nachhaltigkeit ausrichten und dabei die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft langfristig sichern“.
Der Themenbereich Wirtschaft umfasst
– Rohstoffnahe Produktionssysteme um die Nachhaltigkeitspotenziale in der industriellen Ver-arbeitung von Rohstoffen stärker zu nutzen (Aufgliederung nach Branchen: Gießerei, Elektronik und Elektrotechnik, Textilindustrie, Metallerzeugung, etc.),
– Bedürfnisfelder und Wertschöpfungsketten (Wie müssen Systeme und Wertschöpfungsket-ten zukünftig unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gestaltet werden?),
– Nachhaltige Unternehmensführung und innovative Geschäftsmodelle (z.B. Betriebliche Instrumente für Nachhaltiges Wirtschaften, Neue Produktnutzungsstrategien),
– Schlüsselinnovationen, also Querschnittstechnologien und -innovationen die einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Wirtschaft leisten können (z.B. Bionik) und
– Klimaschutzstrategien
Exkurs: The Dutch Environment and Technology Programme - http://www.senternovem.nl/milieutechnologie/English/index.asp
38 Themenkonsolidierung Smart Production
The objective of the Dutch Environment and Technology Programme (ETP) is to stimulate the devel-opment and application of innovative, environment-oriented technologies in the Netherlands. The programme makes use of subsidies and other instruments, such as transfer of knowledge, innovative networks, sector projects, and target group support. The programme, managed by SenterNovem, focuses on the application of sustainable industrial processes, products and services and the non-technical aspects of sustainable innovations. The main target group of the programme are SMEs. The annual budget for subsidies is approximately 4.5 M€. Each year approximately 60 projects are granted with a subsidy.
Im Forschungsschwerpunkt Nachhaltige Werkstoffe ist das deutsche Förderprogramm Nachwach-sende Rohstoffe und das finnische BioRefine-Programm anzuführen.
Exkurs: Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe – www.nachwachsenderohstoffe.de
Dieses vom deutschen BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-schutz) getragene Förderprogramm ist mit einem Fördervolumen von 51, 5 Mio. Euro pro Jahr dotiert und ist orientiert auf:
– den Aufbau von Produktlinien von der Erzeugung bis zur Verwendung nachwachsender Roh-stoffe,
– die Erschließung weiterer Verwendungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe im Nichtnah-rungsmittelsektor,
– die Informationsvermittlung und Beratung vor allem für Produzenten, Verarbeiter und Anwender sowie Verbraucher nachwachsender Rohstoffe und
– die Öffentlichkeitsarbeit für die Verwendung nachwachsender Rohstoffe.
Schwerpunkte sind sowohl die energetische als auch die stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen (Biopolymerwerkstoffe, Spezialpolymerer aus nachwachsenden Rohstoffen,..). Gefördert werden produktions- und verwendungsorientierte anwendungsbezogene Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte.
Exkurs: BioRefine - http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/BioRefine/en/etusivu.html
Dieses auf die Verarbeitung von Biomasse fokussierte Förderprogramm ist mit einem Gesamtbudget von 137 Millionen Euro für 5 Jahre ausgestattet und wird von der Tekes (The Finnish Funding Agen-cy for Innovation and Technology) betreut.
Ziel des Programms ist es neue Konzepte und Technologien zum Thema Biomasse und deren Ver-arbeitung bzw. Nutzung zu entwickeln auf Basis dessen Prozesse, Produkte und Dienstleistungen für Bioraffinerien entwickelt werden können. Dabei gilt es Finnland stark auf dem internationalen Markt zu positionieren und dabei die nationalen Kapazitäten (Fachpersonal und Know-How) zu nut-zen. Die Vernetzung der teilnehmenden und relevanten Unternehmen sowie ein verstärkter Wissens-transfer auf nationaler und internationaler Ebene stehen genauso im Vordergrund wie die Entwick-lung von neuen Strategien und Technologien.
8.3.2 Initiativen und Netzwerkaktivitäten
Forschungsschwerpunkt Ressourceneffizienz
Exkurs: ERA-NET Sustainable Enterprise (SUSPRISE) - www.susprise.net
39
SUSPRISE zielt auf einen Ausbau der Kooperation und Koordination nationaler Aktivitäten der Nachhaltigkeitsforschung ab um gemeinsame Entwicklungen and Anwendungen neuer nachhaltiger Technologien zu unterstützen.
Exkurs: ERA-NET on Catalysis:
Dabei handelt es sich um ein Nachfolgeprojekt von ERA-Net Susprise, welches voraussichtlich im letzten Quartal 2010 startet.
Die genaue Rolle von Österreich (Experte, Teilnehmer, etc.) ist dabei noch nicht definiert.
Schwerpunkt des Programms liegt im Anwendungsbereich und soll in enger Zusammenarbeit mit der Industrie bzw. mit Partnerfirmen aus der Industrie erarbeitet werden und einen verstärkten Aus-tausch auf europäischer Ebene fördern.
Inhalte des Programms sind unter anderem: Biomasse - Nutzung für Treibstoff oder/und als indus-trielles Einsatzmaterial, Energieumwandlung, Brennstoffzellentechnologie, Energieeffizienz etc.
Forschungsschwerpunkt Nachhaltige Werkstoffe
Exkurs: ERA-NET Bioenergy - www.eranetbioenergy.net
ERA Net Bioenergy wurde als Plattform geschaffen, um die starken Aktivitäten die von den verschie-denen Ländern im Bereich Bioenergie gesetzt werden zu bündeln und zu vernetzen. Durch die Betei-ligung an diesem Programm kann ein verstärkter Wissensaustausch erfolgen und gezielt in ver-schiedene Entwicklungsprojekte investiert werden. Durch die enge Zusammenarbeit der Mitglieder können oft schneller und einfacher bessere Ergebnisse erreicht werden. Durch internationale Zu-sammenarbeit können so nationale Forschungsprogramme im Bereich Bioenergie unterstützt wer-den mit dem Ziel einen hohen Wissensaustausch zu erreichen und die Entwicklung zukünftiger Technologien voranzutreiben.
Für den Themenbereich Biorefinery gibt es ein Joint Work programme.
Exkurs: ERA-NET Wood Wisdom Net
Diese internationale Plattform wurde 2004 ins Leben gerufen und setzte erste Schwerpunkte im Be-reich Holzforschung und -technologien. Mittlerweile sind 19 Partner aus 12 Ländern beteiligt.
Österreich ist bisher nicht beteiligt, sondern hat Beobachter- bzw. ExpertInnenstatus. Teilweise wur-de durch BRIDGE Finanzierung an den jährlich stattfindenden Joint Calls teilgenommen.
Ziel des ERA-NET ist es, einen möglichst großen Know-How Austausch zwischen den Mitgliedern zu erreichen und mögliche Kooperationen zu fördern.
Exkurs: The Dutch Network on Biorefinery – www.biorefinery.nl
Biorefinery.nl is a joint initiative of Wageningen University and Research Centre (WUR) and the Energy research Centre of the Netherlands (ECN), supported by SenterNovem.
40 Themenkonsolidierung Smart Production
It is meant to inform industry, research institutes, universities, social institutes, and governments about research activities, new developments and projects. With the feedback of these groups it also concentrates on establishing a global biorefinery vision and formulating a roadmap for research on and development of biorefinery processes.
Relevante Europäische Technologieplattformen
Forschungsschwerpunkt Nachhaltige Werkstoffe
ETP Sustainable Chemistry (SusChem) – www.suschem.org/
Die ETP SusChem wurde im Juli 2004 offiziell ins Leben gerufen, mit dem Ziel den F&E-Bedarf der Chemieindustrie zu bündeln und zu fokussieren. Drei technologische Themen, Industrielle Biotech-nologie, Materialwissenschaften, -technologien und Prozessdesign wurden dabei identifiziert. Sei-tens der Stakeholder wurde die Strategische Forschungsagenda (SRA) "Innovating for a better futu-re" (SusChem 2005) erarbeitet, welche im November 2005 veröffentlicht wurde, sowie auch ein „Implementation Action Plan“ (SusChem 2006).
Im 7. FRP wurde eine erfolgreiche Umsetzung der von SUSCHEM vorgeschlagenen Themen in den Bereichen Energie, Neue Materialien/Werkstoffe, Biotechnologie sowie Informations- und Kommuni-kationstechnologien erzielt.
In Österreich hat sich bisher keine nationale Plattform formiert.
Forest-based Sector Technology Platform - www.forestplatform.org/
Die Forest-based Technology Plattform (FTP) wurde im Februar 2005 unter Mitwirkung der "Euro-pean Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois)" der "Confederation of European Forest Owners (CEPF)" und der "Confederation of European Paper Industries (CEPI)" gegründet. Sie um-fasst inhaltlich die Bereiche Forstwirtschaft, Holz- und Papierindustrie, holzbasierte Bioenergie und Spezialprodukte aus Lignozellulose. Die SRA wurde 2006 publiziert (Forest-Based Sector Technolo-gy Platform 2006).
Themenschwerpunkte sind:
– Entwicklung innovativer holzbasierter Produkte für sich verändernde Märkte und Verbraucher-bedürfnisse
– Entwicklung intelligenter und effizienter Herstellungsprozesse von holzbasierten Produkten mit verringertem Material- und Energiebedarf
– Sicherstellung und Steigerung der Verfügbarkeit von Biomasse für die Produkt- und Energieer-zeugung
– Nachhaltige und multifunktionale Bewirtschaftung der Wälder
– Der waldbasierte Sektor aus Sicht der Gesellschaft
Auf nationaler Ebene gibt es die Plattform Forst Holz Papier (Forest Technology Plattform).
Sowohl SusChem als auch Forest-Based Sector Technology Platform vertreten die Notwendigkeit eines neuen, integrierten Bioraffinerie-Ansatzes, wobei die Forest Platform den Schwerpunkt auf holz-basierte Bioraffinerien setzt.
Impressum
AIT-F&PD-Report ISSN 2075-5694
Herausgeber, Verleger, Redaktion, Hersteller:
AIT Austrian Institute of Technology GmbH Foresight & Policy Development Department
1220 Wien, Donau-City-Straße 1 T: +43(0)50550-4500, F: +43 (0)50550-4599
f&[email protected], http://www.ait.ac.at/foresight_and_policy_development
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.