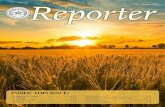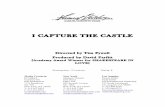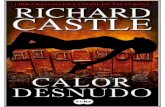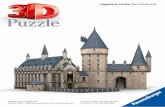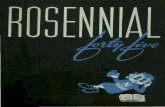The high and late medieval castle in Schleswig-Holstein, Northern Germany. An archaeological...
Transcript of The high and late medieval castle in Schleswig-Holstein, Northern Germany. An archaeological...
Der Band versammelt die Beiträge einer interdisziplinären Tagung zum Thema „Burgen in Schleswig-Holstein“, die vom 20. bis 22. September 2013 in der Sparkassenakademie in Kiel stattfand. Ausgewiesene Burgenexperten der Bereiche Geschichte, Archäolo-gie und Denkmalpflege skizzieren den aktuellen Forschungsstand, präsentieren neue Ergebnisse und zeigen Perspektiven auf, um das „vergessene Burgenland Schleswig-Holstein“ wissenschaftlich weiter zu erschließen und es einer breiteren Öffentlichkeit in Erinnerung zu bringen. Zudem wird vergleichend auf die Entwicklungen in den Nach-barregionen Mecklenburg, Dänemark und Niedersachsen sowie in Südwestdeutschland eingegangen. Der Band vermittelt somit einen guten Eindruck zum Stand der aktuellen Burgenforschung weit über Schleswig-Holstein hinaus.
Oliver Auge studierte Geschichte und Lateinische Philologie in Tübingen, wo er auch promovierte. Nach seiner Habilitation in Greifswald ist er derzeit Professor für Regi-onalgeschichte mit Schwerpunkt zur Geschichte Schleswig-Holsteins im Mittelalter/Früher Neuzeit an der Universität zu Kiel.
42
KW
St/A
Oliv
er A
uge
(Hrs
g.) ·
Ver
gess
enes
Bur
genl
and
Sch
lesw
ig-H
olst
ein
Kieler WerkstückeReihe A:
Beiträge zur schleswig-holsteinischenund skandinavischen Geschichte
42
Oliver Auge (Hrsg.)
Vergessenes Burgenland Schleswig-Holstein
Die Burgenlandschaft zwischen Elbe undKönigsau im Hoch- und Spätmittelalter
ISBN 978-3-631-66147-5
Lizenziert für U. Müller
Kieler Werkstücke Reihe A:
Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte
Herausgegeben von Oliver Auge Begründet von Erich Hoffmann
Band 42
Lizenziert für U. Müller
Oliver Auge (Hrsg.)
Vergessenes Burgenland Schleswig-Holstein
Die Burgenlandschaft zwischen Elbe und Königsau im Hoch- und Spätmittelalter
Beiträge einer interdisziplinären Tagung in Kiel vom 20. bis 22. September 2013
Lizenziert für U. Müller
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildung:
Siegel der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Die Universität trägt ihren Namen nach ihrem Gründer, dem Herzog Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorf, der sie im
Jahre 1665 – nur siebzehn Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges – für sein Herzogtum ins Leben rief. An diese Zeit erinnert auch ihr Siegel: Es zeigt eine Frauengestalt mit einem Palmzweig und einem Füllhorn voller Ähren in den Händen, die den Frieden
versinnbildlicht. Das Siegel trägt die Unterschrift: Pax optima rerum (Frieden ist das höchste Gut).
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Redaktion: Frederic Zangel
Gedruckt auf alterungsbeständigem, säurefreiem Papier.
ISSN 0936-4005
ISBN 978-3-631-66147-5 (Print) E-ISBN 978-3-653-05716-4 (E-Book)
DOI 10.3726/978-3-653-05716-4 © Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt am Main 2015 Alle Rechte vorbehalten.
Peter Lang Edition ist ein Imprint der Peter Lang GmbH.
Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
www.peterlang.com
Lizenziert für U. Müller
Inhaltsverzeichnis
Oliver AugeVergessenes Burgenland Schleswig- Holstein? Eine Einführung �������������������7
I� Ergebnisse und Perspektiven der Burgenforschung zu Schleswig-Holstein
Oliver AugeSpätmittelalterliche Kleinburgen in Schleswig- Holstein: Geschichtswissenschaftliche Forschungsbilanz und Forschungsperspektiven ��������������������������������������������������������������������17
Ulrich MüllerVergessenes Burgenland Schleswig- Holstein? Die archäologische Perspektive �����������������������������������������������������������������51
Christian FreyEine Burgenlandschaft erzählt: Nordelbische Burgen in der Slawenchronik Helmolds von Bosau ��������������������������������������������111
Ortwin PelcBurgen und Landesherrschaft in Schleswig- Holstein �������������������������������127
Jan HabermannNiederadelige Führungsgruppen und Burgsitze im spätmittelalterlichen Nordelbien �������������������������������������������������������183
Stefan MagnussenCastles in Contested Landscapes� Kleinburgen im Herzogtum Schleswig als Phänomen gesellschaftlichen und herrschaftsräumlichen Wandels (13� bis 16� Jahrhundert) – eine Projektskizze �����������������������������������������������������������������������������������221
Frederic ZangelDie Funktion landesherrlicher Burgen� Eine Untersuchung anhand der Pfandbriefe Christians I� von Dänemark �������������������������������������������233
Ulf Ickerodt, Eicke Siegloff und Claudia MandokVergessenes Burgenland Schleswig- Holstein – Die Perspektive der archäologischen Denkmalpflege �������������������������������������������������������249
Lizenziert für U. Müller
6 Inhaltsverzeichnis
II� Ergebnisse und Forschungen zu Nachbarregionen und Südwestdeutschland
Rainer AtzbachDer Burgenbau im Königreich Dänemark – ein Überblick ����������������������279
Felix BiermannSpätmittelalterliche Turm- und Burghügel in Mecklenburg- Vorpommern ����������������������������������������������������������������309
Arnd ReitemeierBurgen und ihre Erforschung im heutigen Niedersachsen �����������������������347
Thomas ZotzDie Burgenlandschaft in Südwestdeutschland �����������������������������������������367
Verzeichnis der Autorin und Autoren �����������������������������������������������������391
Lizenziert für U. Müller
Ulrich Müller
Vergessenes Burgenland Schleswig- Holstein? Die archäologische Perspektive
This article gives an overview of the development and the current state of archeological research on castles in Schleswig- Holstein. It points out the issues that are important and worthwhile to take a closer look at. In this context, the rapidly increasing number of motte- and- baily castles in the 13th and 14th century as well as the connections between castles and manors are discussed. An examination of transformation processes provides many new insights regarding the development of, for example, the nobility but also of medieval society as a whole.
Wer die großen Burgenausstellungen der letzten Jahre besucht, in deren Ka-talogen gestöbert oder moderne Fachbücher über Burgen gelesen hat, wird nicht umhinkommen, die Landstriche nördlich der Elbe als weitgehend burgenlosen Raum wahrnehmen zu wollen� In der Tat – der Blick in die Landschaften zwischen Nord- und Ostsee zeigt keine Anlagen vom Format der mittelrheinischen oder schweizerischen Höhenburgen� Auch die viel klei-neren, aber keineswegs unwichtigen „Motten“1 erschließen sich dem Be-trachter nicht unmittelbar� Somit verwundert es nicht, wenn die Burgen der Vergessenheit anheimgefallen sein sollten�
1. Frühes Mittelalter
Im Vergleich zu den hoch- und spätmittelalterlichen Anlagen sind Burgen aus der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrtausends recht gut erforscht� Vor allem die Befestigungen aus den slawischen und sächsischen Siedelgebieten standen im Fokus der Archäologie, während Untersuchun-gen an wikingerzeitlichen (dänischen) Anlagen sich weitgehend auf die Lembecksburg auf Föhr, die Hochburg von Haithabu und das Danewerk (Waldemarsmauer) beschränkten�2 Die Erforschung der sächsischen Anla-gen war bis in die 1960er- Jahre durch eine dezidiert ethnische Zuweisung der Funde und Befunde, den Abgleich mit der schriftlichen Überlieferung und eine Interpretation geprägt, welche die Anlagen als „Flucht- “, „Volks- “ oder
1 Im Folgenden werden Motte und Turmhügelburg stellenweise synonym verwendet�
2 Segschneider, Ringwälle� – Kalmring, Hedeby� – Dobat, Borge� – Lemm, Ringwälle� – Müller, Grenzen� – Müller- Wille, Obodriten�
Lizenziert für U. Müller
52 Ulrich Müller
„Mittelpunktsburgen“ sehen wollte�3 Die aus den Schriftquellen erschlos-sene soziopolitische Gliederung (Stammesverfassung, Gaustruktur usw�) gab immer wieder Anlass zu einer Diskussion der archäologischen Quellen�4 Die Forschungen zu den Anlagen haben insbesondere durch die jüngste Studie von Thorsten Lemm einen neuen Anstoß erhalten�5 Er setzte sich dezidiert und vergleichend mit der archäologischen Überlieferung auseinan-der und kontextualisierte diese mit den schriftlichen Quellen bzw� entspre-chenden Interpretationen� Damit ist es Lemm gelungen, eine „vergessene“ sächsische Burgenlandschaft in den Blickpunkt moderner Forschung zu ho-len� Die „Landnahme“ durch slawische Stammesgruppen und Stämme seit dem 8� Jahrhundert führte wie andernorts auch in den östlichen Landesteilen Schleswig- Holsteins zu einem Burgenbau�
Die systematische Erfassung und Erforschung der slawischen Anlagen ist vor allem mit Karl- Wilhelm Struve zu verbinden� Er fasste ab den 1950er- Jahren die bis dato sporadisch aufgemessenen oder auch prospektierten Anlagen in einem Corpus zusammen�6 Über punktuelle Untersuchungen hinausreichend haben Projekte, die durch den Sonderforschungsbereich 17 („Ostseeraumforschung“) angestoßen wurden, in der Folgezeit „Siedlungs-kammern“ und Zentralplätze vergleichend untersucht� Durch Grabungen und naturwissenschaftliche Analysen in Alt- Lübeck, Bosau, Oldenburg und Scharstorf konnte eine hohe Datendichte erzielt werden, welche die histo-rischen Prozesse der Zeit des 8� bis 11� Jahrhunderts nicht nur beleuchtete, sondern zahlreiche Facetten ausleuchtete und vergleichbar machte�7 In der jüngsten Zeit sind Forschungen an limnischen Standorten hinzugekommen�8 Ein traditionelles Thema der Forschung war und ist der limes Saxoniae� Durch die Wirkmächtigkeit der zwar verschiedentlich angezweifelten, letzt-lich aber immer wieder als historisches Faktum herangezogenen Beschrei-bung der „Slawengrenze“ bei Adam von Bremen lebt die Forschung zu den frühmittelalterlichen Burgwällen stark von dem Gegensatz „sächsisch“ – „slawisch“�9 Dabei ist kritisch anzumerken, dass von der postulierten Bur-genkette entlang des limes kaum eine der Anlagen gründlich prospektiert, geschweige denn archäologisch untersucht worden ist� Die historische
3 Struve, Burgenorganisation�4 Hierzu Meier, Im frühen Mittelalter, S� 69- 82�5 Bock, Polabien� – Lemm, Ringwälle�6 Struve, Burgen�7 Meier, Im frühen Mittelalter, S� 169- 215� – Müller- Wille, Obodriten� 8 Bleile, Central Sites�9 Lemm, Ringwälle, S� 339- 354� – Müller, limes saxoniae� – Bock, Limes
Saxoniae�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 53
Einordnung stützt sich daher weitgehend auf Oberflächenfunde und den Abgleich mit den historischen Daten�
Zusammenfassend und mit Blick auf die hochmittelalterlichen Burgen ist hervorzuheben, dass unsere Kenntnis sowohl der spätslawischen als auch der spätsächsischen bzw� billungerzeitlichen Plätze begrenzt ist� Insgesamt lässt sich feststellen, dass gerade für die wichtige Zeit des 11�/12� Jahrhun-derts kaum valide Daten vorliegen, die es erlauben, die ohnehin spärliche schriftliche Überlieferung zu kontextualisieren� Die Gründe für diese For-schungslücke sind vielfältig� Sie liegen einerseits in der schlechten Überlie-ferung der meist erodierten Befunde dieser Zeit, andererseits spiegelt sich darin aber auch eine Forschungstradition, die zwischen frühmittelalterlicher Archäologie und einer „Archäologie des Mittelalters“ trennt�
2. Die hoch- und spätmittelalterlichen Burgen
Zwischen 1000/1100 und der Zeit um 1500 vollziehen sich auch in Schleswig- Holstein folgenreiche Umstrukturierungsprozesse� Wie andernorts wird die Burg zum Ausdruck insbesondere eines adeligen Lebenszuschnittes� Burgen sind sichtbare, materiell- physische Erscheinungsformen im Raum� Sie sind durch ihre räumliche Materialität Teil von institutionalisierten und normati-ven Regulationssystemen, Ausdruck von gesellschaftlichen Interaktions- und Handlungsstrukturen sowie von Symbol- und Repräsentationssystemen�
2.1. Forschungsstand
Der archäologische Forschungsstand zu den hoch- und spätmittelalterlichen Burgen in Nordelbien scheint ungenügend zu sein, wenn man in einschlägige Publikationen schaut�10 Der Blick in die angrenzenden Regionen ist erhellend� In Niedersachsen ist der Stand der Burgenforschung als sehr gut zu bezeich-nen�11 Ähnliches gilt auch für Mecklenburg- Vorpommern und Brandenburg� Hier dominierte bis in die 1990er- Jahre die frühmittelalterliche „slawische“ Archäologie, doch sind gerade aus der jüngsten Zeit eine Reihe von regio-nalen wie übergreifenden Studien zu verzeichnen�12 In Dänemark wiederum
10 Böhme u� a�, Burgen� – Großmann/Ottomeyer, Burg� – Felgenhauer- Schmiedt u� a�, For schungsstand� – Von kunsthistorischer Seite Albrecht, Adelssitz� Im Fol-genden sollen lediglich die Burgen im Blickpunkt stehen� – Seesperren, Landweh-ren oder Stadtbefestigungen werden nicht weiter betrachtet, siehe hierzu Pelc, Tor und Mauer, und Gläser, Stadtbefestigungen�
11 Ettel, Burgen� – Zeune, Burgenforschung� – Heine, Burgen� – Vgl� auch den Beitrag von Arnd Reitemeier im vorliegenden Band�
12 Schwarz, Befestigungen� – Biermann, Motten� – Donat, Rittersitze� – Möller, Wohnbauten� – Szczesiak, Herrensitze� – Breitling u� a�, Brandenburg�
Lizenziert für U. Müller
54 Ulrich Müller
begann recht früh eine intensive Auseinandersetzung mit den mittelalterlichen Wehranlagen, obwohl traditionell die Schwerpunkte der Forschung auf der Wikingerzeit lagen� Meilensteine waren die Katalogisierungen nachwikinger-zeitlicher Anlagen seit den 1950er- Jahren sowie die Veröffentlichung der Burg von Næsholm durch Vilhelm la Cour 1961�13 In der Folgezeit wurden die nachwikingerzeitlichen Anlagen verschiedentlich behandelt� Seit den 1990er- Jahren ist auch hier eine verstärkte Beschäftigung mit dem Thema „Burg“ zu erkennen und inzwischen liegen Bearbeitungen vor, die neben der Aufar-beitung von Altgrabungen auch moderne Untersuchungen umfassen�14 Den vergleichenden Überblicken von Ingolf Ericsson und Jan Kock können das Corpuswerk von Jørgen Skaarup und Vivian Ettings monographische Bear-beitung der Königsburgen des 14� Jahrhunderts an die Seite gestellt werden�15
Lassen sich Gründe für den vergleichsweise schlechten Forschungsstand in Schleswig- Holstein anführen? Zunächst einmal war die mittelalterliche Burgenforschung des 19� und frühen 20� Jahrhunderts fest in den Händen der Bau- und Kunstdenkmalpflege und die Entwicklung einer Mittelalter-archäologie begann zögerlich� Zudem dominierten im Lande überwiegend Turmhügelburgen/Motten� Diese sich meist nur noch als Hügel im Gelände abzeichnenden Anlagen dürften der Kunst- und Baudenkmalpflege als wenig repräsentativ erschienen sein� So wurden sie denn auch vielfach als ur- oder frühgeschichtlich identifiziert�
Neben Heinrich Handelmann, Carl Schuchhardt oder Alfred Tode war Herrmann Hofmeister einer der ersten, welcher durch eine systematische Auf-nahme der ostholsteinischen Anlagen die hochmittelalterlichen Adelsburgen als eigenen Typ beschrieb�16 Ihm fiel auf, dass es neben den „sächsischen“ und „slawischen“ Anlagen auch Burgen gab, die sich weder den Slawen noch den Sachsen zuweisen ließen� Rund 50 Anlagen wies Hofmeister daher dem Typ der mittelalterlichen Adelsburg zu� In der Nachkriegszeit kam es wiederholt zur Aufnahme oder zu Untersuchungen (z� B� Sterley, Müggenburg), systema-tische Erfassungen und Prospektionen oder Sondagen blieben jedoch aus�17 Die moderne archäologische Burgenforschung in Schleswig- Holstein ist mit den Namen Karl- Wilhelm Struve, Hermann Hinz, Ericsson sowie Joachim Kühl zu verbinden� Struve initiierte in den späten 1960er- Jahren in Anlehnung an Carl Schuchardt und Hofmeister ein „Burgenvermessungsprogramm“, dessen Ziel
13 Zum Folgenden vgl� auch den Beitrag von Rainer Atzbach in diesem Band�14 Z� B� Madsen, Grimsborg� – Hertz, Trøjborg� – Ders�, Kogsbøl Voldsted� –
Kock/Kristiansen, Skjern� – Krants Larsen, Tønderhus�15 Ericsson, Wehrbauten� – Kock, Dendrochronological dating� – Skaarup, Mid-
delalderlige borge� – Etting, Royal Castles�16 Hofmeister, Wehranlagen, S� 1ff�17 Vasiliadis, Motten, S� 58ff� – Prange, Sterley� – Langenheim, Müggenburg�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 55
es war, die Burgen im Zuge einer systematischen und flächendeckenden Auf-nahme als elementare Komponente der mittelalterlichen Siedlungslandschaft darzustellen� Allerdings sind die Ergebnisse nur für die slawischen Anlagen ver-öffentlicht worden�18 Die programmatischen Grundlagen hierfür fasste Struve 1973 in einem kurzen Aufsatz zusammen, Teilergebnisse für die mittelalterli-chen Burgen sind publiziert�19 Die Einrichtung eines Sonderforschungsberei-ches (SFB 17) bescherte auch der Burgenforschung einen Auftrieb, standen doch nun neben der Erstellung eines Burgwallcorpus auch Grabungen an aus-gewählten Plätzen im Mittelpunkt� Neben Struve ist Hinz zu nennen, der sich als Mittelalterarchäologe dieses Themas annahm� Unter seiner Leitung wurden ab 1972 in der Gemeinde Blekendorf die slawische Burganlage „Hochborre“ und die beiden Motten „Großer“ und „Kleiner Schlichtenberg“ untersucht und von Ericsson mustergültig vorgelegt�20 Hinz selbst stellte die beiden Bur-gentypen „Motte und Donjon“ in einen europäischen Zusammenhang�21
Parallel zu diesen Unternehmungen kam es auch von Seiten der archäolo-gischen Denkmalpflege zu Untersuchungen� Hierzu gehören beispielsweise Grabungen in Leck, an der Haneburg bei Wester- Ohrstedt, in Ramsdorf, der „Curia Eckhorst“ oder die umfassenden Untersuchungen an der Hatzburg bei Wedel�22 Eine umfangreiche Grabungstätigkeit entwickelte Kühl, der unter an-derem die Anlagen von Bargfeld- Stegen, Havekost, Steinburg- Eichede/Slamer-sekede und Travenhorst untersuchte�23 Neben Turmhügelburgen standen auch spätmittelalterlich- neuzeitliche Anlagen im Fokus, zu denen unter anderem Wensin- Garbek und Roseburg- Wotersen gehören�24 Nicht alle diese Plätze wur-den umfassend publiziert, für viele von ihnen existieren lediglich Vorberichte�
Trotz dieser vergleichsweise umfangreichen Arbeiten steht eine kompara-tive Vorlage und Analyse der Burgen des hohen und späten Mittelalters aus� Nach den Studien aus der ersten Hälfte des 20� Jahrhunderts unternahm In-geborg Leister 1952 den Versuch, die Entwicklung der Gutsherrschaft auch vor dem Hintergrund der mittelalterlichen Burgen darzustellen, und Hans Riediger und Bernd Köhler behandelten 1967 die „Feldsteinkirchen, Burgen und Herrensitze“ insbesondere in Stormarn, dem Herzogtum- Lauenburg und Ostholstein�25 Ausgehend von den Arbeiten durch Struve und in Futterkamp
18 Struve, Burgen�19 Struve, Burgenorganisation� – Ders�, Burgwallcorpus�20 Ericsson, Futterkamp 1� – Ders�, Futterkamp 2� – Ders�, Vom Slawischen
Burgwall�21 Hinz, Motte�22 Reichstein, Leckhus� – Hingst, Ramsdorf� – Ders�, Haneburg� – Bokelmann,
Eckhorst� – Neuß- Aniol, Hatzburg bei Wedel�23 Kühl, Burg Stegen� – Ders�, Havekost� – Ders�, Slamersekede� – Ders�, Travenhorst�24 Struve, Garbek� – Porath, Wotersen�25 Leister, Rittersitz� – Riediger/Köhler, Burgen und Herrensitze�
Lizenziert für U. Müller
56 Ulrich Müller
untersuchte Ericsson in diachroner Perspektive die Burgenentwicklung in Schleswig- Holstein und band diese vergleichend in den Ostseeraum ein�26
Von besonderer Bedeutung ist der „Burgwallkatalog“ im Archäologi-schen Landesmuseum, der federführend durch Struve seit den 1960er- Jahren erstellt wurde�27 Er enthält eine Vielzahl von Informationen zur Lage der Morphologie, den schriftlichen Quellen und weitere Angaben� Die nach Alt- Kreisen gesammelten Informationen füllen rund 40 Ordner und Karteikäs-ten� Die Daten sind bislang nicht ausgewertet� Neben dem Burgwallcorpus wurde im Rahmen des SFB 17 durch Helge Seider ein Manuskript erstellt, das für Ostholstein und Plön die historischen Quellen für die bekannten Burgen nennt und auswertet�28
In der Folgezeit sind immer wieder regionale Zusammenstellungen er-schienen, doch war es Arthur Dähn vorbehalten, in seiner Monographie 412 Anlagen aufzuführen, wobei hier auch frühmittelalterliche Ringwälle be-rücksichtigt wurden�29 Die aktuelle Landesaufnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig- Holstein verzeichnet rund 500 Anlagen�
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zahlreiche und unterschiedliche Daten vorliegen, die zu ganz unterschiedlichen Wissensdomänen gehören�
1� Der Anteil flächig untersuchter Anlagen ist überschaubar� Mitunter sind weniger die Turmhügel als solche, wohl aber die Zugangswege (u� a� Brü-cken) oder Befestigungsstrukturen (Palisaden) erfasst�
2� An erstaunlich vielen Plätzen sind kleinere Untersuchungen (Wallschnitt, Sondagen) vorgenommen worden�
3� Sehr zahlreich sind mehr oder minder exakte Aufmessungen, die heute durch das Hinzuziehen der Laserscandaten noch einmal deutlich kontex-tualisiert werden können�
4� Geophysikalische Prospektionen sind verhältnismäßig wenig erfolgt� In jüngster Zeit wurde beispielsweise die Anlage von Tangstedt geomagne-tisch untersucht�30 Bohrungen erfolgten unter anderem an der Motte von Kühren („Goldberg“)� Umfangreiche interdisziplinäre Untersuchungen fanden auch an der Motte von Lütjensee statt�31
26 Ericsson, Mittelalterliche Wehrbauten� – Ders�, Wehrbauten�27 Mein Dank geht an Dr� Ralf Bleile, Stv� Direktor des Archäologischen Lan-
desmuseums Schles wig, der mir die Einsicht in die Kartei ermöglichte� Hinweise auch bei Struve, Burgwallcorpus�
28 Seider, Burgen in Schleswig- Holstein�29 Z�B� Hennigs, Stormarn� – Risch, Pinneberg� – Bonsen, Schwansen� – Dähn,
Turmhügel�30 http://www�golfanlage- wulfsmuehle�de/wp- content/uploads/2013/02/01_ Vermutete_
Burg_Neu fassung_B_07�05�201024�01�11�pdf [Letzter Zugriff: 11�9�2014]�31 Fischer u� a�, Lütjensee�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 57
2.2. Burgentypologie
Der Versuch, Burgentypen zu definieren, ist so alt wie die Burgenforschung� Stellvertretend kann sicherlich das Burgenbuch von Otto Piper genannt wer-den, symptomatisch ist die Diskussion um den Typ des Donjons und der Motte�32 Die neuere Burgenforschung stellt zu Recht die Frage, ob und in welchem Umfang eine Burgentypologie noch zeitgemäß ist�
Wie auch andernorts nimmt in der schleswig- holsteinischen Literatur die Frage der Typisierung einen breiten Raum ein� Klassisch sind topografische Merkmale, die „Höhenburgen“ fff von „Niederungsburgen“ unterscheiden, wobei für erstere wohl am ehesten die Burg in Bad Segeberg genannt wer-den kann� Ebenfalls anzutreffen sind landschaftlich- „ethnische“ Bindungen, wenn auf „dänische“ Burgen nördlich der Eider und auf Fehmarn, auf „frie-sische“ Burgen oder die Anlagen in den Kolonisationsgebieten hingewiesen wird� Die Ansprache als „Volks- “, „Flucht- “ oder „Herrenburgen“ findet sich vor allem in der Literatur bis in die 1970er- Jahre�33 Erschwert wird die Diskussion durch den Rekurs auf Quellenbezeichnungen, insbesonde-re castrum und curia�34 Diese stehen allerdings nicht nur für unterschiedli-che Bautypen, sondern soziopolitische bzw� –ökonomische Konstellationen� Ähnliches gilt auch für die Unterscheidung in hoch- und niederadelige An-lagen oder „Bischofsburgen“, „königliche“, „landesherrliche“ Burgen oder Anlagen der „Raubritter“�
Häufiger anzutreffen sind funktionale Typologien�35 In der älteren Litera-tur erscheint vielfach die Bezeichnung „Wasserburg“� Darunter wurde nicht nur eine Turmhügelburg mit Wassergraben verstanden, sondern auch noch mehrteilige Anlagen sowie „nach Art der Wasserburgen geschützte Gutshö-fe“ bezeichnet�36 Zeitgemäßer erscheint die Unterscheidung in Turmburgen und Turmhügelburgen� Erstere sind insbesondere in den nördlichen Landes-teilen als steinerne Turmburgen anzutreffen�37 Die genaue Datierung und Ansprache gestaltet sich in den meisten Fällen schwierig, so dass man nicht ohne weiteres eine Unterscheidung in einen unbewohnten Bergfried und ei-nen Wohnturm bzw� Donjon vornehmen kann� Festhalten lässt sich, dass Turmburgen bzw� frühe Donjons in Schleswig- Holstein eher die Ausnah-me bilden und in ihrer Verbreitung den dänischen Einfluss widerspiegeln� Inwieweit die Steinbauten jedoch hölzerne Vorläufer hatten, ist meistens unbekannt�
32 Felgenhauer- Schmiedt u� a�, Forschungsstand� – Piper, Burgenkunde�33 Leister, Rittersitz, passim� – Riediger/Köhler, Burgen und Herrensitze, passim� 34 Leister, Rittersitz, S� 19- 32� 35 Zuletzt Risch, Form und Funktion�36 Riediger/Köhler, Burgen und Herrensitze, S� 66�37 Radtke, Oldenburg� – Ericsson, Wehrbauten� – Etting, Royal Castles�
Lizenziert für U. Müller
58 Ulrich Müller
Naturgemäß nimmt die Diskussion um das „château de motte“ den meisten Raum ein, handelt es sich bei den Anlagen in Schleswig- Holstein doch über-wiegend um diesen Typ� Nach Hinz und Ericsson ist eine Motte eine Anlage, die auf einem künstlich aufgeschütteten Erdhügel errichtet wurde und meist eine runde, seltener ovale oder rechteckig- quadratische Grundform besaß�38 Auf dem Hügel befanden sich meist ein Turm oder ein vergleichbares Bau-werk, weitere Bauten konnten hinzukommen� Der Hügel wurde von einem oder mehreren Gräben umfasst und die Vorburg war in der Regel vorgelagert� Die ebenfalls übliche Bezeichnung „Turmhügelburg“ meint den Bau auf einer natürlichen Erhebung�39 Die aktuelle Diskussion hat gezeigt, dass sich Kriteri-en wie die künstliche Hügelaufschüttung und die Innenbebauung im Grunde nur durch Prospektionen bzw� Grabungen verifizieren lassen� Mit dem Typ der „Motte“ oder „Turmhügelburg“ ist europaweit eine lange Forschungs-tradition und nicht zuletzt facettenreiche Diskussion ihrer formalen Anspra-che und Genese verbunden� Der kleinste gemeinsame Nenner ist wohl, dass es sich um eine turmartige Anlage handelt, die auf einem künstlich aufgeschüt-teten oder vergrößerten Hügel errichtet wurde�40 Die weiteren Merkmale – Wall- Grabensysteme, Vorburg oder Nebengebäude – sind häufig anzutreffen; eine Entwicklung von einer „Flachmotte“ hin zu einer „Hochmotte“ ist in Schleswig- Holstein beispielsweise kaum nachgewiesen�41
In Schleswig- Holstein setzt nach gegenwärtigem Forschungsstand der Mottenbau im 13� Jahrhundert ein� Räumliche Schwerpunkte liegen in den Gebieten des Landesausbaues� Die konstruktiven Lösungen sind wie andern-orts vielfältig und folgen sowohl den naturräumlichen Gegebenheiten als auch den funktionalen Ansprüchen� Als gut untersuchte und datierte Anlage kann neben den Motten vom Schlichtenberg die Hatzburg gelten� Nach ab-schließender Vorlage der Grabungen aus Havekost wird man über diese ver-schiedentlich rekonstruierte Anlage besser unterrichtet sein (Abb� 1,1- 2)�42 Nach wie vor sind wir sowohl über das gesamte Erscheinungsbild als auch über konstruktive Details erstaunlich wenig informiert� Nicht umsonst ori-entierte man sich bei der Errichtung der Anlage in Lütjenburg an zahlreichen archäologischen, bildlichen und schriftlichen Vorbildern�43
Die intensive Diskussion um die Motte/Turmhügelburg wird in Nord-deutschland noch um die „Kemlade“ bereichert: Anlagen, die auf einer
38 Hinz, Motte, S� 23- 33�39 Ebd�, S� 70�40 Ericsson, Futterkamp 2, S� 115�41 Struve, Burgenentwicklung, S� 103�42 Kühl, Havekost� – Jarchov, Havekost�43 Kühl, Slamersekede, S� 117, Abb� 4� – Dähn, Turmhügel, S� 402� – Friedhoff,
Lebendiges Mittelalter�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 59
künstlichen Insel oder im ufernahen Bereich errichtet wurden� Walter Bas-tian, der sich als erster intensiv mit diesem Typ auseinandersetzte, fasste unter diesem Begriff in Blockbautechnik errichtete Pfahlbauten an limni-schen Standorten zusammen und unterschied drei Typen�44 Weiterhin sah er ihre Errichtung im Kontext der Zerstörung von landfesten Anlagen der „Raubritter“ in Norddeutschland zwischen 1306 und 1361� Struve griff die Anregungen von Bastian auf und konnte in Schleswig- Holstein entsprechen-de Anlagen identifizieren�45 Ericsson versteht unter Kemlade eine befestigte Siedlung auf einer oder mehreren künstlichen Inseln, die in der Regel Türme oder turmähnliche Gebäude aufweist�46 Motte und Kemlade sind demnach mit Ausnahme ihres Standortes weitgehend identische konstruktive Lösun-gen, letztere erscheinen aber nicht zeitgleich mit dem frühen Auftreten der Motten�47 Valentin Mayr hat 1998 die Kemlade einer kritischen Betrachtung unterzogen, die am überlieferten Befund ansetzte und als kleinsten gemeinsa-men Nenner die „Pfahlsetzungen im Freiwasser oder Ufersaum“ mit unter-schiedlichen Aufbauten herausstellte�48 Topographisch fügt sich die Kemlade in den Typ von Siedlungen an limnischen Standorten ein�
Unter den Anlagen in Schleswig- Holstein ist an erster Stelle sicherlich auf die Anlage in Travenhorst hinzuweisen, die Kühl in einem Vorbericht prä-sentierte (Abb� 2)�49 In der Rekonstruktion erscheint ein zweigeschossiger Bau mit Walmdach, der auf einem Plateau in Ständer- und Rahmenbauweise im frühen 14� Jahrhundert errichtet worden ist� Der Platz zeigt nicht zu-letzt, dass mit der Errichtung derartiger Anlagen auch im Nieder- und Über-schwemmungsbereich zu rechnen ist� Hinzu kommen neue Datierungen� So scheint die Anlage im Stolper See aufgrund der Dendrodaten in das 12� Jahrhundert zu gehören�50 Damit ist zu fragen, ob es sich um eine Kemlade handelt oder eher eine spätslawische bzw� kolonisationszeitliche Burg erfasst wird� Auch die Befunde aus Wahlstorf sind kritisch zu sehen, denn sie wei-sen lediglich auf eine seeseitige Pfahlkonstruktion einer ansonsten landseitig errichteten Anlage hin�51 Auch die enge soziopolitische Eingrenzung ist nach Mayr zu hinterfragen�52
44 Bastian, Kemladenforschung, S� 103�45 Struve, Pfahlbauten�46 Ericsson, Wehrbauten, S� 260�47 Ebd�, S� 261�48 Mayr, Kemladen, S� 87�49 Kühl, Travenhorst, S� 28, Abb� 9�50 Lüth, Siedlungslandschaft, S� 159ff�51 Ebd�, 164f�52 Mayr, Kemladen, S� 96�
Lizenziert für U. Müller
60 Ulrich Müller
Neben den Motten/Turmhügelburgen und den Kemladen finden sich in Schleswig- Holstein auch profane Einzelbauten aus Stein meist rechteckiger Kubatur, die häufig als curia angesprochen werden� Leister definierte als cu-ria einen Typ, der zwischen castrum und Bauernhof angesiedelt ist, keinen Bergfried, aber eine Umwehrung besitzt�53 Ein Problem ist dabei allerdings, was für eine bauliche Struktur denn konkret eine curia beinhaltet� Bauar-chäologisch wird vielfach von einem „Festen Haus“ gesprochen� Der Termi-nus „Festes Haus“ meint ein aus Stein bzw� Backstein errichtetes massives Gebäude, das zu Wohn- , Wehr- und Repräsentationszwecken diente� Dieser Bautyp lässt sich seit dem 10� Jahrhundert nachweisen und findet Eingang in die Burgenarchitektur� Eine neuerliche Blüte erlebt das „Feste Haus“ mit Ausgang des Spätmittelalters und zu Beginn der Frühen Neuzeit, wo es zu-nehmend die mehrgliedrige Burg ablöst� Aufgrund des relativ schlechten Forschungsstandes ist die Kenntnis über diesen Typ im späten Mittelalter Nordeuropas beschränkt�54 So bleibt nicht nur die genaue zeitliche Einord-nung, sondern auch die Abgrenzung von „normalen“ Steinbauten des ländli-chen oder städtischen Raumes schwierig� Weiterhin sind feste Häuser des 16� und 17� Jahrhunderts nicht zwingend Steinbauten, sondern können auch in Holz- Steinbauweise oder als Fachwerkbau ausgeführt worden sein� Ähnlich schwierig sind auch die Bezeichnungen „befestigter Hof“ sowie „Herren-haus“� Wird man ersteren noch durch ein Wall- oder Grabensystem sowie die Mehrteiligkeit umgrenzen können, so bezeichnet Herrenhaus zumindest in der frühen Neuzeit den Mittelpunkt eines Gutes� Eine deutliche funktio-nale wie bauhistorisch- architektonische Abgrenzung vom massiven Wohn-haus ist mitunter ebenso schwierig wie vom Schloss�
2.3. Archäologischer Befund und historisches Ereignis
Eine möglichst genaue Datierung der Errichtungs- und Umbauphasen sowie der Aufgabe oder Zerstörung von Burgen ist für die historische Kontextu-alisierung unabdingbar� Der vorherrschende Bautyp der Motte/Turmhügel-burg ist überwiegend eine Holzkonstruktion, und die vielfach anzutreffende Feuchtbodenerhaltung sollte ihr Übriges tun, damit man zu einer vali-den Datengrundlage gelangt�55 Dem steht jedoch der oben skizzierte For-schungsstand gegenüber, denn nur wenige Anlagen sind durch Dendrodaten abgesichert� Die Datierung stützt sich nach wie vor weitgehend auf Fund-material und hier insbesondere auf Keramik� Vergleichend oder ergänzend
53 Bokelmann, Eckhorst, S� 153� – Kühl, Travenhorst, S� 53f� – Leister, Ritter-sitz, S� 24�
54 Ericsson, Wehrbauten, S� 249- 269�55 Siehe zu Dänemark Kock, Dendrochronlogical dating�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 61
werden weitere Fundgruppen hinzugezogen� Ein generelles und nicht allein auf Schleswig- Holstein beschränktes Problem ist dabei der Befundkontext der Funde� Für eine präzise Datierung sollten die Funde aus stratifizierten Schichten stammen, also beispielsweise Bau- oder Abbruchhorizonten zu-zuweisen sein� Dies ist in der Regel nur selten der Fall� Die Mehrzahl des Fundmaterials stammt meist aus der Verfüllung, die kaum eine Stratigra-fie aufweist� Eine Korrelation dieser Funde mit Bau- und Nutzungsphasen ist natürlich möglich, setzt aber in der Regel eine flächige Ausgrabung vo-raus� Eine exakte Datierung auf der Grundlage der Keramik ist ebenfalls nicht ganz unproblematisch� Die Keramikchronologie des hohen und späten Mittelalters in Schleswig- Holstein stützt sich weitgehend auf die Daten aus Schleswig und Lübeck, doch beziehen sich Untersuchungen von Burgen bis in die 1980er- Jahre hinein auf ein weitgehend veraltetes Chronologiegerüst� In den letzten Jahrzehnten ist die Forschung weiter vorangeschritten und hat neue Perspektiven eröffnet, so dass für manche „Altgrabungen“ mit einer veränderten Datierung zu rechnen sein wird�
Nur in wenigen Fällen stützt sich die Datierung auf dendrochronologi-sche oder radiometrische Daten� Die gute Feuchtbodenerhaltung der Hatz-burg oder der Burg in Travenhorst, die Brückentrassen in Ramsdorf oder zur Fasaneninsel im Eutiner See boten Grundlagen für präzise und mit-unter hoch auflösende Daten� Mit den Befunden aus dem Burgkloster in Lübeck liegen ebenfalls valide Dendrodaten zur landesherrlichen Burg des 12� Jahrhunderts vor�56 Sehr frühe Daten hat die Motte aus Lütjensee gelie-fert� Die14C- Daten aus dem Burggraben erbrachten in einem Bohrkern das Intervall zwischen cal� 990- 1160 AD sowie cal� 1030- 1160 AD aus einer Holzprobe�57 Die Autoren gehen davon aus, dass damit ein Bau des 11�/12� Jahrhunderts datiert wird�
Da massiver Steinbau an Burgen in Schleswig- Holstein selten anzutreffen und zudem aufgehendes Mauerwerk kaum erhalten ist, treten bauhistorische Datierungen und Analogien in den Hintergrund�58 Insgesamt ist festzuhal-ten, dass die archäologisch gut untersuchten Burgen auch entsprechend gut datiert sind� Weitaus schwieriger gestaltet sich die Analyse von Anlagen, die nur ausschnittsweise oder gar nicht untersucht sind�
Es bleibt der Blick auf das schriftliche Datum� Im Jahre 1255 wird in einem Vertrag zwischen dem Grafen von Holstein und der Stadt Lübeck ge-gen die Buchwalds auf Gosefeld das castrum Gosevelde genannt�59 Dies gilt auch als bislang ältester Hinweis auf den hochmittelalterlichen Burgenbau�
56 Gläser, Lübecker Befestigungen, S� 274ff� – Dubisch u� a�, Burghügel, S� 52- 57�57 Fischer u� a�, Lütjensee, S� 185, Abb� 4�58 Vgl� z� B� Radtke, Oldenburg� 59 Hofmeister, Wehranlangen, S� 58, 67� – Leister, Rittersitz, S� 21�
Lizenziert für U. Müller
62 Ulrich Müller
Der rund 50 Jahre später erfolgte Schiedsspruch von König Erich VII� aus dem Jahre 1310 nennt barfred, also Bergfriede�60 Die Motte in Stove am schwarzen See wurde in einem Kaufvertrag von 1377 als curia cum fortalicio tituliert und nach dem Ausbau unter Bischof Heinrich als castrum bezeich-net�61 Der Wohnturm der Motte in Carlow wurde in Urkunden fortalicum oder propugnaculum genannt�62 Diese Angaben sind wichtig, doch stellen sie eine historisch- archäologische Auswertung auch vor Probleme, wenn nach der Korrelation von schriftlichem Datum und archäologischem Befund ge-fragt wird� Trotz einer vergleichsweise genauen Überlieferung bleibt auf die häufige Diskrepanz zwischen archäologischen Daten und der Erwähnung in Schriftquellen hinzuweisen� So kann anhand der Schriftquellen die Er-richtungszeit für die Motte von Lütjensee um oder nach 1300 eingegrenzt werden� Dem schriftlichen Datum 1311 sind aber die14C- Daten gegenüber-zustellen, die Burgphasen für das 11�/12� Jahrhundert vermuten lassen�63 Auch für zahlreiche weitere Anlagen ließen sich Beispiele anführen, so dass in einem erheblichen Umfang mit frühen Datierungen zu rechnen sein wird� Dies wiederum ist für eine soziopolitische Interpretation, die beispielsweise nach der Entwicklung der Ritterschaft fragt, von weitreichender Bedeutung� In den Schriftquellen wird vielfach zwischen curia und castrum differenziert� So werden in Stegen curia castri Steghen oder die villam Grobenitze cum curia et castro et omnibus edificiis et molendino in curia genannt, was auf eine bauliche und topografische Differenzierung hindeutet�64 Nicht nur die Bauten, auch ihre Errichter oder Bewohner finden Eingang in die schriftliche Überlieferung� Frühe Studien liegen von Leister und Heinz Wolfgang Prehn vor� Vor allem Leister brachte die curia und ihre Entwicklung mit spezifi-schen Besitzformen in Verbindung�65 Diese rechtshistorische Ansprache wird man vor dem Hintergrund der dünnen Quellenlage sicherlich heute anders bewerten, doch bleibt die wichtige Erkenntnis, dass sowohl castrum als auch curia auf dem Weg zum Schloss und Gutshof wichtige Etappen darstellen� Neben diesen Arbeiten sind umfangreichere Analysen von Ulrich Lange über die Grundlagen der Landesherrschaft der Schauenburger in Holstein, die Veröffentlichung von Ulrich March über die holsteinische Heeresorganisa-tion sowie Kai Fuhrmanns Monographie über die Ritterschaft als politische Korporation vorgelegt worden, einen neuerlichen Impuls hat die Forschung
60 Ebd�, S� 20�61 Hofmeister, Wehranlagen, S� 22f�62 Ebd�, S� 27�63 Fischer u� a�, Lütjensee, S� 186�64 Leister, Rittersitz, S� 31ff� 65 Ebd�, S� 31�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 63
jüngst durch die Arbeit von Hans Gerhard Risch zum holsteinischen Adel erhalten�66
Somit scheint es ganz selbstverständlich zu sein, archäologische Befunde und schriftliche Quellen zu korrelieren� Gerade für die historische Archäo-logie ist die Verdichtung der Quellen und die Parallelüberlieferung durch die schriftlichen Quellen jedoch eine Herausforderung� Nach landläufiger Mei-nung braucht die Historische Archäologie „historische“ Daten, um die Be-funde mit Ereignissen wie der Errichtung oder Zerstörung von Burgen oder den „Burgbewohnern“ zu verbinden� Umgekehrt soll der archäologische Be-fund Angaben zum Aussehen einer Burg, eine genauere Datierung oder die Verknüpfbarkeit mit historisch überlieferten Fakten gewährleisten� Schließ-lich soll das Fundmaterial möglichst noch Einblicke in die entsprechenden Lebenswelten und sozialen Praxen ermöglichen� Ebenfalls gewünscht ist die Identifikation eines im Gelände bekannten Burgenstandortes mit schriftli-chen Angaben� Dies gestaltet sich in der Regel weniger banal als gemeinhin angenommen� Denn neben Anlagen, die mit Hilfe schriftlicher Quellen ein-deutig belegt werden können, gibt es solche, die sich möglicherweise mit schriftlichen Quellen in Verbindung bringen lassen und nicht zuletzt jene, zu denen keine schriftliche Überlieferung bekannt ist� Beispiele lassen sich zahlreiche anführen�67
Festzuhalten bleibt, dass die Angaben in den Schriftquellen vielfältig und auch vor dem Hintergrund des archäologischen Befundes nicht einfach zu verstehen sind� Das Potential der schriftlichen Quellen liegt meines Erach-tens vor allem im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit� Gerade die verstärkt einsetzende Verschriftlichung administrativer Vorgänge liefert ein dichtes Bild, das über biographische oder prosopographische Zugänge hin-aus auch sozial- oder wirtschaftshistorische Vorgänge aufklären kann�
3. Burgenlandschaften und Burgennutzer
Schleswig- Holstein zeichnet sich durch sehr unterschiedliche „Burgenland-schaften“ aus�68 Versteht man Landschaft als Teil des relationalen Raumes im Sinne von Martina Löw, so stellt sich die Burgenlandschaft als ein dynami-sches Gebilde aus materiellen und symbolischen Komponenten dar, welches in Handlungsabläufe integriert ist�69 Dabei bildet das Errichten und materi-elle wie immaterielle Positionieren von Burgen einen Teil des sogenannten
66 Prehn, Altholstein� – Lange, Landesherrschaft� – March, Heeresorganisation� – Fuhrmann, Ritterschaft� – Risch, Adel�
67 Z� B� Bock, Eichede� – Risch, Lütjensee� – Bokelmann, Eckhorst�68 Zum Begriff „Burgenlandschaft“ z� B� Höfle/Wagener, Landschaft�69 Löw, Raumsoziologie�
Lizenziert für U. Müller
64 Ulrich Müller
„spacing“- Prozesses, der in einer Wechselwirkung zur eigentlichen Synthese-leistung steht – Wahrnehmungs- , Vorstellungs- und Erinnerungsprozesse –, welche die Räume konstituieren�
Raum wird somit auch Austragungsort von Machtverhältnissen und so-zialen Differenzierungen – in geografisch- physischer wie auch symbolischer Sicht� Für Schleswig- Holstein lassen sich durchaus unterschiedliche geogra-fische Regionen erkennen, die durch komplexe historische Entwicklungen geprägt sind� Mit dem Herzogtum Schleswig einerseits und der Grafschaft Holstein/dem Herzogtum Holstein andererseits existieren zwei völlig unter-schiedliche Herrschafts- und Rechtsräume� Mit der Grafschaft Ratzeburg und der askanischen Herrschaft existierte lange Zeit ein reichsunmittelbares Herzogtum mit ebenfalls spezifischen Bedingungen� Eine Besonderheit stel-len Nordfriesland und Dithmarschen dar, die nahezu „burgenfrei“ sind und in denen kein Adel im eigentlichen Sinne nachzuweisen ist�
Trotz vieler Gemeinsamkeiten können in diesen Regionen durchaus spe-zifische Rahmenbedingungen bezüglich Herrschaftskonsolidierung, Vasalli-tät und Burgenrecht angenommen werden� So untersagte beispielsweise ein Erlass der Königin Margrete I� von Dänemark zwischen 1396 und 1483 den Bau privater, befestigter Wohnsitze�70 Dies dürfte sicher die Burgen-landschaft im Herzogtum Schleswig mitgeprägt haben, denn in den Regio-nen nördlich der Eider sind niederadelige Burgen kaum und verhältnismäßig spät anzutreffen� Weiterhin hat es in Dänemark wohl den Bau von „Festen Häusern“ gefördert� Anders stellt sich das Bild in den Gebieten der ehema-ligen slawischen Besiedlung und des Landesausbaus dar� Hier dominierten die Motten bzw� Turmhügelburgen als vorherrschende (niederadelige) Be-festigungen; im späten Mittelalter ist ein enormer Anstieg insbesondere in den Regionen des Landesausbaues zu erkennen� Es dürfte richtig sein, die Erbauer vor allem unter den niederen Adeligen zu suchen, selbst wenn im Einzelfall wohlhabende städtische Bürger am Burgenbau beteiligt waren�
Die Burgen zeichnen nicht zuletzt komplexe Prozesse der Formierung und Veränderung von Herrschaftsgrundlagen ab�71 So meint „landesherrlich“ nicht per se eine imposante Burg� Wenn beispielsweise Herzöge und Grafen Burgen errichten dürfen, so kündet dies nicht zuletzt auch von veränderten Handlungsspielräumen� Damit werden in Schleswig- Holstein unterschied-liche Räume und Konzepte einer Herrschaftskonsolidierung erkennbar, die im Sinne einer Machtverfestigung und zunehmend als Ausdruck eines Herr-schaftsanspruches zu interpretieren ist�
70 Ericsson, Wehrbauten, S� 264�71 Risch, Form und Funktion�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 65
3.1. Das Herzogtum Schleswig. Burgen im Schleswiger Landesteil
Das Herzogtum Schleswig nahm eine ganz eigene Entwicklung, die ihren Ausdruck auch in der Burgenlandschaft findet� Das dänische Königtum ex-pandierte insbesondere unter Waldemar I�, Knud IV� und Waldemar II� und versuchte damit an die Politik Knut Lawards anzuknüpfen, der nicht nur für das Land zwischen Eider und Königsau/Kongeå eine Sonderstellung im dä-nischen Reich schuf, sondern auch im slawischen Ostholstein regierte�72 Un-ter den Waldemaren wurde die dänische Vorherrschaft in Nordelbien weiter ausgebaut� Dänemark wurde weitgehend von einer starken Königsmacht regiert, wobei es allerdings innerhalb des Reiches zunehmend zu Differenzie-rungs- und Territorialisierungsprozessen kam� Dies zeigt sich insbesondere am Herzogtum Schleswig, das innerhalb des dänischen Reiches eine Sonder-stellung einnahm�73 Ob unter dem Jarltum Knut Lawards, den Waldemaren oder dem Abelgeschlecht – die Grenzlage zu Holstein und zum römisch- deutschen Reich förderte diesen Status, der sich zwischen Abschottung und Integration bewegte� Die Errichtung von Burgen war ein zentrales Element in der Herrschaftspolitik, doch stützte sich die Macht nicht unbedingt auf ein Netz von niederadeligen Burgen, sondern blieb auf die königlichen Anlagen und die Gefolgschaft beschränkt� Erst die schrittweise Ausbildung der Her-remannen und deren weitere Differenzierung zu einer Ritterschaft förderte die Errichtung niederadeliger Anlagen� Diese Entwicklung schlägt sich auch im Burgenbau nieder�74 Nicht zuletzt kommt es unter holsteinischer Herr-schaft (1326- 1459) zu erheblichen Erwerbungen des holsteinischen Adels in Schleswig und Dänemark� Somit entwickelte sich trotz vieler Gemeinsam-keiten im schleswigschen Landesteil eine ganz eigene Burgenlandschaft�75
Neben Ribe mit dem Ribehus und der Burg von Tøndern war Schleswig traditionell das „Tor zum Kontinent“ und für die dänische Südpolitik von weitreichender Bedeutung� Über das Danewerk und die Waldemarsmauer sowie die frühe Stadtentwicklung und deren Akteure ist viel geschrieben worden� Darüber hinaus wurde immer wieder die Möweninsel als Stand-ort einer frühen Burg diskutiert� Bei der dortigen Burg könnte es sich um die schriftlich überlieferte Jürgensburg handeln, die nicht nur Kontrollpunkt des Hafens im 12� und in der ersten Hälfte des 13� Jahrhunderts gewesen war, sondern ebenso als Gefängnis und als Repräsentationsbau bei fürstli-chen Treffen und Hochzeiten diente� Der Platz ist jüngst wieder in den Blick-punkt gerückt und eine frühe Datierung sehr wahrscheinlich�76 Die Schlei als
72 Etting, Royal Castles, S� 15- 20, 29- 38�73 Poulsen, Tiden�74 Radtke, Turmhügelburgen�75 Poulsen, Tiden, S� 410�76 Rösch u� a�, Jürgensburg�
Lizenziert für U. Müller
66 Ulrich Müller
Handels- und Kommunikationsweg war zudem durch eine Vielzahl von Bur-gen und Schiffssperren gesichert�77 Zu der Burgenkette entlang der Schlei ge-hörte auch die Oldenburg oder Gammelborg zwischen Schleimündung und dem Hafen Olpenitz� Sie soll aus den Zeiten Knut Lawards stammen und wird 1132 schriftlich erwähnt�78 Weitere Informationen, Karten und Zeich-nungen sowie Fundbeobachtungen der Neuzeit lassen den Schluss zu, dass es sich um einen steinernen Rundturm gehandelt hat, dessen Funktion Christi-an Radtke als „Zollaußenstelle“ charakterisiert�79 Aufgrund vergleichbarer Anlagen in Dänemark sowie der Analyse der schriftlichen Quellen datiert Radtke das Bauwerk in die 20er- Jahre des 12� Jahrhunderts�80
Weitere schriftlich bezeugte Anlagen der schleswigschen Herzöge finden sich unter anderem im 14� Jahrhundert in Flensburg, Sonderburg/Sønderborg, Apenrade/Åbenrå und Tondern/Tønderhus�81 Nicht an allen Plätzen erfolg-ten archäologische Untersuchungen� Westlich von Hadersleben lag Tørning borg� Die 1331 ersturkundlich erwähnte Burg sicherte die Wege zwischen Nordschleswig und dem nördlichen Jütland� Sie war Sitz eines königlich- herzoglichen Lehensmannes� Die bedeutende Anlage könnte ebenfalls Vor-läufer im 11�/12� Jahrhundert besessen haben und wurde in der zweiten Hälfte des 15� Jahrhunderts aufgegeben�82 Von Bedeutung für die Forschung ist Flensburg, welches sich im Herzogtum Schleswig bereits früh zu einer Handelsstadt entwickelte� Die Standorte früher Burgen wurden dementspre-chend intensiv diskutiert�83 Für die landesherrliche Burg wird ein Standort nördlich von St� Johannis vermutet� Die auf dem Flensburger Stadtsiegel – um 1300 datierend – dargestellte achteckige Turmburg veranlasste Hans- Friedrich Schütt zu Überlegungen, die „Flensburg“ im Bereich St� Marien zu lokalisieren�84 Aufgrund spätmittelalterlicher Abbildungen wäre es möglich, dass der Standort einer Burg an der Nordostecke der Stadtbefestigung und des späteren Bergfriedes zu suchen ist� Inwieweit es sich bei den Anlagen um frühe Burgen des 12� Jahrhunderts handelt ist allerdings fraglich�
Das Leckhus bei Leck war Sitz eines königlichen Vogtes; archäologische Untersuchungen fanden in den 1950er- sowie 1970er- Jahren statt�85 Mög-licherweise hatte die Anlage bereits einen Vorläufer im 11� Jahrhundert�
77 Nakoinz, Schlei�78 Radtke, Oldenburg�79 Ebd�, S� 348�80 Ebd�, S� 346�81 Poulsen, Tiden, S� 510� – Etting, Royal Castles, S� 54�82 Meier, Im hohen und späten Mittelalter, S� 66� – Gregersen, Tørning� 83 Harck, Grundtypen, S� 149ff� – Schütt, Flensburg S� 31- 35�84 Schütt, Turmbau� 85 Reichstein, Leckhus� – Dähn, Turmhügel, S� 143�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 67
Als eine weitere landesherrliche Burg, die angeblich auf Knut Laward zu-rückgehen soll, ist Stubbe bei Rieseby anzuführen� Bei der südöstlich des Herrenhauses gelegenen Anlage handelt es sich um eine Turmhügelburg mit Steinfundamentierung, die durch Wall- Grabensystem umschlossen wird� Eine Burg wird 1332 erwähnt; nach ihrer Zerstörung 1410 soll eine neue Burg errichtet worden sein, die ein Vorgänger des Gutes Saxtorf war�86
Unter den dänenzeitlichen Burgen im östlichen Holstein sind Segeberg so-wie die Standorte auf Fehmarn erwähnenswert� Die Anlage auf dem Kalk-berg mit ihren mansiunculas markiert den Versuch Knut Lawards, auch in Ostholstein Fuß zu fassen� Sie wurde allerdings 1131 zerstört�87 Eine Burg auf der Insel Fehmarn wird 1231 als castrum erwähnt, die Insel zählte seit Waldemar II� zum dänischen Besitz� Begehungen und kleinere Grabungen lassen zwei Standorte vermuten�88 Die Untersuchungen deuten auf einen Steinbau, der mit Sicherheit nicht slawenzeitlich gewesen ist� Seine Funktion wird man in der Sicherung des Küstenabschnittes sehen dürfen� Waldemars-zeitlich ist auch die Anlage von Glambek, die wohl 1210 für den dänischen Amtsverwalter gebaut und im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde�89 Es handelt sich um eine rechteckige Anlage (53 x 36 m), die von einem Was-sergraben und einem flachen Wall umgeben ist� Die Anfang des 20� Jahr-hunderts wiedererrichtete Burg weist in der nordöstlichen Ecke Reste des quadratischen Bergfrieds (11 x 11 m) und der Ringmauer auf�
Neben den königlichen und landesherrlichen Anlagen sind noch die Burgen der Bischöfe erwähnenswert� Hierzu gehören Befestigungen in Schwabstedt und Alt- Gottorf, die den Schleswiger Bischöfen gehörten sowie die Anla-gen der Ripener Bischöfe (Brink, Møgeltønderhus)� Für Schwabstedt ist am Nordufer der Treene der Standort einer Turmhügelburg bekannt, die mög-licherweise mit der Burg der Schleswiger Bischöfe in Verbindung gebracht werden kann� Diese wird urkundlich für das 14� Jahrhundert überliefert�90 Besser informiert sind wir über die Burg in Alt- Gottorf bei Gut Falkenberg (Abb� 3,1)�91 Nach August Sachs wurde die Burg 1161 zerstört, nach Vilhelm La Cour dagegen im Jahr 1182 erbaut und erst 1193 zerstört� Die zwei-teilige Anlage besteht aus der 2100 qm großen Hauptburg sowie der rund 1400 qm großen Vorburg, die sich beide 6- 8 m in der Landschaft erheben (Abb� 3,2)� Als weitere Anlage ist Treia (Abb� 4,1) am westlichen Treeneufer
86 Burgenkartei Struve Bd� IV, Stubbe�87 Erdmann- Degenhardt, Segeberg, S� 4- 9�88 Struve, Burgen, S� 25�89 Friedhoff, Lebendiges Mittelalter�90 Meyer, Schwabstedt� – Dähn, Turmhügel, S� 146�91 Burgenkartei Struve Bd� I, Falkenberg� – Struve, Burgwallcorpus, S� 101f� –
Dähn, Turmhügel, S� 356�
Lizenziert für U. Müller
68 Ulrich Müller
erwähnenswert, die als Zollstelle und zur Sicherung des Treeneüberganges diente�92 Diese ebenfalls zweiteilige Anlage ist wohl 1263 zerstört worden� Von der sogenannten Bischofsburg am westlichen Treeneufer sind noch die zwei oval- polygonale Hügel sowie ein Grabensystem erkennbar (Abb� 4,2)�
Bislang wenig im Blickpunkt standen die kleineren Burgen lokaler Herr-schaften� Sie konzentrieren sich in den Regionen an der Schlei und in An-geln, weniger häufig am westlichen Geestrand� Weiterhin finden sich gehäuft Anlagen in den Regionen nördlich von Hadersleben, auf Alsen sowie im Sundewitt� Im Umfeld von Flensburg befinden sich die Anlagen Niederhuus und Eddeboe�93 Von der Burganlage Niederhuus bei Niehuus, einer Mitte des 14� Jahrhundert überlieferten Anlage, sind im Gelände kaum noch Spu-ren erhalten�94 Die Anlage wurde zum Schutz Flensburgs von den Grafen Klaus und Heinrich errichtet, sie kam vorrübergehend in dänischen Besitz� Untersuchungen erfolgten nur ansatzweise, eine hölzerne Palisade konnte nachgewiesen werden� Ähnliches gilt auch für die Eddeboe (Junkernplatz) westlich von Flensburg, dem Stammsitz der Familie Jul�
Zahlreiche der landesherrlichen und/oder niederadeligen Burgen im südli-chen Schleswig sind archäologisch nicht weiter untersucht�95 Eine Ausnahme bildet, neben dem genannten Leckhus, die Haneburg bei Wester- Ohrstedt� Deutlich besser ist die Situation im nördlichen Schleswig�96 Hier sind neben der Troiburg/Trøjborg bei Visby und der Skodburg insbesondere die Adels-burg von Solvig nordöstlich von Tønder zu nennen� In Skodburg konnte unter anderem ein Steinfundament der Zeit um 1300 erfasst werden, die An-lage von Trøjborg ist noch als Ruine erhalten und wurde in der ersten Hälfte des 14� Jahrhundert auf einer künstlich angelegten, rund 30 x 30m großem Erhebung errichtet�97 Der quadratische, rund 12 x 12 m große Steinbau mit Innenhof wurde von zwei Gräben geschützt und ist ein gutes Beispiel einer donjonartigen Architektur� Ebenfalls in das frühe 14� Jahrhundert datiert ist die Burg Solvig bei Arnåen�98 In der ältesten Phase handelt es sich um einen rund 144 qm großen Hügel, auf dem ein Holzturm errichtet wurde� Etwas später, vermutlich in die Mitte des 14� Jahrhunderts, ist die Anlage von Nørrevold bei Arrild anzusetzen� Untersuchungen dieser nur kurzfristig bestehenden Burg belegen einen zentralen Turmhügel mit zwei Vorburgen�99
92 Gemeinde, Treia� – Dähn, Turmhügel, S� 370�93 Meier, Im hohen und späten Mittelalter, S� 67�94 Ebd�, S� 66f� – Dähn, Turmhügel, S� 353�95 Vgl� Dähn, Turmhügel, S� 342- 372�96 Hingst, Haneburg� – Madsen, Grimsborg� – Hertz, Trøjborg�97 Ders�, Kogsbøl Voldsted� – Poulsen, Tiden, S� 509f�98 Poulsen, Tiden, S� 511�99 Ebd�, S� 514- 517�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 69
Insgesamt stellt sich die Situation im Herzogtum Schleswig für weitere Forschungen als spannend dar� Die besondere Grenzlage und der Sondersta-tus innerhalb des dänischen Reiches sowie seine zeitweilig sehr starke Ver-bindung zu Holstein führen im Burgenbau zu einer Gemengelage, in der sich zahlreiche Traditionen vermischen�
3.2. Die Grafschaft und das Herzogtum Holstein
3.2.1. Landesherrliche Burgen der Schauenburger im 12. und 13. Jahrhundert
Mit der Ausbildung der Grafschaft Holstein formierte sich ein Herrscher-haus, das für rund 350 Jahre die Geschichte der Regionen zwischen Elbe und Eider maßgeblich bestimmte�100 Gerade in der Frühzeit vollzogen sich grund-legende Veränderungen, zu denen die herrschaftliche Umformung der be-stehenden Territorien und der hoch- und spätmittelalterliche Landesausbau gehörten� Die durchaus komplexe Geschichte der holsteinischen Grafschaft findet ihren materiellen Ausdruck auch in den zahlreichen Burganlagen, die mehr oder minder deutlich als „landesherrlich“ angesprochen werden� Es ist gleichermaßen faszinierend wie schwierig, die in den schriftlichen Quel-len benannten Orte und Plätze mit entsprechenden Geländedenkmälern zu verbinden�
Nachdem sich im fortgeschrittenen 13� Jahrhundert Holstein zu einem bedeutsamen Territorialstaat entwickelt hatte, wurden spätestens mit den Teilungen am Ende des 13� Jahrhunderts die Verhältnisse unübersichtlich� Die Grafschaften agierten vor allem nach außen gemeinsam, wobei neben dem dänischen Reich auch zunehmend die Städte, insbesondere Lübeck, Konfliktfelder boten� Weiterhin sind die Elbmarschen und Dithmarschen zu nennen, die ebenfalls zunehmend eigenständige politische Ziele verfolgten� Nach dem Ende des Billungerhauses kam Adolf I� von Schauenburg an die Macht� Seine Machtbasis stützte sich zwar auf die Grafschaft Holstein und Stormarn sowie Hamburg, mit dem dänischen Reich Knut Lawards im Nor-den und der abodritischen Herrschaft im Osten war indes die Machtbasis nicht nur im Inneren schmal, sondern auch von außen bedroht�101
Von den frühen schauenburgischen Adelsburgen Adolfs I� lassen sich le-diglich Hamburg und Itzehoe lokalisieren�102 Im 11� Jahrhundert spielten ne-ben Hamburg auch die Standorte Itzehoe als neue Burg sowie die Böklenburg
100 Auge/Kraack, 900 Jahre�101 Zu dieser eng mit der Schauenburger- Dynastie verknüpften Entwicklung
Kraack, Schauenburger�102 Först, Hamburg� – Andersen, Itzehoe�
Lizenziert für U. Müller
70 Ulrich Müller
und die Wittorfer Burg als reaktivierte Anlagen eine wichtige Rolle�103 Die Burg von Itzehoe ist mit den Billungern zu verbinden�104 Sie ließen die Anlage im 11� Jahrhundert errichten� Nach dem Niedergang des Billungerhauses wurde die Burg jedoch von den Schauenburgern weitergeführt und um 1200 ausgebaut� Die an einer engen Flussschleife der Stör gelegene Burg verlor spätestens mit dem Aufschwung der Neustadt ihre Bedeutung� Als schriftlich überlieferte Burg kommt noch der Stammsitz des Stormarner Overbodens in Kirchsteinbek hinzu�105 Ebenfalls zu nennen sind die Burgen in Ulzburg und Arensvelde als mögliche sächsische Burgen bzw� Billunger Residenzen sowie die Anlagen von Leezen und Fresenburg� Über diese spätslawischen Burgen im Bereich des limes Saxoniae ist allerdings wenig bekannt�106 Für die Forschung bedeutsam ist die Burg von Arnesvelde am Rande des Ahrens-burger Tunneltales� Der Name „Arnesvelde“ wird erstmals in einer Urkunde im Jahre 1195 erwähnt�107 Fassbar wird eine mehrteilige Anlage, auf deren Bedeutung zuletzt Lemm hingewiesen hat; Günther Bock vermutet aufgrund der Schriftquellen, dass die Anlage auf das 11� Jahrhundert zurückgehen könnte�108
In den südöstlichen Landesteilen ist die Ratzeburg zu nennen�109 Über die slawische Ringwallanlage – Sitz des Fürsten Ratibor – ist leider ebenso we-nig bekannt wie über die Anlage auf der Schlossinsel, die 1143 Heinrich der Löwe errichten ließ� Zu den frühen landesherrlichen Burgen gehört weiterhin die Ertheneburg, 1106 durch den Tod Magnus‘ von Sachsen auch als letztes Haus der Billunger bezeugt� Im Jahre 1181 wird sie gebrandschatzt und ihr Materialbuch für den Bau der Lauenburg verwendet� Die Ausgrabungen ha-ben immer wieder zur Diskussion über einen slawenzeitlichen Vorgänger ge-führt�110 Eine Besonderheit in der Burgenlandschaft von Schleswig- Holstein bildet Bad Segeberg�111 Der Ort, 1260 mit dem Stadtrecht beliehen, besaß bereits zu Zeiten Knut Lawards eine Burg auf dem mächtigen Kalkberg� Diese ist allerdings nur schriftlich bezeugt� Unter Adolf I� wurde 1130 die-se Anlage zerstört und 1134 durch Lothar von Süpplingenburg die „Sie-gesburg“ errichtet, die bis zu ihrer endgültigen Zerstörung 1644 zahlreiche Zerstörungen, Wiederaufbauten und Umbauten erlebte� Den Zustand am
103 Lemm, Ringwälle, S� 380�104 Andersen, Itzehoe�105 Lemm, Ringwälle, S� 379�106 Struve, Burgen, S� 79ff�, 88ff�107 Risch, Ahrensfelde�108 Lemm, Ringwälle, S� 389f�109 Struve, Burgen, S� 101ff� – Schmid- Hecklau, Herzogtum- Lauenburg�110 Schmid-Hecklau, Herzogtum-Lauenburg, S� 267ff�111 Dazu und im Folgenden Erdmann- Degenhardt, Segeberg, S� 6ff�, 14ff�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 71
Ende des 16� Jahrhundert fing der Kupferstich von Georg Braun und Frans Hogenberg (1588) ein� So wenig über die Anlage bekannt ist, so bemerkens-wert ist, dass sie die einzige Höhenburg darstellt�
In den östlichen Landesteilen wird mit dem Kolonisationsaufruf von Adolf II� ein Transformationsprozess in Gang gesetzt, der in den ehemals abodritischen Reichen jenseits des limes Saxoniae zu einer grundlegenden und nachhaltigen Umgestaltung der kulturellen Landschaft führt� Von ar-chäologischer Seite ist der Landesausbau vor allem durch Rüdiger Schnieck vergleichend analysiert worden und durch Phillip Lüth um einen regionalen Beitrag bereichert worden�112 Felix Rösch hat die Siedlung von Grellenkamp in den entsprechenden hochmittelalterlichen Kontext gestellt�113 In diesen Arbeiten wird verschiedentlich Bezug auf die Burgenlandschaft genommen, wobei deutlich wird, dass es an aussagekräftigen Daten nach wie vor man-gelt� Gerade vor dem Hintergrund der Strukturveränderungen des ersten Drittels bis Mitte des 12� Jahrhunderts sind die Burgen sowohl im Hinblick auf Territorialisierung als auch für die Stadtentwicklungen von großer Be-deutung� Im östlichen Holstein waren die späteren Städte wie Lütjenburg, Oldenburg, Eutin und Plön bereits in spätslawischer Zeit oftmals Sitze von Stammes- und Fürstenburgen� In kaum einer dieser Städte fanden archäolo-gische Untersuchungen statt�
Aber auch generell bleibt die Frage nach den möglichen topographischen und/oder funktionalen Kontinuitäten zwischen spätslawischen und hoch-mittelalterlichen Anlagen ein Desiderat� Stellvertretend genannt seien hier die Siedlungskammern Giekau, Grube und Süsel� Der slawische Burgwall von Giekau gehört zu den mittel- und spätslawischen Anlagen und ist Teil einer Siedlungskammer mit Gräberfeld und Flachsiedlung�114 Ob die Burg im Zuge eines dänischen Feldzuges 1019 zerstört wurde, bleibt offen, doch rei-chen die jüngsten Funde bis in die erste Hälfte des 11� Jahrhunderts� Nord-westlich der slawischen Anlage befindet sich die Turmhügelburg Neuhaus (Abb� 5,1- 2), die wohl mit der Familie von Ghikowe in Verbindung gebracht werden kann� Sie ist für das Jahr 1239 erwähnt� Die Anlage ist von einem Graben eingefasst und besitzt im Süden zwei weitere kleine Erhebungen, die außer- halb der Vorburg liegen� Neben dieser Anlage ist noch die „Water-borg“ zu nennen, die sich unmittelbar westlich des slawischen Walles be-findet (Abb� 5,3)� Die mehrteilige Anlage ist inzwischen stark erodiert und bestand wohl aus zwei Hügeln, die insbesondere im Schnitt erkennbar sind� Die gesamte Anlage ist allerdings nicht hinreichend datiert, so dass die zeitli-chen Bezüge zwischen dem slawischen Burgwall, der Burg von Neuhaus und
112 Schnieck, Besiedlung� – Lüth, Siedlungslandschaft� 113 Rösch, Grellenkamp�114 Struve, Burgen, S� 64ff�
Lizenziert für U. Müller
72 Ulrich Müller
der „Waterborg“ offenbleiben� Die mutmaßliche slawische Burganlage Gru-be wurde zu Beginn des 20� Jahrhunderts eingeebnet, wieterhin ist die 1305 überlieferte landesherrliche Anlage castrum Grobe bekannt�115 Denkbar wäre eine Standortkontinuität der Anlagen im Niederungsbereich des 1930 trockengelegten Gruber Sees� Ganz ähnlich stellt sich die Situation in Süsel bei Sierksdorf dar, wo die zweiteilige „Süseler Schanze“ nach Ausweis der schriftlichen Quellen und kleineren Untersuchungen vermutlich bis in das 12� Jahrhundert benutzt worden ist� Struve vermutet jedoch eine nur kurz-fristige Nutzung und verweist auf die Motte am Nordwestufer des Süseler Sees�116 Weiterhin ist auf Pronsdorf hinzuweisen� Kleinere Wallschnitte in der einteiligen, rund 1,5 ha großen Anlage haben eine mittelslawische Nutzung nachgewiesen�117 Westlich des imposanten Ringwalles ist eine Motte belegt, die lediglich indirekt durch die Ersterwähnung des Dorfes 1249 datiert wer-den kann� Rund 3,5 km von den beiden Burgen entfernt befindet sich das Gut Pronsdorf� Inwieweit dieses auf eine 1350 genannte curia zurückgeht, muss derzeit offen bleiben�118
Von den schriftlich bezeugten großen Stammes- und Fürstenburgen des 11�/12� Jahrhunderts sind die Anlagen von Alt- Lübeck und Lübeck sowie Oldenburg gut untersucht� Wenig zugänglich zeigen sich die Anlagen, die dem spätslawischen Ringwall Starigard in Oldenburg in Holstein folgten� Befunde des späten 12� oder 13� Jahrhunderts sind schwierig zu interpretie-ren�119 Neben der Herrschaftsresidenz von Alt- Lübeck ist die Abfolge von spätslawischem Ringwall und schauenburgischer Anlage sowie deren Struk-turen im Norden der Lübecker Altstadt durch eingehende Grabungen recht gut erschlossen�120 Im Umfeld der Anlagen in und um Lübeck ist der Hir-tenberg am Stülper Huck bei Travemünde bedeutsam� Er wird als Standort einer möglichen Turmburg diskutiert, deren Errichtung Mitte des 12� Jahr-hunderts erfolgt sein soll�121 Dies erschließt sich durch die Erwähnung in den Schriftquellen (1147, 1181), die Heinrich den Löwen als Erbauer namhaft machen� Ausgrabungen erfolgten im 19� und frühen 20� Jahrhundert� Neben Wall- Grabensystemen konnte ein Innenraum von ca� 30–40 m Durchmes-ser mit einem Steinfundament freigelegt werden, der wohl zu einem Turm gehört haben dürfte� Die weitere Geschichte der wiederholt zerstörten und
115 Ebd�, S� 31�116 Ebd�, S� 55f�117 Ebd�, S� 80ff�118 Ebd�, S� 84�119 Ebd�, S� 49f� – Willert, Städtegründungen, S� 114�120 Gläser, Lübecker Befestigungen, S� 274- 280�121 Schneider, Stülper Huk�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 73
wiedererrichteten Anlage ist recht kompliziert, so dass auch eine genaue An-sprache der Befunde schwierig ist�
Zu den schriftlich bezeugten Burgen in Süsel oder Lütjenburg ist kaum etwas bekannt�122 Über die landesherrliche Burg von Plön ist viel spekuliert worden; archäologisch lässt sie sich weder auf der Olsburg noch in der Stadt Plön nachweisen�123 Ganz ähnlich stellt sich die Situation in Eutin dar, das 1257 die Stadtrechte erhielt� Der Ort war bereits seit 1156 Marktort und Residenz der (Fürst)bischöfe von Lübeck�124 Entscheidende Hinweise zu An-lagen des 11� und 12� Jahrhunderts fehlen trotz der Untersuchungen im Be-reich der Fasaneninsel�125
Eine Sicherung der schauenburgischen Landesherrschaft konnte spä-testens nach der Schlacht von Bornhöved in neuen Dimensionen erfolgen� Adolf IV� betrieb eine aktive Politik, deren Ausdruck nicht nur der Ausbau bestehender Marktsiedlungen und Stadtrechtserhebungen war, sondern sich auf eine Reihe von Burgen insbesondere in den östlichen Landesteilen stütz-te� Allerdings fanden an keinem dieser aus den Schriftquellen erschlossenen oder vermuteten Standorte nennenswerte archäologische Untersuchungen statt� Mancherorts bleibt die Identifikation schwierig, wie beispielsweise für die Anlagen nordwestlich des Dorfes Wisch (Abb� 6)� Im Gelände sichtbar ist eine recht große Kuppe ovaler Grundform, vor der sich östlich ein na-hezu kreisförmiger Hügel befindet� Mittig zwischen diesen beiden Anlagen scheint sich ein Wallgrabensystem zu befinden� Möglicherweise handelt es sich auch bei der nördlichen Kuppe um einen Burghügel� Ob es sich bei die-sen Anlagen wirklich um die landesherrliche Burg „Brahmhorst“ handelt, bleibt unklar, selbst wenn Grabungen Hinweise auf einen massiven Turm erbracht haben sollen�126
Für das 1238 mit dem Stadtrecht belehnte Bad Oldesloe nennen die Schriftquellen eine landesherrliche Burg des mittleren 13� Jahrhunderts, die Graf Johann I� von Schauenburg errichtet haben soll� Der Standort wird auf dem Kirchberg vermutet�127 Kiel als weitere Stadtgründung Adolfs IV� besaß eine landesherrliche Burg, die vermutlich dem Standort des heutigen Schlosses entspricht�128 Sie wurde vermutlich bereits 1242 errichtet und soll-te die Siedlung an einer schmalen Landzunge zwischen Kieler Förde und
122 Willert, Städtegründungen, S� 113f�123 Freytag, Plön� – Struve, Burgen, S� 67ff� – Willert, Städtegründungen, S� 112f� –
Müller, Olsburg� – Lüth, Siedlungslandschaft, S� 142f�124 Willert, Städtegründungen, S� 116f�125 Struve, Burgen, S� 28� – Lüth, Siedlungslandschaft, S� 135ff�126 Dähn, Turmhügel, S� 297�127 Ebd�, S� 406�128 Willert, Städtegründungen, S� 121ff� – Müller, Kiel, S� 428f�
Lizenziert für U. Müller
74 Ulrich Müller
Kleinem Kiel schützen� Baubegleitende Untersuchungen am Schloss durch den Kunsthistoriker Carl- Heinrich Seebach haben zwar zahlreiche Befunde erbracht, jedoch keine eindeutigen Hinweise auf eine frühe Anlage geliefert� Schwierig bleibt auch die Einschätzung einer Burg in Eckernförde� Die frühe Topographie wurde verschiedentlich diskutiert�129 Auch wenn die „Eckern-burg“ neben dem Dorf und einem suburbium für die Stadtwerdung maßgeb-lich gewesen sein sollte, bleiben konkrete archäologische Nachweise offen� Ebenso spärlich sind die Informationen zu Rendsburg (Stadtrecht um 1235), das aufgrund seiner Lage im Grenzgebiet zwischen fränkischem und däni-schem Reich und nachfolgend zwischen den Herzogtümern Schleswig und Holstein ein bedeutsamer Standort war�130 Die um 1100 angelegte Burg lässt sich ebenso wenig lokalisieren wie die spätere Anlage� Mit den politischen Veränderungen um 1200, plakativ fassbar durch das „Treffen“ des deut-schen und dänischen Heeres an der Eider, wird wohl auch die Errichtung und der Ausbau des castrum Reinoldesburch an der Eider durch Adolf II� und Adolf III� zu verbinden sein� Aus topografischen Erwägungen lassen sich mehrere Standorte anführen, eindeutige archäologische Hinweise gibt es aber nicht� Zu möglichen Burgen in Neustadt in Holstein und Heiligenhafen ist ebenfalls wenig bekannt�131
Aus dem 13� und 14� Jahrhundert ist eine Reihe von landesherrlichen Bur-gen überliefert� Von den Burgen im Unterelberaum sind die Hatzburg und die Burg von Itzehoe archäologisch sehr gut untersucht�132 Bei der Hatzburg handelt es sich um eine Anlage, die um 1300 durch die Grafen von Schau-enburg erbaut wurde� Diese Anlage wird in einer Urkunde von Graf Adolf VI� von Holstein aus dem Jahr 1311 erwähnt� Die Anlage wurde um 1400 aufgegeben� Die Burg von Itzehoe wurde um 1200 erweitert bzw� umge-baut�133 Von der einstmals landesherrlichen Burg in Pinneberg ist nichts mehr vorhanden� Die Anlage, Zentrum der schauenburgischen Herrschaft, wurde 1720 abgebrochen� Als Standort einer landesherrlichen Burg (Wulfsburg) nicht gesichert ist dagegen eine Anlage bei Tangstedt� Die neuerlichen Unter-suchungen erbrachten bislang Hinweise auf eine frühe Datierung in das 11� Jahrhundert�134 Als landesherrliche Anlagen sind noch die Steinburg bei Sü-derau, nahe Steinburg, sowie das Schloss Barmstedt zu nennen� Westlich des
129 Unverhau, Eckernförde� – Harck, Grundtypen�130 Gudd u� a�, Rendsburger Schloss� – Willert, Städtegründungen, S� 127�131 Ebd�, S� 125ff�132 Neus- Aniol, Wedel� – Andersen, Itzehoe�133 Ebd�134 Dähn, Turmhügel, S� 245� – http://www�golfanlage- wulfsmuehle�de/wp- content/
up loads/2013/02/01_Ver mutete_Burg_Neufassung_B_07�05�201024�01�11�pdf [Letzter Zugriff: 10�9�2014]�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 75
Ortsrandes der Kremper Au wurde die Steinburg um 1300 durch den Grafen Johann II� von Holstein errichtet� Die Anlage ist im Gelände gut sichtbar (Abb� 7,1- 2)� Am Standort des 1806 erbauten Schlosses in der Krückau- Niederung bei Barmstedt soll die landesherrliche Burg des späten 12� Jahr-hunderts gestanden haben� Untersuchungen der 1930er- Jahre erbrachten unter anderem Holzbefunde�135
Angesichts der zahlreichen Teilungen der Grafschaft (Kiel, Itzehoe, Sege-berg; Plön, Rendsburg, Pinneberg) zwischen 1261 und 1290, den weiteren Entwicklungen dieser Linien, der räumlichen Zersplitterung und den vor-liegenden archäologischen Daten ist es nicht immer einfach, die bekannten Anlagen eindeutig historisch zu kontextualisieren� Gerade für die Zeit der Konsolidierung der schauenburgischen Herrschaft wären genaue Daten über Errichtungszeitpunkt, mögliche Vorgängeranlagen oder die Art der Befesti-gung unerlässlich�
3.2.2. Die Vermottung
Insbesondere unter den Schauenburgern Adolf II� und Adolf III� wurde die Einwanderung von adeligen Familien massiv gefördert� Die Vasallen wur-den meist mit Herrschaftsrechten ausgestattet� Insbesondere der Landesaus-bau im lauenburgisch- ratzeburgischen Raum sowie in Ostholstein stützte sich auf den Adel, der bald über entsprechende juristische, administrative, ökonomische und auch militärische Macht verfügte� Aus den schriftlichen Quellen ist abzulesen, dass Lehnsmänner besonders in den Elbmarschen und Ostholstein zunächst über Streubesitz verfügten und im Verlauf des 14� Jahrhunderts sich zunehmend größere Besitzungen herausbildeten� Weiter-hin profitierten die Adeligen von den zahlreichen Auseinandersetzungen der Landesherrschaften bzw� trugen ihrerseits zu einer gewissen Destabilisierung bei� Die Burgen waren hierbei wichtige Machtzentren�
Über die Anlagen der Schauenburger hinaus entstanden so eine Vielzahl niederadeliger Sitze� Sie gehörten zum Typ der Turmhügelburg oder Mot-te� Aus Schleswig- Holstein sind rund 500 Turmhügelburgen bekannt� Die Mehrzahl von ihnen konzentriert sich in den östlichen und südöstlichen Lan-desteilen� Dies spiegelt nicht nur den Forschungsstand, sondern auch die his-torische Situation wider� Die schauenburgische Herrschaft in Holstein und Stormarn unterschied sich einerseits von der politischen Situation im Herzog-tum Lauenburg, das seit 1296 reichsunmittelbar war, andererseits prägte der mittelalterliche Landesausbau beide Regionen nachhaltig� Für eine weitere archäologisch- historische Analyse bieten sich unterschiedliche Regionen an�
135 Dähn, Turmhügel, S� 240�
Lizenziert für U. Müller
76 Ulrich Müller
Als eine „Schlüsselregion“ kann Stormarn gelten�136 Unter Adolf IV� kam es zu einem umfassenden Landesausbau, der seinen Ausdruck auch in der Einrich-tung neuer bzw� dem Ausbau bestehender Burgen fand� Die Burg Arnesvel-de bildete sicherlich einen Ausgangspunkt für den Landesausbau und besaß eventuell noch ältere Vorläufer�137 Die Baugestalt der schauenburgischen An-lage als auch möglicher Vorgänger können indes nur archäologische Untersu-chungen bestätigen� In der Anlage in Lütjensee (Lütjensee I) am Westufer des Sees, die neben zwei Turmhügeln noch einen umfassenden Vorburgbereich so-wie Wall- Grabensysteme beinhaltet, sind umfangreiche prospektive Arbeiten sowie historische Studien durchgeführt worden�138 Die14C- Daten haben zur Vermutung geführt, dass im Kern der wohl in das mittlere 14� Jahrhundert datierenden Anlage noch ein älterer Bau steckt� Mit der Burg von Bargfeld- Stegen, ersturkundlich 1302 genannt, konnte eine mehrteilige Befestigung am Zusammenfluss von Alster und Alter Alster untersucht werden (Abb� 8)�139 Zu der Anlage gehört neben dem mit einem Graben umgebenen Turmhü-gel noch die östlich gelegene Vorburg sowie umliegende Wirtschaftsflächen� Nicht zuletzt ist auch die Steinburg bei Eichede durch die schriftliche wie archäologische Analyse gut aufgearbeitet�140 Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass kleinräumige Studien nur auf der Basis einer Auswertung der materiellen wie schriftlichen Quellen erfolgen können� Einer Auswertung harrt dagegen die Anlage von Tralau�141 Im Gutspark des 19� Jahrhunderts befindet sich in Sichtachse, nordöstlich des Herrenhauses, das Ensemble des „Eiskellerber-ges“ (Abb� 9)� Hier wurde auf dem mutmaßlichen Mottenstandort bei der Anlage des Parks ein Eiskeller eingerichtet, von dem noch der aus Granit-steinen aufgesetzte Trichter erhalten ist� Ob der Eiskeller mit seinem nahezu idealtypischen Mottenquerschnitt wirklich mit der überlieferten Burg Tralau in Verbindung gebracht werden kann, ist allerdings offen�
Ebenfalls von großer Bedeutung dürfte die Region der ostholsteinischen Se-enplatte sein� Hier entstanden zwischen dem 13� und 15� Jahrhundert zahlrei-che Burgen, von denen nur wenige untersucht sind (Abb� 12)� Hinzu kommt eine dichte, bislang aber nur unvollständig ausgewertete schriftliche Über-lieferung� Unter den zahlreichen Anlagen seien nur einige herausgegriffen� Mit der Burg Neuschlag bei Schönweide- Grebin ist eine der imposantesten Anlagen in Schleswig- Holstein bekannt (Abb� 11,1)� Im 3D- Modell zeichnet
136 Hennigs, Stormarn�137 Lemm, Ringwälle, S� 389 mit Bezug auf eine unpublizierte Studie von Günther
Bock� 138 Fischer u� a�, Lütjensee� – Risch, Lütjensee�139 Kühl, Burg Stegen�140 Ders�, Slamersekede� – Bock, Eichede�141 Dähn, Turmhügel, S� 425�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 77
sich die komplexe Struktur dieser mehrphasigen Burg sehr deutlich ab� Die in der Niederung zwischen Tresdorfer See und Rottensee gelegene Burg ist 1933 untersucht worden� Die Anlage ist etwa 260 m lang und besitzt eine Kernburg mit einem Durchmesser von rund 30 m� Die Kernburg ist von einem tiefen, steilwandigen Graben und einem hohen Außenwall umgeben (Abb� 11,2)� Weitere Elemente sind eine erste halbmondförmige und eine zweite, trapez-förmige Vorburg sowie ein vorgelagertes System von Abschnittswall und Graben (Abb� 13,3)� Struve datierte die Anlage in die erste Hälfte des 13� Jahrhunderts und weist auf typologische Gemeinsamkeiten zu Burgen in Dä-nemark hin�142 Mit der Burg von Lebrade bei Rathjensdorf ist eine auf den ersten Blick zwar unscheinbare Anlage bekannt� Diese gewinnt aber vor dem Hintergrund der archäologischen Untersuchungen der Wüstung Tramm an Bedeutung, besteht doch hier die Möglichkeit einer Umfeldanalyse�143
Nicht alle Plätze sind gut prospektiert oder gar untersucht� So sind mit den vier Turmhügelburgen bei Nehmten am Großen Plöner See Anlagen be-kannt, die wohl unmittelbar mit dem 1331 erwähnten Dorf in Verbindung stehen�144 Die Burgen Godau I und II südlich von Godau sowie Nehmten I und II liegen im heutigen Uferbereich des Sees�145
Um eine diachrone Siedlungs- und Landschaftsanalyse durchzuführen, sollte der Bestand an Burgen nicht nur hinlänglich bekannt, sondern auch gut datiert sein� Hier ist auf den südlichen Teil des Lanker Sees zu verweisen (Abb� 12)�146 Hier sind neben der mutmaßlichen slawischen Inselsiedlung auf dem Probstenwarder noch die Burgen von Kühren („Goldburg“), Altenhof- Wahlstorf sowie Wahlstorf- Burg beim Gut bekannt� Hinzu kommen die Burg im Dorf Wahlsdorf sowie das Gut „Hof Wahlstorf“ am Lanker See� Südwestlich des Lanker Sees („Wahlsdorfer Bucht“) befindet sich in einem Niederungsgebiet in Halbinsellage die Burg Kühren „Goldberg“ (Abb� 13, 1- 2)� Mutmaßlich handelt es sich um eine Motte, deren zentraler Hügel von einem Graben begrenzt wurde und die im Südwesten einen Toreinlass besaß� Die Burg wurde durch einen Bohrtransekt prospektiert, der zwar keine ein-deutigen Hinweise auf den Aufbau, jedoch Proben für14C- Datierungen und Ergebnisse aus dem spätem 14� und frühe 15� Jahrhundert lieferte� Lüth hat die Anlage jüngst als Motte interpretiert, die „am Ende des 14� Jahrhun-derts unter Ausnutzung einer natürlichen, morphologischen Gegebenheit in einem feucht bis nassen Milieu errichtet wurde“�147 Die zweiteilige Anlage
142 Struve, Burgwallcorpus, S� 236f�143 Nowotny, Tramm�144 Dähn, Turmhügel, S� 283ff�145 Burgenkartei Struve Bd� X, Nehmten�146 Zum Folgenden Lüth, Siedlungslandschaft, S� 162- 167�147 Ebd�, S� 167�
Lizenziert für U. Müller
78 Ulrich Müller
von Altenhöfen ist teilweise archäologisch untersucht (Abb� 13,3)� Sie wurde zuletzt von Mayr als Kemlade angesprochen, was aber aufgrund der ver-schollenen Ausgrabungsbefunde und der historischen Seespiegelschwan-kungen nur teilweise möglichsein wird�148 Aufgrund von Keramik und der schriftlichen Überlieferung wird der Komplex in das 13� und frühe 14� Jahr-hundert datiert� Im Jahre 1338 wird die Zerstörung einer Burg im Kontext der Lübecker Landfriedensbestrebungen genannt� Als dritte Anlage ist die Burg Wahlstorf in unmittelbarer Nähe zum Gut zu nennen� Es handelt sich um eine unregelmäßige, polygonale Anlage mit Wall- Grabensystem, von der in den 1960er- Jahren Kulturschichten sowie Funde dokumentiert werden konnten, die wenig spezifisch in das ausgehende 12� bis 15� Jahrhundert datieren (Abb� 13,4)�
Nach Lüth folgt der jungslawischen Besiedlung mit dem mutmaßlichen Zentrum auf dem Probstenwarder im Zuge des Landesausbaues die Einrich-tung von Dorf und Burg Lanken (Altenhof)�149 Die Burg Kühren deutet er als möglichen, aber nur kurzfristig genutzten Nachfolger der 1338 zerstörten An-lage von Altenhof� Dieser folgt dann die deutlich größere Burg von Wahlstorf und dann mit der Errichtung der Wasserburg im ausgehenden 15� Jahrhundert (1469) eine neuerliche Verlegung und grundlegende Umstrukturierung� Ob der Ablauf so rekonstruiert werden kann, ließe sich nur mit weiteren Unter-suchungen klären, die auch die Turmhügelburg Wahlstorf im gleichnamigen Dorf miteinbeziehen müssten� Die Anlage auf einer Niederung am Ostrand des Dorfes ist undatiert und wird allgemein in das 14� bis 16� Jahrhundert gesetzt�150 In jedem Falle bleibt auf Parallelitäten zur Siedlungskammer Futter-kamp hinzuweisen� Als mögliche spätslawische Mittelpunktburg ist die An-lage der Hochborre auszumachen, die noch bis in das 11�/12� Jahrhundert in Benutzung war� Die Siedlungskammer wird dann kolonisationszeitlich durch die zweiphasige Motte Schlichtenberg erschlossen� Der „Große Schlichten-berg“ datiert zwischen 1200 und 1400, während der „Kleine Schlichtenberg“ nur kurzzeitig von 1356/57 bis 1360/70 in Benutzung gewesen ist� Mitte des 14� Jahrhunderts kommt es zur neuerlichen Besiedlung der Hochborre, der dann ab 1433 das Gut Futterkamp folgt (Tabelle 1)�
Auch das Herzogtum Lauenburg bietet in Bezug auf Detailstudien ein gro-ßes Potential� Für die beiden „Silkenburgen“ im Koberger Zuschlag (Forst-haus Schevenböken), die bereits von Schuchardt untersucht worden sind, ist die genaue Funktion und Datierung unbekannt�151 Den Schriftquellen ist zu entnehmen, dass der Wirtschaftshof der „Sylkenburg“ sowie die Ortschaften
148 Zur Diskussion ebd�, S� 163ff�149 Ebd�, S� 162ff�150 Dähn, Turmhügel, S� 295�151 Ebd�, S� 98� – Struve, Schevenböcken, S� 121f�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 79
1468 nicht mehr bestanden� Die Sondagen ließen auf einen hölzernen Turm (Burg I) bzw� einen Bergfried mit Steinfundament (Burg II) schließen� Eben-falls bemerkenswert sind die Burgen von Borstorf� Während Borstorf I und II lediglich als Turmhügel überliefert sind, besteht die Anlage Borstorf III im Rebbenbruch südlich von Borstorf aus einem rund 5 m hohen und rund 40 m großen Hügel, an den sich im Südwesten eine halbkreisförmige Vorburg mit mutmaßlich umwallter Hofstelle anschließt�152 Die Grabungen erbrachten Holzbefunde im Vorburgbereich� In der schriftlichen Überlieferung ist eine Borchardetorpe mehrfach erwähnt� Für 1291 ist die Zerstörung der Anla-ge genannt� Für 1326 und 1349 liegen weitere Nachrichten vor, doch um welche der Anlagen es sich handelt, bleibt offen� Am nordwestlichen Rand von Linau befindet sich eine dreigliedrige Wehranlage, die Burg Linau�153 Sie besteht aus drei Burghügeln, die durch einen 10 m breiten Wassergraben ge-trennt wurden� Sie ist eine der wenigen Steinburgen, deren Fundamente bzw� Mauerstücke noch bis in das 20� Jahrhundert erhalten sind� Der Bergfried wird auf dem rund 7 m hohen und 25- 30 m großen Mittelrücken lokalisiert� Zwei weitere, durch Gräben getrennte Hügel, befinden sich nordwestlich bzw� östlich davon� Die gesamte Anlage ist rund 160 m lang und wird von Gräben eingefasst� Grabungen im späten 19� Jahrhundert belegten einen runden Bergfried mit mutmaßlicher Ziegelbedeckung, der auch als Donjon angesprochen wird� Für Linau existiert eine recht dichte Überlieferung� So wird die Burg Linowe als rofhus bezeichnet� Sie stellte eine der bedeutends-ten „Raubritterburgen“ des 14� Jahrhunderts dar� Ob die Burg Linowe mit dem Burgplatz identisch ist, bleibt offen� Die wohl 1308 von der Familie Scharffenberg erbaute und bereits 1349 zerstörte Anlage kann auch einen Vorläufer besessen haben, denn die chronikalische Überlieferung berichtet von einer älteren Burg, die im Zuge des Landfriedens 1291 zerstört worden sein soll� Denkbar wäre, dass sich dieses Datum auch auf die Anlage von Linau- Oberteich („Schloßteich“) bezieht: Einen rund 25 m großen Turmhü-gel in der sumpfigen Niederung�154
So gut manche Anlagen sich im Gelände abzeichnen, aufgemessen oder gar archäologisch untersucht sind, so selten fanden Untersuchungen in den Vor-burgbereichen und angrenzenden Wirtschaftsflächen statt� An der Hatzburg wurden die weiteren Anlagen nur ansatzweise untersucht� Die Burg Sülsdorf am Ratzeburger See, die um 1300 als curia Taulestorpe Erwähnung findet, besteht aus einem mit Wall- und Graben gesicherten Turmhügel sowie der Vorburg, die eine Fläche von rund 10�000 qm einnimmt und ebenfalls durch
152 Struve, Borstorf, S� 122ff�153 Ders�, Linau� 154 Ebd�, S� 109�
Lizenziert für U. Müller
80 Ulrich Müller
ein Grabensystem gesichert war�155 Für andere Anlagen gibt es abweichende Interpretationen� So wird eine südwestlich der Turmhügelburg Hohn gelege-ne quadratische Einfriedung als Viehpferch gedeutet�156 Wie sehr eine genaue-re Analyse notwendig ist, zeigte Kühl für die Burg von Stegen auf� Im Gelände sichtbar (Abb� 8) sind drei unterschiedlich große Plateaus, die als Haupt-burg, Vorburg und „Gartenbereich“ angesprochen wurden, wobei letzterer allerdings bebaut gewesen ist�157 Daneben ist noch eine weitere Burgstelle identifiziert worden, so dass sich hier eine Reihe von Interpretationen für die Funktionen der einzelnen Standorte ergibt� Die Anlage von Ramsdorf bei Brekendorf (Owschlag) ist ebenfalls zweiteilig� Sie besteht aus der Hauptburg und einem weiteren Hügel� Ausgrabungen haben Wohn- und Wirtschafts-strukturen auf der ersten Kuppe sowie einen Wirtschaftshof des 16� Jahrhun-derts auf der zweiten Kuppe erbracht�158 Unter diesem befand sich allerdings ein älterer Bau, der als Wohn- und Wehrturm angesprochen wird�
Große Forschungslücken bestehen in Bezug auf die Verhältnisse zwischen Turmhügelburg/Motte und ländlicher Siedlung� Wie andernorts auch kon-zentrierte sich die Forschung eher auf die Burganlage als auf das Umfeld mit möglichen Siedlungsstandorten� Neben Tramm hat sich durch die Ausgra-bung einer ländlichen Siedlung bei Gut Rosenkranz (ehemals Gut Schinkel, Abb� 14,1) nahe Schinkel eine günstige Situation ergeben� Allerdings ist die Burg selbst verschliffen und lediglich durch Wall- Grabensysteme erkennbar�159 Sie wird im neuzeitlichen Gutspark gelegen haben, wo sich der Standort noch schwach im LIDAR- Bild abzeichnet (Abb� 14,2)�160 Die Ausgrabungen west-lich des Gutshofes belegen ein Dorf des 13� Jahrhunderts�161 Die schriftliche Überlieferung setzt um 1260 bzw� 1284 ein, als Nicolus de Schinkele eine Burg mit Wassergraben errichtet, die in ihrem umgebauten Bestand auch auf der Rantzauschen Tafel abgebildet ist� Die Schriftquellen brechen um etwa 1400 ab und auch archäologisch wird eine Siedlungslücke zwischen der ers-ten Hälfte des 15� Jahrhunderts und dem 18� Jahrhundert fassbar�162
Die Turmhügelburgen und Motten in Schleswig- Holstein bieten ein gro-ßes Potential für weitere archäologische wie historische Studien, das bis-lang nicht ausgeschöpft worden ist� So gut die topografische und schriftliche Überlieferung im Einzelfall auch sein mag, so unklar bleibt letztlich die
155 Riediger/Köhler, Burgen und Herrensitze, S� 76�156 Dähn, Turmhügel, S� 318�157 Kühl, Burg Stegen, S� 249�158 Hingst, Ramsdorf, S� 139- 144� – Dähn, Turmhügel, S� 311�159 Ebd�, S� 333�160 Burgenkartei Struve Bd� IV, Rosenkranz�161 Lübke, Rosenkranz, S� 99�162 Ebd�, S� 97�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 81
genaue historische Kontextualisierung� Auf den ersten Blick liegt es natürlich nahe, die im Gelände mehr oder minder sichtbaren oder sogar prospektier-ten Plätze historischen Ereignissen oder Personen zuzuweisen� Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass sich meist weder die Standorte noch die konkrete Struktur der Anlagen genau bestimmen lassen�
4. Von der Burg zum Gut
Die Aufgabe der niederadeligen Burgen und die Errichtung befestigter Her-renhäuser und Schlösser sowie die Durchsetzung der Gutsherrschaft ist von archäologischer Seite nicht nur in Schleswig- Holstein kaum thematisiert worden� Dies ist erstaunlich, denn vielerorts zeugt bereits die topographische Nähe von mittelalterlichem und neuzeitlichem Standort von diesen Prozes-sen� Eine Verlagerung ist evident und entspricht auch den Entwicklungen in anderen Teilen Deutschlands und Europas� Es war Leister vorbehalten, für Schleswig- Holstein Anfang der 1950er- Jahre hierzu eine Studie vorzulegen� Sie wies darauf hin, dass die „Gutshöfe“ bis zur Mitte des 17� Jahrhunderts in Niederungslagen und an gewässernahen Standorten zu finden seien, wäh-rend in „Höhenlagen“ (Kuppen) eher Meier- Höfe anzutreffen seien�163 Ihrer Aussage, dass die „Gutshöfe“ der frühen Neuzeit (und damit auch ihre Be-wohner) tendenziell eher dem Adelssitz des späten Mittelalters und seiner „Wehrhaftigkeit“ verwurzelt seien, wird man sicherlich überprüfen müssen, doch sind ihr wichtige Hinweise zu den Standorten der Gutshöfe zu verdan-ken� Nachfolgende Arbeiten zur Entstehung von Herrenhäusern und Gutshö-fen haben die Aussagen von Leister meist unreflektiert übernommen, stellen den „burgartigen Charakter“ der Herrenhöfe heraus und betonen, dass diese eher aus der „wehrhaften Wasserburg als von der curia am Dorfe“ abzuleiten sein�164 Diese Aussagen wird man in einer neuerlichen Analyse der schrift-lichen Quellen, der bestehenden Bauten sowie der archäologischen Daten untersuchen müssen� So sind zahlreiche Standorte von Turmhügelburgen un-bekannt, durch Wüstungsprozesse ist zudem mit weitaus mehr Herrenhöfen zu rechnen als gemeinhin angenommen� Schließlich fehlt es an archäologi-schen Grabungen und bauhistorischen Untersuchungen, welche Aussagen zu zeitlichen, räumlichen und sozioökonomischen Transformationsprozessen ermöglichen� So vermutete Ericsson für die Siedlungskammer Futterkamp in der ursprünglich slawischen Hochborre einen Hinweis auf einen befestigten Hof� Der Platz wurde im späten Mittelalter unter Bezug auf die ehemaligen Grabensysteme ummauert und ein viereckiger Turm errichtet� Auch das Gra-bensystem in Gleschendorf wird gerne als ein Beispiel für den Standort eines
163 Leister, Rittersitz, S� 54ff�164 Bubert/Walter, Herrenhäuser, S� 3� – Hirschfeld, Herrenhäuser, S� 4�
Lizenziert für U. Müller
82 Ulrich Müller
befestigten Hofes angeführt und Ericsson deutet zudem die Befunde aus Alt- Wensin bei Garbek und Roseburg- Wotersen als Belege für befestigte Höfe�165
Für andere Plätze sind die Bezüge weniger deutlich� Eine möglicherweise vergleichbare Situation könnte in Haselau vorliegen�166 Bei dem Schlossberg handelt es sich um ein rechteckiges Plateau von rund 7�000 qm, welches von einem Wassergraben eingeschlossen wird� Dem Schlossberg vorgelagert ist der sogenannte „Kuhberg“, eine rund 14�000 qm große Fläche, die durch eine Erdbrücke mit dem Schlossberg verbunden ist� Über einen Burgenstandort ist nichts bekannt� Die Anlage entstand Anfang des 16� Jahrhunderts� Weitere Beispiele lassen sich nennen: Hierzu gehören beispielsweise das bereits ge-nannte Tralau, das Gut Kittlitz oder das Gut Kulpin mit der Turmhügelburg Doddenredder sowie einer Anlage im Bereich des heutigen Gutshofs� Kaum noch sichtbar existieren hier ein Grabensystem und eine Befestigung, die mög-licherweise auf eine Anlage des mittleren 14� Jahrhunderts zurückgehen�167 In Nusse ist neben der undatierten „Gänseburg“ am Südrand des Hofsees auf die Anlage im Ritzauer Hof hinzuweisen�168 Bis in das 19� Jahrhundert ist hier die Hofanlage der gleichnamigen Familie überliefert� Im Süden der An-lage befand sich noch der Turmhügel, der deutlich auf einer Karte aus dem Jahre 1571 dargestellt ist� Nach der Zerstörung der ersten Burg wurde 1409 eine neue Anlage errichtet� Ihr folgte im 16� Jahrhundert der Hof� Eine ko-lorierte Zeichnung um 1840 stellt das Schloss auf einer Hochmotte dar� Mit Mustin bei Ratzeburg wird eine vergleichbare Wüstungssituation erfasst�169 Urkundlich ist für 1291 die Zerstörung einer „Raubritterburg“ überliefert, die sich möglicherweise auf der Flur „Ole Hofkoppel“ befunden hat� Im 16� Jahrhundert wird auf dieser Geestkuppe am Großen See das Wasserschloss der Familie Rantzau lokalisiert, das allerdings zerstört wurde� Der Herrensitz befindet sich auf dem sogenannten Bornwinkelberg�170 Westlich des Gutes Hasselburg bei Altenkrempe befinden sich markante Kuppen, die Teil einer Burganlage sind� Die Interpretation bleibt schwierig, jedoch scheint es sich nach Dähn um eine dreiteilige Burganlage zu handeln�171 Auf die Situation am Lanker See wurde bereits oben hingewiesen� Das heutige Herrenhaus des Guts Wahlstorf geht auf eine Wasserburg aus dem Ende des 15� Jahrhunderts zurück�172 Sie wurde durch Detlev von Thienen ab 1469 errichtet� Das von
165 Ericsson, Wehrbauten, S� 268f�166 Dähn, Turmhügel, S� 241�167 Burgenkartei Struve Bd� X, Kittlitz, Kulpin� – Dähn, Turmhügel, S� 94, 102, 107�168 Loewe, Nusse, S� 113- 119� – Dähn, Turmhügel, S� 111�169 Ebd�, S� 110�170 Burgenkartei Struve Bd� XI, Mustin� 171 Dähn, Turmhügel, S� 161�172 Hirschfeld, Herrenhäuser, S� 234f�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 83
einem Wassergraben umschlossene zweigeschossige Backsteindoppelhaus mit Satteldächern und Treppengiebeln besaß einen Treppenturm� Eine Erwei-terung mit Wirtschaftsgebäuden und Torhaus erfolgte im 16� Jahrhundert� Unter Hans von Thienen kam es 1613 zu weiteren Umbaumaßnahmen, zu denen auch ein neuer umschließender Wassergraben gehörte�
Neben den Standorten spielt auch die Entwicklung der Gebäudetypen eine wichtige Rolle� Über den rezenten Bestand hinaus sind es zunächst die Abbil-dungen der „Rantzauske Borge“, die uns Informationen über die Neuzeit lie-fern� Heinrich Rantzau ließ 1585 den Stammbaum seines Geschlechtes durch Franz Hogenberg stechen� Dieser Stich bildete die Grundlage für die Rantzau- Tafel, die 1587 durch Daniel Freese gemalt wurde und auf deren Randleiste fünfzig Herrenhäuser auf Rantzauer Gütern dargestellt sind� Zu den abgebil-deten Gebäuden gehören unter anderem die Burg Arnesvelde, die Trøjborg oder die damaligen Herrenhäuser von Nütschau, Salzau, Wandsbek, Rastorf, Breitenburg und Rantzau� Sie vermitteln einen durchaus plausiblen Eindruck der frühen Gebäude, selbst wenn eine detailgetreue Wiedergabe nicht das pri-märe Ziel gewesen sein dürfte� Eine umfassende Analyse der Gutshäuser aus kunsthistorischer Sicht ist Peter Hirschfeld zu verdanken� In seiner Studie hat er sich auch mit den frühen Bauformen und ihrer Genese auseinandergesetzt� Er sah den „einteiligen Typ“ des Gutshaues in der Tradition der älteren Bau-ernhäuser und stellte entwicklungsgeschichtlich die Trennung von Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude heraus�173 Diesen Typ ordnete er in einen deutlichen Gegensatz zu den befestigten Anlagen in den nordschleswigschen Landestei-len oder den landesherrlichen und bischöflichen Burgen ein�
Hier wären weitere Forschungen am Objekt notwendig, denn bauhisto-risch ist dieser Typ nicht einfach nachzuweisen� Ein mutmaßlich früher Beleg für ein „Festes Haus“ ist die Anlage aus Eckhorst, die als curia interpretiert wird (Abb� 15)�174 Das Steinfundament eines rechteckigen Gebäudes wird weniger als Turmfundament einer Turmhügelburg denn als Gebäude anzu-sprechen sein� Mit der Datierung in das 14� Jahrhundert scheint es zugleich ein früher Beleg für ein „Festes Haus“ zu sein, das auf einem künstlich aufge-schütteten Hügel errichtet worden ist� Die Befunde von Roseburg- Wotersen sind teilweise vorgelegt worden, wobei es sich um die erste umfassende Aus-grabung eines renaissancezeitlichen Platzes in Schleswig- Holstein handelt�175 Auf einer Fläche von rund 700 qm und in einer Entfernung von rund 500 m zu dem 1736 errichteten Herrenhaus konnten neben zwei Einzelgebäuden und einem Vorratshaus noch Wirtschaftsgebäude sowie Brunnen freigelegt werden� Die gesamte Anlage wurde von einem Wasserlauf eingefasst�
173 Ebd�, S� 14ff�174 Bokelmann, Eckhorst�175 Porath, Wotersen� – Kühl, Travenhorst, S� 51ff�
Lizenziert für U. Müller
84 Ulrich Müller
Differenzierter erscheint der Bautyp in Form des sogenannten Doppelhau-ses� Der Bau aus Wahlstorf kann als eine der am besten erhaltenen Anlagen gelten, mit den Bauten aus Quarnbek und Hasselburg liegen vergleichbare Bauten vor�176 Ein guter archäologischer Hinweis auf ein Doppelhaus besteht mit dem Befund aus Alt- Wensin bei Garbek (Abb� 16,1)�177 Auf einem etwa 8�400 qm großen Burgplateau konnte in den 1970er- Jahren ein Gebäude er-graben werden, das überzeugend als Doppelhaus interpretiert und in die Zeit „kurz vor 1500“ datiert werden konnte (Abb� 16,2)� Der Standort beim Dorf Garbeke in der Flur Schierau wurde nach dem Kauf durch Joachim Brock-dorf 1635 aufgegeben, das neue Herrenhaus 1642 als Doppelhaus errichtet�
Ebenfalls wenig untersucht sind Beziehungen zu wohnturmartigen Bauten� Hirschfeld interpretiert den runden, am westlichen Küchentrakt gelegenen Treppenturm der Gutsanlage von Farve als einen im Kern spätmittelalterli-chen Bau�178
Insgesamt sind die Entwicklungslinien nicht einfach einzuschätzen� In der Tat bleibt es schwierig, allein aus dem überlieferten Baubestand heraus zu entwicklungsgeschichtlichen Aussagen zu gelangen, und auch die (bau)- archäologischen Daten liefern zur konkreten Ausgestaltung der einzelnen Gebäude wenig Anhaltspunkte� Hier befinden sich Geschichte, Baugeschich-te und Archäologie in einer schwierigen Lage, da für jede der Quellengrup-pen nicht genügend Informationen vorliegen und eine Zusammenschau häufig zu Zirkelschlüssen führt�
5. Zusammenfassung und Perspektiven
Vergessenes Burgenland Schleswig- Holstein? Aus archäologischer Perspekti-ve muss man diese Aussage relativieren, denn die Burgen des Landes standen und stehen sehr wohl im Blickpunkt der Archäologie� Durch die Vielzahl an Anlagen und aufgrund der spezifischen historischen Entwicklungen besitzt Schleswig- Holstein für die Burgenforschung eine internationale Dimension� Dabei hat die Archäologie das Land zwischen den Meeren immer als eine Drehscheibe für den Güter- und Ideentransfer gesehen und auf die vielgestal-tige Vernetzung hingewiesen� Die politische Konstellation von schauenburgi-schen Landesherrschaften und dänischen Königsherrschaften, die Regionen der Westküste mit ihren regionalen Herrschaften, das Herzogtum Lauenburg sowie die beiden großen Hansestädte Hamburg und Lübeck schaffen ein Tableau, auf dem sich Strukturen und Prozesse von europäischer Dimensi-on bündeln� Der Erforschung der Burgen kommt hierbei eine Schlüsselrolle
176 Hirschfeld, Herrenhäuser, S� 17f�177 Struve, Garbek� – Kühl, Travenhorst, S� 47- 50�178 Hirschfeld, Herrenhäuser, S� 22�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 85
zu, denn in den Burgen kombinieren sich ökonomische, rechtliche, soziale, kulturelle und letztlich räumliche Strukturen� Burgen als Ausdruck adeli-gen Selbstverständnisses (Status) und adeliger Handlungsspielräume (Wahr-nehmung) waren Herrschaftszentren, „nodal points“ in unterschiedlichen Netzwerken� Sie konstituierten mit ihren materiellen und immateriellen Aus-prägungen die mittelalterlichen Räume�
Die rund 500 Burgen in Schleswig- Holstein bieten also enormes Potential für weitere Forschungen� Sicherlich böten neue und insbesondere flächen-deckende Ausgrabungen nicht nur bekannte, sondern vermutlich auch neue Einblicke in die Baugestalt und den Lebenszuschnitt auf einer Burg� Gewinn-bringend erscheint es mir, zunächst die vorhandenen archäologischen Daten auszuwerten, mit weiteren Geoinformationen zu verknüpfen und im Ver-bund mit weiteren Disziplinen wie der Regionalgeschichte Schwerpunkte zu setzen� Zwei Aspekte erscheinen mir dabei besonders geeignet�
1� Transformationsprozesse an „Epochengrenzen“: Die Entwicklungen am Übergang von spätslawischen bzw� spätsächsischen Gesellschaften hin zu Landesherrschaften ist von archäologischer Seite bislang kaum themati-siert worden� Ganz Ähnliches gilt auch für das späte Mittelalter mit der Aufgabe der Motten/Turmhügelburgen und der Verlagerung der Herr-schaften im Zuge der Durchsetzung der Gutsherrschaft�
2� Die Vermottung als ein raumwirksamer Prozess: Die Entstehung von Turmhügelburgen und Motten ist ein gesamteuropäisches Phänomen mit facettenreichen lokalen und regionalen Entwicklungen� Mit der Errich-tung von Burgen wird grundlegend in den vorhandenen Raum eingegrif-fen und eine völlig neue Kategorie geschaffen�179
Dabei erscheint es mir angesichts der Heterogenität der politischen Räume zwischen Nord- und Ostsee sinnvoll, auf einer mittleren Maßstabebene an-zusetzen und anhand von Schlüsselregionen entsprechende Untersuchungen vorzunehmen� Dies wird meines Erachtens auch der Spezifik archäologischer Daten gerecht, die sich zwischen lokalem Befund und kleinräumiger Generali-sierbarkeit bewegen� In diesen Mesoregionen wären dann weiterführende Un-tersuchungen mit Grabungen an ausgewählten Standorten gewinnbringend� Wenn die Burgen in Schleswig- Holstein auf den ersten Blick nicht dem Bild einer „typischen Mittelalterburg“ entsprechen, so liegt dies kaum am For-schungsstand� Es ist eine Frage der Perspektive� Die vielgestaltigen Burgen, „Festen Häuser“ und befestigten Höfe des Landes sind Teil einer gemeinsa-men europäischen Geschichte, in der die Handlungs(spiel)räume, insbesonde-re des Adels, ihren materiellen Ausdruck in ebendiesen Anlagen finden�
179 Vgl� hierzu auch den Beitrag von Stefan Magnussen im vorliegenden Band�
Lizenziert für U. Müller
86 Ulrich Müller
DarstellungenAlbrecht, Uwe: Der Adelssitz im Mittelalter� Studien zum Verhältnis von Ar-
chitektur und Lebensform in Nord- und Westeuropa� München u� a� 1995�
Andersen, Hans Helmuth: Die Burg in Itzehoe� Ausgrabungen und Funde� Neumünster 1980 (Offa- Ergänzungsreihe, 4)�
Auge, Oliver/Kraack, Detlev (Hgg�): 900 Jahre Schauenburger im Norden� Eine Bestandsaufnahme� Kiel/Hamburg 2015 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig- Holsteins, 121; zeit + geschichte, 30)�
Bastian, Walter: Zur Kemladenforschung� Die Kemlade von Lassan bei Klocksdorf, Gmde� Gadebusch und ihre Funde� In: Jahrbuch Bodendenk-malpflege Mecklenburg (1959), S� 162- 1988�
Biermann, Felix: Motten im nördlichen Ostdeutschland� In: Felgenhauer- Schmiedt, Sabine/Csendes, Peter/Eibner, Alexandrine (Hgg�): Motte – Turmhügelburg – Hausberg� Zum europäischen Forschungsstand eines mittelalterli- chen Burgentypus� Wien 2007 (Beiträge zur Mittelalterar-chäologie in Österreich, 23), S� 111- 134�
Bleile, Ralf: Central Sites on the Periphery? The Development of Slavonic Ramparts on Islands in Freshwater Lakes in Northern Germany (8th- 12th Century AD)� In: Bork, Hans- Rudolf (Hg�): Landscapes and human development� The contribution of European archaeology� Bonn 2010, S� 285- 296�
Bock, Günther: Der „Limes Saxoniae“ – keine karolingische Grenze! In: Jahrbuch für den Kreis Stormarn 31 (2013), S� 13- 30�
–: Eine historische Untersuchung zur einstigen Burg von Eichede, Kreis Stor-marn� In: Archäologische Nachrichten aus Schleswig- Holstein 12 (2001), S� 88- 114�
–: Umbrüche in Polabien während des 11� Jahrhunderts� In: Biermann, Felix (Hg�): Transformationen und Umbrüche des 12�/13� Jahrhunderts� Lan-genweissbach 2012 (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 64), S� 67- 82�
Böhme, Horst Wolfgang/von der Dollen, Busso/Kerber, Dieter/Meckseper, Cord/Schock- Werner, Barbara/Zeune, Joachim (Hgg�): Burgen in Mittel-europa� Ein Handbuch, Bd� 2� Darmstadt 1999�
Bokelmann, Klaus: Untersuchungen an der Curia Eckhorst, Kr� Ostholstein� In: Offa� Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 28 (1971), S� 150- 160�
Bonsen, Uwe: Burgen im mittelalterlichen Schwansen� In: Heimatgemein-schaft Eckernförde 65 (2007), S� 201- 226�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 87
Breitling, Stefan/Krauskopf, Christof/Schopper, Franz (Hgg�): Burgenland-schaft Brandenburg� Petersberg 2013 (Berliner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpflege, 10)�
Bubert, Ingo/Walter, Hanspeter: Gutshöfe, Herrenhäuser und Schlösser im östlichen Holstein� Schellhorn 52003�
Dähn, Arthur: Ringwälle und Turmhügel� Mittelalterliche Burgen in Schleswig- Holstein� Husum 2001�
Dobat, Andres: Kongens Borge� Højbjerg 2013 (Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter, 76)�
Donat, Peter: Mittelalterliche Rittersitze im westlichen Mecklenburg� In: Jahrbuch für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg- Vorpommern 49 (2002), S� 175- 238�
Dubisch, André/Hähn, Cathrin/Müller, Eric/Rohland, Hendrick/Siegfried, Katrin: Ein tiefer Blick in die Geschichte des Lübecker Burghügels� Neue Befunde zur Befestigung und Entwicklung eines wichtigen Siedlungskerns der Stadt Lübeck� In: Falk, Alfred/Müller, Ulrich/Schneider, Manfred (Hgg�): Lübeck und der Hanseraum� Beiträge zur Archäologie und Kul-turgeschichte� Lübeck 2014, S� 51- 68�
Erdmann- Degenhardt, Antje: Im Schatten des Kalkbergs� Die Geschichte von Burg, Kloster und Stadt Segeberg� Bad Segeberg 1988�
Ericsson, Ingolf: Futterkamp� Untersuchungen mittelalterlicher befestigter Siedlungen im Kreis Plön, Holstein, Teil 1: Funde� Neumünster 1981 (Offa- Bücher, 47)�
–: Futterkamp� Untersuchungen mittelalterlicher befestigter Siedlungen im Kreis Plön, Holstein, Teil 2: Befunde und Siedlungsentwicklung� Neu-münster 1983 (Offa- Bücher, 54)�
–: Mittelalterliche Wehrbauten in Schleswig und Holstein� In: Castella Maris Baltici 1 (1993), S� 67- 78�
–: Vom slawischen Burgwall zum deutschen Gut� Studie zur mittelalterlichen Siedlungsgenese im Raum Futterkamp, Holstein� Lund 1984�
–: Wehrbauten des Mittelalters in Skandinavien und dem Gebiet südlich der Ostsee� In: Andersson, Hans/Wienberg, Jes (Hgg�): The Study of Medieval Archaeology� Stockholm 1993 (Lund Studies in Medieval Archaeology, 13), S� 219- 291�
Ettel, Peter: Burgen und Befestigungen in Niedersachsen vom 7� bis 11� Jahr-hundert� In: Archäologie in Niedersachsen (2013), S� 29- 35�
Etting, Vivian: The royal castles of Denmark during the 14th century� An analysis of the major royal castles with special regard to their functions
Lizenziert für U. Müller
88 Ulrich Müller
and strategic importance� Copenhagen 2010 (Studies in archaeology and history, 19)�
Felgenhauer- Schmiedt, Sabine/Csendes, Peter/Eibner, Alexandrine (Hgg�): Motte – Turmhügelburg – Hausberg� Zum europäischen Forschungsstand eines mittelalterlichen Burgentypus� Wien 2007 (Beiträge zur Mittelalter-archäologie in Österreich, 23)�
Fischer, Lars/Nakoinz, Oliver/Glos, Rainer: Die älteste Motte in Schleswig- Holstein? Aktuelle Ergebnisse archäologischer und botanischer Un-tersuchungen zur Entwicklung des Dorfes Lütjensee im Mittelalter� In: Hammaburg Neue Folge 14 (2003), S� 179- 195�
Först, Elke: Befestigungen des Mittelalters und der Neuzeit in der Ham-burger Innenstadt� In: Gläser, Manfred (Hg�): Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI: Die Stadtbefestigungen des Mittelal-ters und der Neuzeit� Lübeck 2010, S� 255- 272�
Freytag, Hans- Joachim: Die Lage der slawischen und frühen deutschen Burg Plön� In: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig- Holsteinische Ge-schichte 110 (1985), S� 27- 52�
Friedhoff, Jens: „Lebendiges Mittelalter“ und „vergessene Ruinen“ – die Turmhügelburg Lütjenburg und die Burgruine Glambeck in Schleswig- Holstein� In: Burgen und Schlösser 4 (2012), S� 215–221�
Fuhrmann, Kai: Die Ritterschaft als politische Korporation in den Herzogtü-mern Schleswig und Holstein von 1460 bis 1721� Kiel 2002�
Gaude, Britta: Die Motte von Altenholz, eine mittelalterliche Burg� In: Ar-chäologische Gesellschaft Schleswig- Holstein 1 (1989), S� 28- 31�
Gemeinde Treia (Hg�): Chronik der Gemeinde Treia� Husum 2005�
Gläser, Manfred: Die Lübecker Befestigungen (Burgen und Stadtmauern) im Mittelalter und in der Neuzeit� In: Ders� (Hg�): Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI: Die Stadtbefestigungen des Mittelal-ters und der Neuzeit� Lübeck 2010, S� 273- 292�
– (Hg�): Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI: Die Stadtbefestigungen des Mittelalters und der Neuzeit� Lübeck 2010�
Gregersen, Hans: Tørning – Tørninghus, Tørninglen, Tørning ladegård, Tør-ning mølle, Tørning kro, Tørning tinghus� Tørning 1982�
Großmann, Ulrich/Ottomeyer, Hans (Hgg�): Die Burg� Wissenschaftlicher Begleitband zu den Ausstellungen „Burg und Herrschaft“ und „Mythos Burg“� Berlin u� a� 2010�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 89
Gudd, Alfred/Heindel, Manfred/Hoop, Edward: Das Rendsburger Schloss� Neueste Untersuchungen und Ergebnisse zu Lage, Größe und Aussehen� In: Rendsburger Jahrbuch 50 (2000), S� 45- 64�
Harck, Ole: Grundtypen der neuen dänischen und schleswigschen Städte� In: Hoffmann, Erich/Frank Lubowitz (Hgg�): Die Stadt im westlichen Ost-seeraum, Teil 1� Frankfurt a� M� u� a� 1995 (Kieler Werkstücke: Reihe A, Beiträge zur schleswig- holsteinischen und skandinavischen Geschichte, 14), S� 145- 154�
Heine, Hans- Werner: Burgen vom Typ Motte und Turmburgen in Niedersach-sen und angrenzenden Landschaften� In: Felgenhauer- Schmiedt, Sabine/Csendes, Peter/Eibner, Alexandrine (Hgg�): Motte – Turmhügelburg – Hausberg� Zum europäischen Forschungsstand eines mittelalterlichen Burgentypus� Wien 2007 (Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Öster-reich, 23), S� 61- 84�
Hennigs, Burkhard von: Burgen in Stormarn� Ein Überblick zum derzeitigen Forschungsstand� In: Jahrbuch für den Kreis Stormarn (1991), S� 57- 70�
Hertz, Johannes: Gammelt nyt om Kogsbøl Voldsted� In: Hikuin 19 (1992), S� 103- 124�
–: Træk af Trøjborgs bygningshistorie 1347- 1854� In: Hikuin 19 (1992), S� 153- 178�
Hingst, Hermann: Eine Mittelalterliche Burganlage in Ramsdorf, Kr� Rendsburg- Eckernförde� In: Offa� Berichte und Mitteilungen zur Urge-schichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 28 (1971) S� 139- 144�
–: Haneburg, ein mittelalterlicher Burghügel in Wester- Ohrstedt, Kreis Nord-friesland� In: Offa� Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühge-schichte und Mittelalterarchäologie 30 (1973), S� 133- 155�
Hinz, Herrmann: Motte und Donjon� Zur Frühgeschichte der mittelalterli-chen Adelsburg� Köln 1981 (Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 1)�
Hirschfeld, Peter: Herrenhäuser und Schlösser in Schleswig- Holstein� Mün-chen 51980�
Hoffmann, Erich/Lubowitz, Frank (Hgg�): Die Stadt im westlichen Ostsee-raum� Vorträge zur Stadtgründung und Stadterweiterung im hohen Mit-telalter� Frankfurt a� M� u� a� 1995 (Kieler Werkstücke: Reihe A, Beiträge zur schleswig- holsteinischen und skandinavischen Geschichte, 14)�
Höfle, Bernhard/Wagener, Olaf: Burgen in der Landschaft – Inszenierung und Entzifferung anhand neuer Methoden� In: Wagener, Olaf (Hg�): Sym-bole der Macht? Aspekte mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Architek-tur� Frankfurt a� M� 2012, S� 123- 152�
Lizenziert für U. Müller
90 Ulrich Müller
Hofmeister, Hermann: Die Wehranlagen Nordalbingiens� Zusammenstel-lung und Untersuchung der urgeschichtlichen und geschichtlichen Burgen und Befestigungen, Bd� 1� Lübeck 1917�
Jarchov, Otto: Die Ritterburg in Havekost� In: Jahrbuch für Heimatkunde 15 (1981), S� 74- 79�
Kalmring, Sven: Hedeby Hochburg – Theories, State of Research and Da-ting� In: Offa� Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschich-te und Mittelalterarchäologie 71 (2014) [Im Druck]�
Kock, Jan: Dendrochronological dating and research into fortresses in Den-mark� In: Château Gaillard 25 (2012), S� 211- 221�
–/Kristiansen, Mette: Skjern slot� En undersøgelse af en borg og dens om-givelser gennem middelalder og renæssance� In: Kuml� Årbog for Jysk Arkaeologisk Selskab (2010), S� 129- 177�
König, Gerd G�: Motte „Bokop“ bei Groß Zecher� In: Führer zu archäologi-schen Denkmälern in Deutschland 2, Kreis Herzogtum Lauenburg II� Stutt-gart 1983 (Schriftreihe der Stiftung Herzogtum Lauenburg, 4), S� 82- 85�
Kraack, Detlev: Die frühen Schauenburger als Grafen von Holstein und Stor-marn (12�- 14� Jahrhundert)� In: Rasmussen, Carsten Porskrog/Imberger, Elke/Lohmeier, Dieter/Momsen, Ingwer (Hgg�): Die Fürsten des Landes, Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg� Neumüns-ter 2008, S� 29- 51�
Krants Larsen, Lars: Tønderhus� En købstadsborg i hertugdømmet Slesvig� Tondern 2010�
Kühl, Joachim: Burg Stegen� Archäologische Ausgrabungen auf der mittel-alterlichen Burg des Johann von Hummersbüttel� In: Denkmalpflege im Kreis Stormarn 3 (1997), S� 238- 251�
–: Slamersekede – ein Adelssitz des späten Mittelalters im Kreis Stormarn� In: Archäologische Nachrichten aus Schleswig- Holstein 12 (2001), S� 115- 144�
–: Untersuchung und Restaurierung an dem spätmittelalterlichen Turmhügel von Havekost, Kr� Ostholstein� In: Die Heimat 91 (1984), S� 83- 94�
–: Von der Burg zum Herrenhaus� Unter besonderer Berücksichtigung der Kemlade von Travenhorst, Kreis Segeberg� In: Heimatkundliches Jahr-buch für den Kreis Segeberg 54 (2008), S� 12- 59�
Lange, Ulrich: Grundlagen der Landesherrschaft der Schauenburger in Holstein, 2 Teile� Teil I� In: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig- Holsteinische Geschichte 99 (1974), S� 9- 93; Teil II� In: Ebd� 100 (1975), S� 83- 160�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 91
Langenheim, Kurt: Untersuchungen auf der „Müggenburg“ bei Ratzeburg� In: Die Heimat 59 (1952), S� 179- 182�
Leister, Ingeborg: Rittersitz und adeliges Gut in Holstein und Schleswig� Kiel 1952 (Schriften des Geographischen Instituts der Universität Kiel, 14,2; Forschungen zur deutschen Landeskunde, 64)�
Lemm, Thorsten: Die frühmittelalterlichen Ringwälle im westlichen und mittleren Holstein� Neumünster 2013 (Schriften des Archäologischen Landesmuseums, 11)�
Löw, Martina: Raumsoziologie� Frankfurt a� M� 2001 (Suhrkamp- Taschenbuch Wissenschaft, 1506)�
Loewe, Gudrun: Ritzerauer Hof bei Nusse� In: Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 2, Kreis Herzogtum Lauenburg II� Stuttgart 1983 (Schriftreihe der Stiftung Herzogtum Lauenburg, 4), S� 113- 119�
Lübke, Cornelia: Eine Burg und ihre Bauern – Das Gut Rosenkranz und die Gemeinde Schinkel im Lichte neuer Ausgrabungen� In: Archäologische Nachrichten aus Schleswig- Holstein (2013), S� 94- 100�
Lüth, Phillip: Diachrone Studien zur prähistorischen Siedlungslandschaft im Bereich der Plöner Seenplatte� Neumünster 2012 (Offa- Bücher, 88)�
Madsen, Lennart: Grimsborg, Jels, Refsø og Dresvold� In: Hikuin 19 (1992), S� 89- 102�
March, Ulrich: Die holsteinische Heeresorganisation im Mittelalter� In: Zeit-schrift der Gesellschaft für Schleswig- Holsteinische Geschichte 99 (1974), S� 95- 139�
Mayr, Valentin: Kemladen, Pfahlbauten des Spätmittelalters in Schleswig- Holstein und Mecklenburg� Ungedruckte Diplomarbeit� Kiel 1998�
Meier, Dirk: Schleswig- Holstein im frühen Mittelalter: Landschaft – Archäo-logie – Geschichte� Heide 2011�
–: Schleswig- Holstein im hohen und späten Mittelalter: Landesausbau – Dörfer – Städte� Heide 2012�
Meyer, Hans: Schwabstedt� 5000 Jahre Schwabstedter Geschichte� Eckern-förde 1986�
Möller, Gunnar: Mittelalterliche niederadlige Wohnbauten in Vorpommern� In: Biermann, Felix/Mangelsdorf, Günter (Hgg�): Die bäuerliche Ostsied-lung des Mittelalters in Nordostdeutschland� Untersuchungen zum Lan-desausbau des 12� bis 14� Jahrhunderts im ländlichen Raum� Frankfurt a� M� 2005 (Greifswalder Mitteilungen, 7), S� 355- 364�
Lizenziert für U. Müller
92 Ulrich Müller
Müller- Wille, Michael: Zwischen Kieler Förde und Wismarbucht� Archäo-logie der Obodriten vom späten 7� bis zur Mitte des 12� Jahrhunderts� In: Ders� (Hg�): Zwischen Starigard/Oldenburg und Novgorod� Beiträge zur Archäologie west- und ostslawischer Gebiete im frühen Mittelalter� Neumünster 2011 (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, 10), S� 44- 61�
Müller, Ulrich: Der „limes saxoniae“ – Deutungshorizonte und Deutungsho-heiten in der Forschung nach 1945� In: Smolnik, Regina (Hg�): Umbruch 1945? Die prähistorische Archäologie in ihrem politischen und wissen-schaftlichen Kontext� Dresden 2012 (Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 23), S� 138- 153�
–: Die Befestigungen von Kiel – Stadtmauer, Forts und Bunker von später 13� Jh� bis 1945� In: Gläser, Manfred (Hg�): Lübecker Kolloquium zur Stadt-archäologie im Hanseraum VI: Die Stadtbefestigungen des Mittelalters und der Neuzeit� Lübeck 2010, S� 427- 444�
–: Die Olsborg – eine Inselsiedlung um das Jahr 1000� In: Biermann, Felix/Kersting, Thomas/Klammt, Anne (Hgg�): Der Wandel um 1000� Beiträ-ge der Sektion zur Slawischen Frühgeschichte der 18� Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Greifs-wald, 23� bis 27� März 2009� Langenweißbach 2011 (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropa, 60), S� 85- 96�
–: Grenzen, Grenzgänger, Grenzregionen� In: Krieger, Martin/Lubowitz, Frank/Frandsen, Steen Bo (Hgg�): 1200 Jahre deutsch- dänische Grenze� Neumünster 2013 (zeit + geschichte, 28), S� 47- 69�
Nakoinz, Oliver: Burgen und Befestigungen an der Schlei� In: Archäologi-sche Nachrichten aus Schleswig- Holstein 13 (2005), S� 91- 131�
Neuß- Aniol, Helene: Die Hatzburg bei Wedel, Kreis Pinneberg� Archäolo-gische Ausgrabung und historische Quellen� In: Offa� Berichte und Mit-teilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 49/50 (1992/1993), S� 465- 511�
Nowotny, Jörg: Das Rätsel der Papstbulle – Die mittelalterliche Wüstung Tramm in Plön� In: Archäologische Nachrichten Schleswig- Holstein 2009 (2009), S� 96- 99�
Pelc, Ortwin: Burg, Tor und Mauer� Die Befestigung der schleswig- holsteinischen Städte im Mittelalter� In: Lohmeier, Dieter/Paczkowski, Renate (Hgg�): Landesgeschichte und Landesbibliothek� Studien zur Ge-schichte und Kultur Schleswig- Holsteins� Heide 2002, S� 21- 45�
Piper, Otto: Burgenkunde: Bauwesen und Geschichte der Burgen� München 31912 [Neudruck Augsburg 1994]�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 93
Porath, Antina: Ein Adelssitz des 16�/17� Jahrhunderts in Wotersen, Kr� Her-zogtum Lauenburg� Vorbericht der Grabung 1988� In: Archäologisches Korrespondenzblatt 20 (1990), S� 235- 239�
Poulsen, Bjørn: Pest, krig, skat og stormflod – tiden 1340- 1430� In: Ethel-berg, Per/Madsen, Orla (Hgg�): Det Sønderjyske Landbrugs Historie� Ha-derslev 2003, S� 493- 537�
Prange, Wolfgang: David Wackerbarts Bergfried in Sterley� Lauenburgische Heimat Neue Folge 21 (1958), S� 10- 15�
Prehn, Heinz Wolfgang: Gesellschaft, Wirtschaft und Verfassung in Althol-stein� Neue siedlungs- und agrarhistorische Beiträge zur sächsischen So-zialstruktur nach Quellen aus dem sächsisch- slavischen Grenzgebiet vom frühen bis zum hohen Mittelalter� Hamburg 1958�
Radtke, Christian: Bemerkungen zur Funktion und Datierung von Turmhügelburgen nördlich der Eider� In: Jahrbuch für die Schleswigsche Geest 24 (1976), S� 38- 44�
–: Die Oldenburg an der Schleimündung� In: Offa� Berichte und Mittei-lungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 38 (1981), S� 333- 347�
Reichstein, Joachim, Leckhus� Zur Lage der mittelalterlichen Turmhügel-burg in Leck� In: Die Heimat 88 (1981), S� 24- 31�
Riediger, Hans/Koehler, Bernd: Feldsteinkirchen, Burgen und Herrensitze im Gebiet des Limes Saxoniae� Reinbek 1968 (Landschaften um Hamburg, 1)�
Risch, Hans Gerhard: Der holsteinische Adel im Hochmittelalter� Eine quantita-tive Untersuchung� Frankfurt a� M� u� a� 2010 (Kieler Werkstücke: Reihe A, Beiträge zur schleswig- holsteinischen und skandinavischen Geschichte, 30)�
–: Die „curia“ in Lütjensee� Ein spätmittelalterlicher Wohnsitz im Kreis Stor-marn, 2 Teile� Teil I� In: Die Heimat 95 (1988), S� 193- 199; Teil II� In: Ebd� 96 (1989), S� 64- 96�
–: Die mittelalterlichen Burgen im Kreis Pinneberg� Ein Überblick zum der-zeitigen Forschungsstand� In: Gläser, Manfred (Hg�): Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum� Rostock 1993 (Schriften des Kulturhistorischen Museums in Rostock, 1), S� 167- 174�
–: Die mittelalterliche Burg Ahrensfelde� In: Jahrbuch des Alstervereins (1987), S� 40–46�
–: Form und Funktion� Einige theoretische Gedanken zur Entwicklung der mittelalterlichen Burgen im Gebiet nördlich der Elbe� In: Falk, Alfred (Hg�): Lübeck und der Hanseraum� Beiträge zur Archäologie und Kultur-geschichte� Lübeck 2014, S� 245- 262�
Lizenziert für U. Müller
94 Ulrich Müller
Rösch, Felix: Die Wüstung Bad Malente- Grellenkamp� Eine Siedlung des hochmittelalterlichen Landesausbaus in Ostholstein� Bonn 2012 (Univer-sitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, 212)�
– u� a�: Die „Jürgensburg“ auf der Möweninsel in Schleswig� In: Offa� Be-richte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalte-rarchäologie 72 (2015) [Im Druck]�
Schmid- Hecklau, Arne: Slawenzeitliche Funde im Kreis Herzogtum Lauen-burg� Neumünster 2002 (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäolo-gie der Ostseegebiete, 3)�
Schneider, Manfred: Stülper Huk� Hirtenberg und Befestigung� In: Gläser, Manfred/Carnap- Bornheim, Claus von (Hgg�): Hansestadt Lübeck� Aus-flugsziele zwischen Lübeck und Travemünde� Stuttgart 2013 (Ausflüge zu Archäologie, Geschichte und Kultur in Deutschland, 56), S� 210- 212�
Schnieck, Rüdiger: Archäologische Studien zur nachslawischen Besiedlung zwischen Limes Saxoniae und Warnow� Bonn 2003 (Universitätsfor-schungen zur prähistorischen Archäologie, 103)�
Schütt, Hans- Friedrich (Hg�): Die als Steinbau errichtete Turmburg in Flens-burg� In: Offa� Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschich-te und Mittelalterarchäologie 53 (1996), S� 317–325�
–: Flensburg in Bild und Wort� Von den Anfängen bis zum 20� Jahrhundert� Flensburg 2003�
Schwarz, Uwe: Die niederadligen Befestigungen des 13� bis 16� Jahrhunderts im Bezirk Neubrandenburg� Berlin 1987 (Beiträge zur Ur- und Frühge-schichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg, 20)�
Segschneider, Martin (Hg�): Ringwälle und verwandte Strukturen des ersten Jahrtausends n� Chr� an Nord- und Ostsee� Neumünster 2009 (Schriften des Archäologischen Landesmuseums, Ergänzungsreihe 5)�
Seider, Helge: Die Burgen in Schleswig- Holstein� Die Adelssitze und Bauern-dörfer des 12� bis 17� Jahrhunderts im Kreis Plön� Unveröffentlichtes Ma-nuskript im Archiv des Archäologischen Landesmuseums Schloss Gottorf�
Skaarup, Jørgen: Øhavets middelalderlige borge og voldsteder� Rudkøbing 2005�
Struve, Karl- Wilhelm: Archäologische Ergebnisse zur Frage der Burgenorga-nisation bei den Sachsen und Slawen in Holstein� In: Blätter für deutsche Landesgeschichte 106 (1970), S� 47- 52�
–: Burghügel beim Forsthaus Schevenböck� In: Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 2, Kreis Herzogtum Lauenburg II� Stuttgart 1983, S� 121- 123�
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 95
–: Burg im „Rebbenbruch“ bei Borstof� In: Führer zu archäologischen Denk-mälern in Deutschland 2, Kreis Herzogtum Lauenburg II� Stuttgart 1983, S� 124- 126�
–: Burg Linau� In: Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 2, Kreis Herzogtum Lauenburg II� Stuttgart 1983, S� 109- 113�
–: Die Ausgrabung eines spätmittelalterlichen Herrenhauses auf der „Schier-au“ bei Garbek, Kr� Segeberg� In: Die Heimat 84 (1977), S� 159- 167�
–: Die Burgen in Schleswig- Holstein� Die slawischen Burgen� Neumünster 1981 (Offa- Bücher, 35)�
–: Grundzüge der schleswig- holsteinischen Burgenentwicklung im Mittelal-ter� In: Die Heimat 80 (1973), S� 98- 106�
–: Mittelalterliche Pfahlbauten in Seen und ihre Deutung als Wehranlagen� In: Die Heimat 72 (1965), S� 341- 347�
–: Teilprojekt A 3, Burgwallcorpus Schleswig- Holstein, Sonderforschungs-bereiches 17, Skandinavien- und Ostseeforschung, Christian- Albrechts- Universität zu Kiel, Abschlussbericht 15� Kiel 1984, S� 217- 243�
Szczesiak, Rainer: Befestigte und unbefestigte niederadlige Herrensitze im Land Stargard vom 13� bis 16� Jh� Darstellung an ausgewählten Beispie-len� In: Biermann, Felix/Mangelsdorf, Günter (Hgg�): Die bäuerliche Ost-siedlung des Mittelalters in Nordostdeutschland� Untersuchungen zum Landesausbau des 12� bis 14� Jahrhunderts im ländlichen Raum� Frank-furt a� M� 2005 (Greifswalder Mitteilungen, 7), S� 365- 390�
Unverhau, Henning: Anfang und frühe Entwicklung der Stadt Eckernförde� In: Jahrbuch der Heimatgemeinschaft Eckernförde 53 (1995), S� 151- 172�
Vasiliadis, Stefan: Motten in Schleswig- Holstein� Unveröffentlichte Bache-lorarbeit� Kiel 2012�
Willert, Hans: Die Städtegründungen in Holstein im 13� Jahrhundert� In: Hoffmann, Erich/Lubowitz, Frank (Hgg�): Die Stadt im westlichen Ost-seeraum� Vorträge zur Stadtgründung und Stadterweiterung im hohen Mittelalter� Frankfurt a� M� u� a� 1995 (Kieler Werkstücke: Reihe A, Bei-träge zur schleswig- holsteinischen und skandinavischen Geschichte, 14), S� 109- 132�
Zeune, Joachim: Burgenforschung in Niedersachsen� Hochmittelalter und Spätmittelalter� In: Archäologie in Niedersachsen (2013), S� 36- 40�
Lizenziert für U. Müller
96 Ulrich Müller
Tabelle 1: Vergleich der Siedlungsentwicklung in den Siedlungskammern Futter-kamp und Wahlstorf in Ostholstein
Futterkamp Datierung Wahlstorf DatierungHochborre I 11�/12� Jh� Probstenwerder 9�- 12� Jh� (?)
Großer Schlichtenberg I
um 1200 bis um 1300
Altenhöfen 1232 (?) bis 1338
Großer Schlichtenberg II
um 1300 bis um 1400
Kleiner Schlichtenberg
1356/57 bis 1360/70
„Goldburg“ CalAD 1319- 1351 (36,3%)CalAD 1390- 1425 (59,1%)
Hochborre II Mitte 14� Jh� bis Mitte 15� Jh�
Wahlstorf – Burg ab Mitte 14� Jh� (?) bis Mitte 15� Jh� (?)
Gut Futterkamp ab 1433 Wahlstorf – Gut ab 1469
Abb. 1,1: Burg Havekost bei Ahrensbök, Kr. Ostholstein. Grabungsbefunde (nach Kühl, Havekost, S. 86, Abb. 5)
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 97
Abb. 1,2: Burg Havekost bei Ahrensbök, Kr. Ostholstein, Kr. Topografie (nach Dähn, Turmhügel, S. 156)
Abb. 2: Travenhost, Befunde der Kemlade (nach Kühl, Travenhorst, S. 28 Abb. 11)
Graben I
0 40m
N
Trave
Gra
ben
II
Lizenziert für U. Müller
98 Ulrich Müller
Abb. 3,1: Alt- Gottorf bei Gut Falkenburg, Kr. Schleswig- Flensburg. Geländemodell auf der Datengrundlage des DGM 1 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
100m
Profil
Abb. 3,2: Alt- Gottorf bei Gut Falkenburg, Kr. Schleswig- Flensburg. Höhenschnitt auf der Grundlage des DGM1
38m
36m
34m
32m
30m
0m 25m 50m 75m 100m 125m 150m
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 99
Abb. 4,1: Treia, Kr. Schleswig- Flensburg. Geländemodell auf der Datengrundlage des DGM 1 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
100m
Profil
Abb. 4,2: Treia, Kr. Schleswig- Flensburg. Höhenschnitt auf der Grundlage des DGM1
4,0m
4,5m
3,5m
3,0m
0m 25m 50m 75m 100m
Lizenziert für U. Müller
100 Ulrich Müller
Abb. 5,1: Neuhaus bei Giekau, Kr. Plön. Geländemodell auf der Datengrundlage des DGM 1 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
100m
Profil
Abb. 5,2: Neuhaus bei Giekau, Kr. Plön. Höhenschnitt auf der Grundlage des DGM1
41m
40m
39m
38m
36m10m9m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 101
Abb. 5,3: „Waterborg“ bei Giekau, Kr. Plön. Burganlage (nach Dähn, Turmhügel, S. 270)
Abb. 6: Bramhorst bei Wisch, Kr. Plön. 3- D Geländemodell auf der Datengrundlage des DGM 1 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
Lizenziert für U. Müller
102 Ulrich Müller
Abb. 7,1: Steinburg bei Süderau, Kr. Steinburg. Geländemodell auf der Datengrundlage des DGM1 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
100m
Profil
Abb. 7,2: Steinburg bei Süderau, Kr. Steinburg. Höhenschnitt auf der Grundlage des DGM1
2m
3m
1m
0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 103
Abb. 8: Burg Stegen bei Bargfeld- Stegen, Kr. Stormarn. Gesamtanlage (nach Kühl, Burg Stegen, S. 240 Abb. 2)
Abb. 9: Gut Tralau, Gmde. Travenbrück, Kr. Stormarn. Topografie auf der Datengrundlage der TK5 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
Lizenziert für U. Müller
104 Ulrich Müller
Abb. 10: Mittelalterliche Burgen der ostholsteinischen Seenplatte (Lüth, Siedlungsentwicklung, S. 158, Abb. 113)
5 km15. Jh.14. Jh.13. Jh.vor 1200ohne Datierung
Abb. 11,1: Burg Neuschlag bei Grebin, Kr. Plön. Geländemodell auf der Datengrundlage des DGM 1 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
100m
Profil 2
Profil 1
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 105
Abb. 11,2: Burg Neuschlag bei Grebin, Kr. Plön. 1: Höhenschnitt durch die Vorburg auf der Grundlage des DGM1. 2: Höhenschnitt durch die Kernburg auf der Grundlage des DGM1
29m
28m
27m
26m0m 20m10m 30m 50m40m 60m 80m70m 90m
35m
30m
25m
0m 50m 100m 150m 200m
1
2
Abb. 12: Lanker See, Kr. Plön. Lage der Burganlagen am südlichen See (Lüth, Siedlungsentwicklung, S. 162 Abb. 118)
1km
Goldburg Wahlstorf
BurgGut
Altenhöfen
5 km
Lizenziert für U. Müller
106 Ulrich Müller
Abb. 13,1: Motte Goldburg bei Kühren, Kr. Plön. Geländemodell auf der Datengrundlage des DGM 1 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
100m
Abb. 13,2: Motte Goldburg bei Kühren, Kr. Plön. Höhenschnitt auf der Grundlage des DGM1
21m
20m
0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 107
Abb. 13,3: Altenhöfen, Wahlstorf, Kr. Plön. Geländemodell auf der Datengrundlage des DGM2 (nach Lüth, Siedlungsgeschichte, S. 163, Abb. 119)
Abb. 13,4: Burg Wahlsburg bei Gut Wahlstorf, Kr. Plön. Geländemodell auf der Datengrundlage des DGM 1 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
100m
Lizenziert für U. Müller
108 Ulrich Müller
Abb. 14,1: Burg im Gut Rosenkranz bei Schinkel, Kr. Rendsburg- Eckernförde. Topografie auf der Datengrundlage der TK5 © GeoBasis- DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig- holstein.de)
Abb. 14,2: Burg im Gut Rosenkranz bei Schinkel, Kr. Rendsburg- Eckernförde. Höhenschnitt auf der Grundlage des DGM1
10m
9m
8m
0m 10m 20m 30m 40m 50m
Lizenziert für U. Müller
Die archäologische Perspektive 109
Abb. 15: Curia Eckhorst bei Eckhorst, Kr. Ostholstein (Bokelmann, Eckhorst, Abb. 4)
Abb. 16,1: Alt- Wensin bei Garbek, Kr. Segeberg. Grabungsbefunde (Struve, Garbek, Abb. 4)
Lizenziert für U. Müller