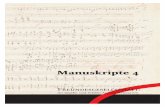Schaefer_Jaeger 1984_Verkohlte Steinkerne der Kornelkirsche (Cornus Mas L.) aus dem Palaeolithikum...
Transcript of Schaefer_Jaeger 1984_Verkohlte Steinkerne der Kornelkirsche (Cornus Mas L.) aus dem Palaeolithikum...
Alt-Thüringen 20 S. 15-22 Böhlau Weimar 1984
DIETER SCHÄFER KLAUS-DIETER JÄGER
VERKOHLTE STEINKERNE DER KORNELKIRSCHE (CORNUS MAS L.)
AUS DEM PALÄOLITHIKUM DES OBEREN TRAVERTINS
VON WEIMAR-EHRINGSDORF
Seit mehreren Jahrzehnten zahlen die Travertinaufschlüsse von Weimar-Ehringsdorf
zu den wichtigsten Fundplätzen paläolithischer Artefakte wie auch
pleistozäner Menschen in Mitteleuropa. Teile des umfangreichen Fundgutes
wurden im Schrifttum wiederholt vorgelegt und diskutiert (bes. SCHUSTER 1928;
BEHM- BLANCKE 1960; FEUSTEL 1983; VLÔEK 1984). Eine Vielzahl geologischer
und paläontologischer Untersuchungen haben dazu geführt, daß die örtlichen Verhältnisse
im Zeitraum der Entstehung und urgeschichtlichen Besiedlung des
Ehringsdorfer Travertins verhältnismäßig gut bekannt sind, und durch STEINER/
WIEFEL (1974; 1977) sind die zahlreichen Veröffentlichungen aus früheren Jahrzehnten
bibliographisch erschlossen worden. Im letzten Jahrzehnt wurde zunächst
die umfangreiche Forschungsgeschichte durch eine zweibändige Monographie
bereichert, die eine systematisch angelegte Folge von Spezialuntersuchungen
über geologische Verhältnisse und paläontologische Funde enthält (Das Pleistozän
von Weimar- Ehringsdorf 1974; 1975). Hinzu kommt der Versuch einer
resümierenden Analyse des gegenwärtigen Kenntnisstandes durch STEINER (1979).
über Neufunde von paläoökologisch interessanten Wirbeltierresten berichtet
HEINRICH (1980). Mehrfach erfolgten Problemanalysen zur stratigraphischen Korrelation
und zeitlichen Stellung des Travertinvorkommens (STEINER 1979; JÄGER/
HEINRICH 1979; 1982; HEINRICH 1982) zuletzt anhand einer Serie neuer radiometrischer
Daten durch BRUNNACKER et al. (1983).
Insgesamt hat also Ehringsdorf von seiten mehrerer Forschungseinrichtungen
größere Aufmerksamkeit erfahren als viele andere bedeutsame Fundplätze altsteinzeitlicher
Artefaktinventare und Menschenreste in Mitteleuropa. Dennoch
ist nicht nur die Diskussion um die geochronologische Position des Travertins und
seiner Funde noch immer kontrovers (STEINER 1979; JÄGER/HEINRICH 1979; 1982,
FEUSTEL 1983; HEINRICH 1981). Die Fortdauer des Travertinabbaues trägt aber
dazu bei, durch Neufunde das Bild der paläolithischen Kultur von Ehringsdorf
zu ergänzen und abzurunden. Solche Erkenntnisfortschritte müssen nicht unbedingt
an die Auffindung weiterer Silexartefakte, Jagdbeutereste oder Skelettreste
des Menschen selbst gebunden sein. Vielmehr können in diesem Zusammenhang
auch Beobachtungen ganz anderer Art archäologische Bedeutung erhalten,
was im folgenden dargelegt wird.
**
Im Winter 1980/81. wurde im Travertinsteinbruch Weimar- Ehringsdorf mit
neuen Erschließungsarbeiten westlich und südwestlich des alten Hauboldbruches
(zur Lage siehe STEINER 1974, S. 33, Abb. 13) begonnen. Damit konzentrierte
sich die - im Verhältnis zu den fünfziger und sechziger Jahren allerdings verhältnismäßig
kleinräumige - Abbautätigkeit wieder auf Bereiche in relativer Nachbarschaft
der klassischen Fundlokalitäten (Forschungspfeiler bzw. Bruch Fischer
in etwa 80-150 in Entfernung; Abb. 1). Während des Frühjahrs 1981 wurde der
Abbau des Oberen Travertins erheblich beschleunigt. Infolgedessen waren im
MaisJuni 1981 von seiner Gesamtmächtigkeit stellenweise nur noch wenige Dezimeter
Travertin bzw. Travertinsand über dem Pariser vom Abbau verschont geblieben
(Taf.II'1). Gerade erst freigelegte Flächen dieses Bruchabschnittes beging
D. Schäfer am 5. 6. 1981. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Travertinsandschicht
untersucht (Taf. III), in der sich konzentriert auf einer Fläche von etwa 20 X 20 cm
in gleichem Höhenniveau 20 verkohlte karpologische Reste (MW 523/83) fanden,
deren Bearbeitung K. -D. Jäger übernahm.
Die Fundschicht wurde in einem Höhenabstand von 50-60 cm über der Bodenbildung
auf dem Pariser im Oberen Travertin angetroffen und wies eine Mächtigkeit
von 10-25 cm auf. Sie bestand aus unverkittetem "Travertinsand" (zu
dieser Terminologie vgl. WAGENBRETH/STEINER 1974, S. 83), in dem Travertinknollen
von geringer Festigkeit (Form flach bis unregelmäßig rund, Dm im Mittel
bei 1-2 cm, selten mehr als 3 cm) eingelagert waren. Die gesamte Schicht war in
trockenem Zustand von sehr blasser brauner Farbe (MUNSELL 10 YR 8/4... 7/3).
Eine Parallelisierung dieser Fundschicht mit bestimmten Abschnitten der Kernbohrungen
von Ehringsdorf (vgl. STEINER/%\AGENBRETH 1971, S. 50, Abb. 2,
Kernbohrungen 57-59, S. 71-73) ist nicht möglich, da einerseits mit Kernverlusten
zu rechnen ist (frdl. Mitt. y. Dr. W. Steiner). Andererseits sind die Bohrstellungen
zu weit hangaufwärts entfernt, als daß sich zu beobachtende Faziesveränderungen
nicht auswirken würden. Daher bleibt zunächst nur die Feststellung, daß nach
der feinstratigraphischen Unterteilung das Ehringsdorfer Travertinpaketes die
Fundschicht im (offenen) Rahmen des Typusprofiles 7 liegt (WAGENBRETH/STEI-NER
1974, S. 89, 91, Abb. 5). Auch hier traten bis zu Beginn der fünfziger Jahre
- wie auch neuerdings wieder - Artefaktfunde auf.
Die aus dieser Schicht geborgenen 20 karpologischen Reste liegen sämtlich in
verkohltem Zustand vor. Es handelt sich dabei um walzenförmige Gebilde, die
eine gewisse Ähnlichkeit mit Dattelkernen haben (Taf. IV, a), sich von diesen aber
durch ausgesetzte Leisten unterscheiden. Dieses Merkmal begegnet in analoger
Weise bei rezenten Steinkernen von Cornus inas L. (Taf. IV, b), die auch ähnliche
Abb. 1: Der TravertintagebauWeimar-Ehringsdorf mit den wichtigstenBrüchen, verändert nachSTEINER(1979, S. 32, Abb. 13) 1: Begrenzungdes Travertinvorkommens;- 2: alte verfüllte Steinbrüche
im Travertin; - 3: Umgrenzungder ehemaligenBrüche Fischerund Kaempfe (nicht mehrvorhandeneBruchwände); 4: Tagebaugrenzen1974/75 (Einstellungdes großflächigenAbbaus);-5: Steinbruchfür Werksteingewinnung;- 6: Abbaustand1982 des (ehemaligen)nördlichenHaubold-Bruches;
- 7: Steilhangzur Tim
Abmessungen besitzen. Für 16 Steinkerne liegt der Durchmesser bei jeweils5 mm,
wobei die Längen in diesen Fällen zwischen 7 und 10 mm variieren. Viermal wird
der Durchmesser von 5,0 mm überschritten (Maximalwert 6,5 mm). Bei diesen
Steinkernen betragen die Werte für die Länge 8-11 mm. Die Mittelwerte für die
Ehringsdorfer Serie belaufen sich für die Länge auf 9,2 mm, für den Durchmesser
auf 5,6 mm. Unsere Meßwerte an rezenten Steinkernen von Cornus mae L. aus der
Dresdener Elbtalweitung liegen zwischen 13 und 15 mm für die Länge und bei
6 mm für die Breite und damit innerhalb der von BROUWER/STÄHLIN (1955, S. 141)
angegebenen Wertespanne. Experimentelle Erfahrungen über Art und Ausmaß
von Meßwertveränderungen durch den Verkohlungsprozeß liegen unseres Wissens
für die Steinkerne von Cornus inas L. bisher nicht vor.
Diagnostisch entscheidend ist aber der Vergleich der Querschnittsbilder bei
den Fossilresten aus Ehringsdorf mit solchen rezenter Steinkerne von Cornus
mae L. (Taf. IV, e, d). Dieser Vergleich sichert die Zugehörigkeit der angetroffenen
Fossilreste zur Gattung Cornus. Sie wird in naturnahen Gehölzbeständen Mitteleuropas
durch drei Arten vertreten. Dazu gehört der rote Hartriegel (Cornus
sanguinea L.), dessen europäisches Verbreitungsgebiet von den Mittelmeerländern
im Süden bis in das südliche Skandinavien im Norden reicht (Details bei HEal
1906-1931, V, 2 S. 1556.) Die zweite Art ist der Schwedische Hartriegel (Cornus
suecica L.), dessen nordeuropäisches Verbreitungsgebiet nur im Tiefland südlich
und westlich der Ostsee nach Mitteleuropa übergreift (Karte bei HEGT 1906-1931,
V 2, S. 1556). Bei dieser Art erreichen die Steinkerne lediglich eine Länge von
etwa 3 mm, bei Cornus sanguinea, abgesehen von einer mehr kugeligen Gestalt
und glatten Oberfläche, nur von etwa 5-8 mm (BROTJWER/STÄHLIN, 1955, S. 143;
HEGT 1906-19311 V 2, S. 1546). Bei Cornus inas L. liegt dagegen die Länge der
unverkohlten Steinkerne rezent bei 11-16 mm, der Durchmesser bei 4-7 mm, was
den in Ehringsdorf angetroffenen Verhältnissen entspricht.
Blattabdrücke von Cornus sind aus mitteleuropäischen Interglazialtravertinen
mehrfach belegt, so in Thüringen aus Burgtonna und dem Unteren Travertin
von Ehringsdorf (VENT 1955; 1958; 1978). Diese und andere Nachweise werden
bisher zumeist als Cornus sanguinea L. angesprochen. Jedoch ordnet bereits VENT
(1978, S. 63) im Gegensatz zu HEGT (1906-1931, V, 2, S. 1547) die in Burgtonna
gefundenen , ,Blattunterseitenabdrücke unterschiedlicher Vollständigkeit' ' (VENT
1978, Taf. 15,2), zu "einer nicht bestimmbaren Cornus-Art". Demgegenüber gibt
MAI (1980, S. 8) für den Travertin von Bilzingsleben neben Blattabdrücken, ebenfalls
dort von Cornus san guinea L. unter Swida san guinea (L.) Opiz, Funde von
Cornus- Früchten beider Arten an. Auch in dieser Hinsicht ist der karpologische
Nachweis von Cornus inas L. für den Oberen Travertin von Ehringsdorf bemerkenswert.
Diese Art gehört noch gegenwärtig zur mitteleuropäischen Flora, wo sie in
den Gebirgslandschaften des Südens verstreut auftritt und nach Norden bis in
das nördliche Harzvorland, weiter westlich im Rhein- Gebiet bis nach Aachen
reicht (ROTHMALER/METJSEL/SCHUBERT 1972). Dieses Teilareal findet in den
Mittelmeerländern seine Fortsetzung nach Süden, und dem entspricht in Mitteleuropa
eine deutliche Bindung an Waldgesellschaften der Quercetalia pubescentis
sowie Gebüschbestände des Berberdion, die zu den Prunetalea gehören (vgl.
OBERSDORFER 1957, S. 518ff., 526ff.). Darüber hinaus ist sie in der Gegenwart
als Zierstrauch verbreitet, der vor allem durch seine leuchtend gelben Blütendolden
im Vorfrühling (Blütezeit März/April) auffällt. Generell werden trockene
Standorte bevorzugt. Die Art ist kalkhold (ROTHMALER/MEUSEL/SCHUBERT 1972).
Die Steinkerne werden in den Früchten, ähnlich wie diejenigen der Kirsche, von
genießbarem Fruchtfleisch umschlossen, worauf die Bezeichnung , ,Kornelkirsche"
hinweist. Ihr Genuß ist bereits für das klassische Altertum bezeugt, und die
Römer haben nach PLINIus (Naturalis historia XV, 105) die Kultur der Kornelkirschbäume
mit großer Sorgfalt betrieben (SCHMIDT 1901, Col. 1633). Über Früchte,
die für die Winterbevorratung zubereitet wurden, berichten COLUMELLA (De
re rustica VII 10,3) und OvID (Metamorphosen VIII 665; vgl. SCHMIDT 1901, Col.
1633; HEGI 1906 bis 1931, V, 2). Noch in jüngster Zeit werden die "länglichen,
kirschartigen Früchte" als Obst genossen (BROUWER/STÄHLIN 1955, S. 143). Allerdings
kommen die Früchte im heutigen mitteleuropäischen Areal nicht immer
zur Reife.
Auch von Vögeln (z. B. Saatkrähen) ist bekannt, daß sie gelegentlich Früchte
der Kornelkirsche zusammentragen und verzehren (HEGI 1906-1931, V, 2, S. 552).
Ähnliches wird für die Früchte des Roten Hartriegels (für menschlichen Genuß
ungeeignet) berichtet, die u. a. von Elster, Seidenschwanz und Drossel aufgenommen
werden (HEGI 1906-1931, V, 2, S. 1547).
In bezug auf das Ehringsdorfer Fossilvorkommen dürfte diese Möglichkeit der
Erklärung für die Anhäufung von Steinkernen jedoch wegen ihres Erhaltungszustandes
entfallen, der auf jeden Fall Feuereinwirkung voraussetzt und deshalb
ohne eine Beziehung auf die bereits mehrfach belegte paläolitische Besiedlung des
Geländes zur Entstehungszeit des Oberen Travertins kaum verständlich ist. Es
liegt deshalb nahe, diese Besiedlung sowohl für den Erhaltungszustand der Kornelkirschen-Steinkerne
als auch für ihr Auftreten auf kleiner Fläche verantwortlich
zu machen. Paläolithische Artefakte sind aus dem Oberen Travertin von Ehringsdorf
in verschiedenen Teilen des Bruchgeländes in der Vergangenheit bereits
mehrfach festgestellt worden (vgl. SCHUSTER 1928, S. 199f.; BEHM- BLANCKE 1960,
S. 193). Bis zur Entdeckung einer Brandschicht im Oberen Travertin (STEINER/
STEINER 1975) waren dies freilich nur Einzelfunde, zudem ohne Befundzusammenhang
mit einer Brandschicht. Also war bzw. ist zugleich für die meisten dieser
Stücke die Frage noch offen, ob sie aus einer autochthonen oder allochthonen
Fundposition stammen. Auch die neueren Artefaktfunde - einschließlich derjenigen
im Unteren Travertin') - tangieren nördlich und nordwestlich das Hauptverbreitungsgebiet
der Brandschichten als bisher relativ seltene Einzelstücke im
Gestein.
1) Veröffentlichungin Vorbereitung.
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der starke fazielle Wechsel in den
lithologischen Verhältnissen des Oberen Travertins im nördlichen Haubold- Bruch.
Dieser seit 1981 immer wieder beobachtete Befund läßt sich auf einen ehemals
verhältnismäßig starken Wechsel der Sedimentationsverhältnisse schließen. So
darf damit gerechnet werden, daß in diesem Gelände relativ kleinflächige Travertinriegel
zu verschiedenen Zeiten grundsätzlich begehbar waren. Daß dies auch
tatsächlich der Fall war, legt ein Befund aus der unmittelbaren Nachbarschaft
der karpologischen Reste nahe: 1,80 in über der Oberkante der Bodenbildung des
Parisers fand D. Schäfer am 4. 5. 1981 in einer Travertinsandschicht mehrere
kleine Knochensplitter mit einem dazugehörigen größeren aufgeschlagenen distalen
Humerusende vom Wildschwein (Sue serofa) 2) gemeinsam mit einem kleinen
Abb. 2: Geröllartefaktaus feinkörnigemQuarz. Oberer Travertin des (ehemaligen)nördlichenHaubold-Bruchesvon Ehringsdorf 1/1
2) Für die Beurteilung der Knochenfragmente(MW 524/83) danken die Autoren herzlich HerrnDr. Dr. 11.-I). Kahike, Weimar, sowie insbesondereH. Barthel, Weimar, der zur Absicherungder
infolge alter Beschädigungen(Nagetiere?) schwierigenBestimmungMessungenam Humerusendevornahm.
Quarzgeröll (Taf. 11,2, Abb. 2). Letzteres zeigt zwei Negative an einem der lang-schmale
Enden, die mit der gegenüberliegenden Gerölloberfläche eine Arbeitskante
bilden.3)Abgesehen vom ersten Nachweis von Wildschweinresten aus dem Oberen Travertin
von Ehringsdorf4) wirft dieser Fund zugleich ein Licht auf die prinzipielle
Möglichkeit des Auftretens von autochthonen oder zumindest parautochthonen
Befunden in diesem Bereich des Oberen Travertins mit seinen bisher wenigen
aber interessanten Funden - ein Nachweis, der ohne Zusammenhang mit einer
Brandschicht sicher schwerfällt. Zugleich zeigt sich die Bedeutung der weiteren Begehung
der Ehringsdorfer Travertinbrüche trotz des - verglichen mit früheren Aufschlußverhältnissen
- kleinflächigen Abbaues und vorliegender monographischer
Bearbeitung.
Literatur
BEHM-BLANCKE,G.: AltsteinzeitlicheRastplätzeim Travertingebietvon Taubach,Weimar, Ehringsdorf.- Alt- Thüringen4 (1960). Weimar.
BROUWER,W. ; STÄTTILIN,A. : Handbuchder Samenkundefür Landwirtschaft,Gartenbauund Forstwirtschaft.- Frankfurt a. M., 1955.
BRUNNACKER,K., et. al. : RadiometrischeUntersuchungenzur Datierung mitteleuropäischerTravertinvorkommen.- Ethnogr.-Archäolog.-Z. 24 (1983)S. 217-266. Berlin.
- Das Pleistozänvon Weimar-Ehringsdorf, 1, 2/hrsg.vom Zentr. Geolog.Inst. - Berlin 1974,1975.-(Abh. d. Zentr. Geolog.Inst. - PaläontologischeAbh.; 21, 23).
FEUSTEL,R. : Zur zeitlichenund kulturellenStellungdes Paläolithikumsvon Weimar-Ehringsdorf. -Alt- Thüringen19 (1983)S. 16-42. Weimar.
HEm, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa mit besonderer Berücksichtigungvon Deutschland,Österreichund der Schweiz.- München, 1906-1931.
HEINRICH,W. -D. : BiostratigraphischeAspekte einer neuen Kleinsäugerfaunaaus dem UnterenTravertin von Weimar-Ehringsdorf. - Z. Geol.Wiss.8 (1980)7, S. 923- 927. Berlin.
- Zur stratigraphischenStellungder Wirbeltierfaunenaus den Travertinfundstättenvon Weimar-Ehringsdorfund Taubachin Thüringen.- Z. Geol.Wiss.9 (1981)9, S. 1031-1055. Berlin.
HÜNERMANN,K. A. : Sus serofa Linné aus dem Pleistozänvon Weimar-Ehringsdorf. - In: DasPleistozänvon Weimar-Ehringsdorf. - Berlin, 1975. - 2, S. 251-264. - (Abh. d. zentr. Geol. Inst.Paläont.; 23).
JÄGER,K.-D. ; HEINRICH,W.-D. : Aktuelle Aspekteund Problemebei der quartärstratigraphischen
Einordnungder mittelpaläolithischenTravertinstationvon Ehringsdorfbei Weimar. - Ausgrab.u. Funde24 (1979)6, S. 261-267. Berlin.
- The Travertine at Weimar-Ehringsdorf - An Interglacial Site of Saalian Age? - QuaternaryGlaciationsin the Northern Hemisphere,IGCP - Project 73/1/24, Report No. 7 (1982),S. 98-114.Prague.
3) Material: feinkristallinerQuarz; L GO;Br 36; St 21 mm, Gew.63g; flachovaleForm (MW 525/83).4) Der Bearbeiter des bisherigenEhringsdorferSuiden-Materials, K. A. Hünermann, wertet derenAuftretenim Unteren Travertin folgendermaßen:"Infolgeder großen Übereinstimmungmit rezentenWildschweinenkann für den EhringsdorferSuidenauch dieselbeLebensweiseangenommenwerden.Da rezente Wildschweineauf Kälte empfindlichreagierenund dichte Wälder bevorzugen,sind dieSuiden in der EhringsdorferFauna vorzügliche Faziesfossilienfür interglaziales Waldbiotop."(HÜNERMANN1975,S. 261).
MAI, D. H. : Pflanzenrestedes mitteipleistozänenTravertinsvon Bilzingsleben.- Ethnogr.-Archäol.z.21 (1980)1, S. 4-15. Berlin.
MUNSELLSoil ColorChartsed. by MunsellSoil ColorCompanyInc. Baltimore.-Maryland/USA,1954.OBERDÖRFER,E. : SüddeutschePflanzengeselischaften.- Jena, 1957.ROTIIMALER,W.; MEUSEL,H.; SCHUBERT,R.: Exkursionsflorafür die Gebieteder DDR und BRD:
Gefäßpflanzen.- Berlin, 1972.SCHMIDT,M. C. P.lb.: Cornus.- In Pauly-Wissowa Real-Encyclopädieder CiassischenAltertumswissenschaft,
Neue Bearbeitung.Col. 1633-1635.- Stuttgart, 1901.SCHUSTER,E.: Die altsteinzeitlicheKultur von Ehringsdorf.- In: Der Schädelfundvon Weimar-Ehringsdorffhrsg.
von F. Weidenreich.- Jena, 1928. - S. 141-204.STEINER,W.: Der Travertin von Ehringsdorfund seineFossilien.- Wittenberg Lutherstadt, 1979.-
(Die Neue Brehm-Bücherei; 522).STEINER,IL; STEINER,W.: Ein steinzeitlicherRastplatz im OberenTravertin von Ehringsdorfbei
Weimar. - Alt- Thüringen13 (1975)S. 17-42. Weimar.STErNER,W.; WAGENBRETH,O.: Zur geologischenSituation der altsteinzeitlichenRastplätze im
Unteren Travertin von Ehringsdorfbei Weimar. - Alt- Thüringen11 (1971) S. 47-75. Weimar.STEINER,W.; WIEFEL, H.: Die Travertine von Ehringsdorfbei Weimar und ihre Erforschung.-
In: Das Pleistozänvon Weimar-Ehringsdorf. - Berlin, 1974. -1, s. 11-60. - (Abh. d. zentr. Geol.Inst. Paläont.; 21).
- Zur Geschichteder geologischenErforschungdes Travertins von Taubachbei Weimar. - Berlin,1977. - S. 9-81. - (Quartärpaläontologie;2).
VENT,W. :Überdie Flora desRiß-Würm-Interglazials in Mitteldeutschlandunter besondererBerücksichtigungder Ilmtaltravertinevon Weimar-Ehringsdorf. -Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. 4(1955)
4/5, S. 467-485. Jena.- Die Pflanzenweltder Timtaltravertinevon Weimar-Ehringsdorf zur Unstrut-Warmzeit. - Alt-Thüringen
3 (1958)S. 16-28. Weimar.- Die Flora des Travertins von Burgtonnain Thüringen.- In: Das Pleistozänvon Burgtonnain
Thüringen/hrsg.von H.-D. Kahike. - Berlin, 1978,-S. 59-66. - (Quartärpaläontologie;3).VLÖEK,E.: Weimar-Ehringsdorf. Die Menschenreste.- Weimar, 1984. - (Weimarer Monographien
zur Ur-und Frühgeschichte;6).WAGENBRETH,O.; STEINER,W.: Zur Feinstratigraphieund Lagerungdes Pleistozänsvon Ehringsdorf
bei Weimar. - In: Das Pleistozänvon Weimar-Ehringsdorf. - Berlin, 1974.- 1, S. 77-152.-(Abh. d. zentr. Geol. Inst. Paläont.; 21).
II
): Der (!'hemnlige) nördliche Huubold-Bruch zur Fundzeit der karpologischen Reste (.Juni 1981). Der Pfeil gibt die Lage der FundsteIle an. Fund~ ,
:2: Distales Hnmerusende von Sus scroJa. L. aus dem Oberen Tm vertin von Weimar.Ehringsdorf UT Unterer Travert'
16'
IU
('n Re.ste (Juni 1981). FundsteIle der karpologischen Reste im Oberen Travertin von Ehringsdorf.
u Weima r-Ehringsdorf UT Unterer Travertin; P Pariser; Ab begrabener Boden auf dem Pariser; OT Oberer Travertin
10'
IV
o 3mm
a) Corwus 1I!1t8 L ., verkohlte Stein kerne allS dem Oheren T ra vertin von \\'eimar-Ehringsdorf; b) Cornus 111.(/8 L. , lInvcrkohlte rezente , 't cillkerne aus Sauhsen (Elbta l bei J)resden) ; - c) Comu,o 1/1118 L., \7erkoh lte Stein kerne aus ' Veims l' -Ehringsdorf im QU{,l'sehnittbild: - d) Comu"~ nws 1.., unvcr
kohlte rezente Bteinkcmc a l lS SnehsPIl im Quersehnittbild
















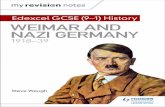



![Kouřil P., Gryc J. 2011: Der Burgwall in Chotěbuz – Podobora und seine Stellung in der Siedlungsstruktur des oberen Odergebietes vom 8. bis zum 9. / 10.Jahrhundert, [in:] J. Macháček,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63156d693ed465f0570b8f58/kouril-p-gryc-j-2011-der-burgwall-in-chotebuz-podobora-und-seine-stellung.jpg)