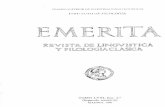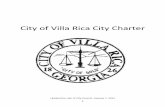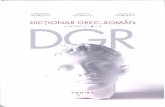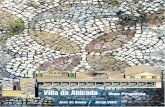Ristow 2011 Cologne St. Pantaleon roman villa and early medieval church SAFM3
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Ristow 2011 Cologne St. Pantaleon roman villa and early medieval church SAFM3
Schriftenreihe
S t u d i e n z u S p ä t a n t i k e
u n d F r ü h m i t t e l a l t e r
Herausgegeben von
Orsolya Heinrich-Tamaska,
Niklot Krohn und
Sebastian Ristow
Band 3
ISSN 1867-5425
Verlag Dr. Kova�
Untergang und Neuanfang
Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmittelalter
3. Siedlungsarchäologie
(Mannheim, 13.–14. Mai 2008)
4. Militaria und Verteidigungsanlagen (Detmold, 1. September 2009)
Herausgegeben von
Jörg Drauschke, Roland Prien und Sebastian Ristow
Verlag Dr. Kova�
Hamburg 2011
VERLAG DR. KOVA� e. K. F A C H V E R L A G F Ü R W I S S E N S C H A F T L I C H E L I T E R A T U R
Leverkusenstr. 13 · 22761 Hamburg · Tel. 040 - 39 88 80-0 · Fax 040 - 39 88 80-55 E-Mail [email protected] · Internet www.verlagdrkovac.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISSN: 1867-5425
ISBN: 978-3-8300-5029-2 © VERLAG DR. KOVA� in Hamburg 2011 Umschlaggestaltung: Verlag Dr. Kova� Umschlagzeichnung: Michael Kinski (nach der Vorlage der Schmuckscheibe von Limons) Redaktion: Hrsg.; Schlussredaktion und Satz: archaeoplanristow (M. Hundt/S. Ristow) Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, fotomechanische Wiedergabe, Aufnahme in Online-Dienste und Internet sowie Vervielfältigung auf Datenträgern wie CD-ROM etc. nur nach schriftlicher Zustimmung des Verlages. Gedruckt auf holz-, chlor- und säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. Archivbeständig nach ANSI 3948 und ISO 9706.
Sebastian Ristow
Frühmittelalterliche Nutzung über römischen Resten im westlichen Suburbium des römischen Köln –
Ausgrabungen unter und in der Umgebung der Kirche St. Pantaleon
Schlagwörter: Köln, Siedlungskontinuität, frühe KirchenbautenKeywords: Cologne, settlement continuity, early church buildings
Die Ausgrabungen bei und unter der romanischen Kirche von St. Pantale-on, unmittelbar vor der Südwestecke der römischen Stadt Köln gelegen, be-gannen in der Zeit großer Zerstörungen am Gebäude während des zweiten Weltkriegs. Schon vor den eigentlichen geregelten Bodenuntersuchungen durch das Römisch-Germanische Museum der Stadt Köln zwischen 1955 und 1962 war durch kleinere Sondagen bekannt, dass römische Baureste vorhanden waren und dass die heutige Kirche ältere Substanz enthält1. Nach der Entdeckung von Fundamenten einer repräsentativ großen und gut ausgestatteten villa suburbana mit Kernstrukturen im Bereich des heutigen Presbyteriums der Kirche äußerte man – entsprechend den damals üblichen Interpretationsansätzen2 – vorschnell das Postulat von der villa als antike Hauskirche. Das Erklärungsmodell der domus ecclesiae, begründet vor allem
1 Zu den ersten kleinmaßstäbigen Bodenöffnungen bei St. Pantaleon: F. Fremersdorf, Fundbeobachtungen und eigene Ausgrabungen der Römischen Abteilung des Wall-raf-Richartz-Museums. Germania 11, 1927, 157–161 hier 161; P. A. Tholen, Ein ottoni-scher Großbau als Saalkirche. Die Baugeschichte auf neuen Spuren – St. Pantaleon in Köln als Beispiel. Westdt. Beobachter 5.2.1936, Die Unterhaltung; F. Fremersdorf, Neue Beiträge zur Topographie des römischen Köln. Röm. Germ. Forsch. 18 (Berlin 1950) 54 f.; ders., Die römische villa suburbana bei der Pantaleonskirche in Köln. In: Festschr. A. Steeger. Niederrheinisches Jahrb. 3, 1951, 24–26; ders., Cologne gallo-ro-maine et chrétienne. In: Mémorial d‘un voyage d‘études de la Sociétée nationale des Antiquaires de France en Rhénanie (Juillet 1951) (Paris 1953) 91–136.
2 Zu diesen Interpretationsproblemen s. Beiträge in: N. Krohn (Hrsg.), Kirchenarchäo-logie heute – Forschungen am Schnittpunkt archäologischer und historischer Wissen-schaften. Veröff. Alemannischen Inst. 77 (Darmstadt 2009). – Zu Beispielen aus dem Rheinland bes. S. Ristow, Frühchristliche Kirchenarchäologie im Rhein-Mosel-Raum. Ebd. 61–90.
Safm3 1303.indd 191 08.08.2008 09:55:49
Ristow192
mit der durch die Kirche beibehaltenen von der Ostung abweichenden Aus-richtung schon der römischen villa und vorgetragen 1956 von Fritz Fremers-dorf3, dem damaligen Kölner Stadtarchäologen und Gründungsdirektor des Römisch-Germanischen Museums, wurde aber noch während der Grabung von seinem Nachfolger Otto Doppelfeld berechtigterweise als nicht begrün-det zurückgewiesen. Schon Doppelfeld erkannte, dass die Abweichung von der Orientierung auf die römische Limitation und den entsprechend schräg aus der Südwestecke der Stadt tretenden Verlauf der römischen Fernstraßen zurückgeht und deshalb keine Kontinuität in der kultischen Nutzung der Bausubstanz angenommen werden muss. Interessant ist, dass Fremersdorf selbst, der seinen Ansatz aber auch nicht weiterverfolgte, in der didaktischen Aufbereitung seiner eigenen Kirchengrabung unter St. Severin, nur wenige Kilometer östlich von St. Pantaleon – ebenfalls außerhalb der römischen Stadt Köln, aber auf einem Gräberfeld gelegen – den Schlüssel zur profanen Begründung der Richtungsabweichung visualisierte. Wie kein anderer Plan zeigt die Ölmalerei in der Grabungszone von St. Severin – ein Unikat – die Lage der Kirchen mit spätantik-frühmittelalterlichen Ursprüngen im Ver-hältnis zur Limitation (Abb. 1). Hier wird sehr deutlich, dass eine genaue Ausrichtung der Kirche nach Osten eigentlich äußerst ungewöhnlich wäre. Das gilt auch für das gesamte heutige Bebauungsraster des Pantaleonsvier-tels. Da aus dem Befund der villa selbst, wie auch aus dem Fundmaterial keine Indizien für die Anwesenheit von Christen am Platz des Hügels von St. Pantaleon vor dem 7. Jh. abgeleitet werden können, ist die Theorie zu einer spätantiken Hauskirche hinfällig. Dennoch wurde sie 2006 überra-schenderweise von archäologischer Seite erneut vorgetragen4. Jetzt wurden neue Argumente in die Diskussion eingeführt, die sich aber nach näherer Prüfung als wissenschaftlich nicht tragfähig erwiesen haben. Im Wesent-lichen handelt es sich neben den schon bekannten retrogressiven Schlüssen zur kirchlichen Baugeschichte, also der Ableitung einer frühchristlichen
3 F. Fremersdorf, Ältestes Christentum. Mit besonderer Berücksichtigung der Gra-bungsergebnisse unter der Severinskirche in Köln. Kölner Jahrb. Vor- u. Frühgesch. 2, 1956, 7–26 hier 18–20. – In seiner Ausgabe Nr. 221 vom 21.9.1956 berichten der Kölner Stadt Anzeiger und ähnlich auch die NRZ in der Ausgabe Nr. 223 vom 23.9.1956 über die Theorien zu einer ‚christlichen Andachtsstätte’ unter St. Pantaleon, die Fremers-dorf der Presse gegenüber erläutert hatte.
4 S. Schütte, Geschichte und Baugeschichte der Kirche St. Pantaleon. Colonia Romanica 21, 2006, 81–136.
Safm3 1303.indd 192 08.08.2008 09:55:49
Ausgrabungen unter und in der Umgebung der Kirche St. Pantaleon 193
Kirche aus der Existenz von späteren, ottonenzeitlichen und romanischen Kirchenbauten am Ort, um zwei weitere Punkte, die Sven Schütte 2006 an-führte: 1. die Existenz frühchristlicher Funde und 2. das Vorhandensein von als christlich eingestufter Architektur, hier besonders eines Baptisteriums.
Die Aussagekraft frühchristlicher Funde als beweglicher Güter, deren Nut-zungszusammenhang und Kenntnis ihrer Bedeutung durch den möglichen Nutzer oft ganz generell gar nicht bestimmt werden können, ist in Bezug auf einen Architekturbefund meist äußerst begrenzt. Im speziellen Fall der von Schütte als spätantik angeführten Funde kommt aber noch hinzu, dass das eine Stück, eine silberne Riemenzunge (Abb. 3), nicht wie von ihm angege-
1 Ölgemälde in der Grabungszone von St. Severin mit Darstellung der römischen Limitation um Köln und der Lage der frühchristlichen Kirchen. Im Südwesten der Stadt (o. li.) St. Pantaleon, im Süden (li.) St. Severin. Die Straße an St. Gereon ist feh-lerhaft rekonstruiert. – Gemälde: Johannes Schumacher, 1956, Foto: Sebastian Ristow, bearb. Horst Stelter, Duisburg.
Safm3 1303.indd 193 08.08.2008 09:55:52
Ristow194
ben aus dem 4. Jh. stammt, sondern karolingerzeitlich ist, und auch bei dem anderen Fund, einer Steinscheibe mit eingelegten Marmorplättchen, eine Datierung erst in ottonische oder noch spätere Zeit wahrscheinlicher sein könnte als ein spätantiker Ansatz (Abb. 4)5. Von Bedeutung ist schließlich, dass die beiden angeführten Funde vollkommen für jede Argumentation um christlichen Bedeutungsgehalt ausfallen, da es sich um Streufunde han-delt. Ferner besaß die Riemenzunge möglicherweise gar kein eingeritztes Kreuzornament, da es sich nach Ausweis eines Fotos des heute nicht mehr auffindbaren Stückes bei diesen Spuren um Korrosion handeln dürfte, die vom Zeichner der 1960er Jahre überinterpretiert wurden6, und auch im an-deren Fall gar kein christlich intendiertes Kreuz als Symbol vorliegt, son-dern lediglich eine im weiteren Sinn kreuzförmige Anordnung steinerner Schmuckplatten in einem kostbaren Bodenfragment7.
Die Theorie zu einem ‚Baptisterium’ des 4. Jhs. oder sogar noch früherer Zeit erweist sich nach Prüfung der Argumente ebenfalls als hinfällig. He-rangezogen wurde von Schütte dazu der Befund eines halb in den Boden eingetieften, holzausgekleideten Erdkellers auf der zur Stadt hin ausgerich-teten Rückseite der villa, wie er für die römischen Provinzen zur Vorratshal-tung bei entsprechenden Villenanlagen nicht untypisch ist8. Die Deutung als Taufstätte erfolgte wieder auf dem Weg der retrogressiven Ableitung aus der Existenz eines karolingerzeitlichen Zentralbaus im Westen der spä-teren Kirchen, für den im Übrigen aber auch keine Zweckbestimmung als Baptisterium gesichert ist und auch nicht einmal als wahrscheinlich ange-nommen werden kann9. Darüber hinaus rekonstruierte Schütte einen Zu-lauf zur Wassereinleitung in den Holzkeller, für den es aber keinen Beleg
5 Dazu: S. Ristow, Die Ausgrabungen von St. Pantaleon in Köln. Archäologie und Ge-schichte von römischer bis in karolingisch-ottonische Zeit. Zeitschr. Arch. Mittelal-ters, Beih. 21 (Bonn 2009) 27 mit Abb. 14–15; S. 42, 62 f.
6 Die Riemenzunge ist verschollen, sodass der wirkliche Zustand des Fundes nur von einem s/w-Arbeitsfoto aus dem Archiv des Römisch-Germanischen Museums her be-urteilt werden kann (Abb. 3).
7 Die Steinscheibe mit Einlegearbeiten zeigt eine kreuzförmige Aufteilung der Oberflä-che (Abb. 4). Sie stammt vielleicht aus dem Bau von St. Pantaleon und wurde aus dem Kriegsschutt aufgelesen. Ob sie vielleicht einen besonderen Ort in der romanischen Kirche zierte, kann nur vermutet werden.
8 Zu solchen Holzkellern mit Lit. Ristow 2009 (Anm. 5) 23 f. bes. 38–46.9 S. Ristow, Frühchristliche Baptisterien. Jahrb. Ant. Christentum, Ergbd. 27 (Münster
1998) bes. zu St. Pantaleon 312, Nr. 963.
Safm3 1303.indd 194 08.08.2008 09:55:52
Ausgrabungen unter und in der Umgebung der Kirche St. Pantaleon 195
in der Befunddokumentation gibt. Besonders problematisch ist hierbei, dass der zu diesem Zweck von Schütte in Anspruch genommene Kanalstrang zu einer Abwasserführung der villa gehört10, sodass jede Theorie zur Einrich-tung eines Baptisteriums in diesem Keller zurückgewiesen werden muss.
Fremersdorf und Schütte waren also dem Faszinosum erlegen, möglichst frühe Ursprünge des Christentums in den Grabungsbefunden unter der späteren Kirche von St. Pantaleon erkennen zu wollen. Dazu existieren kei-ne archäologischen Belege. Und auch eine vor diesem Hintergrund ange-führte Kontinuität zwischen Antike und Mittelalter am Pantaleons-Hügel südwestlich außerhalb der römischen Stadtmauer lässt sich nicht aus den Grabungsergebnissen erweisen (Abb. 2). Vielmehr scheint die villa nach dem ‚Frankensturm’ des Jahres 355 weitgehend aufgegeben worden zu sein und hat nur noch eine allenfalls sporadische Nachnutzung erfahren. Erst im letz-ten Drittel des 6. Jhs. sind dann merowingerzeitliche Gräber als Indiz für die Anwesenheit der fränkischen Elite zu werten, die sich vor den Mauern Kölns auf dem topografisch hervorstechenden Hügel mit seinen römischen Ruinen beisetzen ließ. Von den Gräbern sind einige wenige ungestört überliefert, andere nur in geringen Fragmenten ihres teils hochwertigen Inventars11. Die sozial separierte Bestattung hochstehender Franken im Kontext noch beste-hender oder nur partiell noch aufrecht stehender römischer Architektur ist
10 Schütte 2006 (Anm. 4) bes. 88 f. – Zur Befundsituation der Kanalführungen Ristow 2009 (Anm. 5) 43.
11 Zu den Funden Ristow 2009 (Anm. 5) 58–66. – Zu den älteren römischen Bestattungen am Ort fehlen die meisten Informationen, lediglich einige sekundär in den merowin-gerzeitlichen Gräbern beigegebene Gefäße und Münzen erweisen, dass man gelegent-lich bei der Anlage der frühmittelalterlichen Bestattungen auf diese älteren Gräber stieß. Zum Phänomen der Wiederverwendung römischen Materials in merowinger-zeitlichen Grabinventaren U. Müssemeier, Römische Gefäße in merowingerzeitlichen Gräbern am Niederrhein. In: B. Päffgen/E. Pohl/M. Schmauder (Hrsg.), Cum grano salis. Beiträge zur europäischen Vor- u. Frühgeschichte. Festschr. V. Bierbrauer (Fried-berg 2005) 249–268.
Safm3 1303.indd 195 08.08.2008 09:55:52
Ristow196
2 Die Lage der villa von St. Pantaleon vor dem römischen Köln. – Verändert nach S. Ristow, Köln. In: RAC XXI (Stuttgart 2004) Sp. 176–216 hier Sp. 179 f.
Safm3 1303.indd 196 08.08.2008 09:55:55
Ausgrabungen unter und in der Umgebung der Kirche St. Pantaleon 197
im austrasischen Bereich fast schon als Standard anzusehen12. Im Fall von St.
Pantaleon wird der Befund aber deshalb interessant, weil auf die Einrich-tung des kleinen Friedhofs bei den Ruinen der villa im 7. Jh. die Errichtung eines etwa 27 m langen und 13 m breiten Saalbaus mit Rechteckschluss in südöstlicher Richtung folgt (Pantaleon I). Gleichzeitig veränderte man für alle danach erfolgten Beisetzungen die Bestattungsrichtung von der ‚Blick-richtung’ der Verstorbenen nach Südwesten jetzt nach Südosten. Die ver-änderte Ausrichtung der Gräber folgt also dem Verlauf der Mauern und ist
12 R. Knöchlein, Die nachantike Nutzung der Bad Kreuznacher Palastvilla. Mainzer Arch. Zeitschr. 2, 1995, 197–209; S. Ristow, Grab und Kirche. Zur funktionalen Bestim-mung archäologischer Baubefunde im östlichen Frankenreich. Röm. Quartalschr. Christl. Altkde. 101, 2006, 214–239; zum Problemkreis des Verhältnisses Frühmittel-alter/Antike und der Wieder- und Weiterverwendung allgemein, z. B. B. Effros, Mo-numents and memory. Repossessing ancient remains in the early medieval Gaul. In: M. de Jong/F. Theuws/C. van Rhijn, Topographies of Power in the Early Middle Ages. Transformation of the Roman World 6 (Leiden 2001) 93–118.
3 Karolingerzeitliche Riemenzun-ge ohne Spuren eines Ornaments in-nerhalb der Rahmung des Schmuck-feldes. – Nach Ristow 2009 (Anm. 5) 27 Abb. 14–15.
4 Schmuckscheibe wohl aus einem Bodenbereich der karolinger- oder otto-nenzeitlichen Kirchenbauphasen von St. Pantaleon mit eingelegten Porphyrplat-ten. – Foto: Sebastian Ristow.
1 cm
Safm3 1303.indd 197 08.08.2008 09:55:56
Ristow198
5 Vorgängerbau D
der romanischen K
irche von St. Severin. – Nach Päffgen 1992 (A
nm. 13) Beil. 21.
Safm3 1303.indd 198 08.08.2008 09:55:58
Ausgrabungen unter und in der Umgebung der Kirche St. Pantaleon 199
demnach im Zusammenhang mit der Entstehung der neuen Archi-tektur zu sehen.
Die genaue Funktion dieses Ge-bäudes muss zunächst offen blei-ben. Teile von liturgischen Ein-bauten wurden nicht gefunden, also weder Abschrankungen noch z. B. ein Altarfundament oder Ver-gleichbares. Somit ist das Gebäude zunächst wohl in erster Linie als ein Grab- und Memorialbau viel-leicht mit dem Charakter einer Eigenkirche im weiteren Sinn zu identifizieren.
Andere Bauten dieser Art in Köln mit hochrangigen spätmerowingerzeit-lichen Sarkophagbestattungen befinden sich z. B. unter der Kirche von St. Severin mit deren Vorgängerbau D nach Bernd Päffgen13 (Abb. 5). Hier liegt für das 7./8. Jh. eine ganz ähnliche Grundrissstruktur vor und auch eine ähnliche Problematik. Die Architektur auf dem südlichen Friedhof vor den Mauern der Stadt ist ebenfalls ohne Befunde der Innenausstattung und so-mit ohne Hinweise auf eine liturgische Nutzung nachgewiesen. Erst mit dem Beginn der Verehrung des Bischofs Severin, vermutlich im 7. Jh., kann für die Architektur von St. Severin mit christlicher Verehrung des Bischofs-grabes und dann wohl auch mit Gottesdiensten in dem so ausgezeichneten Gebäude gerechnet werden14. In ähnlicher Weise ist vermutlich die Struktur der Fragmente des vorromanischen Grundrisses der Vorgängerarchitektur
13 B. Päffgen, Die Ausgrabungen in St. Severin zu Köln. Kölner Forsch. 5,3 (Mainz 1992) Beil. 21.
14 S. Ristow, Frühes Christentum im Rheinland. Die Zeugnisse der archäologischen und historischen Quellen an Rhein, Maas und Mosel (Münster 2007) 137 f.; ders., Kir-chenarchäologie im Rheinland. In: Th. Otten u. a. (Hrsg.), Fundgeschichten – Archäo-logie in Nordrhein-Westfalen. Schr. Bodendenkmalpfl. Nordrhein-Westfalen 9. Aus-stellungskat. Köln (Mainz 2010) 204–206.
6 Versuch einer Grundrissrekonstruk-tion der vorromanischen Bauphase von St. Cäcilien. – Nach Spiegel 1984 (Anm. 15) 224 Fig. 75.
Safm3 1303.indd 199 08.08.2008 09:56:01
Ristow200
von St. Cäcilien im Stadtinneren15 zu interpretieren (Abb. 6). Dort finden sich – ebenso wie in den Arealen von St. Pantaleon, St. Kunibert, St. Gereon, dem Dom und St. Maria im Kapitol in Köln – die charakteristischen trapez-förmigen Sarkophage aus Kalkstein, die zu hochrangigen Beisetzungen der fränkischen Elite gehörten. In der späten Merowingerzeit kamen diese Grab-behältnisse vom Raum Trier-Luxemburg her auch im Rheinland in Mode16. Bemerkenswert ist, dass die damit gefassten hochwertigen Beisetzungen immer in Verbindung mit Architektur stehen und insofern, wie in Köln bei
15 E. M. Spiegel, St. Cäcilien. Die Ausgrabungen. Ein Beitrag zur Baugeschichte. In: H. Kier/U. Krings (Hrsg.), Köln. Die Romanischen Kirchen. Von den Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg. Stadtspuren – Denkmäler in Köln 1 (Köln 1984) 209–234.
16 S. Ristow, Trapezförmige Sarkophage des frühen Mittelalters in Köln. Kölner Jahrb. 32, 1999, 305–341.
7 Grabsteinfragment mit spätmerowingerzeitlichem Stabkreuz aus dem Lapidari-um von St. Pantaleon. – Foto: Sebastian Ristow.
Safm3 1303.indd 200 08.08.2008 09:56:03
Ausgrabungen unter und in der Umgebung der Kirche St. Pantaleon 201
den Beispielen von St. Kunibert und St. Maria im Kapitol, sicher belegen, dass – trotz fehlender interpretierbarer bzw. in die späte Merowingerzeit da-tierbarer Baubefunde – hier mit großer Wahrscheinlichkeit Memorialbauten oder sogar Grabkirchen angenommen werden müssen.
Eine ähnliche Klasse von Beisetzungen dieser Periode des späten 7. und 8. Jhs. erweisen die Funde von Grabsteinen mit ganzflächig eingeritzten Stangenkreuzen, von denen ebenfalls ein Beispiel von St. Pantaleon bekannt ist (Abb. 7).
Die Gräber und der älteste frühmittelalterliche Vorgängerbau der heutigen Kirche St. Pantaleon zeigen an diesem Punkt der vorstädtischen Topografie an, dass das ehemalige südwestliche suburbium Kölns, seit der 2. Hälfte des 4. Jhs. weitgehend verlassen, in der ausgehenden Merowingerzeit wieder be-siedelt worden ist. Auf die Konzentration der Siedlungsaktivitäten im mero-wingerzeitlichen Köln in den östlichen Arealen der Stadt, besonders östlich des ehemaligen cardo maximus, wies zuerst Fritz Fremersdorf hin17. Jakob Torsy erklärte die rheinseitigen Areale der Stadt zum ‚fränkischen Königs-gut’ mit dünner Besiedlung und nahm die Privatbebauung unmittelbar da-hinter in einem Streifen um die Kirche St. Kolumba an18. 1956 wertete Walter Lung Funde von reliefband- und rollstempelverzierter Keramik, Pingsdorfer Gefäßen und Kugeltöpfen aus, um diese Fragen neu zu klären19. Zuletzt kam Marcus Trier zu ähnlichen Ergebnissen20, sodass sich die Theorien zur Bin-nenaufsiedlung des ehemaligen römischen Stadtgebietes zwischen dem 5. und 8./9. Jh. zu bestätigen scheinen.
Die folgenden Bauphasen von St. Pantaleon sollen an dieser Stelle nur kurz resümiert werden: Pantaleon II aus der 1. Hälfte des 9. Jhs. ist vor allem definiert durch den Einbau einer Winkelgangkrypta und somit sehr
17 F. Fremersdorf in: K. Schumacher, Siedelungs- und Kulturgeschichte der Rheinlan-de von der Urzeit bis in das Mittelalter 3. Die merowingische und karolingische Zeit (Mainz 1925) 162–165 mit Taf. 10 bes. 163.
18 J. Torsy, Studien zur Frühgeschichte der Kölner Kirche. Kölner Dombl. 8/9, 1954, 9–32.19 W. Lung, Zur Topographie der frühmittelalterlichen Kölner Altstadt. Kölner Jahrb.
Vor- u. Frühgesch. 2, 1956, 54–70.20 M. Trier, Agrippina Colonia und das Militärlager Divitia am Übergang von der An-
tike zum Mittelalter (400–700 n. Chr.). In: M. Konrad/C. Witschel (Hrsg.), Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen – Nuclei spätantik-frühmittelalter-lichen Lebens? Abh. Bayer. Akad. Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. (München 2011) im Druck.
Safm3 1303.indd 201 08.08.2008 09:56:03
Ristow202
wahrscheinlich der Anlage eines bedeutenden verehrten Grabes oder Reli-quiendepots an dieser Stelle. In dieser Phase wurde das Gebäude auch um Seitenannexe und nach Nordwesten um einen repräsentativen ‚Westbau’ erweitert. Wohl nur wenig später (Pantaleon III) werden nordwestlich vor dem Gebäude ein Atrium und ein Zentralbau mit alternierenden Nischen angelegt, der jedoch trotz seiner markanten Bauform in dieser Zeit nicht mehr als Baptisterium eingestuft werden kann. Wohl zum Ende des 9. Jhs. erfuhr die Kirche eine bauliche Beeinträchtigung und verlor vermutlich mindestens Teile ihrer Reliquienausstattung. Möglicherweise ist dies den Einfällen der Normannen am Niederrhein geschuldet, bei denen vielleicht auch die außerhalb des Schutzes der alten römischen Mauer Kölns liegende Kirche geplündert worden ist. In der 1. Hälfte des 10. Jhs. kam es jedenfalls zu einer Erneuerung des Kryptenbereichs und zur Aufgabe von Zentralbau und wohl auch Teilen des Atriums (Pantaleon IV). Als Erzbischof Brun in der Mitte des 10. Jhs. den Bau zu seiner Lieblingskirche erkor und begann, die zu diesem Zeitpunkt nach den zeitgenössischen Berichten verfallene Kirche massiv zu fördern, traf er den zuletzt beschriebenen Bauzustand an. Brun ließ die Stiftsgebäude errichten (Pantaleon Va) und stattete die Kirche
8 Fragmente der ottonenzeitlichen Großskulpturen von der Fassade im Nordwe-sten der Kirchenbauphase Pantaleon VI. – Foto: Sebastian Ristow.
Safm3 1303.indd 202 08.08.2008 09:56:05
Ausgrabungen unter und in der Umgebung der Kirche St. Pantaleon 203
mit neuen Reliquien und bei seinem Tod 965 testamentarisch mit reichen Baumitteln für weitere Maßnahmen aus. Aus diesen Geldern finanzierte man die Erneuerung der Krypta (Pantaleon Vb), in der Brun dann auch bei-gesetzt wurde. Die noch folgende Erneuerung des Apsisbereichs wurde 980 geweiht. Schließlich wurde – wohl auf Betreiben der Kaiserin Theophanu, die 991 in St. Pantaleon beigesetzt wurde – erneut ein repräsentativer Bau-teil im Nordwesten errichtet, der nach Form und zu vermutender Funktion am besten mit dem Ausdruck ‚Westwerk’ zu bezeichnen ist (Pantaleon VI). Um diese Zeit oder kurz danach entstand auch der bekannte erstklassige Fassadenschmuck mit Großskulpturen, von denen Teile im Lapidarium der Kirche aufbewahrt werden (Abb. 8).
Zusammenfassung
Die Ausgrabungen an der Kölner Kirche St. Pantaleon, unmittelbar vor der Süd-westecke der römischen Stadt gelegen, erbrachten eine römische villa suburbana mit mehreren Steinkellern und einem in Holz ausgebauten Erdkeller.Die Gebäude wurden bis um 400 aufgegeben. Für das 5. und die 1. Hälfte des 6. Jhs. fehlen Anzeichen von Nutzung des Hügels von St. Pantaleon. Gut aus-gestattete merowingerzeitliche Gräber werden jetzt zwischen den römischen Ruinen eingebracht. Ende des 7. Jhs. verwendet man deren Baumaterial für die Errichtung eines Rechtecksaals zur Einbringung weiterer Bestattungen von An-gehörigen der spätmerowingerzeitlichen Kölner Elite. Die mittelalterlichen Kir-chenbauten entwickeln sich aus dieser Memorialarchitektur des 7./8. Jhs.Eine gelegentlich postulierte kultische Kontinuität schon bis in antike Zeit lässt sich nicht belegen.
Summary
Early Mediaeval use above Roman remains in the western suburb of Roman Cologne. Excavations under and around the church of St. PantaleonThe excavations at the Cologne church of St. Pantaleon, situated directly in front of the south-western corner of the Roman city, revealed a Roman villa suburbana with several stone cellars and an earth cellar reinforced with timbers. The buil-
Safm3 1303 01.indd 203 07.04.11 12:49
Ristow204
ding was abandoned by around 400. For the 5th and 6th centuries there is no sign of the hill of St. Pantaleon being used. Richly furnished Merovingian graves were placed between the Roman ruins. At the end of the 7th century their buil-ding material was used for the erection of a rectangular hall for the deposition of further burials for members of the Late Merovingian elite of Cologne. The mediaeval church buildings developed from this memorial architecture of the 7th / 8th century. A sometimes postulated continuity of cult back to Roman times cannot be authenticated.
PD Dr. Sebastian RistowArchäologisches Institut der Universität zu Köln
Albertus-Magnus-PlatzD-50923 Köln
Safm3 1303 01.indd 204 07.04.11 12:49