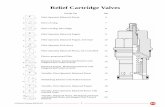Relief, Orthostaten, Stelen in Phrygien und Tabal
-
Upload
uni-tuebingen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Relief, Orthostaten, Stelen in Phrygien und Tabal
Relief, Orthostaten, Stelen
in Phrygien und Tabal
IANES – Tübingen
Zwischen Ost und West – Zentral- und Westanatolien in der Eisenzeit: Tabal,
Phrygien, Lydien und Lykien
Dozenten: Dr. A. M. Wittke – Prof. Dr. Peter Pfälzner
Referent: Simon Herdt
04.07.12
SS 12
2
Gliederung
1) Phrygien 3
a) Orthostaten 3
b) Stelen 22
c) Relief 27
2) Tabal 40
a) Orthostaten 40
b) Stelen 42
c) Relief 53
3) Fazit 68
4) Literaturverzeichnis 70
3
1) Phrygien
a) Orthostaten
aus dem westanatolischen Raum liegen der Forschung bislang nur wenige Beispiele
phrygischer Reliefplatten vor (ganz ähnlich verhält es sich auch für die verbleibenden
Gattungen der Flachbildkunst Phrygiens), diese können den Fundorten nach in zwei
Gruppen unterteilt werden:
phrygische Orthostaten aus Gordion
insgesamt wurden im Jahre 1956 in der phrygischen Hauptstadt Gordion 7
Fragmente reliefierter Platten aus hellbraunem Poros-Stein gefunden
die Orthostaten wurden innerhalb der Zitadelle, zwischen den beiden Megara
2 und 3 (Abb. 1) zuunterst perserzeitlicher Fundamente geborgen und
stammen aus der Phase YHSS 6 bzw. dem „Destruction Level“ (Tab. 1 und 2)
daraus ergibt sich als zeitlicher Rahmen die initiale Phase der phrygischen
Kultur, welche nach neusten Radiocarbon-Untersuchungen ins frühe 9. bzw.
späte 10. Jahrhundert BC datiert
zwar konnte keine der hochrechteckigen Platten komplett und/oder in ihrem
Originalkontext geborgen werden, dennoch dürften alle Stücke eine Höhe von
ca. 61 cm erreicht haben und waren wahrscheinlich Teil eines Bildzyklus,
welcher nach G.-K. Sams in oder am Torbau vor der großen Zitadellenmauer
(dem „Polychrome House“), nach Ausgräber R. Young am Durchgang in der
Umfassungsmauer zwischen Megaron 2 und 3 angebracht war, während U.
Kelp die Ummauerung von Megaron 3 präferiert, welches gemeinhin als
„Palast“ angesprochen wird
die Orthostatenfragmente sind teilweise noch in unfertigem Zustand belassen,
was wiederum gegen eine tatsächliche Aufstellung in Gordion spricht
dargestellt sind zumeist Tiere, insbesondere Löwen und Huftiere aber auch
eine Sphinx (?), ein Vogelmensch, ein Möbelstück, sowie die Beine eines
menschlichen Helden im Kampf mit einem Löwen
aufgrund seiner äußerst freiplastischen Gestaltung und dabei sehr
eigentümlichen Form sei hier insbesondere auf den Löwenkopf aus Gordion
verwiesen (Abb. 2, 3 und 4)
die Bestimmung der dargestellten Tierart gestaltet sich auf den ersten Blick
als schwierig: der Kopf, der frontal auf den Betrachter gerichtet ist, ist
ungewöhnlich flach und lang, das Maul endet horizontal, um die Augenhöhlen
(das Material der eingelegten Pupillen ist nicht bekannt) sind mehrere Kreise
in den Stein gearbeitet, unter den horizontal abgestumpften Zahnreihen des
geöffneten Mauls finden sich keine Reißzähne, eine lange Zunge hängt
heraus und endet auf der Plattenoberfläche
die oben genannten Attribute lassen zunächst an Nutzvieh, respektive ein
Rindvieh schließen, allerdings deuten die runden Ohren und die deutlichen
4
Rautenritzungen einer Mähne, welche sich flachplastisch auf der Steinplatte
fortsetzen, sowie die Abwesenheit von Hörnern, zweifelsohne auf einen
Löwen hin, das Bildnis wird vom einem breiten, aus dem Stein
herausgearbeiteten Rahmen eingefasst
hierbei zeigt sich aber eine interessante Eigenheit der frühphrygischen Plastik:
es scheint, als habe für die Bildhauer zunächst eine gewisse Schwierigkeit in
der Umsetzung figürlicher Motive bestanden, gerade der Löwen(Kuh)kopf aus
Gordion wirkt in Teilen abstrakt und als der geometrischen Tradition, welche
in Gordion noch vor der Darstellung von Figuralmotiven belegt ist, verhaftet,
bei der Herausarbeitung letzterer Kategorie orientierte man sich stark an den
Beispielen späthethitischer Bildhauerei, wie im weiteren Verlauf dieser
Ausführung beschrieben
zu den verbleibenden Fragmenten aus Gordion zählen die Hinterteile zweier
im Profil nach rechts schreitender Huftiere (Abb. 5 und 6), jeweils auf einer
separaten Reliefplatte dargestellt
die Tiere dürfen aufgrund ihrer langen, breitgefächerten Schweifbehaarung
und der kräftigen Hinterbeine durchaus als Pferde angesprochen werden
auf einem der beiden Hinterteile sind die Reste der Pranken eines Raubtieres,
vermutlich ein Löwe, in Form langer Krallen zu erkennen (Abb. 6), leider ist
die Platte just an dieser Stelle gebrochen und ihr Gegenstück bleibt
verschollen
ähnlich dem Löwenkopf wird auch die kaum erhaltene Flügelspitze eines
Mischwesens, vermutlich einer Sphinx (Abb. 7) von einem breiten Rahmen
eingefasst
die mit einfachen Ritzungen angedeuteten Federn sind in engen Reihen
zusammengefasst, die der gebogenen Form des Flügels folgend nach links
oben verlaufen, ein möglicher Vergleiche findet sich in Karkemiš (Abb. 8)
ein weiteres Fragment zeigt den geschlossenen Schnabel, ein Auge, sowie
den erhobenen Arm eines nach rechts gewandten Vogelmenschen im Profil
(Abb. 9), die Art der Darstellung erinnert an ähnliche, allerdings weitaus
besser erhaltene Beispiele aus Karkemiš (Abb. 10 und 11)
der Arm des Vogelmenschen endet abrupt über dem Handgelenkt, wo
nackter, unbearbeiteter Stein an die Figur anschließt, ein Indiz dafür, dass
dieses Stück nie vollendet wurde
ein ebenfalls nur fragmentarisch erhaltenes, nichtsdestotrotz äußerst
aufschlussreiches Stück aus Gordion zeigt einen nach rechts schreitenden
Mann und den Kopf eines herabhängenden, dem Mann zugewandten Löwen
(Abb. 12), die Beine des Mannes wirken kurz und plump, Reste eines
Hüftrockes sind erhalten
die gedrungene, kräftige Form der Beine sowie die Schnabelschuhe der Figur
weisen diese als von der späthethitischen Bildhauerei beeinflusst aus, zwei
ganz ähnliche Beispiele dieser Kampfszenerie zwischen Held und Tier finden
sich in Karkemiš (Abb. 13 und 14) als Teil des sogenannten „Herald´s Wall“,
9. Jahrhundert BC
im Unterschied zu Karkemiš hängt der Kopf des Löwen aus Gordion noch vor
dessen Vorderbeinen ganz zuunterst, dem Helden zugewandt
5
das bereits erwähnte, gordische „Möbelstück“, weist sich als ein
Plattenfragment aus, welches die plastisch herausgearbeitete Ecke eines
Stuhls bzw. Throns zeigt (Abb. 15)
ein Teil der Sitzfläche und ein Stuhlbein sind noch deutlich zu erkennen, an
die Sitzfläche schließen zwei mit einer geraden Linie horizontal voneinander
getrennte Swastika-Bänder an
bei dem Stück handelt es sich wohl um die linke untere Ecke einer
Reliefplatte, da der Stein nur wenige Zentimeter zur Rechten des Stuhlbeins
sorgfältig abgetragen und glattgeschliffen wurde
ein Vergleichsbeispiel, das vielleicht eine ähnliche Szene wie ehemals in
Gordion darstellt, stammt erneut aus Karkemiš (Abb. 16), wo auf einem
Orthostat des „Long Wall of Sculpture“ eine auf einem elaborierten Thron
sitzende, weibliche Würdenträgerin abgebildet ist
phrygische Orthostaten aus Ankara
aus Ankara und Umgebung stammen insgesamt 10 Orthostaten von 1 auf 1,6
m Größe, allesamt ohne Kontext, allerdings werden die Stücke aufgrund
stilistischer Ähnlichkeiten der Bildmotive untereinander sowie der Tatsache,
dass es sich bei dem verwendeten Material um jeweils ein und dieselbe
Gesteinsart handelt, als eine zusammenhängende Gruppe betrachtet
wahrscheinlich waren sie ursprünglich Teil der Bauskulptur eines Gebäudes
und wurden schon in der Antike an unterschiedliche Orte verschleppt
die Stücke stehen größtenteils noch in der Tradition späthethitischer
Bildhauerei, allerdings sind gewisse assyrisierende Merkmale nicht zu
verkennen
im allgemeinen werden die Ankara-Orthostaten in das ausgehende 8. bzw.
frühe 7. aber auch das 6. Jahrhundert BC datiert, dargestellt sind im Profil
nach rechts und links schreitende Tiere (Löwe, Pferd, Stier) und Mischwesen
(Greif, Sphinx), ein Tier pro Platte
besonders deren Köpfe besitzen eine starke Plastizität, im Falle der Sphingen
zeigt sich in eine deutliche Eigengewichtung der Federn, vergleichbar mit
Solchen assyrischer Elfenbeinreliefs
die Körper sind durch feine Auswölbungen aus dem Gestein modelliert
worden und plastisch gegliedert, Vergleiche finden sich unter den
Tierdarstellungen des Assurbanipal aus der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts BC
die Löwen aus Ankara (Abb. 17 und 18) weisen einen schmalen Körperbau
auf, ihr Schwänze biegen nach vorne um, die Mäuler sind geöffnet, die
Unterkiefer leicht verkürzt und erinnern nicht von ungefähr an assyrische
Vorbilder, Sehnen und Muskeln sind naturalistisch wiedergegeben, die Mähne
allerdings wird nur durch eine einfache Linie vom Rest des Körpers
abgehoben
auf der anderen Seite ist zu beachten, dass die Darstellung von Löwen in der
späthethitischen bzw. phrygischen Bildhauerei eine lange Tradition besitzt,
wie Beispiele aus Boğazköy (Abb. 19) und Aslantaş (Abb. 20) bezeugen,
desweiteren finden sich Vergleichsbeispiele nicht nur auf assyrischem Gebiet,
auch in Zentralanatolien existieren Löwenplastiken, welche eine ähnliches
Maß an Sorgfalt und Naturalismus aufweisen, Beispiel Göllüdağ (Abb. 21),
auch Einflüsse aus dem griechischen Raum sind denkbar
6
der Körper der Sphinx aus Ankara ist unnatürlich in die Länge gezogen, ihr
Schwanz geschwungen, ein Flügel hebt sich über dem Hinterleib vom Körper
ab (Abb. 22)
Sehnen werden dargestellt, ansonsten ist die Figuren eher schlicht gehalten,
ein Stirnband dient als Kopfbedeckung, das Haupthaar ist zu einem breiten
Zopf gebunden und ruht im Nacken, der Bart ist lang und weist einen
assyrisierenden Lockenwurf auf
die Darstellungen der Körper von Greif und Sphinx entsprechen einander fast
völlig (geschwungener Schwanz, abgehobener Flügel), möglicherweise waren
sie einst antithetisch angeordnet
der mit geöffnetem Schnabel nach links schreitende Greif (Abb. 23 und 24)
besitzt Ähnlichkeiten mit den späthethitischen Vogelmenschen aus Sakçgözü
(Abb. 25), die kräftige Form von Ober- und Unterkiefer ist typisch für
phrygische Greifenbilder, er besitzt ferner eine gefiederte Brust, eine Mähne
und eine Locke
die gewollte Verkürzung des Auges, welche den dreidimensionalen Eindruck
weiter verstärkt, weist in das Ende der 1. Hälfte des 1. Jahrtausends BC
die Darstellung eines Stiers (Abb. 26) findet ebenso Parallelen in der
späthethitischen Kunst von Zincirli und Karkemiš, wobei die schon zuvor
erwähnte Überlänge auch diesem Bildnis anhaftet
das Pferd aus Ankara (Abb. 27) besitzt eine bogenförmige Mähne, ein breites
Maul, einen gedrungenen Kopf sowie eine nierenförmige Stilisierung des
Schulterblatts, der Körper fällt ebenfalls länglich aus
assyrische Reliefs sind bezüglich der Innengliederung der Mähne ähnlich, ein
anderer Vergleich findet sich in Form einer phrygischen Reiterdarstellung aus
Elfenbein in Gordion selbst (Abb. 28)
7
Karte 1: Anatolien, späthethitische Fürstentümer.
Karte 2: Anatolien, späthethitische Fürstentümer.
8
Karte 3: Anatolien, topografische Karte.
Tab. 1: Chronologie Gordions.
Tab. 2: Chronologie Phrygiens.
10
Abb. 3: Löwenkopfrelief aus Gordion, Detailansicht Maul.
Abb. 4: Oberseite des Löwenkopfreliefs aus Gordion.
11
Abb. 5: Hinterteil eines Huftiers, Gordion.
Abb. 6: Hinterteil eines Huftiers mit Resten von Krallen, Gordion.
13
Abb. 9: Unvollendeter Vogelmensch aus Gordion.
Abb. 10: Zwei Vogelmenschen aus Karkemiš.
Abb. 11: Vogelmensch, Karkemiš.
14
Abb. 12: Held und Löwe aus Gordion.
Abb. 13: Held und Löwe aus Karkemiš.
Abb. 14: Kampf zweier Helden/Götter mit einem Löwen aus Karkemiš.
20
Abb. 25: Umzeichnung der Vogelmenschen aus Sakçgözü.
Abb. 26: Stier aus Ankara.
Abb. 27: Pferd aus Ankara.
22
b) Stelen
eine Pfeilerstele aus Daydalı
aus Daydalı, einem Dorf 20 km östlich von Emirdağ, stammt ein etwa 0,64 m
hoher und 0,3 bis 0,32 m breiter Reliefpfeiler aus feinkörnigem Basalt
Basalt als Ausgangsmaterial ist bislang für kein weiteres Erzeugnis
phrygischer Bildhauerei bekannt
das Stück aus Daydalı ist auf drei Seiten skulptiert (Abb. 29), auf der
Vorderseite findet sich ein doppelköpfiges Mischwesen (Abb. 30), rechts und
links davon beherbergen die Nebenseiten je ein einfaches Mischwesen bzw.
einen einfachen Vogelmenschen im Profil (Abb. 31 und 32)
die Mischwesen weisen seltsam überproportionierte Schnäbel und spitze
Ohren auf, über die Wange hängt eine Locke, im Nacken sitzt, mit Ausnahme
der doppelköpfigen Figur, eine Mähne
die Vogelmenschen auf den Nebenseiten sind mit ihrem Blick in Richtung der
Vorderseite gewandt, ihr Rumpf ist frontal, Kopf und Beine hingegen im Profil
dargestellt
alle Figuren wirken unproportioniert, Arme und Hände sind unverhältnismäßig
klein, in ihren Händen halten sie nicht näher bestimmbare Attribute,
möglicherweise Blumen, das doppelköpfige Wesen hält gleich zwei dieser
Sorte
aus den geöffneten Schnäbeln hängt je eine Zunge, die Gewänder sind durch
eine enge Senkrechtschraffur wiedergegeben, die doppelköpfige Figur trägt
einen kurzen Rock, während die einfachen Vogelmenschen ein langes
Gewand tragen, welches eines ihrer beiden Beine vollständig bedeckt
wohingegen das andere nackt bleibt
bei den konzentrischen Kreisen, von denen je ein Paar an den Rücken eines
Mischwesens anschließt, könnte es sich um eine abstrakte Darstellungsform
von Flügeln handeln, auch wenn diese absolut ungewöhnlich ist
Belege für die Darstellung doppelköpfiger Figuren existieren u. a. in Tell Halaf
(Abb. 33)
das Werk aus Daydalı weist einige ikonografische wie stilistische
Besonderheiten auf, zum einen wäre da die geringe Reliefstärke, die unruhige
Oberfläche, die unbeholfenen Körperproportionen, die aufgeblähte Form des
Schnabels und die abstrakte Flügelform sowie die kreuz- bzw. blumenartigen
und funktional nicht näher zu differenzierenden Objekte in den Händen der
Figuren
möglicherweise handelt es sich bei diesem Beispiel um ein äußerst
provinzielles Stück in der Tradition bzw. Peripherie der späthethitischen Kunst
23
eine Pfeilerstele aus Mihalıççık
aus Mihalıççık, etwa 50 km nordwestlich von Gordion gelegen, stammt ein bis
auf 1,2 m Höhe erhaltener, skulptierter Kalksteinpfeiler mit zwei Bildseiten
(Abb. 34)
auf der einen Seite, vom Bearbeiter F. Prayon als Vorderseite angesprochen,
ist ein nach rechts schreitendes Pferd mit Reiter dargestellt, die rechts
anschließende Nebenseite zeigt eine zum Reiter hin gewandte Frau in
schlechtem Erhaltungszustand, die linke Nebenseite ist geglättet aber ohne
Relief, während die Rückseite roh belassen wurde
beide Bildseiten sind von einer Leiste gerahmt, der Reiter trägt eine Kappe im
phrygischen Stil, einen Hosenanzug, Pfeil und Bogen, direkte stilistische
Bezüge zu der Elfenbeinschnitzerei aus Gordion (Abb. 28) können nicht
hergestellt werden, auch wird die Mähne des Pferdes anders als etwa in
Gordion und Ankara (Abb. 27) dargestellt
die Frau hält eine gerippte Phiale in ihrer rechten Hand, der Gegenstand in
ihrer Linken ist nicht zu identifizieren, was u. a. auch auf den schlechten
Erhaltungszustand dieser Bildseite zurückzuführen ist
24
Abb. 29: Umzeichnung aller Bildseiten des Pfeilers aus Daydalı.
Abb. 30: Vorderseite des Pfeilers aus Daydalı.
25
Abb. 31: Rechte Nebenseite des Pfeilers aus Daydalı.
Abb. 32: Linke Nebenseite des Pfeilers aus Daydalı.
26
Abb. 33: Orthostat mit doppelköpfigem Mischwesen aus Tell Halaf.
Abb. 34: Umzeichnung der Bildseite mit Pferd und Reite des Pfeilers aus Mihalıççık.
27
c) Relief
auch im Bereich der Flachbildkunst mit immobilem Charakter liefert das phrygische
Reich nur wenige Beispiele, Felsreliefs sind ausschließlich in und um Midas-Stadt
bezeugt, und eine andere Gattung von Flachbilden, die Graffiti, finden sich
ausschließlich an Hausfassaden in Gordion, phrygische Grabreliefs werden in dieser
Ausführung nicht berücksichtigt, da Teil einer gesonderten Arbeit
die Prozessionsreliefs von Midas-Stadt
im Bereich der Eingangsrampe von Midas-Stadt (Abb. 35) finden sich in
Nordost-Richtung verlaufend mehrere in den Fels gehauene Figuren und
Figurengruppen, wohl alle Teil eines Prozessionszuges
eine genaue Datierung des Zuges ist nicht möglich, da eine stilistische
Auswertung aufgrund der äußerst schlechten Erhaltung, der Witterung und
der erschwerten Arbeitsbedingungen (wie von den Bearbeitern beschrieben,
sieht man je nach Stand der Sonne andere Formen im Gestein) kaum bzw.
nicht möglich ist, die Zeitspanne reicht von der Hatti-Zeit bis zu den
Achämeniden, E. Akurgal favorisiert eine Einordnung um 700 BC
das wohl besterhaltene Bildnis zeigt einen 0,7 m großen, nach rechts
ausgerichteten Mann (Abb. 36 und 37) mit einem Bart, einem Haarschopf,
Schnabelschuhen, einer Art Stab in der Hand und möglicherweise einem
Köcher auf dem Rücken, er steht links zweier Symbole, welche die Form
eines Vogels und eines Kegels haben
dabei könnte es sich um bislang unbekannte Hieroglyphen oder aber
Opfergaben handeln, da das Bildnis in direktem Zusammenhang mit einem
ebenfalls in den Fels gehauenen Stufenaltar (Abb. 38 und 39) zu stehen
scheint, demzufolge könnte es einen Gläubigen oder Priester bei einer
bestimmten Kulthandlung darstellen
die anderen Figuren im Zug setzen etwa ab Bodenhöhe an, wohingegen der
oben erwähnte Mann freischwebend ist, auch überragen sie ihn mit
Körpergrößen von 1,2 bis 2,5 m deutlich an Größe, weiterhin ist er durch
seinen Anbringungsort von den restlichen Teilnehmern der Prozession
ausgeschlossen, eine gleiche Zeitstellung von Mann und Prozession erscheint
nicht gegeben
aus dem Prozessionszug stammt ein nach rechts gerichteter Mann mit
Adorationsgestus (Abb. 40 und 41), dieser lässt sich am ehesten mit der Figur
auf dem Grabrelief von Hamam Kaya (Abb. 42 und 43) vergleichen
ein nach links gerichteter Löwenmensch mit erhobenen Armen (Abb. 44 und
45), erinnert an eine Sonnenscheibe haltende Mischwesen aus Tell Halaf oder
Karkemiš, auch wenn in Midas-Stadt keine Spuren einer Scheibendarstellung
bezeugt sind, das Gesicht des Löwenmenschen ist en face wiedergegeben
drei verschleierte Personen in Midas-Stadt bilden eine nach rechts
schreitende Figurengruppe (Abb. 46), welche sich auf eine, auf einem
Nachbarfelsblock abgebildete, sitzende Figur zubewegen (Abb. 47 und 48),
von der allerdings nur die Füße erhalten sind (Abb. 49)
28
eine weitere Gruppe setzt sich aus mindestens zwei Figuren zusammen (Abb.
50 und 51), diese nach rechts gewandt sind, die hintere Person hat einen ihrer
Arme erhoben
die Graffiti von Gordion
aus Gordion stammen die frühesten Zeugnisse phrygischer Flachbilder, in
Form einfacher Ritzungen auf dem Putz der dortigen Megara (insbesondere
Megaron 2), weshalb sie gemeinhin als „Graffiti“ angesprochen werden
der Stil ist im allgemeinen geometrisch-abstrakt (Abb. 52), was im Hinblick auf
die gordischen Orthostaten ein Element der frühphrygischen
Figuraldarstellungen darstellt
dargestellt sind neben geometrischen Mustern insbesondere Menschen bei
alltäglichen oder kriegerischen Aktionen (Abb. 53 und 54), sofern diese
korrekt gedeutet werden, ebenfalls häufig sind Tiere, zumeist Löwen (Abb. 55
und 56), abgebildet
30
Abb. 36: Felsrelief eines Mannes mit Bart und Stab in Midas-Stadt.
Abb. 37: Umzeichnung des Felsreliefs.
31
Abb. 38: Stufenaltar in Midas-Stadt, nahe der Eingangsrampe.
Abb. 39: Rekonstruktionszeichnung des Altars.
32
Abb. 40: Felsrelief eines Mannes mit erhobenem Arm in Midas-Stadt.
Abb. 41: Umzeichnung des Felsreliefs.
33
Abb. 42: Umzeichnung des Grabmals von Hamam Kaya.
Abb. 43: Detailfoto der Figur auf dem Grabmal von Hamam Kaya.
35
Abb. 46: Felsrelief einer Figurengruppe in Midas-Stadt.
Abb. 47: Aufnahme der Gesamtkomposition Figurengruppe-Sitzender.
Abb. 48: Umzeichnung der Gesamtkomposition.
36
Abb. 49: Unvollständig erhaltenes Felsrelief einer sitzenden Figur in Midas-Stadt.
Abb. 50: Felsrelief einer weiteren Figurengruppe in Midas-Stadt.
Abb. 51: Umzeichnung des Felsreliefs.
38
Abb. 53: Umzeichnung einer Wandputzritzung aus Gordion, möglicherweise ein Jäger.
Abb. 54: Umzeichnung einer Wandputzritzung aus Gordion, möglicherweise eine
Kampfhandlung zweier Personen.
39
Abb. 55: Umzeichnung zweier Löwendarstellungen aus Gordion.
Abb. 56: Aufnahme eines Stücks Hausverputz mit Löwendarstellung, Gordion.
40
2) Tabal
a) Orthostaten
im Gegensatz zu den Zeugnissen phrygischer Flachbildkunst, welche äußerst
spärlich gestreut sind, liegen der Wissenschaft aus dem zentralanatolischen Tabal
zahlreiche Beispiele der dort im 1. Jahrtausend BC ausgeführten Stein- und
Felsarbeiten vor, wenngleich im Falle tabalischer Orthostaten nur Fragmente
existieren, so entschädigen doch aufwendige Produktionen, wie etwa die Stele von
Bor oder das Relief von Ivriz
unter genannten Reliefplattenfragmenten, die im Übrigen sehr selten sind und wenn
gefunden, sich meist in und um die Ortschaften Kültepe und Kululu gruppieren, finden
sich u. a. Stücke möglicherweise assyrisierender Bärte, eine genauere stilistische
Auswertung ist in Anbetracht des Erhaltungszustandes meist nicht gegeben
ein Fragment aus Kültepe
neben zwei weiteren Bruchstücken, die keine Ergebnisse lieferten, stammt ein
geradezu exzeptionell gut erhaltenes, wenn auch nicht vollständiges Stück
aus Kültepe, welches einen Mann mit Hörnerkrone darstellt (Abb. 57)
die Person, höchstwahrscheinlich ein Gott bzw. Wettergott, trägt einen kurzen
Rock mit Fransen und einen Gürtel, sie bewegt sich nach links, während sie in
ihrer rechten Hand einen Speer, in ihrer Linken einen Adler und einen Hasen
hält
ein Zopf fällt vom Kopf in den Nacken, Ansätze eines Bartes sind nicht zu
erkennen
die Orthostaten aus Göllüdağ
die Siedlung Göllüdağ zeichnet sich neben ihrer außergewöhnlichen Lage, sie
wurde auf der Spitze des Berges Göllüdağ, nahe eines dort gelegenen
Bergsees errichtet, ihrem Erhaltungszustand, fast unberührt, vermutlich
bewusst aufgegeben, ihrer Konzeption, komplett ummauert, geplant angelegte
Stallungen und ein sakral-monumentaler Bereich mit Löwenpfeilern, auch
durch die Tatsache aus, dass sich in ihr das einzig bekannte Beispiel für im
architektonischen Verband angetroffene, tabalische Orthostaten befindet
die Orthostaten (Abb. 58) umreißen den Grundriss eines Gebäudes, welches
vermutlich nie vollendet wurde, leider trifft dies auch auf die Reliefplatten
selbst zu, die zwar in situ, mit Ausnahme ihrer rechteckigen Form aber völlig
unbearbeitet belassen wurden
41
Abb. 57: Fragment einer Reliefplatte aus Kültepe.
Abb. 58: Aufnahme einiger der unbearbeiteten Orthostaten aus Göllüdağ.
42
b) Stelen
die zentrale Figur im tabalischen Pantheon war zweifelsohne die Person des Sturm-
bzw. Vegetationsgottes Tarhunt, welcher auch kriegerische Aspekte in sich vereinen
konnte und dessen Name in etwa „Eroberer“ oder „der Eroberer sein“ bedeutet,
gleichzeitig war er das bestimmende Thema tabalischer Flachbildhauerei, mit
Ausnahme weniger Königsdarstellungen waren es zumeist Tarhunt und seine
göttlichen Attribute, denen eine Verewigung in Stein zu Teil wurde
die Stele von Keşlik
aus der Siedlung Keşlik, die zwischen dem Ort Niğde und dem Berg Göllüdağ
liegt, stammt eine stark verwitterte, jedoch fast vollständige Stele, welche mit
einer luwischen Inschrift und einem Bildnis des Tarhunt versehen ist (Abb. 59)
der Wettergott ist mit einem in hethitischer Tradition stehendem Rock und
Schnabelschuhen abgebildet, in seinen Händen hält er die für sein Amt
typischen Attribute, welche ihn letztlich eindeutig als Tarhunt ausweisen
zum einen wäre dies eine Weinranke mit Früchten, welche links der Gottheit
aus dem Boden sprießt und die der Gott mit seiner rechten Hand ergreift
in seiner linken Hand hält Tarhunt die Ähren einer Weizen- oder
Gerstenpflanze, die unmittelbar rechts von ihm aus dem Boden tritt
der Wettergott mit Hörnerkrone ist nach rechts gewandt, im Nacken ein breiter
Zopf an Haaren, das Gesicht ziert ein langer Bart im assyrischen Stil
die Stele von Niğde
die Stele von Niğde ist in einem allgemein guten Erhaltungszustand und zeugt
von einer hohen Plastizität, dargestellt ist ein göttliches Wesen (Hörnerkrone)
unter einer Flügelsonne (Abb. 60)
die Gottheit trägt Schnabelschuhe und ein kurzärmeliges Gewand, welches in
einem kurzen Rock mit Fransen endet, um die Hüften ist ein Gürtel mit
Anhang gewunden, auf ihrem Kopf trägt sie eine Hörnerkrone mit Aufsatz, die
Spirallocken von Bart und Zopf erinnern stark an assyrische Vorbilder
in ihrer rechten Hand trägt die Gottheit eine Art Dolch oder Sichel,
möglicherweise auch eine Axt, während sie in der Linken ein Blitzbündel hält,
rechts von ihr treten Ähren aus dem Boden, links eine Weinranke, sie ist damit
zweifelsohne als der Wettergott Tarhunt anzusprechen
die luwische Inschrift berichtet von Muwaharani, einem Sohn des Warpalawa,
Herrscher von Tuwana bzw. Süd-Tabal, Erstgenannter fand zuletzt in
assyrischen Quellen um 709 BC Erwähnung
die Stele von Ivriz
nahe dem berühmten Felsrelief von Ivriz (Abb. 78 und 79), förderten
Kanalarbeiten die Unterseite einer Stele zu Tage (Abb. 61)
erneut handelt es sich wohl um eine Darstellung des Tarhunt, zu erkennen ist
ein etwa kniehoher Rock mit Volutenenden und hethitisierende
Schnabelschuhe, ganz ähnlich der Stele von Keşlik
43
die Gottheit ist nach rechts gewandt, an der Spitze des nachgestellten Schuhs
tritt der Stamm einer Weinranke aus dem Boden, an der Spitze des
vorangestellten Schuhwerks sind es eindeutig die gegliederten Stängel von
Weizen oder Gerste
die bilinguale Inschrift ist in luwisch und phönizisch gehalten und datiert in die
2. Hälfte des 8. Jahrhunderts BC
die Stele von Aksaray
aus Aksaray, nahe dem großen Salzsee, stammt ein weiteres Abbild des
Tarhunt, wenn auch nur die Unterseite mit Schnabelschuhe erhalten ist (Abb.
62)
die Stele von Bor
die in der Fachliteratur häufig als „Stele von Bor“ (Abb. 63 und 64)
bezeichnete Stele wurde ursprünglich in Kemerhisar, dem antiken Tuwana,
aufgefunden
sie hat die Form eines Obelisken und ist in zwei fast gleich große Hälften
zerbrochen, von denen die untere Hälfte aber deutlich schlechter erhalten ist,
ihre Höhe beträgt nunmehr 2,08 m
das Stück ist mit einer Inschrift und einem Abbild des Warpalawa versehen,
der Herrscher von Süd-Tabal hat seine Arme in einer Art Gebetsgestus vor
seiner Brust erhoben, er trägt eine halbrunde Kopfbedeckung mit einem
kleinen Aufsatz auf der Stirnseite, desweiteren ein langes Gewand und einen
Umhang, sowie Schnabelschuhe
in seiner Darstellungsweise erinnert der König stark an das Relief von Ivriz
(Abb. 78 und 79), Bart und Zopf verweisen auch hier auf Einflüsse aus dem
assyrischen Raum
die Kleidung des Warpalawa ist reich mit geometrischen Mustern verziert,
aufwendig konzipiert und elaboriert, die unterste Reihe des Rocks zieren
verschiedenartige Hackenkreuze, ein möglicher Hinweise für bestehende
Kontakte in den phrygischen Raum, wo jene Formen besondere Beachtung
fanden
die Inschrift berichtet vom Bau eines Garten durch Warpalawa zu Ehren des
Tarhunt, gleichzeitig dankt der König dem Gott für den Gedeih eben jener
Pflanzen, welche er zum Ruhme des Wettergottes anlegte
die Stele von Tavşan Tepesi
aus Tavşan Tepesi stammt eine in zwei Teile zerbrochene Stele einer
sitzenden Person (Abb. 65 und 66)
der Bearbeiterin S. Aro folgend, welche sich intensiv mit der materiellen Kultur
Tabals befasst hat, handelt es sich dabei um ein tabalisches Stück aus dem 8.
oder 7. Jahrhundert BC
dargestellt ist eine thronende Göttin, die in ihrer rechten Hand einen Stab, in
ihrer Linken einen Dolch hält, ferner trägt sie einen langen Rock und
Schnabelschuhe, sie wirkt etwas gedrungen
unter dem Thron liegt ein Löwe mit geöffnetem Maul, die Sitzfläche wird von
einem Genius getragen
44
das Stück ist nur grob ausgearbeitet und stellt laut Aro wohl eine Ausnahme in
der Bildhauerei Tabals dar
die Stele von Ҫiftlik
ein weitere Steinmetzarbeit mit Königsdarstellung stammt aus Ҫiftlik, sie ist
halbzylindrisch gearbeitet, ihre Unterseite fehlt (Abb. 67)
das Gesicht wurde bereits in der Antike mutwillig herausgebrochen, ebenso
wie Teile der Inschrift, wozu auch der Name des Herrschers zählte, die
Phrase „ich bin“, welche dem Namen vorangestellt war und einige andere
Textteile sind noch erhalten
auf erstgenannte Phrase weist die linke Hand des Herrschers, in seiner
rechten Hand hält er einen Stab als ein Zeichen von Macht und Weisheit
er selbst bezeichnet sich im weiteren Verlauf der Inschrift als Diener des
Tuwatti, einem König Kern-Tabals aus der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts BC,
denkbar wäre auch Tuatti, der in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts BC in Tabal
herrschte und in assyrischen Quellen durch Salmanassar III Erwähnung fand
die Stele von Andaval
aus Andaval stammt das ungewöhnlich archaisierende Kopfstück einer
Herrscherstele, abgebildet sind die statische Haartracht sowie das rundliche
Auge eines, der Inschrift folgend, tabalischen Prinzen im Profil (Abb. 68)
Entsprechung findet die Darstellung der Haare u. a. in Karkemiš, auf dem
sogenannten „Long Wall of Sculpture“, 9. bzw. 8. Jahrhundert BC (Abb. 69)
47
Abb. 61: Unterteil einer Stele aus Ivriz, gefunden nahe dem Relief von Ivriz.
Abb. 62: Detailaufnahme eines Schnabelschuhs, Stele von Aksaray.
53
c) Relief
im Vergleich zu anderen späthethitischen Fürstentümern, so auch Phrygien, zeichnet
sich Tabal durch eine ungewöhnlich hohe Dichte an in oder aus dem Gestein
gearbeiteten Felsbildern aus, je nach Bearbeiter beläuft sich deren absolute Zahl auf
mindestens 5, maximal 6 Exemplare
das Relief vom Kizildağ
der Kizildağ ragt aus dem zentralanatolischen Hochplateau und ist ein mäßig
zerklüfteter Berg (Abb. 70), auf dessen natürlichen Felsformationen gleich
mehrere Inschriften aus dem 2. und 1. Jahrtausend BC zu finden sind
daneben ist eine größere Formation an Felstrümmern (Abb. 71), welche
entfernt an einen Thron erinnern mag, an einer ihrer Außenseiten mit einem
schwachen Relief versehen, dessen Umrisslinien nur wenige Millimeter in die
Felswand reichen
dargestellt ist eine sitzende Figur, bärtig, die in ihrer linken Hand einen Stab,
in ihrer Rechten eine flache Trinkschale hält, ihre Füße, in Schnabelschuhen
gehalten, ruhen auf einem Schemel (Abb. 72 und 73)
sie trägt ein kurzärmeliges Gewand, das über ihren Fußknöcheln in einem
Fransensaum endet und eine kegelförmige Kopfbedeckung mit Ohrenklappen,
die monumentale Sitzgelegenheit wird ob ihrer Größe stark betont und ist mit
hoher Wahrscheinlichkeit als Thron anzusprechen, so wie die abgebildete
Person einen tabalischen Herrscher darstellt
dass es sich bei dem bärtigen Mann um einen König handelt, darauf verweist
ebenfalls die zu dem Relief gehörige luwische Inschrift, die rechts der Figur,
etwa in Kopfhöhe, angebracht wurde
allerdings nennt die Inschrift den Großkönig Hartapu, Sohn des Mursili und
einer der Nachfolger des Kurunta, Letzterer war König von Tarhuntašša, dem
Vorgängerreich von Tabal, er regierte im 12. Jahrhundert BC und damit
deutlich vor der Blütezeit Tabals im 8. Jahrhundert BC
dahingegen kann das Felsrelief, das seine assyrisierenden Elemente nicht zu
verbergen mag, keinesfalls vor dem 9. Jahrhundert BC entstanden sein, die
Darstellung der sitzenden Herrscherfigur erinnert neben der assyrischen
Gestaltung von Zopf und Bart in ihrer Haltung frappierend an ein Bildnis des
Assurnasirpal II aus Nimrud (Abb. 74)
des weiteren ist zu vermerken, dass die luwischen Hieroglyphen plastisch aus
dem Felsen heraustreten, während es sich bei dem Figuralmotiv lediglich um
eine einfache, wenig kunstvoll, ausgeführte Ritzung handelt, ein weiterer
Beleg für die Dichotomie von Inschrift und Relief
eine mögliche Erklärung für diesen Umstand wäre, dass ein uns unbekannter
Herrscher Tabals im 9. oder 8. Jahrhundert BC auf die antike Inschrift stieß
und im Sinne einer künstlichen Familienbildung, eine Legalisierung seiner
eigenen Machtstellung bezweckend, indem er sich auf die altehrwürdigen
Herrscher von Tarhuntašša bezog, sein eigenes Bildnis neben der Inschrift
anbringen ließ
54
die deutlichen Unterschiede in der Elaboration von Relief und Hieroglyphen
lassen ferner vermuten, dass zu Anfang neben der Inschrift auch ein Bildnis
aus dem 12. Jahrhundert BC existiert haben könnte, dieses wurde später
abgetragen um Platz für das Abbild der tabalischen Herrscherfigur zu schaffen
neben einer künstlich angelegten Genealogie wäre auch eine tatsächliche
Verwandtschaft zwischen Hartapu und dem tabalischen König vorstellbar, der
die Erneuerung der Felsarbeiten zu Ehren seiner verblichenen Vorfahren
veranlasste
abschließend noch eine Überlegungen zu der luwischen Inschrift des 12.
Jahrhunderts BC, die Nennung der Namen Mursili und Kurunta eröffnet einige
interessante Perspektiven
zum einen könnte der Vater Hartapus mit der Annahme eines
prestigeträchtigen, hethitischen Namens (Mursili) die Anbindung an die
Vormachtstellung des Hatti-Reichs in Anatolien gesucht haben, was die
Regentschaft des Hartapu unmittelbar nach dem Zusammenbruch des
hethitischen Großreiches ansetzt, da ein hethitischer Königsname wie Mursili
schwerlich zur Zeit der Hatti-Könige von einem in ihrem Einflussbereich
befindlichen Fürsten getragen werden konnte
andererseits wäre ebenso denkbar, dass es sich bei genanntem Mursili
tatsächlich um Mursili III handelte, der auch unter dem Namen Urhi-Teshub
bekannt und ein Bruder von Kurunta war, Mursili III war ursprünglich König
von Hatti, wurde aber von seinem Onkel Hattusili II entmachtet und floh ins
Exil nach Ägypten, von wo er später wieder zurückkehrte und ein kleines
Königreich nahe dem Kizildağ begründete, vielleicht Tarhuntašša, von wo er
Widerstand gegen Hattusili II übte, dies würde die Regentschaft des Hartapu
direkt vor den Untergang des Hatti-Reichs setzen
gleichwohl, welche der genannten Möglichkeiten korrekt ist, so stimmt doch
das 12. Jahrhundert BC als Entstehungszeitraum der Felsinschrift
das Relief von Karapınar
in Karapınar, nahe Kayseri, wurde bei Bauarbeiten das ca. 0,62 m hohes
Felsrelief eines stehenden Mannes entdeckt (Abb. 75), leider wurde es im
weiteren Verlauf der Arbeiten vollständig zerstört
eine äußerst dürftige Fotografie und eine Umzeichnung sind die letzten
Zeugen des Flachbilds, dargestellt war eine bärtige Person ohne
Kopfbedeckung, in einem Langen Gewand, mit Schwert, Gürtel und einem
Stab in ihrer rechten Hand
der linke Arm ist erhoben, vielleicht als Grußformel, möglicherweise aber
auch, um auf eine nicht erhaltene Inschrift hinzuweisen, sie gleicht damit in
ihrer Konzeption der Stele aus Ҫiftlik (Abb. 67)
das Relief von Gökbez
auf einer Felswand nahe Gökbez, das 40 km südöstlich von Niğde entfernt
liegt, findet sich das Abbild einer nach links schreitenden Gottheit mit
erhobenen Armen (Abb. 76)
in ihrer rechten Hand trägt sie eine Axt, in ihrer Linken ein Blitzbündel, sie
trägt ferner einen Gürtel und einen kurzen Rock, ihre Kopfbedeckung wird als
55
Helm angesprochen, wahrscheinlicher ist aber eine stark verwitterte
Hörnerkrone
zwischen ihren Beinen sprießt eine Weinranke empor, die nach links abknickt,
rechts der Figur findet sich ein bislang nicht zu deutendes Symbol, das an
einen Doppeltorbogen erinnern mag
Weinranke, Axt und Blitze lassen in der Figur mit hoher Wahrscheinlichkeit
den Sturmgott Tarhunt in seiner kriegerischen Form erkennen
das Felsrelief von Ivriz
das wohl populärste Felsrelief Anatoliens findet sich in Ivriz, wo nur wenige
Meter unterhalb der dargestellten Szenerie ein Quelle zu Tage tritt (Abb. 77),
dahingehend war das Relief in der Antike sicherlich Teil eines Quellheiligtums
dargestellt sind der Wettergott Tarhunt und der südtabalische König
Warpalawa (Abb. 78 und 79), die Gottheit ist mit einer Körpergröße von 4,2 m
deutlich monumentaler als der König, welcher auf einem Vorsprung stehend
seine Arme ehrfürchtig/betend vor Brust und Gesicht hält, die
Darstellungsweise des Warpalawa gleicht jener auf der Stele von Bor (Abb. 63
und 64) sowohl in Körperhaltung als auch in Art und Form der Bekleidung,
erneut zeigt sich auf der Gewandung des Königs ein Band von verdrehten
Hackenkreuzen, ähnliche Formen finden sich auf phrygischer Keramik und
Möbelstücken aus dem Tumulus MM (Abb. 80), ebenfalls phrygisch
ferner wird der Umhang des Warpalawa von einer Knopffibel gehalten, die
nach typologischen Kriterien als aus dem phrygischen Raum stammend zu
bezeichnen ist
die Darstellung des Tarhunt hingegen ähnelt stark jener auf der Stele von
Aksaray bzw. der Ivriz-Stele (Abb. 61), auch wenn hier nur der untere Teil
erhalten ist, so gleichen sich beide Götterbilder doch in der Wiedergabe des
Rockes mit Volutenenden und den Schnabelschuhen, sowie den beiden
göttlichen Attributen, Weinranke und Kornähren, die an exakt den gleichen
Stellen aus dem Boden emporsteigen
die Weinranke auf dem Relief von Ivriz scheint den Gott halb zu umschlingen,
bevor sie dieser mit seiner rechten Hand ergreift, in seiner Linken hält er das
für seine Person typische Ährenbündel, desweiteren trägt er eine Hörnerkröne
und einen Gürtel, an dem der vogelköpfige Griff einer Stich- oder Schlagwaffe
zu erkennen ist
neben den figürlichen Motiven ist auch eine Inschrift auf dem Felsen
angebracht, insgesamt erreicht das Werk eine Höhe von 6 m und zeichnet
sich durch eine hohe Plastizität und einen außerordentlichen Detailgrad aus,
wie die Ausarbeitung der Gesichter und Gewandungen zeigt
interessant in Verbindung mit dem oben bereits angesprochenen
vogelköpfigen Knauf (Abb. 81) ist die Tatsache, dass es sich dabei weniger
um einen Hinweis auf die kriegerischen Aspekte des Tarhunts, als vielmehr
um eine Betonung dessen landwirtschaftlicher Qualitäten bzw. seiner
allgemeinen Bedeutung für die Ernte handelt
tatsächlich handelt es sich bei dem „Schwertgriff“ in Adlerkopfform wohl um
den Knauf einer Sichel, wie ähnliche Darstellungen auf einem Kudurru der
mittelbabylonischen Zeit, 11. Jahrhundert BC (Abb. 82) und einer
56
neuassyrischen Elfenbeinplatte aus Nimrud, 9. Jahrhundert BC (Abb. 83),
nahelegen
davon abgesehen ergeben sich für die Annahme, das abgebildete Objekt am
Gürtel des Tarhunt verkörpere ein Schwert, einige Unstimmigkeiten, so tritt die
Schwertscheide nicht auf der gegenüberliegenden Seite des Körpers hervor,
wodurch die Waffe unnatürlich verkürzt wird, desweiteren weist der Schnabel
des Adlers nach oben und somit in die falsche Richtung, würde man in dieser
Ausrichtung zum Schwerte greifen bestünde Verletzungsgefahr, der Schnabel
müsste eigentlich nach unten weisen
dass das Felsrelief als Teil eines Quellheiligtums zu verstehen ist, wird durch
ein weiteres Relief (Abb. 84 und 85) und eine in den massiven Fels gehauene
Kultanlage (Abb. 86), nur etwa 100 m südlich der Abbildungen von Wettergott
und König, bestätigt
dargestellt ist ein Opferzug, von der voranschreitenden Person ist lediglich die
untere Hälfte erhalten, eine ihr nachfolgende Person hält ein Opfertier an Kopf
und Hinterteil, das Tier konnte bislang nicht identifiziert werden, wirkt es doch
wie eine Mischung aus Stier und Pferd, das Relief ist schlecht erhalten,
möglicherweise wurde es nie verfertigt, es ist 1,1 m hoch und 0,9 m breit, die
Basis misst vom Boden aufwärts 0,4 m
die unmittelbar nördlich des Flachbildes anschließende Felstreppe führt zu
einer rechteckigen Vertiefung im Fels, möglicherweise Auffangort für Blut- und
Trankopfer oder ehemaliger Sitz eines Götterbildes
inwiefern diese Anlage und das Relief als tabalisch zu bezeichnen sind ist
unklar, als zeitlicher Rahmen wird das 12. bis 9. Jahrhundert BC angegeben,
es könnte sich dabei um ein Vorgängerheiligtum zum tabalischen Hauptrelief
handeln, welches in die 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts BC datiert
das Relief von Ambarderesı
aus Ambarderesı, einem Tal nahe der Quelle von Ivriz, stammt ein Felsrelief,
das vermutlich eine direkte Kopie des berühmten Ivriz-Reliefs darstellt (Abb.
87)
das Relief misst zwar nur 4,5 m an Gesamthöhe und verfügt über keine
Inschrift, gleicht seinem großen Vorbild aber bis ins Detail, sofern dies ob der
etwas gröberen Bearbeitung und dem schlechten Erhaltungszustand möglich
ist
57
Abb. 70: Der Kizildağ.
Abb. 71: Aufnahme der thronartigen Felsformation mit Relief und Inschrift.
60
Abb. 76:Das Relief von Gökbez.
Abb. 77: Ivriz, (A) Relief, (B) Quelle, (C) Fluss, (D) Brücke ins Dorf.
63
Abb. 80: Rekonstruktionszeichnung eines Möbelstücks aus Tumulus MM.
Abb. 81: Detailaufnahme, Gürtel des Tarhunt mit Weintrauben und Adlerkopfknauf.
64
Abb. 82: Umzeichnung der Göttersymbole eines Kudurru der mittelbabylonischen Zeit.
Abb. 83: Neuassyrische Elfenbeinplatte aus Nimrud.
68
3) Fazit
nachfolgend je ein stichwortartiges Fazit zur Flachbildkunst aus Phrygien und Tabal
Phrygien
die phrygische Flachbildkunst ist im weitesten Sinne eine Verschmelzung
späthethitischer wie typisch phrygisch-gordischer Elemente
besonders deutlich wird dies an den frühesten Orthostaten und Wandreliefs
aus Gordion, die sich durch teils abstrakte und schwerfällige Formen
auszeichnen
diese frühesten phrygischen Figuralmotive wirken, wie etwa der Löwenkopf
aus Gordion, etwas unbeholfen, die starre geometrische Haltung einiger
Figuren gordischer Graffiti verweist auf eine alte phrygische Tradition, welche
die Darstellung von Figuren nicht kannte, jedoch auf ein variantenreiches
Repertoire an geometrischen Formen zurückgreifen konnte, wie reich mit
derlei Motiven verzierte Kultfassaden, Keramikgefäße und Möbelstücke aus
Phrygien beweisen
trotz genannter „phrygischer“ Eigenheiten, finden die Orthostaten aus Gordion
deutlichste Entsprechung in verschiedenen späthethitischen Fürstentümern,
so z. B. Karkemiš und Zincirli
sofern die Orthostaten von Ankara tatsächlich phrygischen Ursprungs sind, ihr
Kontext bleibt bis auf weiteres ungewiss, so lässt sich mit Beginn des 8. bzw.
7. Jahrhunderts BC und damit dem wachsenden Interesse Assyriens an
Anatolien, ein gewisser assyrischer Einfluss auf die Flachbildkunst Phrygiens
beobachten, welcher sich in der naturalistischen und langgezogenen
Darstellung von Tieren und Mischwesen äußert
interessant ist weiterhin, dass gesicherte Beispiele phrygischer
Flachbildkunst, außerhalb Gordions existieren nur vereinzelte Beispiele, die
Reliefs von Midas-Stadt sind stilistisch kaum bzw. nicht auszuwerten, nur
innerhalb oder nahe Gordions, der phrygischen Hauptstadt selbst, anzutreffen
sind, dies wirft weitergehend die Frage auf, inwiefern das klassische Phrygien
tatsächlich als ein in sich geschlossenes, territoriales Königreich zu verstehen
ist, oder ob es sich in Wirklichkeit lediglich um eine kleine Lokalmacht
handelte, deren Einfluss kaum weiter als die Ausdehnung Gordions reichte
69
Tabal
die tabalische Flachbildkunst ist im weitesten Sinne eine Verschmelzung
späthethitischer wie neuassyrischer Elemente, was besonders deutlich durch
im assyrischen Stil gehaltene Frisuren und Körper- bzw. Sitzhaltungen
unterstrichen wird
gleichzeitig verweisen dargestellte Kleidungsstücke, wie Volutenröcke und
Schnabelschuhe, sowie die teils gedrungene aber stets kräftige Form der
Körper, auf eine starke, späthethitische Präsenz, in deren Schatten das Reich
Tabal und seine Flachbilder entstanden
dabei ist die Wirkung des neuassyrischen Reiches auf die Bildhauerei in Tabal
keinesfalls zu unterschätzen, es gilt als erwiesen, dass sich die Blütezeit
tabalischer Flachbildkunst in der 2. Hälfte des 8. Jahrhundert ereignete,
zeitgleich mit im anatolischen Raum stattfindenden, assyrischen
Interventionen, die meisten Fürsten Tabals, so auch Warpalawa, waren
gegenüber den Herrschern aus Assur tributär
70
4) Literaturverzeichnis
Literatur
S. Aro, Tabal. Zur Geschichte und materiellen Kultur des zentralanatolischen Hochplateaus
(Diss. Helsinki 1998)
D. Berndt, Midasstadt in Phrygien. Eine sagenumwobene Stätte im anatolischen Hochland
(Mainz am Rhein 2002)
L. Bier, A Second Hittite Relief at Ivriz, Journal of Near Eastern Studies 35 Nr. 2, 1976, 115–
126
K. Bittel, Die Hethiter. Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3. bis zum Anfang des 1.
Jahrtausends vor Christus (München 1976)
J.-D. Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions I, 2 (Berlin 2000)
J.-D. Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions I, 3 (Berlin 2000)
F. Işik, Zur Entstehung Phrygischer Felsdenkmäler, Anatolian Studies 37, 1987, 163–178
U. Kelp, Der Einfluss des späthethitischen Kulturraumes auf Orthostaten in Gordion, in: M.
Novák – F. Prayon – A.-M. Wittke (Hrsg.), Die Außenwirkung des späthethitischen
Kulturraumes. Güteraustausch – Kulturkontakt – Kulturtransfer, AOAT 323 (Münster 2004)
285–298
Kunst- und Ausstellungshalle der BRD (Hrsg.), Die Hethiter und ihr Reich. Das Volk der 1000
Götter, Ausstellungskatalog Bonn (Stuttgart 2002)
C. Melchert (Hrsg.), The Luwians (Leiden 2003)
W. Orthmann, Untersuchungen zur späthethitischen Kunst (Bonn 1971)
W. Orthmann, Der Alte Orient, PKG 14 (Berlin 1975)
W. Orthmann, Die Außenwirkung auf Assyrien, Urartu und Phrygien. Zusammenfassung und
Ausblick, in: M. Novák – F. Prayon – A.-M. Wittke (Hrsg.), Die Außenwirkung des
späthethitischen Kulturraumes. Güteraustausch – Kulturkontakt – Kulturtransfer, AOAT 323
(Münster 2004) 459–463
F. Prayon, Phrygische Plastik (Tübingen 1987)
L.-E. Roller, Early Phrygian Drawings from Gordion and the Elements of Phrygian Artistic
Style, Anatolian Studies 49, 1999, 143–152
L.-E. Roller, Towards the Formation of a Phrygian Iconography in the Iron Age, in: A.
Ҫilingiroğlu – A. Sagona (Hrsg.), Anatolian Iron Ages 6. The Proceedings of the Sixth
Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Eskisehir, 16-20 August 2004 (Leuven 2007) 207–
223
71
W. Röllig, Sprachen und Schriften der Levante in Anatolien, in: M. Novák – F. Prayon – A.-M.
Wittke (Hrsg.), Die Außenwirkung des späthethitischen Kulturraumes. Güteraustausch –
Kulturkontakt – Kulturtransfer, AOAT 323 (Münster 2004) 205–214
G.-K. Sams, Sculpted Orthostates at Gordion, in: K. Emre (Hrsg.), Anatolia and the Ancient
Near East. Studies in Honour of Tahsin Özgüç (Ankara 1989) 447–454
F. Sarre, The Hittite Monument of Ivriz and a Carpet Design of Asia Minor, The Burlington
Magazine for Connoisseurs 14 Nr. 69, 1908, 143–147
E. Schwertheim – E. Winter (Hrsg.), Neue Funde und Forschungen in Phrygien, Asia Minor
Studies 61 (Bonn 2008)
S.-R. Steadman u. a. (Hrsg.), The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. 10,000 – 323
B.C.E. (Oxford 2011)
M. Şahin, Neue Beobachtungen zum Felsrelief von İvriz/Konya. Nicht in den Krieg, sondern
zur Ernte: Der Gott mit der Sichel, Anatolian Studies 49, 1999, 165–176
Nachschlagewerke
H. Cancik u. a. (Hrsg.), Der Neue Pauly (DNP). Enzyklopädie der Antike (Stuttgart 1996–
2003)
DNP VI (1999) 527–533 s. v. Kleinasien III. C. c. (F. Starke)
DNP IX (2000) 965–967 s. v. Phryges, Phrygia (E. Olshausen)
DNP XI (2001) 1190 s. v. Tabal (E. Cancik-Kirschbaum)