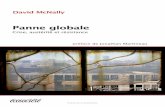Genre et sexualité: Homophobie entre philosophie et psychanalyse
Psychoanalyse und Zeitgeschichte - psychanalyse et histoire du temps présent
Transcript of Psychoanalyse und Zeitgeschichte - psychanalyse et histoire du temps présent
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Psychoanalyse und Zeitgeschichte / Psychanalyse et histoire du temps présent
»Der Gebrauch der Analyse zur Therapieder Neurosen ist nur eine ihrer Anwendungen.
Vielleicht wird die Zukunft zeigen,daß sie nicht die wichtigste ist« (GW XIV, 85)
EinleitungDas Thema: ›Psychoanalyse und andere Wissenschaften‹, im hier diskutierten Fall der Geschichte, sowie die Frage nach ihrem Verhältnis zueinander ist nicht neu. Es bekommt in meinen Augen jedoch eine besondere Aktualität angesichts der Frage nach dem Sinn unserer ›Erinnerungskultur‹ in Deutschland in Bezug auf den Nationalsozialismus – seit der Adenauer-Ära bis zur gegenwärtigen Erstarrung in Wiederholung und Lagerdenken. In diesem Sinne scheint mir ein Blick über die Grenzen auf das Werk des französischen Zeithistorikers Henry Rousso sinnvoll, der in verschiedenen Schriften und unter Einbeziehung psychoanalytischer Erkenntnisse dieStadien der Erinnerungskultur Frankreichs in Bezug auf das Vichy-Regime reflektiert. Die zweite Überlegung gilt den Fragen nach dem Verhältnis Psychoanalyse – Geschichte selbst, damit auch den Fragen der ›Laienanalyse‹ im Bereich kollektiver Erscheinungen. Das ist nicht uninteressant für einen Blick auf den gegenwärtigen Zustand der Psychoanalyse selbst, die in weiten Bereichen ihren gesellschaftskritischen Stachel zugunsten ihres Reüssierens als Teilder allgemeinen Gesundheitsfürsorge eingezogen hat. Das Thema reihtsich ein in eine mehrschichtige Problematik, die Freud bereits in DieLaienanalyse (1926) diskutierte. Ja früher noch: anhand von zwei Schriften aus den 1890er Jahren möchte ich zeigen, daß Freud bereitshier aus seinen Erfahrungen mit seiner sich entwickelnden Wissenschaft der Psychoanalyse – damals noch ›Seelenbehandlung‹ genannt – die individuelle nicht von der kollektiven, der kulturellen Perspektive abtrennt. Das ist gleichzeitig ein Plädoyer für das Wiederlesen von Freud um auch die nach dem Zweiten Weltkriegaufgestellte These zu prüfen, Freud habe eine ›Einpersonen-Psychologie‹ vertreten, die es nun in Richtung auf eine ‹Zweipersonen-Psychologie‹ bzw. eine ›interpersonelle Psychoanalyse‹zu verbessern galt. 1
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
1. Alte und neue Fragen der LaienanalyseDer Begriff Laienanalyse wird im allgemeinen Verständnis anhand von Freuds 1926 erschienener Schrift Die Frage der Laienanalyse auf die Probleme der Ausübung von Psychoanalyse durch Nichtärzte bezogen. Esgibt jedoch eine ältere Bedeutung des Begriffs Laienanalyse, sozusagen avant la lettre, d. h. bevor der Begriff mit Die Frage der Laienanalyse definiert wurde. Die ältere Bedeutung soll hier dargestellt werden, da sie nach meiner Überzeugung erhellend ist füreine wünschbare interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Psychoanalyse und Zeitgeschichte. Die ältere Bedeutung geht aus von Freuds Besorgnis in Bezug auf ›wilde Analyse‹ und sein Plädoyer für eine Ausbildung in allen Bereichen, in denen psychoanalytische Erkenntnisse und Untersuchungsmethoden eine Rolle spielten. Umgekehrt schließt sich daran mein Plädoyer an, daß Psychoanalytikerals Laien in der Geschichtsforschung und –schreibung sich ebenfalls eine Sach- und Methodenkenntnis erwerben können und sollen.
1.1. Die Frage der Laienanalyse wiederbetrachtetFür Freud war der Anlaß zur Diskussion der Laienanalyse durch die Bedingungen in den USA gegeben, in denen Nichtmediziner die Psychoanalyse nicht praktizieren durften. Freud geht jedoch auch insGrundsätzliche und dabei auf den Status und die Zukunft der psychoanalytischen Wissenschaft und Erkenntnis ein.
Der Komplex, den Freud in Die Laienanalyse diskutiert, umfaßt mindestensvier Themen, die seit 1926 nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Ich skizzieren sie hier nach ihrem wesentlichen Schwerpunkt: 1. Fragen einer staatlichen Reglementierung und Gesetzgebung, 2. dieFolgen eines eventuell damit einhergehenden Ausschlusses von Wissenschaftlern aus anderen als den ärztlichen (und psychologischen) Berufen, 3. die sich damit ergebende Gefahr eines Verlustes der kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Bedeutung der Psychoanalyse als Erkenntnisverfahren, und 4. die sich daraus ergebenden Gefahren für die Ausbildung und Praxis der Psychoanalytiker selbst.
1.2. Die Frage(n) einer staatlichen Reglementierung der psychoanalytischen Praxis
Im Zusammenhang mit der ersten Frage hält Freud zunächst einmal kategorisch und im Text hervorgehoben fest, »daß niemand die Analyseausüben soll, der nicht die Berechtigung dazu durch eine bestimmte Ausbildung erworben hat« (GW XIV, 267). Er erteilt damit – auch 2
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
explizit – jeder ›wilden Psychoanalyse‹ eine Absage, im engeren Sinne bei ihrer Ausübung in der therapeutischen Praxis, im weiteren Sinne bei ihrer Ausübung durch Psychoanalytiker und andere Wissenschaftler in nichttherapeutischen Untersuchungsfeldern.
Freud hatte bereits 1890 die Psychoanalyse – damals noch ›Seelenbehandlung‹ genannt, wie folgt bestimmt: als eine »Behandlungvon der Seele aus, Behandlung – seelischer oder körperlicher Störungen – mit Mitteln, welche zunächst unmittelbar auf das Seelische des Menschen einwirken. Ein solches Mittel ist vor allem das Wort, und Worte sind auch das wesentliche Handwerkszeug der Seelenbehandlung (GW V, S. 289)1. Freud hebt hier hervor, daß die Psychoanalyse nicht am Körper des Subjekts ansetzt, sondern die Seele – Psyche – als ihren Untersuchungs- und Behandlungsraum, daß sie mit Mitteln der Sprache ›behandelt‹, einschließlich der körperlichen, und das heißt psychosomatischen Leiden. Seelisches undKörperliches sieht er dabei als eine Einheit an: »Das Verhältnis zwischen Leiblichem und Seelischem (beim Tier wie beim Menschen) isteines der Wechselwirkungen, aber die anderen Seite dieses Verhältnisses, die Wirkung des Seelischen auf den Körper, fand in früheren Zeiten wenig Gnade vor den Augen der Ärzte« (ebd., S. 291).
Er geht jedoch noch weiter, und das ist wichtig für unser Thema Psychoanalyse und Zeitgeschichte, indem er 1. auch die Denkvorgänge und 2. das zivilisierte Umgehen der Menschen miteinander in den Bereich der Affektivität mit einschließt, der im Falle der Störung durch das Wort behandelbar, und das heißt auch verstehbar wird. Was die Denkvorgänge angeht, sieht er sie als »in gewissem Maße ›affektiv‹ [an], und kein einziger von ihnen entbehrt der körperlichen Äußerung und der Fähigkeit, körperliche Vorgänge zu verändern« (ebd., S. 296, meine Hervorhebung).
Man denke hier an Alexander Mitscherlichs drei Bände Krankheit als Konflikt. Studien zur psychosomatischen Medizin, in denen er das Erlebnis als eine »leib-seelische Gleichzeitigkeit« (1967, 13ff.) definiert. »Alle Gleichzeitigkeit des Körperlichen und des Seelischen ist unwillkürlich und unbewußt« (a.a.O. S.20) und damit genuiner Gegenstand von Psychoanalyse: diese »seelisch-leibliche
1 Daß diese Schrift im Band V aufgenommen ist – also ›Werke aus den Jahren 1904-1905 – geht auf einen inzwischen korrigierten editorischen Fehler zurück. S. Reinke, Ellen 2012b (2013b).3
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Gesamtgestalt einer Erregung […] ist in sich objekt- und ichbezogen2,d. h. sinnvoll« (a.a.O. S. 24). Mitscherlich sieht damit psychosomatisches Leiden als ein Zerreißen des leib-seelischen Simultangeschehens, die Chronifizierung des Leidens, als eine ›Defektautonomie‹ des Körperlichen. Für diese Somatisierung entwickelt er das Konzept einer ›zweiphasigen Verdrängung‹ (a.a.O. S. 71ff.), d. h. das körperliche Symptom entwickelt sich nach dem Scheitern einer psychoneurotischen Konfliktlösung. Es ist also eine Regression. »Regression im Sinne der Resomatisierung bedeutet partielles Rückgängigmachen erreichter Affektbewältigung durch Gedankenarbeit, das heißt, der Reifungsvorgänge, welche Desomatisierung affektiver Vorgänge mit sich bringen« (a.a.O. S. 123). Ausgelöst wird diese Resomatisierung durch ›Objektverlust‹ - real oder phantasiert - »der das Gefüge von [psychoneurotischen] Reaktionsbildungen und Abwehrvorgängen endgültig stört« und zu einer»Stimmung der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit […] Ich-Verarmungdurch die regressiven Vorgänge [führt], welche durch den Objektverlust und die mit ihm verbundene neurotische Angst ausgelöstwerden. Das Welterlebnis der endgültigen Feindseligkeit und des Gescheitertseins entspricht einem Projektionsvorgang. Das Diktat geht von den inneren Objekten, einer Art archaischem Über-Ich, aus« (ebd.). Es ist meines Wissens noch nicht systematisch erforscht worden, ob diese Ansätze Mitscherlichs nicht erkenntnisfördernd auf die Analyse unseres gegenwärtigen Denkens und Erinnerns in Bezug aufden Nationalsozialismus fruchtbar gemacht werden könnten, insbesondere, was seine Hypothese des Vorherrschens von archaischen Über-Ich-Vorläufern angeht, als eines Mangels an integrationsfähigenIchleistungen, wie das vor allem bei sog. Traumagedächtnis der Fall ist. Ein sorgfältiges Wiederlesen der o. g. Schriften Mitscherlichs könnte dazu ein Anfang sein.
Das zivilisierte Umgehen der Menschen miteinander , in das Freud den Bereich der Affektivität mit einschließt, arbeitet Freud 2. zu einer rudimentären Theorie der Kultur aus, was die Beziehungen und den Umgang der Subjekte miteinander im öffentlichen Raum angeht. »Ein
2 Unter interdisziplinärer Perspektive sei hier angemerkt, daß der psychoanalytischen Terminus ›Objekt‹ die psychische Repräsentanz der erfahrenen und verarbeiteten Beziehungen – Interaktionen – mit den relevanten Bezugspersonen innerhalb und außerhalb der Familie meint. In ihrer nichtverarbeiteten Form sind sie keine Repräsentanzen, d. h. Produktevon Aneignung, sondern ›Introjekte‹, d. h. Fremdkörper in der seelischen Organisation.4
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Mensch erfahre eine Beleidigung, einen Schlag oder dergleichen, so ist das psychische Trauma mit einer Steigerung der Erregungssumme des Nervensystems verbunden. Es entsteht dann instinktiv die Neigung, diese gesteigerte Erregung sofort zu vermindern, er schlägtzurück, und nun ist ihm leichter, er hat vielleicht adäquat reagiert, d.h., er hat so viel abgeführt, als ihm zugeführt wurde. Nun gibt es verschiedene Arten dieser Reaktion. Für ganz leichte Erregungssteigerungen genügen vielleicht Veränderungen des eigenen Körpers, Weinen, Schimpfen, Toben und dergleichen. Je intensiver daspsychische Trauma, desto größer ist die adäquate Reaktion. Die adäquate Reaktion ist aber immer die Tat. Aber, wie ein englischer Autor geistreich bemerkte, derjenige, welcher dem Feinde statt einesPfeiles ein Schimpfwort entgegenschleuderte, war der Begründer der Zivilisation, so ist das Wort Ersatz für die Tat und unter Umständender einzige Ersatz (Beichte). Es gibt also neben der adäquaten Reaktion eine minder adäquate. Wenn nun die Reaktion auf ein psychisches Trauma gänzlich unterblieben ist, dann behält die Erinnerung daran den Affekt, den sie ursprünglich hatte« (1893, GW Nachtragsband, S. 192f.).
Freud beschreibt hier nichts weniger als die Tatsache, dass die ›Erledigung‹ des psychischen Traumas auf zwei Wegen erreicht werden kann: erstens durch die Tat, zweitens durch das Wort – letztere Aktion definiert er als Kennzeichen des zivilisierten Menschen. Die Psychoanalyse wendet sich damit von Anfang an seelischen, psychosomatischen und kulturellen Themen zu, und es ist unter dieserPerspektive nicht verwunderlich, daß Forscher aus anderen als dem ärztlichen Bereich früh zu Freuds Kreis gehörten oder zunehmend psychoanalytische Erkenntnisse für ihr Fach als wichtig erkannten.
Für diese breite Möglichkeit der psychoanalytischen Erkenntnis stehtnun allerdings die standesmäßige Ausbildung und Organisation des Arztberufs in einem gewissen Spannungsverhältnis, was Freud einerseits aufgrund der Verantwortung und Folgen für die körperlichen Eingriffe beim Patienten anerkennt, andererseits erkennt er in diesem Regelungsbedarf eine Neigung zum Verbot gerade für die psychoanalytische Ausbildung und Berufsausbildung. Er benennt in der Laienanalyse die Gefahren, die mit einer behördlichen und gesetzlich reglementierten Form der Ausbildung i. e. S. einhergehen: »Ist die Ausübung der Psychoanalyse überhaupt ein Gegenstand, der behördlichem Eingreifen unterworfen werden soll,
5
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
oder ist es zweckmäßiger, ihn der natürlichen Entwicklung zu überlassen? Ich werde gewiss hier keine Entscheidung treffen, aber ich nehme mir die Freiheit, Ihnen dieses Problem zur Überlegung vorzulegen. In unserem Vaterlande herrscht von alters her ein wahrerfuror prohibendi, eine Neigung zum Bevormunden, Eingreifen und Verbieten, die, wie wir alle wissen, nicht gerade gute Früchte getragen hat. […] Ich weiß nicht, ob Sie die Lust und den Einfluß haben werden, sich den bürokratischen Neigungen zu widersetzen« (1926, XIV, 268).
Das sind wahrlich prophetische Worte, denn die Vor- und Nachteile der gesetzlichen Regelung im Rahmen des PsychTG sind bekannt und werden diskutiert. Zu ihnen gehört auch – wieder – die Frage der ›Laien‹-Analyse. Freud plädiert in diesen Zusammenhang für ein Minimum an Verordnungen und Gesetzen, für gerade eben einmal die Garantie, daß niemand die Psychoanalyse ausüben können soll, der nicht eine unter mehreren möglichen Arten von psychoanalytischer Ausbildung durchlaufen hat. Dies gilt insbesondere für den Fall einer therapeutischen Anwendung der Psychoanalyse, ob sie nun durch Ärzte oder Nichtärzte ausgeübt wird.
1.3. Die alte und die neue Frage der ›Laien‹-AnalyseIm Gegensatz zur Problematik, die Freud in Die Laienanalyse 1926 zu bearbeiten hatte, war die Frage der Laien zu Anfang nicht an die einer medizinischen Ausbildung gekoppelt. Im Gegenteil. Sie bezog sich ausschließlich auf die Frage und die Notwendigkeit einer psychoanalytischen Ausbildung, die wie wir oben gesehen haben, für Freudeine Voraussetzung für deren Ausübung war. Die erste und eigentlicheFrage der Laienanalyse schloß also die Ärzte mit ein, sofern sie keine psychoanalytische Ausbildung absolviert hatten. Freud sah sich– paradoxerweise aufgrund der größeren Verbreitung psychoanalytischer Erkenntnisse seit dem Erscheinen der Traumdeutung um 1900 - genötigt, dazu in seiner Schrift Über ›wilde‹ Psychoanalyse (1910, GW VIII, S. 117-125) das Notwendige zu sagen. Psychoanalyse, so hebt er hervor, läßt sich nicht in Vorlesungen oder Lehrbüchern lernen; sie ist die Arbeit am Widerstand und der Übertragung, und die braucht Zeit (a.a.O. S. 124). »Es reicht also für den Arzt nichthin, einige der Ergebnisse der Psychoanalyse zu kennen, man muß sichauch mit ihrer Technik vertraut gemacht haben, wenn man sein ärztliches Handeln durch psychoanalytische Gesichtspunkte leiten lassen will« (ebd.). Der organisatorische Rahmen für die Ausbildung
6
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
zum Psychoanalytiker fand sich in der gerade gegründeten psychoanalytischen Vereinigung, so daß damals überhaupt erst eine verläßliche und durch die Gemeinschaft der Psychoanalytiker weiter zu entwickelnde Möglichkeit für sie gegeben war. Die alte Frage nach der Laienanalyse war damit eindeutig geklärt. Sie betraf alle Grundausbildungen, nicht nur die ärztliche.
Bei der neuen, 1926 erörterten Frage nach der Laienanalyse i. e. S. war es aufgrund der Bestimmungen für die USA eindeutig, daß mit ›Laien‹ nun ausschließlich Nichtärzte gemeint waren. Diese Einschränkung galt in Europa noch kaum Für die Wiener oder Berliner Vereinigung ergäbe Aufzählung aller nichtärztlichen Analytiker, selbst nur der berühmtesten, eine stattliche Liste. So war es zunächst für die europäischen Psychoanalytiker von untergeordnetem Interesse, eine Lanze für das Recht von Nichtmedizinern zu brechen. Das sollte sich mit dem Nationalsozialismus drastisch ändern und zu einer existentiellen Frage für diejenigen unter den Psychoanalytikern werden, denen es gelang, in die USA zu emigrieren.Zwischen 1938 und 1943 flohen zahlreiche deutschjüdische Analytiker in die USA und trafen dort auf ein anderes Gesundheitssystem, das auch für die Ausbildung zum Psychoanalytiker ein Medizinstudium und eine psychiatrische Facharztausbildung voraussetzte. »The American asserted full autonomy concerning training standards and requisit provessional credentials for psychoanalytic recognition in the United States. As part of this, the American promulgated what came to be known as the ›1938 rule‹, that psychoanalytic training in American institutes would be limited to psychiatric physicians, and that membership in the American Psychoanalytic Association would be barred to all nonphysicians, except for a grandfathered handful of acknowledged and prominent psychoanalytic leaders like Peter Blos, Erik Erikson, Ernes Kris and Robert Waelder, all of them fully trained in Europe before 1938« (Wallerstein, 1998, S. 48).
Die therapeutische Ausübung der Psychoanalyse betrachtet Freud allerdings in der Laienanalyse als nur einen Fall möglicher Anwendungen, wenn auch dadurch hervorgehoben, daß sich die psychoanalytische Wissenschaft zunächst aus dieser Praxis heraus entwickelt hat. Um es mit seinem Satz zu paraphrasieren: »Das Ich ist vor allem ein körperliches…« (Das Ich und das Es, GW XIII, 253) heißt, daß die Ichentwicklung ihren Ausgang aus den Körpererfahrungennimmt, das entwickelte Ich jedoch in der Interaktion mit den
7
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Bezugspersonen und der Umwelt gründet, wie oben bereits im Zusammenhang mit dem Ansatz von Alexander Mitscherlich betont wurde.In ihrer Wissenschaftsentwicklung ging die Psychoanalyse, diese ›Wissenschaft neuen Typs‹, vom Junktim von Heilen und Forschen aus, die Reflexion der erkenntnistheoretischen Konsequenzen folgte verständlicherweise nach, sowohl in der psychoanalytischen Forschergemeinschaft wie auch in der Philosophie und den Sozialwissenschaften.
Hier geht es also um das Interesse an der Wissenschaft Psychoanalyse als Erkenntnisverfahren, als eine Forschungsmethode, die den Zugang zu den Bereichen ermöglichen, die mit dem Bewußtsein und der ihm eigenen Reflexionsfähigkeit nicht verstanden und erklärtwerden können. Es geht gerade um die »Lücken im Bewußtsein« (s. Reinke, 2001, 2002), in diesem Zusammenhang um die Theorie des Unbewußten, die Philosophen wie Paul Ricoeur aufgegriffen haben in ihrer Kritik am Descartes´schen ego cogito. Daß Freud 1926 ein drohendes Verschwinden der Psychoanalyse im Bereich des Therapeutischen fürchtete, war durch die lebhaften interdisziplinären Diskussionen der ersten Hälfte des 20. Jh. und philosophischen Diskussionen besonders der zweiten Hälfte des 20. Jh. zunächst einmal abgewendet. Es ist aber an der Zeit, an diese Gefahr wieder zu erinnern:
»Wir halten es nämlich garnicht für wünschenswert, daß die Psychoanalyse von der Medizin verschluckt werde, und dann ihre entgiltige Ablagerung im Lehrbuche der Psychiatrie findet, im Kapitel Therapie, neben Verfahren wie hypnotische Suggestion, Autosuggestion, Persuasion, die, aus unserer Unwissenheit geschöpft,ihre kurzlebigen Wirkungen der Trägheit und Feigheit der Menschenmassen danken. Sie verdient ein besseres Schicksal und wird es hoffentlich haben. Als ›Tiefenpsychologie‹, Lehre vom seelisch Unbewußten, kann sie all den Wissenschaften unentbehrlich werden, die sich mit der Entstehungsgeschichte der menschlichen Kultur und ihrer großen Institutionen wie Kunst, Religion und Gesellschaftsordnung beschäftigen. Ich meine, sie hat diesen Wissenschaften schon jetzt ansehnliche Hilfe zur Lösung ihrer Probleme geleistet, aber dies sind nur kleine Beiträge im Vergleich zu dem, was sich erreichen ließe wenn Kulturhistoriker, Religionspsychologen, Sprachforscher usw. sich dazu verstehen werden, das ihnen zur Verfügung gestellte neue Forschungsmittel selbst zu handhaben« (GW XIV, 1926, 283).
8
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Freud führt an anderer Stelle aus, wie er sich die Ausbildung der therapeutischen Psychoanalytiker und der Wissenschaftler vorstellt, die nicht oder nicht nur klinisch arbeiten möchten, sodass sie psychoanalytische Methoden und Theorien in ihrer eigenen Praxis handhaben können. Diese – unter dem Gesichtspunkt eines ärztlichen Monopols gesehen – ›Laien‹ müssten, wie die klinischen Analytiker, eine praktische und theoretische Unterweisung durch ältere, erfahrene Psychoanalytiker durchlaufen haben. Ein solcher Unterrichtin Psychoanalyse wäre sowohl in den Instituten gegeben (GW XIV, 1926, 260), als auch in psychoanalytischen Hochschulen mit einem besonders breiten, interdisziplinären Angebotsspektrum.
»Wenn man, was heute noch phantastisch klingen mag, eine psychoanalytische Hochschule3 zu gründen hätte, so müsste an dieser vieles gelehrt werden, was auch die medizinische Fakultät lehrt: neben der Tiefenpsychologie, die immer das Hauptstück bleiben würde,eine Einführung in die Biologie, in möglichst großem Umfange die Kunde vom Sexualleben, eine Bekanntheit mit den Krankheitsbildern der Psychiatrie. Andererseits würde der analytische Unterricht auch Fächer umfassen, die dem Arzt ferne liegen und mit denen er in seiner Tätigkeit nicht zusammenkommt: Kulturgeschichte, Mythologie, Religionspsychologie und Literaturwissenschaft« (GW XIV, 81).
Er geht damit auf Bedingungen ein, die in der Vergangenheit von den psychoanalytischen Instituten erfüllt wurden. Noch in der Zeit meiner eigenen Ausbildung am Sigmund-Freud-Institut Frankfurt in Rahmen der Richtlinien der DPV/IPV wurde das so gehandhabt, daß die Kollegen aus anderen Fachrichtungen an der Ausbildung derjenigen teilnehmen konnten, die als Berufsziel die therapeutische Anwendung der Psychoanalyse anstrebten. Von diesen Kollegen wechselten einige
3 Zu diesem Thema heute: s. IPU – International Psychoanalytic University – Psychoanalytische Hochschule Berlin, http://www.ipu-berlin.de/hochschule.html (zuletzt abgerufen 20.6.15); s. a. Forschen und Heilen. Auf dem Weg zu einer psychoanalytischen Hochschule. Beiträge aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Sigmund-Freud-Instituts. Hg.: Herbert Bareuther, Hans-Joachim Buch, Dieter Ohlmeier, Thomas Plänkers. Frankfurt a. M. (Suhrkamp), 1989; darin u. a. Alfred Lorenzer: Plädoyer für eine psychoanalytische Hochschule, S. 31-46; in bezug auf das Thema Zeitgeschichte: Hajo Funke: Emigrantengeschichten: ›Sich wirklich gefühlsmäßig vergegenwärtigen, was geschehen ist‹. Alexander Mitscherlich aus der Sicht emigrierter Psychoanalytiker, S. 305-320; s. a. weitere Schriften von Hajo Funke zum Thema Zeitgeschichte, z. B. Die Erinnerung. Gespräche mit jüdischen Wissenschaftlern im Exil. S. Fischer, 1989; Umkämpftes Vergessen. Walser-Debatte, Holocaust-Mahnmal und neuere deutsche Geschichtspolitik. Brumlik / Funke /Rensmann, (Verlag Hans Schiler), 2. Aufl. 2010; 9
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
ganz in den therapeutischen Bereich, eine zweite Gruppe verband beides miteinander, d.h. sie arbeiteten mit Patienten sowie in der Anwendung der Psychoanalyse in ihrer Disziplin. Eine dritte, wahrscheinlich die kleinste Gruppe nutzte die Psychoanalyse ausschließlich für die Forschung und Theoriebildung in der eigenen Disziplin. Der bekannteste Repräsentant dieser dritten Gruppe dürfteder Historiker Peter Gay4 sein, auf den ich im nächsten Absatz noch zu sprechen kommen werde.
Allerdings machte man sich innerhalb der Psychoanalyse bis zu den Arbeiten Alfred Lorenzers zur Tiefenhermeneutischen Kulturanalyse (1986) keine grundsätzlichen Gedanken über einen notwendigen Methodentransfer vom therapeutischen auf den außertherapeutischen Bereich. Man vernachlässigte die Tatsache, daß es sich bei letzteremum einen anderen Gegenstand, nämlich nicht um individuelle, sondern um kollektive Phänomene handelt. Alle Absolventen hielten sich qua psychoanalytischer Ausbildung für befähigt, auf Gebieten wie den Literaturwissenschaften, der Jurisprudenz, etc. zu forschen, auch wenn sie in diesen Disziplinen nicht ausgebildet waren. Mit der Änderung der Ausbildungsrichtlinien innerhalb der DPV in den 70er Jahren des 20. Jh. und schließlich mit der Psychotherapiegesetzgebung in Deutschland ist diese Möglichkeit erschwert bis unmöglich geworden. Es gab keine psychoanalytische Ausbildungsmöglichkeit für Nichtärzte und Nichtpsychologen mehr, soweit sie eine Approbation anstrebten. Die Ausbildung von Pädagogenund Erziehern in der psychoanalytischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen scheint nun ebenfalls auszulaufen. Die Psychoanalyse hat sich auf ihren klinischen Anwendungsbereich zurückgezogen und den Kontakt zu anderen Fächern zunehmend verloren. Mit dieser ›Medizinalisierung‹5 ist die gesellschaftskritische Potenz der Psychoanalyse vielerorts aus dem Blick geraten, auch ihre notwendigeEinbindung in einen interdisziplinären Diskurs, sowie vor allem das gesellschaftliche Interesse an der Erkenntniskraft der Psychoanalyse, womit ich zum 4. und letzten Punkt komme, den Freud
4 Gay, Peter (1985): Freud for Historians. Oxford University Press5 (s. u. a. Reinke, 1991: Psychoanalyse zwischen politischer Psychologie und Medizinalisierung. Psychosozial (47), S. 8 – 18; dies. 1996: Wiederanknüpfung an die HORNsche Position einer „kritischen Theorie des Subjekts“ als Erkenntnisfrage im interdisziplinären Raum zwischen Gesellschaftstheorie und Psychoanalyse. In: Bruns, G., Hg.: Psychoanalyse im Kontext: soziologische Ansichten der Psychoanalyse. Opladen (Westdeutscher Verlag), 1996, S. 126 - 15210
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
anspricht: die Konsequenzen für die Ausbildung der klinischen Psychoanalytiker selbst.
Einerseits, so lesen wir bei Freud im Zusammenhang mit Überlegungen zu einer psychoanalytischen Hochschule, kann die psychoanalytische Ausbildung nicht auskommen, ohne den zukünftigen Analytiker in Fächern wie »Kulturgeschichte, Mythologie, Religionspsychologie und Literaturwissenschaft« (GW XIV, 281) zu unterweisen. Andererseits ist durch die Einführung des PsychTG ein Rahmen abgesteckt, der in Bezug auf Praxis, Methode und Theorie recht eng gesteckt ist6. Zwar haben die psychoanalytischen Institute und die inzwischen gegründeten psychoanalytischen Ausbildungen an den Universitäten, wie die Gründung von psychoanalytischen Hochschulen die Möglichkeit,hier gegenzusteuern, jedoch scheint mir deren Spielraum begrenzt. Auch scheinen mir die Probleme, die mit der universitären Ausbildungzusammenhängen, noch nicht genügend ins Bewußtsein getreten zu sein,folglich auch noch nicht genügend reflektiert. Andererseits gibt es durchaus (noch!) ein lebendiges Interesse anderer Disziplinen an derPsychoanalyse, und ich meine, daß die Psychoanalytiker das vordringlich aufnehmen sollen durch die Verstärkung bestehender oderdie Schaffung neuer interdisziplinärer Diskurse.
1.4. Psychoanalyse und Zeitgeschichte aus historischer SichtDies lässt sich am Beispiel ›Psychoanalyse und Zeitgeschichte‹ darstellen. Dieses Interesse hat eine Geschichte, die sich in verschiedene Stadien einteilen lässt, beginnend mit dem Ersten Weltkrieg. Das Interesse der Geschichtswissenschaftler, insbesondereder Zeitgeschichtler an der Psychoanalyse hat sich nach den Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts nicht überraschender Weisebeständig verstärkt. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg war dies der Fall. Unmittelbar danach standen noch klinische und kollektive Fragen der Kriegstraumatisierung im Mittelpunkt, damals weitgehend konzentriert auf die Erfahrungen der Soldaten in den Materialschlachten dieses ersten industriellen Krieges und deren Nachwirkungen. Ein Zeugnis innerhalb der Psychoanalyse davon sind die Aufsätze, die Freud 1919 in der Schrift Psychoanalyse der Kriegsneurosen zusammengefasst hat.
In der Zwischenkriegszeit verlagerte sich das Interesse an Erkenntnissen der Wirkung unbewusster Bedingungen auf das Verstehen 6 S. http://www.gesetze-im-internet.de/psychth-aprv/BJNR374900998.html (zuletzt abgerufen am 10.6.15)11
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
der Zeitgeschichte. Hier sind die Themen ›Psychoanalyse und Marxismus‹ sowie ›Psychoanalyse und Kritische Theorie der Gesellschaft‹ relevant. Beide unterscheiden sich tendenziell darin, daß das Thema ›Psychoanalyse und Marxismus‹ noch unter dem naiven Optimismus einer bereits am Horizont sichtbaren menschenwürdigen Gesellschaftsordnung diskutiert wurde. Das schloß die Hoffnung ein, daß sich durch die sozialistische Bewegung auch diejenigen zusätzlichen Einschränkungen und Triebverzichte auflösen würden, die(damals?) noch über das kulturell notwendige Maß hinaus der Mehrzahlder Gesellschaftssubjekte von einer Minderzahl aufgezwungen wurden (Die Zukunft einer Illusion, 1927, GW XIV, S. 355ff.). Es wurde in der Zwischenkriegszeit deutlich, daß die nationalistische Strömung weit eher in der Lage war, die Massen der Subjekte anzusprechen, sie zu einem großen Teil erreichen, als die sozialistischen Parteiungen. Neben den Vertretern der Kritischen Theorie hat dies niemand besser erkannt als Ernst Bloch 1935 in Erbschaft dieser Zeit, wo er argumentierte, daß die Vertreter der sozialistischen Bewegungen zu den Menschen über die Sachen sprachen, während die Vertreter der nationalistischen, besonders der nationalsozialistischen Strömung aus dem 19. Jh., die Menschen in ihrem berechtigten Unbehagen und den damit verbundenen Gefühlen der Zurücksetzung direkt ansprachen – und erreichten. Mit der Ankerkennung durch die Vertreter einer kritischen Theorie der Gesellschaft, daß nur die Psychoanalyse ein Wissen über diese Verhältnisse beim Individuum bereitstellen könnte,entwickelte sich der weniger naive Zweig der Analytischen Sozialpsychologie7. Die Psychoanalyse wurde darin als diejenige Wissenschaft verstanden, die die gesellschaftlichen Verhältnisse ›vom Subjektende her‹ analysiert.
Diese Perspektive einer Kritischen Theorie der Gesellschaft zusammenmit einer Kritischen Theorie des Subjekts erwies sich jedoch ab dem Zeitpunkt als nicht mehr tragfähig, als die Nachkriegsgeschichtsschreibung ab etwa Mitte der 70er Jahre des 20. Jh. zunehmend vor die besondere Herausforderung gestellt war, neben dem Krieg und seinen Nachwirkungen der neuartigen Herausforderung gerecht zu werden, die sich durch die Anerkennung des Herausragens der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden ergab. Diese zeitliche Bestimmung geht einerseits von Henry Rousso aus, wurde also für Frankreich entwickelt, wird jedoch für die deutsche
7 S. Dahmer, Helmut, Hg. : Analytische Sozialpsychologie, Bd. 1 und 2, Frankfurt a. M. (Suhrkamp), 198012
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Diskussion relevant8. Hier ging es nun nicht mehr um ein Verstehen von Klassenverhältnissen, von Kriegen, sondern um die Notwendigkeit,sich mit den Themen des Völkermordes und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit auseinanderzusetzen. Eine Zäsur in diesem Zusammenhang war die Aufhebung der Verjährungsfrist für Kriegsverbrechen und Völkermord, niedergelegt in einem Übereinkommender Mitglieder des Europarates im Jahre 19749. Damit war auch die Frage nach der Relevanz der Psychoanalyse für die zeitgeschichtlicheForschung und die Zeitgeschichtsschreibung neu gestellt.
2. Der Ansatz von Henry Rousso in Analyse de l´histoire. Analyse de l´historien (2002)
In Freuds Schrift »›Psychoanalyse‹ und ›Libidotheorie‹« (1923) lesen wir eine ›Definition‹ dessen was er unter Psychoanalyse verstanden wissen will : » Psychoanalyse ist der Name 1) eines Verfahrens zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind; 2)einer Behandlungsmethode neurotischer Störungen, die sich auf diese Untersuchung gründet; 3) einer Reihe von psychologischen, auf solchem Wege gewonnenen Einsichten, die allmählich zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin zusammenwachsen.« (GW XIII, 211, meine Hervorhebung). Unter der Perspektive, daß sowohl die Bestimmungen 1 und 3 auch auf Forscher zutreffen können, die nicht die therapeutische Ausübung derPsychoanalyse anstreben, scheint mir die Frage der Berechtigung einer Inanspruchnahme psychoanalytischer Verfahren und Theorien positiv zu beantworten sein. Rousso geht in seinem Artikel aus dem Jahre 200210 über diese Frage hinaus und untersucht, in welcher Weisedie Psychoanalyse für die Zeitgeschichte unverzichtbar ist. Er arbeitet darin vier Bereiche heraus.
2.1. Anwendung der Psychoanalyse in der biographischen Analyse»Die erste Möglichkeit besteht in ihrer Anwendung im biographischen oder ›metabiographischen‹ Bereich, insofern sie im Subjekt mehr erkennt als die Lebensgeschichte eines herausragenden Individuums« 8 S. Dan Diner (2007): Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des Holocaust,der sich hierin auf Rousso bezieht.9 http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/082.htm (zuletzt abgerufen 10.6.15)10 Rousso, Henry: Analyse de l´histoire. Analyse de l´historien. In : EspacesTemps 80-81/2002, S. 126-13413
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
(S. 128). Diese Möglichkeit erstreckt sich in der Praxis zwischen dem Pol eines kritikwürdigen Biographismus und dem Pol, den Helmut Dahmer in ›Psychoanalyse als Gesellschaftstheorie‹11 folgendermaßen bestimmte: »Die ›Kultur‹ wird von ihrem ›Seelenende‹ her in den Blick genommen« (S. 10). Dieser Blick ersetzt freilich nicht die Gesellschaftsanalyse, wie die Autoren einer ›Kritischen Theorie des Subjekts‹, vor allem Alfred Lorenzer und Klaus Horn gezeigt haben12.Der andere Pol, die Gefahr eines Biographismus innerhalb der Psychoanalyse ist genügend kritisch betrachtet worden. Man erinnere sich an Johannes Cremerius, Hg.: Neurose und Genialität. Psychoanalytische Biographien (S. Fischer, 1971)13. Ebenso sei verwiesen auf den Methodentransfer, den Alfred Lorenzer von der klinischen Psychoanalyse auf ihre Anwendung im Bereich kultureller, also kollektiver Erscheinungen vorgeschlagen hat14. Analoges dürfte für diesen Zweig der Anwendung in den Geschichtswissenschaften gelten. Rousso verweist dazu u. a. auf Peter Gay (Freud for Historians, 1985)15. Peter Gay – der u. a. den Biographismus der psychohistorischen Untersuchungen kritisiert hat, stellt in seinem ersten Kapitel die These auf: »The professional historian has always been a psychologist – an amateur psychologist« (S. 6). Gay diskutiert die Möglichkeiten und die Grenzen einer Rezeption der psychoanalytischenErkenntnisse, jenseits des in die Alltagssprache von Jedermann, und auch in verschiedene Fachsprachen, eingesickerten ›Jargons‹, der sich in der Regel im Gebrauch oder Missbrauch psychoanalytischer Begriffe und Theorieversatzstücken erschöpft.
In diesem Zusammenhang ist es für uns Psychoanalytiker interessant und wichtig, eine Kritik von Rousso an der heutigen Psychoanalyse zur Kenntnis zu nehmen: Das Schwinden – bis zum Verschwinden - des
11 Dahmer, Helmut: Psychoanalyse als Gesellschaftstheorie. In: PSYCHE, 29. Jg., 1975, Heft 11, S. 991-1010; ich zitiere nach der Neuveröffentlichung von Dahmer, Helmut, Hg.: Analytische Sozialpsychologie, Band I. Frankfurt a. M. (edition suhrkamp), 198012 S. dazu: Reinke, Ellen (1996): Wiederanknüpfung an die HORNsche Position einer ›Kritischen Theorie des Subjekts‹ als Erkenntnisfrage im interdisziplinären Raum zwischen Gesellschaftstheorie und Psychoanalyse. In: Bruns, Georg (Hg.): Psychoanalyse im Kontext. Opladen (Westdeutscher Verlag), S. 126–152.13 S. dazu die Kritik von Urs Widmer, FAZ vom 30.03.1971, S. 5L14 Alfred Lorenzer (1986 ): Tiefenhermeneutische Kulturanalyse. In: Lorenzeru. a.:Kultur-Analysen. S. Fischer, 1986, S. 7-112.
15 Oxford University Press; 14
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Interesses an der Psychoanalyse aus dem interdisziplinären Diskurs. Dies habe zwar auch etwas mit den bekannten ›Widerständen‹ gegen eine psychoanalytische Erkenntnis zu tun, die schon Freud beklagt hatte. Auch damit, daß die Sozial- und Gesellschaftswissenschaften sich gegenwärtig »anderen Moden und Paradigmen« (S. 127) zugewandt haben. Aber die zunehmende Nichtbeachtung der Psychoanalyse »ist zweifelsohne auch eine Konsequenz der Schwierigkeiten innerhalb der Psychoanalyse (oder bei den Psychoanalytikern), sie ist gefangen zwischen auf der einen Seite ihrer therapeutischen Ethik und auf deranderen Seite der Verführung zur wilden Psychoanalyse. Das Gewicht der Psychoanalyse scheint im öffentlichen und akademischen Raum verloren zu sein. Das darf allerdings den Historiker oder den Soziologen nicht dazu verleiten, sich eine Reflexion der psychologischen Dimensionen seiner Arbeit zu ersparen, wenn er versucht, die Absichten der Handelnden, ihre Handlungsgründe, ihre Vorstellungen und ihre Erinnerungen zu verstehen « (S. 127/128).
2.2. Der metaphorische Gebrauch psychoanalytischer KonzepteRousso bezieht sich hier auf die rhetorische Figur eines metaphorischen Gebrauchs von psychoanalytischen Konzepten16, die ursprünglich für die Analyse individueller Subjekte entwickelt wurden und deren Anwendung auf die Geschichtsschreibung, speziell der Zeitgeschichte. Hier kann er als Beispiel auf seine Schrift Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours17 verweisen. Seine metaphorische Verwendung psychoanalytischer Konzepte wird bereits im 1. Teil des Buches in der Gliederung des sich verändernden Umgangs in Frankreichmit dem Vichy-Syndrom deutlich.
Rousso sieht hier aufeinanderfolgende Verstehens- und Diskussionsschwerpunkte in der kollektiven Erinnerung von der Verdrängung / Verleugnung ab 1944 mit Hilfe der ›großen Erzählung‹, die vor allem durch die Person von de Gaulle repräsentiert wurde. Das war die Erzählung eines ›ewigen Frankreich, geeint im Widerstandgegen den Besatzer‹. Diese Periode teilt Rousso in ›unabgeschlosseneTrauer‹ von 1944-1954, und ›die Verdrängung‹ von 1954-1971 ein. 16 In diesem Zusammenhang mit Roussos Ausführungen zum metaphorischen Gebrauch psychoanalytischer Konzepte in anderen Wissenschaften ist es sinnvoll, jeweils an geeigneter Stelle auf die philosophische Perspektive Paul Ricoeurs sowohl zur Metapher wie zur Psychoanalyse Bezug zu nehmen. 17 1987/1919: Seuil; eine deutsche Übersetzung dieses Buches ist mir nicht bekannt. Dafür kann man auf Deutsch lesen: Frankreich und die dunklen Jahre. Das Regime von Vichy in Geschichte und Gegenwart; Vichy: Frankreich unter deutscher Besatzung 1940-194415
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Dieses Selbstbild zerbricht – nicht zuletzt durch mediale Großereignisse wie Spiel- und Dokumentarfilme18 – mit dem Anfang der Siebziger Jahre und den unbequemen Fragen einer neuen Generation, mit der ersten ökonomischen Krise nach den Trente Glorieuses, den etwa dreißig Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs.
Mit diesen Entwicklungen zerbricht auch der bisher blanke Spiegel, in dem sich Frankreich als ›unschuldiges Opfer fremder Mächte‹ gesehen hatte. Rousso nennt hier die Jahre von 1971-1974. In dieser Zeit beginnt auch in Frankreich die Erinnerung an das Schicksal der europäischen Juden, besonders verbunden mit den Namen und Aktivitäten von Beate und Serge Klarsfeld. Man erinnert sich vielleicht daran, daß Beate Klarsfeld 1968 dem damaligen Kanzler Kurt Georg Kiesinger öffentlich ohrfeigte, begleitet von einem dreimaligen „Nazi“-Ruf. Ein symbolträchtiges Geschehen19. In diesem Zeitraum kam es auch zu ersten Prozessen oder der Fortführung von verschleppten Prozessen von Tätern im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, einer zunehmenden Verlagerung der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in den Bereich der Justiz, wie Rousso betont. Eine ›Zeit des Unbehagens‹ nennt Rousso die Jahreanschließenden zwischen etwa 1978 und 1981, nicht zuletzt gekennzeichnet durch neue antisemitische Manifestationen in Frankreich und anderen Ländern, sowie dem Beginn des ›negationisme‹,d. h. der Ableugnung der Verbrechen gegen die europäischen Juden, beispielsweise durch Robert Faurisson. In diese Zeit fällt auch die Ausstrahlung der US-Serie ›Holocaust‹, der das europäische Publikum zu Tränen der Rührung veranlasste, diejenigen unter den Überlebendenvon Auschwitz jedoch eher befremdete. Überlebende, darunter Charlotte Delbo, machten das öffentlich wie in ihrer ›Trilogie – Auschwitz et après ‹ (1965, 1970 u. 1971). Die Psychoanalytikerin Anne-
18 Als Beispiele: Le chagrin et la pitié, einen vierstündigen Dokumentarfilm des Max Ophüls Sohns Marcel Ophuls von 1969, gedreht in Schwarzweiß. Der Film montiert Interviews mit Zeitzeugen und Wochenschauaufnahmen aus der Zeit. Deutscher Filmtitel: Das Haus nebenan – Chronik einer französischen Stadt im Kriege. Oder der Spielfilm von Louis Malle: Lacombe Lucien. Das Skript für diesen Film hatMalle unter Mitarbeit von Patrick Modiano geschrieben, dessen La place de l´étoile 1968 erschienen war. 19 Es wäre verführerisch zu untersuchen, vor welcher Szene wir dabei stehen.Noch interessanter wäre es, das / die Gerichtsverfahren zu analysieren, diezwar den Schlag als intendierten ›Nazistempel‹ inkriminierte, nicht jedoch den dreimaligen Nazi-Ruf. Das würde hier den Rahmen sprengen, aber als vorsichtige Hypothese kann doch erwogen werden, ob wir uns hier nicht mit einem Bereich säkularisierter Ritualhandlungen konfrontiert sehen.16
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Lise Stern hat das in ›begrenzt-öffentlichen‹ Gesprächen zum Ausdruck gebracht20.
Diese Ereignisse bewirkten, lt. Rousso, eine ›Widerkehr des Verdrängten‹ und riefen neue Abwehrstrategien auf den Plan, auf die ich im nächsten Punkt eingehe. Hier sollte einen Moment angehalten werden, um die Probleme eines metaphorischen Gebrauchs der Psychoanalyse anzusprechen, wofür Rousso von einigen kritisiert wurde. Das spricht er auch selbst an.
2.2.1. Exkurs zu Metapher (Ricoeur) und Symbol (Lorenzer)Ich will hier zunächst die Überlegungen zur Metapher von Paul Ricoeur in seinem Buch La métaphore vive21 (deutsch: Die lebendige Metapher) skizzieren. Ricoeur schreibt: »Die Rhetorik der Metapher setzt das Wort als Referenzeinheit. In diesem ersten Zusammenhang gehört die Metapher zu den Diskursfiguren als Einzelwort im Sinne einer ›Aussage‹ - man denkt hier an ›l´énoncé‹ von Foucault - und muß als Trope aufgrund von Ähnlichkeit definiert werden. Als figurativezeigt sich die Metapher als Verschiebung und Erweiterung des Wortsinns; ihre Erklärung greift auf eine Theorie der Ersetzung zurück« (S. 7). Was Ricoeur hier beschreibt, ist, in anderen Worten,daß der metaphorische Gebrauch sich lebendig entwickelt, die Metapher also einen dynamischen Charakter und eine Geschichte hat. Das birgt eine Möglichkeit für das Verstehen und die Gefahr, daß dermetaphorische Charakter nicht mehr erkannt wird. In letzterem Fall ist sie erstarrt zu einem feststehenden ›Zeichen‹, mit dem hantiert wird, mit dem aber nichts mehr ›begriffen‹ werden kann. Sie wird nun›wort-wörtlich‹ und damit ›tot‹. Mit der toten Metapher wird nur noch das Immergleiche reiteriert, ein lebendiges, ein neues Denken ist damit nicht mehr möglich. Im weiteren Verlauf seiner Argumentation untersucht Ricoeur die Metapher als Satz und schließlich im Rahmen einer Semantik des Gesprächs (discours). Hieran arbeitet Ricoeur zwei Arten von übergeordneten Theorien heraus:
20 Charlotte Delbo hat in ihrer ›Trilogie – Auschwitz et après (1965, 1970 u. 1971) ihre ›Erfahrungen‹ niedergelegt; sie gibt dem zweiten Band den Titel: Une connaissance inutile – eine nutzlose Erfahrung. Anne-Lise Stern, ›einmal ein deutsches Kind‹ hat ihre Erinnerungen in Le savoir-déporté. Camps, histoire, psychanalyse (2004) veröffentlicht. Sie wurde Psychoanalytikerin in Paris. 21 Seuil, 1975. Zitate nach meiner Übersetzung17
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Theorie von Spannungsverhältnissen (théorie de la tension): hier entsteht die Metapher im Zentrum des Satzes selbst als Gesamteinheit;
Theorie von Ersetzungsverhältnissen (théorie de la substitution): diese beschäftigt sich mit dem Endstadium (effet) der Sinneinschreibung auf der Ebene des isolierten Wortes.
Die Bezogenheit der Metapher lässt sich nach Ricoeur jedoch nicht innerhalb des Rahmens einer semantischen Theorie erkennen. Das leistet nur die Hermeneutik. Der Übergang zum hermeneutischen Gesichtspunkt ist ein Ebenenwechsel. Dieser führt von der Ebene des Satzes auf die Ebene der diskursiven Einheiten, Gedicht, Erzählung, Essay, etc. Auf dieser Ebene ist die Frage der Metapher nicht mehr die der Form als diskursive Figur, orientiert am Wort. Auch nicht mehr nur als Frage nach dem Sinn der Metapher bei der Einführung einer neuen semantischen Zugehörigkeit. Sondern in der Frage »nach dem Vermögen einer Umschrift (›redécrire‹) in der Referenz, (référence) d. h. der Bezüglichkeit, der Ausdrucksmetapher. Dieser Wechsel von der Semantik zur Hermeneutik findet seine grundsätzlicheRechtfertigung in dem Verhältnis, das zwischen jedem diskursiven Unternehmen zum Sinn besteht, der die innere Organisation bestimmt, und auf der anderen Seite der Bezogenheit, die seine Fähigkeit sichert, sich auf eine Wirklichkeit außerhalb der Sprache zu richten. Hier zeigt sich die Metapher als eine diskursive Strategie,die unter Bewahrung und Entwicklung der Gestaltungskraft der Spracheihre heuristische Kraft bewahren und entwickeln kann, wie sie ihren Ausdruck in der (fiktiven) Erzählung findet (ebd.).
Man denke in diesem Zusammenhang auch an die Ausführungen von AlfredLorenzer zum Symbolbegriff22. Lorenzer diskutiert in Kritik des psychoanalytischen Symbolbegriffs (1970) das Symbol in seiner Spannung zwischen einer sinnlich-bedeutungsreichen präsentativen Symbolik, wie in der Kunst, im Ritual etc., über die zunehmend denotative, also hinweisende Symbolik der Sprache, bis zu einer Einbindung des Symbols in ein bestimmtes abstraktes Zeichensystem, mit dem Verlust
22 Hier könnte man wieder an Ricoeur anschließen, der im letzten Teil von La symbolique du mal (1960; dt. Symbolik des Bösen. Phänomenologie der Schuld, München (Karl Alber, 2002) seine Zusammenfassung mit dem Titel ›Das Symbol gibt zu denken‹ überschreibt. Das muß jedoch einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben. 18
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
jeder sinnlich-bedeutungsreichen Konnotation. Lorenzer beschreibt einen immer wieder notwendigen »schöpferischen Akt der Symbolzertrümmerung, das heißt die Sprengung eines bisher gültigen geschlossenen Zeichensystems, die sich in einem umschriebenen schöpferischen Augenblick abspielt, und zwar auf der herabgesetzten Ebene der Primärorganisation« (1970, S. 85). Das zeigt er an verschiedenen historischen Beispielen ungelöster wissenschaftlicher Fragen. Das Zeichen als reine Denotation legt fest. Um diese Denkeinschränkung und Kreativitätshemmung wieder zu verflüssigen, ist eine ›Destruktion‹ des Zeichens die notwendige Voraussetzung. Lorenzer nennt dies einen immer wieder notwendigen »schöpferischen Akt der Symbolzertrümmerung, das heißt der Sprengung eines bisher gültigen geschlossenen Zeichensystems, die sich in einem umschriebenen schöpferischen Augenblick abspielt, und zwar auf der herabgesetzten Ebene der Primärorganisation« (1970, S. 85) an verschiedenen historischen Beispielen ungelöster wissenschaftlicher Probleme23.
Ende Exkurs
Die metaphorische Verwendung der Psychoanalyse, betrachtet unter der obigen Argumentation, ist erkenntnisstiftend, wenn der Forscher den Charakter der Metapher als lebendige Metapher im Sinne Ricoeurs reflektiert und sie so für sein Untersuchungsfeld fruchtbar macht. Unter dieser Perspektive verstehe ich auch Roussos weitere Argumentation, mit der er eine ab der Mitte der siebziger Jahre sichentwickelnde Abwehrbewegung als Reaktion auf das Unbehagen (malaise)in der französischen Gesellschaft beschreibt. Er diagnostiziert eineBesessenheit (obsession) in der Beschäftigung mit den Themen der Vergangenheit, was er als eine weitere Abwehrbewegung qualifiziert. Das ist nicht nur bei uns, sondern auch in Frankreich der Fall, wie Rousso am Beispiel der Medienaufregung über Mitterands ›Vergangenheit‹ als ›Rechter‹, gar ›Kollaborateur‹ 1994 darlegt. DieGefahr bei dieser medialen Vermarktung angeblich neuer ›Enthüllungen‹ aus der Vichy-Zeit liege in einem Zuviel der Erinnerung: weil »Besessenheit von der Vergangenheit immer mehr zum Ersatz für dringliches Engagement in der Gegenwart wird. Es bringt
23 S. dazu Reinke, Ellen: ›Hermeneutik des Leibes‹. Psychoanalyse zwischen Leiblichkeit und Vorstellungsarbeit. In: Psychosozial, 35. Jg. (2012), Heft II, Nr. 128, S. 21-48; wiederabgedruckt in dies..., Hg. Alfred Lorenzer – zur Aktualität seines Interdisziplinären Ansatzes. Gießen (Psychosozial-Verlag), 2013, S. 37-8419
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
der jungen Generation wenig, die Kriegsgeneration zu richten. Sie muß über sich selbst urteilen und ihre Rolle in den heutigen Tragödien hinterfragen« (zitiert bei Gsteiger, 1994).
In dieser Bewegung der Besessenheit wird nun das zu Anfang aus der Geschichtsschreibung ›Ausgeschlossene‹ zum ›Eingeschlossenen‹ in einem doppelten Sinne. Es wird beständig in Politik, Öffentlichkeit und Forschung thematisiert, gleichzeitig wird das Thema in einen geschlossenen Diskurs verbannt – es wird gebannt. Zu den Kennzeichen dieser Verbannung gehört die ›moralische‹ Verpflichtung zur Erinnerung (devoir de mémoire) bei den Tätern, aber auch bei den Opfern. »Combien de discours sur le ›devoir de mémoire‹, proférés par des chercheurs ou des militants de la ›deuxième‹ ou ›troisième‹ génération n´ont-ils pas eu pour conséquence d´obliger les victimes à rester enfermés dans cette identité sociale de victimes? « (2002, S. 133).
Hatte Charlotte Delbo noch in Une connaissance inutile beklagt, daß niemand etwas von ihren ›Erfahrungen‹ in Auschwitz hören wollte, so wird die Erinnerung und das Erzählen nun von den Opfern abgefordert.Eile scheint geboten, sie sollen das jetzt tun, wir sollen sie jetzt befragen, ›solange sie noch leben‹. So kehrt das zuvor Ausgeschlossene als Eingeschlossenes wieder, begleitet von dem Zwang, den Foucault für jede Aussage (énoncé) aufgrund der ›herrschenden Verhältnisse‹ diagnostizierte. Das ist vielleicht mit einer der Gründe dafür, daß z. B. die Psychoanalytikerin Anne-Lise Stern sich zwar spät bereiterklärte, in einem kleinen öffentlichen Kreis über ihre Erfahrungen zu sprechen, sich jedoch jegliche Fragen verbat. Ihre Zuhörer hatten ihre Erzählungen so zu nehmen, wie sie sie gab, das heiß: sie machte sie zur Gabe. Den Zuhörern kam damit die Aufgabe zu, ihre ungleichzeitigen und metaphorischen Erzählungen, oft nur Fragmente, sich verarbeitend anzueignen. Diese Qualität der Gabe besagt, wie oben für die lebendige Metapher skizziert, daß sich solche Metaphern nicht in eine begrifflich erstarrte, formalisierbare, objektivierbare, oder terminologisch zu vereindeutigende Sprache eingemeinden lassen. Die Metapher behält damit die Kraft, auf das Unsagbare zuzugehen24, ohne die Möglichkeit des Verstehens zu verlieren.24 Man könnte hier vielleicht an Wittgenstein anschließen, der uns eine Grenze sinnvollen Sprechens anzuerkennen zumutet. Auch das kann man als Gabe verstehen, als ein Daraufstoßen, daß es Bereiche gibt, in die die Sprache allein nicht hineinreicht.20
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Beim Verlust der lebendigen Metapher dagegen kommt zur Aufrichtung von Tabus, die oft das Gegenteil von dem bewirken, was sie bewirken sollten. Das Tabu ruft so die Tabubrecher wie die Verleugner und Negationisten geradezu hervor, ja, es ›beschwört‹ sie. Die zur Erinnerungsforderung, zum Zwang verwandelte ›Erinnerungskultur‹ erweist sich als Unkultur, sie ersetzt die eigene Erinnerungsarbeit und führt zur zunehmenden Delegation der Erinnerungsarbeit an die Opfer und zur Delegation der Gerechtigkeitsforderungen an die Justizorgane. Unter den Bedingungen der Besessenheit (obsession) sieht Rousso die Möglichkeit einer metaphorischen Anwendung der Psychoanalyse als »fast eine Notwendigkeit« (S. 131) an.
2.3. Die Psychoanalyse als erkenntnistheoretisches ModellDiese Anwendung der Psychoanalyse unterscheidet Rousso von den beiden Vorherigen. Sie ergibt sich aus der Feststellung einer relativen Ähnlichkeit in den Verfahren und dem Gegenstand beider Disziplinen. »Die Psychoanalyse und die Geschichte sind zwei Verstehensmodi für die Beziehung des Menschen in seiner Zeit, seinerLebenszeit und seiner geschichtlichen Zeit. Auch dann, wenn der Historiker nicht unmittelbar auf Konzepte der Psychoanalyse zurückgreift bei der Interpretation der Materie, die er untersucht, kann er eine nützliche Sensibilisierung für sein Feld aus der ›Untersuchungs‹- und ›Behandlungsmethode‹ der Psychoanalyse gewinnen, das heißt aus der Art und Weise, wie diese sich der Lebenszeit und Lebensgeschichte des Analysanden nähert« (S. 131). Erbezieht sich hier auf den Philosophen und Historiker Michel de Certeau. Certeau argumentiert, daß die Psychoanalyse und die Geschichtsschreibung bislang auf unterschiedliche Weise den Erinnerungsraum aufgefasst haben. Die Geschichtswissenschaften hätten in der Vergangenheit vorwiegend ein lineares Modell, eine Abfolge von Ereignissen, entwickelt25. Die Psychoanalyse dagegen ein Modell des Ineinandergreifens und der Übereinanderlagerung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Er bezieht sich auf Freuds Archäologie-Metapher, die die Erinnerungen übereinander sedimentiertund gleichzeitig dynamisch wirksam im Erinnerungsraum sieht.
Rousso merkt dazu an, daß gerade die Tatsache, dass Certeau die Geschichtswissenschaftler auf dieses Verständnis hingewiesen hat, zuihrer Entwicklung in die für die Psychoanalyse beschriebene Richtung
25 Dies jedenfalls seit der christlichen Zeitrechnung, s. dazu 1.521
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
anregte. Das kann man nicht besser zum Ausdruck bringen, als es Rousso selbst tut:
»Faire de l´histoire c´est étudier ce qui, dans le passé, proche ou lointain, fut tout à la fois un passé, un présent, et un futur: faire de l´histoire, notamment de l´histoire du temps présent, c´estprendre en compte ce qui du passé continue de vivre et de jouer dansles actions humaines – comme dans une analyse -, mais pour des fins différents. Ensuite, de même qu´en psychanalyse la position de l´analyste est tout sauf indifférente et ›objective‹, la position de l´historien au regard de son objet est de plus en plus réfléchie et étudie comme telle dans des nombreuses étudies historiques. L´historiographie, entendu ici comme l´étude de la pratique des historiens, n´est plus simplement (sauf pour quelques bastions rétrogrades) un exercice d´érudition gratuit et ›narcissique‹. Elle devient de plus en plus partie prenante de la démarche même de l´historien. Travailler par exemple sur le témoinage orale et sur l´histoire proche oblige le chercheur à clarifier son rôle et sa place dans la mesure où ses discours – comme souvent dans les sciences sociales – peuvent produire des effets, voir modifier l´objet observé : tous ceux qui travaillent sur la postérité d´un grand événement ont pu constater ce phénomène. […]C´est dans ce domaine particulier qu´une connaissance, même superficielle, de la théorie psychanalytique, s´est avéré indispensable : comment, même si on se refuse à les ›appliquer‹ à une matière historique, ignorer en ce domaine des concepts comme celui de ›refoulement‹, d´›occultation‹, d´›amnésie‹, d´›après-coup‹ ? Quand bien même voudrait-il le faire, et sauf à nier l´existence de l´inconscient (ce qui résout le problème). L´historienpeut-il éviter de se frotter à l´inconscient, notamment celui des acteurs qu´il étudie, parfois qu´il interroge directement, sans mêmeparler du sien ?« (S. 132)26.26 «Geschichtsforschung ist das Studium dessen, was in der nahen oder fernen Vergangenheit gleichzeitig Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges war: Geschichtsforschung, insbesondere die Zeitgeschichte muß das in Rechnung stellen, was vom Vergangenen noch lebendig ist und in den Handlungen der Menschen noch eine Rolle spielt – wie in der Analyse, aber mit unterschiedlichem Ziel. Außerdem: ebenso wie in der Psychoanalyse die Position des Psychoanalytikers alles andere als gleichgültig oder ›objektiv‹ ist, so wird die Position des Historikers in der Beziehung zu seinem Objekt in zahlreichen Studien zunehmend reflektiert und selbst Gegenstand von historischen Untersuchungen. Die Geschichtsschreibung, die ich hier als die Praxis des Historikers verstehe, ist (außer in gewissen rückständigen Kreisen) nicht mehr nur eine Übung in freischwebender und ›selbstbezogener‹ Gelehrsamkeit. Sie wird zunehmend zum integralen Teil derVorgehensweise des Historikers. Die Untersuchung mündlicher Zeugnisse und der unmittelbaren Vergangenheit verlangt vom Forscher, daß er sich über seine Rolle und seinen Ort klar wird, in dem Maße wie solche Diskurse – wie22
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Daß die Geschichtsschreibung, insbesondere die der Zeitgeschichte, hier geradezu einen Paradigmenwechsel vollzogen hat, ist das Resultat ihrer Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse als Erkenntnismethode. Geschichte und Psychoanalyse – das sind die zwei Seiten einer Medaille bei dem Bestreben, eine Geschichtsschreibung anzustreben, die den Herausforderungen des 20. Jh. an sie gerecht werden möchte.
Diese Geschichtsschreibung berücksichtigt die Erinnerung, bei den Subjekten wie bei den Kollektiven, und die Erinnerungskultur, wie sie sich in den jeweiligen Ländern seit dem Jahre 1944 verändert hat. Zu dieser Erinnerung gehört das Zeugnis derjenigen – insbesondere, aber nicht nur der Opfer – die in der Zwischenkriegs-,Kriegs- und Nachkriegszeit gelebt haben. Auch hier zeichnet sich einParadigmenwechsel ab. Wie ich oben erwähnt habe, haben wir als Psychoanalytiker selbst das Zeugnis unserer Kollegin Anne-Lise Stern, die das Vernichtungslager Auschwitz überlebt hat. So wie sie es gegeben hat – als Gabe und, wie ich meine, als Vermächtnis, ist esan uns, diese Gabe davor zu bewahren, zu einem Tabu zu werden. Oder zu einem Unberührbaren, das wir in einen Schrein einsperren, den wirgelegentlich – zu bestimmten Daten zum Beispiel – aufsuchen? Müssenwir uns nicht vielleicht Fragen stellen: - was ist das, dieses ›savoir-déporté‹ - und es in den Prozeß des Erinnerns – Wiederholens– Durcharbeiten einbinden? Das, was Anne-Lise Stern erlebt hat, ist ja eben keine ›Fatalität‹, Produkt eines unentrinnbaren Schicksals.
oft in den Sozialwissenschaften – auf den Gegenstand selbst wirken, ja das untersuchte Objekt verändern können: alle, die die Nachwirkungen eines einschneidenden Ereignisses untersuchen, haben dieses Phänomen erlebt. So meine ich, daß die Forschungen zur Geschichte der Erinnerung, wie die zuder Fortdauer der Gegenwart (oder des Gegenwärtigen) des Vergangenen schließlich dazu beigetragen haben, die Vorstellungen von der Linearität inder sozialen Repräsentanz der Zeit zu verändern, und zwar zu ihrem Vorteil.Gerade auf diesem Gebiet hat sich eine Kenntnis der psychoanalytischen Theorie – auch wenn es nicht sehr tiefgehend sein sollte – als unverzichtbar erwiesen. Selbst wenn man sich der ›Anwendung‹ solcher Kenntnisse auf dem historischen Gebiet verweigert: wie kann man denn hier solche Konzepte wie ›Verdrängung‹, wie ›Verstellung‹, wie ›Nachträglichkeit‹, ›Amnesie‹ oder ›Nachträglichkeit‹ ignorieren? Selbst wenn jemand das tun wollte, indem man zum Beispiel die Existenz des Unbewußten negiert (was das Problem lösen würde): wie kann der Historiker es vermeiden, mit dem Unbewußten in Berührung zu kommen, insbesondere bei den Subjekten, deren Handlungen er studiert, manchmal in direkter Befragung, ohne jemals sein eigenes Unbewusstes zu berücksichtigen?«23
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Das Problem eines ›richtigen Erinnerns‹ (juste mémoire) hat Paul Ricoeur als eine seiner zentralen Bürgerpflichten bezeichnet, denen er sich in seinem Leben gestellt hat. Hier sieht er sich nicht als Historiker, sondern als Mensch und öffentliche Person, die sich für eine ›Politik des richtigen Erinnerns‹ einsetzt. In verschiedenen Schriften und Interviews hat er das getan, vor allem in dem 1995 erschienenen Band Kritik und Glaube (dt. Karl Alber, 2009). Das richtige Erinnern ist eine Arbeit, die wir selbst leisten müssen, Erinnerungsarbeit in dem Sinne, wie Ricoeur den Begriff von Freud versteht und übernimmt. Es ist ein Prozeß des Umschreibens, nicht des Stillstands, und diese Erkenntnis wendet er auch auf die Geschichtsschreibung an: »Man erkennt, wie weit der psychoanalytische Begriff des Erinnerns von der Vorstellung einer einfachen Wiederholung realer Ereignisse durch eine Art Blick auf die Vergangenheit entfernt ist; vielmehr handelt es sich um eine Arbeit, die sich mittels immer komplexerer Strukturierungen vollzieht. Diese Art Erinnerungsarbeit ist gemeint, wenn vom BegriffGeschichte oder der narrativen Struktur des Lebens die Rede ist« (Psychoanalyse und Hermeneutik, S. ). Dazu gehört nach Ricoeur vor allem das, was er »défataliser l´histoire« nennt,
Dieser Paradigmenwechsel (tournant épistémologique) wird auch und vor allem in einem Werk Paul Ricoeurs deutlich, in seiner Schrift von 2000: La mémoire, l´histoire, l´oubli. Die größte Herausforderung stellt sich in diesem Zusammenhang mit der Frage nach dem Vergessen. Hierbei handelt es sich geradezu um das Gegenteil dessen, was der deutsche Reflex als ›Schlußstrichmentalität‹ inkriminiert. In einem seiner eher seltenen systematischen Bezüge auf die Philosophie Heideggers argumentiert Ricoeur mit dessen Paradox eines destruktiven und eines konstruktiven Vergessens. Dieses Paradox, oder diese »wesentliche Zweideutigkeit« (équivocité primordiale, a.a.O, S. 572) ist bei Heidegger in der Gegenüberstellung zwischen ›Vergangenheit‹ und ›Gewesenheit‹ gefasst. Das ›es ist gewesen ‹ ist eine Anerkennung dessen, was war, in der Gegenwart und durch die Gegenwart. Es ist das Gegenteil einer› Ablage‹ des Vergangenen im destruktiven Vergessen, als ›bloßer Wiederholung‹, denn es weist in die Zukunft. Es ist nicht überraschend, daß Ricoeur an dieser Stelle(a.a.O. S. 576ff.) wieder auf Freud zurückgreift, dieses Mal auf Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten und speziell auf Trauer und Melancholie. Drei Lehren sind nach Ricoeur daraus zu ziehen: Die erste Lehre derPsychoanalyse besteht darin, daß keine Erinnerungsarbeit stattfinden
24
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
kann, solange die Erinnerung eine traumatische bleibt, »unzugänglich, unverfügbar. Statt der Erinnerung tauchen Ersatzsymptome auf, Symptome, die die Wiederkehr des Verdrängten« aus dem zeitlosen Unbewußten markieren, und es ist die Aufgabe, diese durchzuarbeiten, - wie im Falle des gemeinsamen Entzifferns im analytischen Prozeß.
Die zweite Lehre aus der Psychoanalyse besteht darin, zu erkennen, daß ganze Komplexe von ›Vergessenem‹ oder ›Verlorenem‹ wiedererscheinen können. »Die Psychoanalyse ist damit für den Philosophen der zuverlässigste Partner für die These, daß nichts jemals wirklich vergessen sein kann«. Zur Verfügung des Bewußtseins,und damit eines Subjekts, das in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, kommt es jedoch nicht in der Qualität einer traumatischen Erinnerung – Wiederholung, sondern nur in der Qualitäteiner angeeigneten, durchgearbeiteten Erinnerung. Wenn es zum Teil einer Lebensgeschichte geworden ist, über die das Subjekt eine Geschichte erzählen kann, wird es Teil seiner narrativen Identität. Wie Ricoeur argumentiert, ist es die Kraft der Libido, die den Teufelskreis der Unbewusstheit, der Unverfügbarkeit, und des hilfloses Ausgeliefertseins an die traumatische Erinnerung durchbrechen kann.
Die dritte Lehre aus der Psychoanalyse, die zentrale, ist daher die Notwendigkeit des Durcharbeitens: »Das Durcharbeiten, worin die Erinnerungsarbeit besteht, ist nicht möglich ohne die Trauerarbeit, die wir in Bezug auf das verlorene geliebte wie gehasste Objekt zu leisten haben. Mittels der Trauerarbeit können wir uns von ihm lösen. Diese Aneignung des Verlorenen durch das Feuerbad des Wiedererinnerns ist für jeden metaphorischen Gebrauch der Psychoanalyse und ihrer Lehren in Feldern außerhalb ihres engeren Anwendungsbereiches von entscheidender Bedeutung« (a.a.O., 577).
Die Bedeutung dieser dritten Lehre exemplifiziert Ricoeur anschließend unter der Überschrift ›Vergessen und manipulierte Erinnerung‹ und bezieht sich nun direkt auf die Zeitgeschichtsschreibung. Er charakterisiert sie als eine notwendigerweise selektive Erzählung, die vom Erinnerten einen gewissen Gebrauch und damit auch einen Missbrauch machen kann. Dies ergibt sich aus der prinzipiellen Unabgeschlossenheit der Erzählung, sowohlwas ihren unabschließbaren Umfang angeht, als auch ihre zeitliche Struktur, das heißt ihr Unzeitgemäßwerden durch einen neuen Blick 25
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
zurück, eine neue Selektion oder neue Ereignisse. Insofern nimmt Ricoeur auch Freuds Begriff der ›Nachträglichkeit‹ in diesen Zusammenhang mit auf. Auf der kollektiven Ebene ist hiermit die Gefahr eines ideologischen Gebrauchs verbunden. »Die Strategien des Vergessens pfropfen sich unmittelbar auf diese Konstruktionsarbeit auf: man kann immer auch anders erzählen: durch das Unterdrücken, das Verschieben der Bedeutungsakzente, durch die unterschiedliche Gewichtung der Handlungen von Akteuren und das Verschieben der Handlungsgrenzen. Beim Durchlaufen aller Ebenen der Konfiguration und der Refiguration von Erzählungen, von der Ebene der narrativen Identität des Subjekts bis zur Ebene der einer gemeinsamen Identitätsbildung, die unsere Zugehörigkeit zu einer Gruppe bestimmt, besteht die größte Gefahr in der Lenkung durch eine autorisierte Geschichte, die aufgenötigt, zelebriert und von Manifestationen des Gedenkens bestimmt wird. In letzterem Falle wirdaus der Fähigkeit zur Erzählung eine Falle, wenn die Mächtigeren sich der Erzählkomposition (mise en intrigue) annehmen und eine kanonische Erzählung aufzwingen, entweder, indem sie eine Drohkulisse aufbauen oder verführen, Angst verbreiten oder schmeicheln. Das, was vergessen wurde wird hier verschleiert, insofern die sozialen Akteure ihrer Eigenmacht zum Erzählen beraubt werden. Aber selbst diese Enteignung ist nicht denkbar ohne eine heimliche Komplizenschaft der Enteigneten, die das Vergessen einerseits passiv erleiden, andererseits aktiv betreiben« (a.a.O. S.580). In Bezug auf die nachträgliche Figur eines Schweigens oder Nichterinnerns im Anschluß an den Zweiten Weltkrieg, das heute als Vorwurf an die damaligen Akteure formuliert wird, lässt sich daher sagen, daß sie allzu bereitwillig die offizielle Erzählung angenommen haben. Allerdings weist dieser Vorwurf, insoweit er berechtigt ist, immer auch auf die Vorwerfenden zurück: wie steht esmit ihrem sapere aude! d. h. mit der Zumutung an sich selbst, sich als gegenwärtige Akteure der gleichen Zumutung zu stellen? Ricoeur erinnert hier an Freuds Psychopathologie des Alltagslebens (1904), die den Untertitel trug: Vergessen, Versprechen, Aberglaube und Irrtum.
Hier schließt sich auch der Kreis zu Henry Rousso, speziell dessen Werk Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours. Ricoeur nennt u. a. dieses WerkRoussos, das die Abfolge der Geschichtsbilder in Frankreich untersucht, ein mutiges Risiko. Roussos Arbeit über das Syndrom von Vichy könne selbst als ein Beispiel nicht nur von zeitgeschichtlicher Analyse gelten, sondern auch als ein Akt von
26
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
staatsbürgerschaftlicher Risikobereitschaft – eben ein Akt von sapere aude! - gelten.
Rousso greift nicht nur mit dem Begriff Syndrom im Titel, sondern auch bei seiner Gliederung auf psychoanalytische Erkenntnisse zurück. In seiner Einleitung, ›La névrose‹ schreibt er in Bezug aufseinen eigenen Lernprozeß: »Débutant à la fin des années 1970 une recherche sur l´histoire du régime de Vichy, et bien que sachant à l´évidence le sujet encore brûlant, je pensais la distance suffisantepour jouer du scalpel en toute innocence. Mais le cadavre était encore chaud : l´heure n´était pas au médecin légiste mais bien plutôt au médecin tout court, voire au psychanalyste« (a.a.O. S. 9)27. Sein Gegenstand ist die Geschichtsschreibung über Vichy mit Beginn der ersten Reden von Präsident de Gaulle am 25. August 1944 und ihren spezifischen Umformulierungen bis zum Mauerfall auf der Basis dessen, was jeweils in dieser Geschichtsschreibung eingeschlossen bzw. ausgeschlossen war. Neben der politischen ›Erzählung‹ und der wissenschaftlichen Forschung berücksichtigt Rousso auch literarische Texte, und, zeitgemäß, besonders den Film, vom Propagandafilm über den Dokumentarfilm bis zum Spielfilm. Roussos Ansatz ist damit ein fortdauernder Lernprozess in der Auseinandersetzung, ein totaler Gegensatz zum Schlagabtausch in Deutschland.
Ricoeur hält fest, daß die Differenz wie die Vergleichsmöglichkeiten der Geschichtsschreibung zu beiden Seiten des Rheins selbst ein lohnendes Thema für die zeitgeschichtliche Analyse wären (a.a.O. S. 581 Fn.), von dem beide Seiten profitieren könnten. In der deutschen historischen Forschung ist dieser Ansatz Ricoeurs, das neue Paradigma, ebenfalls aufgegriffen worden, wie zumBeispiel die Beiträge in dem von Burkhard Liebsch herausgegebenen Buch Bezeugte Vergangenheit oder versöhnendes Vergessen (Akademie-Verlag, 2010) belegen.
27 Etwa: Ich begann gegen Ende der 70er Jahre mit einer Untersuchung über die Geschichte des Vichy-Regimes, und obgleich es offensichtlich war, daß das Thema noch von brennender Aktualität war, hielt ich den zeitlichen Abstand zum Geschehen für ausreichend, um mit aller Unschuld das chirurgische Messer anzusetzen. Die Leiche war jedoch noch warm: die Zuständigkeit des Gerichtsmediziners war noch nicht gekommen, wir befanden uns noch in der Zuständigkeit des Allgemeinmediziners, genauer gesagt, des Psychoanalytikers.27
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
2.4. Der Gebrauch der Psychoanalyse in Fragen der EthikBei diesem vierten möglichen Beitrag der Psychoanalyse zur Zeitgeschichte geht es Rousso nicht mehr nur um die Begründung der Stichhaltigkeit für eine Anwendung der psychoanalytischen Erkenntnisse auf die Geschichtswissenschaften. Noch geht es nur um die Inspiration, die sie für eine Dekonstruktion des Zeitverständnisses bereitstellen kann. Die Frage, die es hier zu stellen gilt, betrifftsie unmittelbar und ist viel grundsätzlicher: Wie definiert der Historiker – oder jeder andere Forscher in den Sozialwissenschaften – seine Beziehung zum Anderen?
Rousso bezieht sich hier – wie auch bei den Fragen eines neuen Verständnisses der Geschichtswissenschaften – wieder auf Paul Ricoeur. Ricoeur hatte in der französischen Diskussion durch zwei Schriften den Anstoß zu neuer Reflexion auch in den Geschichtswissenschaften gegeben, wie das ja schon im letzten Kapitel dargelegt wurde. 1990 erschien sein Buch Soi-même comme un autre, und zehn Jahre später, La mémoire, l´histoire, l´oubli (2000). In Das Selbst als ein Anderer hat Ricoeur seine aus der Philosophie Nietzsches undFreuds heraus grundsätzliche Kritik am Descartes´schen ego cogito als Garant unmittelbarer Erkenntnis noch einmal expliziert und eine tiefere Neuformulierung gefordert, die der Tatsache des Unbewußten im psychoanalytischen Sinne gerecht wird. Im Rahmen der Hermeneutik führte ihn das zur Formulierung einer ›Hermeneutik des Verdachts‹. Als Vertreter dieser nennt er neben Nietzsche und Freud Karl Marx. Freilich bleibt er dabei nicht stehen, sondern postuliert den Weg über die Hermeneutik des Verdachts als notwendige Voraussetzung für eine Hermeneutik des Sinns. In Das Selbst als ein Anderer legt er nun den Schwerpunkt auf die Untersuchung der Frage, wie sich dieses Selbst in Bezug auf seine mitmenschliche und kulturelle Umwelt konstituiert. Seine These lautet: Das Selbst ist von Anfang an mit dem Anderen vermittelt. Dies arbeitet er für die Kategorie des Wunsches in der Psychoanalyse heraus:
» Die Beziehung auf den anderen ist nicht etwas, was zum Wunsch ersthinzukommt. Aus dieser Sicht hat Freuds Entdeckung des Ödipuskomplexes im Laufe seiner Selbstanalyse in Bezug auf alle weiteren Entdeckungen paradigmatische Bedeutung: der Wunsch wird hier unmittelbar in seiner triangulären Struktur erfasst, in der es um zwei Geschlechter und drei Personen geht. Hieraus folgt auch, daßdas, was in der Theorie als symbolische Kastration benannt wird, nicht ein Hinzugefügtes oder Äußerliches ist, sondern Ausdruck der
28
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
ursprünglichen Beziehung des Wunsches auf eine Idealen verpflichteteVerbotsinstanz, was das Kind im Phantasieren als väterliche Bedrohung seiner libidinösen Wünsche erlebt. Aus diesem Grund wird von Anfang an alles ausgeschlossen, was den Wunsch solipsistisch erscheinen lässt, wie zum Bespiel bei einer Definition des Wunsches in Begriffen einer nur vom Einzelnen ausgehenden [psychischen] Energie, von Spannungsverhältnissen, von Abfuhr. Die Vermittlung mit dem Anderen ist für den Wunsch konstitutiv, er ist Wunsch in Beziehung zu… Der Andere kann antworten oder sich verweigern, befriedigen oder drohen. Mehr noch: er kann wirklich oder nur phantasiert sein, anwesend oder verloren, eine Quelle von Angst oder auch Objekt eines erfolgreich abgeschlossenen Trauerprozesses. Mit dem Konzept der Übertragung bringt die Psychoanalyse alle diese Möglichkeiten ins Spiel, indem das Drama, das den neurotischen Konflikt ausgelöst hat, in einer neuen, miniaturhaften Szene dargestellt wird. Aus der psychoanalytischen Erfahrung selbst erwächst also die Notwendigkeit,die libidinösen Wünsche in der zwischenmenschlichen Beziehung selbstzu erkennen, weniger als einen Bedarf, sondern als ein an den anderengerichtetes Bedürfnis« (aus: Psychoanalyse und Hermeneutik, meine Hervorhebung)28.
Für Rousso gilt diese Analyse der grundsätzlichen Bezogenheit zwischen dem Selbst und dem Anderen für die Geschichtswissenschaftennicht nur dann, wenn er als Zeitgeschichtler unmittelbar mit einem Zeitzeugen konfrontiert ist, also einem lebendigen Gegenüber. Sie gilt auch dann, wenn er ›nur‹ hinterlassene Zeugnisse studiert. »Wirstehen hier vor einer ganz anderen Situation als der eines distanzierten Beobachters, der ›kühl‹ an die Untersuchung herangehenkann. Wir haben hier eine Situation, in der der Affekt, die Emotionen, die Identifizierungen eine Rolle spielen (selbst dann, wenn sie nur von seiner Seite ausgehen). Wenn es sich um ein direktes, lebendiges Gegenüber im Gespräch handelt, wird die Frage nach der Übertragung unabweisbar« (S. 133, meine Hervorhebung). Für den Historiker, ganz besonders für den Zeithistoriker ergeben sich hier zwei Möglichkeiten der ethischen Haltung als Forscher: er kann eine vorgeblich objektive Haltung einnehmen und die Bezogenheit zwischen dem Selbst und dem Anderen negieren, wie im positivistischen Wissenschaftsverständnis - oder ausgehend vom Axiom der Neutralität des Forschers wie bei Max Weber ein 28 Alfred Lorenzer hat diesen Prozeß der Bedürfnisbildung in seiner Schrift Zur Begründung einer materialistischen Sozialisationstheorie (1972) als psychoanalytische Grundfigur herausgearbeitet: Sie entsteht im Wechselverhältnis zwischen Mutter und Kind bereits im intrauterinen Stadium.29
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
unmittelbares Einfühlen in die seelische Verfassung eines Anderen anstreben. Es versteht sich von selbst, daß Rousso mindestens für die Weber´sche Haltung eintritt.
Die Welt mit den Augen eines Anderen zu sehen: das scheint Rousso jedoch für den Historiker nicht ausreichend. Er verweist auf die Psychoanalyse als diejenige Theorie, die die Grundlagen für ein Verstehen der zwischenmenschlichen Bezogenheit, für das Verhältnis zwischen dem Selbst und dem Anderen, herausgearbeitet hat. Dies schließt notwendigerweise die Bereitschaft zur Reflexion der Verhältnisse mit ein, die in der Psychoanalyse als Übertragung – undwie ich meine, auch der Gegenübertragung) bezeichnet werden29. Roussomeint nun damit keinesfalls, daß aus jedem Historiker ein Psychoanalytiker werden muß30, aber: »daß er sich die Wirkung der Übertragung vergegenwärtigen muß, darf nicht vernachlässigt werden. Ich kann mich hier auf die lebhaften Diskussionen mit dem Soziologenund Historiker Michael Pollak über seine Forschungsarbeit mit Auschwitz-Überlebenden beziehen, und auf die Art, wie er mit der ihmeigenen Sensibilität die zum Teil langdauernden Beziehungen zu diesen Frauen gestaltete « (ebd.)31.
In einem weiteren Bereich zeigt sich nach Rousso ebenfalls ein gravierender Mangel an Bereitschaft zur Reflexion des Verhältnisses Forscher - ›Forschungsgegenstand‹. So beunruhigt es ihn nachhaltig, daß immer mehr Soziologen und Historiker, darunter nicht die Geringsten, behaupten, man müsse sich bei der Arbeit über extreme Gewalt als Forscher ohne jedes Zögern »auf die Seite der Opfer stellen« (ebd.). Aus meiner Sicht würde ich hinzufügen, dass eine solche unreflektierte Art der Identifizierung mit den Opfern auch bei ausgebildeten Therapeuten zu finden ist. Aus psychoanalytischer
29 Es sei am Rande angemerkt, daß in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts aufgrund bestimmter konkretistischer Mißinterpretationen Freud´scher Metaphern wie der Spiegel- und der Chirurgenmetapher auch die Psychoanalytiker an diese Tatsachen erinnert werden mußte. Dieser Aufgabe widmete sich Heinz Kohut, der den Begriff der Empathie in die Psychoanalyse, insb. die US-amerikanische, ›wiedereinführte‹.30 Peter Gay ist diesen Weg gegangen, s. Freud for Historians, a.a.O. S. XIV.31 S. u. Michael Pollak (1991): L´Expérience concentrationnaire : Essai sur le maintien de l´identité sociale, Éditions Métailière, Wiederauflage Seuil, Ponts Essais, 2014 ;ders. : Die Grenzen des Sagbaren. Ffm : Campus, 1988. S. auch aus der Erfahrung eines Psychoanalytikers: William G. Niederland (1980): Folgen der Verfolgung: Das Überlebenden-Syndrom. Seelenmord. Niederland schildert darin u. a. die Verstrickungen von Übertragung und Gegenübertragung bei seinen Patienten aufgrund seines deutschen Akzents.30
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Sicht kann ich das nur als Weigerung verstehen, sich die eigenen Reaktionen in einem inneren Arbeitsprozess, der notwendigerweise miteiner Distanzierung vom unmittelbaren und per definitionem unbewußten Übertragungs-Gegenübertragungserleben verbunden ist, bewußt zu machen. Bewußt machen, das heißt Durcharbeiten, und Durcharbeiten heißt, wie wir oben mit Ricoeur gesehen haben, Trauerarbeit. Was Rousso hier anspricht, ist die Problematik für denForscher selbst bei der Konfrontation mit extremer Traumatisierung bei seinem Gegenüber, und die damit notwendigerweise einhergehenden Probleme von Nähe und Distanz. Was dabei herauskommt, wenn man das ignoriert, nennt Rousso einen ›Mitgefühls-Diskurs‹, »durchdrungen von einem sozialen Evangelismus, [der] nicht nur schwerwiegende Probleme auf der wissenschaftlichen Ebene schafft«, sondern die potentielle Gefahr birgt, das Gegenteil von dem zu bewirken, was aufder bewußten Ebene beabsichtigt wird.
Hier, so betont Rousso noch einmal ausdrücklich, wird eine Kenntnis der Psychoanalyse unverzichtbar, denn der Komplex impliziert ethische Fragen. Der Historiker [und der Psychoanalytiker, ER], der aus der Position seiner unreflektierten Betroffenheit heraus ›Geschichte schreibt‹, [oder ›deutet‹, ER] verstößt gerade gegen die ethischen Forderungen, für die er sich auf der verbalen und schriftlichen Ebene stark macht. Die Psychoanalyse, sofern sie als kritische Theorie verstanden wird, könnte ein wirksames »Gegengift [sein] gegen die exzessive Moralisierung und die Verlagerung der Arbeit an der Vergangenheit auf die juristische Ebene, die wir heutein unseren Gesellschaften beobachten, durchdrungen von der Illusion,dass die Gegenwart die Vergangenheit von all ihren Fehlern und Verbrechen reinwaschen könnte« (ebd.).
Diese Säuberungs-Besessenheit hat Rousso bereits am Beispiel der épuration im gerade befreiten Frankreich analysiert. Sie setzt voraus,daß ich mich selbst als ›Saubermann‹ sehe und berechtigt, den Anderen als Träger des Schmutzigen und des Bösen. Damals wurden in Frankreich unter anderem Frauen kahlgeschoren und vom Mob durch die Straßen gehetzt, geschlagen, bespuckt und sozial isoliert. Es wurde ihnen in der Zeit unmittelbar nach dem August 1944 sozusagen außergerichtlich der Prozess gemacht. In Bezug auf diese Vergangenheit können wir diese Ereignisse bereits einigermaßen verstehen, u. a. im Sinne dessen, was René Girard in seiner anthropologischen Untersuchung zur gesellschaftlichen Funktion des
31
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Sündenbocks herausgearbeitet und als soziale Riten der Ausgrenzung bis zur Vernichtung einer Gruppe von vermeintlichen oder wirklich Schuldigen bezeichnet hat32. Die Motive für einen solchen sozialen Prozess sind den Akteuren grundsätzlich unbewusst, sie handeln ›par méconnaissance‹, d. h., indem sie sich über ihre Motive selbst täuschen oder durch Interessen außerhalb ihrer selbst getäuscht werden. Das heißt auch, daß die Bereitschaft zur Säuberung in den Dienst politischer oder ideologischer Interessen genommen werden kann. Dieser Ausbruch von kollektiver Gewalt ist in der Regel zeitlich begrenzt, wie im Falle der ›épuration33‹ in Frankreich ganz unmittelbar nach der Befreiung durch die Alliierten. Es stellt sich die Frage, ob unter den Bedingungen der Besessenheit, die Rousso fürden gegenwärtigen Stand unserer sogenannten Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur, insbesondere der deutschen, diagnostiziert, mit einer baldigen Überwindung dieser Erstarrung zu rechnen ist.
Daß die Psychoanalyse hierzu einen unverzichtbaren Beitrag leisten kann, steht außer Frage, wie ich hoffe, in der Darlegung der Argumentation von Rousso aus zeitgeschichtlicher und Ricoeur aus philosophischer Perspektive gezeigt haben. Es steht auch für mich außer Frage. Die Frage ist für mich eher: ist die Psychoanalyse, diesich weitgehend auf ihr therapeutisches Terrain zurückgezogen hat, dazu bereit und in der Lage? Die Rückeroberung ihrer gesellschaftskritischen Potenz sollte sich nicht nur Zeithistorikernund Philosophen überlassen. An Aufforderungen dazu und an Warnungen vor dem Verlust des ›Stachels Freud‹ fehlt es in der Literatur nicht. Das ist gleichzeitig eine Frage an die Bereitschaft von jedemeinzelnen Psychoanalytiker zur Selbstreflexion darüber, was vom kritischen Potential der Psychoanalyse auch für die Praxis verloren geht, also für seine Arbeit mit dem Patienten, wenn er sich die Bewusstmachung der eigenen Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse unter dem Druck des Alltags oder 32 René Girard (1982): Le bouc émissaire, deutsch Der Sündenbock (1988); s. a. bereits James Frazer (1890/1900): The golden bough, deutsch: Der goldene Zweig, aktuelle Auflage rororo, 2004. 33 Épuration im Französischen bedeutet nicht nur Reinigung, sondern auch dieEntfernung der unreinen Objekte aus der Gesellschaft durch geeignete Methoden der Erniedrigung, des Rufmordes und der sozialen Isolierung, bis zur Vernichtung. Die außerlegale épuration in Frankreich produzierte etwa 10.000 Tote, darunter viele Frauen, deren ›Kollaboration‹ darin bestanden hatte, daß sie mit dem ›Besatzer‹ intime Beziehungen eingegangen waren, oder zumindest solcher verdächtigt werden konnten.32
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
ideologischen Kurzschlüssen erspart. Psychoanalyse, hat Freud nach meiner Erinnerung in einem Brief an Alexander Lurija geschrieben, ist ›Arbeit mit Widerstand und Übertragung‹. Nicht nur derjenigen bei den ›Anderen‹, sondern auch bei jedem einzelnen Forscher selbst.
33
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
LiteraturDelbo, Charlotte (1970) ›Trilogie – Auschwitz et après (1965, 1970: Une connaissance inutile, u. 1971)
Freud, Sigmund (1890): Psychische Behandlung – Seelenbehandlung. GW V, S. 287-315Freud, Sigmund (1893): Über den psychischen Mechanismus hysterischerPhänomene. GW Nachtragsband, 183–195Freud, Sigmund (1910): Über ›wilde‹ Psychoanalyse. GW V, S. 118-125Freud, Sigmund (1914): Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. WeitereRatschläge zur Technik der Psychoanalyse II. GW X, S. 126-136Freud, Sigmund (1916/1917 [1915]): Trauer und Melancholie. GW X, S. 428 - 446Freud, Sigmund (1919): Psychoanalyse der Kriegsneurosen. Mit Beiträgen von Ferenczi, Abraham, Simmel und Jones. Leipzig / Wien (Int. Psychoanal. Verlag); Reprint Outlook Verlagsgesellschaft mbH, 2012Freud, Sigmund (1921): Massenpsychologie und Ich-Analyse. GW XIII, S. 71-161Freud, Sigmund (1923b): Das Ich und das Es. GW XIII, S. 235-290Freud, Sigmund (1923a): »›Psychoanalyse‹ und ›Libidotheorie‹«. GW XIII, S. 211-233Freud, Sigmund (1926): Die Frage der Laienanalyse. GW XIV, S. 207-296Freud, Sigmund (1927): Die Zukunft einer Illusion. GW XIV, S. 325-380
Gay, Peter (1978): Freud, Jews and other Germans. Masters and Victims in Modernist Culture. Oxford University Press; Dt.: Freud, Juden und andere Deutsche. Herren und Opfer in der modernen Kultur. Hamburg (Hofmann & Campe), 1986; TB-Ausgabe dtv, 1989Gay, Peter (1985): Freud for Historians. Oxford University Press; Dt. Freud für Historiker. Tübingen (edition diskord), 1994Gay, Peter (1988): Freud. A Live for our Time. New York / London (W.W. Norton); dt.: Freud. Eine Biographie für unsere Zeit. Frankfurt a. M. (S. Fischer), 1989Gay, Peter (1998): My German Question. Growing up in Nazi Berlin. Yale University Press; Dt. Meine Deutsche Frage. Jugend in Berlin 1933-1939. München(Beck), 1999
Gsteiger, Fredy: Besessen von der Vergangenheit. In: Die Zeit, Jg. 1994, Aug. 40; http://www.zeit.de/1994/40/besessen-von-der-vergangenheit/komplettansicht (zuletzt abgerufen 20.6.15)
Mitscherlich, Alexander (1966): Krankheit als Konflikt. Studien zur Psychosomatischen Medizin 1. Frankfurt a.M. (Suhrkamp)
34
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Mitscherlich, Alexander (1967): Krankheit als Konflikt. Studien zur Psychosomatischen Medizin 2. Frankfurt a. M. (Suhrkamp)Mitscherlich, Alexander (1977 [1946]): Freiheit und Unfreiheit in der Krankheit. Studien zur psychosomatischen Medizin 3. Frankfurt a. M. (Suhrkamp)
Reinke, Ellen (2001): Freud als Kognitionsforscher. In: Wahrnehmen und Erkennen. Hg. H. Reuter u. a. Lengerich (Papst), 2001, S. 188-200; Reinke, Ellen (2002): Phantom und Wirklichkeit von Bewusstsein und Unbewusstem. In: Theo Hug & Hans Jörg Walter, Hg.: Phantom Wirklichkeit. Pädagogik der Gegenwart. Hohengehren (Schneider Verlag), 2002, S. 269-281Reinke, Ellen, Hg. (2012): Von Freud zu Lorenzer. Psychoanalyse im Spannungsfeld zwischen Sozial- und Neurowissenschaften. psychosozial, 35. Jg. (2012), Heft II (Nr. 128)Reinke, Ellen (2012a) Hermeneutik des Leibes. Psychoanalyse zwischenLeiblichkeit und Vorstellungsarbeit. In: Reinke, Ellen, Hg. (2012), S. 21 – 48; wiederabgedruckt (2013a) in: Reinke, Ellen (2013): Alfred Lorenzer. Zur Aktualität seines interdisziplinären Ansatzes. Gießen (Psychosozial-Verlag), S. 37-84
Ricoeur, Paul (1960): La symbolique du mal. Paris (Aubier Montainge) ; lieferbare Ausg. mit einem Vorwort von Jean Greisch: Paris (Seuil), 2009; dt.: Symbolik des Bösen. Phänomenologie der Schuld II. 2. Aufl. 2009Ricoeur, Paul (1965) : Die Interpretation. Ein Versuch über Freud. Frankfurt amMain (Suhrkamp), 1969Ricoeur, Paul (1975): La métaphore vive. Paris (Seuil) ; dt. : Die lebendige Metapher. München (Wilhelm Fink), 2004Ricoeur, Paul (1990): Soi-même comme un autre. Paris (Seuil) ; dt. : DasSelbst als ein Anderer. München (Wilhelm Fink), 2005Ricoeur, Paul (2000): La mémoire, l´histoire, l´oubli. Paris (Éditions du Seuil) ; dt. : Gedächtnis, Geschichte, Vergessen. München (Wilhelm Fink), 2004Ricoeur, Paul (2008): Über Psychoanalyse. Schriften und Vorträge. Gießen (Psychosozial-Verlag), 2015
Rousso, Henry (1980): Un château en Allemagne : La France de Pétain en exile, Sigmaringen 1944-1945. Paris (Ramsay) ; lieferbare Aug. mit einem neuenVorwort Un château en Allemagne. Sigmaringen 1944-1945. Paris (Pluriel), 2012Rousso, Henry (1987): Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours. Paris (Seuil), 1990Rousso, Henry (1992) : Les années noires : vivre sous l´Occupation. Paris (Gallimard) ; dt. : Frankreich und die ›dunklen Jahre‹. Das Regime von Vichy in Geschichte und Gegenwart. Göttingen (Wallstein), 2010
35
Psychoanalyse und Zeitgeschichte
Rousso, Henry (2002): Analyse de l´histoire. Analyse de l´historien.In: Espaces Temps, 80-81, 2002, Michel de Certeau. Histoire/psychanalyse. Mises à l´épreuve. S. 128-134Rousso, Henry (2012) : La dernière catastrophe. L´histoire, le présent, le contemporain. Paris (Gallimard)
Stern, Anne-Lise (2004): Le savoir-déporté. Camps, histoire, psychanalyse. (2004)
Wallerstein, Robert S. (1998): Lay Analysis : Life inside the Controversy. Rothledge, 2012
36








































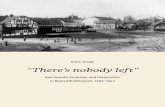





![[Ed]. Où en est l’histoire du temps présent ? Notions, problèmes et territoires, Dijon, Université de Bourgogne, 1998.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633562d302a8c1a4ec01bf3f/ed-ou-en-est-lhistoire-du-temps-present-notions-problemes-et-territoires.jpg)
![Paul Ricoeur, Η ψυχανάλυση αντιμέτωπη με την επιστημολογία [La psychanalyse confrontée à l'épistémologie]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632f1420e68c6e65e90a94a0/paul-ricoeur-i-psunlusi-ntimetopi-me-tin-epistimologi.jpg)