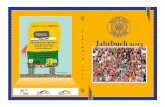Narrative Etablierung einer Kriegswissenschaft. Die deutsche Bakteriologie am Vorabend des Ersten...
Transcript of Narrative Etablierung einer Kriegswissenschaft. Die deutsche Bakteriologie am Vorabend des Ersten...
7
Narrative Etablierung einer Kriegswissenschaft. Die deut-sche Bakteriologie am Vorabend des Ersten Weltkriegs*
Silvia Berger, Zürich
Die Bakteriologie ist ein locus classicus nicht nur der Medizingeschichte, sonderndes Selbstverständnisses der Medizin als Wissenschaft überhaupt. Ihr Aufstieg zumherrschenden Paradigma, das Ende des 19. Jahrhunderts das Verständnis vonK¡ankheitsursachen und ihrer Bekämpfung gegenüber den hygienischen, und das
heißt vor allem auf Umweltfaktoren bezogenen Ätiologien revolutionierte, ist guterforscht. Während zunächst vor allem die beiden ,,Heroen" Louis Pasteur und Ro-bert Koch im Zentrum der Aufmerksamkeit standen, haben sich die Interessen mitt-lerweile multipliziert. Diskutiert werden heute Fragen der Institutionalisierung derneuen Wissenschaft, die durch sie ausgelöste laboratory revolution, Aspekte derEpistemologie und visualisierung, ihre öffentliche wahrnehmung, ihre Durchset-zung in Medizin und Gesundheitspflege sowie die politische Umsetzung undDienstbarmachung des bakteriologischen Wissens.l
Ein Themenfeld allerdings fand - zumal im deutschsprachigen Raum - bislangwenig Aufmerksamkeit: Es ist der Konnex von Bakteriologie und Krieg. Wie indiesem Beitrag argumentiert wird, ist genau dieser Konnex für das Ansehen und dieWirkmächtigkeit der medizinischen Bakteriologie an der Wende zum 20. Jahrhun-dert von zentraler Bedeutung. Mit einem Fokus auf Deutschland vertrete ich dieThese, dass es Robert Koch und seinen Schülern gelang, die Geltung ihrer Diszip-lin, die seit den spektakulären,,Erregerjagden" der l880er Jahre kaum mehr Erfol-ge vorweisen konnte, durch die Rekonfiguration der Bakteriologie als potenteKriegswissenschaft zu Beginn des neuen Jahrhunderts massiv zu bestärken. So sehrzu bestärken, dass sie bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs auf dem eigentlichenHöhepunkt ihrer Autorität stand und mit bislang unerreichten finanziellen Mitteln,Personal und Materialien ausgestattet wurde. Zeniral für diese Entwicklung war derEinsatz diskursiver Strategien und Narrative. Ein Nanativ sollte sich dabei als be-sonders effektiv erweisen: Die zwangsläufige Verbindung von Kriegen und Seu-chen in historischer Perspektive. Immer, wenn die ,,Kriegsfackel" lodere' so dasErzählmuster Kochs, würden die Kriegsseuchen ihr,,Haupt" erheben und aus ihren,,Schlupñvinkeln" hervor kriechen. Kriege und damit das Geschick gaîzer Völker
Der vorliegende Aufsatz steht in Zusammenhang mit meiner Dissertation ,,Bakterien inKrieg und Frieden. Eine Geschichte der medizinischen Bakteriologie in Deutschland, 1890-1933", die 2009 bei Wallstein/Göttingen erschienen ist.Zum Forschungsstand vgl. Berger 2009 (Anm. *), S' 12f.; Gradmann, Christoph, Krankheitim Labor. Robert Koch und die medizinische Bakteriologie, Göttingen 2005, S. 8, 9.
360 Silvia Berger
seien in vergangenen Zeiten durch Seuchen entschieden worden.2 Einen Auswegaus dem Dilemma versprach nur eine Wissenschaft: Die Bakteriologie mit ihrenmodernen, rationellen Maßnahmen zur Bekämpfirng von Seuchen.
Kriege und Seuchen - das vermeintlich nvingende Paar
Weshalb sollten retrospektive Erzählungen über die Dyade ,,Krieg und Seuchen"problematisch sein? Gehören kriegerische Auseinandersetzungen und Pestilenznicht seit alters her zusammen? Folgt man dem Medizinhistoriker Roger Cooter,darf die scheinbar fatale Verknäpfung von Kriegen mit Epidemien keineswegs alsselbsterklåirend, inhärent logisch oder schlicht naturgegeben aufgefasst werden.Wie verschiedene historische Studien zeigen korurten, stehen viele, vielleicht sogardie meisten Epidemien gar nicht in einem direkten Zusammenhang mit Kriegen'Richard Evans etwa hat für die Choleraepidemien des 19. Jahrhunderts die Bedeu-tung von sozialen oder politischen Umbrüchen bei der Verbreitung von Krankhei-ten relativiert; Revolutionen und Truppenbewegungen verlängerten die Epidemienbestenfalls. Emmanuel Le Roy Ladurie wiederum konnte bei der Pest belegen, dassfür deren Ausbreitung Armut, Schmutz und Promiskuität wichtiger waren als Krie-ge. Der kausale Zusammenhang zwischen Seuchen und Kriegen wird des Weiterenauch durch Studien zur Relation von Ernährung und Krankheit zunehmend in Fragegestellt. Wie Cooter aufzeigt, ist der lange Zeit fast kanonische Glaube historischerDemographen, Unterernährung aufgrund kriegsbedingter Hungersnöte ziehe eineepidemische Mortalitätskrise nach sich oder würde sie beschleunigen, nach neuerendemographischen Untersuchungen so unsicher geworden wie der Imperativ selbst,der eine zwangsläufige Verbindung von Kriegen mit Mangelernährung posfuliert.3Aus der Perspektive des Historikers ist die Rede von Epidemien in Relation zuKriegen schließlich auch deshalb heikel, weil sie eine Abgrenzbarkeit zweier singu-låirer Phänomene suggeriert. Kriege und Seuchen lassen sich gar nicht als diskreteEreignisse erfassen; sie sind immer verwoben in größere demographisch-pathogeneund sozio-politische Systeme.a
Aus diesen Gränden fordert Cooter, das vermeintlich selbstredende Paar zuhistorisieren, sich also zu fragen, wann eine dominante, generalisierbare Verbin-dung von Kriegen und Seuchen erstmals konzipiert wurde und wozu sie diente.Ohne die Faktizität von K¡ankheiten in Kriegszeiten in Abrede stellen zu wollen,argumentiert er, dass die Idee, Kriege und Seuchen retrospektiv miteinander zukoppeln, als ein Wissensprodukt und eine Ressource problematisiert werden sollte
Koch, Robert, Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten insbesonde¡e der Kriegsseuchen,in: Schwalbe, Julius (Hrsg.), Gesammelte Werke von Robert Koch,2. Bd. l. Teil 1912, S.
277.Cooter, Roger, Of War and Epidemics. Unnatural Couplings, Problematic Conceptions, in:Soc. Hist. Med. l6:2 (2003), S. 286.Ebd. s.288.
2
3
4
Narrative Etablierung einer Kriegswissenschaft 361
- eine Ressource, die in einem spezifischen historischen Kontext aufgrund spezifi-scher Interessen eingesetzt wurde.'
Geht man im Anschluss an Cooter der Frage nach, wann genau Erzählungenüber Kriege und Epidemien in der Weltgeschichte im Feld der deutschen Bakterio-logie im großen Stil entfaltet wurden, wird deutlich, dass dies zu ganz bestimmtenZeiçunkten geschah: Bei der Lancierung einer großen Kampagne zur Bekämpfungdes Typhus abdominalis unmittelbar nach der Jahrhundertwende sowie zu Beginndes Ersten Weltkriegs. Im Folgenden werde ich diese beiden Ereignis- und Erfah-rungsräume genauer in den Blick nehmen.
Eine Kriegs\ryissenschaft begründen: Der Typhus als Kriegsseuche
In den l870er und l880er Jahren erregten Robert Koch und seine Schüler mit ihrenlaborbasierten Arbeiten über die kleinsten, unsichtbaren Lebewesen und deren un-heilvolle Rolle im Krankheitsgeschehen in der Öffentlichkeit großes Aufsehen.Auch von Seiten des Staates bedachte man die junge Wissenschaft von den Bakte-rien mit Beifall und Fördermaßnahmen, schließlich versprach sie neue und effizien-te Handhaben gegen die akuten epidemischen und endemischen Infektionskrank-heiten, die die gesundheitspolitische Agenda beherrschten. Seit den l890er Jahrenfreilich befand sich die Bakteriologie in einer Phase der Ernüchterung. Ihr mono-kausales, auf die Erreger fokussiertes Krankheitsmodell war scharf angegriffenworden und musste revidiert werden; die ursprüngliche Euphorie über die zuvorhoch gelobten ,,Bakterienjäger" begann sich zu verflüchtigen.u Robett Koch selbsterlebte um 1900 einen empfindlichen Karriereknick. Die erfolgreichen Jahre derCholerabekämpfung waren vorüber. Bei der Diphterie hatte ihn Emil Behring mitder Entwicklung der Serumtherapie in den Schatten gestellt. Mit einem Heilmittelgegen die Tuberkulose war er gescheitert. Auch seine Malaria-Expeditionen in dieKolonien, die er um die Jahrhundertwende unternahm, resultierten nicht in den er-hofften spektakulären Ergebnissen. Zu guter Letzt musste er auch institutionell ei-nen Rückschlag hinnehmen, als das unter seiner Führung in Berlin geplante deut-sche ,,Reichs-Institut für Tropenhygiene" 1899 überraschend Hamburg zugeschla-gen wurde.T
Koch suchte deshalb nach einem Betätigungsfeld, auf dem er Erfolge vermel-den und zugleich seine Beziehungen zu den Behörden best?irken konnte. DiesesFeld schien ihm mit einer Kampagne gegen den Typhus gegeben - eine durch kon-taminiertes Wasser und Nahrungsmittel übertragene Durchfallerkrankung, die ingewissen Gebieten Deutschlands endemisch war. Seine bei der Cholera und der
Ebd., s. 284, 288, S. 292î.Vgl. Berger 2009 (Anm. *), Kap. 5.Zur Krise Kochs um die Jahrhundertwende vgl. Briese, Olaf, Angst in Zeiten det Cholera,Berlin 2003, S. 302-303; Mendelsohn, J. Andrew, Cultures of Bacteriology. Formation andTransformation of a Science in France and Germany, 1870-1914, Phil. Diss, Princeton1996, S. 590.
567
362 Silvia Berger
Malaria entwickelten Maßnahmen der Seuchenbekämpfung, die auf die Identifika-tion der Infektionsquellen und -stoffe sowie die Absonderung und Überwachungvon Erkrankten und sogenannter ,,Keimträger"8 fokussierten, versprachen hierwirksam zu sein. Zentrale Voraussetzung war freilich ein schnelles und zuverlässi-ges Nachweisverfahren, das selbst bei klinisch unsicheren Fâllen die verursachen-den Typhusbakterien feststellte. Im Jahr 1901 hielt man diese Diagnostik dank in-tensiver, von Koch angeregter Studien und der Entwicklung eines Lackmus-Milchzucker-Agars zur Isolierung der Erreger in der Hand (Bilder l-2).e
Mit der Bitte um umfassende finanzielle Unterstützung einer Kampagne gegenden Typhus war Koch bei den Zivilbehörden zunächst gescheitert.r0 Gegen Ende1901 wandte er sich deshalb an die Sanit?itsbehörden im Königlichen Kriegsminis-terium, mit welchen ihn bereits füiher enge Kontakte verbunden hatten. Um im mi-litärischen Kontext Evidenzen für seine Kampagne zu erzeugeî, musste es Kochgelingen, dem in der Öffentlichkeit bislang auf wenig Resonanz stoßenden Typhusein prägnantes Antlitz zu verleihen und seine Bedrohlichkeit namentlich für dieArmee hervoranheben. Zu diesem Zweck setzte er das eingangs erwähnte Narrativein. Im Oktober 1901 lenkte er die Aufrnerksamkeit der Militärbehörden in einemVortrag mit dem Titel ,,Seuchenbekämpfung im Kriege" mittels eines Rückblicksauf die Geschichte auf die scheinbar ursächlichen und habituellen Beziehungenzwischen Kriegen und Epidemien. Kriegsseuchen hätten Armeen oft stark redu-ziert, beispielsweise das Fleckfieber das französische Heer vor Neapel im Jahr1528. Aber auch im Krimkrieg, im amerikanischen Bürgerkrieg oder im deutsch-französischen Krieg hätten Seuchen wie Pocken, Ruhr, Fleckfieber und Choleraviele Opfer gefordert.rt Den Abdominaltyphus rückte er in seiner Erzählung nunals ,,immer noch die häufigste und deshalb wichtigste Kriegsseuche" gekonnt inden Vordergrund und betonte, dass man mit dem neuesten, an seinem Institut erar-
8
9
Als ,,Keim¡'oder,,Bazillenträger" bezeichnete man Menschen, die ohne erkennbare klini-sche Erkrankung pathogene Bakterien in sich trugen und weiterverbreiteten. Wie ChristophGradmann zeigle, wurde die Neuausrichtung der bakteriologischen Seuchenbekämpfung aufdie ,,Bazillenträger" maßgeblich durch Kochs Studien über tropische Tierinfektionen um1900 beeinflusst. Gradmann, Christoph, Robert Koch and the invention ofthe carrier state:tropical medicine, vetenery infections and epidemiology around 1900, in: Stud. Hist. Phil.Biol. Biomed. aß Q010\,5.232-240.Vgl. Drigalski, Wilhelm v., Im Wirkungsfelde Robert Kochs, Hamburg 1948, S. D7ff. Diean den sogenannten ,,Conradi-Drigalski-Agar" geknüpften Erwartungen sollten sich späternicht e¡füllen. Zur Verbesserung der diagnostischen Möglichkeiten ab 1903 vgl. Hollatz,Friedhelm, Die Typhusbekämpfung im Südwesten Deutschlands (1903-1918) im Spiegeld¡eier medizinischer Wochenschriften, Med. Diss., Berlin 1948, S. 33ff.Briese 2003 (Anm. 8), S. 305.Koch, Robert, Seuchenbekämpfung im Iftiege (1901), in: Schwalbe, Julius (Hrsg.), Ge-sammelte Werke von Robert Koch, 2. Bd. l. Teil, Berlin 1912, S. 290f .
10ll
Narrative Etablierung einer Kriegswissenschaft 363
beiteten Nachweisverfahren schon innerhalb von 18 bis 24 Stunden mit Sicherheiterkennen könne, ob Typhus vorliege.l2
Koch ließ es nicht beim ingeniösen Einsatz des ,,Krieg und Seuchen"-Narrativsbewenden, um die Haltung des Kriegsministeriums zu beeinflussen. Raffiniert warauch die Wahl der Gegend, in der seine Typhuskampagne stattfinden sollte. AlsGebiet eines ersten Vorversuchs propagierte er n¿imlich einen Landstrich zwischenTrier und Saargemünd, der im Südwesten Deutschlands an Frankreich angrenzte.Genau hierbei handelte es sich um einen Teil des militärisch-strategisch sensiblenGebiets des ,,Schlieffen-Plans". Das von Koch in einem Brief an das Kultusminis-terium Ende 1901 als ,,Aufmarschgebief'bezeichnete Territorium sollte von allenTyphuserregern im Sinne einer Mobilmachungsvorarbeit befreit werden, damit dieArmeen ihre Operationen in voller Stärke beginnen konnten und der deutsche Nati-onalstaat nach außen abgesichert war.13
Während Koch l90l den Typhus erstmals als wichtige Kriegsseuche einge-führt hatte, zielte er in einem weiteren, im November 1902 vor dem wissenschaftli-chen Senat der Kaiser-Wilhelm-Akademie fii¡ das militäråirztliche Bildungswesengehaltenen Vortrag ohne Umschweife direkt auf den Typhus und seine verheeren-den Konsequenzen in früheren Kriegen:
,,Meine Herren! Dass der Abdominaltyphus eine der gefÌihrlichsten Kriegsseuchen ist,ist Ihnen allen bekannt. Ich brauche nu¡ daran zu erinnern, dass im Deutsch-Französischen Kriege in unse¡er Armee über 73.000 Erkrankungen und gegen 9.000TodesfÌille an Typhus vorkommen."r4
In der Folge machte er die versammelte Schar von Militãråirzten auf die drohendenGefahren in einem zukünftigen Krieg aufmerksam. Was würde geschehen, wenndie Armee in einer Gegend auftnarschieren müssteo die von Typhus verseucht war?Die Armee würde ihre Operationen zwangsläufig typhusverseucht beginnen. Diessei namentlich an der lüestgrenze des Reiches zu erwarten, an der bedenklicheVerhältnisse herrschten. ,,Ort an Ort", vor allem im Bezirk des 8. Armeekorps, seivon Typhus befallen. Gegenüber dieser Gefah¡ gab es denn auch nur einen Schutz:die bakteriologische Seuchenbekämpfung, also das systematische Aufspüren undVerfolgen jeglicher Spuren der Infektion, die rigide Isolierung aller K¡ankheitsfülleund -verdächtigen und die Vernichtung aller Erreger.ls
Kochs rhetorische Strategien umfassten in seinem VorFag auch eine besondereKlassifizierung der bakteriologischen Maßnahmen, die gegen den Typhus zum Ein-satz gelangen sollten. Erstmals fasste er die bakteriologischen Untersuchungen undDesinfektions- und Isolationspraktiken unter dem Signum der ,,Offensive" zusam-men. Gegenüber früheren Zeiteq in denen man fìir möglichst große Reinlichkeit
Ebd., s. 293f.Vgl. Koch an den Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, 17
Dezember 1901, in: Schwalbe l9l2 (Hng.), Gesammelte Werke, Bd. 2.2,5.915.Koch, Robert, Die Bekämpfung des Typhus, in: Schwalbe l9l2 (Anm. I 1), S. 296.Ebd., s. 297.
l2l3
t4l5
364 Silvia Berger
gesorgt und die Wasserverhältnisse zu verbessern versucht habe - also einen ,,eherdefensiven Standpunkf' einnahm - sei man jetá in die ,,Offensive" gegangen, soKoch. Man kenne jetzt den Infektionsstoff und könne ,direkt auf ihn losgehen".Mit dieser Rede von der ,,Offensive" sigralisierte Koch nicht nur St¿i¡ke und Ent-schlossenheit, sondem löste vor dem Hintergrund der deutschen Milit¿irdoktrin undmilitärischen Standardpraktiken auch enoÍne Resonanzen aus. Wie Isabell Hulldargelegt hat, wurde der ,,Kult der Offensive" * obwohl ein europäisches Phäno-men - nirgends so gepflegt und nirgends so stark als Grundlage für das militärischeTraining und die Planung umgesetzt wie in Deutschland. Auch der um die Jahrhun-dertwende Gestalt annehmende Schlieffen-Plan war ein rein offensiver Plan.l6 AlsResonanzraum verlieh dieser Plan beziehungsweise der gekonnte Einsatz der Me-taphorik der ,,Offensive" der von Koch propagierten Typhusbekämpfung zusätzli-che Legitimität und Evidenz.
Bakteriologische rrOffensive": Die Typhuskampagne
Angesichts des aufgebotenen ,,Krieg und Seuchen"-Narrativs und der persuasivendiskursiven Strategien Kochs erstaunt es nicht, dass das Militär seine Pläne befü¡-wortete. Dem systematischen Kampf gegen den Typhus sollte großzügige personel-le Unterstützung und Finanzierung gewährt werden. Bereits im Dezember 1901fand ein erstes Treffen mit dem Chef der Militåi¡sanitätsabteilung GeneralstabsarztRudolph von Leuthold statt, in dem Details über die Zusammenarbeit abgestimmtund Finanzierungsfragen für einen Vorversuch in einigen Landkreisen von Triergeklåirt wurden. Nachdem Koch die Unterstützung des Militärs hatte, bewilligteauch das Preußische Kultusministerium substantielle Beiträge für seine Typhus-kampagne. Neben den ,,strategischen", kriegsentscheidenden Gesichtspunkten \ryardas Kultusministerium von einem entschlossenen Vorgehen gegen die Krankheitzweifellos ansîitzlich überzeugt aufgrund der verheerenden Folgen, welche kurzzuvor eine Typhusepidemie in Gelsenkirchen gezeitigt hatte.lT Diese forderte seitdem Spätsommer 1901 im rheinisch-westfÌilischen Kohlen¡evier über 3.000 Er-krankungen und fast 350 Tote und konnte erst gegen Ende des Jahres eingedämmtwerden.r8 Ebenso wie beim Industriebezirk von Gelsenkirchen handelte es sichauch bei dem von Koch ins Auge gefassten Gebiet im Südwesten Deutschlands umein boomendes, dicht bevölkertes Industrieareal, in welchem neue Gruben und Hüt-
l6 Hull, Isabell v., Absolute Destruction. Military Culture and the Practices of War in ImperialGermany, Ithaca,{London 2005, S. 164.Vgl. Drigalski 1948 (Anm.9), S.178.Zum gerichtlichen Nachspiel der Epidemie und dem Richtungsstreit zwischen Kontagionis-ten und Lokalisten vgl. Howard-Jones, N., Gelsenki¡chen Typhoid Epidemic of 1901, Ro-bert Koch, and the dead hand of Max von Pettenkofer, in: British Medical Journal, 13. Jana-ry 1973, S. 103-5; Weyer-von Schoultz, Mafin, Die Gelsenkirchener Typhusepidemie undihr gerichtliches Nachspiel, in: Vögele, Jörg, Woelk, Wolfgang (Hrsg.), Stadt, Krankheitund Tod, Berlin 2000, S. 3 17-338.
t7l8
Narrative Etablierung einer Kriegswissenschaft 365
ten entstanden waren und der Typhus als Volkskrankheit eine Gefìihrdung für diesoziale und wirtschaftliche Entwicklung der Region bedeutete.
Im Verlauf des Jahres I 902 versprach der Kaiser, der von Generalstabsarzt vonLeuthold auf Kochs Typhusbekämpfung aufrnerksam gemacht worden war, nacheinem Treffen mit Koch höchsþersönlich zusätzliche Mittel, um eine erste Erwei-terung der Kampagne auf Saarbrücken zu ermöglichen.l9 Anfang 1903 erhieltKoch aus dem Budget des Reichsamts des Innem schließlich auch großzügigereichsstaatliche Finanzmittel.2o Die von Militär, Landesbehörden und Reich bewil-ligten Gelder, die sich bis l9ll auf insgesamt 2,5 Mio. Reichsmark beliefen, ge-statteten eine Ausdehnung der ,,verschärften TyphusbekÈimpfung" von den preußi-schen Gebieten rund um Trier und Saarbrücken auf Gebiete der benachbarten baye-rischen Pfalz, des oldenburgischen Birkenfelde und aufdie reichsländischen Bezir-ke Unterelsass und Lothringen, Insgesamt wohnten in diesem rund 26.000 Quad-ratkilometer großen Gebiet im Südwesten Deutschlands ca. 3,5 Mio. Einwohner.2l
Bis 19ll waren 85 Bakteriologen - davon die Hälfte Militärärzte - in elf Ty-phusstationen an dem ,,planmäßigen Feldzug gegen den Typhus'¿2 beteiligt. Die3.240 Gemeinden des Gebietes wurden dabei einem bakteriologischen Belage-rungszustand unterworfen. So wurden zahllose Erkundigungen vor Ort vorgenom-men, Auskünfte über Typhus- oder verdächtige KrankheitsfÌille bei Geistlichen,Lehrem und Ortskrankenkassen eingeholt, Zählkarten und Fragebögen ausgefüllt,eine schier unvorstellbare Anzahl von Stuhl- und Urinproben in speziellen Ver-sandgefüssen an die Untersuchungsstellen verschickt (Bild 4), Hunderttausendebakteriologischer Untersuchungen durchgeführt, Berichte verfasst und Ratschlägean Arzte und Ortsbehörden erteilt. Tausende von K¡anken, Krankheitsverdächtigenund möglichen gesunden Überträgern wurden desinfiziert und Typhuskranke undBazillenträger in K¡ankenhäusern oder Isolierbaracken abgesonde#3 und einermedizinisch kurativen Behandlung unterzogen.2a
Mit dieser ersten medizinischen Rasterfahndung in der Geschichte sollte esnicht nur gelingen, das Gebiet zugunsten der ansässigen Bevölkerung von Krank-
l9 Kirchner, Martin, Ûber den heutigen Sønd der Typhusbekämpfung, Jena 1907, S. 12;Dn-galski 1948 (Anm. l0), S. 266. Spezialberichte von Leutholds an den Kaiser über den Vor-versuch Kochs in der Umgebung Triers wiesen darauf hin, dass die Gesundheit der Regi-menter an der Westgrenze zu Frankeich von der Aufdeckung versteckter Typhusfìille ab-hing. Mendelsohn 1996 (Anm. 7), S. 625.Mendelsohn 1996 (Anm. 7), S. 647, 648.Hollatz 1948 (Anm. 8), S. ll; Vögele, Jörg, Typhus und Typhusbekämpfung in Deutsch-land aus sozialhistorischer Sicht, in: Med.hist. Journal 33 (1998), S. 74.Fraenkel, Carl: Rezension ,,Zusammenstellung der Maßnahmen der Typhusbekämpfung imRegierungsbezirk Trier" (von Schlecht), in: Hygienische Rundschau Bd. 9 (1904), S. 930.Während man die gesunden Infiziefen im Vorversuch allesamt der Isolierung unterwa{konnte dies im erweiterten Gebiet der Kampagne aufgrund wirtschaftliche¡ undjuristischerProbleme nicht mehr umgesetzt werden.Zur Typhuskampagne als ,,Big Science" vgl. Mendelsohn 1996 (Anm. 7),5.672fî.
202t
22
23
24
366 Silvia Berger
heitsherden zu befreien. Die möglichst weitgehende ,,Ausrottung" des Typhus warvon Beginn an mit dem Streben verbunden, ein seuchenfreies, gleichsam sterilesTerrain für die militärischen Operationen im zukünftigen Krieg zu schaffen.
,,Wissenschaftlicher Schutzgeist" im Weltkrieg
Die Bakteriologie wurde in der Typhuskampagne erstmals und sehr bewusst alseine ftir den Krieg unabdingbare Wissenschaft positioniert. Was hier seinen Anfangnahm, war die Rekonfiguration und Etablierung der Bakteriologie als epidemiolo-gische Feldwissenschaft, als eigentliche Kriegswissenschaft.
Als der Erste Weltkrieg ausbrach, erreichte nicht nur die Rede von der bakteri-ologischen ,,Offensive" und von bakteriologischen ,,Feldzügen", sondern auch dieProduktion historischer Berichte über die naturgegebene Verbindung von Kriegenmit Seuchen ihren Kulminationspunkt. Kaum ein wissenschaftlicher und populärerZeitschriftenartikel, kaum eine Monographie und kaum ein Behördenbericht zumThema Seuchenbekämpfung kamen in den ersten Kriegsmonaten ohne Erzählungenüber das Auftreten verheerender Seuchen in den Feldzügen der V/eltgeschichteaus.25 Exemplarisch ist ein Vortrag Martin Kirchners, der sich als Medizinalrat imPreußischen Kultusministerium maßgeblich für die Implementierung der Typhus-kampagne eingesetzt hatte. Im September 1914 betonte er in einem Kurs äberKriegsseuchen:
,,Wer die Geschichte der Seuchen kennt durch die Jahrhunderte hindurch, der weiß, dasswiederholt Armeen von schweren Krankheiten heimgesucht wurden, welche sich mitfurchtbarer Schnelligkeit verbreiteten, den Sieger und den Besiegten gleichmäßig inMitleidenschaft zogen und zur Folge gehabt haben, dass schwere Entscheidungen her-beigeführt wo¡den sind. Nicht nur die Intelligenz der Völker, nicht nu¡ die Macht ihrerkriegerischen Untemehmungen haben die Weltgeschichte bestimmt, sondem [...]schwere Seuchen, die die Völke¡ dezimiert haben."2ó
Oftmals belegten die historischen Berichte gar, dass der Verlust durch Krankheitdenjenigen durch den militärischen Einsatz übertraf. Die Rede von der Zwangsläu-figkeit von Kriegen und Seuchen produzierte dabei einen geradezu idealtypischenAutomatismus, der die Bekämpfung von Kriegsseuchen wie Typhus, Cholera oderFleckfieber zur kardinalen Aufgabe des Feldsanitätswesens erhob und die Bakterio-logie endgültig in den Rang einer potenten Kriegswissenschaft katapultierte.
25 Vgl. (als Auswahl): Verhütung übertragbarer Krankheiten im Kriege, in: Vossische ZeinngNr. 431 (1914); Lentz, Otto, Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten unter Berücksich-tigung der Verhältnisse im Kriege und die Mitwirkung der Krankenkassen, in: Ortskran-kenkasse Nr. 12 (1914), S. 386-393; Altschul, Theodor, Kriege und Seuchen, Prag 1914;Bundesarchiv Berlin, R86/4538: Berichtentwurf Bumm an den Staatssekretär des Innem,betrifft Verhütung von Kriegsseuchen bei der Zivilbevölkerung, 3.8.1914.Kirchner, Martin, Verhütung und Bekämpfung von Kriegsseuchen, in: Adam, Curt (Hrsg.),Seuchenbekämpfung im Kriege, Jena 1915, S. 28.
Narrative Etablierung einer Kriegswissenschaft 367
Entscheidend befürdert wurde dieser Prozess durch die zeitgenössische Model-lierung der Gefahren, auf der die Logik des Paars ,,Ktiege und Seuchen" basierte.Ein gängiges Argument bei der konstruierten Gleichschaltung von Kriegen undSeuchen war die Begünstigung des Ausbruchs von Epidemien durch die bei kriege-rischen Vorgängen erfahrungsgemäß entstehende Massierung und Bewegung vonMenschen. Der neu entfesselte Krieg drohte nun nicht nur Europa, sondern gleichmehrere Kontinente mit einzubeziehen. Für Beobachter lag es deshalb auf derHand, dass enorne, bisher unerreichte Menschenmassen in die militärischen Aus-einandersetzungen involviert sein würden und sich von einem Punkt zum nächstenbewegten.2T Seuchentechnisch repräsentierten sie eine immense Gefahr für Armeeund Reich, zumal die Schnelligkeit ihrer Fortbewegung durch den Ausbau derMassenverkehrsmittel zugenommen hatte. Zudem galten die fremden Armeen undihre Ursprungsländer als besonders bedrohlich. Vor allem Russland wurde als,,Brutstätte" zahlreicher Infektionskrankheiten beurteilt; Englands Truppen stelltenaufgrund ihrer Beschäftigung ,,halbwilder Elemente" aus den Kolonien ein Risikodar.28 Vor dem Hintergrund dieser eskalierenden Bedrohungsszenarien war esnachgerade vorbestimmt, dass die Verhütung von Seuchen zur existenziellen Her-ausforderung stilisiert wurde. So betonte August Wassermann, einer der erstenSchüler Kochs, der Schutz des Heeres und Volkes vor den Kriegsseuchen sei ,,indieser schweren, aber unvergleichlich großen Zeit[...] zu einem integrierenden Teiljener große Existenzfrage geworden, um die wir in einzig dastehender Einigkeitund Begeisterung das Schwert gezogen haben".2e
Mit welchem Ansatz die Seuchenbekåimpfung zu bewerkstelligen war, schienfür Wassermann wie auch für die Behörden klar: Es war die BakteriologieKoch'scher Prägung, die als Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Bestrebungen geltenmusste. Im Kontext der vom zwingenden Paar ,,Krieg und Pestilenz" als Schreck-gespenst an die Wand projizierten Seuchengefahr rückte die modeme, ,,offensive"Seuchenbekämpfung der Bakteriologen unweigerlich in den Rang eines ,,wissen-schaftlichen Schutzgeistes". Er und nur er sicherte das Überleben Deutschlands vordem,,Würgeengel" früherer Kriege.3o
Die Bakteriologen erlebten zu Beginn des Weltkriegs deshalb auch ein all timehigh threr Anerkennung. Das Prestige der Wissenschaft manifestierte sich unteranderem darin, dass bei den organisatorischen Vorkehrungen nichts dem Zufallüberlassen wurde und Infrastruktur und Ausrüstung kaum tüünsche offen ließen.
27 Vgl. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kultu¡besitz, HA Rep 76 VIII B/3554: Aufzeich-nung über die am 24.10.1914 abgehaltene Beratung des Reichsgesundheitsamts, betreffenddie durch den Krieg bedingte Seuchengefahr, S. 7.
28 Zur Debatte um den Einsatz von Kolonialtruppen vgl. Koller, Christian, Von Wilden allerRassen niedergemetzelt. Die Diskussion um die Verwendung von Kolonialtruppen in Euro-pa zwischen Rassismus, Kolonial- und Militärpolitik (1914-1930), Stuttgart 2001.
29 Wassermann, August, Über Seuchenbekämpfung im Kriege, in: Adam, Curt (Hrsg.), Seu-chenbekämpfung im Kriege, S. l-3.
30 Unser wissenschaftlicher Schutzgeist im Kriege, in: Der Türmer, Juni 1915, S. 332.26
368 Silvia Berger
Jeder Korpshygieniker wurde mit einem gut bestückten bakteriologischen Kastenmit Mikroskopen ausgerüstet, die beratenden Hygieniker füh¡ten ein großes tragba-res Laboratorium mit sich, mit dem ein vollständiges, von Nachschub unabhängiges Feldlaboratorium gebildet werden konnte. Eingerichtet wurden zudem bakterio-logische Laboratorien bei allen Seuchenlazaretten, bei den Absonderungshäusern(Bild 2) und Seuchengenesungsheimen. Fahrbare Trinkwasserbereiter, Desinfekti-onsmittel, mobile Desinfektions- und Entlausungsapparate und die Bereitstellungvon Impfstoffen - insbesondere gegen Cholera und Typhus - rundeten die sanitäreMobilmachung ab.3r
Die Militärbakteriologen sahen den gesundheitlichen Herausforderungen dennauch nicht mit ängstlicher Besorgnis, sondern größter Zuversicht entgegen. Analogden beim Typhusfeldzug entwickelten Bekåimpfungspraktiken lancierten sie einenminutiös vorbereiteten und mit schier unerschöpflichen Mitteln, Materialien undPersonal geführten ,,Krieg" gegen die pathogenen Bakterien. Angeleitet vom Stre-ben nach der totalen Keimfreiheit und der Vermeidung jeglicher Zonen infektiöserIndifferenz, überzogen sie das nunmehr ,reale' Feld mit einem noch nie da gewese-nen bakteriologischen Ordnungs- und Kontrollnetz.32 Der Sieg über die ,,unsichtba-ren Feinde..- die Bazillen und Kriegsseuchen - schien zu Beginn des Krieges be-reits vorgezeichnet. Die verheerende Influenza-Pandemie von 1918119 und weitereirritierende Seuchengänge indes machten nur wenige Jahre später eindrücklich klar,dass dies eine Illusion war.33
31 Vgl. Schwalm, Erich, Gliederung, Ausrüstung und Tätigkeit des sanitätskorps im Felde, in:Hofftnann, Wilhelm (Hrsg.), Die deurschen Ãrzte im Weltkriege, Berlin 1920, S. 255-315.Zu Entwicklung, Einsatz und den Debatten über die Wirksamkeit von Typhusimpfstoffenunmittelbar vor und während des Weltkriegs vgl. Linton, Derek S., Was Typhoid Inoculati-on Safe during world war I? Debates within German Military Medicine, in: J. Hist. Med.Allied Sci. 55.2 (2000), S. 101-133; Vögele 1998 (Anm. 2l)' S. 76f.
32 Zur bakteriologischen ,,Kriegsführung" im weltkrieg vgl. detailliert Berger 2009 (Anm. *),
s. I 86-251.33 Zur Krise der Bakteriologie im Anschluss an die Influenza-Pandemie 1918/19 vgl. Men-
delsohn, J. Andrew, Von der ,,Ausrottung" zum Gleichgewicht. wie Epidemien nach demErsten Weltkrieg komplex wurden, in: Gradmann, Christoph; Schlich, Thomas (Hrsg.),Strategien der Kausalitât, Pfaffenweiler 1999, S. 227-268; Berger 2009 (Anm. *), S. 283ff'
Narrative Etablierung einer Kriegswissenschaft 369
A li,,. l$, \i.r{,il{tg tal., lilr I r ttru-tilar rtrchun$jrì*rdi!!1.(li¡rr l'øs*¡xli¡.ui¡¡. 1 ì¡k'x L B&\.!'l¡iil{'uvl {,l$f fùr t r¡r\ 2. lll¡'úhi¡l.rrr|rl (¡h¡ ftn siuhl, ;rì liork ,irr fr¡tr."hnrlõ(l"Ì. J l!ôpircl!'it.n ¡*s l'li, tj¡t:ì,p'¡ r t'¡tsr .lrrfurßrri r.,n Í'ji¡,ri¡Àr;r lx.i ì¡n.b rl¡* lilu,. :1, lJlrhhii,,,-r'rÌ'l lils{ l:,r lìld- .1. lL'Þli¡,¡ralÞ.r, zur,\üf¡¡rhr¡¡ ¡lr irr rlir lllrhhi¡ls,¡r
t¡'ri.ckl, r¡ t;lN'j.l-)i,. Vorñrì'rl{rjiÍ} fiir llrrL¡tiLr,.ri¡1..'i1h.ìjt ^rr rL, (;ljur \r. 9 ri!l :} fr,r
Slul'lr:rrlltìrt,,ì.:,tiil'li'l-rhù1,,.. ¡il:rda¡¡11.r¡¡N¡.ttiìrAü¡nrff.
Abb. t: Typhusversandgeföþ, in: Lentz, Otto: Die Seuchenbekãmpfung und ihre technischenHilfsmittel, Berlin 1917, S. 15.
Abb.2: Bakteriologen, DizyJe-Gros/Frankreich 1915, (Nachlass Uhlenhuth (privat)), abgedrucktin: Neumann, Herbert: Paul Uhlenhuth. Ein Lebenfi)r die Forschung, Berlin 2004, S. 123'
I
I
I
ffir
yrldl' h\iiil¡r lrtr*
r.û&t. .rilLr la. l'l.r¡ ii" ì!n.¡.¡
@
llic¡. 1.3!'_rc:€
frTi\-'
370 Silvia Berger
Narracyjne utworzenie nauk wojennych - bakteriologia i pierws-za wojnâ éwiatowa
Pol4czenie bakteriologii i wojny nie zwrócilo do tej pory w historii medycynywiçkszej uwagi- pr4majmniej w obszarze niemieckojçzycznym. S4 one jednakkluczowe dla autor¡etu i efektywnoSci nauki o bakteriologii na przelomie XXwieku. Ten referat broni tezy, 2e Robertowi Kochowi i jego uczniom, poprzez re-konfiguracjç i ustanowienie bakteriologii jako epidemiologicznie waimej nauki wo-jennej, udalo siç wzmocnió znaczenie tej dyscypliny, która od czasu slawnych po-lowari na zarazki w latach 80 XIX wieku nie mogla wykazaó siç juz sukcesamimedycanymi i musiala zaakceptowaó ró2nego typu wstrzqsy w swoim sytemiewiedzy. To wzmocnienie nast4pilo do tego stopnia, 2enapoczqlkupierwszej wojnyéwiatowej zostaNa nazutaîa egzystencjalnym, naukowym,,duchem ochronnym"Niemiec.
Najistotniejszym dla tego rozwoju byNo wlqczenie specjalnego narratora:przymusowe pol4czenie wojen i epidemii w perspektywie historycanej. Pomiçdzykampaniami wojennymi i epidemiami, argumentowal Koch, istnieje zaleànoíóptzycz!îowa i zwyczajowa. Kiedy plonie pochodnia wojenna, wtedy zanzy wo'jenne podnosza swoje glowy, wyczolguj4 siç ze swoich kryjówek i niszczq dumnearmie. Z doéwiadczeú wczeSniejszych wojen naleff wyci1gn4ó wniosek, 2e w sto-sunku do tej katastrofalnej pary istniala tylko jedna mo2liwoéó ochrony: brakterio-logicme ø¡,t alczanie epidemii.
Tak jak opisuje Roger Cooter, domniemane naturalne wspolwystçpowanie wo-jen i epidemii zostanie przedstawione i opisane historycznie jako produkty wiedzy izasobów. Zostanie ukazane,2e Koch, bezpoérednio w nowym stuleciu, po razpierwszy pomyslowo rozwinql i bþskotliwie zastosowal narracjç przy promowaniudu2ej kampanii zt¡¡alczania tyfusu. St4d powinna wziqó, pocz4tek transformacjabakteriologii do nauki wojennej.
Waàrym katalizatorem w promowaniu kampanii bylo, oprócz wl4czenia narra-tora ,,wojny i epidemii", strategicznie m4dry wybór obszaru malczania. Jako obs-zar kampanii przeciwfyfusowej Koch propagowal mianowicie obszar do zajgcia wramach ,,planu Schlieffena" w poludniowo-zachodnich Niemczech, który mial byówyczyszczorry z wszystkich zarazkíw w celu ,,pracy mobilizacyjnej i uéwiadami-aj1cej". Dodatkowo strategie te obejmowaþ równieZ poszczególne opisowe kate-goryzacje bakteriologicznych praktyk epidemiologicanych. Koch oglosil jenajpierw jako ,,ofensywç", co wtedy na tle aktualnej kultury militamej i mili-tamych praktyk wywylatro ogromny oddáwigk i wzmocnilo dodatkowo legitymiza-cjç i oczywistoÉó dzialaibakteriobójczych, takich jak de4mfekcja i izolacja.
Kiedy rozpoczgta siç pierwsza wojna éwiatowa, swój punkt kulminacyjnyprzeiryNa nie tylko ,,ofensywa", ale teL produkcja historycznych komentarzy onajwidoczniej naturalnych pol4czeniach wojen i epidemii. Dodatkowo wspieranyprzez íwczesne postrzeganie zagroLeí, na którym opierala siç ówczesna logika pa-
ry ,,wojny i zarazy" - skomasowanie ludzi, przyspieszenie niebezpiecznych
Narrative Etablierung einer Kriegswissenschaft 371
ruchów, ,,wschód" jako ognisko epidemii - automatycznie wciqgnçþ bakteriologiçw poczet niezbçdnych nauk wojennych, zaberyieczaj4cych egzystencjç Niemiec.
Zwiçkszenie autorytetu i ich lepsza opinia byþ ogromne i zmaterializowaþ siçw totalnej ,,wojnie" przeciwko bakcylom, w której higieniSci i bakteriolodzywojskowi wtqczyli realne obszary z do tej pory niespotykanymi sieciami bakterio-logicznymi, poddanymi najwyàszej zasadzie porz4dku, kontroli i bezpieczeústwa.
Me dizi ngesch ichte im Kontext Ute Caumanns/ Fritz Dross/Anita Magowska(Hrsg. / red.)
Medizin und Kriegin historischer Perspektive
Medycyna i wojnaw perspektywie h istorycznej
Beiträge der Xll. Tagungder Deutsch-Pol nischen Gesel lschaft
für Geschichte der Medizin,Düsseldorf 18.-20. September 2009
Prace Xl l. konferencji Polsko-N iemieckiegoïowarzystwa Historii Medycyny,
Düsseldorf 18 do 20 wrze5nia 2009 r.
Herausgegeben vonKarl-Heinz Leven, Mariacarla Gadebusch Bondio,
Hans-Georg Hofer und Cay-Rüdiger Prüll
Begründet a ls Freiburger Forschungenzur Medizingeschichte von Ludwig Aschoff,
fortgesetzt von Edua rd Seidler
Band 17
öslz ösaz
PETER LANGFrankfurt am Main . Berlin ' Bern . Bruxelles. New York' 0xford . Wien
PFTER LANGI nternationa ler Verlag der Wissenschaften