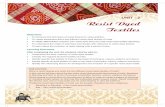Mirella Carbone (Hg
Transcript of Mirella Carbone (Hg
Mirella Carbone (Hg.)
Annemarie Schwarzenbach Werk, Wirkung, Kontext
Akten der Tagung in Sils/Engadin vom 16. bis 19. Oktober 2008
Mit einer Schwarzenbach-Bibliographie 2005-2009
AISTHESIS VERLAGBielefeld 2010
Sonderdruck aus:
Mechthild Heuser
Im Fremden das Vertraute suchen – Perspektiven fotografischer Empathie im Werk Annemarie Schwarzenbachs
Wider den Exotismus
Die Fotoporträts Annemarie Schwarzenbachs sprechen durch ihre Unmit-telbarkeit an: Das offene, unverstellte Lächeln des Ziegenhirten in Afgha-nistan, ein verschmitztes Schmunzeln afrikanischer Halbwüchsiger… Bei der Betrachtung der Porträts von Bewohnern fremder, für Europäer exotisch wirkender Länder wie Persien, Irak, Afghanistan, Indien, Afrika erstaunt die Vertrautheit, die aus den Gesichtern der Abgelichteten der Fotografin (und dem Betrachter) gegenüber spricht. Wüsste man es nicht besser, könnte man meinen, man blicke in ein aufgeschlagenes Familienalbum.
Das Verhältnis zwischen Fotografin hinter und Subjekt vor der Linse ist ein gleichberechtigtes, respektvolles. Der Blick durch die Kamera taxiert weder, noch beurteilt er. Zunächst beobachtet er wertfrei und besticht dann durch die Nähe mit den und die Sympathie für die Dargestellten.
Abb. 1: Irak, 1933-1934. „Arab. Dorf: Jude, Neger u. Araber.“ (AS-03-096K)
236
Abb. 2: Junger Araber bei Ur. Irak 1933-1934 (AS-03-105)
Die Porträts entstehen auf Augenhöhe. Um Halbwüchsige zu fotografieren, geht Annemarie Schwarzenbach buchstäblich in die Knie, sie vermeidet die hierarchische Perspektive von oben nach unten, vom Überlegenen zum Unterlegenen.
Anders als beispielsweise einer der Meister der modernen Reportage- und Porträtfotografie, Henri Cartier Bresson, operiert Annemarie Schwarzen-bach keinesfalls mit „dem entscheidenden Augenblick“ (vgl. Cartier Bresson 1952). Sie ‚ertappt‘ ihre Gegenüber auch nicht ‚auf frischer Tat‘, sie lässt ihnen Zeit, so macht es den Anschein.
Mechthild Heuser
237
Abb. 3: Warka (Uruk). Deutsche Ausgrabung, 1933-1934 (AS-03-115)
Als Gegenpol zur oft im Bildjournalismus beschworenen Spannung, die in erster Linie auf das Überraschungsmoment in der Fotografie setzt, den Foto-grafen tendenziell als Jäger definiert, operiert Annemarie Schwarzenbach mit der Langsamkeit. Ihren Gegenübern bleibt Muße, sich zu sammeln. Blicken sie in die Kamera, und das tun sie häufig, fühlt sich allenfalls der Betrach-ter ertappt, insofern, als der Blick geistesgegenwärtig und beseelt aus dem Bild herausschaut, den Beschauer unmittelbar anspricht. Einen fassungslo-sen Gesichtsausdruck des von der Kamera überwältigten Objekts sucht man hier vergeblich.
Im Fremden das Vertraute suchen
238
Abb. 4: Employment Center in Cincinnati/Ohio, Februar 1938 (AS-10-084)
Fazit: Akzeptanz und Einfühlung als Beweggründe für die Bildproduktion
Auffällig ist das Fehlen jeglichen ethnografischen (Forschungs-)Interesses, das, oft genug gepaart mit dem nötigen Kolonialherrengehabe, für manche Reisende jener Zeit sprichwörtlich war. In der Abstinenz vom Exotismus liegt eine Stärke, die den Bildern innewohnt. Sie sind bar jedes ethnozent-rischen Überlegenheitsgefühls, das mit zeitgenössischen Ängsten vor einer ‚farbigen Gefahr‘ korrespondierte. Sie sind frei von Rassismus.
Mechthild Heuser
239
Abb. 5: Flusshafen Cincinnati/Ohio Port, 1936-1938 (AS-10-256)
Hier blickt ein waches, unabhängiges Auge, von einer liberalen Einstellung geleitet, auf ebenso unabhängige, selbstbewusste, zumindest für den Moment des Bildes ‚freie‘ Bürger.
Xenos
Im Griechischen lautet das Wort für Fremder gleich wie das für Gast: Xenos! Eine ähnliche Gleichung, meint man, läge den Fotos der Annemarie
Schwarzenbach zugrunde. Sie zeigte im Fremden das Vertraute. Während
Im Fremden das Vertraute suchen
240
ihre Mutter, Renée Schwarzenbach Wille, zeitlebens den Fokus ihrer Kamera mit Hingabe auf ihre eigene Familie richtete, d.h. auf ihre Kinder, auf die Gesellschaften, die sie gab, auf ihren Wohnsitz und auf ihre Heimat, die Schweiz, sucht man diesen Blickwinkel bei ihrer Tochter Annemarie beinahe vergeblich.
Die geografische und kulturelle Fremdheit überspielt sie mit der Fotoka-mera: Sie führt uns die Menschen, die sie für bildwürdig hält, in einer so gro-ßen Unmittelbarkeit, mit einer so großen Selbstverständlichkeit vor Augen, dass wir deren Hautfarbe vergessen, deren fremdartige Kleidung für einen Moment übersehen und ihre Andersartigkeit in den Hintergrund treten lassen.
Sie scheinen uns vertraut, weil uns ihre Gestik und Mimik bekannt sind: Ein herzliches Lächeln überzeugt und berührt überall auf der Welt gleicher-maßen, egal ob es im Irak, in Afghanistan oder in Afrika beobachtet und abgelichtet wurde.
Annemarie Schwarzenbach, die sich von ihrer eigentlichen Familie zuletzt ausgestoßen fühlen musste, kreierte sich auf jeder Reise in die ‚neue Welt‘ eine neue Familie, „the family of man“, um einen späteren weltbewegenden Ausstellungstitel Edward Steichens vorwegzunehmen (Steichen 1955).
Vintage Prints, Blattkopien und Blätterwald: Vom Umgang mit einem Material und über dessen Wertschätzung – Fotografie auf Papier, Fotografie und ihr Format, Fotografie in den Printmedien
Insgesamt sind in dem mehrere tausend Bilder umfassenden Fotonachlass der Annemarie Schwarzenbach erstaunlich wenige ausgearbeitete Abzüge anzutreffen, denen man eine handwerkliche Sorgfalt in der Verarbeitung angedeihen ließ.
Besondere Finessen der Vergrößerungspraxis, eine variantenreiche Papier-auswahl oder Experimente mit dem Kontrast der Tonwerte sucht man ver-geblich. Fototechnische Experimente, eines der Kennzeichen der Avantgarde der 20er und 30er Jahre, waren für Annemarie Schwarzenbach offenbar kein Thema. Die wenigsten Abzüge dürften eigenhändig vergrößert worden sein, und wenn, dann einem sehr pragmatischen Gebot folgend, dem es keines-wegs darum ging, jene Möglichkeiten der künstlerischen Verarbeitung, die das Labor zu der Zeit bereithielt, auszuschöpfen.
Mechthild Heuser
241
Ich würde sogar die These wagen, dass für Annemarie Schwarzenbach das Foto mit dem Betätigen des Auslösers bereits vollendet war. Ihr Ehrgeiz richtete sich auf die Bildfindung vor Ort, in situ, im Licht, nicht auf jene im Fotolabor, in der Dunkelheit. Dafür spricht die überwältigende Anzahl an Kontaktkopien, die akribisch beschriftet und kommentiert, als Rohmaterial oft ausreichten, oft sicherlich aufgrund der Reisebedingungen auch ausrei-chen mussten, um das Konzept für eine Reportage zu konkretisieren. Der Fotonachlass der Annemarie Schwarzenbach suggeriert, dass für sie die defi-nitive Bestimmung des Endresultats auf Papier nebensächlich blieb. Sie ließ dem Medium in seiner unendlichen Reproduzierbarkeit alle Möglichkeiten offen, heischte sich gar nicht erst an, es künstlich zu beschränken.
Angesichts des Verwertungszweckes in Zeitungen und Zeitschriften, d.h. in Printmedien, erscheint ein solcher ‚burschikoser‘, flüchtiger Umgang nahe liegend und dem Zweck der vergleichsweise unbeständigen Tages- und Illus-triertenpresse optimal angepasst und angemessen. Nicht im Vintage Print (d.h. in dem Abzug, der zur Zeit der Filmbelichtung mit großer Sorgfalt und nach genauester Anleitung des Fotografen oder sogar von eigener Hand im Labor hergestellt worden ist), sondern im massenhaften Abdruck der jewei-ligen Zeitschriftenauflage erfüllte sich für die Fotoreporterin Annemarie Schwarzenbach der Sinn ihres Tuns!
Kommentare zur Fotografie aus der Feder der Annemarie Schwarzenbach
Theoretische Bemerkungen zur Fotografie, die das Medium selbst zeitkri-tisch reflektieren, sucht man im schriftlichen Werk der Autorin vergeblich. Sehr wohl aber äußert sie sich zu Anwendung und Stellenwert der Fotogra-fie im Werk anderer Kollegen, Kollegen, die gereist sind wie sie selbst. Eine Quelle dafür liefert ihr Buch über Lorenz Saladin, den früh und tragisch ver-storbenen Alpinisten, zu dessen Biografin sie wurde.
Liest man ihr Buch über Saladin vor der Folie ihrer eigenen Biografie, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, sie habe in diesem „Abenteu-rer“ ihr Alter Ego gefunden. Hellsichtig, und wie um ihre eigene Erfahrung zu bekräftigen, schreibt sie:
Es gehört zu den Merkmalen, an denen man den „Abenteurer“ erkennt, dass er sein Schicksal nicht fest in der Hand hat, dass sein Lebenslauf weder auf ein
Im Fremden das Vertraute suchen
242
Ziel gerichtet, noch von einer Idee getragen, einem Inhalt erfüllt ist, mag die-ser Inhalt gross oder bescheiden, nach aussen sichtbar und wirksam, oder eine innere Kraft, ein Wesenszug sein. Mangelnder Inhalt und Mangel an Haltung bedingen sich meistens gegenseitig, beides ist häufig dem Abenteurer eigen-tümlich, dessen „Drang in die Ferne“ dann identisch wird mit Flucht und Aus-flucht, Ausweg und Irrweg. Er flieht, um der Begegnung mit seinem Schicksal auszuweichen, und seine Existenz wird zu einer Kette von Zufällen – mag er dieselben auch tatkräftig und selbst heroisch meistern, so ist er doch nicht sei-nes Schicksals Schmied. Der Drang in die Ferne und die wahrhaft abenteu-erlichen Umstände seines Lebens sind es, die den Bergsteiger Lorenz Saladin mit dieser Sorte von Leuten verbindet, aber nicht mehr und nicht weniger. (LS:13)[…]Saladin hat erst angefangen, Tagebücher zu führen, Berichte nach Hause zu schicken und gar Artikel zu schreiben, als es sich, seiner Meinung nach, recht-fertigen liess. Auch die Photographien aus seiner Jugendzeit, und auch dieje-nigen aus Süd- und Nordamerika, sind durchaus anspruchslos, amateurhaft, nur bestimmt, private Erinnerungen zu bewahren und Albums für Familie und Freunde zu füllen. Obwohl es sich Saladin auch später nicht einfallen liess, photographieren zu lernen, nimmt der Wert seiner photographischen Produktion zu mit der Bedeutung seiner Unternehmungen. Und dies nicht nur, weil die Bilder aus unbekannten und ferneren Regionen stammen. Auch aus den Hochländern Südamerikas liessen sich seltene und schöne Aufnah-men mitbringen. Saladins erste bedeutende Bilder stammen aus dem Kauka-sus, die dichteste Produktion ist diejenige seiner letzten Expedition. Darunter befinden sich wahre Meisterstücke, sowohl Bergbilder, Landschaftsaufnah-men wie auch Portraits kirgisischer Träger, Strassenhändler und Nomaden-mädchen – menschliche Dokumente allerersten Ranges, nicht nur bedeutend, weil sie aus einer Gegend „am Rande der Welt“ stammen, wohin selten oder nie ein Europäer gelangt ist, sondern, und vor allem, weil sie gesehen sind von einem Menschen unserer Art, von unserem Fleisch und Blut, der lebte und empfand wie wir und der seine persönlichen Eindrücke und Empfindungen zu übersetzen wusste in die grosse, geheimnisvoll ergreifende Sprache, die in uns anklingt, die Bilder, Töne, Farben, ja glückliche und leidende Gefühle zu beschwören vermag noch aus dem Medium der fremdesten Welt, mit einem Wort: in die Sprache, die dem Gebiet der Kunst verwandt ist.Vielleicht hätte Lorenz Saladin den tiefen Unterschied zwischen seinen Ama-teurbildchen einer Lamaherde in Peru oder eines Kakteenstrauchs in Ari-zona und den herrlichen Bildern vom Wege zum Khan Tengri selbst nicht gekannt. Fast ist es rührend, und jedenfalls beglückend und ermutigend, zu beobachten, wie ein einfacher Mensch fast absichtslos seinen Weg geht, wie
Mechthild Heuser
243
er keine Zweifel und keinen Blick zurück kennt und wie sich doch alles orga-nisch zusammenfügt, so weit, dass selbst seine Kräfte und Fähigkeiten mit der Aufgabe wachsen, die er sich nicht einmal gesucht hat – oder doch nur einer Leidenschaft, einem dunklen Drange folgend. Und so kommt es, dass Lorenz Saladin […] uns ein vollständiges und in seiner Art grossartiges Werk hinter-lassen konnte – fast ohne sein Zutun. (LS:24f.)
Diese persönliche Wertschätzung, die Annemarie Schwarzenbach den Fotos des Alpinisten Lorenz Saladin angedeihen lässt, entbehrt jedes fotografie-immanenten Fachjargons, kommt ohne jedes fotografiespezifische Vokabu-lar aus. Im Grunde beschreibt die Autorin weniger die Substanz der foto-grafischen Bilder als vielmehr die Gefühle und allgemeinmenschlichen Regungen, die diese Fotos im Sinne von Erinnerungsbildern, von quasi archetypischen Empfindungsqualitäten, heraufbeschwören. Noch deutli-cher formuliert, verbalisiert sie jene Assoziationen, welche die Fotografien in ihrem Gedächtnis auslösen. Sie sieht nicht das aktuelle Bild, sie benutzt es zum Abruf eigener Erinnerungsbilder und erliegt damit jener kulturellen visuellen Prägung, jenem Phänomen, das der Kunsthistoriker Max Imdahl als „wiedererkennendes Sehen“ von dem „sehenden Sehen“ methodisch unter-schied (Imdahl 1981). Dabei überdeckt die assoziierte Bedeutung eines Bil-des das tatsächlich Wahrgenommene, die bildimmanenten Reize, und lässt diese in den Hintergrund treten. Sie bleiben unbeachtet. Dementsprechend lässt Schwarzenbachs Beschreibung formale Bildkriterien wie Komposition, Hell-Dunkelkontraste, Tonigkeit, Format, komplett außer Acht.
Rolle und Bedeutung der Fotografie im Werk der Annemarie Schwarzenbach
Annemarie Schwarzenbach machte sich Gedanken zum Stellenwert der Sprache, weil sie selber schrieb, sowohl Prosa als auch Poesie. Daraus den Umkehrschluss zu ziehen, dass sie auch über Fotografie schreiben würde, weil sie diese zu praktizieren pflegte, schlägt fehl.
Der Umstand, dass die promovierte Historikerin sich zu vielen Themen schriftlich äußerte (zu politischen, historischen, geografischen, zu Literatur und Film, zum eigenen Seelenbefinden), dabei jedoch das Medium, dessen sie sich selbst jahrelang bediente, die Fotografie, aussparte, gibt zu Denken.
Im Fremden das Vertraute suchen
244
Abb. 6: Westfront Street (vermutlich), Knoxville/Tennessee, 1937 (AS-09-030)
Sicherlich verweist die Lücke weniger auf ein Manko (selbstverständlich hätte sie sich zur Fotografie äußern können, wenn sie gewollt hätte), als viel-mehr auf eine Absichtslosigkeit, eine gewisse Gleichgültigkeit, man könnte vielleicht am ehesten von einer Unbekümmertheit im Umgang mit dem Medium sprechen.
Annemarie Schwarzenbach reflektierte die Fotografie nicht in dem Maße, wie Fotografen dies gemeinhin tun. In ihrem Selbstverständnis definierte sie sich über das Wort und damit als Literatin oder als Journalistin bzw. als Reisejournalistin. Die Fotografie verwendete sie als Hilfsmittel, das der
Mechthild Heuser
245
Eigenkreation von Texten scheinbar unanfechtbare bildliche Beglaubigun-gen, Dokumente, zur Seite stellte. Der Zweck der Reise war die Reportagebe-richterstattung und der Zweck heiligte die Mittel, von denen die Fotografie eines war: Einerseits als Dokument, das Textbeiträge illustrierte, andererseits als pragmatisches Instrument, mit dessen Hilfe Kontakte leichter zu knüpfen waren als mit dem Mittel der Sprache.
Augenkontakte sind eindeutiger als Worte, allgemeinverständlicher als eine Fremdsprache, die man zuweilen nur unzulänglich oder gar nicht beherrscht, eine Sprache, die unverstanden bleiben oder missverstanden wer-den könnte, eine Sprache, die dem Fremdsein eine Stimme verleihen würde, unüberhörbar. In der Situation des verbalen Befremdens schaffen emotional aufgeladene optische Eindrücke Verständnisbrücken, Momente der Nähe, die sich mithilfe einer fotografischen Momentaufnahme festhalten lassen. Der durch den Auslöser bediente Kameraverschluss klingt immer gleich, egal wo auf der Welt man sich befindet. Ein kurzes Geräusch, das sich zuweilen im Straßenlärm verliert.
Annemarie Schwarzenbach war eine Reisejournalistin, die fotografiert hat, um ihre Reisejournale durch Bilddokumente zu beglaubigen. Umge-kehrt proportional zu dem Maße, in dem sie ihre Texte überarbeitet und geschliffen hat, betrieb sie die Fotografie flüchtig, in einem dokumenta-rischen Sinne formuliert, so absichtslos wie möglich. Aus fotohistorischer Sicht, gemessen an Ausarbeitungsgrad und technischem Anspruch, gehören ihre Bilder in den Bereich der Amateurfotografie.
Divergenzen zwischen Sprache und Bild
Ich hatte, wie jedermann, Photographien von Baalbek gesehen. Aber man kann Dimensionen nicht photographieren und Erlebnisse der Schönheit und der Vollkommenheit nur unvollkommen vermitteln. (WV:52)
Die Gleichgültigkeit, die Distanz, die Reserviertheit, das Misstrauen gegen-über dem Bild ist ein Phänomen, das man bei Literaten hin und wieder antrifft: Sie konzentrieren ihre gesamte innovative Gestaltungskraft auf die Sprache und erachten die Bilder als der Sprache von vornherein nicht eben-bürtig. So als sei das Bild per se die Realität und damit unbeeinflussbar, die Sprache dagegen als unmittelbare subjektive Hervorbringung allein kreativ beeinflussbar und individuell formbar.
Im Fremden das Vertraute suchen
246
Abb. 7: Zürcher Illustrierte, Einbandrückseite, 26. Juli 1940.Foto Annemarie Klark
Mechthild Heuser
247
Das fotografische Bild wird erst durch den Einsatz eines technischen Appa-rats, der sich als dritte Instanz zwischen Sujet und Autor schiebt, möglich. Die Abfolge präzise geschliffener optischer Linsen, die dem Kameragehäuse angeschlossen werden, wird bis heute ‚Objektiv‘ genannt. Nicht von unge-fähr meint der griechische Wortstamm ‚photo-graphein‘ ein ‚Zeichnen mit Licht‘, und nicht umsonst überhöhte Henry Fox Talbot diese Formel mit seiner Definition der Fotografie als „Stift der Natur“ („pencil of nature“).1 Dahinter ließe sich eine Absicht vermuten, die die mögliche Realitätsnähe der Fotografie gesetzmäßig verankert sehen möchte.
Bis heute liegt in diesem Potential des Realismus ihr größter Trumpf. Aber seit Erfindung der Fotografie 1839 haben ihre Exponenten diesen Trumpf auch immer wieder in Frage gestellt, haben versucht, die Subjekti-vität, die trotz Objektiv möglich ist, mit allen Mitteln der Kunst zu insze-nieren. Immer wieder wurde im Wettstreit mit der Malerei die Nähe zu ihr demonstriert. Man denke etwa an die impressionistisch weichzeichnenden Gummi- und Pigmentdrucke von Julia Margret Cameron im 19. Jahrhun-dert, oder eines Heinrich Kühn und anderer Anhänger des Pictorialismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ähnliches gilt für die Landschaftsfotogra-fie, z.B. für die Städtevedouten eines John Ruskin (man denke an Venedig), die mit den gemalten Vedouten eines Canaletto zu wetteifern versuchten, indem sie die genau gleichen Blickpunkte wieder aufsuchten und nun ins fotografische Bild setzten.
Man denke aber auch und insbesondere an Zeitgenossen Annemarie Schwarzenbachs, deren Fotos sie hätte kreuzen können, an Fotos, die in den Printmedien präsent waren und sich eines künstlerischen Interesses erfreu-ten, wie z.B. die Fotoporträts von August Sander. Wenn Annemarie Schwar-zenbach auf Reisen ging, um die Vielfalt menschlichen Daseins mit der Kamera festzuhalten, so verfolgte Sander ein ähnliches Ziel vor der eigenen Haustür in seiner späteren Heimatstadt Köln.
Vergleichende Fotografie und unmittelbare Beobachtung sind dabei die treffenden Stichworte, die Sanders methodische Vorgehensweise charakte-risieren. Auch er bemüht sich um eine vorurteilsfreie und wirklichkeitsnahe Darstellung. Er selbst sprach von „exakter Photographie“. Statt „aus dem Küchenmädchen eine Dame, aus dem Hausknecht den Diplomaten, aus
1 Fox Talbot, Henry. Der Stift der Natur (1844). Zitiert nach: Kemp 1999:61.
Im Fremden das Vertraute suchen
248
dem Bettler den Heroen und aus dem einfachen Soldaten den Feldherrn“2 zu machen, formulierte Sander sein fotografisches Credo wie folgt:
Bei der Betrachtung meiner Arbeiten bitte ich zu berücksichtigen, dass ich entgegen der üblichen Art bemüht bin, das Charakteristische, das Anlage, Leben und Zeit dem Gesichte eingeprägt haben, auch darin zu lassen, und dass ich daher ähnliche, ausdrucksvolle und charakteristische Portraits liefere, die dem Wesen des Photographierten durchaus entsprechen.3
In diesem Sinne ist es für Sander maßgeblich, seine Kunden in dem ihnen eigenen Umfeld, sei es das Wohnhaus oder der Vorgarten oder der Arbeits-platz oder das Stadtviertel, abzulichten. Explizit kritisiert er das etablierte Vorgehen vieler Studiofotografen, die alle Personen, unabhängig von ihrer „Gesellschaftsklasse in mechanischer Weise […] mit Architektur oder vor mit einer Landschaft bemaltem Hintergrund“4 darstellten. Sein Ziel war es, Menschen ohne Maske (ein weiterer Vortrags- und späterer Buchtitel) ins Bild zu setzen. Das gelingt ihm allein mit den Mitteln der Fotografie, auf deren Bildsprache er vertraut. Diese ist präzise genug, um eine Person minu-tiös zu charakterisieren, ohne das gesprochene oder das geschriebene Wort hinzuzuziehen.
Bilder ohne Worte existieren im Vorstellungskosmos der Annemarie Schwarzenbach nicht. Sie erläutert jedes Bild, das zum Abdruck in eine Illus-trierte oder ein Buch gelangt, mit einer ausführlichen Textstrecke. In Winter in Vorderasien (WV), das im Vorspann als „Reisebericht mit 16 ganzseitigen fotografischen Abbildungen“ angekündigt wird, bleiben die Fotos in ihrer Präsenz schon anteilsmäßig weit hinter dem Text zurück. Sie sind vergleichs-weise kleinformatig abgedruckt, bis zu drei Bildern auf einer Seite, was der Faszination bzw. Lesbarkeit des Fotos eher ab- als zuträglich ist.
Dabei fällt auf, dass ihr Text jeweils deutlich präziser auf Phänomene ein-zugehen vermag, als ihre Bilder. So heißt es in Winter in Vorderasien über die weißen Gebirgsketten des Taurus beispielsweise:
2 Sander, August. Vortrag für den WDR. 1931, Blatt 3. Zitiert nach: Conrath-Scholl 1997:24-32.
3 Ebenda.4 Ebenda.
Mechthild Heuser
249
Wie Traumgebilde steigen sie aus der Ebene empor, den Fuss von Nebel umwallt, die phantastischen Spitzen und Zacken gelb, rosa und schwarz leuch-tend, vom Licht getroffen, das sie wie Metallspiegel zurückwarfen. (WV:40)
Oder, an anderer Stelle, ebenfalls über die gesehene Landschaft:
Als die Sonne nach langer Zeit aufging, war sie wie eine rote Flamme, und man sah nichts mehr. Erst allmählich floss das Licht über die Hügel, sie erglänzten einer nach dem anderen, teilten sich in einen schattigen Abhang und einen glänzenden und folgten weithin wie Wellen aufeinander. […] In einigen Wadis hatte sich während der letzten Regen Wasser angesammelt. Es lag als schwar-zes Auge in den länglichen Brunnen. (WV:87)
In der sprachlichen Formulierung gelingen Annemarie Schwarzenbach ver-bale Schnappschüsse, blitzlichtartig erhellte Momentaufnahmen, die wir in ihrer Fotografie vergeblich suchen.
Wo die fotografischen Bilder allgemeingültig bleiben, ihre Aussage mehr-deutig, bringt erst der Text die gewünschte eindeutig prononcierte Lesart.
Arnold Kübler, einer der wohl bedeutendsten Schweizer Zeitschriftenre-dakteure der 30er und 40er Jahre, seines Zeichens Chefredakteur der Zür-cher Illustrierten, für die Annemarie Schwarzenbach exklusive Bildberichte über ihre Reisen lieferte, bringt dies in seinem Nachruf in der Zeitschrift Du im Jahre 1943 treffend auf den Punkt, wenn er schreibt: „Sie photogra-phierte nicht um des Sehens willen, sondern des Wissens wegen, ihre Bilder gehören als Bestandteile zu Berichten, sind Beweise und Ergänzungen zu Ausgesagtem.“ (Kübler 1943)
Bibliografie
Schwarzenbach, Annemarie. Winter in Vorderasien. Zürich: Rascher, 1934. Clark-Schwarzenbach, Annemarie. Lorenz Saladin. Ein Leben für die Berge. Bern/
Stuttgart: Hallwag, 1938.
Cartier Bresson, Henri. The Decisive Moment. New York: Simon & Schuster, 1952 [Englische Version von Images à la Sauvette].
Conrath-Scholl, Gabriele. Menschen des 20. Jh. – Aspekte einer Entwicklung. Köln: Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, 1997.
Im Fremden das Vertraute suchen
250
Imdahl, Max (Hg.). „Bildautonomie und Wirklichkeit: Zur theoretischen Begrün-dung moderner Malerei“. Wallraf-Richartz-Jahrbuch. Bd. 29, 31 u. 36. Köln: DuMont, 1981.
Kemp, Wolfgang. Theorie der Fotografie I 1839-1912. München: Schirmer/Mosel, 1999.
Kübler, Arnold. „In Sils“. Du. Nr. 3, 1943. S. 28-34.Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur (Hg.). Vergleichende Konzep-
tionen. August Sander, Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, Bernd und Hilla Becher. Ausstellungskatalog. München: Schirmer/Mosel, 1997.
Sander, August. Menschen ohne Maske. Mit einem Text von Gunter Sander und einem Vorwort von Golo Mann. Luzern/Frankfurt/M.: Bucher, 1971.
Steichen, Edward. The Family of Man. Prologue by Carl Sandburg. New York: The Musuem of Modern Art, 1955.
Mechthild Heuser
Inhaltsverzeichnis
Mirella CarboneEinleitung .....................................................................................................
Walter Fähnders Zwischen Biografik und Werkanalyse: Die Schwarzenbach-Rezeption seit den 90er Jahren ..........................
Die Schriften aus Afrika (1941/42)
Sofie Decock/Uta Schaffers›Dann endeten die Pfade, irgendwo zwischen Himmel und Erde, am Weltenrand‹.Apokalyptische Bilder und apokalyptische Struktur in Annemarie Schwarzenbachs Das Wunder des Baums (1941/42)
Goncalo Vilas-Boas›Et maintenant se fait l’unité entre ce qui parle en moi, et le monde du dehors.‹Annemarie Schwarzenbachs Afrika-Texte .............................................
Simone WichorZwischen Literatur und Journalismus.Zur Gattungsproblematik in Schwarzenbachs Reportagen und Feuilletons am Beispiel Afrika .........................................................
Schwarzenbachs Werk im Kontext ihrer Zeit
Heidy Margrit Müller/Kamal Y. Odisho Kolo Verdichtete Bildkraft – Annemarie Schwarzenbachs Erzählung Die Mission über die Massaker von 1915 und 1918 in Urmia .................................
9
19
45
75
99
119
Claudia Röhne›Heimweh nach fremden Gebirgen‹:Heimatentwürfe und die Ambivalenz des Exils in Flucht nach oben .....................................................................................
Sabine RohlfNeue Frauen und feminine Dichter –Annemarie Schwarzenbachs Figuren im Spannungsfeld zeitgenössischer Geschlechterkonstruktionen .....................................
Kira SchmidtMythische Strukturen in Annemarie Schwarzenbachs Tod in Persien ...............................................................................................
Susan Zerwinsky›…am Ende der Welt‹ –Literarische und mediale Imaginationen im Werk von Annemarie Schwarzenbach ..............................................................
Annemarie Schwarzenbach als Fotografin
Silvia HenkeDie Möglichkeit eines Zeichens.Annemarie Schwarzenbachs Beitrag zur Untersuchung von Kultur
Mechthild HeuserIm Fremden das Vertraute suchen –Perspektiven fotografischer Empathie im Werk Annemarie Schwarzenbachs ...................................................
Barbara StempelDie Schweiz in den asiatischen Reiseberichten Annemarie Schwarzenbachs .....................................................................
Franziska BergmannAnnemarie Schwarzenbachs Fotoreportagen über die USA aus Perspektive der Critical Whiteness Studies ......................................
145
165
189
209
219
235
251
279
Georg JägerAnstelle eines Nachwortes. Einige Bemerkungen zu Annemarie Schwarzenbachs Dissertation
Walter FähndersBibliografie der Werke über Annemarie Schwarzenbach (2005-2010) ....................................
Siglen der Werke Annemarie Schwarzenbachs ..........................................
Die Autorinnen und Autoren .......................................................................
291
297
310
311