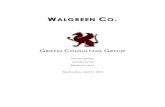Crosscap number two knots in $S^3$ with (1,1) decompositions
Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]
Transcript of Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]
Verbindungslinien
Historische alttestamentlich-religionsgeschichtliche Anstöße zum Christlichen Orient anhand ausgewählter biographischer Fallstudien
Florian Lippke
1. Bemerkungen zur alttestamentlichen Wissenschaft
Die alttestamentliche Wissenschaft1 blickt nach 250 Jahren ihres Wirkens auf
ein beachtliches methodisches Instrumentarium2 zurück, das sich in vielerlei
Hinsicht als Exportschlager herausgestellt hat. So sind in der aktuellen Diskus-
sion um „Form und Gattung“3 sowie um „kommunikationspragmatische Ansät-
ze“4 in Ägyptologie und Altorientalischer Philologie immer wieder Problemfel-
der ausmachbar, die – momentan diskutiert – schon einmal ihre Vorläufer in
der alttestamentlichen Forschungsgeschichte und Diskussionskultur hatten.5 In
besonderem Maße drängen sich in puncto Methodologie zwei Hauptbereiche
auf, die bezüglich ihrer Bedeutung allen anderen systematischen Zugängen
gewissermaßen den Rang ablaufen: Die antike Literaturgeschichte (1.1.) und
die traditionsgeschichtlich-religionsgeschichtliche Analyse (1.2.).
1 Es ist dem Diktum E. Blums zuzustimmen, dass atl. Exegese insgesamt „schon im Ansatz […] ein recht ambitiöses Unterfangen“ darstellt, cf. BLUM (2005),12); cf. zu dieser Einschät-zung auch Anm. 13.2 Cf. die grundlegenden Entwürfe von STECK, UTZSCHNEIDER/ NITSCHE, KREUZER/ VIEWEGER und BECKER, die allesamt in der aktuellen Lehre Berücksichtigung finden. Dass nicht jedes Instru-mentarium gleich als „Methode“ zu gelten hat, ist mit BLUM (2005), 13 festzuhalten.3 Zur Debatte innerhalb der atl. Wissenschaft, cf. (2006). 4 Insgesamt HARDMEIER, sowie IDEM/ HUNZIKER-RODEWALD.5 Allerdings sind diese Fragerichtungen ganz allgemein in den beiden genannten Fächern im-mer noch viel zu selten präsent. Unter anderem fehlt bis zum heutigen Tag eine Gesamtskiz-ze der altägyptischen literarischen Gattungen. Eine Ausnahme (in der altorientalischen Philo-logie!) stellt z.B. bezüglich der Diskussion literarischer Topik der Aufsatz von FUCHS dar. Cf. hier besonders seine Ausführungen zur vermeintlichen Historizität (72): „Ein getreuliches Ab-bild der Wirklichkeit zu bieten, lag niemals in der Intention der Verfasser“, zudem 92 zur Gen-refrage und 9478 zur „Quellengläubigkeit“, außerdem 111 und für die pragmatische Auswer-tung gerade auch unter Berücksichtigung der differierenden Vorstellungen und lebensweltli-chen Zusammenhänge, 115 f. Überaus ertragreiche Ausführungen gerade zu „Form und In-halt“ (!) bieten zudem die Ausführungen von RÖLLIG (1998); (2004).
13
Florian Lippke
1.1. Die antike Literaturgeschichte
Die antike Literaturgeschichte ist vor allem durch zwei Hauptkomponenten be-
stimmbar: Die erste Komponente ist die deskriptive6. Gerade in Bezug auf die
Frage, wie Literatur „funktioniert“ und welchen Kommunikationsaspekten7 sie
unterworfen ist, hat sie vornehmlich Antwort zu geben. Aber auch die damit im-
plizierten Fragestellungen, welche Gattungen8 existier(t)en und Verwendung
fanden, müssen in diesem Rahmen verhandelt werden. Ebenso muss die Ver-
hältnisbestimmung von Textbezeugung und Aussagewert9 reflektiert werden.
Mit anderen Worten: Was wird auf welche Weise zum Ausdruck gebracht und
welche Sachverhalte werden nicht thematisiert? Die Beantwortung literaturge-
schichtlicher Fragen kann natürlich nie ohne das Korrektiv der Taphologie/ Ta-
phonomie betrieben werden.10 Zugleich kann eine Literaturgeschichte keines-6 Diese hat ihrem Wesen nach auch komparatistisch zu verfahren, cf. für die ntl. Exegese programmatisch DORMEYER.7 Es sei hier nur in Aufnahme des sog. kommunikativen Handlungsspiels (KHS) auf die gene-relle Frage der (kommunikations)pragmatischen Einordnung literarisch überlieferter Traditi-onsliteratur verwiesen; cf. zudem die Klassifizierung der atl. Literatur als „adressatenbezoge-ne Mitteilungsliteratur“ bei BLUM (2005), 30.8 Gerade hier ist auf H. Gunkel und den von ihm geleisteten Beitrag zur literaturgeschichtli-chen Erforschung des Alten Testaments hinzuweisen, cf. später 3.2. 9 Hier muss die biblische Literatur gerade zwischen den Polen „heiliger, kanonisierter, (wo-möglich inspirierter) Text“ und „nordwestsemitisches Corpus von Traditionsliteratur des 1. Jt. v. Chr.“ umsichtig positioniert werden. Die betrachteten Texte sind in den seltensten Fällen exklusiv das eine oder das andere. 10 Es ist also mithin die Frage zu traktieren, welcher Anteil der Gesamtliteratur der „alttesta-mentlichen Zeit“ (wie breit man sie auch im Einzelfall jeweils bestimmen mag) überhaupt im Corpus des alttestamentlichen Kanons entgegentritt. Die Kehrseite der Medaille lautet natür-lich: Was ist verloren gegangen? Im Rahmen der nordwestsemitischen Epigraphik des 1. Jt. v. Chr. (cf. KAI) ist diese Frage beinahe mit verheerenden Implikationen zu beantworten, da hier wohl nur ein einstelliger Prozentbereich erhalten geblieben ist: Zu gering ist die Anzahl der beschrifteten phönizischen, aramäischen, transjordanischen und hebräischen Denkmäler im Vergleich zu den Mengen an beschrifteten Papyri/ Pergamenten, die durch widrige Witte-rung und klimatische Faktoren verlorengegangenen sind. Trotz alledem gliche aber eine Ge-ringschätzung der epigraphischen Funde einem Ausschütten des Kindes mit dem Bade; sie stellen einen einzigarten Schatz semitischer Überlieferung dar. Im Rahmen der alttestament-lichen Traditionsliteratur könnte die quantitative Abschätzung des erhaltenen Materials grö-ßer ausfallen, bleibt aber ein hochspekulatives Unterfangen. Qualitativ hingegen muss wohl literaturwissenschaftlich von einer (mehr oder weniger) zufälligen Erhaltung des Belegmateri-als ausgegangen werden: Zwar unterliegen die atl. Texte reflektierten Redaktionsprozessen, aber die inhaltliche Zusammensetzung des überlieferten Schriftgutes ist nicht repräsentativ. Es fehlen überaus wichtige und bekannte Gattungen; noch zufälliger ist die sprachliche Zu-sammensetzung des Materials. Gerade weil das überlieferte Material nur einen Bruchteil der Literatur der atl. Epochen umfasst, ist selbst ein prima vista signifikanter Befund wie einem hapax legomenon, zunächst auf die Quellensituation zurückzuführen. Ebensowenig darf aus
14
Verbindungslinien
falls im Deskriptiven verharren. Gerade auch weil dem zur Diskussion stehen-
den Bezugsgegenstand (dem Alten Testament) in vielerlei Hinsicht ein hetero-
gener Charakter11 attestiert werden muss, sind diachrone Lösungswege zu for-
mulieren. Diesem Plädoyer für das Nachvollziehen der historischen Entwick-
lung muss zugleich die Forderung nach einer methodisch-kontrollierten Erhe-
bung der entsprechenden Entwicklungsstufen zur Seite gestellt werden.
Hiermit ist zugleich ein ganz wesentlicher Aspekt der literarkritischen und redakti-onsgeschichtlichen Diskussionen angesprochen. Eine Problemanzeige12 ist hier notwendig: Überlieferungsgeschichte und „Formgeschichte“ zogen beide nach be-deutenden Blütezeiten eine Diversifikation durch zahlreiche heterogene Ergebnis-se nach sich, in deren Verlauf der jeweilige Methodenschritt auch Einbußen an Plausibilität zu verzeichnen hatte.13 Dies lässt sich an der Rückfrage leicht er-schließen, welcher Exeget heute noch aktiv überlieferungsgeschichtliche Studien mit Vorstufenrekonstruktion betreibt.14 Eine Standortbestimmung der redaktionsge-schichtlichen Forschung wäre hier gleichfalls von Nöten. Zum einen wird sie als Universalmethode proklamiert15, zum anderen häufen sich die zahlreichen Einzel-untersuchungen, die untereinander nicht mehr kompatibel zu sein scheinen. Gera-de das Letztgenannte muss den Blick auf die methodischen Grundlagen ins Zen-trum rücken: Ein Vorher und Nachher unterschiedlicher Verse, Kapitel und Bücher
zwei oder drei Belegen eines Wortes im Kanon eine Bezugnahme, ein intertextuelles Verhält-nis der entsprechenden Verse und Kapitel zwingend geschlossen werden. Diese Engführung hat, trotz ihrer moderaten Plausibilität, an zahlreichen Stellen in der Sekundärliteratur er-staunliche Blüten getrieben. 11 Redaktionsgeschichtliche Prozesse, die plausibel nachweisbar sind, können an vielen Stel-len als gesichert gelten. Eine enge gegenseitige Bezugnahme der Kategorien synchron und diachron aufeinander und ihre wechselseitige Verwendung, cf. BLUM (2004), muss als unhin-tergehbar für eine „atl. Exegetik“, cf. (2005), besonders 39 f. gelten. 12 Diese lässt sich verallgemeinern: „Die alttestamentliche Exegese hat ein strukturelles Pro-blem, das jeweils beim Verlust vermeintlicher ‚Selbstverständlichkeiten’ unübersehbar durch-schlägt. Dieses Strukturproblem beruht auf der Kluft zwischen einem hochgesteckten Erklä-rungsanspruch und einer defizienten Datenbasis“, cf. (2005), 11 f. Dabei „verdeckt“ die „un-bestritten große (historische) Tradition (der Methode) den Blick auf gewisse Defizite“, ebd. (Zusätze FL). 13 „Die sog. Formgeschichte ist bei Alt und Noth ansatzweise und bei ihren Nachfolgern ganz zu Tode geritten worden“, so DONNER I,30 f., cf. zudem die Hinweise auf die formgeschichtli-che Forschungsgeschichte bei BLUM (2006), 85 f. Die Donnersche Einschätzung ist zu teilen; die genannten Exponenten sind gleichwohl in anderen Fachbereichen mit bedeutenderen und immer noch hochzuschätzenden Ergebnissen hervorgetreten. 14 Zur Sache, cf. (2005), 26.15 Es ist zumindest möglich die Ausführungen von R.-G. Kratz in dieser Hinsicht zu lesen, cf. KRATZ. Hingegen ist auch das Votum (2005), 14 zu berücksichtigen: „Sobald ‚Redaktionsge-schichte‘ zur ‚Methode‘ geworden ist, stellt sie bereits eine Fehlentwicklung dar, insofern ein denkbares diachrones Modell zu einer Selbstverständlichkeit, d.h. zu einer apriorischen Vor-aussetzung gemacht ist“, cf. hierzu auch die im Anschluss an dieses Zitat präsentierte Eng-führung im Rahmen der Prophetenexegese.
15
Florian Lippke
im atl. Schrifttum ist unbestritten. Ein Erklärungsmodell (von seiner Prägung durchaus durch die deutsche Wissenschaftskultur beeinflusst) begibt sich auf die Suche nach Redaktoren und ihren Spuren im Text. Dabei ist aber der methodische Weg durchaus nicht unproblematisch: Eine Redaktionsschicht kann überhaupt nur dann erst wahrgenommen werden, wenn der vermeintliche Redaktor dies nach-vollziehbar kenntlich machte.16 Mit anderen Worten: Ein Redaktor, der angleichend einen kohärenten Text aus mehreren Quellen produziert, kann mit dem Instrumen-tarium nicht erfasst/ beschrieben werden. Jenseits der Nachweisgrenze bleiben in diesem Fall Textkürzungen – durchaus nicht unplausible Szenarien.17 Damit wird das Entwicklungsmodell eines Textes auf Fortschreibungen reduziert. Diese Aspekte, die insgesamt eine Systemschwäche bedingen, können allerdings nicht durch eine Intensivierung der kritischen Haltung des Exegeten ausgeglichen wer-den. Zu schnell mündet eine solche gesteigert hyper-kritische Haltung in einen Of-fenbarungspositivismus hinsichtlich der eigenen Methode.18 Dies gipfelt in Postula-ten, dass jeder Text Brüche enthalten muss, die man auch allesamt vollständig auffinden und entschlüsseln könne.19 Gerade das Gegenteil scheint aber der Fall
16 Die Suche nach diesen Indikatoren ist bei weitem noch nicht abgeschlossen, geschweige denn schon wirklich systematisch in Angriff genommen worden. Entwürfe von ZAKOVITCH (1992/3); (2004a); (2004b) und (2010) weisen auf eine Ableitbarkeit der Indikatoren aus der rabbinischen Tradition hin; man muss hierin wohl einen alt-neuen Schlüssel zum Verständnis der biblischen Schriften sehen, der auch die klassischen Definitionen der stilistischen For-men inclusio und concatenatio beeinflussen dürfte. 17 Cf. auch BLUM (2005),16.19–20.22 besonders mit den Anm. 24.32.18 Ein Doppeltes ist dieser Tendenz entgegenzuhalten: Erstens zeigt sich bei einer Vielzahl der detailliert-redaktionsgeschichtlichen Arbeiten, dass die erbrachten Ergebnisse (zu Ur-Schicht, Grundschicht etc.) mindestens so inkohärent sind, wie der ursprüngliche Ausgangs-text, der Endtext. Zweitens muss das Postulat der absoluten Stringenz von Texten, das ein anachronistisches Postulat darstellt, enttäuscht werden; cf. hierzu LIPPKE [im Druck]. Die Ver-anschlagung von „störenden“, „unpassenden“ oder nachträglich „schlecht“ eingefügten Stücken, ist im letzten Sinn vielleicht gar nur ein Niederschlag der defizienten Texttheorie, die als Axiom nicht hinterfragt wird. Mit BLUM (2005), 159 ist zu postulieren: „Je mehr es (…) um Fragen des kulturellen und einzelsprachlichen Stilempfindens geht, ist sehr wohl mit diver-gierenden Maßstäben zu rechnen.“ 19 Es ist durchaus möglich, die Ausführungen von BERNER insgesamt, im speziellen aber ge-rade 68 (erster Abschnitt) in diesem Sinne zu verstehen. Jedoch ist die Plausibilität seiner Ergebnisse kritisch zur Diskussion zu stellen: Achtzehn diachrone Schichten (so 341) in der Exodus-Erzählung (Ex 1-18!) zu vermuten, ähnelt dem Versuch von W. SCHMITHALS (21965), aus dem 1. und 2. Korintherbrief Brief sechs (später (1973), neun (!)) separate Briefe zu identi-fizieren; zur Sache ZIMMERMANN 93; noch deutlicher im Übrigen der spätere Hinweis von Schmithals auf die dreizehn! ursprünglichen Briefe, bei PROBST 10 ff., besonders 13. Berner verharrt allerdings nicht bei dieser Schichtenanzahl sondern fügt noch Unterschichten (+ und ++) hinzu. Gänzlich unübersichtlich wird die Analyse, wenn Berner angibt, dass unter den einzelnen Kapiteln seines Buches (zur Exoduserzählung) keine einheitliche Schichtenbe-zeichnung existiert: „Schicht I in Kap II. ist also nicht mit Schicht I in Kap III identisch“ (9). Eine private Mitteilung von W. Oswald erwähnt eine Gesamtbilanz von ca. 360 literarkriti-schen Brüchen, die Berner in achtzehn Kapiteln identifiziert haben will. Ich bin für diesen Hin-weis dankbar.
16
Verbindungslinien
zu sein.20 – Auch zeichnet sich an vielen anderen Stellen das Problem einer me-thodischen Engführung ab: Intertextualitätsphänomene und vermeintliche Brüche werden in der Vielzahl der Fälle diachron ausgewertet. Dabei wird sehr häufig von Zitierverhältnissen gesprochen, ohne dass dies näher begründet wird. Andere Op-tionen und Entstehungsmodelle werden sehr häufig vernachlässigt.21 Dabei ist zu beobachten, dass immer häufiger die vermeintlichen „Verstöße“ gegen die ana-chronistische Projektion eines einheitlichen Textes, grundsätzlich zu Lasten der Tradenten gehen. Diese seien nicht qualifiziert im Tradentenhandwerk, könnten kein Hebräisch, verfügten nicht über die Fähigkeit glatte Anschlüsse zu bilden. Ein reflektiertes Verständnis der atl. und ao. Traditionsprozesse muss sich zuvorderst von der (häufig nur impliziten) Herabwürdigung des Tradenten befreien, um sich neu zu orientieren.
Literaturgeschichtliche Entwürfe begegnen in den beiden aktuell den Markt do-
minierenden Einleitungswerken22; zudem ist der Gesamtentwurf von SCHMID
hervorzuheben. Das letztgenannte Werk kann als vorbildliche literaturge-
schichtliche Aufarbeitung bezeichnet werden und trifft in der überragenden
Mehrheit der Fälle sicherlich die sinnvollsten Positionen. Ganz generell zeigt
sich beim Verfasser auch eine Behutsamkeit in Bezug auf redaktionsge-
schichtliche Thesen und die methodische Verankerung überzeugt. Zugleich
darf dieses Positivbeispiel aber nicht über die oben angedeutete und ansons-
ten weit verbreitete Methodenschwäche hinwegtäuschen.23 Alte Fragenkom-
plexe stehen wieder zur Disposition: Wie lassen sich die Entwicklungsstufen
nachweisen? So fallen unter anderem auch gerade Numerus- und Personen-
wechsel24 für die Kriteriologie25 häufig aus. „Störend“ oder „unpassend“ emp-
20 Damit müsste auch die „heuristische[] Vorordnung der Fokussierung auf Indizien diachro-ner Uneinheitlichkeit (zu Gunsten) vo[n] Lesungen, die sich ganzheitlich auf einen Text ein-lassen“ relativiert werden; Zitat bei BLUM (2005), 23, leicht adaptiert.21 SOMMER stellt eine rühmliche Ausnahme dar; zum Zitationsverhältnis, cf. 21–30.22 ZENGER; GERTZ/ BERLEJUNG/ SCHMID.23 Dabei stammen die Überlieferungen, die sich als Test- und Modell-Fälle zur literar- und re-daktionsgeschichtlichen Arbeit anbieten, nicht nur aus dem atl. Bereich (Könige- und Chro-nikbücher). Gerade auch die synoptische Evangelien-Überlieferung, die Textfunde von Qum-ran, das Jubiläenbuch und Tatians Diatessaron bieten sich als Analyseobjekte an! Damit sind als Testcorpora explizit auch die für den christlichen Orient relevanten Werke angesprochen. Die ersten Untersuchungen sind bei BLUM (2005), 17-20 und 24 zusammengefasst: Eine Vor-stufenrekonstruktion der schriftlichen Vorlagen im Wortlaut ist aus den genannten Corpora nicht möglich (bes. (2005), 19)! Die immer wieder vorausgesetzte Selbigkeit des Textes ist nicht gegeben. 24 Aber auch die häufig für diachrone Schichtungen vereinnahmte Apposition steht hier zur Diskussion, cf. den Appendix zu diesem Artikel mit Beispielen und Anmerkungen. 25 Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass Einheitlichkeit/ Uneinheitlichkeit das diachrone Wachstum eines vorliegenden Textes anzeigen können (cf. das Beispiel bei (2005), 21 zu Ri
17
Florian Lippke
fundene Passagen können nicht als Kriterien herangezogen werden, muss ih-
nen doch als anachronistisches Geschmacksurteil oder als Präsupposition26,
wie ein Text zu funktionieren habe, ein ambivalenter Wert zukommen. Die me-
thodische Rück- und Gegenfrage nach alternativen Erklärungsoptionen und
deren Plausibilität muss axiomatisch in der Methode verankert werden.
1.2. Die Traditionsgeschichte (mit dem Spezialfall der Religionsgeschichte)
Mit diesem Bereich öffnet sich ein weites Feld. Die traditionsgeschichtliche Ar-
beitsweise hat sich im Rahmen der Lehrbücher zur atl. Exegese gut etabliert.
Neben den neueren Entwürfen, die sich mit der Thematik auseinanderset-
zen27, ist vor allem der bekannte §8 bei Steck28 zu nennen, der als Grundlage
für die methodischen Implikationen zu gelten hat. In jüngster Zeit tritt auch das
Methodenbuch von Utzschneider/ Nitsche §6 mit den entsprechenden Ausfüh-
rungen in den Vordergrund.29 Eine Option kann sein, dieses von Steck ange-
stoßene Verfahren detaillierter fortzuführen: Hierfür stehen die sinnvollen,
wenn auch sehr detaillierten Definitionsversuche weitreichender Termini wie
„Konzept, Type, Token, Frames, Skripte und Schemata“30. Auf der anderen
Seite ist es aber notwendig, einen zusätzlichen Fragehorizont intensiver mit-
einzubeziehen. Wenn die religionsgeschichtliche Erforschung zu den zentralen
Aspekten der atl. Wissenschaft gehört31, dann muss die Berücksichtigung der
religiösen Symbolsysteme von besonderer Bedeutung sein. Dies ist mit KEEL/
6). Sie können aber genauso gut auch unabhängig von diachronen Aspekten eines Textes auftreten, zum Beispiel bei tiefgreifenden Transformationsprozessen, cf. (2005), 25, zu 1 Kön 17. 26 Die gravierendsten Vorannahmen betreffen aber, wie angedeutet, Signifikanz und Suffizi-enz (hierzu pointiert (2005), 15). 27 KREUZER/ VIEWEGER unter 7. (88–95), BECKER unter 7. (119–133).28 STECK 126–149.29 UTZSCHNEIDER/ NITSCHE 187–212.30 Cf. KRÜGER.31 Cf. so insgesamt JBTh 10 (1995) mit seiner programmatischen Frage „Religionsgeschichte Israels oder Theologie des Alten Testaments?“ und vor allem JANOWSKI (2005b), mit den ent-sprechenden Unterkapiteln „I.2. Religionsgeschichte Israels als ‚zusammenfassende Diszi-plin‘“ und dem graphischen Schema, 97, sowie „II. Argumente für eine integrative Perspekti-ve“ im Rekurs auf Koselleck, Geertz u.a., v.a. aber auch unter Berücksichtigung des Sche-mas zur JHWH-Königs-Vorstellung, 109, und der komparativen Gegenüberstellung, 111 f.
18
Verbindungslinien
UEHLINGER32 zu fordern,33 kann aber hier nicht en détail dargelegt werden. Je-
doch scheint es notwendig, holzschnittartig die Schlagworte und die dazuge-
hörigen Exponenten (im Sinne des portraithaften Charakters der Studie) wie-
derzugeben. Zumindest fünf Meilensteine müssen Berücksichtigung finden.34
a. Ernst Cassirer35 betrieb mit besonderem Eifer das Projekt der „Philosophie
der symbolischen Formen“, welches einen erweiterten Kultur- und Mythosbe-
griff in die Diskussion einbrachte. Indem er unterschiedliche Bestandteile der
menschlichen Sphäre definierte, die allesamt zur Kultur und zum Mythos bei-
tragen, ermöglichte er neue Sichtweisen: Die wesentlichen Aspekte des Le-
bens sind nach seiner Auffassung nicht isoliert voneinander gegeben. Die Ver-
bindungen zwischen den Sektoren und ihre Wechselwirkungen sind von emi-
nenter Bedeutung für die Vorstellungswelt, für die Deutung von Geschehnis-
sen, letztlich auch für die Bewältigung von Rückschlägen. Im Wortlaut:„Sprache, Mythos, Religion, Kunst, Wissenschaft, Geschichte sind die Bestandteile, die verschiedenen Sektoren dieser Sphäre. Eine ‚Philosophie des Menschen‘ wäre daher eine Philosophie, die uns Einblick in die Grundstruktur jeder dieser verschiedenen Tätig-keiten gibt und uns zugleich in die Lage versetzt, sie als ein organisches Ganzes zu ver-stehen.“36
Damit kann dem Ansatz von Cassirer durchaus ein Interesse am holistischen,
umfassenden Menschenbild attestiert werden.37 Das Axiom der Verbundenheit
stellt sich bei Cassirer zudem mit folgendem Zitat deutlich dar, bei dem unter
Aufnahme von Goethes Faust postuliert wird:
32 KEEL/ UEHLINGER 2.8.9.457.33 Cf. auch hierzu LIPPKE (2010), 579.34 Cf. zu dieser Auswahl auch schon die stichwortartige Nennung der Exponenten im Rah-men der Diskussion um die Symbolsysteme der levantinischen Bronzezeiten, cf. (2011), 211 f. und auch der kurze Vermerk im Rahmen der ägyptisch-theologischen Schöpfungsvorstel-lungen bei [im Druck]. Die hier gemachten Ausführungen dienen der Klärung der jeweiligen spezifischen Anliegen durch eine Zitatauswahl und durch die Verortung im Kontext der Se-kundärliteratur. Sie versuchen die bisherigen Stichwortnennungen zu fundieren. 35 Geboren am 28. Juli 1874 in Breslau, gestorben am 13. April 1945 in New York.36 CASSIRER 110, so auch zitiert bei MAURER 18ff. und bei BEVC 37; s. auch die Einordnung bei ROHLS II, 332f.473–475; UEHLINGER (2005a), 38f; FREY (1997), 261; JANOWSKI (1989), 20–23; (2001a), 14–18 in Bezug auf das Weltbild (cf. auch 2.2c im vorliegenden Beitrag); im Kontext von Ps 31 (2006), 51; früher mit ersten Anstößen auch GESE 202–222; im aktuellen Diskurs zudem HARTENSTEIN (1997), 15–17 und (2008), 18. 37 Eben dies macht seine Ergebnisse so anknüpfungsfähig für die biblischen Wissenschaften, da auch gerade dort die Bedeutung des „ganze(n) Menschen“ immer klarer vor Augen tritt und inzwischen deutlich artikuliert wird (cf. JANOWSKI (2010); (2012)).
19
Florian Lippke
„Jetzt schlägt in der Tat ein Schlag tausend Verbindungen, die alle in der Setzung des Zei-chens zum mehr oder minder kräftigen und deutlichen Mitschwingen gelangen.38
Mit diesen Setzungen bilden Cassirers Erkenntnisse den Ausgangspunkt für
alle weiteren in diesem Abschnitt diskutierten Gelehrten und deren Modelle.
b. Fernand Braudel39, der Exponent der Annalles-Schule, mit seinem Blick auf
weite traditionsgeschichtliche Verbindungslinien, hat sich stets für den weiten
Fokus ausgesprochen. Dieser Fokus tritt deutlich in seinem mehrbändigen
Werk „Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II.“ her-
vor. Nicht die Einzelereignisse konstituieren Geschichte; es kommt vielmehr
auf die basalen Strukturen und die darin wirkenden grundlegenden Gesetzmä-
ßigkeiten an. So kann Braudel pointiert ausführen, dass für das Verständnis ei -
ner konkreten Kultur die allgemeinen Bedingungen, unter denen sie funktio-
niert und die ihr besonderes Gepräge wesentlich mitbestimmen, wichtiger sind
als einzelne Ereignisse. Teil dieser Bedingungen sind die zentralen sozialen,
politischen und religiösen Zeichen40, die viel länger andauern als einzelne Er-
eignisse und Herrscher. Diese Bedingungen ermöglichen überhaupt erst das
Funktionieren ihrer Herrschaft und damit bedingen sie die von ihnen bewirkten
Ereignisse. Im Wortlaut äußert sich Braudel über die – seiner Meinung nach –
oberflächliche Ereignisgeschichte (histoire événementielle) und über ihre
grundlegende Größe (das Ereignis):„Ereignisse sind Staubkörnchen: sie blitzen kurz im Lichtstrahl der Geschichte auf und fal-len alsbald dem Dunkel und häufig der Vergessenheit anheim.“41
38 Zitiert bei SCHWEMMER 58, siehe auch PEDERSEN 123 und BRAUN/ HOLZHEY/ ORTH 80. Zu er-wähnen ist, dass sinnvoller Weise beide Zitate inzwischen auf der Plattform wikipedia nach-weisbar sind, wenn auch dort nur mit dem Verweis auf die Hamburger Ausgabe bei Meiner. 39 Geboren am 24. August 1902 in Luméville-en-Ornois, gestorben am 28. November 1985 in Cluses.40 Cf. hierzu gerade Cassirer im vorherigen Abschnitt. 41 BRAUDEL (III),13. Allerdings kann man Braudel nicht ohne weiteres Aversionen gegen „Er-eignisse“ schlechthin unterstellen. Dies beweist schon die Weiterführung des Zitats: „Jedes Ereignis aber, so kurzlebig es sein mag, erhellt ein Stückchen der Geschichtslandschaft und bisweilen auch ein großes Panorama. Nicht nur ein politisches Panorama, denn auf jedem Teilgebiet - Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, sogar Geographie - gibt es dieses Ereig-nisgeflimmer, diese aufblinkenden Stäubchen.“ (ebd.) Im weiteren Verlauf verwehrt sich Braudel gar gegen den Vorwurf, „von vornherein etwas gegen das Ereignis“ zu „haben“.
20
Verbindungslinien
Die Implikationen von Braudel sind auch in der aktuellen theologisch-religions-
geschichtlichen Forschung präsent und werden in die Reflexionsprozesse ein-
gebunden.42
c. Als dritter Forscher ist Clifford Geertz43 zu nennen, der mit dem Instrument
der dichten Beschreibung bzw. der dichten Interpretation (thick description) die
symbolischen Formen Cassirers zu einem pattern, zum religiösen und kulturel-
len Symbolsystem, erweiterte. Diese dichte Beschreibung versucht durch un-
terschiedliche Zugangsweisen das Verständnis eines Phänomens und des da-
hinter liegenden Symbolsystems zu erhellen: Alle zur Verfügung stehenden
Quellen müssen befragt werden, um ein möglichst44 umfassendes Bild zu er-
halten. Denn schon die zu untersuchenden Gegenstände kommen nicht linear,
vollkommen geordnet oder gar kohärent dokumentiert auf uns. Gerade des-
halb wäre die Reduktion auf eine Informationsquelle (z.B. die schriftlichen
Überlieferungen) eine problematische Engführung.45 Umso weniger ist dies für
die mannigfachen Verbindungen zwischen mehreren Gegenständen und Vor-
stellungen der Fall. Denn auch hier gilt:
42 So ist der Hinweis für die Arbeit mit Bildquellen in IPIAO I, 26, aber auch bei SCHROER 9 und bei KEEL/ UEHLINGER 5 zu finden; cf. auch JANOWSKI (2001c), 30 f. mit dem weiterführen-den Verweis auf den Braudelschen Aufsatz „Geschichte und Sozialwissenschaften. Die lange Dauer“ und die Implikationen bei Koselleck. METTINGER 201115 fasst in seinem Plädoyer zum Anikonismus die Grundelemente des Braudelschen Systems zusammen. UEHLINGER (1995), bietet ein umfängliches und gelungenes Referat der Drei(!)teilung der Geschichte, 61 f. gera-de auch mit dem treffenden Verweis auf H. und M. Weippert sowie A. Alt (Anm. 19 f.); in der aktuellen Diskussion ist Braudel auch bei LEUENBERGER 74 präsent, cf. dort die weitere Litera-tur. 43 Geboren am 23. August 1926 in San Francisco, gestorben am 30. Oktober 2006 in Phil-adelphia; cf. zur Wirkung seiner Ansätze die Nennung bei JANOWSKI (2003), 29 f., besonders 32, RONNING 12 und ZENGER 163, KEEL/ SHUVAL/ UEHLINGER XI, KEEL/ UEHLINGER 7, UEHLINGER (2005a), 40; für die anthropologischen Diskussionen, REINHARD 79 f., JANOWSKI (2005a),169 f., cf. auch Anm. 37; zudem ist der Rekurs auf Geertz auch bei BERLEJUNG 19, PEZZOLI-OLGIATI 381 und LEUENBERGER zur Methodik der Quellennutzung ao. Bilder (71) nachgewiesen; cf. im anderem Kontext auch SEEBA, vor allem 53 f.44 Es gilt auch hier wiederum das Korrektiv durch Taphonomie/ Taphologie, cf. Anm. 11.45 Die „pluri-mediale kulturgeschichtliche Rekonstruktion“ besitzt somit Maximenwert. Zu die-sem Begriff, wie auch zum gesamten Abschnitt über Geertz, cf. UEHLINGER (2005b), 156, be-sonders auch die forschungsgeschichtlich aussagekräftige Fußnote 23. Der dort postulierten Korrelation von „thick description“ und „Kontextualisierung“ ist in gleichem Maße uneinge-schränkt zuzustimmen.
21
Florian Lippke
“in a multiplicity of complex conceptual structure, many of them superimposed upon or knotted into one another, which are at once strange, irregular, and inexplicit, and which (…, erg. one) contrive somehow first to grasp and then to render.”46
Mit anderen Worten: Komplexe überlappende Strukturen benötigen ein ganzes
Methodenarsenal, um umfassend, adäquat und damit dicht beschrieben zu
werden. JANOWSKI hat in einer fokussierten Darstellung47 die wichtigsten The-
sen aus Geertz‘ Werk destilliert und mit der weiterführenden Sekundärliteratur
ins Gespräch gebracht: Anhand der einschlägigen Stellen bietet er Definitio-
nen der Begriffe Kultur, Symbol, kulturelles System und Religion. Das Kernmo-
dell, bestehend aus den genannten Begriffen, vermag er höchst produktiv mit
den Anliegen der Theologie Alten Testaments zu verbinden. Dies geschieht un-
ter Wahrung der integrativen Funktion, genauer durch Integration der religions-
geschichtlichen Aspekte, für die Geertz‘ System Anwendung findet (wiederum
108).
Nur angemerkt sei, dass somit eine Bewältigungsstrategie für Zeiten der An-
fechtung durch ein funktionales und adaptionsfähiges Symbolsystem geradezu
katalysiert wird.
d. In der forschungsgeschichtlichen Würdigung der langen Traditionsbögen ist
im Folgenden auf Maurice Halbwachs48 zu verweisen. Seine Entdeckungen
waren wegweisend für die Erforschung des kollektiven/sozialen bzw. kulturel-
len Gedächtnisses49. Mit diesen Begriffen kommen die überindividuellen
Aspekte der Traditionstransmission ins Blickfeld:„Es gibt kein mögliches Gedächtnis, außerhalb derjenigen Bezugsrahmen, deren sich die in der Gesellschaft lebenden Menschen bedienen, um ihre Erinnerungen zu fixieren und wiederherzustellen.“50
46 GEERTZ 10.47 UEHLINGER (2005b), 108 f.48 Geboren am 11. März 1877 in Reims, am 16. März 1945 im KZ Buchenwald ermordet; cf. zur wissenschaftlichen Würdigung ERLL 7. 49 Recht treffend weist DE HULSTER 58 auf Halbwachs hin, ebenso wie auf die Verbindungen zur Forschung von A. und J. ASSMANN. Hingegen wird bei de Hulster der Konstellationsbegriff im entsprechenden Kapitel „3.5.2 Linking text and image in culture“ nur sehr locker einge-bunden. Die Tragkraft des Begriffs wird leider nicht deutlich. Zur aktuellen Bedeutung im Kontext der Erinnerungstheorie, cf. die Hinweise/ Nennungen Halbwachs bei MARKSCHIES/ WOLF 10 und zudem die Ausführungen von BIEBERSTEIN (86) im gleichen Band. 50 HALBWACHS 121, insgesamt auch zur Kontextualisierung des Zitats bei ASSMANN (32000), 34f. Zur forschungsgeschichtlichen Einordnung BIEBERSTEIN 507.
22
Verbindungslinien
Gerade weil das Gedächtnis nicht ausschließlich im Individuum „codiert“ wird,
und damit über den individuellen Tod hinaus Informationen transzendiert wer-
den, fügen sich die Theorien von Braudel und Halbwachs so trefflich zueinan-
der. Halbwachs Thesen stellen in gewisser Weise die mnemologische Variante
des Braudelschen Systems dar.51
e. Als letzter in dieser Reihe muss Jan Assmann52 Erwähnung finden, der
durch die Rezeption und Weiterführung der Halbwachsschen Ideen die Bedeu-
tung des kollektiven Gedächtnisses für die Antike (besonders für Ägypten)
plausibilisierte. Als seine besondere Leistung gilt nach wie vor, die sehr spezi-
ellen und zum Teil nicht-systematisierten Aussagen Halbwachs‘ in ein sehr kla-
res und verständliches System gebracht zu haben.53 Damit hat er dieses Ge-
dankengut in gewissem Maße für die weitere Erforschung überhaupt erst akti-
viert und verfügbar gemacht.54 Insgesamt sind es mindestens drei Werke, mit
denen A. und J. ASSMANN die Ideen Halbwachs‘ weiterentwickelt55 haben. Hier-
bei sind die beiden Zitate, die MAURER einführend nennt56, ganz hervorragend
geeignet, um die Verbindungen mit den zuvor diskutierten Exponenten aufzu-
weisen: „Alles spricht dafür, dass sich um den Begriff der Erinnerung ein neues Paradigma der Kulturwissenschaften aufbaut, das die verschiedenen kulturellen Phänomene und Felder – Kunst, Literatur, Politik und Gesellschaft und Recht – in neuen Zusammenhängen sehen lässt.“57
51 Es gilt hier natürlich gleichwohl die folgerichtige Einordnung, die DIETRICH 937 erörtert: Ohne Individuen, die sich erinnern, ist das Modell nicht funktionstüchtig. 52 Geboren am 7. Juli 1938 in Langelsheim.53 Es stellt sich an diesem Punkt allerdings die Frage, in welchem Maße sich die Assmann-sche Darlegung wirklich nur als popularisierte und systematisierte Übersetzung der Halb-wachsschen Ideen verstehen lässt. Für eine sehr umsichtige Analyse s. die vergleichenden Ausführungen bei BARSTAD 2–5 mit dem Untertitel „Assmann and the Hebrew Bible“, in dem er durchaus Unterschiede gegenüber Halbwachs zu benennen weiß. 54 Für die differenzierte Aufnahme in den theologischen Disziplinen, cf. JANOWSKI (2001b) ins-gesamt, aber mit einem fokussierten Beispiel 2305. Zur Aufnahme und Kontextualisierung, cf. auch die Einleitungsparagraphen bei MENDELS 143 f., bei LE DONNE 163 f.169 und insgesamt DUNN. 55 ASSMANN (2004); (2006); (32006b); (2007).56 (2008), 33 f.57 (32000), 11, cf. zudem auch SANDEL bes. 90–95 und PATZEL-MATTERN 23–48.
23
Florian Lippke
Assmanns „Phänomene und Felder“, die er in Aufzählung erwähnt, sind dem
aufmerksamen Leser der Cassirerschen Äußerungen schon geläufig. Ass-
manns erklärtes Programm ist es folglich, die „Sektoren“ (Cassirer) der Sym-
bolischen Formen mit Hilfe des Erinnerungsbegriffes zusammenzubinden. Da-
bei fungiert die Erinnerung als konnektives Element und hermeneutischer
Schlüssel zu den einzelnen Bereichen. Der Begriff konnektiv ist in diesem Fall
ein von Assmann bereitgestellter: „Jede Kultur bildet etwas aus, das man ihre konnektive Struktur nennen könnte. Sie wirkt verknüpfend und verbindend, und zwar in zwei Dimensionen: der Sozialdimension und der Zeitdimension. Sie bindet den Menschen an den Mitmenschen dadurch, daß sie als ‚symbolische Sinnwelt‘ (Berger/Luckmann) einen gemeinsamen Erfahrungs-, Erwartungs- und Handlungsraum bildet, der durch seine bindende und verbindliche Kraft Vertrauen und Orientierung stiftet. Dieser Aspekt der Kultur wird in den frühen Texten unter dem Stichwort ‚Gerechtigkeit‘ verhandelt. Sie bindet aber auch das Gestern ans Heute, indem sie die prägenden Erfahrungen und Erinnerungen formt und gegenwärtig hält, indem sie in einen fortschreitenden Gegenwartshorizont Bilder und Geschichten einer anderen Zeit einschließt und dadurch Hoffnung und Erinnerung stiftet.Dieser Aspekt der Kultur liegt den mythischen und historischen Erzählungen zugrunde. Beide Aspekte: der normative und der narrative, der Aspekt der Weisung und der Aspekt der Erzählung, fundieren Zugehörigkeit oder Identität, ermöglichen dem Einzelnen, ‚wir‘ sagen zu können. Was einzelne Individuen zu einem solchen Wir zusammenbindet, ist die konnektive Struktur eines gemeinsamen Wissens und Selbstbilds, das sich zum einen auf die Bindung an gemeinsame Regeln und Werte, zum anderen auf die Erinnerung an eine gemeinsam bewohnte Vergangenheit stützt.“58
So gilt auch für diese Darstellung Assmanns, dass sie aus den kulturwissen-
schaftlichen Diskursen Ergebnisse und Modelle für prähellenistische Kultur-
kontinua bereitstellt. Im Falle des Erinnerungsmodells, des Modells der Kon-
nektivität und der Theologiesierung (einzelner Begriffe) sind Assmanns Ergeb-
nisse mit den religionsgeschichtlichen und theologischen Interessen ertrag-
reich ins Gespräch zu bringen.59
58 ASSMANN (32000), 16; cf. auch ALKIER 84.59 Dass dies nicht für alle Entwürfe gilt, zeigt deutlich sein Projekt, den Monotheismus bibli -zistisch-wortgetreu von der Figur des aus Ägypten „stammenden“ Mose ableiten zu wollen. Mit diesem Vorgehen soll letztlich dem Monotheismus von Anfang an ein extremes Gewalt-potential zugeschrieben werden. Diese Darstellung ist leider religionsgeschichtlich einseitig, da sie (1.) das Gewaltpotential der polytheistischen Ausformungen unterbeleuchtet, (2.) der geschichtlichen Entwicklung des Monotheismus nicht gerecht wird und (3.) zwei große mo-nolithische Blöcke (Monotheismus und Polytheismus) gegeneinander ausspielt, die in dieser puren Form auch in der Umwelt Israels nie ganz verwirklicht wurden.
24
Verbindungslinien
1.3. Durchführung
Die detailliert ausgeführten Aspekte, Antike Literaturgeschichte und Traditions-
geschichte/Religionsgeschichte, stellten für die folgenden Exponenten immer
ein besonderes Betätigungsfeld dar:
Gesenius ist Studierenden vor allem seit dem Sprachenerwerb in Form seines
Wörterbuchs geläufig. Neben seinen philologischen Kompetenzen, ist auf sein
Interesse an den atl. Traditionslinien und auch auf die Beschäftigung mit den
religionsgeschichtlichen Implikationen der Nachbarkulturen hinzuweisen.
Gunkel, der in gewisser Hinsicht als einer der Begründer der atl. Literaturge-
schichte zu gelten hat, betätigte sich zugleich von seinen frühen Werken an
mit den Schöpfungsvorstellungen in der Umwelt60. Die Kontakte zu E. Schra-
der eröffneten ihm neue Horizonte in der sich rasant weiterentwickelnden alt-
orientalischen Philologie.
Gressmann und Dalman haben sich eher auf den zweiten Aspekt (Traditions-
geschichte) verlagert, auch wenn sich dezidiert Arbeiten von literaturgeschicht-
lichem Interesse nachweisen lassen. Und auch wenn Kahle eher durch seine
textkritischen Untersuchungen bekannt geworden ist, hat er doch beide oben
genannten Forschungsbereiche im Sinne einer epochenübergreifenden Litera-
tur- und Traditionsgeschichte zu überbrücken gewusst. Dies zog sich neben
den atl. Zeugen über die orientalischen Sprachen bis hin ins Mittelalter und
den in dieser Epoche zu verortenden masoretischen Interpretationsansätzen.
Diese kurze Übersicht zeigt: Die fünf folgenden Gelehrten sind mit ihren Inter-
essen im Zentrum der alttestamentlichen Methodendiskussion zu verorten. Zu-
gleich soll im Folgenden versucht werden, ihre Impulse für ein Programm der
Methodik in der Wissenschaft des Christlichen Orients fruchtbar zu machen.
Denn auch diese hat in vielerlei Hinsicht und in reger Frequenz mit der bibli-
schen Überlieferung, ihrer Interpretation61 und Charakterisierung zu tun.
60 Cf. hierzu gerade die programmatische Schrift „Schöpfung und Chaos in Urzeit und End-zeit“, cf. GUNKEL (1895).61 Gerade der Verhältnisbestimmung von biblischer Überlieferung und ihrer Ausformung, Reinterpretation und Neuakzentuierung im Rahmen der christlichen Liturgien muss hier be-sonders Beachtung geschenkt werden.
25
Florian Lippke
2. Biographische Kurzportraits und deren Ertrag
2.1 Wilhelm Gesenius: Philologische Weite und ein bis heute andauerndes
Projekt
Mit Wilhelm Gesenius62 tritt dem Forschenden ein unermüdlich nach Vollstän-
digkeit strebender Lexikograph63 und Grammatiker64 entgegen, der auch von
seinen Studenten nicht weniger verlangte: „Dem jungen Vatke“ gab er den Rat,
bevor er sein Seminar besuchte, sollte er doch bitte einmal das gesamte AT
aus dem Hebräischen übersetzen.65 Dass Gesenius ohne eigenes Verschul-
den gerade mit dem geltungssüchtigen Heinrich Ewald harsch zusammen-
stieß, tat weder Gesenius’ Reputation noch der Bedeutung der Sanskrit-Philo-
logie, in der Ewald gedachte zu reüssieren, einen merklichen Abbruch. Die Be-
mühungen um die phönizische66 und maltesische Sprache67 haben Gesenius
im Besonderen beschäftigt. In vielerlei Hinsicht löste er schon die Forderungen
der modernen Wissenschaft nach der „pluri-mediale(n) kulturgeschichtliche(n) 62 Geboren am 3. Februar 1786 in Nordhausen, gestorben am 23. Oktober 1842 in Halle. Den folgenden Erwägungen liegt vor allem SMEND (1989), 53–70 zu Grunde; KRAUS bietet wie auch REVENTLOW (1990–2011) und STAUBLI (2009) keine eigens ausgeführten Kapitel; cf. aber inzwischen RÜTERSWÖRDEN. 63 Neben den zahlreichen Auflagen des Wörterbuchs (bis vor kurzem GESENIUS (171921) mit zahllosen Nachdrucken, nun aber das mit Abstand hochwertigste hebräische Lexikon GESENI-US (181987–2010) von Donner und anderen bearbeitet) sind vor allem auch die Bände des Thesaurus philologicus criticus linguae Hebraeae et Chaldaeae Veteris Testamenti, GESENIUS (1829–1858) zu nennen.64 GESENIUS/ KAUTZSCH stellt nach wie vor eine der Standardgrammatiken neben BAUER/ LEAN-DER und dem aktuellen Entwurf von JOÜON/ MURAOKA dar. 65 Hierzu SMEND (1989), 54. Eine solche Hürde würde in heutiger Zeit wohl eher einen Schwund der Besucherzahlen als ein hohes Niveau im Seminar garantieren. 66 So z.B. die Untersuchungen zu phoenico-griechischen Inschriften (GESENIUS (1825)) und die „Paläographischen Studien über phönizische und punische Schrift“ (1835), die neben den epigraphisch-numismatischen Studien (aufbauend auf den Erkenntnissen H. Hollmanns) auch punisch-numidische Studien enthalten. Letztere stehen allerdings wiederum im Dienst der Entzifferung entsprechender Münzfunde (cf. die Durchführung des zweiten Teils). Vor al-lem aber ist der umfassende über 600-seitige in vier Büchern vorgelegte Gesamtentwurf „Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta“ (1837) zu würdigen. Dieser kann nicht nur mit gutem Recht als eine substantielle Paläographie bezeichnet werden (cf. vor allem §§12–45 und die knapp 50 Tafeln im Anhang), er bietet auch einen Überblick über die späteren Entwicklungen und Randphänomene der phönizischen Sprache und ihrer Nachfolger. Über den Wert, den Gesenius der phoenico-lateinischen Überlieferung (Plautus, Poenulus) schon damals zuschrieb, informiert im Übrigen seine kurze Schrift „Punica Plautina“ (oJ), cf. FRIED-RICH/ RÖLLIG §III.37.67 inzwischen auch BAIER besonders FALLER 170 ff. 67 GESENIUS (1810). Das Maltesische wird im Rahmen der semitischen Sprachkunde viel zu häufig unterschlagen; Gesenius trat den Beweis der Abhängigkeit vom Arabischen an und bemühte sich um die Widerlegung der These der direkten Entwicklung aus dem Punischen.
26
Verbindungslinien
Rekonstruktion“68 ein, indem er neben der Handschriftenkunde, auch Inschrif-
ten aus der biblischen Umwelt in seinen Seminarsitzungen miteinbezog. In
diesem Sinne wurde er dem Ideal der philologischen Kontextualisierung, so-
fern es die damals beschränkteren Möglichkeiten überhaupt zuließen, gerecht.
Aber nicht nur in sprachlicher Hinsicht, sondern auch durch das Einbeziehen
von Kartenwerken69, Realienkunde70 und Bildmaterial71 war er um ein umfas-
sendes Verständnis der atl. Schriften und ihrer Lebenswelt nachhaltig bemüht.
Bei Betrachtung des Geseniusschen Oeuvres wird dem Leser sofort klar: Es
liegt ein Projekt der komparativen Philologie von nicht zu überschätzendem
Ertrag vor, gepaart mit einem breiten Sachinteresse, das sich in den nunmehr
achtzehn Auflagen bis zum heutigen Tag fortgesetzt hat. Nur um die Relevanz
der Orientalistik und des Christlichen Orients zu dokumentieren, seien hier ei-
nige Zitatstatistiken vermerkt. Im Wörterbuch der 17. Auflage taucht die Phra-
se „Christlich-Palästinensisch“ 60 Mal72 auf. Der Name des Arabisten und Sy-
risch-Spezialisten Carl Brockelmann ist 133 Mal verzeichnet, während der
später zu erwähnende Dalman (3.3.) gut 100 Mal in die Diskussion miteinbe-
zogen wird.
August Dillmann, Alttestamentler, Orientalist und Äthiopist ist mit 573 Nennun-
gen auf dem zweiten Platz hinter dem Spitzenreiter in dieser Hinsicht zu plat-
zieren. Denn für Theodor Nöldeke, den Experten für Neusyrisch, Mandäisch,
und vieler weiterer semitistischer und arabistischer Disziplinen ist die stattliche
Zahl von 870 Nennungen zu veranschlagen.
Diese Aufstellung präsentiert schlagend die Bedeutung des „Projekts Geseni-
us“ (in philologischer Hinsicht) für eine interdisziplinäre Beschäftigung zwi-
schen Altem Testament und Christlichem Orient – wo sonst findet man neben
hebräischen, akkadischen und ugaritischen Hinweisen, entsprechend syri-
68 S. oben Anm. 46.69 Das Interesse an der Archäologie und Geographie Palästinas und der angrenzenden Ge-biete lässt sich sehr gut an der Übersetzung und kommentierten Herausgabe des Burck-hardtschen Reiseberichtes (GESENIUS (1823/4)) zeigen; in seinen Schriften verweist Geseni-us des Öfteren auf die archäologischen Lehrbücher von de Wette, Jahn und Bellermann.70 Hierzu konnte auch der Thesaurus (Anm. 64) sehr gute Verwendung finden, siehe auch das Diktum Wellhausens aus der Bleekschen Einleitung, kolportiert bei SMEND (1989), 60. 71 Entsprechend der Angabe bei Smend wohl ROSSELLINI.72 Diese Angabe und die folgenden Werte beruhen auf eigener Zählung und sind Mindestwer-te, die im Einzelfall noch höher ausfallen können.
27
Florian Lippke
sche, koptische, äthiopische und arabische Belege versammelt? Deshalb ist
Gesenius und das von ihm angestoßene Projekt (in Form der zahlreichen
Wörterbücher) ein überaus ertragreicher Anknüpfungspunkt für die philologi-
sche Diskussion im Bereich „Christlicher Orient“. Dabei nehmen seine Werke
in vielfacher Hinsicht eine Brückenfunktion zwischen den orientalischen und
den frühen semitischen Sprachen ein. Zum einen ist dies für das Vokabular
nachzuweisen, zum anderen für Ideomatik und Stilistik. So eröffnet Gesenius
den Forschenden im Christlichen Orient einen Blick in den tiefen philologi-
schen Brunnen der Vergangenheit.
2.2. Hermann Gunkel: Überindividuelle Bezeugungen und Text-bildungsmus-
ter
„Kein Gelehrter hat auf die Methode der biblischen Exegese weit über
Deutschland hinaus im Mittleren Drittel des 20. Jh. so tief eingewirkt wie Her-
mann Gunkel“.73 Er74 hat in Bezug auf die Literaturgeschichte des Alten Testa-
ments Bedeutendes geleistet: Das Interesse an den zu Grunde liegenden Gat-
tungen sowie am Sitz im Leben75 haben ihm einen überaus großen Ruhm ein-
gebracht. Dass diese Gattungsfragen76 geradezu als literaturgeschichtlicher
Schlüssel für die alttestamentliche Traditionsliteratur betrachtet werden kön-
nen, wird dem interessierten Leser seiner Schriften schnell klar.77 Auch wenn
durch Schüler und Imitatoren das Projekt der Gattungsbestimmung auf Grund
übereifriger Neudefinitionen Plausibilitätseinbußen zu verzeichnen hatte78, tat
73 So der Eröffnungssatz bei SMEND (1989), 160, und insgesamt 160–172, der wie zu den an-deren diskutierten Exponenten auch, sehr viele Einzelaspekte zu versammeln weiß. Deswei-tern können für zusätzliche Aspekte sowohl KRAUS 79–83, als auch REVENTLOW (2011/IV), 427–346, und Staubli (2009), 51 f. herangezogen werden.74 Geboren am 23. Mai 1862 in Springe, gestorben 11. März 1932 in Halle.75 Eigentlich bei Gunkel „Sitz im Volksleben“, cf. GUNKEL (1913), 33 f. aber auch bei KLATT 170 zudem mit forschungsgeschichtlichen Implikationen 1276.76 Unter anderem stellte sich die Gattungsfrage als ertragreiches Instrument zur Klassifizie-rung der kleineren literarisch-poetischen Formen, der Psalmen, heraus: Hiervon legen der forschungsgeschichtlich bemerkenswerte Psalmenkommentar (GUNKEL (41926)) und die sy-stematisierende Einleitung in die Psalmen (IDEM/ BEGRICH) ein beeindruckendes Zeugnis ab. 77 Seine Publikationen und deren Titel weisen dies programmatisch auf: Sagen und Ätiologi-en beschäftigten ihn im berühmten Genesis-Kommentar (GUNKEL (41917)); zum Märchen im Alten Testament äußerte er sich ebenfalls monographisch (1917). 78 Hierzu BLUM (2006), 88 f.
28
Verbindungslinien
dies dem Wert des ursprünglichen wissenschaftlichen Unterfangens keinen
Abbruch. Gunkels Arbeiten beschäftigen sich mit der Kontextualisierung der
überlieferten Schriften, wie auch mit dem Projekt einer antiken Literaturge-
schichte. Da die literarische Überlieferung des Christlichen Orients aber gera-
de in einem sehr engen Rückbezug zur biblische Traditionsliteratur steht,
muss in Bezug auf Texttypen und Textgattungen das Projekt einer Literaturge-
schichte des Christlichen Orients vorangetrieben werden; hier sollte die Konti-
nuität und Diskontinuität der Gattungen besondere Berücksichtigung finden.
Für die Frage nach Gattungen im Fachbereich des Christlichen Orients bietet
sich Gunkel als spiritus rector und Gesprächspartner an. Gerade ein Projekt
im Anschluss an die Gunkelschen Fragestellungen müsste zunächst eine Gat-
tungsgeschichte der Literatur des Christlichen Orients vorantreiben, sodass
Spektrum und Bildungsmuster klarer vor Augen treten. Durch die Intensivie-
rung dieser Studien ist zugleich einer methodischen Absicherung der Weg ge-
bahnt: Denn die Gattungsgeschichte als Spezialfall der Literaturgeschichte
zeigt Szenarien für Intertextualität auf, die nicht mit einem einfachen Zitatver-
hältnis erklärt werden können. Mit anderen Worten: Ein Intertextualitätsphäno-
men muss nicht immer auf einer zeitlichen Abhängigkeit zweier Texte beruhen,
vielmehr kann Grund für diese Intertextualität im weitesten Sinne auch ein
Gattungsphänomen sein. Diese Einsicht vermeidet bei der Analyse relevanter
Texte aus dem Bereich des Christlichen Orients wie auch aus dem des Alten
Testaments die zuvor problematisierten Engführungen.
29
Florian Lippke
3.3. Gustaf Dalman: Kontinuitäten der palästinischen und levantinischen Welt
Dalman79 unternahm erst spät, als schon etablierter Forscher80, seine erste
Orientreise. Volksnähe und generelles Interesse am kulturellen Erbe des be-
suchten Gebietes erweckten in ihm die Idee zu einem Projekt, dass die „lan-
gen Kontinuitäten“ zum Ausgangspunkt hatte. Die Bevölkerung Palästinas war
zu dieser Zeit noch größtenteils mit vorindustriellen Produktionstechniken im
Alltag vertraut. Im Bewusstsein, wie fern die westliche (industrialisierte) All-
tagswelt der antik-biblischen war und dass ein Auseinanderdriften beider Wel-
ten voranschreiten würde, erkannte Dalman den Wert der ihm aktuell vor Au-
gen stehenden Realien und kulturellen Bräuche/ Handlungsweisen. Indem er
diese aufzeichnete und sie in einem großen vielbändigen Kompendium dem
wissenschaftlichen Forum vorlegte, bot er einen hermeneutischen Zugang zu
den vorindustriellen, antiken Rahmenbedingungen und kulturellen Erscheinun-
gen. Dalman hat so in ganz besonderer Weise zur Erschließung der levantini-
schen Kulturen beigetragen: Nicht wie Wellhausen, ging es ihm um ein Sezie-
ren von literarischen Schichten und um diachrones Aufteilen der Texte; diese
Texte waren nach Wellhausens Ansicht sowieso sehr verderbt.81 Dalmans Pro-
jekt war ein Projekt der longue durée: Durch Beobachtung der Traditionen der
Beduinen und ansässiger Araber war es ihm möglich die „Arbeit und Sitte in
Palästina“82 umfassend darzustellen. Zu Recht werden diese Abhandlungen
als grundlegendes Werk für Archäologie und Realienkunde bezeichnet. Dal-79 Geboren am 9. Juni 1855 in Niesky, gestorben am 19. August 1941 in Herrnhut; STAUBLI (2009), 49 f. bietet als Einziger der zuvor genannten forschungsgeschichtlichen Abrisse eine adäquate Würdigung Dalmans. Zu Recht gibt Staubli dem Exponenten das Epitheton „Pio-nier der biblischen Ethnoarchäologie“ bei und stellt den kurzen Ausführungen ein treffendes Motto voran: „Noch hatten die wohlgemeinten Reformen der englischen Regierung und der jüdischen Einwanderung nicht allen Zauber des Orients zerstört.“ Meine nun folgenden Aus-führungen können, auch wegen der nicht übermäßig breiten Forschungsliteratur zu Dalman, nur Paraphrasenqualität erreichen. Eine rühmliche Ausnahme in der Sekundärliteratur stellen die beiden Monographien von MÄNNCHEN (1987); (1993) dar. 80 Eine Grammatik (DALMAN (21905)) und ein Wörterbuch (DALMAN (31938)) hatte er bis dahin u. a. verfasst.81 Eine solche Geringschätzung ist aus heutiger Forschungsperspektive zu vermeiden, selbst wenn zuweilen Wellhausens Ideen in Begriffen wie der „redaktionskritischen Entwirrung“ (die sich z.B. BERNER 68 als Ziel setzt) nachklingen. Da aber selbst der schon diskutierte C. Ge-ertz von einer „verknoteten“ und „seltsam, irregulären“ Überlieferung spricht, darf man viel-leicht an dieser Stelle mit Berner nicht zu hart ins Gericht gehen! 82 DALMAN (1928–1942); inzwischen vollständig digital verfügbar über das Portal V.IRAT (Lipp-ke).
30
Verbindungslinien
man tat dies zuvorderst im Dienste der Erforschung des Alten Testaments (und
des Neuen Testaments); letztlich um den im Text verhandelten Aspekten ein
adäquates Verständnis zu entlocken. Das Projekt Dalmans ist nicht geschei-
tert: Die großen Traditionslinien zeigten sich als auswertbar, auch gerade über
einen Zeitraum von vielen Jahrhunderten hinweg. Dass er mit den Eckpunkten
seiner Analyse (Altes Testament und vorindustrielles Palästina) die für uns hier
interessante Zeit des Christlichen Orients geradezu überspannt, kann nur als
Glücksfall gelten: Die in Dalmans Werk niedergelegten Erkenntnisse bieten
gute Anknüpfungspunkte für Fragenkreise der Wissenschaft vom Christlichen
Orient und Dalman kann als exzellenter Ansprechpartner für Fragen zur Ar-
chäologie und der Realienkunde gelten.83
2.4. Hugo Gressmann: Der dezidierte Blick in die Umwelt
Ein streitbarer und nicht einfacher Gelehrter84 tritt uns mit Hugo Gressmann
entgegen: „Am 27. März 1877 als Sohn eines Bahnhofsverwalters im Lauen-
burgischen Mölln geboren“85, gehörten im späteren Studium Giesebrecht,
Wellhausen, Smend, Schultheiß, Hoffmann, Liszbarski und Bousset zu seinen
Lehrern.86 Dass er nicht in vielen Hinsichten als Konformist zu gelten hatte, be-
weist auch der Titel einer Preisarbeit, welcher er das Motto: „Sei ein Schwätzer
und sieh, alle Schwierigkeiten verschwinden“ provokativ voranstellte.87 Gress-
mann stand weniger der diffizilen Zergliederung der Texte nahe; mehr Wert
legte er auf die Analyse der Umwelt des Alten Testaments und somit auf ein
solides Verständnis der Biblischen Welt88. Allerdings fügte er sich ganz in das
bekannte Klischee, wonach „Bibliker“ und „Dogmatiker“ gegenüber dem je an-
deren große inhaltliche, bisweilen persönliche Differenzen zu kultivieren pfle-
83 Viele Studien und Analysen von bleibendem Wert hat Dalman vorgelegt, ohne dass alle hier nun genannt werden könnten. Aber gerade DALMAN (1930), wie auch die archäologisch weit über den Titel hinausgreifende Monographie (31924), zeigen dies deutlich. Als langjähri-ger Herausgeber des traditionsreichen Palästinajahrbuchs (PJ) in Jerusalem hat er sich zu-dem bleibenden Ruhm erworben. 84 Eine der wenigen gut verwendbaren Quellenaufbereitungen ist wiederum bei SMEND (1989), 173–181 auffindbar; cf. inzwischen auf FREULING.85 Ebd., 173; Gressmann starb am 7. April 1927 in Chicago.86 Ebd., 174.87 Ebd.88 Zur sinnvollen Renaissance des Begriffs vergleiche inzwischen LEHMANN.
31
Florian Lippke
gen. So warf er Emil Brunner eine Scheuklappendogmatik vor89, auch Karl
Barths Theologie wurde nicht geschont.90
Einen besonderen Entwurf Gressmanns stellen die Sammlungen von Texten
und Bildern91 dar. Sie beschreiten den Weg der pluri-medialen Erforschung
und nehmen bei dieser Gelegenheit auch endlich die bildlichen Darstellungen
genauer in den Blick.92 Solche Kompendia für die nicht-christliche Umwelt des
Christlichen Orients sind noch ein Desiderat.93 In Auswahl und Methodenum-
riss bietet sich Gressmann als Vorreiter und Gesprächspartner an, gerade weil
er den Blick über den religionsinternen und konfessionellen Tellerrand wagte
und somit der atl. Exegese eine Horizonterweiterung sonders gleichen be-
scherte. Nur am Rande sei auf zwei Werke verwiesen, die im Kontext der Ar-
chäologie und Traditionsgeschichte anzusiedeln sind: Zum einen ist dies eine
Abhandlung über Ausgrabungen in Palästina94, zum anderen die vom Titel selt-
sam klingende Schrift über den „Erdgeruch“95, die sich in die Forschungen zur
longue durée einordnen lässt. Gerade an dieser Stelle ist die Verbindung zu
Dalman recht deutlich. Auch ist die Abhandlung über die Musikinstrumente hier
zu verorten.96 Zu seinen Werken gehören zudem sehr spezielle Fragestellun-
gen, die aber das zielgerichtete religionsgeschichtliche Gespür verraten.97
89 SMEND (1989), 180; empfehlenswert ist die Lektüre der gesamten Entwicklung bei Smend. 90 Dabei sind die noch gemäßigten Aussagen, dass „Karl Barths Theologie aus dem 4. Esra Buch stamme“ und „signifikant sei für eine Zeit der Inflation und des Zusammenbruchs“. Für die ausgeführten Zitate und die weiteren illustren Reaktionen von Karl Barth, aber auch zu einem deutlichen Diktum J. Wellhausens, cf. wiederum (1989), 180. 91 GRESSMANN (1909a).92 Cf. die forschungsgeschichtliche Würdigung IPIAO I, 13–16. 93 In gewisser Hinsicht kann man aber auf den substantiellen von HAAS/ BONNET herausgege-benen „Bilderatlas zur Religionsgeschichte“ (1924–1934) verweisen, der neben den ägypti-schen (2/4), hethitischen (5), babylonisch-assyrischen (6), ägäischen (7) und germanischen (1) religiösen Symbolsystemen auch die Ainu und ihre Religion (8), die Religionen in der Um-welt des Urchristentums (9/11), die Religion der Jainas (12), die Religion der Griechen (13/14) und sogar die Religion des Mithra (15) präsentiert. Dieser erste Versuch der Aufar-beitung in einem umfassenden Kompendium ist viel zu häufig unbeachtet geblieben.94 GRESSMANN (1908).95 (1909b).96 (1903), cf. aber inzwischen auch BRAUN und STAUBLI (2007).97 GRESSMANN (1923).
32
Verbindungslinien
2.5. Paul Kahle: Textbezeugung und Entwicklungsgeschichte der Übersetzun-
gen
Paul Kahle98 war nicht nur Orientalist sondern auch dezidiert Theologe. Das
zeigt neben seiner Beschäftigung mit dem Pentateuch (Promotion) auch seine
langjährige Tätigkeit als Pfarrer in Rumänien und Ägypten. Durch gute interna-
tionale Beziehungen, die er ertragreich einsetzte und in seinen Schriften re-
flektiert, sind wertvolle, jedoch nur noch viel zu selten rezipierte Werke ent-
standen: Wer kann sich heute noch rühmen, die „Masoreten des Ostens“99
oder die des „Westens“100 durchgearbeitet zu haben? Aber auch schon seine
grundlegende Abhandlung zur Kairoer Genisa101 findet oft nicht den notwendi-
gen Anklang. Paul Kahle war ein Charakter mit Spezialmeinung: Die Masore-
ten waren für ihn Inventoren im besten Sinne. Sie definierten Interpunktions-
zeichen neu, schufen ein neues System der Vokalisation, gaben der hebräi-
schen Sprache eine Wortmelodie (durch spezielle Betonung), die sie vorher
(seiner Meinung entsprechend) so nie gehabt hatte. Insgesamt arbeitete er
sich mit Akribie durch orientalische Manuskripte, verfasste eine Einführung zur
Arabischen Bibel102 und war auch der zweiten Hexapla-Spalte bei Origenes
nicht abgeneigt103, als ihn Kardinal Mercati wiederholt darauf aufmerksam
machte. Auch mit Dalman104 ist er in Kontakt gekommen.
Seine Arbeiten könnten in einem weiteren Feld Interesse finden: Letztlich bie-
tet ein Großteil seiner Beschäftigung die Traktate und Abhandlungen der jüdi-
schen Bevölkerung im Kontext des Christlichen Orients. Ob sie als Bezugs-
quellen (womöglich mit Fällen der nahen Rezeption) oder aber als Belege ei-
ner Diskontinuität zur Literatur des Christlichen Orients verwendet werden
können, muss zunächst offen bleiben. Fraglos weiht uns Kahle aber in seinen
98 * 21. Januar 1875 in Hohenstein, † 24. September 1964 in Bonn.99 KAHLE (1913) aber auch schon (1902).100 (1927); (1930).101 (1962).102 (1904).103 (1961), 31–51.104 Eine weitere Verbindung der Exponenten mit Jerusalem, Ebd., 20. Dass Kahle in gewisser Weise auf Dalmans Spuren wandelte (und zwar bezüglich der Verschriftlichung des arabisch-kulturellen Erbes), zeigen für Ägypten (1909) und für die direkte Umgebung von Jerusalem IDEM/ SCHMIDT; cf. hierzu auch die Arbeit von BLAU, der sich auf eben diesen sprachlich-ethno-logischen Survey in Bir-Zeit/ Ramallah bezieht.
33
Florian Lippke
Schriften in die Texttransmissionsgeschichte der Spätantike und des aufkom-
menden Mittelalters ein. Dieser Fakt dürfte gleichsam von nicht untergeordne-
ter Bedeutung für die Fragen der Texttransmission zentraler Texte des Christli-
chen Orients sein und macht Paul Kahle, wie auch seine Vorgänger, die hier
Erwähnung fanden, zu einer Referenzgröße von besonderer Güte. In gewisser
Hinsicht umspannt sein Werk den zeitlichen und räumlichen Kernbereich des
Christlichen Orients und bietet somit zahlreiche Vorarbeiten und Anknüpfungs-
punkte105.
3. Inhaltliches: Ein Synoptikum der Kompetenzbereiche des Christlichen
Orients vermehrt um die „breiten Traditionslinien“ und die entsprechen-
den Anknüpfungspunkte zu atl. Exponenten
Das hier zur Diskussion gestellte Schema106 besteht aus fünf chronologischen
Ebenen (1-4.5) und einer Metaebene an der Spitze, die das Projekt der Metho -
dendiskussion in der Wissenschaft vom Christlichen Orient illustrieren soll. Da-
bei ist jede der fünf historischen Ebenen (1-4.5) zeitlich als eine stark verein-
fachte Epoche zu verstehen. So entspricht die tiefste Ebene den frühen Epo-
chen107, deren Traditionsbögen108 durchaus schon im Epipaläolithikum einset-
zen. Diese Ebene reicht hinauf bis in die Epochen der Bronzezeiten109 und
zum Beginn der Eisenzeit (bis zum Beginn des 1. Jt. v. Chr.). Subsumiert sind
hier die sogenannten „Hochkulturen“ im weitesten Sinne (Hatti, das Alte bis
Neue Reich in Ägypten, Sumer, Akkad sowie insgesamt die assyrischen und
babylonischen Kulturzentren). Will man die nächste Ebene den Kulturen im
Zentrum der Levante vorbehalten, so sind auf Ebene 1 auch die ägyptischen,
assyrischen und babylonischen Metropolen und Reiche des 1. Jt. mitzuden-
ken. Diese könnten aber, bei rein chronologischer Sektierung mit gleichem
Recht in der nächst höheren Stufe (2) angesiedelt werden. Stufe 1 beschreibt
zugleich auch die, von Braudel implizierten, geografischen Eckdaten, in denen
105 Der weite Fokus Paul Kahles und seines Oeuvres zeigt sich auch am Inhaltsverzeichnis seiner Gedenkschrift, die von BLACK besorgt wurde; aber auch schon in KAHLE (1956) tritt dies recht klar hervor. 106 Cf. Abb. 1 im Anhang.107 Artefakte zunächst überwiegend bildlicher und erst ab dem 4. Jt. v. Chr. schriftlicher Natur. 108 Entsprechend IPIAO I, 26–28.109 Cf. zu den überlappenden religiösen Symbolsystemen in der Levante jetzt LIPPKE (2011).
34
Verbindungslinien
sich die großen Traditionskontinuitäten abspielen. Die nächste Ebene (2) um-
fasst die direkten lokalen Einflüsse in der ersten Hälfe des ersten Jahrtau-
sends. Durch eine solche Anordnung wird auch die Vermittlerrolle dieser Be-
völkerungsgruppen deutlich: Assyrisches konnte beispielsweise im aramaisier-
ten Gewand in die Südlevante gelangen110, Ägyptisches konnte durch die Ver-
mittlung der Philister oder Phönizier auftreten111. Das nicht explizite Vorkom-
men einer Größe „Israel“ oder „Juda“ auf dieser Stufe soll zur Diskussion anre-
gen, inwiefern die Entwicklung Israels aus Kanaan und die reflektierte Abgren-
zung in nachexilischer Zeit überhaupt in einem eigenen Zweig dargestellt wer-
den kann/muss. Spätestens in der nach-griechischen Ebene (4) ist aber das
rabbinisch-jüdische Erbe klar als eigener Strang zu kennzeichnen. Der rele-
vante Abschnitt für die alttestamentliche Traditionsliteratur ist also ein bedeu-
tender Teil der Stufe 2 und der gesamte Bereich der Stufe 3. Da das vorgeleg-
te Schema die Darstellung von Kontinuitäten begünstigt, sind nicht alle – frag-
los existierenden – Diskontinuitäten darstellbar. Sie müssten in einem weiteren
Schema adäquat Berücksichtigung finden. Letztlich orientiert sich das hier vorgestellte Schema zwar auch in Einzelpunkten, beson-ders aber bezüglich der Gesamtanlage an dem Projekt der „Vertikalen Ökumene“ von Othmar Keel. Dieses Projekt legt – ohne die Sensibilität für die Differenzen auszublenden – auf die großen Verbindungslinien und Kontinuitäten (im Sinne von 1.3+4) wert. Ebenso wie im aktuellen kirchlichen Diskurs die Ökumene über konfessionelle (z.T. auch Religi-ons-)Grenzen hinausblickt, so stellt die vertikale Ökumene den Fokus auf die historische Dimension ein.112 Das Verständnis der eigenen Religion/Konfession wird durch eine Be-schäftigung mit dem Erbe der früheren Religionen kontextualisiert und erhellt. So können
110 Cf. hierzu die assyrisierenden Tendenzen in der Reliefkunst der aramäisch-luwischen Stadtstaaten (Panamuwa-Relief in Zincirli).111 Dies spielt wohl gerade in ikonographischer Hinsicht eine Rolle, wenn möglicherweise durch die phönizischen Schalen ein Motivrepertoire nach Palästina/Israel gelangt, das seine Ursprünge in Ägypten hat; zur Sache der kurze Hinweis bei LIPPKE (2012), §4a, und TILLY/ ZWICKEL 205. Desweiteren ist hier auch an die Situla-Funde zu denken, die mit ihrem relativ ausführlichen Darstellungsrepertoire als mobile (und damit einfach zu transferierende) Mus-terstücke Vorlagencharakter für die Stempelsiegelglyptik gehabt haben können. In diesen Kontext ist auch die Konventions- und Motivübernahme auf Elfenbeinpanelen der Levante einzuordnen. Diese wurden in großen Mengen in assyrischen Residenzstädten als Importgut gefunden. Ob die postramessidische Massenware, die von Münger mit Siamun und Tanis (als Herstellungsort) in Verbindung gebracht wird, vielleicht auch (eher?) mit den infrastruktu-rellen Expansionen der Philister zu korrelieren ist und damit Ägyptisches über Philistäa ver-mittelt wurde, müsste noch einmal gesondert untersucht werden. 112 STAUBLI (2005), KEEL (2009), besonders 10.12 f.17.31, DE PURY 532–552, KEEL (2007), 9; STAUBLI (2011) hat das Phänomen des Antikanaanismus eingehend beleuchtet. Seine Unter-suchung führt die Ergebnisse von KEEL weiter, cf. (2011), 349.
35
Florian Lippke
die einzelnen Stufen der Grafik, die nicht im Sinne einer Hierarchie zu lesen sind, als Stu-fen von Kontinuität und Diskontinuität begriffen werden, bei denen auf dem Weg von un-ten nach oben große Teile des religiösen Symbolsystems weitergegeben und integriert werden. So können im Fachbereich des Christlichen Orients durchaus Reflexe aus den Hochkulturen des 3. und 2. Jt. v. Chr. auffindbar sein. Häufig, dies versucht die Grafik auch zu einem gewissen Grad zu zeigen, treten allerdings diese Reflexe in einer adaptier-ten, re-interpretierten und neuakzentuierten Weise auf: Gerade diese Akzentuierung ver-schleiert aber nie vollständig die Herkunft der Motive.
Eine besondere Rolle im Schema, wie auch in der Geschichte, spielt die inter-
pretatio christiana (5) der vorchristlichen theologischen Phänomene und Aus-
sagen. Diese Perspektive sub specie christiani bringt viele religionsgeschicht-
lich relevante nicht genuin christliche Vorstellungen in den Referenzrahmen
der christlichen Theologie hinein. Eines muss bei der Betrachtung der früh-
christlichen Phänomene, dem „Laboratorium“113, konstatiert werden: Der christ-
liche Glaube muss auch gerade aus seiner Vorgeschichte heraus verstanden
werden. Eine dogmatische Festlegung auf einen Offenbarungsbegriff „senk-
recht von oben“ mit nur bedingten Verbindungen zur Umwelt wäre in diesem
Fall nochmal nachdrücklich zu diskutieren. Durch diese historische Kontextua-
lisierung sind viele neue Fragen zu formulieren, die hier nicht aufgezählt oder
gar gelöst werden können. Aber gerade in der Kontextualisierung stecken ent-
scheidende Chancen für Theologie und Kirche in der heutigen Zeit: Die Aufga-
be, Theologie in pluralen Gesellschaften aus christlicher Warte zu präsentie-
ren, könnte durch dieses Schema neue Akzente gewinnen.
Um die Methodik im epochalen Bereich des Christlichen Orients zu vertiefen,
wurden Anknüpfungspunkte aus der alttestamentlichen Forschung benannt
und vorgestellt. Diese fließen nun in einer Metaebene (s. Grafik) ein, die, ne-
ben den geschichtlichen Implikationen, nun das Fach in seiner wissenschaftli-
chen Dimension darzustellen versucht. Die Anknüpfungspunkte sind, entspre-
chend den diskutierten Forschern, in fünf Bereichen dargestellt. Den Christli-
chen Orient in philologischer, literarischer, religionsgeschichtlicher, realien-
kundlicher und textgeschichtlicher Hinsicht multiperspektivisch zu charakteri-
sieren, muss Ziel der nächsten Dekaden sein. Anknüpfungspunkte von alttes-
tamentlicher Seite sind zahlreich und ertragreich, wie jedes der einzelnen Por-113 Cf. zu dieser Metapher LÖHR 29, aber auch MARKSCHIES (1997), 46; (2000), 292; (2001), 117, zum gleichen Sachverhalt (2009), 260, aber auch 277 und 380 in Bezug auf Clemens, Origenes und andere. Verwendung findet der Begriff auch bei POPKES 207, bei HENGEL 102, sowie bei FREY (2005), 43.
36
Verbindungslinien
traits zu vermitteln bemüht war. Auch die atl. Forschung kann aus diesen Be-
ziehungen in methodischer und historischer Hinsicht einen Erkenntniszuge-
winn verbuchen. Gerade durch die zeitliche Nähe114 zur Antike hält der Christli-
che Orient ein großes Reservoir an Quellen bereit, die zwar mitunter von der
christlichen Warte aus neu interpretiert wurden, jedoch ihren ursprünglichen
Kern in sich tragen. Ziel all dieser Überlegungen muss neben einer gefestigten
Methodik der Altertumswissenschaften auch gerade der Erweis der großen In-
tegrationsfähigkeit des Christentums durch die Jahrhunderte sein. Die inklu-
dierenden Tendenzen, die sowohl für das Alte Testament wie auch für die
(ur-)christlichen Literaturen gelten, zeigen dabei die enge Umweltvernetzung.
Diese Vernetzung gilt es auch durch alle Differenzen/Diskontinuitäten zu be-
achten. Sie eröffnet uns einen Blick auf die vitale Entwicklung des christlichen
Glaubens in Abgrenzung und Aufnahme der umgebenden Traditionen. Für die-
se letzte Aussage gilt, wie in der hebräischen Prophetie, das poetische Achter-
gewicht.
ALKIER, Stefan: Wunder und Wirklichkeit in den Briefen des Apostels Paulus. Ein Bei-trag zu einem Wunderverständnis jenseits von Entmythologisierung und Rehistori-sierung, Tübingen 2001 (WUNT 134)
ASSMANN, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Ge-dächtnisses, München 32006
–– : Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006
ASSMANN, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 32000
–– : „Mythos und Geschichte“. In: ALTRICHTER, Helmut; HERBERS, Klaus; NEUHAUS, Hel-mut (Hgg.): Mythen in der Geschichte. Freiburg 2004, 13–28
–– : Religion und kulturelles Gedächtnis. Zehn Studien, München 2007BAIER, Thomas (Hg.): Studien zu Plautus‘ Poenulus. Tübingen 2004 (Scripta-Oralia;
127)BARSTAD, Hans: History and Memory. Some Reflections in the “Memory Debate” in
Relation to the Hebrew Bible, in: DAVIES, Philip R.; EDELMAN Diana V. (Hgg.): The Historian and the Bible. Essays in Honour of Lester L. Grabbe, New York 2010, 1–10 (Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies; 530)
BARTON, Stephen (Hg.): Memory in the Bible and Antiquity. The Fifth Durham-Tübin-gen Research Symposium (Durham, September 2004), Tübingen 2007 (WUNT 212)
114 Zum Teil mit einer deutlichen Überlappung.
37
Florian Lippke
BAUER, Hans; LEANDER, Pontus: Historische Grammatik der hebräischen Sprache des alten Testamentes. Halle 1922
BECKER, Uwe: Exegese des Alten Testaments. Ein Methoden- und Arbeitsbuch, Tü-bingen 22008 (UTB 2664)
BERLEJUNG, Angelika: Die Theologie der Bilder. Herstellung und Einweihung von Kult-bildern in Mesopotamien und die alttestamentliche Bilderpolemik, Freiburg CH 1998 (OBO 163)
BERNER, Christoph: Die Exoduserzählung. Das literarische Werden einer Ursprungs-legende Israels, Tübingen 2010 (FAT 73)
BEVC, Tobias: Kulturgenese als Dialektik von Mythos und Vernunft. Ernst Cassirer und die Kritische Theorie, Würzburg 2004 (Trierer Studien zur Kulturphilosophie; 11)
BICKEL, Susanne et al. (Hgg.): Bilder als Quellen – Images as Sources. Studies on Ancient Near Eastern Artefacts and the Bible Inspired by the Work of Othmar Keel, Freiburg CH 2007 (OBO Sonderband)
BIEBERSTEIN, Klaus: Die Pforte der Gehenna. Die Entstehung der eschatologischen Erinnerungslandschaft Jerusalems, in: JANOWSKI, Bernd; EGO, Beate (Hgg.): Das biblische Weltbild und seine altorientalischen Kontexte. Tübingen 2001, 503–539 (FAT 36)
BLACK, Matthew: In memoriam Paul Kahle. Berlin 1968 (BZAW 103) BLAU, Joshua: Syntax des palästinensischen Bauerndialektes von Bīr-Zēt auf Grund
der "Volkserzählungen aus Palästina" von Hans Schmidt und Paul Kahle. Walldorf-Hessen 1960 (Beiträge zur Sprach- und Kulturgeschichte des Orients; 13)
BLUM, Erhard: „‘Formgeschichte‘ – ein irreführender Begriff?“ In: UTZSCHNEIDER, Hel-mut; BLUM, Erhard (Hgg.): Lesarten der Bibel. Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Alten Testaments, Stuttgart 2006, 85–96
–– : Notwendigkeit und Grenzen historischer Exegese. Plädoyer für eine Alttesta-mentliche Exegetik, in: JANOWSKI, Bernd (Hg.): Theologie und Exegese des Alten Testaments / der Hebräischen Bibel. Zwischenbilanz und Zukunftsperspektiven, Stuttgart 2005, 87–124 (SBS 200)
–– : Vom Sinn und Nutzen der Kategorie „Synchronie“ in der Exegese. In: DIETRICH, Walter (Hg.): David und Saul im Widerstreit. Freiburg CH 2004, 16–30 (OBO 206)
BRAUDEL, Fernand: Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. Frankfurt 1994
BRAUN, Hans-Jürg; HOLZHEY, Helmut; ORTH, Ernst Wolfgang (Hgg.): Über Ernst Cassi-rers Philosophie der symbolischen Formen. Frankfurt am Main 1988 (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft; 705)
BRAUN, Joachim: Die Musikkultur Altisraels, Palästinas. Studien zu archäologischen, schriftlichen und vergleichenden Quellen, Freiburg CH 1999 (OBO 164)
CASSIRER, Ernst: Versuch über den Menschen. Hamburg 2007DALMAN, Gustaf: Aramäisch-neuhebräisches Handwörterbuch zu Targum, Talmud
und Midrasch. Göttingen 31938–– : Arbeit und Sitte in Palästina. Gütersloh 1928-1942 (7 Bände)–– : Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch nach den Idiomen des palästi-
nischen Talmud, des Onkelostargum und Prophetentargum und der jerusalemi-schen Targume. Leipzig 21905
38
Verbindungslinien
–– : Jerusalem und sein Gelände. Gütersloh 1930–– : Orte und Wege Jesu. Gütersloh 31924 (Beiträge zur Förderung christlicher Theo-
logie, Reihe 2, Sammlung wissenschaftlicher Monographien; 1)DIETRICH, Jan: Kollektive Schuld und Haftung. Religions- und rechtsgeschichtliche
Studien zum Sündenkuhritus des Deuteronomiums und zu verwandten Texten, Tü-bingen 2010 (ORA 4)
DONNER, Herbert: Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen (Band 1: Von den Anfängen bis zur Staatenbildungszeit). Göttingen 32000 (GAT 4,1)
DORMEYER, Detlev: Das Neue Testament im Rahmen der antiken Literaturgeschichte. Eine Einführung, Darmstadt 1993
DUNN, James: Social Memory and the Oral Jesus Tradition. In: BARTON, Stephen (Hg.): Memory in the Bible and Antiquity. The Fifth Durham-Tübingen Research Symposium (Durham, September 2004), Tübingen 2007, 179–194 (WUNT 212)
ERLL, Astrid: Medium des kollektiven Gedächtnisses. Ein (erinnerungs)kultur-wissen-schaftlicher Kompaktbegriff, in DIES. (Hg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität - Historizität – Kulturspezifität, Berlin 2004, 3–22 (Media and cultu-ral memory; 1)
FALLER, Stefan: Punisches im Poenulus. In: BAIER (2004), 163–201FREULING, Georg: Hugo Greßmann. In: WiBiLex. URL: www.wibilex.de/stichwort/
Gressmann [15.IX.2013]FREY, Jörg: Probleme der Deutung des Todes Jesu in der neutestamentlichen Wis-
senschaft. Streiflichter zur exegetischen Diskussion, in: FREY, Jörg; SCHRÖTER, Jens (Hgg.): Deutungen des Todes Jesu im Neuen Testament. Tübingen 2005, 3–50 (WUNT 181)
–– : Zum Weltbild im Jubiläenbuch. In: ALBANI, Matthias; FREY, Jörg; LANGE, Armin (Hgg.): Studies in the Book of Jubilees. Tübingen 1997, 261-293 (TSAJ 65)
FRIEDRICH, Johannes; RÖLLIG, Wolfgang: Phönizisch-punische Grammatik. Rom 31999 (Analecta orientalia; 55)
FUCHS, Andreas: Waren die Assyrer grausam? In: ZIMMERMANN, Martin (Hg.): Extreme Formen von Gewalt in Bild und Text des Altertums. München 2009, 65-119 (Münchner Studien zur Alten Welt; 5)
GEERTZ, Clifford: The interpretation of cultures. Selected essays, London 1973GERTZ, Jan-Christian; BERLEJUNG, Angelika; SCHMID, Konrad (Hgg.): Grundinformation
Altes Testament. Göttingen 42010 (UTB 2745) GESE, Hartmut: Zur biblischen Theologie. Alttestamentliche Vorträge, Tübingen 31989GESENIUS, Wilhelm: De Inscriptione Phoenico-Graeca in Cyrenaica. Halle 1825–– : Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Leipzig
171921–– : Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Be-
gonnen von Rudolf Meyer, bearb. und hrsg. von Herbert Donner, Berlin u. Heidel-berg 181987–2010
–– (Hg.): Johann Ludwig Burckhardt's Reisen in Syrien, Palästina und der Gegend des Berges Sinai. Weimar 1823 f.
–– : Paläographische Studien über phönizische und punische Schrift. Leipzig 1835–– : Punica Plautina. o.O. o.J.
39
Florian Lippke
–– : Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta quotquot supersunt. Leipzig 1837–– : Thesaurus philologicus criticus linguae Hebraeae et Chaldaeae Veteris Testa-
menti. Leipzig 1829–1858–– : Versuch über die maltesische Sprache zur Beurtheilung der neulich wiederhohl-
ten Behauptung, dass sie ein Ueberrest der altpunischen sey, und als Beytrag zur arabischen Dialektologie. Leipzig 1810
–– ; KAUTZSCH, Emil: Hebräische Grammatik (GK). Leipzig 281909GRÄTZ, Sebastian; SCHIPPER, Bernd: Alttestamentliche Wissenschaft in Selbstdarstel-
lungen. Göttingen 2009 (UTB 2920)GRESSMANN, Hugo: Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament. Tübingen
1909 [= GRESSMANN (1909a)] –– : Die Ausgrabungen in Palästina und das Alte Testament. Tübingen 1908 (Religi-
onsgeschichtliche Volksbücher 3. Reihe, Allgemeine Religionsgeschichte, Religi-onsvergleichung; 10)
–– : Musik und Musikinstrumente im Alten Testament. Eine religionsgeschichtliche Studie. Gießen 1903
–– : Palästinas Erdgeruch in der israelitischen Religion. Berlin 1909 [=GRESSMANN (1909b)]
–– : Tod und Auferstehung des Osiris nach Festbräuchen und Umzügen. Leipzig 1923 (Der Alte Orient Jg. 23/3)
GUNKEL, Hermann; BEGRICH, Joachim: Einleitung in die Psalmen. Die Gattungen der religiösen Lyrik Israels, Göttingen 1933
GUNKEL, Hermann: Genesis. Göttingen 41917 (Göttinger Handkommentar zum Alten Testament I. Abteilung, Die historischen Bücher; 1)
–– : Das Märchen im Alten Testament. Tübingen 1917–– : Die Psalmen. Göttingen 41926 (Göttinger Handkommentar zum Alten Testament,
II. Abteilung: Die poetischen Bücher; 2)–– : Reden und Aufsaetze. Göttingen 1913–– : Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit. Eine religionsgeschichtliche Unter-
suchung über Gen 1 und Ap Joh 12, Göttingen 1895HAAS, Hans; BONNET, Hans (Hgg.): Bilderatlas zur Religionsgeschichte. 13 erschiene-
ne Bände, Leipzig 1924–1934HALBWACHS, Maurice: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt
1985 (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft; 538) HARDMEIER, Christof; HUNZIKER-RODEWALD, Regine: Texttheorie und Texterschließung.
Grundlagen einer empirisch-textpragmatischen Exegese, in: UTZSCHNEIDER, Hel-mut; BLUM, Erhard (Hgg.): Lesarten der Bibel. Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Alten Testaments, Stuttgart 2006, 13–45
HARDMEIER, Christof: Textwelten der Bibel entdecken. Grundlagen und Verfahren ei-ner textpragmatischen Literaturwissenschaft der Bibel, Gütersloh 2003/4 (Text-pragmatische Studien zur Hebräischen Bibel; 1/1 f.)
HARTENSTEIN, Friedhelm: Die Unzugänglichkeit Gottes im Heiligtum. Jesaja 6 und der Wohnort JHWHs in der Jerusalemer Kulttradition, Neukirchen-Vluyn 1997 (WMANT 75)
–– : Weltbild und Bilderverbot. Kosmologische Implikationen des biblischen Monothe-ismus, in: MARKSCHIES, Christoph; ZACHHUBER, Johannes (Hgg): Die Welt als Bild.
40
Verbindungslinien
Interdisziplinäre Beiträge zur Visualität von Weltbildern, Berlin u. New York 2008, 15–37 (AKG 107)
HENGEL, Martin: Die vier Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus. Studien zu ihrer Sammlung und Entstehung, Tübingen 2008 (WUNT 224)
DE HULSTER, Izaak: Iconographic exegesis and Third Isaiah. Tübingen 2009 (FAT 2/36)
JANOWSKI, Bernd: Das biblische Weltbild. Eine methodologische Skizze, in: IDEM; EGO, Beate (Hgg.): Das biblische Weltbild und seine altorientalischen Kontexte. Tübin-gen 2001, 3–26 (FAT 36) [=JANOWSKI (2001a)]
–– ; EGO, Beate (Hgg.): Das biblische Weltbild und seine altorientalischen Kontexte. Tübingen 2001 (FAT 36)
JANOWSKI, Bernd: „Du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt“ (Ps 31,9). Gott, Mensch und Raum im Alten Testament, in: LOPRIENO, Antonio (Hg.): Mensch und Raum von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 2006, 35–70 (Colloquium Rauri-cum; 9)
–– (Hg.): Der ganze Mensch. Zur Anthropologie der Antike und ihrer europäischen Nachgeschichte, Berlin 2012
–– : Die heilige Wohnung des Höchsten. Kosmologische Implikationen der Jerusale-mer Tempeltheologie, in DERS.: Der Gott des Lebens. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments 3, Neukirchen-Vluyn 2003, 27–71
–– : Der Himmel auf Erden. Zur kosmologischen Bedeutung des Tempels in der Um-welt Israels, in: IDEM; EGO, Beate (Hgg.): Das biblische Weltbild und seine altorien-talischen Kontexte. Tübingen 2001, 229–260 (FAT 36) [=JANOWSKI (2001b)]
–– : Konstellative Anthropologie. Zum Begriff der Person im Alten Testament, in FREVEL, Christian (Hg.): Biblische Anthropologie. Neue Einsichten aus dem Alten Testament, Freiburg 2010, 64–87 (QD 237)
–– : Der Mensch im alten Israel. Grundfragen alttestamentlicher Anthropologie, in: ZThK102 (2005),143–175 [=JANOWSKI (2005a)]
–– : Rettungsgewißheit und Epiphanie des Heils. Das Motiv der Hilfe Gottes "am Morgen" im alten Orient und im Alten Testament (Band 1, Alter Orient), Neukir-chen-Vluyn 1989 (WMANT 59)
–– : Theologie des Alten Testaments. Zwischenbilanz und Zukunftsperspektiven, in: IDEM (Hg.): Theologie und Exegese des Alten Testaments / der Hebräischen Bibel. Zwischenbilanz und Zukunftsperspektiven, Stuttgart 2005, 87–124 (SBS 200) [= JANOWSKI (2005b)]
–– : Die Toten loben JHWH nicht. Psalm 88 und das alttestamentliche Todesver-ständnis, in: AVEMARIE, Friedrich; LICHTENBERGER, Hermann (Hgg.): Auferstehung – Resurrection. The Fourth Durham-Tübingen-Symposium (Resurrection, Exaltation and Transformation in Old Testament, Ancient Judaism, and Early Christianity), Tübingen 2001, 3–45 (WUNT 135) [=JANOWSKI (2001c)]
JOÜON, Paul; MURAOKA, Takamitsu: A Grammar of Biblical Hebrew. Rom 2006 (Subsi-dia Biblica; 27)
KAHLE, Paul: Die arabischen Bibelübersetzungen. Texte mit Glossar und Literatur-übersicht, Leipzig 1904
–– : Der hebräische Bibeltext seit Franz Delitzsch. Stuttgart 1961
41
Florian Lippke
–– : Die Kairoer Genisa. Untersuchungen zur Geschichte des hebräischen Bibeltex-tes und seiner Übersetzungen, Berlin 1962
–– : Masoreten des Ostens. Die ältesten punktierten Handschriften des Alten Testa-ments und der Targume, Leipzig 1913 (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Tes-tament; 15)
–– : Masoreten des Westens. 1. Texte und Untersuchungen zur vormasoretischen Grammatik des Hebräischen 1, Stuttgart 1927 (Beiträge zur Wissenschaft vom Al-ten Testament N.F.; 8)
–– : Masoreten des Westens. 2. Das Palästinische Pentateuchtargum, die palästini-sche Punktation, der Bibeltext des Ben Naftali, Stuttgart 1930 (Texte und Untersu-chungen zur vormasoretischen Grammatik des Hebräischen; 4, zugleich Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament; 50 Folge 3/14)
–– : Der masoretische Text des Alten Testaments nach der Überlieferung der babylo-nischen Juden. Leipzig 1902
–– : Opera minora. Festgabe zum 21. Januar 1956, Leiden 1956–– ; SCHMIDT, Hans: Volkserzählungen aus Palästina. Gesammelt bei den Bauern von
Bir-Zayt und in Verbindung mit Dschirius Jusif in Jerusalem, Göttingen 1918-1930KAHLE, Paul: Zur Geschichte des arabischen Schattentheaters in Egypten. Leipzig
1909 (Neuarabische Volksdichtung aus Egypten; 1)KEEL, Othmar: Die Geschichte Jerusalems und die Entstehung des Monotheismus.
Göttingen 2007 (Orte und Landschaften der Bibel; 4/1)KEEL, Othmar; UEHLINGER, Christoph (Hgg.): Göttinnen, Götter und Gottessymbole.
Neue Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen, mit einem Nachwort von Florian Lipp-ke, Fribourg 62010
KEEL, Othmar: Selbstverherrlichung. Die Gestalt Abrahams in Judentum, Christentum und Islam, Basel 2009 (Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Ba-sel; 45)
–– ; SHUVAL, Menachem; UEHLINGER, Christoph (Hgg.): Studien zu den Stempelsie-geln aus Palästina/ Israel. Band 3: Die frühe Eisenzeit, ein Workshop, Freiburg CH 1990 (OBO 100)
KLATT,Werner: Hermann Gunkel. Zu seiner Theologie der Religionsgeschichte und zur Entstehung der formgeschichtlichen Methode, Göttingen 1969 (FRLANT 100)
KRAELING, Emil: The Old Testament since the Reformation. London 1955 (Lutterworth library; 47)
KRATZ, Reinhard G.: Art. Redaktionsgeschichte/ Redaktionskritik I. Altes Testament, in: TRE 28 (1997), 367–378
KRAUS, Hans-Joachim: Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments. Neukirchen-Vluyn 41988
KREUZER, Siegfried; VIEWEGER, Dieter: Altes Testament. Ein Arbeitsbuch, Stuttgart 22005
KRÜGER, Thomas: Überlegungen zur Bedeutung der Traditionsgeschichte für das Ver-ständnis alttestamentlicher Texte und zur Weiterentwicklung der traditionsge-schichtlichen Methode. In: UTZSCHNEIDER, Helmut; BLUM, Erhard (Hgg.): Lesarten der Bibel. Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Alten Testaments, Stuttgart 2006, 233–245
42
Verbindungslinien
LE DONNE, Anthony: Theological Memory Distortion in the Jesus Tradition. A Study in Social Memory Theory, in: BARTON, Stephen (Hg.): Memory in the Bible and Anti-quity. The Fifth Durham-Tübingen Research Symposium (Durham, September 2004), Tübingen 2007, 163–177 (WUNT 212)
LEHMANN, Gunnar: Archäologie in der Welt der Bibel. In: Cardo 9 (2011), 5–12LEUENBERGER, Martin: Segen und Segenstheologien im alten Israel. Untersuchungen
zu ihren religions- und theologiegeschichtlichen Konstellationen und Transforma-tionen, Zürich 2008 (AThANT 90)
LICHTHEIM, Miriam: Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings (Volume III: The Late Period), Berkeley 1980
LIPPKE, Florian: GGG (Göttinnen, Götter und Gottessymbole) im forschungsge-schichtlichen Kontext. Zugleich ein Nachwort zur 6. Auflage, in: KEEL, Othmar; UEHLINGER, Christoph (Hgg.): Göttinnen, Götter und Gottessymbole. Neue Erkennt-nisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlos-sener ikonographischer Quellen, mit einem Nachwort von Florian Lippke, Fribourg 62010, 565–592 (= V.IRAT II-1 http://goo.gl/jRgkf)
–– : Rez. STAUBLI 2009. In review bei JNSL.–– : Skizzen zu ägyptisch-theologischen Kosmogonien und Schöpfungskonstellatio-
nen. Überblick und Anknüpfungspunkte, in: HIRSCH-LUIPOLD, Rainer; GRÜNSCHLOSS, Andreas (Hgg.): Kosmologie, Kosmogonie, Schöpfung. Tübingen im Druck (Ratio Religionis Studien; 2) [= LIPPKE (im Druck)]
–– : The Southern Levant in context. A brief sketch of important features related to the religious symbol system in the Bronze Ages, in: MYNÁROVÁ, Jana (Hg.): Egypt and the Near East – the Crossroads. Proceedings, Oxford 2011, 211–234
–– : Weitere Miscellanea zu den nordwestsemitischen Sonnengottheiten. Tübingen 2012 (V.IRAT; II-2)
LÖHR, Winrich A.: Epiphanes’ Schrift “Περὶ δικαιοσύνης”. In: BRENNEKE, Hanns-Christof (Hg.): Logos. Festschrift für Luise Abramowski zum 8. Juli 1993, Berlin 1993, 12–29 (Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche Beihefte; 67)
MÄNNCHEN, Julia: Gustaf Dalman als Palästinawissenschaftler in Jerusalem und Greifswald 1902–1941. Wiesbaden 1993 (ADPV; 9,2)
–– : Gustaf Dalmans Leben und Wirken in der Brüdergemeine, für die Judenmission und an der Universität Leipzig 1855–1902. Wiesbaden 1987 (ADPV; 9,1)
MARKSCHIES, Christoph: Alta trinità beata. Gesammelte Studien zur altkirchlichen Tri-nitätstheologie, Tübingen 2000
MARKSCHIES, Christoph; WOLF, Hubert, (Hgg.): Erinnerungsorte des Christentums. München 2010
MARKSCHIES, Christoph: Die Gnosis. München 2001 (Beck'sche Reihe 2173)–– : Kaiserzeitliche christliche Theologie und ihre Institutionen. Prolegomena zu einer
Geschichte der antiken christlichen Theologie, Tübingen 2009–– : Zwischen den Welten wandern. Strukturen des antiken Christentums, Europäi-
sche Geschichte, Frankfurt/Main 1997 (Fischer-Taschenbuch; 60101)MAURER, Michael: Kulturgeschichte. Eine Einführung, Köln u. Wien 2008 (UTB 3060)MENDELS, Doron: Societies of Memory in the Graeco-Roman World. In: BARTON,
Stephen (Hg.): Memory in the Bible and Antiquity. The Fifth Durham-Tübingen Re-
43
Florian Lippke
search Symposium (Durham, September 2004), Tübingen 2007, 143–161 (WUNT 212)
METTINGER, Tryggve: Israelite aniconism. Developments and origins, in: VAN DER TOORN, Karel (Hg.): The Image and the book. Iconic Cults, Aniconism and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, Brussels 1997, 173–204
PATZEL-MATTERN, Katja: Geschichte im Zeichen der Erinnerung. Subjektivität und kul-turwissenschaftliche Theoriebildung, Stuttgart 2002 (Studien zur Geschichte des Alltags; 19)
PEDERSEN, Esther Oluffa: Die Mythosphilosophie Ernst Cassirers. Zur Bedeutung des Mythos in der Kantischen Erkenntnistheorie und in der Sphäre der modernen Poli-tik, Würzburg 2009
PEZZOLI-OLGIATI, Daria: Die Gegenwelt des Todes in Bild und Text. Ein religionswis-senschaftlicher Blick auf mesopotamische Beispiele, in: BICKEL, Susanne et al. (Hgg.): Bilder als Quellen – Images as Sources. Studies on Ancient Near Eastern Artefacts and the Bible Inspired by the Work of Othmar Keel, Freiburg CH 2007, 379–401 (OBO Sonderband)
POPKES, Enno E.: Das Menschenbild des Thomasevangeliums. Untersuchungen zu seiner religionsgeschichtlichen und chronologischen Einordnung, Tübingen 2007 (WUNT 206)
PROBST, Hermann: Paulus und der Brief. Die Rhetorik des antiken Briefes als Form der paulinischen Korintherkorrespondenz (1 Kor 8–10), Tübingen 1991 (WUNT II/45)
DE PURY, Albert: Der geschichtliche Werdegang Jerusalems als Ausdruck der “verti-kalen” Oekumene. Plaidoyer für ein versöhntes Jerusalem, in: BICKEL, Susanne et al. (Hgg.): Bilder als Quellen – Images as Sources. Studies on Ancient Near Eas-tern Artefacts and the Bible Inspired by the Work of Othmar Keel, Freiburg CH 2007, 529–558 (OBO Sonderband)
REINHARD, Wolfgang: Die anthropologische Wende der Geschichtswissenschaft. In: WAGNER, Andreas (Hg.): Anthropologische Aufbrüche. Alttestamentliche Men-schenkonzepte und anthropologische Positionen und Methoden, Göttingen 2009, 79–99 (FRLANT 23)
REVENTLOW, Henning: Epochen der Bibelauslegung (4 Bände). München 1990–2011ROHLS, Jan: Protestantische Theologie der Neuzeit. Tübingen 1997RÖLLIG, Wolfgang: Semitische Inschriften auf Grabdenkmälern Syriens und der Le-
vante. Formale und inhaltliche Aspekte, in: BOL, Renate (Hg.): Sepulkral- und Vo-tivdenkmäler östlicher Mittelmeergebiete (7. Jh. v. Chr.–1. Jh. n. Chr.). Kulturbe-gegnungen im Spannungsfeld von Akzeptanz und Resistenz, Paderborn 2004, 23–32
–– : Sinn und Form. Formaler Aufbau und literarische Struktur der Karatepe-Inschrift, in: ARSEBÜK, Güven (Hg.): Light on Top of the Black Hills. FS H. Çambel, Istanbul 1998, 675-680
RONNING, Christian: Vom Ritual zum Text - und wieder zurück? In: ZENGER, Erich (Hg.): Ritual und Poesie. Formen und Orte religiöser Dichtung im Alten Orient, im Judentum und im Christentum, Freiburg 2003, 1–23 (HBS 36)
ROSELLINI, Ippolito: I monumenti dell'Egitto e della Nubia. Pisa 1832–1844
44
Verbindungslinien
RÜTERSWÖRDEN, Udo: Wilhelm Gesenius. In: WiBiLex 2007. URL: www.wibilex.de/ stichwort/Gesenius [15.IX.2013]
SAEBØ, Magne (Hg.): Hebrew Bible, Old Testament. The history of its interpretation (bisher 3 Bände), Göttingen 1996 ff.
SANDEL, Marcus: Historizität der Erinnerung/ Reflexion des Historischen. Die Heraus-forderung der Geschichtswissenschaft durch die kulturwissenschaftliche Gedächt-nisforschung, in: OESTERLE, Günter (Hg): Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung, Göttingen 2005, 89–119 (For-men der Erinnerung; 26)
SCHMID, Konrad: Literaturgeschichte des Alten Testaments. Eine Einführung, Darm-stadt 2008.
SCHMITHALS, Walter: Die Gnosis in Korinth. Göttingen 21965 (FRLANT 66 NF 48)–– : Die Korintherbriefe als Briefsammlung. In: ZNW 64 (1973), 263–288. SCHROER, Silvia; KEEL, Othmar: IPIAO. Die Ikonographie Palästinas/Israels und der
Alte Orient. Eine Religionsgeschichte in Bildern: Bd. 1, Vom ausgehenden Mesoli-thikum bis zur Frühbronzezeit, Fribourg 2005
SCHROER, Silvia (Hg.): Images and gender. Contributions to the hermeneutics of read-ing ancient art, Freiburg CH 2006 (OBO 220)
SCHWEMMER, Oswald: Ernst Cassirer. Ein Philosoph der europäischen Moderne, Ber-lin 1997
SEEBA, Hinrich: New Historicism und Kulturanthropologie. Ansätze eines deutsch-a-merikanischen Dialogs, in: SCHOLTZ, Gunter (Hg.): Historismus am Ende des 20. Jahrhunderts. Eine internationale Diskussion, Berlin 1997, 40–54
SMEND, Rudolf: Deutsche Alttestamentler in drei Jahrhunderten. Göttingen 1989–– : From Astruc to Zimmerli. Old Testament Scholarship in three Centuries, Tübin-
gen 2007SOMMER, Benjamin: A prophet reads scripture. Allusion in Isaiah 40–66, Stanford
1998 STAUBLI, Thomas: Antikanaanismus. Ein biblisches Reinheitskonzept mit globalen
Folgen, in: BURSCHEL, Peter; MARX, Christoph (Hgg.): Reinheit. Wien 2011, 349–388
–– : Musik in biblischer Zeit und orientalisches Musikerbe. Stuttgart 2007–– (Hg.): Vertikale Ökumene. Erinnerungsarbeit im Dienst des interreligiösen Dia-
logs, Freiburg CH 2005–– (Hg.): Wer knackt den Code? Meilensteine der Bibelforschung, Mannheim 2009STECK, Odil H.: Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik, ein Arbeits-
buch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, Neukirchen-Vluyn 141999TILLY, Michael; ZWICKEL, Wolfgang: Religionsgeschichte Israels. Von der Vorzeit bis zu
den Anfängen des Christentums, Darmstadt 2011UEHLINGER, Christoph: Die Elfenbeinschnitzereien von Samaria und die Religionsge-
schichte Israels. Vorüberlegungen zu einem Forschungsprojekt, in: SUTER, Claudia E./ UEHLINGER, Christoph: Crafts and Images in Contact. Studies on Eastern Medi-terranean art of the first millennium BCE, Fribourg 2005, 149–189 (OBO 210) [=UEHLINGER (2005b)]
45
Florian Lippke
–– : Gab es eine joschianische Kultreform? Plädoyer für ein begründetes Minimum, in: GROSS, Walter (Hg.): Jeremia und die „deuteronomistische Bewegung“. Wein-heim 1995, 57–89 (BBB 98)
–– : „Medien“ in der Lebenswelt des antiken Palästina? In: FREVEL, Christian (Hg.): Medien im antiken Palästina. Materielle Kommunikation und Medialität als Thema der Palästinaarchäologie, Tübingen 2005, 31–61 (FAT II/10) [=UEHLINGER (2005a)]
UTZSCHNEIDER, Helmut; NITSCHE, Stefan: Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibe-lauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh 2001
UTZSCHNEIDER, Helmut; BLUM, Erhard (Hgg.): Lesarten der Bibel. Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Alten Testaments, Stuttgart 2006
ZAKOVITCH, Yair: The Interpretative Significance of the Sequence of Psalms 111-112.113-118.119. In: ZENGER, Erich (Hg.): The Composition of the Book of Psalms. Leuven 2010, 215–228 (Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium; 238)
–– : Juxtapositionen im Buch der Psalmen (»Tehillim«). In: HOSSFELD, Frank-Lothar (Hg.): Das Manna fällt auch heute noch. Beiträge zur Geschichte und Theologie des Alten, Ersten Testaments, Freiburg 2004, 660–673 (HBS 44) [=ZAKOVITCH (2004a)]
-Even Ye .(Introduction to Inner-Biblical Interpretation) מבוא לפרשנות פנים מקראית : ––huda 1992/3
–– : Psalm 82 and biblical exegesis. In: COHEN, Chaim (Hg.): Sefer Moshe. The Moshe Weinfeld jubilee volume. Studies in the Bible and the Ancient Near East, Qumran, and Post-Biblical Judaism, Winona Lake 2004, 213–228 [=ZAKOVITCH (2004b)]
ZENGER, Erich: Einleitung in das Alte Testament. Herausgegeben von Christian Fre-vel, Stuttgart 82011 (Kohlhammer Studienbücher Theologie; 1,1)
–– (Hg.): Ritual und Poesie. Formen und Orte religiöser Dichtung im Alten Orient, im Judentum und im Christentum, Freiburg 2003 (HBS 36)
–– : Theophanien des Königsgottes JHWH. In: IDEM (Hg.): Ritual und Poesie. Formen und Orte religiöser Dichtung im Alten Orient, im Judentum und im Christentum, Freiburg 2003, 163–190 (HBS 36)
ZIMMERMANN, Alfred: Die urchristlichen Lehrer. Tübingen 21988 (WUNT 2,12)
Appendix: Exkurs zu Apposition und Diachronie
Es soll nur kurz auf eine immer wieder auftauchende Argumentationsfigur am
Beispiel von Ex 3 hingewiesen werden:
(BHS) Ex 3,1 צאן יתרו חתנו כהן מדין־ומשה היה רעה את
(ELB) Ex 3,1Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwie-
gervaters, des Priesters von Midian.In dieser Apposition, der Beifügung im gleichen Fall, begegnen drei Inhaltsa-
spekte: Der Eigenname (Jitro), die verwandtschaftliche Funktion (Schwieger-
46
Verbindungslinien
vater) und eine soziale (kultische?) Einordnung (Priester von Midian). Im Re-
gelfall stellt diese kompakte, aber inhaltsreiche Phrase keinerlei Verständnis-
probleme dar. Bei Berner115 lautet die Einschätzung folgendermaßen: Es sei
„nicht zu übersehen, dass die Titulatur des Schwiegervaters […] überfüllt ist,
was auf redaktionelle Arbeit schließen lässt“. Damit wird aber eine völlig gängi-
ge syntaktische Fügung hyperkritisch116 zerlegt und in einer methodischen
Engführung redaktionsgeschichtlich-diachron ausgewertet.117 Wie adäquat die-
se Vorgehensweise zur literarischen Überlieferung des restlichen (süd)östli-
chen Mittelmeerraumes passt, kann ein Blick in die nordwestsemitische Epi-
graphik, aber auch in die ägyptische Sepulkralliteratur zeigen. Bei allen folgen-
den Texten ist eine Fortschreibung im kleinschrittigen Bereich, wie sie Berner
für Ex 3,1 annimmt nicht plausibel denkbar;118 erst recht nicht durch unter-
schiedliche Tradentengruppen.
KAI 10: Ich bin JḤWMLK, König von Byblos, Sohn des JḤRBcL, Enkel des ᵓRMLK, Königs von Byblos (…)KAI 13: Ich, TBNT, Priester der cAštart, König der Sidonier, Sohn des ᵓŠMNcZR (…)KAI 26: Ich bin ᵓZTWD, der ein Gesegneter des Bacal ist, Diener des Bacal, (…) König der Danuna (…)KAI 181: Ich (bin) MŠc, Sohn des KMŠ[JT], König von Moab, der Dibonite (…)
Aus dem ägyptischen Bereich können beliebig viele Titulaturen aufgeführt wer-
den, die komplexer, länger und umfassender sind und mithin offensichtlich in
einem handwerklichen Akt ausgeführt wurden sind:
“The one honored by Amun, great favorite of the lord of Thebes; the Fourth Proph-et of Amen-Re, King of Gods, the herald and follower of Amen-Re, King of Gods;
115 (2010), 59.116 Cf. Anm. 19. 117 Das methodische Schlagwort, das die Vorgehensweise adäquat beschreibt lautet Komple-xitätsreduktion, cf. BLUM (2005), 13 f.27. Es besteht eine latente Gefahr: Durch Komplexitäts-reduktion werden die Optionen und Lösungsszenarien minimiert, eine eindeutige Lösung (diachrone Entwicklung) wird postuliert und nicht hinterfragt. Das Ergebnis ist (prima vista) eindeutig, weil man zuvor alle anderen Möglichkeiten ausgeblendet hat. Dies ist als Zirkel-schluss zu klassifizieren, oder mit Blum „eine Münchhausen-Lösung, nämlich de[r] Versuch[], sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Daten-Defizienz zu ziehen“, zitiert nach ebd., 28. 118 Als Fortschreibungsmodelle sollten insgesamt eher die Blockmodelle favorisiert werden (cf. ebd., 11.22).
47
Florian Lippke
the chief incense-bearer before Amun; the one who performs the robing and pre-pares his holy chapel; the monthly priest of the House of Amun of the third phyle; the second prophet of Mut, mistress of heaven, the prophet of Khons of Benent; the chief scribe of the temple of Khons; the priest who goes in front of him whose throne endures, Amen-Re, King of Gods; the prophet of Amun, Conqueror-of-for-eign-lands; the prophet of Amun, the living protection; the guardian of the chest of the House of Amun of the second phyle; the Eyes of the King in Ipet-sut, the Tongue of the King in Upper Egypt; who begs jubilees for his lord the King from the gods of this land; the fan-bearer to the right of the King, who strides freely in the palace; the true intimate of Horus, his beloved, Djedkhonsefankh, son of the prophet of Amen-Re, King of Gods, who saw the sacred Horus of the palace, Nes-pernebu; born of the sistrum player of Amen-Re, Nesmut (…)”.119
Offensichtlich sind solche umfänglichen Titulaturen, wie die hier aufgeführte
des Nespernebu, problemlos in kohärenten Texten zu finden, ohne dass sich
aus ihnen ein Verdacht auf diachrone Brüche ableiten ließe. Die ägyptischen
Texte, Statueninschriften, sind als synchrone Texte zu klassifizieren. Auch
kürzere Titulaturen zeigen eine komplexere Form:
“The prince, count, royal seal-bearer; true, beloved King’s friend; keeper of the dia-dem of the God’s Adoress; royal servant in the royal harem; em-balmer-priest-of-Anubis of the God’s Wife; prophet of the God’s Adoress, Amenird-is, justified, in her ka-chapel; steward of the ka-priests; prophet of Osiris Giver of Life; the Steward Harwa, son of the scribe Pedimut, justified, (…)” 120
Es zeigt sich auch hier eine extreme Akkumulation von Titeln in Form von Ap-
positionen. Die oben von Berner vermutete Überfülle in Ex 3 ist als nicht-ad-
äquate Einschätzung zu klassifizieren, nicht zuletzt, weil in den genannten
Kontexten sicherlich nicht von literarischem Wachstum und redaktionsge-
schichtlichen Zusätzen in der oben diskutierten Art auszugehen ist. Wie viele
Hände/Schichten wären bei der Inschrift des Nespernebu oder des Pedimut
nach der angedeuteten Methodik voneinander zu scheiden? In diesen Fällen
der Apposition führt die diachrone Zersplitterung auf einen Irrweg.
Zudem ist auf Folgendes hinzuweisen: In Ex 3,10 begegnet die Aussage „so
gehe nun hin, ich will dich zu Pharao senden, daß du mein Volk, die Kinder Is-
rael, aus Ägypten führest“ (ELB). Berner charakterisiert nun das „Nebeneinan-
der“ von „mein Volk“ und „die Kinder Israel“ als „störend“ und „auffällig“. Die
vorgeschlagene Lösung des von ihm identifizierten Textproblems ist wiederum
die diachrone Beseitigung. Dies stellt erneut eine Engführung da. Der Sach-
119 LICHTHEIM (1980), 14.120 Ebd., 25.
48
Verbindungslinien
verhalt hätte auch im Rahmen einer synchronen Analyse unter den Gesichts-
punkten der Stilistik/Struktur und Komposition diskutiert werden können. Am
Ende der skizzierten Vorgehensweise steht ein methodisches Problem: Wenn
jede Apposition redaktionsgeschichtlich zergliedert wird121 und ein Indiz auf
diachrones Wachstum darstellt, wie hätte ein antiker Verfasser(kreis) eine ech-
te synchrone Apposition ausdrücken können? Die Vorgehensweise führt in
eine Aporie und ist gerade methodisch als nicht (stark) abgesichert zu klassifi-
zieren122.
121 Etwas komplexer stellt sich der Sachverhalt bei doppelter Zuschreibung wie z.B. Ex 32,35 dar; dies gilt aber auch nur dann, wenn עשה hier nicht polysem für unterschiedlich akzentu-ierte Handlungen stehen kann.122 Zu ähnlicher Positionierung kommt BLUM (2005), 23: „Bezogen auf das gängige Verständ-nis von Literarkritik scheint sich (…) abzuzeichnen, daß deren Kernkriterien in ihrer Tragfä-higkeit bisher oft weit überschätzt werden.“
49
![Page 1: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Lippke (2014.2), Verbindungslinien [RVO 2|CO 1,1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022213/6320792ea3cd9cf896067893/html5/thumbnails/38.jpg)













![Sunset Seed & Plant Co. (Sherwood Hall Nursery Co.) : [catalog]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63266583e491bcb36c0ac5ab/sunset-seed-plant-co-sherwood-hall-nursery-co-catalog.jpg)