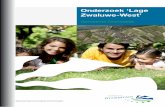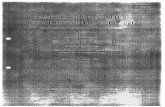Straßennetzwerkanalysen zur Unterstützung sozialräumlicher Untersuchungen - das Projekt CoMStaR
Lage 2009 - Schleifknochen versus Schabbahnknochen. Untersuchungen zur Verwendung steinzeitlicher...
-
Upload
schloss-gottorf -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Lage 2009 - Schleifknochen versus Schabbahnknochen. Untersuchungen zur Verwendung steinzeitlicher...
LAGE
XX
Schleifknochen versus Schabbahnknochen: Untersuchungen zur Verwendung steinzeitlicher Langknochen von Großsäugern mit konkaven Arbeitsbahnen
W. Lage Archäologisches Landesmuseum Schleswig-Holstein, Schleswig
Eine in mesolithischen Kontexten Südskandinaviens regelmäßig auftre-tende Artefaktgruppe sind lateral oft mehrseitig bearbeitete und wie groß-flächig glatt poliert erscheinende Langknochen von großen Säugetieren. Während diese Funde in der archäologischen Forschung bislang meist als Schleifgeräte angesprochen wurden, kann in der vorliegenden Material-studie gezeigt werden, dass es sich bei ihnen um Knochen handelt, die wahrscheinlicher zur Gewinnung von Knochenpulver dienten. Keinesfalls können die auf ihnen zu konstatierenden Spuren durch Schleifen entstan-den sein. Bestärkt wird diese Erkenntnis auch durch Experimente an re-zenten Knochen.
Experimentelle Archäologie, Mesolithikum, Knochenwerkzeuge, Knochenpulver
EINLEITUNG
Die mit den mesolithischen und früh-neolithischen Kulturen in Zusam-menhang stehenden Ausgrabungen in Dänemark, Norddeutschland und Nordpolen erbrachten neben Flintar-tefakten auch oftmals gut erhaltenes Knochenmaterial der für diese Perio-den charakteristischen Faunenbe-stände (Schmölcke 2001; Schmölcke et al. 2006). Unter den zur wissenschaftlichen Untersuchung in die Archäologisch-Zoologische Arbeitsgemeinschaft des Archäologischen Landesmu-seums Schleswig-Holstein, Schloss
Gottorf, Schleswig, eingelieferten Tierknochen und Geweihen finden sich selten aber immer wiederkeh-rend Metapodien, die im Bereich der Diaphyse (Knochenschaft) konkave Ausbuchtungen in Längsrichtung aufweisen (Abb. 1). Bislang wurden diese offensichtlich intensiv bearbei-teten Knochen fast ausschließlich als Schabgerät beziehungsweise „Schleifknochen“ interpretiert (Ewer-sen 2007). So stellt B. B. Henriksen (1976) drei Verwendungsmöglichkei-ten der von ihr als „bones with facets by scraping“ bezeichneten Knochen-artefakte zur Diskussion. Danach
SCHRIFTEN DES NATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREINS FÜR SCHLESWIG-HOLSTEIN
EINGEGANGEN 05-07-2009 REVIDIERT 24-11-2009 ONLINE 11-12-2009 © 2009 Autor
SCHR NATURWISS VER SCHLESW-HOLST 71 26-40 Kiel XII-2009
FORSCHUNGSARTIKEL
SCHLEIFKNOCHEN VERSUS SCHABBAHNKNOCHEN
27
repräsentieren Knochen mit ge-schabten und geglätteten Oberflä-chen eine Phase der Werkzeugher-stellung. Das würde durch das gele-gentliche Auftreten von Stichelbah-nen bewiesen, die zur Auslösung von weiter zu bearbeitenden Knochen-fragmenten angebracht worden sei-en. Zweitens sieht sie in den Kno-chen, deren Schab- und Polierberei-che sich auf die Epiphyse ausweiten, Artefakte, an denen nur der letztge-nannte Bereich als funktional rele-vant in Erscheinung träte. Schließlich hebt sie Knochen mit geöffnetem Markkanal und gleichzeitig unbehan-delten Epiphysen (gemeint sein dürf-ten Epiphysen ohne Abnutzungsspu-ren) hervor. Hier würden die scharfen Kanten der aneinander grenzenden
Facetten die Schneiden von Werk-zeugen ausmachen, die etwa bei der Lederbearbeitung eine Rolle gespielt haben könnten. Durch das Tieferle-gen der Schabbahnen würden die als Schneiden dienenden Kanten fort-während scharf gehalten. Vor einigen Jahren wurde konträr zu den gängigen Interpretationen die These formuliert, die Schabbahnkno-chen hätten primär der Erzeugung von Knochenpulver gedient (David 2004). Die vorliegende Studie möchte einen Beitrag leisten, die Funktion der sogenannten „Schleifknochen“ durch eine vergleichende Feinanalyse zu klären.
MATERIAL UND METHODEN
Um möglichst viele der den infrage kommenden Knochen anhaftenden
Modifikationen miteinander verglei-chen zu können, ist eine statistische
Abbildung 1 Fundplatz Hüde I (Niedersachsen). Beispiele sogenannter „Schleif-knochen“ – hier Metatarsen vom Auerochsen (Bos primigenius).
LAGE
28
Erfassung von insgesamt 100 Schabbahnknochen durchgeführt worden (Tab. 1). Dabei stammen 78 vom Fundplatz Hüde I am Dümmer (Kreis Diepholz, Niedersachsen), einer spätmesolithisch/neolithischen Jagdstation. Die 39 mit stratigraphi-schen Angaben versehenen Fund-stücke verteilen sich wie folgt über drei dort nachgewiesene Siedlungs-horizonte: Schicht mit Spitzbodenke-ramik n = 24, Schicht mit Bischhei-mer- und früher Trichterbecherkera-mik n = 6, Schicht mit entwickelter Trichterbecherkeramik n = 9. Acht weitere Artefakte stammen von dem mesolithisch/neolithischen Fundplatz Berlin LA 4 (Heidmoor, Kreis Sege-berg, Schleswig-Holstein), drei bzw. zwei von den zeitgleichen Fundplät-zen Bebensee (Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein) und Seedorf LA
245 (Heidmoor, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein), ein Streufund aus Ascheberg (Kreis Plön, Schles-wig-Holstein), sowie vier von er-tebøllezeitlichen Fundplätzen auf Rügen (je einer aus Saiser 1 und Breetzer Ort, zwei aus Baabe). Aus Dąbki 9, einem ebenfalls ertebølle-zeitlichen Fundplatz an einem ver-landeten Haffsee nahe Koszalin in Polen, stammen vier mit Facetten versehene Knochen. Weitere sind bei jüngsten Grabungskampagnen zutage getreten, konnten in dieser Untersuchung aber nicht mehr er-fasst werden (Abb. 2). Alle Artefakte wurden tierartlich bestimmt und hin-sichtlich verschiedener Merkmale in einer Datenbank charakterisiert. Dabei sind metrische Parameter wie die Maße des Knochens (nach von den Driesch 1976) sowie Länge und
Tabelle 1 Räumliche und zeitliche Verteilung der in dieser Studie aufgeführten Schabbahnknochen. TBK = Trichterbecherkultur. Holmegaard und Sværdborg I nach Hendriksen 1976. Friesack 4 nach B. Gramsch, freundliche mündliche Mitteilung.
Fundplatz Kultur Datierung Anzahl der Schabban-knochen
Friesack 4 Maglemose 8500-6500 v. Chr. belegt Holmegaard I, IV, V spätes Maglemose um 7000 v. Chr. keine Angabe Sværdborg I spätes Maglemose um 7000 v. Chr. keine AngabeHüde I Rössen/TBK 5. Jahrtausend 78 Berlin LA 4 Ertebølle/TBK 5400-3500 v. Chr. 8 Dąbki 9 Ertebølle 4800-4000 v. Chr. 4 Bebensee LA 76 Ertebølle/TBK 5400-3500 v. Chr. 3 Seedorf LA 245 Ertebølle/TBK 5400-3500 v. Chr. 2 Baabe Ertebølle 4300-4100 v. Chr. 2 Breetzer Ort Ertebølle 4800-4600 v. Chr. 1 Saiser 1 Ertebølle 4500-4000 v. Chr. 1 Ascheberg Streufund undatiert 1
SCHLEIFKNOCHEN VERSUS SCHABBAHNKNOCHEN
29
Breite der als Abhubbahnen be-zeichneten bearbeiteten Knochenbe-reiche ebenso protokolliert worden wie Anzahl, Lage und Ausrichtung dieser Bahnen und deren Oberflä-chenkontur (konkav, konvex, plan, Existenz von Schwellen, Absätzen oder Rattermarken). Diese Daten-bank ist im Internet frei zugänglich (Lage 2009). Ergänzend wurden an einer rezenten Tibia vom Rothirsch Versuche unternommen, um die an den vorgeschichtlichen Artefakten zu
beobachtenden Bearbeitungsspuren nachzuvollziehen. Dazu sind ver-schiedene rekonstruierte Flintgeräte verwendet worden, die aus dem Fundmaterial ertebøllezeitlicher Plät-ze bekannt sind, wie Kernfragmente oder kompaktere Abschläge mit einem Schneidenwinkel von etwa 90°. Experimentelle Archäologie ist seit langem eine bewährte Methode, um steinzeitliche Arbeitstechniken zu rekonstruieren (Stodiek und Paulsen 1996; Lage 2004).
Hüde I
Dąbki 9
Friesack
Holmegaard Sværdborg
Ascheberg
Bebensee
Baabe Saiser 1
Breetzer Ort
Berlin, Seedorf
Abbildung 2 Herkunft der in der Studie berücksichtigten Knochenartefakte.
LAGE
30
Abbildung 3 Fundplatz Hüde I (Niedersachsen). Intentionell bearbeitete Ulna eines Braunbären (Ursus arctos).
Abbildung 4 Artzuordnung der in der Studie berücksichtigten 100 Schabbahnkno-chen. Bei den Rinderknochen, die aufgrund ihrer geringen Größe Hausrindern zu-geordnet werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie von weiblichen Uren stammen.
SCHLEIFKNOCHEN VERSUS SCHABBAHNKNOCHEN
31
ERGEBNISSE
1. Tierartenspektrum und verwende-te Skelettelemente. Die untersuchten Schabbahnknochen stammen mehr-heitlich von Boviden (Rindern). Bei diesen Knochen ist auf der Basis morphologischer Merkmale oftmals eine definitive Zuordnung zu Haus- oder Wildrind nicht möglich, die vom Ur (Bos primigenius) stammenden Funde scheinen aber deutlich zu überwiegen. Außerdem sind Pferd (Equus ferus), Reh (Capreolus ca-preolus), Rothirsch (Cervus elaphus), Elch (Alces alces), Wildschwein (Sus scrofa) und Bär (Ursus arctos) vertre-ten (Abb. 3, 4). Rinderknochen wur-den auch im Verhältnis zu den nach-gewiesenen Faunenresten über-durchschnittlich häufig als Schab-bahnknochen verwendet (Abb. 5). 83% der in dieser Studie analysierten Schabbahnknochen liegen unvoll-
ständig vor. In der Regel sind sie nur als Proximal- oder Distalfragmente erhalten. Metapodien (Mittelfuß- und Mittelhandknochen) sind aufgrund ihres geraden Seitenverlaufs mehr-heitlich verwendet worden (Abb. 6). Aber auch Schienbeinknochen von Rothirsch (Saiser I) und Wildschwein (Holmegaard IV), eine Elle von ei-nem Bär (Hüde I) sowie einen Ra-dius von einem Rothirsch (Berlin-Heidmoor) hat man für den genann-ten Zweck herangezogen. 2. Position und Anzahl der Abbau-bahnen. Die Schabbahnen sind auf den Metapodien mehrheitlich lateral positioniert. Dabei fällt auf, dass sich bei den relativ wenigen Artefakten zum Beispiel aus Bebensee, Berlin, Seedorf und Dąbki 9 die Bahnen (meistens auf jeder Seite eine) paral-lel zueinander positioniert finden,
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Wild- und Hausrind Wildpferd Elch Rothirsch Braunbär
Anteil [%]
Schabbahnknochen
Gesamtspektrum
Abbildung 5 Fundplatz Hüde I (Niedersachsen). Artzuordnung der Schabbahnkno-chen im Vergleich zu den Anteilen des Großwildes am Nahrungsabfall (berechnet nach Hübner et al. 1988).
LAGE
32
während die überwiegende Mehrzahl der Schabbahnknochen von Hüde I Bahnen aufweisen, die spitzwinklig zur Ventralseite konvergieren (Abb. 7). Letztere Beobachtung lässt den Schluss zu, dass durch das „Kippen“ der Bahnen die ventralseitige Kom-pakta (in einigen Fällen auch die dorsalseitige) länger als bei den parallel positionierten abgebaut wer-den konnte, bevor der Knochen an seiner dünnsten Stelle, meistens in der Mitte desselben, schließlich kol-labierte. Die Zahl der Abhubbahnen pro Kno-chen variiert zwischen 1 und 5. Zwei Abbaubahnen pro Knochen überwie-gen allerdings (Abb. 8). Insgesamt weisen die 100 untersuchten Artefak-te 218 Abbaubahnen auf. Fünf Ab-hubbahnen (2%) mit Facetten bele-gen, dass es beim Abbau einer Bahn gelegentlich zum „Verkippen“ des Schabwerkzeuges gekommen ist.
3. Bearbeitungs- und Abnutzungs-spuren. Die Stellen seitlich der dop-pelt holmartig ausgebildeten Dorsal-seiten von Boviden-Mittelfußknochen sowie deren Ventralseiten sind häu-fig von Riefen und Rattermarken, bedeckt, die den Beginn neuer Ab-hubbahnen anzeigen dürften. Quer verlaufende Schnittspuren, die zwischen den Enden der Abhubbah-nen und den Knochenenden anzu-treffen sind, können mit der Zerle-gung des Tieres nach der Schlach-tung in Verbindung gebracht werden. Spätere Überprägungen treten gele-gentlich als diagonal die Oberfläche der Schabbahn schneidende Riefen-bündel in Erscheinung. In welchem Tätigkeitszusammenhang sie ent-standen sein könnten, lässt sich nicht mehr feststellen. Die mehrheitlich auf dem Distalende befindlichen und durch Absätze mar-
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Metatarsus Metacarpus Radius, Ulna, Femur, Tibia
Anzahl
Abbildung 6 Anteile der als Schabbahnknochen genutzten Skelettelemente.
SCHLEIFKNOCHEN VERSUS SCHABBAHNKNOCHEN
33
kierten Ausläufe der einzelnen Schabhübe sind durch sich über-deckende Riefen und häufig auch durch Rattermarken gekennzeichnet (Abb. 7). Das Schaben ist offensicht-lich auch dann fortgesetzt worden, wenn sich der Markkanal bereits geöffnet hatte (Abb. 7). Das lässt sich besonders gut an den vollstän-dig erhaltenen Schabbahnknochen beobachten. An den Proximal- und Distalfragmenten kann die Öffnung bzw. Nichtöffnung des Markkanals, aufgrund ungünstiger Erhaltungsbe-dingungen, häufig nicht mehr nach-vollzogen werden. Insgesamt ist bei 99 der 218 untersuchten Bahnen (45%) der Markkanal eröffnet. Zwölf Schabbahnknochen weisen an
ihrem Proximalende intentionelle Eintiefungen in Längsrichtung des Knochens auf, die trichterförmig ausgebildet sind und vielleicht als Fixierhilfe gedient haben (Abb. 9). 4. Experimentelle Archäologie. Das Schabexperiment an einer rezenten Rothirsch-Tibia führte zu einem ver-gleichbaren Erscheinungsbild wie bei den archäologischen Artefakten. Auch die durch die konvexe Form der Feuersteinschneide vorgegebene konkave Aushöhlung der Arbeits-bahn (gemeint ist jetzt die Oberflä-chenkontur 90° zur Arbeitsrichtung) findet sich auf den steinzeitlichen Funden in gleicher Weise wie auf dem rezenten Experimentierkno-chen. Verschleiert wird diese
Abbildung 7 Fundplatz Hüde I (Niedersachsen). Metapodium distal vom Aueroch-sen (Bos primigenius): 1 - Durch Schaben mit einem Flintgerät geöffneter Markkanal; 2 - Spitzwinklig zu einem Grat konvergierende Abhubbahnen; 3 - Rattermarken.
LAGE
34
Aushöhlung bei Erreichen des Mark-kanals, wenn sich eine durch das Schaben ausgedünnte Knochen-schicht etwa durch Austrocknung aufwirft und zunächst der Eindruck einer konvexen Bahn entsteht. Die beschriebene Bearbeitung des Kno-chens erbrachte als Resultat ein feines Knochenpulver (Abb. 10).
DISKUSSION
Die im Rahmen dieser Studie vorge-nommene Untersuchung der facet-tierten Langknochen macht deren Verwendung als Schabgerät oder „Schleifknochen“ unwahrscheinlich. Gegen diese Interpretation spricht: (a) Das regelmäßige Auftreten von sogenannten „Rattermarken“, also quer zur Arbeitsrichtung verlaufen-den Riffeln mit variierender Amplitu-
Abbildung 8 Anzahl der Abhubbah-nen an den Schabbahnknochen.
Abbildung 9 Fundplatz Hüde I (Niedersachsen). Metapodium vom Auerochsen (Bos primigenius) mit intentioneller Eintiefung am Proximalende in Längsrichtung des Kno-chens (kleines Foto) und paariger Lochung im distalen Bereich.
SCHLEIFKNOCHEN VERSUS SCHABBAHNKNOCHEN
35
de der „Wellen“ und „Täler“. Sie lassen sich auch noch bei fortge-schrittener Aushöhlung des Kno-chens auf den Schabbahnen be-obachten. Diese charakteristische Oberflächenstruktur entsteht durch eine nicht ausreichende Fixierung des Knochens während der Schab-arbeit, wodurch er bei der Bearbei-tung in Eigenschwingung gerät und das Flintgerät die beschriebenen Spuren hinterlässt. Dem Verfasser sind die gleichen Erscheinungen aus dem Metall verarbeitenden Bereich bekannt. (b) Die angebliche Schleiffläche bei mehreren Artefakten ist keineswegs glatt und eben. Vielmehr ist die Schab- oder Abhubbahn bei ihnen durch „hügelige“ Unebenheiten kon-turiert sowie durch einen oder meh-rere Absätze gekennzeichnet, die kurz vor Ausklingen eines Schabvor-ganges (vor den „Ausläufen“, also dem letzten, meist stumpfwinklig abgesetzten Ende einer Schabbahn) an mehreren Knochen beobachtet werden konnten. Diese lassen sich durch die zeitweilige Verminderung des Anpressdruckes des schaben-den Flintwerkzeuges auf die Oberflä-
che und/oder durch eine Verände-rung der Materialdichte des Kno-chens erklären. Als Folge dieser dem Werkzeug einen stärkeren Wider-stand entgegensetzenden „härteren Stelle“ entsteht eine Kuppe, die sich bei jedem weiteren Abtrag vergrö-ßert. Der mit dieser Auffälligkeit ver-sehene Knochen aus Breetzer Ort trägt die Kuppe etwa in der Mitte der Arbeitsbahn (Abb. 11). Auch die sich vor den Enden der Arbeitsbahnen stumpfwinklig absetzenden „Ausläu-fe“ dürften in vermindertem Anpress-druck, der infolge ungünstiger Winkel bei der Heranführung des Werk-zeugs an den Körper zu einer, wenn auch geringfügigen, Minimierung des Kräftepotentials führt, begründet liegen (Abb. 12). (c) Bei mehrfach facettierten Lang-knochen entstehen scharfkantige Grate, die zu der Annahme verleite-ten, sie könnten als Schneide ge-dient haben (Henriksen 1974). Da jedoch an den potentiellen Arbeits-kanten keine Gebrauchsspuren fest-gestellt werden konnten, kann auch diese These nicht aufrechterhalten werden.
Abbildung 10 Die hier gezeigte Bear-beitung eines rezenten Rothirschkno-chens durch schabendes Ziehen mit einem Flintwerkzeug führt zur Gewinnung von Knochenpulver. Der Knochen gleicht nach seiner Säuberung den mesolithi-schen Fundstücken in jeder Einzelheit.
LAGE
36
Eine Erkenntnis der vorliegenden Studie war vielmehr, dass die ent-sprechenden Artefakte als Abfallpro-dukte zu betrachten sind und zwar eines Vorganges, der durch scha-bendes Ziehen mit einem geeigneten Flintgerät Späne und Pulver von der Oberfläche des Knochens ablöst. Diese feinen Späne sind als das Zielprodukt anzusehen, an dem die Menschen des Mesolithikums, der Ertebølle-Kultur und des Neolithi-kums interessiert waren. Bei beidsei-tiger Aushöhlung der Diaphyse nä-herten sich die Arbeitsbahnen mitun-ter so weit, dass die Knochen zer-brachen; deshalb liegt die Mehrzahl der Artefakte in zerbrochenem Zu-stand vor. Der Bruch kann sowohl während der Schabarbeit durch den Anpressdruck des Werkzeugs auf die nur noch randlich vorhandenen Be-
reiche der Kompakta hervorgerufen worden sein, als auch nach der De-ponierung des aufgebrauchten Ab-fallproduktes durch Vertritt oder ähn-liches. Am Fundplatz Hüde I zeigte sich, dass neben den konkav kontu-rierten Bahnen auch vielfach leicht bis stark konvexe und auch plane existieren. Das ließe sich durch den Einsatz von Schabwerkzeugen mit tendenziell geradem Schneidenver-lauf erklären. Zur zeitlichen und räumlichen Ein-ordnung bzw. Beschränkung dieser Geräte lassen sich ebenfalls einige Angaben machen. In Dänemark finden sich die facettierten Langkno-chen, es sind in der Mehrzahl solche vom Ur, in spätmaglemosezeitlichen Horizonten (um 7000 v. Chr.). Wäh-rend Schabbahnknochen dort für die
Abbildung 11 Fundplatz Bergen, Breetzer Ort. Durch zeitweilige Verminderung des Anpressdruckes des schabenden Flintwerkzeuges entstandene Kuppe auf einer Abhubbahn eines Auerochsen-Metapodiums.
SCHLEIFKNOCHEN VERSUS SCHABBAHNKNOCHEN
37
nachfolgende Ertebølle-Kultur bis-lang nicht nachgewiesen sind (freundliche mündliche Mitteilung S.H. Andersen, Arhus, und K. Ro-senlund, Kopenhagen), treten sie im südlichen und östlichen Verbrei-tungsgebiet dieser Kultur regelmäßig auf. Die letztmalige Beobachtung dieses Phänomens an Langknochen von Rindern und Pferden aus mesoli-thisch-neolithischen Übergangsplät-zen wie Bebensee LA76, Seedorf LA 245 und Berlin LA 4 weist darauf hin, dass sich diese Tradition möglicher-weise nicht bis in das Neolithikum bewahrt hat. Die 14C-Datierung eines entsprechend bearbeiteten Pferde-Metapodiums aus Heidmoor ergab ein Alter von 5185 BP, ent-sprechend 4000±42 cal. BC (KIA 35913; kalibriert mit CALIB REV 5.0.2). Dieser Knochen fällt mithin in
die Jahrzehnte der Transformation vom Meso- zum Neolithikum. Bei den fünf entsprechenden Artefakten aus Berlin LA 4 und Bebensee, die auf-grund ihrer geringen Größe Hausrin-dern zugeordnet und damit ins Neoli-thikum gestellt werden, kann über-dies nicht ausgeschlossen werden, dass sie von weiblichen Uren stam-men. Bei Hüde I scheint es sich um einen Sonderfall zu handeln. Die dortige Verwendung von Schabbahnkno-chen bis in das entwickelte Neolithi-kum hinein, könnte mit der besonde-ren Funktion des Platzes als Jagd-station in Verbindung stehen. Einen Hinweis über eine mögliche Verwendung des Knochenpulvers liefert eine Feldstudie der Ethnome-dizinerin U. Lachner-Eitzenberger bei
Abbildung 12 Fundplatz Hüde I (Niedersachsen). Absätze im Auslauf am Ende einer Abhubbahn durch nachlassenden Anpressdruck.
LAGE
38
den Chiquitano-Indianern in Bolivien (Lachner-Eitzenberger 2006). Unter den verschiedenen aus der Natur gewonnenen Heilmitteln fand sich auch Knochenpulver, das zur Linde-rung bzw. Heilung bestimmter Krankheiten (Facialisparese, Herz-beschwerden) getrunken und auch äußerlich aufgetragen wird. Auch in unseren Raum betreffenden Veröffentlichungen wird über den medizinischen Gebrauch und Nutzen von Knochenpulver, das zum Bei-spiel im „Handwörterbuch des deut-schen Aberglaubens“ als „Abschab-sel“ bezeichnet wird, berichtet (Bäch-thold-Stäubli 1987). Noch in den 1960er Jahren haben die Kinder einer damals in Kiel woh-nenden Zahnarztfamilie zum Früh–stück mit einer Messerspitze Kno-chenmehl versetzte Haferflocken zu sich genommen, um die in dem Zu-satz enthaltenen Mineralstoffe zu nutzen. Diese Praxis galt seinerzeit bereits als exotisch. Das Knochen-mehl musste, weil es hier nicht zu beziehen war, aus Schweden impor-tiert werden, wo es unter der Be-zeichnung Benmjöl wohl noch eine größere Bedeutung hatte und viel-leicht noch hat (freundliche Mitteilung von Dr. U. Schneider, Behl). Denkbar ist auch, dass den Stein-zeitmenschen das Knochenmehl als Bindemittel, möglicherweise als Bei-mischung zu bekannten Klebstoffen wie Birkenpech oder Harz gedient hat. In einem Experiment, das Aufschlüs-se über die Verwendung von aufge-kochtem Knochenpulver als Klebstoff
und/oder als Modelliermasse erbrin-gen sollte, fanden genannte Ein-satzmöglichkeiten ihre Bestätigung (Lage, unveröffentlicht). Dabei ließen sich zwei Holzleisten fest miteinan-der verleimen. Ein anderer Teil des aufbereiteten Knochenbreies wurde zu einer beliebigen Form (hier zu einem kleinen Prisma) geknetet. Nach der Trocknung und Aushärtung behielt das jetzt in seiner Konsistenz bimssteinartig anmutende Gebilde seine Form bei. Der aus dem Kno-chenpulver gewonnene Leim kann meines Erachtens nur bei der Ver-bindung von planen Holz- oder Kno-chenobjekten zur Anwendung gelan-gen. Da ebene, für die Verleimung taugliche Flächen mit den steinzeitli-chen Methoden nicht bzw. nicht in größerem Umfang hergestellt werden konnten, ist, wenn überhaupt, wohl eher an kleinteilige Objekte zu den-ken, die verleimt worden sein könn-ten. Die mitunter aus mehreren Tei-len bestehenden steinzeitlichen Kno-chen- oder Geweihskulpturen, bei deren Fertigung zur Herstellung von Leim taugliches Pulver angefallen wäre, könnte man bei der Zusam-mensetzung durch das infrage ste-hende Klebemittel verbunden haben. Ein für das erwähnte Modellieren beispielgebender Fund stammt aus dem Neolithikum der Levante. Hier hat man einem menschlichen Schä-del die Nachbildung eines Haarnet-zes aus Knochenleim aufgetragen (Nahal Hemar). „They are similar to other plastered crania from Ain Ghazal to which small amounts of plaster adhere, as well as modeled crania from Nahal Hemar that have a collagen-based substance applied to the cranial vault“ (Bonogofsky 2001, 144).
SCHLEIFKNOCHEN VERSUS SCHABBAHNKNOCHEN
39
Herzlicher Dank geht an den Stellvertretenden Direktor des Niedersächsischen Landesmuseums, Hannover, Martin Schmidt M.A. für die großzügige Bereitstel-lung der bearbeiteten Tierknochen von Hüde I. Ganz besonders möchte ich mich bei Ulrich Schmölcke (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig) für mancherlei Impulse im Laufe der Arbeit an dieser Studie bedanken. Herzlichen Dank auch an Th. Terberger, Greifswald, S. H. Andersen, Arhus, K. Rosenlund, Kopenhagen, B. Gramsch, Potsdam und S. Harz, Schleswig für wert-volle Hinweise.
LITERATUR
Bächthold-Stäubli, H. (1987): Handwör-terbuch des deutschen Aberglaubens. de Gryter-Verlag, Berlin und Leipzig.
Bonogofsky, M. (2001): Cranial Modeling and Neolithic bone Modification at Ain Ghazal: New Interpretations. Paléo-rient 27, 141-146.
David, É. (2004): Technologie osseuse des derniers chasseurs préhistoriques en Europe du Nord (Xe-VIIIe millénai-res avant J.-C.). Le Maglemosien et les technocomplexes du Mésolithique. Monographie de thèse, Maison d’Archéologie et d’Ethnologie.
Driesch, A. von den (1976): Das Vermes-sen von Tierknochen aus vor- und frühgeschichtlichen Siedlungen. Uni-versität München.
Ewersen, J. (2007): Die Tierknochenfun-de aus der neolithischen Siedlung Heidmoor, Kreis Segeberg. Wach-holtz-Verlag, Neumünster.
Henriksen, B. B. (1976): Sværdborg I Excavations 1943-44. A Settlement of the Maglemose Culture. Arkæologis-ke Studier 3. Copenhagen.
Henriksen, G. (1974): Maglemosekultu-rens facetskrabede knogler. Aarbøger 1974, 5-17.
Hübner, K. D., Saur, R., Reichstein, H. (1988): Die Säugetierknochen der neolithischen Seeufersiedlung Hüde I am Dümmer, Landkreis Diepholz, Niedersachsen. In: Jacob-Friesen, G. und Howitz, J. (Hrsg.), Palynologische und säugetierkundliche Untersuchun-gen zum Siedlungsplatz Hüde I am
Dümmer, Landkreis Diepholz. Göttin-ger Schriften zur Vor- und Frühge-schichte 23, 35-142.
Lachner-Eitzenberger, U. M. (2006): Medicina traditional. Ergebnisse einer ethnomedizinischen Feldstudie bei den Chiquitano in Bolivien. Dissertati-on, Universität München 2006.
Lage, W. (2004): Zur Interpretation der Lehmstraten in den Feuerstellen des Duvenseer Moores – Lehmplatten als Gar- und Röstvorrichtungen während des Mesolithikums in Schleswig-Holstein. Archäologisches Korres-pondenzblatt 34, 293-302.
Lage, W. (2009): Tabellarische Übersicht morphometrischer Merkmale von Schabbahnknochen. http://www. schriften.uni-kiel.de/Band_71/Lage _Anhang.pdf
Schmölcke, U. (2001): Archäozoologische Hinweise zur jungsteinzeitlichen Landschaft Schleswig-Holsteins. Al-bersdorfer Forschungen zur Archäo-logie und Umweltgeschichte 2, 77-88.
Schmölcke, U., Endtmann, E., Klooss, S., Meyer, M., Michaelis, D., Rickert, B.-H., Rößler, D. (2006): Changes of sea level, landscape and culture: The south-western Baltic area between 8800 and 4000 BC. Palaeogeogra-phy, Palaeoclimatology, Palaeoecolo-gy 240, 423-438.
Stodiek, U., Paulsen, H. (1996): Mit dem Pfeil und Bogen. Technik der Stein-zeitlichen Jagd. Verlag Isensee, Ol-denburg.
LAGE
40
Polishing bones versus scraping bones – investigations into the utilization of Stone Age large mammals' long bones with concave facets
W. Lage
Repeatedly, but not frequently, Mesolithic sites from the southern Scandi-navian Maglemose and Ertebølle cultures yield animal bones whose diaphyses are laterally worked into concave facets. Bones from large mammals are concerned in particular, mostly metatarsi but sometimes also metacarpi, radii, ulnae and tibiae. In most cases, the bones with these traces of working originate from aurochs (Bos primigenius), al-though sometimes elements from wild horse (Equus ferus), roe deer (Capreolus capreolus), red deer (Cervus elaphus), moose (Alces alces), wild boar (Sus scrofa), and bear (ursus arctos) were used. It is the aim of this study to clarify the function of these anthropogenically modified bones. For this purpose 100 finds from the sites Hüde I (Niedersachsen, Germany), Heidmoor, Bebensee, Ascheberg (all Schleswig-Holstein, Germany) Saiser 1, Breetzer Ort, Baabe (Rügen Island, Mecklenburg-Vorpommern, Germany) and Dąbki 9 (Zachodniopomorskie, Poland) have been investigated morphometrically. Additionally, a tibia of a modern red deer has been used to experimentally reconstruct the bone-working method of the prehistoric humans. 59% of these Mesolithic bones yielded two intentionally abraded parts ranging along the total length of the diaphysis. On the remainder of the sample, the number of worked areas ranged from one to five. As a result, 149 of such worked parts were stud-ied on the 100 investigated bones. In 65% of the bones, the piece was worked up to the opening of the bone marrow. Chatter marks near the epiphyses and on the abraded parts as well as a concave form of the lat-ter are characteristic of the investigated bones. This is the evidence that these bones were worked by scraping, and typical marks on the bone sur-face show that this scraping was accomplished with a flint tool. Previous theories that such bones were used for polishing must hence be rejected. In fact, it is most likely that they were used for the production of bone meal. This interpretation is supported by the experiment with a modern bone. In modern times bone meal has been used as a medicine or as an agglutinant.
Wolfgang Lage ([email protected]) Archäologisches Landesmuseum Schleswig-Holstein, Schloss Gottorf, 24837 Schleswig