Kindheit und Minne = Kinderminne? Gleichung mit Unbekannten
-
Upload
uni-wuerzburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Kindheit und Minne = Kinderminne? Gleichung mit Unbekannten
1
Kindheit und Minne = Kinderminne?
Gleichung mit Unbekannten
Christian Buhr, M.A. (Würzburg)
Cele pucele, qui la siet, / m’ama des enfance et je li.
(Chrétien de Troyes: Erec et Enide, V. 6052f.)1
Zwei Menschen, die physiologisch und geistig als Heranwachsende oder in sozialer
Hinsicht als noch nicht erwachsen gekennzeichnet sind, stehen sich so nahe, dass sie
sich viel zu früh und meist gegen den Willen der Eltern oder gegen herrschende
Vorstellungen gesellschaftlicher Ordnung ineinander verlieben. Sie kämpfen für ihre
Liebe, die sie mit dem Ernst und mit der Sprache der Erwachsenen betreiben, und gehen
dabei entweder tragisch unter oder werden schlussendlich – oft dank einer glücklichen
Schicksalswendung – doch miteinander vereint. Wahrscheinlich gehört dieses Thema,
das auch innerhalb der höfisch-mittelalterlichen Liebesdichtung aufgegriffen und
vielfach variiert wird, zu den ältesten Mythen der Menschheit. In der germanistischen
Mediävistik ist für dieses Hereinbrechen der Liebe im Kindesalter der romantische
Neologismus ‚Kinderminne‘ gebräuchlich – ein eigentümliches Kompositum, das nach
authentischem Mittelhochdeutsch klingen will und suggeriert, dass es sich um eine
simple, sich selbst erklärende Gleichung handle: Kindheit und Minne ergibt
Kinderminne. Doch trotz zahlreicher Betrachtungen einzelner ‚Kinderminneromane‘
wurde eine grundlegende literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der
Kinderminne bislang nur in Ansätzen versucht.
Ausgehend von Ignace Feuerlichts Studie über den provenzalischen Minnesang,
hat sich einerseits ein literatursoziologisches Erklärungsmuster etabliert, das die
Prominenz der höfischen Kinderliebesthematik mit der Erziehung der Knaben an den
Höfischen des Mittelalters begründet. Diese habe das Verhältnis abhängiger junger
Adliger zu ihren Herrinnen und Erzieherinnen so gefestigt, dass sich Spuren davon nicht
nur in der literarischen Produktion der Dichtersubjekte niederschlügen, sondern auch
beim Publikum eine Disposition hervor riefen, die für die poetische Behandlung der
Kinderliebe in Lyrik und Epik besonders empfänglich mache. Kurzum: Frauendienst
erwachse also aus dem Pagendienst.2 Beispielhaft hierfür mag das in Wolframs Parzival
dargestellte Verhältnis des jungen angevinischen Ritters Gahmuret zu Anphlise, der
Königin von Frankreich, sein. Doch es darf bezweifelt werden, dass Wolfram bei seiner
gegenüber der Quelle frei hinzugefügten Nebenhandlung wirklich ein konkretes Abbild
einer nicht ungewöhnlichen gesellschaftlichen Erscheinung zeichnen wollte. Vor allem
1 Zit. nach Chrétien de Troyes. Erec et Enide. Erec und Enite, hg. v. Albert Gier, Stuttgart 1987. Das
Mädchen, das dort sitzt, liebt mich seit ihrer Kindheit, und ich sie ebenso. 2 Vgl. Ignace Feuerlicht: Vom Ursprung der Minne, in: Der provenzalische Minnesang. Ein Querschnitt
durch die neuere Forschungsdiskussion, hg. v. Rudolf Baehr, Darmstadt 1967, S. 263-302, hier: S. 274f.
und Ignace Feuerlicht: Vom Ursprung der Minne, in: Archivum Romanicum 23 (1939), S. 140-177, hier:
S. 148f. sowie Ingrid Kasten: Frauendienst bei Trobadors und Minnesängern im 12. Jahrhundert. Zur
Entwicklung und Adaption eines literarischen Konzepts, Heidelberg 1986 [= Beihefte zur Germanisch-
romanischen Monatsschrift 5], S. 89f.
2
aber ist zu bemerken, dass es sich hierbei um eine Geschichte handelt, die nach dem
Willen eines ansonsten zu allerlei Digressionen neigenden Erzählers – vielleicht als
verworfener Lebensweg des Heldenvaters – im Hintergrund verbleiben soll.3
So zeugen Gahmuret und Anphlise auch von der begrenzten des
literatursoziologischen Modells für jene Kinderminneromane, die doch ganz anderes
darstellen als die unmittelbare Lebenswirklichkeit höfischer Knaben – ganz abgesehen
von den fragwürdigen biographistischen und literaturhistorischen Implikationen eines
solchen Deutungsansatzes. Spätere soziologische Ansätze etwa von Ursula Liebertz-
Grün kritisieren zwar Feuerlichts These,4 nehmen damit aber auch das Problem der
Kinderminne aus dem Blickfeld. Rüdiger Schnells grundlegende Darstellung höfischer
Liebesdiskurse weiß diese daher nur den einzelnen Darstellungstraditionen zu
unterstellen, ohne dass dabei noch ein spezifischer Eigenwert des mittelalterlichen
Erzählens von kindlicher Liebe hervorgehoben würde.5
An dieser Stelle könnte also eine narratologische Untersuchung der Kinderminne
unter Umständen wertvolle Erkenntnisse liefern. Doch die formalistische
Erzählforschung tendiert dazu, so sie sich denn überhaupt mit der poetischen Faktur
dieser Texte auseinandersetzt, ein höchst vitales Genre in ein enges narratives Korsett
zu zwängen, ohne dabei noch auf konkrete literarische oder mentalitätsgeschichtliche
Fragen Antwort zu geben.6
So blieb die Forschung bislang einer genauen Definition der Kinderminne in
Abgrenzung zu späteren Kinderliebeserzählungen ebenso schuldig wie einer exakten
Einordnung des Phänomens in Kontext der Herausbildung der mittelalterlichen
Liebesdichtung. Die vorliegende Studie wird versuchen, die vorhandenen Leerstellen
mittels eines komparatistischen Verfahrens zu schließen, das epische und lyrische
Äußerungen gleichermaßen zu erfassen und diese in zeitgenössische erotische Diskurse
zu integrieren versucht. Dabei wird eine erhöhte Signifikanz lyrischer Elemente und
Motive im Rahmen des Erzählens von der Kinderminne zu beobachten sein, die es – so
meine These – als ein lyrisches Übertragungsphänomen zu begreifen gilt.
1. Begriffsgeschichte
Höfische Romane und Erzählungen wie „Flore und Blanscheflur“, die von dem Glück
und dem Leid handeln, das aus der Liebe zweier Kinder resultiert, werden in der
germanistischen Mediävistik unter dem Begriff der ‚Kinderminne‘ subsumiert. Für
3 Zu Anphlise und ihrer Rolle im „Parzival“ und im „Titurel“ siehe Christoph März: Anphlise und
Wolfram: eine Mésalliance?, in: ZfdA 121 (1992), S. 20-36. 4 Siehe Ursula Liebertz-Grün: Zur Soziologie des ‚amour courtois‘. Umrisse der Forschung, Heidelberg
1977, S. 85-88, die an dem von Feuerlicht geprägten Ansatz insbesondere den Zirkelschluss herausstellt,
der darin besteht, dass die im „Frauendienst“ Ulrichs von Liechtenstein vorgefundene Verarbeitung
höfischer (Lied-)Kultur als Grundlage für einen – allzu simplen – Vergleich zwischen Troubadours und
Minnesängern herangezogen wurde. 5 Rüdiger Schnell: Causa Amoris. Liebeskonzeption und Liebesdarstellung in der mittelalterlichen
Literatur, Bern und München 1985. 6 Beispielhaft hierfür Armin Schultz: Poetik des Hybriden. Schema, Variation und intertextuelle
Kombinatorik in der Minne- und Aventiureepik: „Willehalm von Orlens“ – „Partonopier und Meliur“ –
„Wilhelm von Österreich“ – „Die schöne Magelone“, Berlin 2000. Wertvolle Grundlagen für eine
vertiefte narratologische Auseinandersetzung mit Kinderminneromanen vom Typus „Flore und
Blanscheflur“ bietet dagegen das Kapitel „Dynastische Allianz und minne“ in Jan-Dirk Müller: Höfische
Kompromisse. Acht Kapitel zur höfischen Epik, Tübingen 2007.
3
diesen nicht ganz unproblematischen Terminus gibt es in anderen philologischen
Fachgebieten kein unmittelbares Äquivalent. Die Romanistik etwa zählt alle
sogenannten Kinderminneromane aufgrund ihrer Erzählstruktur pauschal zu den
Abenteuerromanen (roman d’aventiure)7 und bildet für die handlungsarmen, wenig
chevaleresken und daher eher lyrisch anmutenden Erzählungen – etwa die version
artistocratique des Flore-Romans – die Kategorie der idyllischen Romane (roman
idyllique).8 Andere Klassifizierungsversuche stellen die relativ exakte Topographie
dieser Texte und ihre meist im antiken Mittelmeerraum angesiedelte Handlung in den
Vordergrund, weshalb seit Anthime Fourriers im Jahr 1960 veröffentlichter Studie, die
auf instruktive Weise die Grundzüge eines Realismus im roman courtois skizziert, in
Abgrenzung zur märchenhaft-wunderbaren Welt des Artusromans von Texten
gesprochen wird, worin ein tendenziell realistischer Erzählmodus wirksam ist. Aus
formalästhetischen Gründen subsumiert Fourrier die Kinderliebeserzählungen also unter
den courant réaliste.9
Der Germanist und Literaturhistoriker Wolfgang Golther hingegen stellt schon
1893 fest, ‚Kinderminne‘ im Stile des „Titurel“ oder des Flore-Romans sei ein Thema
oder ein Genre, das den Zeitgenossen gefallen habe.10
Dass diese beiden doch sehr
verschiedenen Texte in einem Atemzug genannt werden können, setzt voraus, dass die
Kinderliebe in der höfischen Dichtung als ein literarisches Konzept sui generis zu
denken ist. Gustav Ehrismann verwendet in seiner 1927 erschienenen
Literaturgeschichte Kinderminne und Kinderliebe synonym11
und gilt damit als
vorbildhaft für die Studien von Erwin Wendt12
, Helmut de Boor13
und Hannes
Kästner14
.
Den exakten Ursprung dieses im mittelhochdeutschen Wortschatz indessen gar
nicht vorhandenen Begriffs zurückzuverfolgen, ist mir nicht gelungen. Er reicht wohl
bis weit ins 19. Jahrhundert hinein – eine literarische Phase also, in der die Liebe
zwischen Kindern oder ehemaligen Spielgefährten gerade höchste Konjunktur hatte.
Vieles deutet darauf hin, dass der Terminus dem „Titurel“ abgelauscht ist (Owê, minne,
waz touc // dîn kraft under kinder, V. 49,1)15
. Andere Spuren führen zu Walthers König-
7 Vgl. Erich Köhler: Vorlesungen zur Geschichte der französischen Literatur. Mittelalter I, Stuttgart:
1985, S. 170f. 8 Dieser Begriff wird von Myrrha Lot-Borodine insbesondere zur Charakterisierung des Flore-Romans
gebraucht. Als zentraler Bezugspunkt hierfür dient ihr hierfür die arkadische Liebesdichtung, wie sie die
von Longos erzählte Hirtengeschichte „Daphnis und Chloe“ repräsentiert. Vgl. Myrrha Lot-Borodine: Le
roman idyllique au Moyen Age, Genf 1972, S. 9 und S. 63. 9 Vgl. Anthime Fourrier: Le courant réaliste dans le roman courtois en France au moyen âge. Bd. 1: Les
débuts (XII. siècle), Paris: 1960, S. 13f. Zum Realismus als ästhetische Eigenschaft des Schicksalsromans
vgl. auch Köhler [Anm. 2], S. 171f. 10
Vgl. Wolfgang Golther: Die deutsche Dichtung im Mittelalter. 800-1500. Neu gesetzte und
überarbeitete Ausgabe nach der Ausgabe Stuttgart 1912, Wiesbaden 2005, S. 228. 11
Vgl. Gustav Ehrismann: Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters. 2. Teil:
Die mittelhochdeutsche Literatur. 2. Abschnitt: Blütezeit (1. Hälfte), München 1927, S. 65 und S. 294. 12
Erwin Wendt: Sentimentales in der deutschen Epik des 13. Jahrhunderts, Borna-Leipzig 1930. 13
Helmut de Boor: Die höfische Literatur. Vorbereitung, Blüte, Ausklang (1170-1250), 11. Aufl.,
München 1991 [= Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart 2]. 14
Hannes Kästner: Minne und kintheit sint ein ander gram. Kinderminne bei Walther von der
Vogelweide und einigen seiner Zeitgenossen, in: Poetica 34, 2002, S. 307-322. 15
Zit. nach Wolfram von Eschenbach: Titurel, hg. v. Helmut Brackert und Stephan Fuchs-Jolie, Berlin
und New York 2003.
4
Heinrich-Ton (minne und kintheit sint einander gram, L. 102,8)16
und selbstverständlich
auch zu der bereits erwähnten Versroman „Flore und Blanscheflur“. Sophie Bernhardi
reimt in ihrer von August Wilhelm Schlegel herausgegebenen, als episches Gedicht in
zwölf Gesängen verfassten sentimentalen Adaption der Erzählung: „Da rangen nun die
Diener nach Gewinne, / Verriethen roh der zarten Kinder Minne.“17
Von dem heute
meist unbedarft verwendeten Kompositum sind ihre Verse bloß noch ein ein
Leerzeichen entfernt.
Nun muss nicht eigens die mittelalterliche Literatur konsultiert werden, um
Erzählungen, Mythen und Phantasmagorien ausfindig zu machen, die kindliche Figuren
zu Protagonisten von Liebesgeschichten erheben, um sie entweder auf tragische Weise
untergehen zu lassen oder – nach einem Abstieg ins Tal der Tränen – eine spätere,
ernste Liebe anzubahnen. Wer die antike Literatur sondiert, kann mühelos bei Ovid
fündig werden; genannt seien an dieser Stelle das für das Mittelalter so bedeutsame
Liebespaar Pyramus und Thisbe sowie die in den „Heroides“ erzählte Geschichte von
Hero und Leander – letztere wurde bis heute in Form der Ballade von den zwei
Königskindern konserviert.18
Nicht von geringerem Rang ist die von Johann Wolfgang
Goethe über die Maßen geschätzte Hirtendichtung „Daphnis und Chloe“ des Longos.
Jenseits der Antikenrezeption finden sich neuzeitliche Spuren der Liebe zwischen
Kindern auch in Aufklärung, Klassik und Romantik. Davon zeugen Voltaires „Candide“
und der rousseauistische Kinderliebesroman des Bernardin de Saint-Pierrre („Paul und
Virginie“) ebenso wie die Popularität der Mignon-Gestalt und Joseph von Eichendorffs
„Marmorbild“. In der Zeit des Biedermeier und im Realismus wird schließlich die
Kinderliebe, deren Glück in der Regel nicht in weiter Ferne, sondern – meist nur eine
Haustür weiter – im unmittelbaren Nahbereich liegt, gar zum literarischen Ideal
(„Immensee“, „Romeo und Julia auf dem Dorfe“). Die literarische Moderne hat dieses
Thema mit einigem Schaudern unter (auto-)biographischer und psychoanalytischer
Perspektive neu gefasst („Les Enfants Terribles“, „Gefährliche Geliebte“), während sich
die romantische Idee von der kindlichen Liebe gegen Ende des 20. Jahrhunderts noch
einmal bei den Drehbuchschreibern („My Girl“) und Kinderbuchautoren („Ben liebt
Anna“) größter Beliebtheit erfreute. Man darf also – mit einiger Vorsicht – die
Kinderliebe als ein nahezu universelles literarisches Phänomen betrachten, das eine dem
Erzählen von der Liebe stets innewohnende lyrisch-epische Emergenz darstellt.19
2. Mittelalterliche Kinderlieben
In seiner Arbeit zu den literarischen Kinderlieben im deutschsprachigen Realismus
schließt Sebastian Susteck das Vorhandensein mittelalterlicher Kinderliebeserzählungen
kategorisch aus. Hierbei folgt er der von Philippe Ariès nachhaltig geprägten Annahme,
16
Zit. nach Walther von der Vogelweide: Leich, Lieder, Sangsprüche, 14., völlig neubearb. Aufl. d.
Ausgabe Karl Lachmanns mit Beiträgen von Thomas Bein und Horst Brunner, hg. v. Christoph Cormeau,
Berlin und New York. 17
Sophie Bernhardi: Flore und Blanscheflur. Ein episches Gedicht in zwölf Gesängen, hg. v. August
Wilhelm von Schlegel, Berlin 1822, S. 34. 18
Vgl. Jaromír Jech: Hero und Leander, in: Enzyklopädie des Märchens, hg. v. Rolf Wilhelm Brednich,
Bd. 6: Gott und Teufel auf Wanderschaft – Hyltén-Cavallius, Berlin und New York 1990, Sp. 845-851,
hier: S. 846. 19
Vgl. Sebastian Susteck: Kinderlieben. Studien zum Wissen des 19. Jahrhunderts und zum
deutschsprachigen Realismus von Stifter, Keller, Storm und anderen, Berlin und New York 2010, S. 10.
5
wonach die Entdeckung der Kindheit ein besonderes Kennzeichen der Neuzeit
darstelle.20
Während vor allem die griechische Antike erste Vorstellungen von
unterschiedlichen Lebensaltern und Entwicklungsstufen entwickelt habe, gehe dieses
Wissen im Mittelalter fast vollständig verloren, gerate das Kind aus dem Blickpunkt der
Gesellschaft. Wenn aber in der Welt des Mittelalters „kein Platz für die Kindheit“21
ist,
wenn also die pädagogische Vorstellung von der Kindheit als Schutzraum vor dem
Erwachsenwerden überhaupt nicht vorhanden war, wie konnten dann die Grundlagen
für die Entstehung eines Erzählens von der Kinderliebe als literarisches Genre irgend
gegeben sein?
Anderseits gibt der Begriff Kinderminne vor, dass es eine spezifische
Besonderheit hochmittelalterlicher Kinderlieben gäbe. In ihrer Studie über die Figur des
Kindes in der mittelhochdeutschen Dichtung kommt Agnes Geering sogar zu dem
Schluss, dass die Liebe im Kindesalter ein für die höfische Dichtung geradezu
charakteristisches Phänomen sei.22
Beide Positionen lassen sich harmonisieren: Susteck
ist insofern zuzustimmen, als der Fokus der Kinderminneromane nicht auf der Kindheit
als einem entwicklungspsychologisch abgrenzbaren Eigenraum liegt, der sich literarisch
darstellen und ausgestalten ließe. Ohnedies meint ja der mittelhochdeutsche Begriff kint
im weiteren Sinne nur einen noch relativ jungen und dementsprechend in besonderer
Weise der sozialen Hierarchie unterworfenen Menschen ohne konkrete Altersangabe.23
Im Vordergrund der mittelalterlichen Kindheitserzählungen steht vielmehr die Minne
selbst; diese Texte sind im Grunde Liebesromane unter veränderten sozialen
Bedingungen: Die Wahl kindlicher Protagonisten bietet einerseits ein originelles
narratives Potential, das sich auf der Ebene der histoire zuweilen stark von anderen
zeitgenössischen Erzählstoffen abhebt, andererseits schafft die Verlagerung der Liebe in
die Jugend neue, gegenüber jedweder Art von Geschlechtlichkeit vordergründig
distanzierte Formen des Sprechens von der Liebe. Mit anderen Worten:
Kinderminneromane sind nicht die verzärtelt-pädagogischen Kinderbuchfassungen des
höfischen Liebesromans, Diskursivierungen höfischer Liebe von spezifischem
Eigenwert.24
Ein kurzer Blick auf die Erzählliteratur der Zeit um 1200 bestätigt diesen
Eindruck: So ist spätestens ab der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein rasanter
Anstieg der literarischen Beschäftigung mit der Kindheit zu beobachten: Zunehmend
werden Figuren portraitiert, die als noch nicht erwachsen gelten können, und es wird
eine nennenswerte Zahl an Kurzerzählungen und Romanen verfasst, die von der
Kameradschaft oder der Liebe zweier Kinder handeln.25
In Frankreich, wo es bereits um
1170 einen Flore-Roman, einen Narziss-Lai und einen Lai von Pyramus und Thisbe
gibt, tritt diese Entwicklung einige Jahrzehnte früher ein. Hat hier auch jene Aventiure
ihren Platz, mit der Chrétien de Troyes seinen Erec-Romans beschließt? Vielleicht ist
es literaturgeschichtlich kein Zufall, dass der Erzähler seinen Rezipienten sehr deutlich
20
Vgl. ebd., S. 14. 21
Philippe Ariès: Geschichte der Kindheit, 17. Aufl., München 2011. 22
Vgl. Agnes Geering. Die Figur des Kindes in der mittelhochdeutschen Dichtung, Zürich 1899, S. 51f. 23
Zu den verschiedenen Bezeichnungen für Kinder und Jugendliche im Mittelhochdeutschen siehe James
A. Schultz: The Knowledge of Childhood in the German Middle Ages. 1100-1350, Philadelphia 1995, S.
23-31. Eine kritische Auseinandersetzung mit divergierenden Kindheitsvorstellungen und der
Unvereinbarkeit lateinisch-gelehrter und volkssprachlich-höfischer Traditionen findet sich am selben Ort
auf S. 39f. 24
Jan-Dirk Müller [Anm. 6], S. 404. 25
Vgl. Schultz [Anm. 23], S. 214.
6
zu verstehen gibt, wie das Problem von joie de la court zu verstehen ist: die
verhängnisvolle Verbindung von Mabonagrin und seiner Dame entwirft er als eine aus
den Fugen geratene, hermetisch gegen die Außenwelt abgeschirmte Liebe, die aus einer
seit frühester Jugend bestehenden Verbindung resultiert: Cele pucele qui la siet / m’ama
des enfance, et je li (V. 6052f.).26
Das allgemeine Verlangen nach Kinder- und Kinderliebesgeschichten ist in
dieser Zeit offenbar so groß, dass die Erzähler mehr und mehr dazu tendieren, selbst
bekannte ‚erwachsene‘ Romanfiguren in die Kindheit oder zumindest in ein relativ
junges Alter zurückzuversetzen. Es sind so unterschiedliche Helden wie Rennewart,
Lanzelot und Alexander, die allesamt nicht gerade als ‚Kinderstars‘ die literarische
Weltbühne betraten und nun dennoch ex post nach dem Geschmack der Zeit übertüncht
werden. In einigen Fällen wird ihnen dann auch eine erste kindliche Liaison
angedichtet, oft wissen sie aber nur wenig von der Liebe. Ihre Existenz also Kind
bereitet dann vielmehr den künftigen Status als Ritter vor.27
Mit der großen Welle der Adaption bekannter literarischer Stoffe durch die Neu-
und Wiedererzähler des 13. Jahrhunderts erfasst dieses Schicksal schließlich sogar die
Nebenfiguren, sei es im Zuge einer zur amplificatio tendierenden Bearbeitungsstrategie
oder einer auf das Enzyklopädische ausgerichteten Poetik. Um diesen Prozess sichtbar
zu machen, eignet sich ein vergleichender Blick auf eine frühe und eine späte
Tristanfassung: Hatte Eilhart von Oberg die Liebe von Tristans Schwager Kehenis zu
der verheirateten Dame Garîôle noch so allgemein gehalten, dass er lediglich von
heimlicher Liebe und einem wie auch immer gearteten älteren Anrecht spricht (nuo hett
dú frow gar lӱß / geloubt Keheniß, / e sú ainen man an nem, V. 8172-8174)28
, so lässt
Heinrich von Freiberg am Ende des 13. Jahrhunderts seine Figuren präzisieren, dass das
Paar bereits seit gemeinsam verbrachten Kindheitstagen in Liebe verbunden sei:
Diu süeze, wandels frîe
genennet ist Kassîe,
gein der mîn herze liebe treit;
wan wir in unser kintheit
mit einander sîn gezogen
und grôzer liebe hân gepflogen
mit einander von kinde unz her.
(Heinrich von Freiberg: Tristan, V. 5757-5763)29
Der Befund der hier vorliegenden, eher heuristisch angelegten Materialsammlung ist
indessen leicht widersprüchlich: Unter qualitativen Gesichtspunkten fällt auf, dass das
Motiv des liebenden Kindes vielfach nur den Nebenschauplatz oder das Eingangsbild
eines epischen Texts darstellt, der letzten Endes von ganz anderen Dingen handelt als
von Herzensangelegenheiten. Zuweilen belassen es die Erzähler lediglich bei Zitaten
und opaken Andeutungen, die unser Interesse wecken, schließlich aber nicht selten an
26
Vgl. Friedrich Wolfzettel: Bilder des Irdischen Paradieses im (französischen) Mittelalter und bei Dante,
in: DDJ 83, 2008, S. 61-91, hier: S. 82. 27
Vgl. James A. Schultz: No Girls, No Boys, No Families. On the Construction of Childhood in Texts of
the German Middle Ages, in: JEGP 94, 1995, S. 59-81, hier: S. 67f. 28
Zit. nach Eilhart von Oberg: Tristrant und Isalde. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch, hg. v. Wolfgang
Spiewok und Danielle Buschinger, Greifswald 1993. 29
Zit. nach Heinrich von Freiberg: Tristan, in: Heinrich von Freiberg, hg. v. Alois Bernt, Halle 1906.
7
den Rändern der erzählten Welt versanden. In Wolframs Werken ist dieses Verfahren
besonders ausgeprägt – eine Vielzahl äußerst knapp umrissener und schemenhaft
beschriebener Jugendlieben wird hier in den Haupttext eingelassen: Gahmuret und
Ampflise, Sigune und Schionatulander, Obie und Meljanz, Rennewart und Alize. Doch
auch andere mittelhochdeutsche Dichter führen die Kinderminne in ihrem Repertoire
höfischer Liebesmotive. Nachklassischen Romanen wie „Mai und Beaflor“ oder
„Tandareis und Flordibel“ mangelt es ebenso wenig an Kindheitsskizzen dieser Art wie
dem „Lanzelet“ Ulrichs von Zatzikhoven, der sowohl die erste Liebe des Helden als
auch die Liebesgeschichte zwischen dem Ritter Loifilol und seiner Dame unzweifelhaft
als Kinderminne markiert.
Daneben gibt es eine ganze Serie von Texten, in deren Verlauf die Liebe
zwischen zwei Kindern ein weitläufiges Programm von Prüfungen und Abenteuern
generiert, das den noch unfertigen männlichen Helden nach Art des
Entwicklungsromans heranreifen lässt. Auch diese Romane sind im engeren Sinne
Kinderminneromane, doch sie neigen von der Mitte des 13. Jahrhunderts an
fortschreitend zur Hybridisierung, verbinden also eine ursprüngliche
Kinderliebesgeschichte mit einer Motivik, die beispielsweise dem Feenroman oder
legendarischen Texten entlehnt ist („Friedrich von Schwaben“, „Reinfried von
Braunschweig“).
In absoluter Reinform wird die Kinderliebe wohl nur in jenen Texten überliefert,
die nach dem Schema ‚idyllischer‘ Liebeserzählungen vom Typus „Flore und
Blanscheflur“ gearbeitet sind. Gegenüber dem eingangs konstatierten Befund vom
ubiquitären Bild der Liebe zwischen zwei Heranwachsenden in der höfischen Literatur
nimmt sich deren Zahl äußerst gering aus. Es scheint, als ließe sich das Thema nur
begrenzt literarisch produktiv machen. Womöglich ist, wie Rüdiger Krohn in Bezug auf
die altfranzösische Erzählung „Aucassin und Nicolette“ vermutet, der nahezu
reibungslose, von ‚metaformeller Gnade‘30
regulierte Handlungsverlauf für ein gewisses
Desinteresse seitens der Dichter und des Publikums verantwortlich. Die schlechte
Überlieferung von Romanen über so problemlose Liebespaare wie Flore und
Blanscheflur scheint dieser Ansicht ebenso Recht zu geben wie die Tatsache, dass sich
die abenteuerlicheren und somit spannungsreicheren Volksbuchfassungen dieser Stoffe
demgegenüber – freilich bei einem etwas anderen Publikum – oft größter Beliebtheit
erfreuten.31
3. Definition
In jeder der genannten Kinderliebeserzählungen finden wir bestimmte Vorstellungen,
die heute wohl als Sandkastenliebe oder Schwärmerei bezeichnet würden:
Liebesverhältnisse, die so ausgestaltet sind, dass sich die Partner bereits seit ihren
Kindertagen kennen und oft sogar ehemalige Spielkameraden sind. Im engeren Sinne
geht es also um eine Beziehung zwischen zwei Heranwachsenden, die eine Intensität
30
Elisabeth Schmid: Über Liebe und Geld. Zu den Floris-Roman, in: Der fremdgewordene Text.
Festschrift für Helmut Brackert, hg. v. Silvia Bovenschen u.a., Berlin und New York 1997, S. 42-57, hier:
S. 43. 31
Vgl. Rüdiger Krohn: Ein allzu problemloses Liebespaar. „Aucassin et Nicolette“ – und was die
deutschen Dichter daraus machten, in: Paare und Paarungen. Festschrift für Werner Wunderlich zum 60.
Geburtstag, hg. v. Ulrich Müller und Margarete Springeth, Stuttgart 2004, S. 197-212, hier: S. 200ff.
8
erreicht, die diejenige gewöhnlicher Kinderfreundschaften weit übersteigt. Unter
soziologischer Perspektive ließe sich hier eine interessante Intensivierung und
Akzentuierung des romantischen Liebescodes erkennen. Niklas Luhmann ging in
„Liebe als Passion“ bekanntlich davon aus, dass die romantische Liebe mit der
Idealisierung der Liebesheirat die Einheit von sexueller Leidenschaft und Ehe durch
Konzepte von lebenslanger Treue und Freundschaft amalgamiert – ein Ideal, das
Luhmann aus diskursprägenden literarischen Texten wie Friedrich Schlegels „Lucine“
induzierte, wo die ideale Partnerin beschrieben wird als eine Frau, dem Mann „zugleich
die zärtlichste Geliebte und die beste Gesellschaft wäre und auch eine vollkommene
Freundin.“32
Die Kinderliebe wiederum idealisiert eine Verbindung heterosexueller
Partner, deren Liebe bereits aus einer in die Kindertage zurückreichenden
Kameradschaft resultiert, so dass die Liebenden nicht erst im Laufe der Beziehung zu
Freunden oder Lebenspartnern werden, sondern es im Grunde immer schon sind. Aus
der zeitlichen Verschiebung resultiert also zugleich eine Verlagerung der Intimität vom
Eros zur Freundschaft.
In Abgrenzung zu modernen Konzeptionen von Kinderliebe ließe sich die
hochmittelalterliche Kinderminne als eine Form literarisch imaginierter kindlicher
Intimität beschreiben, bei der bestimmte höfische Liebesentwürfe in vorerwachsene
Entwicklungsstufen verlagert bzw. die Emotionen höfischer Mädchen und Knaben nach
dem Muster tradierter Vorstellungen von Liebe überformt werden. Die Liebenden
befinden sich folglich in einem relativ jungen Alter, in dem erotisches Begehren bzw.
ein hohes Maß an Intimität noch nicht zulässig ist, weil sie hierfür weder in körperlicher
noch in kognitiver Hinsicht reif sind, vor allem aber weil sie aus sozialer Perspektive
noch nicht als vollwertige Mitglieder der höfischen Gesellschaft gelten können.
Man könnte sie nach den Altersstufen des Augustinus, wenngleich für die
Betrachtung der volkssprachlichen Literatur des Mittelalters nur wenig geeignet, der
infantia, der pueritia oder der adolescentia zuordnen.33
In erster Linie sind die
Protagonisten dieser Erzählungen eben noch-nicht Mann und noch-nicht Frau – und das
heißt mithin auch, dass sie noch als ‚jungfräulich‘ gelten dürfen.34
So lernen wir Sigune
und Schionatulander als heranwachsende Adlige in jugendlichem Alter kennen, die
noch von ihren Erziehern abhängig sind; als Knappe, nicht als Ritter begleitet
Schionatulander seinen Erzieher Gahmuret. Beide nähern sich der Liebe zwar naiv, aber
doch auf eine durchaus konventionelle Weise. Ebenso ist Willehalm von Orlens noch
weit davon entfernt, in der Schwertleite zum Ritter promoviert zu werden, als er in
Liebe zu Amelye entbrennt. Wilhelm von Österreich träumt bereits im zarten
Knabenalter von seiner fernen Geliebten und Flore und Blanscheflur lieben sich vom
Tag ihrer Geburt an. Letzteres ist ein Motiv, das Ulrich von Zatzikhoven parodiert,
wenn er seinen Erzähler im Kontext der Mantelprobe von der Nebenfigur Loifilol
berichten lässt, dieser habe seine Dame schon ein Jahr vor ihrer Geburt geliebt (ê siu
wurde geborn ein jâr, V. 5975)35
.
32
Friedrich Schlegel: Lucinde. Ein Roman, in: Ders.: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Erste
Abteilung: Kritische Neuausgabe, Bd. 5: Dichtungen, hg. v. Hans Eichner, München u.a. 1962, S. 1-96,
hier S. 10. 33
Zum Konzept der Lebensalter siehe Ariès [Anm. 21], S. 69-91. 34
Vgl. Schultz [Anm. 23], S. 63f. 35
Zit. nach Ulrich von Zatzikhoven: Lanzelet. Studienausgabe, hg. v. Florian Kragl, Berlin und New
York 2009. Die Textstelle ist allerdings nicht eindeutig und ließe sich auch so verstehen, dass der Ritter
die Dame schon geliebt habe, seitdem sie ein Jahr alt ist. Der parodistische Gestus bleibt, wie Kragl
zutreffend anmerkt, in jedem Fall erhalten. Vgl. Florian Kragl: Stellenkommentar, in: Ulrich von
9
Die Zurückweisung der Körperlichkeit zugunsten von Reinheit und Askese, von
Tugendhaftigkeit und Geschwisterlichkeit gehört wohl zu den epochenübergreifenden
Merkmalen der Kinderliebe. Hinsichtlich der mittelalterlichen Vorstellung von Kindheit
ließe sich präzisieren: Wenn der Beginn konkreter sexueller Aktivität den Übergang
vom Knaben zum Mann, von der maget zum wîp markiert, dann endet die Kinderminne
unmittelbar mit ihrer sexuellen Erfüllung.36
Aus der kindlichen Paarbeziehung wird
dann eine Herrschaftsehe. Die tragischsten Kindergestalten aber, Pyramus und Thisbe,
entbrennen – jedenfalls in den volkssprachlichen Erzählungen des Mittelalters37
–
gerade nicht in libidinösem Begehren, sondern sterben, noch ehe es überhaupt zu einer
konkreten intimen Annäherung kommen kann.
Ein weiteres spezifisch mittelalterliches Charakteristikum ist ferner, dass fast
alle kindlichen und jugendlichen Liebespaare nicht etwa allein durch Naivität
gekennzeichnet sind, sondern dass sie sich vermittels ihrer höfischen Sozialisierung und
ihrer literarischen Bildung gewisse Grundkenntnisse in der Liebeskunst erworben
haben. Ihre Dialoge klingen dementsprechend immer seltsam altklug und gelegentlich
wird es heutigen Lesern wohl schwer fallen, sich des Eindrucks zu erwehren, die
Autoren hätten schlichtweg vergessen, dass sie Kinder darstellen wollten. Auch in
dieser Hinsicht sind die Kinder also „verkleinerte Ausgaben“38
erwachsener Menschen.
Die Sprache der Liebenden ist darüber hinaus so merklich dem Konzept der Hohen
Minne entlehnt, dass manche Dialoge den Charakter eines in einen Erzähltext
umgegossenen lyrischen Wechsels annehmen.39
In Konrad Flecks Flore-Roman klingt
die Liebesklage des Helden dann so:
‚genâde, frou künginne,
wie kumet daz iuwer minne
mir tegelich ist sô niuwe?
ich gibe iuch mîne triuwe,
daz ir mir verre lieber sint
dan daz einige kint
sîner muoter müge sîn.
waz sol des werden, frouwe mîn?
wan des lîd ich ungemach.‘
(Konrad Fleck: Flore und Blanscheflur, V. 777-785)40
Zatzikhoven: Lanzelet. Studienausgabe, hg. v. Florian Kragl, Berlin und New York 2009. S. 557-624, S.
605. 36
Zu den Auswirkungen des Eros auf das Ende der Kindheit siehe auchReinhard Clifford Kuhn:
Corruption in Paradise. The Child in Western Literature, Hanover/Penns. und London 1982, S. 128-172. 37
Auf die gelehrt-lateinische Tradition einer Deutung der Geschichte von Pyramus und Thisbe als
Warnung vor dem Libidinösen verweist Rüdiger Schnell [Anm. 5], S. 431. 38
Ariès [Anm. 21], S. 91. Siehe hierzu auch Geering [Anm. 22], S. 59. 39
Vgl. Werner Röcke: Liebe und Schrift. Deutungsmuster sozialer und literarischer Kommunikation im
deutschen Liebes- und Reiseroman des 13. Jahrhunderts, in: Mündlichkeit – Schriftlichkeit –
Weltbildwandel. Literarische Kommunikation und Deutungsschemata von Wirklichkeit in der Literatur
des Mittelalters und der frühen Neuzeit, hg. v. Werner Röcke und Ursula Schaefer, Tübingen 1996, S. 85-
108, hier: S. 98. Ähnlich bei James A. Schultz [Anm. 21], S. 144ff. 40
Zit. nach Konrad Fleck: Flore und Blanscheflur, in: Tristan und Isolde und Flore und Blanscheflur.
Zweiter Teil, hg. v. Wolfgang Golther, Berlin und Stuttgart 1889.
10
Das geliebte Mädchen wird dem Knaben zur Minneherrin, zur Königin, deren Gnade
allein sein Leid zu lindern vermag. Eingedenk ihrer Rolle antwortet die christliche
Sklavin Blanscheflur mit einer Reflexion über das Verhältnis von Kindheit und Minne:
‚Flôre, süezer âmîs,
joch minne ich iuch ze gelîcher wîs
und weiz got noch mêre.
doch wundert mich sêre
waz mir sî und wâ von.
joch solt ein kint sîn ungewon
solhes kumbers als ich trage
von iuwern schulden alle tage,
alle zît und alle stunde.‘
(Konrad Fleck: Flore und Blanscheflur, V. 787-795)
Selbst dann noch, wenn sie von Todesgefahr und gegenseitigem Verlust bedroht sind,
handeln die Kinder durchweg wie Erwachsene, entspricht ihr Verhalten den gängigen
Normen und Konventionen höfischer Liebe. Die Erzähler erklären diesen seltsamen
Umstand gerne damit, dass die gelesenen Liebeserzählungen oder aber Frau Minne
persönlich die Kinder liebesverständig (ze minnen verstanden, V. 725) gemacht hätten.
Egal ob im Gespräch, beim Verfassen eigener Gedichte oder angesichts von Abschied
und Verlust: jede Handlung der Liebenden gerät nun so offensichtlich zur lyrischen
Geste, dass die doch vermeintlich so naive Liebe der Kinder nun völlig im höfisch-
literarischen Diskurs aufgeht. Bei Luhmann heißt es:
Das Wagnis Liebe und die entsprechend komplizierte, anforderungsreiche
Alltagsorientierung ist nur möglich, wenn man sich dabei auf kulturelle Überlieferungen,
literarische Vorlagen, überzeugungsfähige Sprachmuster und Situationsbilder, kurz: auf
eine tradierte Semantik stützen kann.41
Dies ist bei Flore und Blanscheflur ebenso der Fall und wie bei Rudolfs „Willehalm von
Orlens“, wo der Protagonist im Alter von 13 Jahren die Kunst der Hohen Minne erlernt
und daraufhin seine Gespielin in den Rang einer Minneherrin erhebt, deren Gnade er
sich erhofft. Die mit sieben Jahren noch nicht im selben Ausmaß literarisch sozialisierte
Amelye reagiert auf diese Avancen mit Unverstand und wird von schame rot (V.
4812)42
. Stets verharrt die Kinderminne also im Spannungsfeld einer signifikanten
Sublimierung der Libido auf der einen und den Implikationen durchaus wirkmächtiger
erotischer Diskurse und Praktiken auf der anderen Seite. Kindliche Unschuld und
höfische Liebeskunst werden stets aufs Neue verhandelt. Die ungezwungene
Darstellung erster eigenständiger Liebeserfahrungen, wie sie bukolische Dichtung zu
vermitteln scheint, ist den mittelhochdeutschen Romanen fremd. Hier haben die Kinder
in der Regel Romane gelesen, und das heißt: Sie kennen den Code.
Die Behauptung, das Mittelalter habe die Liebe zwischen zwei Kindern verklärt,
ja die Kinderminne sei sogar, wie Kurt Ruh formuliert, eine „Feier des Großen und
41
Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Frankfurt/Main 1994, S. 47. 42
Zit. nach Rudolf von Ems: Willehalm von Orlens, hg. v. Victor Junk, 2. Aufl., Dublin u.a. 1967.
11
Reinen“43
, ist insofern äußerst verwunderlich. Nur, weil es sich um Kinder handelt,
sollte die vermeintliche Asexualität und Askese nicht den Blick darauf verstellen, dass
die meisten Erzähltexte die Kinder- und Jugendliebe unmittelbar als eine
problematische Extremform der höfischen Liebe darstellen, die durchaus sexuelle
Implikationen hat und neben erotischen vor allem soziale Gefahren birgt.44
Nicht allein Chrétien konfrontiert eine solchermaßen übersteigerte Intimität mit
der Symbolik pervertierter Ritterlichkeit von joie de la court. Ein kursorischer Blick auf
das Textkorpus genügt, um die Konsequenzen der Kinderminne zu erfassen: Flore
weigert sich aus Liebe, auch nur einen Gedanken an eine ihm ebenbürtige Partie zu
verschwenden und bringt damit seine Dynastie, die mehr oder minder über den
gesamten heidnischen Teil Europas herrscht, in Gefahr; Aucassin vernachlässigt sogar
seine Pflichten in der Landesverteidigung und gibt vor, lieber mit seiner geliebten
Nicolette in die Hölle gehen zu wollen, als ohne sie ins Paradies zu kommen, wo doch
nur lammfromme Pfaffen und zerlumpte Pilger ihr Nachleben verbrächten. Der junge
Willehalm von Orlens geht sogar noch einen Schritt weiter und entführt kurzerhand
seine Freundin Amelye, um eine Hochzeit mit dem spanischen König Avenis zu
verhindern. Und schließlich weiß der junge Held Wilhelm zum Entsetzen des Königs
Agrant, der das Paar wie König Marke heimlich belauscht, ziemlich genau, welcher
Vorgang dafür sorgt, dass man die Prinzessin nur als Mädchen bezeichnet, während
man die Königin doch eine Frau zu nennen pflegt. Wohl eher in spielerischer
Nachahmung der Eltern als in unmittelbar sexueller Absicht möchte er sich daher mit
Aglye nackent hin ze naht ligen (V. 1753).45
Wenn es bei der Kinderminne nur um Liebe in Gedanken ginge, dann wäre die
aus feudaler Perspektive stets befürchtete Mesalliance von geringer Bedeutung. Doch es
sind gerade die meist nur im Hintergrund mitschwingenden, nur vorläufig
ausgegrenzten Konsequenzen, die dafür sorgen, dass die Kinderminne nicht nur offensiv
gegen ein durch den Elternwillen verkörpertes politisches Verständnis von Liebe und
Eheschließung gerichtet ist, sondern auch die Funktionsfähigkeit der feudalen Ordnung
nachhaltig stört.46
Das bedrohliche, normwidrige Verhalten wird daher auch regelmäßig
mit Strafen wie Trennung, Gefangenschaft oder Verbannung sanktioniert. Die
feudalgesellschaftlichen Machtverhältnisse, die inszeniert werden, um an ihrem
Einwirken auf die widerständigen Protagonisten die uneingeschränkte Herrschaft und
die sentimentale Wirkung der Minne sichtbar zu machen, gehören zum strukturellen
Kern des Genres.
43
Vgl. Kurt Ruh: Walthers König-Heinrich-Ton (L. 101,23), in: Walther von der Vogelweide.
Hamburger Kolloquium 1988 zum 65. Geburtstag von Karl-Heinz Borck, hg. v. Jan-Dirk Müller und
Franz Joseph Worstbrock, Stuttgart 1989, S. 9-15, hier: S. 13. 44
Der vorliegenden Darstellung ist nicht daran gelegen, in dieser Sache eine einseitige Ausrichtung der
Kinderminne auf das Sexuelle zu propagieren. Es sei daher an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass
einige Romane, insbesondere der Flore-Roman, durchaus auch den Aspekt der Askese und der Idee der
Liebe als Gottesdienst herausstellen. Vgl. Geering [Anm. 22], S. 71. Insofern der paradiesische
Baumgarten, in dem sich Flore und Blanscheflur bevorzugt aufhalten, auch als christliches Symbol für
das Zeitalter vor dem Sündenfall betrachtet werden kann, wäre es eine durchaus lohnende Aufgabe,
diesen Gesichtspunkt weiter zu beleuchten und in diesem Zusammenhang etwa nach dem Verhältnis der
Kinderminneromane zu der zeitgenössischen, vor allem von Bonaventura und Thomas von Aquin
geprägten Diskussion um die Körperlichkeit bzw. das Geschlecht der Engel zu fragen. 45
Vgl. Jan-Dirk Müller [Anm. 6], S. 401. 46
Vgl. Walter Haug: Die höfische Liebe im Horizont der erotischen Diskurse des Mittelalters und der
frühen Neuzeit, Berlin und New York 2004, S. 22f.
12
In diesem Zusammenhang haben offensichtlich die narrativen Modelle der
Abenteuerromane nach griechisch-antikem Vorbild stilbildend gewirkt. Erzählungen
wie der „Apollonius von Tyrus“ beziehen ihr zentrales Spannungsmoment aus der
schicksalhaften Trennung der Liebenden. Hindernisse wie die Entführung, Verheiratung
oder Versklavung der Geliebten treiben nicht nur immer wieder die Handlung voran, sie
sind auch bestens geeignet, um die Passion zu befeuern und die Intensität der Liebe
unter Beweis zu stellen.47
So werden die Helden zu Wandernden, deren Bewegungen
innerhalb der erzählten Welt weniger auf einen inneren Abenteuertrieb als vielmehr auf
einen bestimmten äußeren Anlass – den Verlust der Geliebten – zurückzuführen sind.
Auf diese Erzähllogik greifen die meisten Erzählungen von Kinderminne
insofern zurück, als sie mit dem väterlichen Verbot des Liebesverhältnisses oder einer
gleichwirksamen gesellschaftlichen Norm einen elementaren Widerstand erzeugen. Das
‚Nein-des-Vaters‘48
, das die Helden überwinden müssen, um dem Jugendalter zu
entwachsen und ihre Geliebte wiederzugewinnen, ist somit das eigentliche Movens der
meisten höfischen Kindheitsromane. Noch einmal zeigt sich also, dass die Kinderminne
nicht die prinzipielle Andersheit kindlich-unschuldiger Liebe portraitiert, sondern
gerade aus dem Status der Kinder als von den Erwachsenen graduell verschieden schafft
– symbolisiert durch das autoritative Nein – jenen Raum schafft, in dem der gemäß der
‚Allianz von Liebe und Roman‘49
zu erwartende Verlauf der verfrühten
Liebesbeziehung, das heißt ihre planmäßige Überführung in die Ehe, retardiert und
zuweilen nachhaltig gestört wird.50
Das Modell der höfischen Kinderliebe hat damit
seinen charakteristischen Bauplan erhalten: Schicksalhafte Bestimmung der Kinder von
Geburt an, Verfeinerung und Entdeckung der Liebe, Strafe, Trennung und – im
günstigsten Fall – glückliche Wiedervereinigung (oft bei gleichzeitigem Tod der
Vaterinstanz) sowie anschließende Heirat. Das Resultat sind weniger Abenteuerromane
als ‚Schicksalsromane‘51
, die ihre Helden durch zahlreiche Prüfungen als ausdauernd,
demütig und geduldig, die Liebenden als uneingeschränkt treu und standhaft
hervorheben. Parallelen zum Tristanprogramm werden hier greifbar, doch besteht der
signifikante Unterschied der Kinderminneromane darin, dass in vielen Fällen am Ende
nicht die Protagonisten untergehen, sondern die alte Ordnung beseitigt und durch eine
neue, auf der einstigen Kinderliebe basierenden Herrscherdynastie ersetzt wird.
4. Lyrik
Karl Bartsch spricht in seinen Ausführungen zum „Parzival“ und zum „Titurel“ nicht
von Kinderminne, der romantische Neologismus ist ihm fremd. Seine Einführung in das
Werk Wolframs von Eschenbach gibt dennoch einen entscheidenden Hinweis für die
literaturwissenschaftliche Deutung dieses Phänomens. In Bezug auf Sigune und
47
Vgl. Schultz [Anm. 23], S. 201. 48
Jacques Lacan: Der Signifikant als solcher bedeutet nichts, in: Ders.: Das Seminar III. Die Psychosen,
hg. v. Jaques-Alain Miller, Weinheim und Berlin 1997, S. 217-231, hier: S. 229. 49
Niels Werber: Liebe als Roman. Zur Koevolution intimer und literarischer Kommunikation, München
2003, S. 9. 50
Vgl. Susteck [Anm. 19], S. 271. Diesem Typus folgen neben den bereits genannten Romanen auch die
altfranzösische ‚chantefable‘ „Aucassin et Nicolete“ und – mit einigen gattungsbedingten
Einschränkungen – sogar Wickrams „Goldfaden“. Pyramus und Thisbe hingegen gehen bei diesem
Versuch zugrunde. 51
Köhler [Anm. 7], S. 170.
13
Schionatulander spricht Bartsch vom lyrischen Charakter der Titurel-Bruchstücke,
deren Reiz vor allem dem lyrischen Hang der Jugend gerecht werde. Der Stoff habe
gerade für Anfänger einen besonderen Reiz (wobei er im Unklaren lässt, ob er den
Leser oder den Dichter meint) und stehe freilich der gereiften Männlichkeit in Form der
tiefen und großartigen Idee des „Parzival“ diametral gegenüber. Aus alldem sei zu
schlussfolgern, dass der „Titurel“ zweifellos Wolframs Jugendwerk sein müsse.52
Bartsch führt weiter aus:
Der Hauptinhalt derselben (Bruchstücke) steht dem Wesen der Lyrik sehr nahe: die
Gespräche über die Minne erörtern die Natur der Liebe, wie es die Lieder der
Minnesinger auch thun.53
Dieser Befund trifft – wie oben gezeigt – auch auf Flore und Blanscheflur zu, die nicht
nur die Rhetorik der Minnesänger beherrschen, sondern auch eigene getiht (V. 824)
über die Liebe zu verfassen imstande sind. Mit einem besonderen Blick auf solche
Übertragungsphänomene können vielfältige, komplexe und vor allem auch
wechselseitige Beziehungen zwischen Kinderminne und Lyrik festgestellt werden, die
mit einem einfachen Intertextualitätsbegriff nicht so recht zu erfassen sind. Hierzu sind
unter anderem die Anspielungen auf den Flore-Roman im Leich Ulrichs von Gutenberg
und der senhal ‚Flore‘ in den Liedern der Comtessa de Dia zu zählen. Lyrik und
Kinderminneroman partizipieren nicht nur an derselben Liebessemantik, sprechen also
eine recht ähnliche, das diskursive Erbe Ovids fortführende Sprache der Liebe. Sie sind
auch durch einen gemeinsamen Bestand an Themen und Motiven, Figuren und
Schauplätzen prinzipiell kompatibel.
So ähnelt die räumliche Distanz und die semi-reale, am Mittelmeer orientierte
Topographie, die in vielen Kinderminne-Erzählungen vorherrscht, dem Konnex von
Fernliebe und Kreuzzugsthematik, wie er seit Jaufre Rudels amor de lonh vielfach
variiert wurde. Die Szenerie der Fernliebe ist so wirkmächtig, dass sich Sigune, die in
den Titurel-Strophen 122 bis 124 eine rührenden Kantilene über ihre Sehnsucht zu
singen scheint, in Erwartung ihres Geliebten am Fenster in Kanvoleis stehend über
Straßen und Wiesen auf das offene Meer hinausträumt. In ihrer Exposition kindlicher
Zweisamkeit rezipieren Romane wie „Flore und Blanscheflur“ tradierte Vorstellungen
vom lieblich-heiteren locus amoenus, die auch in der mittelalterlichen Pastourellen-
Tradition abgerufen werden.
Die Aufnahme lyrischer Imaginationen und Diskursivierungen in den
Liebesroman geht indessen weit über rhetorische und situative Aspekte hinaus.
Nirgends tritt dies so evident hervor, wie in der aus dem frühen 13. Jahrhundert
stammenden altfranzösischen Kinderminnegeschichte „Aucassin et Nicolette“ – ein als
‚chantefable‘ bezeichneter, prosimetrischer Text, bei dem assonierend gereimte
Liedpartien in freie Prosa eingelassen sind. Das Ergebnis ist eine zuweilen burleske, in
jedem Fall aber gesungene Erzählung um die verbotene Liebe zweier Kinder, deren
transgenerische Interferenz mit der Lyrik durch den Einbezug von Versatzstücken aus
Tagelied, Frauenpreis oder jeu parti noch einmal intensiviert wird. Die lyrisch-epische
Verflechtung dieses Textes kulminiert in einer kuriosen Schluss-Sequenz, in der sich
das Mädchen Nicolette – wahrscheinlich als eine entfernte Reminiszenz an den
52
Vgl. Karl Bartsch: Einleitung, in: Wolfram von Eschenbach: Parzival und Titurel. Erster Theil, hg. v.
Dems., Leipzig 1870, S. V-XXXVI, hier: S. XV. 53
Ebd., S. XVII.
14
Tristanroman – als Spielmann verkleidet und während ihres Auftritts in beinahe
balladesker Manier eine lyrische Miniatur ihrer eigenen Liebesgeschichte darbietet.
Nun wäre es der Sache kaum angemessen, eine monokausale literarhistorische
Genese des Kinderminneromans aus der Troubadour-Dichtung und dem Minnesang zu
behaupten. Schon das Eingangszitat aus dem „Erec“ verbietet eine solche Verengung,
trägt doch gerade in der Binnenerzählung im Modus der Kinderminne diskursivierte
Mabonagrin-Geschichte nicht unwesentliche Züge eines conte féerique.54
Die oben
genannten Beispiele bestätigen jedoch Bartschs Vermutung, dass die Kommunikation
zwischen dem Kinderliebesroman und der Lyrik des Hochmittelalters – mit Ausnahme
vielleicht des „Tristan“ – verglichen mit anderen epischen Gattungen und Genres eine
deutlich erhöhte Intensität aufweist. Die signifikanten Spuren lyrisch-epischer
Absorption und Transformation zeigen, dass es dringend geboten ist, den
mittelalterlichen Liebesroman nicht allein als Konstrukt von rein narrativer Faktur zu
begreifen. Es soll daher im Folgenden versucht werden, einige lyrische Fluchtlinien
aufzuzeigen, die das Erzählen von kindlicher Liebe im Mittelalter determinieren.
4.1. Reinheit der Liebe und Dienstgedanke
Kinderminne ist sublimierter Eros unter Beibehaltung des höfischen Liebescodes. Das
Bild des liebenden Kindes prädestiniert, um einem Liebesbegriff besonderen Ausdruck
zu verleihen, der von Keuschheit, Reinheit und Verzicht geprägt ist. Eine solche auf
Entsagung ausgerichtete Liebe prägt auch die Lyrik der Provenzalen Bernart de
Ventadorn und Giraut de Bornelh. Beide singen davon, dass der in Gedanken liebende
Sänger von seiner Dame keine körperliche Erfüllung, weder Küsse noch Beiliegen
verlangen brauche (qu‘eu no volh baizars ni jazers, Nr. 22,52)55
, weil der Frauendienst
ebenso wie der Herrendienst auch unabhängig von der Aussicht auf einen konkreten,
d.h. exakt festgelegten Lohn erfolge (cossi que del gazardo m’an, Nr. 31,52)56
oder weil
die Werbung der Dame ihren Lohn in sich selbst trage, insofern sie der
Vervollkommnung des Mannes diene. Ähnlich verhält es sich mit der Entsagungsminne
bei Friedrich von Hausen oder Reinmar dem Alten.57
Wo hingegen Dienstgedanke und Frauenpreis stark in den Vordergrund gerückt
werden, eignet sich die Vorstellung, sich der Dame bereits im Kindes- respektive
Pagenalter unterworfen zu haben, als ein topisches und hyperbolisches Mittel, um die
Dauer, Distanz und Intensität eines Minneverhältnisses zu betonen. Bei Bernhart de
Ventadorn ist zu lesen:
Pois fam amdui efan,
L‘am ades e la blan (sal);
54
Vgl. Volker Mertens: Enites dunkle Seite: Hartmann interpretiert Chrétien, in: Vom Verstehen
deutscher Texte des Mittelalters aus der europäischen Kultur: Hommage à Elisabeth Schmid, hg. v.
Dorothea Klein, Würzburg 2011, S. 174-190, hier: S. 180f. – zur Feenmotivik im „Erec“ siehe
grundlegend Pierre Gallais: La fée à la fontaine et à l‘arbre. Un archetype du conte merveilleux et du récit
courtois, Amsterdam und Atlanta 1992. 55
Alle Lieder von Giraut de Bornelh zit. nach Ders.: Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh,
hg. v. Adolf Kolsen, Bd. 1: Texte mit Varianten und Übersetzung, Halle 1910. 56
Alle Lieder von Bernart de Ventadorn zit. nach Ders.: Seine Lieder, hg. v. Carl Appel, Halle 1915. Zum
Problem der Deutung lyrischer Verzichtsäußerungen vgl. Kasten [Anm. 2], S. 200f. 57
Vgl. Feuerlicht [Anm. 2], S. 277f.
15
E.s vai m‘amors doblan
A chascu jorn del an.
(Bernart de Ventadorn, Nr. 28,25-28)58
Giraut de Bornelh behauptet sogar, er sei der Minne schon treu ergeben, seitdem er das
Licht der Welt erblickt habe (So qu’eu li plevira, / c’anc de l’ora qu’eu fui natz, Nr.
24,61f.). Das ist freilich noch keine Kinderminne im eigentlichen Sinne, denn nicht das
Kind soll schon wie ein Erwachsener geliebt, sondern der Sänger will in der
Retrospektive bereits als Kind gedient und sein Begehren auf die Dame gerichtet haben.
In der mittelhochdeutschen Lyrik wiederum bringen Friedrich von Hausen (MF 50,11)59
und Albrecht von Johansdorf (MF 90,16f.) Kindheit und Minne erstmals in Verbindung.
Es folgen Heinrich von Morungen (MF 134,31) und Hartmann von Aue (MF
206,17ff.)60
, spätere Belege lassen sich unter anderem bei Ulrich von Singenberg,
Ulrich von Wintersteten und in großer Zahl bei Gottfried von Neifen finden.61
Ulrich
von Liechtenstein hingegen bearbeitet den kindlichen Dienstgedanken in seinem
„Frauendienst“ nicht mehr rein lyrisch, sondern als der Lyrik entlehntes Erzählelement,
das der autofiktionalen Biographie des Minnesängers – nicht ohne heitere Note –
vorangestellt wird. Burleske Effekte erzielen auch Neidharts Winterlieder, die über die
Idee des Minnediensts von kinde an (WL 14)62
hinaus bereits mit der umgekehrten und
zugleich kritisch gewendeten Vorstellung experimentieren, einer ebenso jungen wie
unerbittlichen Minneherrin zu dienen (WL 9). Nicht das Sänger-Ich, sondern das
begehrte Objekt wird in diesem Fall einer Verjüngung unterzogen.
In der Erzählliteratur korrespondiert diese Figur mit dem siebten Buch des
„Parzival“, wo das Mädchen Obilôt seine Rolle als vrouwe freilich weniger destruktiv
interpretiert als beispielsweise seine eigene Schwester Obîe. Die stilisierte Gestik und
die elaborierte Rhetorik von Flore, Schionatulander oder Willehalm ähneln mehr der
Selbstinszenierung der Minnesänger als den chevaleresken Helden der Artusromane.
Die jungen Helden der Kinderminneromane folgen demselben Impuls, dem auch die
Figur des Ulrich von Liechtenstein unterliegt: Ihr Handeln gegenüber der geliebten
Gespielin folgt, wenn auch in je verschiedener Ausprägung, den Regeln der Hohen
Minne. Ohne den von der höfischen Liebeslyrik geschaffenen diskursiven Grund wäre
dies nur schwerlich denkbar.
4.2 Liebe als Macht
Es gehört zu den elementaren Figuren der mittelalterlichen Lyrik, dass die höfische
Liebe allegorisch als Frau Minne in Gestalt einer Königin oder Göttin auftreten und
adressiert werden kann. Als abstrakte Macht, die über das Sänger-Ich gebietet,
Liebesglück bereitet und Leid verursacht, rufen – wohl in Anlehnung an Troubadours
58
Seit wir beide Kinder waren liebe ich sie und diene ihr, und an jedem Tag des Jahres verdoppelt sich
meine Liebe. 59
Sofern nicht anders ausgewiesen, werden alle Lieder des deutschen Minnesangs zit. nach Des
Minnesangs Frühling, unter Benutzung der Ausgaben von Karl Lachmann und Moritz Haupt, Friedrich
Vogt und Carl von Kraus bearb. von Hugo Moser und Helmut Tervooren, Bd. 1: Texte, 38. Aufl.,
Stuttgart 1988. 60
Vgl. Günther Schweikle: Minnesang, 2. Aufl., Stuttgart 1995, S. 197. 61
Vgl. Feuerlicht [Anm. 2], S. 274f. 62
Neidhart: Die Lieder, 5. Aufl., hg. v. Paul Sappler, Tübingen 1999.
16
der zweiten und dritten Generation – schon Friedrich von Hausen und Rudolf von Fenis
die Liebe an. Die Liebe erscheint dann als ein von außen kommendes, von den
Menschen nicht zu verantwortendes Unheil, als etwas, dessen Macht sich gerade auch
daran studieren lässt, dass weder das naive Kind noch der alrewîseste man (MF 66,17)
vor ihr sicher sind.63
Auch die Erzählungen des 12. und 13. Jahrhunderts greifen, insbesondere dort,
wo von Kinderliebe gesprochen wird, diesen Topos ovidianischen Ursprungs wieder
auf. Das mittelhochdeutsche Märe „Aristoteles und Phyllis“ verwendet sowohl das
Motiv des liebenden Kindes als auch des Weisen, dessen blindes Begehren ihn –
öffentlichkeitswirksam als Pony abgerichtet – zum Sklaven eines hübschen Mädchens
werden lässt. Konrad Fleck lässt seinen Erzähler an exponierter Stelle anmerken, dass
die Minne so mächtig sei, dass sie selbst Kinder in ihrer Kunst zu lehren versteht (sô
gewaltic ist der minnen got, V. 610). In ähnlicher Weise zeigen sich die Erzähler des
„Titurel“ (V. 49,1) und des „Willehalm von Orlens“ (V. 4459) darüber erstaunt, dass die
Minne ihre Macht ausgerechnet an zwei naiven Kindern zu erweisen gedenkt.
Trotz ihres literarisierten Charakters haftet der Kinderminne also etwas
Mythisches an: Sie ist eine fremde Macht, eine schicksalhafte Fügung, bedarf aber
weder eines Götterpfeils („Eneasroman“) noch eines magischen Tranks „Tristan“). Wo
ihr Ursprung erzählt wird, gibt sie – ähnlich wie die Liebesrhetorik eines Giraut de
Bornelh – vor, zu den ersten Lebensregungen des Kindes zu gehören und damit
gleichsam seit jeher zu bestehen. Wo aber nicht der sinnliche Körper Auslöser für ein
Liebesbegehren ist, kann eine Variante höfischer Liebe erzählt werden, die zumindest
vordergründig befreit ist von Sexualtrieb und Schuld.64
Umso größer die Sympathien des Lesers mit den Protagonisten wiegen und
umso drastischer die Reaktion ihrer Umwelt ausfällt, desto stärker tritt auch jener
Konflikt hervor, der in den Kinderminneromanen zuvorderst behandelt wird: die auf die
Überwältigung kindlicher Gefährten durch die Liebe folgende unangemessene
Leiderfahrung, die aus dem 'Nein-des-Vaters', welches das Machtdispositiv des
patriarchalen Feudalismus repräsentiert, resultiert.
4.3 Narzissmus
Die knappen Ausführungen über die Gattungsinterferenzen zwischen den
Kinderminneromanen und der Lyrik des Hochmittelalters sollten gezeigt haben, dass es
einige bemerkenswerte Motiv-Dubletten und semantische Berührungspunkte zu
entdecken gibt. Mit dem narzisstischen Begehren kann darüber hinaus noch eine dritte,
dem bisher Dargestellten jedoch nicht unverwandte Variante kindlicher Liebe ergänzt
werden: Mir ist geschehen als einem kindelîne (MF 145,1) lautet Heinrichs von
Morungen berühmte Anspielung auf den im Mittelalter vor allem aus den
„Metamorphosen“ bekannten antiken Mythos von Tod und Verwandlung des Jünglings
63
Das Lied Diu minne betwanc Salomône Heinrichs von Veldeke ist der früheste volkssprachliche Beleg
für den Topos des von der Macht der Liebe besiegten Salomon, den u.a. Wolfram von Eschenbach im
Rahmen der Blutstropfenszene im VI. Buch des „Parzival“ erneut als mythischen Präzedenzfall für die
Minne, die eben auch Salmônen (V. 289,17) zu bezwingen vermag, produktiv macht. Zit. nach: Wolfram
von Eschenbach: Parzival. Studienausgabe. Mittelhochdeutscher Text nach der sechsten Ausgabe von
Karl Lachmann, 2. Aufl., Berlin und New York 2003. 64
Vgl. Rüdiger Schnell [Anm. 5], S. 430f.
17
Narziss. Ähnlich formulierte vor ihm schon Bernard de Ventadorn in seinem
Lerchenlied die grundsätzliche Nähe von Troubadour-Liebe und narzisstischer Liebe.
Die zwei Lieder zeigen, dass die Situation des Narziss bzw. die arglose
Selbstbezogenheit des Kindes und das elaborierte Liebesstreben des Sängers prinzipiell
vergleichbar ist, weil beides auf einer elementaren Täuschung beruht: Hier wie dort
wird die eigene Projektion nicht als solche erkannt, sondern das Selbstbild oder die
ferne Geliebte so begehrt, als handelte es sich tatsächlich um ein anderes Subjekt.65
Andreas Kraß hat diesen Aspekt höfischer Liebesdichtung mit Hilfe der Theorien von
Freud und Lacan evident herausgearbeitet: In seinen Ausführungen zum Narziss-Lied
legt er dar, wie die hier verwendeten Spiegelungs- und Verwundungsmotive sichtbar
machen, dass jedwede Verlagerung der Selbstliebe auf eine höfische Dame
schlechterdings scheitern muss, wenn diese nur Objekt einer Projektion des ritterlichen
Ich-Ideals auf ein namenloses weibliches Wunschbild ist.66
Folgt man dieser Deutung,
so wäre der ‚primäre Narzissmus‘67
, auf den das Bild des selbstbezogenen Kindes
verweist, eine Metapher für die prinzipiell neurotische Struktur der Hohen Minne, das
zerstörte oder zerrinnende Spiegelbild ein Symbol für das Wechselspiel von
Idealisierung und Zweifel.
Doch was bedeutet das für den hier behandelten Romantypus? Gibt es
Möglichkeiten, das narzisstische Dispositiv episch aufzulösen? Freud schreibt in seinen
„Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“, dass es dem Kind gewiss am Nächsten läge,
diejenigen Personen zu Sexualobjekten zu wählen, die es mit einer sozusagen
abgedämpften Libido bereits seit seiner Kindheit liebt.68
Für zahlreiche Liebespaare
insbesondere der Literatur des 19. Jahrhunderts gilt, dass sich ihre Bekanntschaft aus
ihren Kindertagen herleitet, dass sie in familiärer Vertrautheit miteinander aufwachsen
und schließlich von einer geschwisterlichen Relation zu einer sexuellen gelangen.69
Die
Kinderminne wiederum ist nichts anderes als die Idee, die Geliebte gleichsam in der
nestwarmen Kinderstube zu finden, doch aus dem zeitlichen Nacheinander von
Freundschaft und Begehren wird hier ein unheilvolles Nebeneinander, weil
Liebesklugheit und erotisches Begehren zu früh in die kindliche Welt eindringen und
eine biografische Diskontinuität erzeugen.70
Alle zivilisatorischen Bemühungen um
Exogamie – seien sie biologisch, gesellschaftlich oder politisch motiviert – sind
hierdurch aufs Gröbste gefährdet.71
65
Vgl. Gerhard Wolf: Minnesang unter Narzißmusverdacht. Überlegungen zu Heinrichs von Morungen
„Mir ist geschehen als einem kindelîne“ (MF 145,1), in: Das Gedichtete behauptet sein Recht. Festschrift
für Walter Gebhard zum 65. Geburtstag, hg. v. Klaus H. Kiefer, Armin Schäfer und Hans-Walter
Schmidt-Hannisa, Frankfurt/Main 2001, S. 333-345, hier: S. 338. 66
Vgl. Andreas Kraß: Der zerbrochene Spiegel. Minnesang und Psychoanalyse: Das Narzisslied
Heinrichs von Morungen, in: Narziss und Eros. Bild oder Text?, hg. v. Eckart Goebel und Elisabeth
Bronfen, Göttingen 2009, S. 77-100, hier: S. 85f. 67
Sigmund Freud: Zur Einführung des Narzißmus, in: Ders.: Das Ich und das Es. Metapsychologische
Schriften, 6. Aufl., Frankfurt/Main 1998, S. 51-77, hier: S 66. 68
Vgl. Sigmund Freud: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, in: Freud-Studienausgabe, hg. v.
Alexander Mitscherlich, Angela Richards und James Strachey, Bd. 5: Sexualleben, 4. Aufl.,
Frankfurt/Main 1972, S. 37-146, hier: S. 128. 69
Vgl. Horst Thomé: Autonomes Ich und ‚Inneres Ausland‘. Studien über Realismus, Tiefenpsychologie
und Psychiatrie in deutschen Erzähltexten (1848-1914), Tübingen 1993, S. 123. 70
Insofern wäre das liebende Kind die amouröse Variante des puer senex. Vgl. Schultz [Anm. 1], S. 69f. 71
Vgl. Ulrich Wyss: Den „Jüngeren Titurel“ lesen, in: Germanistik in Erlangen. Hundert Jahre nach der
Gründung des Deutschen Seminars, hg. v. Dietmar Peschel, Erlangen 1983, S. 95-113, hier: S. 106ff.
18
Der Blick auf das latente Narzissmus-Thema legt die suggestive Nähe zur
Geschwisterliebe frei, die allen Geschichten von der Kinderminne anhaftet. Die meisten
Fassungen des Flore-Romans negieren zwar eine Verwandtschaft der Kinder
ausdrücklich, doch schon die kuriose Geburt der Liebenden, die sich an einem
Palmsonntag im selben Raum und im selben Augenblick ereignet haben soll, deutet auf
ein Verhältnis hin, das einem Geschwisterpaar gleichkommt. Auf solche Weise
kommen für gewöhnlich nur Zwillinge zur Welt; Byblis und Kaunos beispielsweise, die
im Mittelalter durch die Ovid-Rezeption als Protagonisten einer inzestuösen, wenn auch
einseitigen Liebesgeschichte bekannt sind. Es sei hier nur kurz angemerkt, dass der
Erzähler des Flore-Romans auch im weiteren Verlauf der Geschichte keine Gelegenheit
auslassen wird, um zu betonen, dass die beiden Kinder gleich fühlen, gleich denken und
handeln. Sie sind Seelenverwandte, wenn auch von unterschiedlicher Konfession. Sogar
äußerlich ist die Wesensgleichheit so vollkommen, dass die Menschen, die ihnen
begegnen, sie allenthalben für Doppelgänger halten müssen und nur das Lüpfen der
Bettdecke der allgemeinen Verwirrung ein Ende bereiten kann. In seiner
schwesterlichen Freundin Blanscheflur liebt Flore also offenbar in erster Linie sein
eigenes Ebenbild. Seine lange Suche nach der Geliebten ist folglich nicht nur ein
Liebesabenteuer, sondern bedeutet – wenn man so will – auch ein Streben nach einer
Wiederherstellung seiner Einheit und Ganzheit.72
Unmittelbar auf der Hand liegt das problematische Nebeneinander des
Begehrens zwischen Kindern und des Begehrens zwischen Geschwistern in Johanns
von Würzburg „Wilhelm von Österreich“. Ganz unverschleiert wird die Liebe der
Kinder, die zwar nicht im biologischen Sinne verwandt, doch durch Adoption
verwandtschaftlich verbunden sind, auch als eine Verbindung zurückgewiesen, die
inzestuösen Charakter hat. Eine Laune des Schicksals sorgt in diesem Roman dafür,
dass Wilhelm seiner bislang nur aus der Ferne geliebten Aglye zum Bruder gemacht
wird:
‚dich schol der kuenc ze kinde han:
er hat ein luestic toehterlin;
sich! daz schol din swester sin!‘
(Johann von Würzburg: Wilhelm von Österreich, V.1252-1254)73
Die latente Ambivalenz der in den Romanen des 13. und 14. Jahrhunderts
vorgefundenen Kinderlieben wird hier manifest und kulminiert in Wilhelms Ausrufung
gnade, swesterlin! (V. 1378) – einer kuriosen Hybridformel aus verniedlichter
Verwandtschaftsbezeichnung und klassischer Liebesrhetorik. Das Ergebnis ist absehbar:
Die Kinder werden zunächst mit einem Kontaktverbot (huote) bestraft, das den Fluss
der Liebeskommunikation unterbinden soll, bis der Held in einem zweiten Schritt an
seinen Erzrivalen ausgeliefert wird. Es folgt die obligatorische Serie von Abenteuern,
ehe die beiden schlussendlich doch vereint werden. Allerdings ist dem prekären Glück
in diesem Fall keine Dauer beschienen, Wilhelm gerät in einen tödlichen Hinterhalt,
worauf der Liebestod der Dame folgt. Dass die Eltern ihr Handeln mit der Furcht vor
einer Mesalliance begründen und darüber vergessen, dass sie selbst das Findelkind
Hierzu auch Elisabeth Schmid: Familiengeschichte und Heilsmythologie. Die Verwandtschaftsstrukturen
in den französischen und deutschen Gralromanen des 12. und 13. Jahrhunderts, Tübingen 1986, S. 199f. 72
Vgl. Carol F. Heffernan: The Orient in Chaucer and Medieval Romance, Cambridge 2003, S. 102f. 73
Zit. nach Johann von Würzburg: Wilhelm von Österreich, hg. v. Ernst Regel, Berlin 1906.
19
Wilhelm als Dienst an ihrem Gott Apollo an Sohnes statt angenommen haben, ist
äußerst symptomatisch und zeigt an, dass die Spuren inzestuösen Begehrens in den
Kinderminneromanen allenfalls oberflächlich beseitigt wurden.
Nur auf den ersten Blick realisiert die Kinderminne also eine libidinöse, wenn
auch gegen Normen der feudalen Ordnung verstoßende Objektbesetzung. In Wahrheit
wird, unter dem Schein personaler, gegenseitiger und asketischer Geschlechterliebe
gerade deren Scheitern vorgeführt. Doch wie hängen der Narzissmus einerseits und der
Inzest als Extremfall einer endogamen Beziehung zusammen? Wer sein Begehren auf
das gerichtet hat, was er selbst ist, war oder sein möchte,74
muss idealiter entweder das
eigene Geschlecht oder sein eigen Fleisch und Blut begehren. Der Inzest ist insofern die
dunkle Kehrseite der so idyllischen Kinderminnebeschreibungen. Hartmann von Aue
gibt uns in seinem „Gregorius“ ein sehr genaues Bild von dieser Problematik, indem er
dem ödipalen Motiv Sohn-liebt-Mutter die von einem Bruder-Schwester-Inzest geprägte
Elternvorgeschichte vorausschickt und ihr Zustandekommen mit dem Teufel einerseits
und mit der kindlichen Unbefangenheit der Figuren andererseits erklärt.75
Die narzisstische Anlage höfischer Liebe wird in der Kinderminne folglich nicht
aufgelöst, sondern als oberflächlich entproblematisierte, aber prinzipiell strukturgleiche
Variante derselben regressiven Tendenz fortgeführt, die auch dem Minnesang
innewohnt. Hier sind bemerkenswerte Übereinstimmungen zu beobachten, wenn dieser
Befund mit Heinrichs Lied, das uns den Minnesang als narzisstisches Spiegelkabinett
vorführt, kurzgeschlossen wird. In beiden Fällen prädominiert die Perspektive eines
männlichen Subjekts, das nach einem Ideal strebt, das ihm grenzenloses Wohlbehagen
verspricht (Flore beispielsweise sehnt sich weniger nach einer verantwortungsvollen
Ehe mit Blanscheflur als nach einer Rückkehr in die Idylle der in einem lieblichen
Baumgarten verbrachten Kindertage)76
, zugleich aber durch die Erfahrung von Leid
gebrochen wird. Es kommt zur Entzweiung und endlichen Wiedervereinigung des Ichs
mit seinem Double. Sowohl das Kind als auch der Sänger strebt dabei nach einem Ich-
Ideal, das, wie James A. Schultz hervorhebt, eindeutig höfisch konnotiert ist und seine
Anziehungskraft gerade durch die höfischen und edlen Attribute des Begehrten erhält:
We assume there is something within us that makes us want to love and drives us to seek
out lovers and predetermines to some extent the sort of lover we will want […]. Courtly
lovers do not have this internal component. This means that the attributes of the beloved,
those attributes that enter the eyes and lodge in the heart, play a proportionally greater
74
Vgl. Freud [Anm. 67], S. 66. 75
Vgl. Kästner [Anm. 14], S. 312f. Eine Inzestproblematik gibt es auch in dem mit einer
Kinderliebesgeschichte beginnenden Roman „Mai und Beaflor“, hier jedoch nur auf der Vater-Tochter-
Ebene. In seiner im Wintersemester 2007/08 an der Frankfurter Goethe-Universität gehaltenen Vorlesung
„Sex and Rhyme: Ein Streifzug durch die deutsche Literatur des Mittelalters“ entwirft Andreas Kraß den
dreifachen Inzest als thematische Grundstruktur des „Gregorius“. Den beiden dargestellten
Inzesthandlungen ginge demnach ein erster, auf der Vater-Tochter-Ebene vollzogener Inzest voraus, der
durch die zu große Nähe und die Weigerung des Vaters, die Landesverhältnisse zu ordnen und seine
Tochter zu verheiraten, markiert sei. Mit einigen zeitgenössischen Erzählungen von der Kinderminne
ließe sich diese Deutung sehr gut verbinden. So entwickelt Telion, der König von Rom, zu Beginn der
Erzählung „Mai und Beaflor“ nach dem Tod seiner Ehefrau eine Neigung zu seiner eigenen Tochter. Als
gattungspoetisches Argument ließe sich unterstützend anbringen, dass der Vater-Tochter-Inzest auch in
der für die hier behandelten Texte modellbildenden „Historia Apollonii Regis Tyri“ eine zentrale,
handlungsmotivierende Rolle spielt. Zur Inzestproblematik im Flore-Roman, die sich aus den obskuren
Umständen der Zeugung- und Geburt der Kinder ergibt, siehe Heffernan [Anm. 72], S. 83-107. 76
Vgl. Geering [Anm. 22], S. 61.
20
role. The courtly lover does not seek love. He or she is rendered powerless by the courtly
and noble attributes of the beloved.77
Die höfische Liebe steht zu einem guten Teil im Dienste der Ästhetisierung, der
Distinktion und der Exklusivität des mittelalterlichen Feudaladels. Wenn Courtoisie und
höfische Liebe, wie Schultz ausführt, zwei gleichartige Momente einer Tendenz zur
Verfeinerung und Nobilitierung darstellen, dann ist die Kinderminne ein Modus, im
narzisstischen Begehren des Kindes ein Begehren des Höfischen zum Ausdruck zu
bringen, ohne dass dabei die Probleme des Eros unwillkürlich in den Vordergrund
drängen.78
5. Schluss
Im vorliegenden Aufsatz wurde die Kinderminne als ein in der höfischen Dichtung weit
verbreitetes Phänomen beschrieben, das sowohl in einigen grandiosen als auch in
einigen unterschätzten oder eher epigonalen Texten behandelt wird, das aber auch in
einer Vielzahl von Anspielungen und intertextuellen Verweisen aufscheint. Der
komparatistische Ansatz half dabei zu verstehen, welche Bedeutung den im frühen 12.
Jahrhundert einsetzenden lyrischen Reflexionen über die Liebe hinsichtlich der
Herausbildung der Kinderminne als ein ebenso originelles wie gewichtiges literarisches
Thema beizumessen ist.
Dabei zeigt sich, dass die Kinderminne trotz möglicher sozialhistorischer
Bezugspunkte weder ein bloßes Abbild einer konkreten höfisch-feudalen Wirklichkeit
ist, noch dass wir allein der vermeintlichen Güte, Keuschheit und Askese der Kinder
wegen von einer vollständigen Absorption des höfischen Eros ausgehen sollten.
Mitnichten ist die Kinderminne ein dem die Radikalität des Tristan-Paradigmas
umrankendes und eingehendes „heiteres und wolthuendes Blumenbild“79
– sie ist
„erotisch aufgeladene Asexualität“80
. Wer sich von der Verlagerung des erzählerischen
Akzents auf die Kindheit und deren spezifischer Konstruktion zu sehr vereinnahmen
lässt, läuft daher Gefahr zu übersehen, dass auch die vermeintlich sterile Kinderminne
in erster Linie im Kontext der Geschichte der Sexualität und nur nachrangig Rahmen
einer Geschichte der Kindheit im Mittelalter zu behandeln ist.81
Daneben ist der Befund, dass die Liebe zwischen zwei heranwachsenden
Mitgliedern der höfischen Gesellschaft vielfach ohne eine explizite literarische
Ausgestaltung oder gar ein eigenes Handlungsfundament auskommt, für die
literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit der Kinderminne von großer Bedeutung.
Dies gilt in der Epik ebenso wie in der Lyrik der frühen Troubadours und Minnesänger,
in der die Motivik des Flore-Romans gelegentlich als mythischer Präzedenzfall für die
77
James A. Schultz: Courtly Love, the Love of Courtliness, and the History of Sexuality, Chicago 2006,
S. 171. 78
Vgl. ebd. S. 172. 79
Wolfgang Golther: Flore und Blanscheflur. Einleitung, in: Tristan und Isolde und Flore und
Blanscheflur. Zweiter Teil, hg. v. Dems., Berlin und Stuttgart 1889, S. 235-246, hier: S. 246. 80
Jan-Dirk Müller [Anm. 6], S. 400. 81
Wie die Auseinandersetzungen mit Problemen des Inzests und der Mesalliance erwiese, stellt der
Zusammenhang zwischen kindlicher Intimität und den spezifischen Machtdispositiven dabei eine äußerst
produktive Kategorie für eine weiterführende kulturwissenschaftliche Betrachtung der Kinderminne dar.
21
Liebe am Hof herangezogen wird.82
Im höfischen Roman erscheint die Kinderminne als
ein gleichsam lyrisches Portrait, dessen Bildprogramm der Betrachter schon nach
wenigen, skizzenhaften Pinselstrichen abrufen kann.
Nur teilweise darf es den eingeschränkten Qualitäten der Verfasser angelastet
werden, dass dieses Portrait vielleicht nicht ganz an die großen Liebesentwürfe des
Mittelalters heranreicht – die Schwierigkeiten des Erzählens ‚reiner Kinderliebe‘ wurde
an Romanen wie „Flore und Blanscheflur“ und an der chantefable „Aucassin und
Nicolette“ evident. In den meisten anderen literarischen Entwürfen wird die
Kinderminne funktionalisiert als ein nahezu schablonenhaft zu gebrauchendes Konzept,
in dem sich verschiedene Schichtungen des höfischen Diskurses über die Liebe
sedimentiert haben, die im jeweiligen Text auf spezifische Weise aktualisiert und
hybridisiert werden können. Hier wie dort entpuppen sich also die neuen Variablen, die
in der vorliegenden Studien der Gleichung ‚Kindheit und Minne ergibt Kinderminne‘
hinzuzufügen versucht wurden, als relativ bekannte, erzählerisch abgewandelte
Elemente des höfisch-literarischen Sprechens über die Liebe.
Damit erscheint uns der Charakter dieses literarischen Bildes von den liebenden
Kindern zwar klarer, harrt aber noch immer einer genaueren Deutung. Die Verbindung
von außerehelicher Liebe und Todessehnsucht, stellen eine gewisse Nähe zum Tristan
und Isolde her. Diese Perspektive nehmen oft auch die Eltern der Protagonisten ein,
wobei sie mit ihren übereilten Handlungen – das zeigt insbesondere die Szene am
gefälschten Grabmal in Konrad Flecks „Flore und Blanscheflur“ – das Tristanprogram
nachgerade zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden lassen. Auf der anderen Seite ist
der Verlauf jener Romane, in denen die Liebenden nicht untergehen, eindeutig auf eine
herrschaftsstabilisierende, dem dynastischen Prinzip durchaus Rechnung tragende Ehe
ausgerichtet, was eine entscheidende Entschärfung der radikalen Liebespassion
bedeutet. Zwischen diesen Polen treten ferner andere Aspekte in den Vordergrund der
Auseinandersetzung mit heterosexueller Geschlechterliebe – etwa Ideen von Askese
und Freundschaft.83
Ausgehend von Luhmanns Begriff der romantischen Liebe ließe sich die
Kinderminne schließlich beschreiben als eine frühe Vorläuferin, die so etwas wie einen
dritten Weg zwischen der radikalen Tristanpassion und der harmonisierten
Herrschaftsehe des Artusromans zu gehen versucht. Vor allem Rudolfs von Ems
„Willehalm von Orlens“ – ein seit Walter Haugs Aufsatz über den ‚neuen Liebesroman‘
als Anti-Tristan verstandener Text – scheint in diese Richtung zu weisen.84
Doch auch
dieses Ergebnis bleibt vorläufig und dürfte der Heterogenität der literarischen
Äußerungen über die kindliche Liebe nicht gerecht werden.
Versuchsweise möchte ich daher abschließende eine andere Lesart vorschlagen:
Die Kinderminne stellt ein Übertragungsphänomen dar, das verschiedene, bereits
zwischen 1150 und 1200 etablierte Rede- und Denktraditionen zu einer lyrisch-epischen
82
Erst in Hadlaubs späteren Erzählliedern und Romanzen zielt der Einbezug der Kinderminneszenen auf
eine objektivierende Darstellung. Vgl. Jan-Dirk Müller: Ritual, Sprecherfiktion und Erzählung.
Literarisierungstendenzen im späteren Minnesang, in: Wechselspiele. Kommunikationsformen und
Gattungsinterferenzen mittelhochdeutscher Lyrik, hg. v. Michael Schilling und Peter Strohschneider,
Heidelberg 1996, S. 43-74, hier: S. 49. 83
Die Frage nach der Absorption zeitgenössischer Freundschaftsdiskurse in Romanen wie dem
„Engelhart“ Konrads von Würzburg stellt sich insofern als ein weiterführendes Forschungsthema dar. 84
Walter Haug: Der neue Liebesroman und der leidende Held: Von Rudolfs „Willehalm von Orlens“ zu
Ulrichs von Etzenbach „Willehalm von Wenden“, in: Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den
Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, 2. Aufl., Darmstadt 1992, S. 329-343.
22
Chiffre amalgamiert, die in Form von Liebesromanen wie „Flore und Blanscheflur“
auserzählt und konkretisiert werden kann, aber eben nicht notwendigerweise muss.
Dabei wird die Kinderminne ungeachtet ihrer durchaus sichtbaren Komposition und
Ästhetisierung stets als eine Erscheinung beschrieben, die – wie die Liebe von Geburt
an – naturwüchsig und im wahrsten Sinne des Wortes immerwährend ist. Sie geht sogar
über den Tod hinaus, hat also weder einen konkreten Anfang noch ein Ende. Sie stellt
damit eine massive Störung der temporalen Kontinuität dar. Gleichzeitig ist sie auf der
Grenze des Übergangs zu den magischen, übernatürlichen, dämonischen Formen der
Liebespassion angesiedelt.85
Was bringt ihr Auftauchen im Diskurs über die höfische
Liebe zum Ausdruck? – Anders als der Trank, der Zauber und der Dämon drückt
insbesondere die Flore-Liebe aus, dass Minne keine andersartige, anderweltliche und
radikal neuartige Erscheinung ist, sondern dass alles, was jetzt ist, im Grunde immer
schon da war. Hans Robert Jauß betrachtet das ausgehende Hochmittelalter als eine
Phase der Remythisierung Amors.86
Vielleicht wäre die Kinderminne vorläufig noch am
Ehesten zu verstehen als ein kultureller Mythos vom Ursprung der Liebe.
85
Vgl. Jan-Dirk Müller [Anm. 6], S. 404. 86
Vgl. Hans-Robert Jauß: Allegorese, Remythisierung und neuer Mythos. Bemerkungen zur christlichen
Gefangenschaft der Mythologie im Mittelalter, in: Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption, hg.
v. Manfred Fuhrmann, München 1971, S. 187-210, hier: S. 196f.























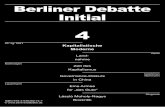










![Kunst und Erfahrung. Eine theoretische Landkarte [mit Jasper Liptow und Martin Seel]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631611895cba183dbf084a85/kunst-und-erfahrung-eine-theoretische-landkarte-mit-jasper-liptow-und-martin-seel.jpg)








