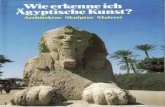Kant's 'Ich' in 'Ich soll' und Freud's 'Über-Ich'
Transcript of Kant's 'Ich' in 'Ich soll' und Freud's 'Über-Ich'
DZPhil 2014; 62(3): 365–381
Béatrice Longuenesse Kants „Ich“ in „Ich soll …“ und Freuds Über-IchAbstracts: ### Kant’s and Freud’s respective investigations of the mind obey fun-damentally different concerns. And yet their views of the structure of our mental life are strikingly similar. The article explores some of those similarities. It com-pares Kant’s transcendental unity of apperception and the organization of mental processes Freud calls ‘ego’ (Ich). It then proceeds to compare Kant’s categorical imperative of morality and Freud’s structure of ego/superego (Ich/ÜberIch). Freud’s structural view of the mind, it is suggested, might offer a developmental account of just those aspects of mental life Kant thought could be explained only by appealing to our belonging in a noumenal world escaping the deterministic laws of the natural world. However, Freud’s approach is exclusively developmen-tal. He does not take any position on questions of justification, the very ques-tions that are central to Kant’s concern. The paper offers a cautious response to the question: what remains, under the Freudian developmental account, of the justificatory ambition of Kant’s formulation of the categorical imperative as an imperative of pure practical reason?###
Keywords: Ego, Freud, Kant, superego ,transcendental unity of apperception
DOI 10.1515/dzph-2014-0028
1 VorbemerkungenEs ist ein seltsamer Gedanke, Kants und Freuds Auffassungen über das Wesen der Moral zu vergleichen, außer vielleicht, um den Gegensatz zwischen ihren Sichtweisen hervorzuheben. Als ich Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts – vor langer Zeit! – begann, Philosophie zu studieren, galt Freud als der dritte der drei großen „Meister des Verdachts“, deren erster Marx und deren zweiter Nietzsche war. Worin Marx, Nietzsche und Freud übereinstimmten, so hieß es, war ihre radikale Infragestellung jedes Ver-
Béatrice Longuenesse: New York University, Department of Philosophy, 504, 5 Washington Place, New York, NY 10003; [email protected]
366 Béatrice Longuenesse
suchs, die universelle Gültigkeit von Werten, insbesondere von moralischen Werten, zu begründen. Marx lehrte, dass moralische Werte Ausdruck von Klas-seninteressen seien, Nietzsche, dass sie Ausdruck des Willens zur Macht seien, und Freud, dass sie gleichzeitig Instrument wie Ergebnis der neurotischen Ver-drängung der Triebe seien. Kant auf der anderen Seite galt als der Erzvertreter des modernen Versuchs, zu erklären, wie universell gültige Begründungen für unsere Überzeugungen und Werte möglich sind, insbesondere, wie es möglich ist, dass Menschen Begründungen entwickeln, die für jeden, vorausgesetzt, er ist fähig, von seinem Verstandesvermögen Gebrauch zu machen, akzeptabel sind. Dieser „Universalismus“ hinsichtlich der Begründung von Überzeugun-gen und Werten machte Kant zu einem der Hauptverdächtigen, gegen den uns unsere Meister des Verdachts lehrten, all unser Geschick im skeptischen Hinter-fragen aufzubieten.
Marx und Nietzsche werden uns im Folgenden nicht weiter beschäftigen. Freud und Kant hingegen sehr wohl; und das aus folgenden Gründen:
Obwohl Freud zu den „Meistern des Verdachts“ gezählt wird, gibt es, wenn es um die Frage geht, die mich interessiert – was ist die Rolle des „Ich“, und allgemeiner gesagt, der ersten Person in unserem mentalen Leben? – überra-schende Übereinstimmungen zwischen Freud und Kant. Es lohnt sich zu unter-suchen, wie weit diese Übereinstimmungen gehen und wo sie enden. Was Freud und Kant gemeinsam haben, ist, dass für sie der Gebrauch der ersten Person mit einer bestimmten Art von Einheit unseres mentalen Lebens in Beziehung steht: nicht mit irgendeiner beliebigen Art von Einheit, sondern mit einer Einheit, die darauf zielt, Gründe für unsere Gedanken und Überzeugungen zu liefern. Gründe und Begründungen zu finden, der Versuch, die Dinge richtig zu sehen, hängt sowohl für Kant wie für Freud wesentlich mit dem Vermögen zusammen, in der ersten Person zu denken. Wir dächten nicht in der ersten Person, wenn wir nicht in dieser Art von geistiger Anstrengung begriffen wären. Doch in dieser geistigen Anstrengung begriffen zu sein setzt voraus, dass wir in der Lage sind, unsere Gedanken und Vorstellungen uns selbst zuzuschreiben – dem aktuell Denkenden: Das ist, was ich sehe; das ist, was ich denke; hier sind meine Gründe dafür.
Wenn ich sage: „Ich glaube, es hat gestern geregnet“, dann meine ich damit, dass es Gründe dafür gibt, zu glauben, dass es gestern geregnet hat (der Garten verströmt einen angenehmen feuchten Duft, wenn ich aus dem Wochenende nach Hause zurückkomme, und diese Tatsache veranlasst mich nicht nur, zu denken, dass es bald regnen wird, sie liefert mir, wenn ich einen Moment überlege, auch Grund zu dem Gedanken: es hat gestern geregnet). Ich selbst habe diese Gründe geprüft und für überzeugend befunden.
Kants „Ich“ in „Ich soll …“ und Freuds Über-Ich 367
Nicht unser ganzes mentales Leben spielt sich nach diesem Muster ab. Jeden Tag, jede Stunde und jede Minute verbinden sich in unserem Geist Vorstellun-gen und Gedanken, ohne dass wir uns fragen, ob sie richtig oder falsch sind, ohne dass wir Gründe prüfen und sie uns zu eigen machen. Derselbe angenehme feuchte Duft in meinem Garten erinnert mich vielleicht an einen Tag letzte Woche, an dem ich nach Hause zurückkam und von ebendiesem Duft überrascht wurde. Das geschieht in mir. Aber wenn ich denke: „Ich glaube, letzte Woche war da genau derselbe Duft“, dann bin ich bereits im Begriff, mehr zu tun: Ich verglei-che den Duft, den der Garten heute hat, mit dem Duft, den er an jenem Tag letzte Woche hatte, und ich könnte Gründe dafür angeben, warum ich glaube, dass es sich um denselben Duft handelt: Ich könnte den Duft, den der Garten heute hat, beschreiben, mir die Assoziationen, die ich letzte Woche hatte, vergegenwärtigen und sie mit denen vergleichen, die ich heute habe. Ich könnte bemerken, dass damals wie heute der Flieder in voller Blüte stand und so weiter. Und zu dem Schluss kommen: „Ja, ich glaube, es ist derselbe Duft.“
Dies trifft auch für eine andere bedeutsame Verwendung des Wortes „Ich“ zu: „Ich“ im Kontext des Satzes „Ich sollte dieses oder jenes tun.“ Es kann ver-schiedene Gründe dafür geben, dass ich aus einem Zustand der Ruhe in einen Zustand der Bewegung übergehe. „Der Wind hat mich das Gleichgewicht verlie-ren lassen.“ „Die dumme Bemerkung meines Bruders hat mich die Beherrschung verlieren lassen.“ Aber wenn ich denke, ich sollte dies oder jenes tun, dann betrachte ich meine Ziele, wäge die Mittel ab, mit denen ich diese Ziele erreichen kann, verwerfe mit Bedauern andere Möglichkeiten und komme schließlich zu dem Schluss: Das ist es, was ich tun sollte.
Diese Beziehung des Gebrauchs von „Ich“ zum Abwägen und Angeben von Gründen ist nicht der einzige bedeutsame Aspekt des Gebrauchs von „Ich“, und es ist nicht immer so offensichtlich, dass das Angeben von Gründen bei unserem Gebrauch von „Ich“ im Spiel ist, wie in dem Beispiel, das ich gerade angeführt habe. 1 Ich bin jedoch überzeugt, dass selbst in den einfachsten Fällen unsere Fähigkeit, Gründe anzugeben und unsere Fähigkeit, das Wort „Ich“ zu gebrauchen, grundlegend miteinander verknüpft sind. Aber ich werde diesen Punkt hier nicht weiter vertiefen. Ich werde mich auf den Fall des „Ich soll …“ beschränken und innerhalb dessen nur auf das moralische „Ich soll …“ Nun sind Kant und Freud aus ganz unterschiedlichen Motiven am moralischen „Ich soll …“ interessiert. Kant interessiert sich dafür, weil er an Fragen des Begründens interessiert ist: Was bedeutet es, eine Aussage – über die Welt oder darüber,
1 Zu den verschiedenen Problemen, die mit dem Gebrauch von „Ich“ verbunden sind, vgl. z. B. Shoemaker (1968); Anscombe (1975); Perry (1979); Evans (1982).
368 Béatrice Longuenesse
was ich tun soll – zu begründen? In welchem Maße können wir Begründungen liefern, die für alle gültig sind – und damit einen Anspruch auf Wahrheit und auf Korrektheit oder Richtigkeit erheben, wenn wir Entscheidungen treffen? Freud hingegen interessiert sich für das „Ich soll“, weil er sich für die Ursprünge gewisser Pathologien unseres mentalen Lebens interessiert und moralisches Sollen zweifellos mit zentralen Pathologien unseres mentalen Lebens verknüpft ist. Und doch kommen Kant und Freud von ihren ganz unterschiedlichen Frage-stellungen aus zu überraschend ähnlichen Darstellungen der strukturellen Ele-mente unseres mentalen Lebens, die uns fähig machen, das Wort „Ich“ auf eben-diese Weise zu gebrauchen: „Ich soll.“ Wenn wir dies einmal erkannt haben, lassen sich interessante Schlussfolgerungen ziehen. Das zumindest will ich im Folgenden versuchen.
Doch genug der Vorbemerkungen. Ich gedenke folgendermaßen vorzugehen: Ich werde zwischen meinen beiden Protagonisten hin- und herspringen, um her-auszufinden, wie sie sich gegenseitig ergänzen und infrage stellen. Der nächste Abschnitt (2) ist Freuds Auffassung von der Struktur des mentalen Lebens gewid-met. Im Anschluss werden wir Kants Auffassung von dieser Struktur betrachten (3). Dann tritt Kants sogenannter „kategorischer Imperativ“ der Moral in den Mittelpunkt: das moralische „Ich soll …“ (4). Schließlich werden wir fragen, in welchem Sinne Freud von einem kategorischen Imperativ der Moral spricht (5). An diesem Punkt werde ich versuchen, ein Resümee zu ziehen und zu fragen, was wir aus dem Vergleich von Kant und Freud lernen können.
2 Freud über die Struktur des mentalen LebensEs würde den Rahmen dieser Überlegungen sprengen, die wissenschaftliche Vali-dität der Einzelheiten von Freuds Theorie des Geistes zu diskutieren. Ich werde im Folgenden, ohne dies weiter zu begründen, eine wohlwollende Haltung gegen-über der freudschen Darstellung der Struktur unseres mentalen Lebens einneh-men. Doch selbst dann bleibt ein Vergleich zwischen Kant und Freud eine äußerst heikle Angelegenheit. Nicht nur aus den anfangs genannten Gründen, sondern auch, weil der Einwand nahe liegt, dass man mit einer solchen Gegenüberstel-lung versucht, das Dunkle (Kant) durch das noch Dunklere (Freud) zu erhellen. Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, überzeugend darzulegen, dass es zu interes-santen und erhellenden Ergebnissen in Bezug auf die Frage nach dem Gebrauch des Wortes „Ich“ führen kann, wenn man diese beiden Gestalten nebeneinander oder einander gegenüber stellt.
Kants „Ich“ in „Ich soll …“ und Freuds Über-Ich 369
In einem berühmten, 1923 veröffentlichten Aufsatz entwirft Freud eine Unter-teilung des Geistes in verschiedene Funktionsweisen, die als seine „zweite Topik“ bezeichnet wird. Freuds erste Topik bestand in der Unterscheidung von bewuss-ten, vorbewussten und unbewussten Vorstellungen. Freud betrachtete es als seine große Entdeckung, dass „geistig“ und „bewusst“ nicht äquivalent sind: es gibt unbewusste mentale Repräsentationen. 2 Ihr Vorhandensein zeigt sich in der Art und Weise, wie sie die Ordnung unserer bewussten Vorstellungen stören (sie bringen mich dazu, etwas zu sagen, das ich nicht sagen wollte; etwas zu tun, das ich nicht tun wollte; sie rufen die phantastischen Gestalten der Träume hervor). Durch analytische Arbeit an den bewussten Vorstellungen ist es möglich, die unbewussten Vorstellungen, deren Existenz die Ordnung der bewussten Vorstel-lungen stört, offenzulegen.
Warum sind bestimmte Vorstellungen unbewusst? Weil sie verdrängt werden. Als Theorie der unbewussten Vorstellungen ist die Psychoanalyse somit eine Theorie der Verdrängung. Einen Zwischenbereich zwischen unbewussten und bewussten Repräsentationen bilden schließlich die vorbewussten Vorstel-lungen. Dabei handelt es sich um Repräsentationen, die dem Bewusstsein zwar nicht aktuell gegenwärtig sind, sich aber gleichsam direkt unter der Oberfläche des Bewusstseins befinden und dort bei Bedarf abrufbar sind: Erinnerungen, Phantasien, Assoziationen und ähnliches.
In den Jahren, bevor er Das Ich und das Es verfasste, kam Freud aufgrund seiner klinischen Erfahrungen zu der Überzeugung, dass seine erste Topik teil-weise unzureichend war. Er hatte erkannt, dass es unbewusste Vorstellungen gibt, die nicht verdrängt sind, sondern vielmehr ihrerseits Instrumente der Ver-drängung darstellen. Mit anderen Worten: Alles Verdrängte ist unbewusst, aber nicht alles Unbewusste ist verdrängt. Die verdrängenden Kräfte und ihre Reprä-sentanten in unserem mentalen Leben liegen selbst im Bereich des Unbewuss-ten. Angesichts dessen lässt sich eine bessere Darstellung der Struktur unseres mentalen Lebens geben, wenn man in ihren Mittelpunkt nicht die Unterschei-dung zwischen unbewussten, vorbewussten und bewussten Vorstellungen stellt (obwohl diese Unterscheidung beibehalten wird), sondern vielmehr die grund-legendere Unterscheidung zwischen verschiedenen Ordnungsmodi oder Struk-turen mentaler Gehalte. Allen unbewussten Vorstellungen gemeinsam ist nicht, dass sie verdrängt sind, sondern, dass sie die Struktur dessen haben, was Freud als „Primärprozesse“ bezeichnet, während vorbewusste und bewusste Vorstel-lungen den Gesetzen von „Sekundärprozessen“ gehorchen. Grob gesagt lassen sich die Gesetze der Primärprozesse in den sonderbaren Weisen beobachten, in
2 Vgl. Freud (1900/1972) und ders. (1915/1972).
370 Béatrice Longuenesse
denen Vorstellungen – zumeist bildliche Vorstellungen und die mit ihnen ver-bundenen Gefühle – in Träumen miteinander verknüpft werden. Primärpro-zesse sind darüber hinaus für verschiedene Formen pathologischen Verhaltens verantwortlich und nicht zuletzt für harmlosere Phänomene wie Versprecher, unbeabsichtigte Handlungen und andere Fehlleistungen. Die Gesetze der Sekun-därprozesse sind grundlegende logische Regeln, nach denen mentale Gehalte so geordnet werden, dass sie sich zu einem einigermaßen konsistenten Weltbild zusammenfügen.
An dieser Stelle kommt Freuds zweite Topik ins Spiel: Die Gesetze der Pri-märprozesse sind die Gesetze des Es. Die Gesetze der Sekundärprozesse sind die Gesetze des Ich. In Das Ich und das Es definiert Freud das Ich wie folgt:
Wir haben uns die Vorstellung von einer zusammenhängenden Organisation der seelischen Vorgänge in einer Person gebildet und heißen diese das Ich derselben.3
Diese „zusammenhängende Organisation der seelischen Vorgänge“ wird von der spezifischen Funktion, die sie zu erfüllen hat, zusammengehalten. Sie ist derje-nige Teil der Psyche, dessen Aufmerksamkeit auf die Anweisungen der Außenwelt gerichtet ist; in dem die mentalen Prozesse so organisiert werden, dass die Welt, wie sie ist, im Geist repräsentiert wird. Das Ich ist getrieben von dem Bemühen, die Welt richtig zu begreifen, namentlich von dem, was Freud als das „Realitäts-prinzip“ bezeichnet.
Das Es hingegen ist der rohe emotionale, primitivere und bei weitem umfang-reichste Teil unseres mentalen Lebens. Es ist der Ausdruck unserer triebhaften Bestrebungen, Zustände der Lust herbeizuführen und Zustände der Unlust zu vermeiden. Es wird nicht vom Realitätsprinzip, sondern vom Lust-Unlust-Prinzip bestimmt. Die Art und Weise, wie Vorstellungen im Es miteinander verknüpft werden, dient nicht dem Zweck, die Realität richtig zu begreifen. Das Es gibt viel-mehr mit Lust verbundenen Vorstellungen gegenüber mit Unlust verbundenen Repräsentationen den Vorzug, selbst wenn es damit der Phantasie den Vorzug gegenüber der Realität gibt. Es findet seinen auffälligsten Ausdruck in unseren Träumen. Während es für das Ich charakteristisch ist, unsere Gedanken auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und unrichtige Gedanken zu eliminieren, werden wir im Es von „unbekannten, unbeherrschbaren Mächten“ regiert. Freud sagt über das Verhältnis von Ich und Es:
Das Ich ist der durch den direkten Einfluss der Außenwelt unter Vermittlung von W-Bw [des Wahrnehmungs-Bewusstseins-Systems] veränderte Teil des Es, gewissermaßen eine Fort-
3 Ders. (1923/1972), 243. ##### Hervorhebung im Original? #####
Kants „Ich“ in „Ich soll …“ und Freuds Über-Ich 371
setzung der Oberflächendifferenzierung. Es bemüht sich auch, den Einfluss der Außenwelt auf das Es und seine Absichten zur Geltung zu bringen, ist bestrebt, das Realitätsprinzip an die Stelle des Lustprinzips zu setzen, welches im Es uneingeschränkt regiert.4
Wenn es sich nur um diese Unterteilung handelte, wäre die Situation bereits komplex genug, da das Ich niemals nur das Ich ist: Das Es stört mit seinem beständigen Andrängen die diskursiven Anstrengungen des Ichs. Aber das ist noch nicht alles, so Freud:
Wäre das Ich nur der durch den Einfluss des Wahrnehmungssystems modifizierte Anteil des Es, der Vertreter der realen Außenwelt im Seelischen, so hätten wir es mit einem einfachen Sachverhalt zu tun. Allein, es kommt etwas anderes hinzu.Die Motive, die uns bewogen haben, eine Stufe im Ich anzunehmen, eine Differenzierung innerhalb des Ichs, die Ich-Ideal oder Über-Ich zu nennen ist, sind an anderen Orten ausei-nandergesetzt worden. Sie bestehen zu Recht. Dass dieses Stück des Ichs eine weniger feste Beziehung zum Bewusstsein hat, ist die Neuheit, die nach Erklärung verlangt.5
Das strukturelle Gesamtbild besteht also nicht nur aus Ich und Es. Es besteht aus Ich, Es und Über-Ich. Die Bildung des Über-Ichs oder Ich-Ideals fällt mit einer dra-matischen Phase in der frühkindlichen Entwicklung zusammen, in der das Kind begreift, dass es nicht das alleinige Objekt der Liebe des geliebten Elternteils ist, und auf diesen Verlust damit reagiert, sowohl die idealisierte Gestalt des gelieb-ten Elternteils als auch die gestrenge Gestalt des Verbote aussprechenden Eltern-teils zu internalisieren. In diesem Sinne gehört das Über-Ich eindeutig zum Es. Es entsteht aus einer irrationalen, gefühlsmäßigen Reaktion auf eine einschnei-dende Verlusterfahrung: Ich verliere dich nicht, du bist in mir.
Paradoxerweise ist in diesem Prozess die emotionale Energie des Es die Kraft, welche die Internalisierung der Werkzeuge des rationalen Denkens und der Normen des sozialen Lebens, die das Kind von dem geliebten Elternteil vermittelt bekommt, vorantreibt. Wenn er diese Phase, die er unter den Begriffen „Zertrüm-merung“ oder „Untergang des Ödipuskomplexes“ zusammenfasst, erläutert, macht Freud die folgende überraschende Feststellung über ihr Fortwirken in den moralischen Einstellungen des erwachsenen Menschen:
Wie das Kind unter dem Zwange stand, seinen Eltern zu gehorchen, so unterwirft sich das Ich dem kategorischen Imperativ seines Über-Ichs.6
4 Ebd., 252.5 Ebd., 256.6 Ebd., 277–278.
372 Béatrice Longuenesse
In einem anderen Text aus dieser Zeit weist Freud ausdrücklich auf die kantische Herkunft des Begriffs des kategorischen Imperativs hin:
Der kategorische Imperativ Kants ist so der direkte Erbe des Ödipuskomplexes.7
Nun wollte Kant den kategorischen Imperativ der Moral ausschließlich auf die Vernunft gründen. Freud aber sagt: Er ist der direkte Erbe des Ödipuskomplexes. Er ist das Beispiel par excellence für die Internalisierung des elterlichen Gesetzes. Wie lassen sich diese beiden Auffassungen vergleichen, geschweige denn mitein-ander vereinbaren? Warum schreibt Freud ausgerechnet dem kantischen katego-rischen Imperativ eine besondere Beziehung zum Ödipuskomplex zu? Bevor ich mich dieser Frage zuwende, möchte ich jedoch zunächst Kants Vorstellung von der Struktur des mentalen Lebens und den Platz, den der kategorische Imperativ darin einnimmt, skizzieren.
3 Kant über den GeistBeginnen wir damit, Freuds Auffassung vom Ich noch einmal kurz zu rekapitu-lieren. Wie wir gerade gesehen haben, bezeichnet Freud als „Ich“ eine Organisa-tion von mentalen Ereignissen, die vom Realitätsprinzip beherrscht wird. Freuds Gebrauch des Wortes „Ich“ unterscheidet sich dabei stark von der Art und Weise, wie wir das Wort „Ich“, das Pronomen der ersten Person Singular, üblicherweise gebrauchen. Freud meint gewiss nicht, dass wir gewöhnlicherweise, wenn wir in unserer sprachlichen Praxis oder in Gedanken das Pronomen der ersten Person Singular verwenden, damit eine bestimmte Organisation von mentalen Ereig-nissen bezeichnen. Wir verwenden „Ich“, um auf uns selbst Bezug zu nehmen, auf die Person, die in diesem Moment das Wort „Ich“ verwendet oder den Begriff „Ich“ denkt. Auf die gleiche Weise wissen wir, dass, wenn jemand anders das Wort „Ich“ gebraucht, das Wort sich auf diese Person bezieht. Zu wissen, was das Wort „Ich“ bedeutet, heißt schlicht, es auf diese Weise zu verwenden. Warum gebraucht Freud das Wort „Ich“ dann auf eine so ungewöhnliche Art und Weise? Der Grund dafür, so meine These, liegt darin, dass Freud der Auffassung ist, die Fähigkeit zur Organisation des Gehalts von mentalen Ereignissen nach logischen Regeln sei eine notwendige Bedingung dafür, den Begriff „Ich“ zu verstehen.
7 Ders. (1924/1972), 380. ##### Hervorhebung im Original? #####
Kants „Ich“ in „Ich soll …“ und Freuds Über-Ich 373
Mit dieser Auffassung kommt Freud jedoch Kant überraschend nahe. Kant betonte stärker als irgendjemand vor ihm, dass unsere Fähigkeit, uns eine Vor-stellung von der Welt zu machen, von unserer Fähigkeit abhängt, unsere Wahr-nehmungen nach logischen Regeln miteinander zu verbinden. Er unterstrich ebenfalls, dass die Verbindung unserer Wahrnehmungen nach logischen Regeln eine notwendige Bedingung dafür ist, in der ersten Person zu denken („Ich denke dies, ich glaube das“8). Wir versuchen, uns nicht in Widersprüche zu verwi-ckeln. Wenn etwas, das wir jetzt gerade wahrnehmen, nicht in unser allgemeines Weltbild passt, versuchen wir herauszufinden, ob wir einer Halluzination oder einer Sinnestäuschung unterliegen, oder ob die Welt schlicht anders ist, als wir gedacht hatten. Wenn wir uns nicht sicher sind, dann treten wir einen Schritt zurück, überlegen noch einmal, um uns dann zu versichern: „Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das hier ist ein Baum und kein Schatten. Ich glaube, dieser Beweis ist gültig; es gibt keinen falschen Schritt in diesem Beweis.“
Doch unsere Fähigkeit zu rationalem Denken dazu zu verwenden, begründe-tes Wissen über die Welt zu erwerben, ist nur eine von mehreren Verwendungs-möglichkeiten. Eine andere grundlegende Verwendungsweise besteht darin, unsere Fähigkeit zu rationalem Denken dazu zu gebrauchen, unsere Handlun-gen zu leiten: dazu, zu bestimmen, was zu tun ist. Für Kant hängt dies wesent-lich davon ab, dass wir uns die richtigen Regeln für unser Handeln geben. Hier stoßen wir auf Kants Begriff eines kategorischen Imperativs und auf eine Verbin-dung zwischen Kant und Freud, die nicht das Ich und sein Verhältnis zur Wahr-nehmung zum Gegenstand hat, sondern das Über-Ich und sein Verhältnis zur Moral. Doch Kants kategorischer Imperativ verdient zunächst eine eigenständige Betrachtung.
4 Kant über den kategorischen ImperativDas Vernunftvermögen ist, sehr allgemein gesagt, die Fähigkeit, Begründungen sowohl für unsere Überzeugungen als auch für die Entscheidungen, die wir in unserem Handeln treffen, zu suchen, wenn möglich zu finden, und wenn wir sie gefunden haben, anderen mitzuteilen (vor allem aber auch mit anderen gemein-sam nach Begründungen zu suchen). Ersteres ist die theoretische Vernunft – nur von ihr war bisher die Rede. Letzteres ist die praktische Vernunft; und diese ist es, in deren Bereich der kategorische Imperativ fällt. Kategorische Imperative sind
8 Vgl. Kant 1787/1968, 108 ff.
374 Béatrice Longuenesse
jedoch nicht die einzige Art von Imperativen, und zunächst muss ich etwas über andere Imperative sagen.
Im Allgemeinen begründen wir unser Handeln durch das Ziel oder die Ziele, die wir uns setzen: Wenn ich eine gute Musikerin werden will, sollte ich täglich meine Tonleitern üben. Wenn ich im Examen einen klaren Kopf haben will, sollte ich heute lieber nicht auf die Party gehen, sondern früh ins Bett. „Ich sollte meine Tonleitern üben“ oder „Ich sollte heute Abend statt auf die Party lieber früh ins Bett gehen“ sind Vorschriften, die wir uns selbst machen. Kant nennt diese selbs-tauferlegten Sollenssätze „Imperative“: Marschbefehle, die wir uns selbst geben. Ob wir sie explizit formulieren oder nicht, wir richten unser Handeln ständig nach solchen Imperativen aus. Wir beurteilen beständig verschiedene Möglich-keiten des Handelns und entscheiden uns dann für eine von ihnen, auch wenn uns eine andere Handlungsmöglichkeit im Hinblick auf unsere Neigungen viel-leicht attraktiver erscheint. Die vorstehenden Beispiele werden von Kant „hypo-thetische“ Imperative genannt9. Es handelt sich bei ihnen um Imperative, die wir uns unter der Bedingung oder Hypothese geben, dass wir etwas Bestimmtes errei-chen wollen: das spezifische Ziel, eine gute Musikerin zu werden; das spezifische Ziel, mein Examen zu bestehen; oder auch nur das spezifische Ziel, ein gutes Ver-hältnis zu meinen Nachbarn zu haben.
Moralische Imperative sind anders beschaffen; und darin, dass er sie für anders beschaffen hält, stimmt Kant wohl mit einer ziemlich verbreiteten Auf-fassung von Moral überein. Moralische Imperative gelten bedingungslos. Was ich tun sollte, ist deshalb das, was ich tun sollte, weil es das Richtige ist, Punkt. Das ist es, was Kant meint, wenn er moralische Imperative „kategorisch“ nennt. Sie sind kategorisch und nicht hypothetisch. Sie nehmen die Form kategorischer Urteile an und nicht die „wenn … dann“-Form hypothetischer Urteile. Der mora-lische Gedanke ist nicht: „Wenn ich ein gutes Verhältnis zu meiner Nachbarin haben will, dann sollte ich freundlich zu ihr sein.“ Der moralische Gedanke ist: „Ich sollte freundlich zu meiner Nachbarin sein, weil das das Richtige ist.“
Aber was macht aus unserer Entscheidung für eine bestimmte Handlung oder Haltung die richtige Entscheidung, Punkt, ohne dass irgendein vorgängiger Zweck begründet, dass es sich tatsächlich um die richtige Entscheidung handelt?
Kant beantwortet diese Frage, indem er ein Prinzip einführt, das ein univer-selles Kriterium dafür liefert, wodurch eine Handlung zu einer moralisch rich-tigen Handlung wird. Es gibt zahlreiche Formulierungen dieses Prinzips, von denen jede von Kant ausführlich kommentiert wurde, und die bis heute den Gegenstand einer ganzen akademischen Kommentierungs-Industrie bilden. Ich
9 Vgl. ebd., 413 ff.
Kants „Ich“ in „Ich soll …“ und Freuds Über-Ich 375
werde mich hier auf die erste Formulierung beschränken, die Kant dem kategori-schen Imperativ gibt. Es geht mir nicht um eine allgemeine Diskussion von Kants Moraltheorie, sondern allein um das „Ich“ in „Ich soll …“ und darum, der Frage nachzugehen, was wir – wenn überhaupt etwas – von Kant in diesem Punkt lernen können.
Die erste Formulierung des kategorischen Imperativs, die Kant vorschlägt, lautet: „Ich soll niemals anders verfahren als so, dass ich auch wollen könne, meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden.“10
Es ist auffällig, dass dieses Prinzip uns nicht sagt, was wir tun sollen. Es sagt uns, was wir nicht tun sollen. Wir sollen uns eine bestimmte Maxime für unser Handeln dann nicht zu eigen machen, wenn es uns unmöglich ist, zu wollen, dass jeder andere sich eben diese Maxime ebenfalls zu eigen macht. Das heißt es, zu sagen: Wir können wollen, dass diese Maxime zum Gesetz wird. Das „nicht wollen können“ ist hier sehr stark. Es soll nicht nur eine pragmatische Schwierig-keit, sondern eine logische Unmöglichkeit ausdrücken. Nehmen wir zum Beispiel an, ich gäbe mir den hypothetischen Imperativ (also keinen moralischen Impe-rativ, sondern nur eine instrumentelle Regel, eine Regel, die mir zum Erreichen meiner Zwecke dient): „Wenn ich dadurch, dass ich jemandem ein Versprechen mache, von dem ich weiß, dass ich es nicht halten kann, von ihm bekomme, was ich will, dann sollte ich ihm ein Versprechen machen, von dem ich weiß, dass ich es nicht halten werde.“ Versuchen wir jetzt, diese Maxime zu verallgemeinern: „Ich soll Versprechen machen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht halten werde.“ Damit verlöre der Begriff des Versprechens seine Bedeutung. Durch ihre Verallgemeinerung wird die Maxime zu einer logischen Unmöglichkeit: Wenn jeder sich die Maxime zu eigen machte, Versprechen zu geben, auch wenn er nicht die Absicht hat, sie zu halten, dann bräche damit die gesamte Praxis des Versprechen-Gebens zusammen.
Dies ist nicht die einzige Art von Unmöglichkeit, die sich aus dem Verallge-meinerungs-Test für Maximen ergeben kann. Aber ich möchte bei diesem Bei-spiel bleiben, um eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie stark der Begriff von Unmöglichkeit ist, der hier im Spiel ist. Eine Maxime wird dadurch unzulässig, dass ihre Verallgemeinerung zu einem Widerspruch führt: entweder (wie in dem Fall, den wir hier betrachten) zu einem Widerspruch mit dem Begriff der in Rede stehenden Handlung (in unserem Beispiel dem Begriff des Versprechens), oder (wie in anderen Fällen, die ich im Rahmen dieser Überlegungen nicht behandeln kann) zu einem Widerspruch mit der grundlegenden Beschaffenheit des mensch-lichen Willens.
10 Ders. (1785/1968), 402.
376 Béatrice Longuenesse
Auffällig ist ebenfalls, dass die Formulierung des kategorischen Impera-tivs nicht besagt, dass dann, wenn eine Maxime diesen Arten von Unmöglich-keit entgeht, sie zum Gesetz werden sollte. Sie besagt nur, dass ich, wenn meine Maxime den Test bestanden hat, sie für mich annehmen kann. Nicht alle Maximen werden, wie das Vorhaben, ein falsches Versprechen zu geben, in meinem Geist eine rote Lampe aufleuchten lassen. Und selbst wenn eine Maxime das tut, dann muss ich keinen komplizierten Prozess des Nachdenkens durchlaufen, um zu wissen, dass ich der fraglichen Maxime nicht folgen sollte. Ich weiß einfach, dass ich es nicht sollte. Indem er den kategorischen Imperativ formuliert, tut Kant nichts weiter, als explizit zu machen, was ich weiß, wenn ich weiß, dass es falsch wäre, mir eine bestimmte Maxime zu eigen zu machen. Was ich weiß, so Kant, ist, dass ich mir nur die Regeln zu eigen machen sollte, bei denen ich auch einver-standen wäre, wenn andere sie sich ebenfalls zu eigen machten.
Aber warum sollte ich mir einen solchen Imperativ geben? Kants Antwort auf diese Frage lautet: Wir tun es einfach. Wir finden den Imperativ in uns. Wir beachten ihn vielleicht nicht immer; oder wir meinen bloß, dass wir ihm folgen, wenn wir uns für eine Handlung entscheiden, während wir in Wirklichkeit mit dieser Handlung nur unser Eigeninteresse verfolgen. Aber wir haben das Prinzip in uns. Warum haben wir es in uns, und warum haben wir es in Form eines Impe-rativs in uns? Weil wir vernunftbegabte Wesen sind und als vernunftbegabte Wesen wollen, dass unser Wille von der Vernunft und nicht von unseren Neigun-gen bestimmt wird. Wir wollen selbstbestimmt oder, mit anderen Worten, frei sein. Frei im negativen Sinne: Wir wollen kein Spielball unserer Neigungen oder der Neigungen anderer sein. Frei im positiven Sinne: Wir wollen einem Gesetz gehorchen, das wir uns selbst gegeben haben, das uns weder von der Natur noch von einer Autorität außerhalb unserer eigenen Vernunft auferlegt wurde. Das ist es, was Kant zufolge aus dem universellen Prinzip („Ich soll niemals anders ver-fahren als so, dass ich auch wollen könne, meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden.“) einen kategorischen Imperativ macht.
Dies kann es jedoch unmöglich gewesen sein, woran Freud dachte, als er den kategorischen Imperativ als direkten Erben des Ödipuskomplexes bezeichnete. Für Freud ist die fundamentale Ebene der moralischen Einstellung eine emoti-onale. Die moralische Einstellung hat ihr Fundament nicht im Ich, sondern im Es. Sie ist kein Element meines mentalen Lebens, das ich (als vernunftbegabtes Wesen, das Begründungen prüft und sich zu eigen macht) selbst erzeuge und vertrete, sondern ein Element, das mir von den archaischsten Aspekten meiner frühkindlichen Entwicklung aufgezwungen wird.
Doch wenn man genauer hinsieht, weist Freuds Genealogie der Moral der moralischen Einstellung einen ambivalenten Status zu. Der Ursprung der Moral ist das Es. Aber die Energie des Es wird in den Dienst der Aufgabe gestellt, die
Kants „Ich“ in „Ich soll …“ und Freuds Über-Ich 377
Elemente des Ich in das mentale Leben des Kleinkindes zu internalisieren: das Erlernen und Aufstellen von Regeln einschließlich der kategorischen Norm der Moral ebenso wie, auf einer allgemeineren Ebene, die Praxis des Begründens, sowohl des Begründens von Überzeugungen wie des Begründens von Handlun-gen. Dieser ambivalente Status der Moral bei Freud wird uns auch im folgenden Abschnitt beschäftigen.
5 Was uns Freud über den Ursprung des kategorischen Imperativs lehren kann
Es ist genau genommen nicht nur und nicht einmal in erster Linie der kantische kategorische Imperativ der Moral, der laut Freud auf die Internalisierung der verlorenen Elternfigur durch das Kind zurückgeht. Es ist vielmehr die gesamte Palette religiöser und gesellschaftlicher Normen, deren Ursprung Freud in dieser Internalisierung sieht. Alle diese Normen haben für das Individuum denselben kategorischen Charakter, nämlich, dass sie nicht von den spezifischen Zielen spe-zifischer Individuen bestimmt sind, sondern dass sie bindend sind, Punkt. (Sie haben die Form kategorischer Urteile: nicht „wenn ich X will, dann sollte ich Y tun“ sondern „Ich sollte Y tun, Punkt.“)
Historisch, und in vielen Fällen bis heute, sind moralische Normen tatsäch-lich nur schwer von gesellschaftlichen und religiösen Normen zu unterscheiden. „Religion, Moral und soziales Empfinden – diese Hauptinhalte des Höheren im Menschen [sic!] – sind ursprünglich eins gewesen“, so Freud11. Aber Kant hatte den Ehrgeiz, eine Formel für die Moral zu finden, die unabhängig von spezifi-schen religiösen oder sozialen Überzeugungen oder Geboten war. Deshalb gab er dieser Formel die absolut universellen Formen, die wir betrachtet haben. Er strebte nach einer Formel für das, was kategorisch an der Moral ist, einer Formel, die die Moral nicht in einer spezifischen Religion oder Gesellschaftsordnung gründete, sondern sie als bindend für die Menschheit als solche erwies.
Der Einwand liegt nahe, dass genau diese Idee einer universellen Fundierung der Moral selbst einer spezifischen Gesellschaft und einer spezifischen Stufe der Menschheitsgeschichte entspringt. Nennen wir diesen Einwand den Relativitäts-Einwand. Die Idee eines universellen Rechts ist eine Idee, die der Aufklärung des 18. Jahrhunderts entstammt. Kants Modell der Moral ist inspiriert von Jean-Jacques Rousseaus politischem Modell des Gesellschaftsvertrags, das auf der
11 Freud (1923/1972), 265.
378 Béatrice Longuenesse
Aufgabe des individuellen Willens zugunsten einer Beteiligung an der Konstituie-rung eines allgemeinen Willens beruht. Man könnte also sagen: Mit seiner Formel für den kategorischen Imperativ internalisiert Kant schlicht die Idee der Univer-salität, die ihren Ursprung im politischen Ideal des Gesellschaftsvertrags hat, für das moralische Gebot: Sieh nur die Regeln des Handelns für dich als erlaubt an, die auch jeder andere für sich als erlaubt ansehen kann.
Die freudsche Darstellung des Ursprungs des kategorischen Imperativs stützt diesen Einwand, stellt jedoch zugleich eine Entgegnung auf ihn dar. Sie stützt den Einwand insofern, dass, wenn Freud recht hat, die einzigen absolut univer-sellen Aspekte der moralischen Einstellung ihre Verwurzelung im Gefühl und ihre kategorische Formulierung sind („Du musst, weil du musst.“ Oder vielmehr: „Du darfst nicht, weil du ganz einfach nicht darfst.“ Moses’ Dekalog: „Du sollst nicht …“). Alle Bemühungen um die diskursive Begründung moralischer Gebote sind letztlich auf die vermittels der Arbeit des Ichs erfolgende Internalisierung der diskursiven, kognitiven und kulturellen Normen angewiesen, die in einem spezifischen Moment in der Geschichte des gesellschaftlichen Lebens gelten.
Aber Freuds Darstellung des Ursprungs des kategorischen Imperativs ist zugleich eine Entgegnung auf den Relativitäts-Einwand: Es ist nichts falsch daran, es ist vielmehr die ureigene Aufgabe des Ichs, zu versuchen, die emotio-nalen, unbegründeten Wurzeln unserer Einstellungen und insbesondere unserer moralischen Einstellungen in eine begründete Basis zu überführen und damit unsere moralischen Einstellungen zu etwas zu machen, das auf Gründen beruht, die wir anderen mitteilen können und sollten. In dieser Hinsicht ist Kants Unter-nehmen vorbildhaft.
Nichtsdestoweniger ist Freuds Genealogie der Moral eine ernüchternde Warnung. Die bleibende Wirkung der kantischen Moralphilosophie liegt in dem Versuch, eine Grundlegung moralischer Normen zu finden, die nicht von spe-zifischen religiösen Überzeugungen oder den kulturellen Normen spezifischer Gesellschaften abhängt. Sie liegt darin, ein allgemeingültiges moralisches Krite-rium für menschliches Handeln zu geben: Handle nicht nach einer Regel, von der du nicht wollen könntest, dass auch alle anderen Menschen nach ihr handeln. Die Gefahr liegt in der Illusion, dass die Moral ihre Autorität allein aus der Ver-nunft bezieht; und unter Autorität verstehe ich hier sowohl die motivierende Kraft, die uns dazu bringt, nach moralischen Geboten zu handeln, als auch die normative Formulierung dieser Gebote als kategorisches „Sollen“. Tatsächlich, so Freud, entspringt die Autorität der Moral unter beiden Aspekten dem Gefühl: der Bindung des Kleinkindes an die Elterngestalt, auf deren exklusive Liebe es verzichten muss, die es jedoch verzweifelt festzuhalten versucht, indem es die Elterngestalt internalisiert. Bei allem Respekt vor Kant ist Freud zufolge selbst die kategorische Formulierung des Gebots ursprünglich nicht seinem rationalen
Kants „Ich“ in „Ich soll …“ und Freuds Über-Ich 379
Charakter geschuldet, sondern der unhinterfragten Autorität seines emotionalen Ursprungs.
Aus diesem Grund ist die moralische Einstellung, so wie Kant sie versteht, mit ihren typischen Elementen – kategorisches Gebot; Konflikt mit den Neigun-gen; Gefahr der Selbsttäuschung und der mangelnden Klarheit über die eigenen Motive – für Freud grundsätzlich ein Gegenstand des Verdachts. In dieser Hin-sicht ist Freuds Auffassung nicht allzu weit entfernt von derjenigen einer anderen überragenden Gestalt der deutschen Philosophie – Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der die kantische Moral nicht nur mit dem Modell des Gesellschaftsver-trages und eines universellen Rechts in Verbindung brachte, sondern auch mit dem Zusammenbruch der französischen Revolution in der Schreckensherrschaft. Aber Hegel ist optimistischer als Freud. Für Hegel sind Vernunft und Sinnlich-keit letztlich dasselbe. Kant ist in die Irre gegangen, weil er dies übersehen hat, und darum hat er der Moral so furchterregende Züge verliehen. Kants Moral mit ihrem konfliktbeladenen Wesen muss im ethischen Leben und seinem Geist der Versöhnung überwunden werden. Anders Freuds Antwort auf das kantische Modell der Moral: Kant hatte recht, was die unüberwindliche Konfliktbeladenheit unseres mentalen Lebens angeht. Doch er hat sich über das Wesen des Konflikts getäuscht, und er hat sich – bedauerlicherweise – einer Illusion hingegeben, was die motivierende Kraft der Vernunft betrifft.
Doch zurück zu unserem ursprünglichen Thema: Was sagt uns das alles über das „Ich“? „Ich“ ist der Leerbegriff par excellence. Zu begreifen, was „Ich“ bedeu-tet, heißt schlicht, zu begreifen, dass, wenn ich einen Satz sage oder denke, in dem „Ich“ die grammatische Rolle des Subjekts einnimmt, sich dieser Satz auf mich bezieht; und dass dies auch für jedes andere Individuum gilt, das „Ich“ sagt. Was wir aus Freuds Perspektive auf Kants kategorischen Imperativ lernen können, ist, dass wir als Wesen, die „Ich“ sagen, nicht nur die Vernunft (die Fähigkeit, Gründe anzugeben) gemeinsam haben, die der Möglichkeit, das Wort „Ich“ zu gebrauchen, zugrunde liegt, sondern nicht weniger den tobenden Kampf der Triebe (Liebe und Aggression) und die aus diesem resultierenden Gefühle von Verlust, Trauer und Schuld – unter deren Anbranden der fragile Damm der Ver-nunft alle Mühe hat, Stabilität zu finden.
6 Abschließende BemerkungenKant zufolge lässt sich die Struktur der mentalen Aktivität, die bei der For-
mulierung moralischer Pflichten stattfindet, nicht aus der Struktur der menta-len Aktivität ableiten, die bei der Formulierung hypothetischer Imperative, also
380 Béatrice Longuenesse
Sätzen der Form „Wenn ich Y will, dann sollte ich X tun“ stattfindet. Auf den vor-stehenden Seiten habe ich die These vertreten, dass wir überraschende Parallelen zwischen Kants Darstellung der Struktur moralischen Begründens und Freuds entwicklungspsychologischer Darstellung der Entstehung moralischer Moti-vation im mentalen Leben menschlicher Wesen entdecken können.12 Ich habe argumentiert, dass diese Parallelen uns Ansatzpunkte dafür liefern, bestimmte Elemente unseres mentalen Lebens unter Rückgriff auf die kausalen Geschich-ten empirischer menschlicher Wesen darzustellen, obwohl Kant der Auffassung war, dass gerade diese Elemente sich einer solchen Darstellung entziehen. Ich habe damit weder Argumente für oder gegen die Gültigkeit von Kants Moralthe-orie vorgelegt, noch habe ich argumentiert, dass Freuds psychologische Theorie richtig sei. Um ersteres zu tun, wäre eine philosophische Untersuchung der Frage danach, wie sich moralische Aussagen begründen lassen, notwendig. Für letz-teres bedürfte es einer philosophischen und psychologischen Untersuchung der epistemischen Grundlagen, die Freud und seine Nachfolger für die psychoana-lytische Theorie in Anspruch genommen haben. Beides sprengt offensichtlich den Rahmen dieser Überlegungen. Ich hoffe aber, dass es mir gelungen ist zu zeigen, dass eine Untersuchung der Struktur moralischer Normativität, wie sie Kant unternommen hat, und eine kausal-entwicklungspsychologische Untersu-chung der Ursprünge unserer moralischen Einstellungen, wie sie Freud vorlegt, nicht nur miteinander vereinbar sind, sondern sich wenigstens im gleichen Maße gegenseitig erhellen, wie sie einander in Frage stellen.
Ich habe in meinen Überlegungen einen zentralen Begriff der kantischen Moraltheorie ausgeklammert: den Begriff der Freiheit. Ich glaube, dass auch dieser Begriff in Freuds psychologisch-klinischer Darstellung der Ursprünge und der Entwicklung unserer normativen Einstellungen eine naturalistische Neu-interpretation erfährt. Diesen Punkt weiter zu vertiefen führte jedoch über den Rahmen der hier angestellten Überlegungen hinaus.13
Aus dem Englischen von Andreas Fliedner
12 Ausführlicher dazu Longuenesse (2012a). 13 Vortrag, gehalten an der American Academy in Berlin am 27. Mai 2013.
Kants „Ich“ in „Ich soll …“ und Freuds Über-Ich 381
LiteraturAnscombe, G. E. M. (1975), The First Person, in: Guttenplan, S. (Hg.), Mind and Language.
Wolfson College Lectures 1974, Oxford, 45–64.Evans, G. (1982), The Varieties of Reference, hg. v. McDowell, J., Oxford.Freud, S. (1972), Gesammelte Werke, hg. v. Freud, A., 7. Aufl., Frankfurt am Main [GW].Freud, S. (1900/1972), Die Traumdeutung, in: GW 2, ##### Seitenangabe #####.Freud, S. (1915/1972), Das Unbewußte, in: GW 10, ##### Seitenangabe #####.Freud, S. (1923/1972), Das Ich und das Es, in: GW 13, ##### Seitenangabe #####. Freud, S. (1924/1972), Das ökonomische Problem des Masochismus, in: GW 13, #####
Seitenangabe #####. Kant, I. (1900 ff.), Gesammelte Schriften, Berlin [AA].Kant, I. (1787/1968), Kritik der reinen Vernunft, 2. Auflage 1787, in: AA ##### Angabe #####.Kant, I. (1785/1968), Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1785, in: AA 4 #####
Seitenangabe #####.Longuenesse, B. (2012a), Kant’s ‚I‘ in ‚I ought to‘ and Freud’s Superego, in: Proceedings of the
Aristotelian Society 86.1, 19–39.Longuenesse, B. (2012b), Two Uses of ‚I‘ as Subject, in: Prosser, S., u. Recanati, F. (Hg.),
Immunity to Error through Misidentification, Cambridge.Longuenesse, B. (i. Dr.): Kant’s ‚I‘ in ‚I think‘ and Freud’s Ego, in: Bacin, S., Ferrarin, A., u. La
Rocca, C. (Hg.), Akten des XI. Kant-Kongresses, Berlin.Perry, J. (1979), The Problem of the Essential Indexical, in: Noûs 13, 3–21.Shoemaker, S. (1968), Self-Reference and Self-Awareness, in: Journal of Philosophy 65/19,
555–567.