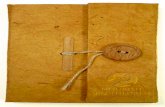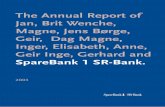Jens Lüning und Ludwig Reisch, Phosphatanalysen in der bandkeramischen Siedlung von Altdorf-Aich,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Jens Lüning und Ludwig Reisch, Phosphatanalysen in der bandkeramischen Siedlung von Altdorf-Aich,...
UNIVERSITÄTSFORSCHUNGENZUR PRÄHISTORISCHEN ARCHÄOLOGIE
Aus dem Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Frankfurt/M. Abteilung Vor- und Frühgeschichte
Band 203
Untersuchungen zu denbandkeramischen Siedlungen
Bruchenbrücken, Stadt Friedberg (Hessen) und Altdorf-Aich, Ldkr. Landshut (Bayern)
herausgegeben
von
Jens Lüning
2011
V E R L A G D R. R U D O L F H A B E L T G M B H, B O N N
Unt
ersu
chun
gen
zu d
en b
andk
eram
isch
en S
iedl
unge
n Br
uche
nbrü
cken
und
Altd
orf-A
ich
UPA 203
Rücken: 12 mm
Universitätsforschungenzur prähistorischen Archäologie
Band 203
Aus dem Institut für Archäologische Wissenschaftender Universität Frankfurt/M.
Abteilung Vor- und Frühgeschichte
2011
Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
2011
Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
Untersuchungen zu denbandkeramischen Siedlungen
Bruchenbrücken, Stadt Friedberg (Hessen) und Altdorf-Aich, Ldkr. Landshut (Bayern)
herausgegebenvon
Jens Lüning
ISBN 978-3-7749-3713-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detailliertere bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Copyright 2011 by Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
Inhaltsverzeichnis
Die Silexartefakte der bandkeramischen Siedlung Bruchenbrücken, Stadt Friedberg/Hessen
Anna-Leena Fischer .............................................................................................................................. 5 Die Hausgrundrisse in der bandkeramischen Siedlung Altdorf-Aich, Ldkr. Landshut/Isar, Niederbayern Daniela Euler ...................................................................................................................................... 91 Die Grubenöfen in der bandkeramischen Siedlung Altdorf-Aich, Ldkr. Landshut/Isar, Niederbayern Jens Lüning und Daniela Euler ......................................................................................................... 209 Die verkohlten Pflanzenfunde aus der linienbandkeramischen Siedlung Altdorf-Aich, Lkr. Landshut, in Niederbayern Stefanie Klooß .................................................................................................................................. 235 Phosphatanalysen in der bandkeramischen Siedlung von Altdorf-Aich, Ldkr. Landshut/Isar, Niederbayern Jens Lüning und Ludwig Reisch ...................................................................................................... 245
245
Phosphatanalysen in der bandkeramischen Siedlung von Altdorf-Aich, Ldkr. Landshut/Isar, Niederbayern
Jens Lüning und Ludwig Reisch
ZusammenfassungIn Altdorf-Aich wurde ein schwarzer Paläoboden von
30-50 cm Stärke entdeckt, der unter einem Kolluvium und über dem anstehenden Löß lag. Erst an der Lößober-kante wurden die üblichen Pfosten- und Grubenspuren sichtbar, die aber mit großer Wahrscheinlichkeit durch den Paläoboden hindurch gegraben waren. Um die Stärke dieses Bodens ist die Erhaltung in Altdorf-Aich besser als in allen anderen bandkeramischen Siedlungen Mit-teleuropas, doch befindet er sich immer noch 0,60-0,90 m unter dem ehemaligen Laufhorizont. Seine Oberfläche wurde phoshatanalytisch untersucht. Dabei erweisen sich die Innenräume aller Häuser als phosphatarm und heben sich gegenüber dem Umfeld als helle Zonen heraus. Ein Unterschied zwischen den verschiedenen Haustypen
besteht nicht. Die Längsgruben enthalten regelmäßig höhere Phosphatwerte als die Häuser.
Außerdem wurde eine der seltenen bandkeramischen rechteckigen Pfosteneinhegungen entdeckt und beprobt. Die zweiphasige Anlage weist aus ihrer Benutzungszeit nur niedrige Phosphatwerte auf, was die häufige Ver-mutung widerlegt, es habe sich bei diesem Typus um „Viehpferche“ gehandelt. Durch eine starke, dreieckige Phosphatanreicherung ist östlich von Haus 2 ein Vieh-standplatz nachweisbar, möglicherweise ein Warteplatz für Schlacht- oder Opfertiere. Aufgrund stratigraphischer Überlegungen ist er jünger als Haus 2, dessen Ruine er durchquert. Drei phosphatreiche Grubenöfen sind eben-falls jünger als Haus 2, aber älter als der Warteplatz.
1. Grabungen und Analytik
Bei Grabungen der Außenstelle Landshut des Bayeri-schen Landesamtes für Denkmalpflege in einem 1995 ausgewiesenen Baugebiet stieß man 1996-1997 auf einen ungewöhnlich gut erhaltenen Teilbereich einer größeren bandkeramischen Siedlung (Meixner 1998a; Engelhardt u.a. 1998). Dort lag unter einem jüngeren, bis 2,1 m star-ken Kolluvium ein fossiler, schwarzbrauner Paläoboden, in dem keine bandkeramischen Bau- und Grubenbefunde erkennbar waren, der aber zahlreiche entsprechende Funde lieferte. Es handelte sich um einen stark verlehm-ten Braunerde-Tschernosem, eine Degradationsstufe der Schwarzerde, mit einer Mächtigkeit von 0,30-0,50 m, der auf einer Fläche von etwa 2,7 ha nachzuweisen war. Dazu kamen „mehrere In-situ-Befunde mit anpassenden Kera-mikscherben, Kleingefäßen, aber auch einem Mahlstein mit zugehörigem Läufer sowie drei Kieselrollierungen, die als Unterfütterungen von Herden bzw. Öfen anzuspre-chen sind“. Die Ausgräber deuteten dieses als „Nachweis großflächig erhaltener, fossiler bandkeramischer Oberbö-den“ ... „als eine weitgehend ungestörte Oberfläche mit ausgezeichnet erhaltenen Baustrukturen“. Zwar wurden „keine ausgeprägten Laufhorizonte beobachtet, doch waren nach Ausweis der In-situ-Befunde zum Zeitpunkt der Überdeckung allenfalls einige Zentimeter des antiken Oberbodens gestört“ (Engelhardt u.a. 1998, 34).
Wegen dieser auf den ersten Blick außerordentlich guten Erhaltungsbedingungen wurde die Siedlung Alt-dorf Bestandteil eines von der Deutschen Forschungs-gemeinschaft geförderten Projektes zur Fortsetzung und
Ausweitung früherer Phosphatanalysen1. Die entspre-chenden Erdproben entnahmen die Ausgräber auf Anre-gung der beiden Verfasser flächendeckend an der Ober-fläche des „schwarzbraunen Paläobodens“ („Planum 1“)2, und zwar im Bereich der „Fläche 7“ 3, wo dieser Boden noch unangetastet vorhanden war und wo man wegen der am Südwest- und Südostrand schon vorher aufgedeckten Hausreste sowie wegen der „Kieselrollierung“in Haus 1 (Lüning/Euler, Grubenöfen, Abb. 1; 2) auf eine gute Grundrissrhaltung hoffen konnte. Vom hangenden
1 Das unter Leitung von J. Lüning und L. Reisch stehende Projekt „Phosphatanalysen in bandkeramischen Häusern und Hausumfeldern“ fand zwischen 2000-2004 statt. Die Analysen wurden im Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg angefertigt (nach der Vanadat-Molybdat-Methode, vgl. Bleck 1965; ders. 1976). Die vorangehende Phosphatuntersuchung in bandkeramischen Häusern siehe bei Stäuble/Lüning 1999. – Aus diesem Projekt sind bisher publiziert: Ein Ofen aus Neckenmarkt, Burgenland, Österreich (Lüning/Reisch 2004, 58ff.) und ein Kurzbericht über die Pfosteneinhegung von Altdorf-Aich (Lüning 2009, 154ff.).2 Nach entsprechender Reinigung wenige Zentimeter darunter. Die Oberfläche des „Paläobodens“, d.h. die Grenze zum hangenden Kolluvium, erhielt die Bezeichnung „Planum 1“, seine Unterkante und Grenze zum anstehenden Löß nannte man „Planum 3“. Bandkeramische Haus- und Grubenbefunde wurden erst ab Planum 3 als dunkle Verfärbungen im Löß sichtbar. Den „Paläoboden“ grub man in Fläche 7 in zwei meist 15 cm starken „Abstichen“ ab, das dabei entstehende „Planum 2“ ist nur in wenigen besonderen Fällen angelegt, aufgenommen und beprobt worden.3 Zur Lage der Fläche siehe Euler, Hausgrundrisse, Beilage 1.
Jens Lüning und Ludwig Reisch
246
Kolluvium freigebaggert wurden 3400 m² ausgegraben. Phosphatanalytisch beproben konnte man aber aus Zeit- und Finanzierungsgründen nur die Hälfte davon, 1794 m² (Farbtafel 1). Die für diese Situation weiterentwickelte Grabungsmethodik hinsichtlich Fundregistrierung und Probenentnahme für Phosphat- und Botanikanalysen wurde zunächst während einer vierwöchigen Lehrgra-bung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank-furt am Main im April 1997 im Bereich von Haus 2 ausprobiert und dann von der Firma ArcTron, ebenfalls noch 1997, auf die übrige Fläche ausgeweitet (Meixner 1998b).
Für die Phosphatanalyse entnahm man je Quadratme-ter vier Erdproben (ca. 50-150 Gramm)4. Davon wurde zunächst nur die Probe aus dem NW-Viertelquadrat („a“) chemisch untersucht, was 1794 Messungen ergab. Dazu kamen durch ein dichteres Meßnetz im Bereich der Häuser 2 und 3 (außerdem das SO-Viertelquadrat „d“) und durch zusätzliche Plana bei den drei Grubenöfen am Nordende von Haus 2 nochmals 332 Messungen. Gerade für die Phosphatanalyse ist das in Altdorf so überra-schend gut erhaltene Bodenprofil von allergrößtem Wert, kommt man doch hier der ehemaligen bandkeramischen Oberfläche erheblich näher, als in fast allen bekannten bandkeramischen Siedlungsflächen Europas5.
Schon die Ausgräber wunderten sich über die relativ geringen Pfostentiefen bei Haus 1 und Haus 2 und ver-muteten als Ursache den „schweren Lehmboden“ und die „Stabilität“ des „zimmermannstechnischen Baugefüges“
6. Die Bearbeitung der Hausbefunde von Daniela Euler (Euler, Hausgrundrisse) führt zum gleichen Ergebnis und wird hier zusammengefasst: Gemessen ab Planum 3 schwankt die Tiefe der Wandpfosten bei Haus 1 zwischen 5-43 cm (Mittelwert 23,9 cm): Die Tiefe seines Innen-gerüstes liegt im besser erhaltenen Nordwesten (Quer
4 Die Fundregistrierung geschah in Fläche 7 nach Quadratmetern und teilweise auch in Einzeleinmessung. Die Botanikproben (5-10 Liter) stammen aus dem NW-Viertelquadrat „a“ (vgl. Euler, Hausgrundrisse, Kap. 2.4). Aus dem gesamten Probenbestand gelangte eine Auswahl zur Analyse, deren Ergebnisse in diesem Beitrag vorgelegt werden. Beim späteren Umzug der Außenstelle Landshut nach Regensburg sind alle übrigen damals noch vorhandenen Proben entsorgt worden. 5 Eine gleich gute Erhaltung gab es in Schwiegershausen, Lkr. Osterrode am Harz: Flindt u. a. 1997; Kaltofen 2003 (Abtrag 20 cm, Pflughorizont 40 cm). Dort wurde keine Phosphatanalyse durchgeführt. Zur Interpretation vgl. Lüning 2011, Kap. 3.4.6 Nach Meixner 1998b, 18.27.28f: Haus 1 mit Wandpfosten bis 0,40 m, Innengerüst bis 0,80 cm unter der Oberkante des Paläobodens; Haus 2 mit Wandposten 40-60 cm, Innengerüst bis 80 cm. Dazu kommt nach Meixner bis zur bandkeramischen Oberfläche noch der „Braunerde-Tschernosem“ mit ca. 0,20-0,30 cm“ (später mit 30-50 cm angegeben, siehe oben Text).
reihen 10, 19, 21) bei 40-75 cm (Mittelwert 62,6 cm), im mittleren und südöstlichen Raum (QR 24, 25, 29, 31, 40) bei 10-42 cm (Mittelwert 23,0 cm), der Mittelwert des gesamten Innengerüstes beträgt 40,8 cm. Bei Haus 2 bewegt sich die Wandpfostentiefe zwischen 22-50 cm (Mittelwert 31,8 cm), beim Innengerüst liegt sie zwi-schen 11-76 cm (Mittelwert 38,8 cm).
Das ist ein ganz normaler Erhaltungszustand vieler bandkeramischer Siedlungen in Europa7, so dass man davon ausgehen muß, dass auch in Altdorf die ehema-lige Geländeoberfläche etwa 1,50 oberhalb von Planum 3 gelegen haben muß; dabei wird eine ehemalige Tiefe des Innengerüstes von 1,80 m angenommen (Lüning 2011, Kap. 3.4)8. Der in Altdorf zusätzlich vorhandene 0,30-0,50 m starke Braunerde-Tschernosem verbessert hier freilich den Erhaltungszustand um diesen Betrag, d.h. die Grenze zwischen Braunerde-Tschernosem und Kolluvium (Planum 1) liegt nur noch 0,60-0,90 cm unter-dem bandkeramischen Laufhorizont. Diese Tiefe schließt aber aus, dass die für die Beurteilung der Ausgräber so wichtigen „In-situ-Befunde“ - und überhaupt die gesamte „Fundstreuung“ - die ehemalige bandkeramische Oberflä-che markieren. Die Funde9 dürften vielmehr, so muß man aus dieser Interpretation schließen, inselartig nur in denje-nigen Bereichen vorkommen, wo sich Gruben befanden, die im Braunerde-Tschernosem allerdings farblich nicht sichtbar waren10. Die „Kieselrollierungen“ sollten die Basis von unterirdischen „Grubenöfen“ darstellen, einer gerade in Niederbayern sehr häufigen, bandkeramischen Befundgattung (Petrasch 1986; Lüning 2004; Pechtl 2008). Für die folgende Beschreibung und Interpretation der Phosphatanalysen in der Fläche ist davon auszugehen, dass sie nicht auf dem bandkeramischen Laufhorizont entnommen worden sind, sondern 0,60-0,90 m darunter.
7 Vgl. beispielsweise von Brandt 1988, 224ff., besonders auch Haus 41 (224f.), Haus 35 und 64.8 So auch D. Euler, Hausgrundrisse bei der Oberflächenrekonstruktion von Haus 1. Sie errechnet im Bereich der „Kieselrollierung“ (Befund 394) sehr richtig einen Abtrag „von gut einem Meter“ oberhalb von Planum 3, denn der von ihr als Referenz herangezogene Pfosten 373 gehört zum besser erhaltenen Nordteil von Haus 1 (s.o.). Dessen Mittel- und Südteil sind viel stärker erodiert, so dass hierfür der generelle Abtrag von 1,50 m gilt.9 Leider ist eine Bearbeitung des Fundmaterials bisher nicht zustande gekommen.10 Die zukünftige Kartierung der in Quadratmetern registrierten Fundverteilung wird vermutlich diese inselartige Verteilung sichtbar machen. Im positiven Falle kommt darunter im Löß ein Grubenbefund zutage. Im negativen Falle ist freilich nichts bewiesen, denn die ehemalige Grube könnte ja gerade im Braunerde-Tschernosem geendet, ihn also nicht durchstoßen haben. Dieses Deutungsdilemma wird bereits von der „Kartierung der wichtigsten Kulturpflanzenreste und fundreichsten Proben (über 100 Funde)“ im Beitrag von St. Klooß illustriert, wo es beides gibt: Proben mit darunter liegendem Grubenbefund und solche ohne denselben (Klooß, Pflanzenfunde, Abb. 1).
Phosphatanalysen in der bandkeramischen Siedlung Altdorf -Aich, Ldkr. Landshut/Isar, Niederbayern
247
Die Kartierung der Phosphatwerte geschieht auf dem von D. Euler interpretierten Plan von Altdorf (Euler, Hausgrundrisse, Beilage 2). Auch die Typenbezeichnung und Beschreibung der Häuser folgt der Autorin. Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass die meisten Hausflächen wie helle, phosphatarme Inseln im phos-phatreichen Umfeld liegen (Farbtafel 1). Betrachtet man den Befund genauer, ergibt sich folgendes:
2.1 Haus 2 (Großbau Typ 1b)
Das 26,60 m lange Haus besteht aus drei Räumen (Großbau) und besitzt im Norden ungewöhnlicherweise einen jüngeren Anbau (Farbtafel 2; 3). Der „Altbau“ verfügt in klassischer Weise über einen Nordwestraum mit Wandgraben, einen Korridor, einen Mittelraum mit, soweit erkennbar, rechtwinklig stehenden Querreihen (QR 23, 27?, 28) sowie einen Südostraum mit drei In-nenjochen aus Rundpfosten. Auf dem gröber, d.h. im 1 m²-Raster kartierten Gesamtplan (Farbtafel 1) wirkt fast die gesamte Innenfläche des Altbaus arm an Phosphat, also die Nordhälfte des Nordwestraums, der Korridor, der Mittelraum und, soweit beprobt, auch der Südost-raum11. An der Scheidelinie zum Südostraum (Querreihe 29) dürften einige höhere Konzentrationen zu einer au-ßerhäuslichen Anreicherungszone gehören, die sich von Südwesten her entlang der Grabungsgrenze locker durch das Haus hindurch erstreckt, wie der Übersichtsplan zeigt. Auf dem enger beprobten Hausplan (Farbtafel 4) wird dieser Gesamteindruck bestätigt, denn der opti-sche Kontrast zwischen innen und außen ist hier noch stärker. Auf beiden Plänen erscheint im nördlichen Teil des Mittelraums (zwischen QR 21 und 23) eine kleine Gruppe von neun locker gestreuten, höheren Werten, die vielleicht auf „Küchenaktivitäten“ hinweisen könnten, weil dieser Bereich von der Forschung seit langem für eine Feuerstelle in Anspruch genommenen wird (Lüning 1997, 28f.; Stäuble/Lüning 1999, 176).
Der jüngere Anbau weist in seiner ungestörten West-hälfte fast nur mittelstarke Phosphatwerte auf, was den Verhältnissen im Nordteil des alten Nordwestraums ent-spricht und bedeutet, dass beide Räume beiderseits der Querreihe 10 (älterer Hausabschluß) eine gleichartige Nutzung erfahren haben (Farbtafel 3; 4). Wie der Vor-platz hinter Haus 2 ohne die von Osten kommende Stö-
11 Für die Kartierung in der Übersichtskarte Farbtafel 1 und der Detailkarte Farbtafel 6 sind die im 1m²-Netz entnommen Proben verwendet worden (aus Viertelquadrat a), für die Kartierung in Haus 2 (Farbtafel 3; 4) dieselben und zusätzlich diejenigen der drei anderen Viertelquadrate (b-d). Auch die Beprobung der Öfen bei Haus 2 war enger (Farbtafel 7-16).
rung (siehe unten) ursprünglich ausgesehen hat, offen-bart ein erstaunlich phosphatarmes, rechteckiges Areal dicht nördlich des Hauses, das sich mit ebenfalls nied-rigen Werten nach Ost und West fortsetzt, so dass man sein Rechteckform vielleicht nicht überinterpretieren sollte (Farbtafel 1). Jedenfalls haben hinter dem Hause Tätigkeiten stattgefunden, die nur sehr wenig Phosphat hinterließen.
In den Nordwestraum und in den Anbau ragen auf dem Übersichtsplan von Osten zwei größere, außerhäusliche, phosphatstarke Flächen herein (Farbtafel 1). Die nördli-che beginnt in Längsgrube 1439 von Haus 13, zieht dann nach Westen durch Grube 1555 und über den Nordrand der „Ofengrube“ 1112 und endet im östlichen Teil des jüngeren Anbaus (Farbtafel 2; Euler, Hausgrundrisse, Beilage 2; Lüning/Euler, Grubenöfen, Abb. 4). Besonders im Detailplan tritt das Eindringen von Nordosten deutlich hervor (Farbtafel 4). Diese Phosphatanreicherung hat zu keinem der vier genannten Befunde eine engere räumli-che Beziehung, hängt also mit keinem ursächlich zusam-men und muß, weil von den Befunden ungestört, jünger sein als sie. Besonders groß ist der zeitliche Abstand zu Haus 2, weil die drei Öfen in Grube 1112 stratigraphisch jünger sind als dieses (siehe unten); diese Phosphatanrei-cherung stellt also, lange nach Auflassung des Hauses, eine erheblich spätere Aktivität dar.
Die südlicher gelegene Phosphatkonzentration bildet mit ihrer geradlinigen, nördlichen und östlichen Be-grenzung eine Dreiecksform, die den Südteil der „Ofen-grube“ 1112 und auch den nördlichen Teil des Hauses 11 überdeckt (Farbtafel 1). Sie hat also mit beiden Befunden ursächlich nichts zu tun, und muß, weil von ihnen un-gestört, jünger sein als sie. Enger ist ihre Beziehung zu Haus 2, weil die zwei Meter breite Nordzone der Kon-zentration nach Westen fast das ganze Haus durchquert, und zwar eingezwängt zwischen die Pfostenriegel 11 und 19 (Farbtafel 3). Diese müssen also noch in irgendeiner Form bestanden haben, als sich der Phosphatstreifen bil-dete. Andererseits nimmt der zwei Meter breite Streifen keine Rücksicht auf den östlichen Arm der Bohlenwand, die den Nordwestraum von Haus 2 umgibt; hier müssen die Bohlen also verschwunden gewesen sein, als die Phosphatkonzentration entstand. Dasselbe ergibt sich bei der Rekonstruktion der Grubenöfen (siehe unten). Man geht wohl nicht fehl in dem Schluß, dass die geradlinig begrenzte Dreiecksform nur durch einen Zaun bewirkt worden sein kann. Dieser war im Norden und Osten jeweils 10 m lang, so dass ein etwa gleichschenkliges Dreieck vorliegt, das über einen Innenraum von rd. 50 m² verfügte.
Nimmt man, was nahe liegt, die Vermutung hinzu, dass die massive Phosphatanreicherung von zeitweise dort verwahrtem Vieh erzeugt worden ist, dann wäre dieser
2. Auswertung
Jens Lüning und Ludwig Reisch
248
dreieckige Viehpferch in der wohl nur teilweise wieder verfüllten Restmulde der Ofengrube 111212 und auf dem Gelände der aufgelassenen Häuser 2 und 11 gebaut worden, und zwar viele Jahrzehnte, nachdem die Häuser bewohnt waren (vgl. Lüning/Euler, Grubenöfen). In Haus 2 schuf man sich einen Durchlass nach Westen und be-nutzte die Reste der Dreipfostenriegel der Querreihen 11 und 19 als Richtpunkte für die neu erbauten Seitenwände einer 2 m breiten und 5 m langen „Kammer“, in der bei-spielsweise zwei bis vier Rinder ruhig gestellt werden konnten13. Es handelt sich also um eine Wiederverwen-dung einer Hausruine. Am Westrand der „Kammer“ liegt im Bereich des Wandgrabens der ehemaligen westlichen Bohlenwand des Hauses eine etwa 1 m breite Zone mit nur mittelstarken Phosphatwerten (Farbtafel 2). Auch hier kann man sich auf den Lehmresten der Wand eine neue Tür oder ein Tor vorstellen. Denn westlich dieses möglichen Durchlasses schloß sich eine große, trapez-förmige Einhegung an, die zwischen den Häusern 2 und 10 liegt und die vielleicht das Ziel des kammerartigen Durchlasses in Haus 2 gewesen war; zweifellos nicht die originale hölzerne Einhegung, sondern ein späterer, nicht mehr erhaltener Nachfolgebau.
2.2 Die Pfosteneinhegungen zwischen den Häusern 2 und 10
Eine äußere, große, nicht ganz rechteckige Einhegung (II) ist 11,20 m breit und 14 bzw. 12 m lang (Farbtafel 5). Sie besteht aus in gleichmäßigen Abständen gesetzten Pfosten, die hinsichtlich Abstand (etwa 1 m) und Dimen-sion den Wandpfosten der Häuser gleichen, also analog als „Pfostenflechtwerkwände“14 ergänzt werden können. In der Nord-, Ost- und Südseite gibt es einige Doppel-pfosten, die unterstreichen, dass diese drei Pfostenwände tatsächlich zusammen gehören. Doppelpfosten finden sich auch bei mehreren Vergleichsobjekten und bezeugen eine massive Bauweise, die über den Zweck von Garten-zäunen15 weit hinausgeht, weshalb man oft auch an Vieh-pferche dachte (Buttler/Haberey 1936, 90; Brandt 1960, 420; Riedhammer 2003, 484f.). Die Westwand läßt sich nur durch zwei Pfosten definieren (Stelle 1488, 1489).
Von Süden führt ein 2 m langer und 1 m breiter, von Pfosten flankierter Eingang hinein, wie es ihn auch sonst gelegentlich gibt (Riedhammer 2003 Abb. 9.10). Er hat ein Gegenstück an der Nordwand besessen (St. 1597–
12 Zur Nutzungszeit der Öfen war Grube 1112 nur noch 70 cm tief, vgl. Lüning/ Euler, Grubenöfen.13 Als Rest einer in Querreihe 19 möglichen Querwand kommt ein Lehmwall aus dem herabgefallenen Verputz dieser Wand in Frage, vgl. Lüning/Euler, Grubenöfen.14 Zum Begriff vgl. von Brandt 1988, 259. 15 Bandkeramische Garten- und Feldzäune bei Lüning 2000, 157.159 Abb. 55.
1511; 1510). Dicht östlich des südlichen Eingangs folgt eine weitere Pfostenreihe, teilweise mit Doppelpfosten (Stelle 1095/1085–1123), die sich nach Norden bis an eine Querflucht verfolgen lässt (Stelle 1520–1139/1140). Das westliche Gegenstück dieser Eingangsflankierung dürfte in der Pfostenreihe 1106–1107–1121 zu suchen sein und einen 3 m breiten Eingang begrenzt haben. Die genannte Querflucht ist Teil eines inneren Pfostenrechtecks, dessen Nordseite knapp 8 m weiter lag (Stelle 1507–1434). Die Ostwand läßt sich über die Pfosten 1434–1433, 1146 und 1139/1140 rekonstruieren; Anhaltspunkte für die West-wand fehlen. Es gab hier also eine kleinere Einfriedung (I) mit 7–8 m Wandlänge.
Ohne Keramikanalyse kann die Chronologie der Befunde von Altdorf nur unvollkommen eingeschätzt werden. Auf Einhegung I nimmt die Längsgrube 1023 von Haus 2 Rücksicht, ein Hinweis auf Gleichzeitigkeit, zumal ihr nördlicher Annex 1141, in dem die Eckpfo-sten 1139/1140 standen, ein undeutlicher Befund war. Die nördliche Fortsetzung der Längsgrube, die Reihe St. 1145, 1147, 1211, 1213, 1216, verspringt etwas nach Osten und existierte offensichtlich in der Zeit des jüngeren Anbaus. Die westlich davor gelegene Einhe-gung I dürfte daher mit Haus 2 in seiner Nutzungsphase gleichzeitig bestanden haben. Im Westen sollte Pfosten 1520 der Eckpfosten der Westwand gewesen sein, weil nur so eine Quadratfigur entsteht. Die Fortsetzung der Westwand von 1520 nach Norden wäre dann den west-lichen Längsgruben von Haus 10 zum Opfer gefallen, also älter als dieses gewesen; die kleine Einhegung I war ausschließlich auf Haus 2 bezogen16.
Die jüngere Einfriedung (II) überlagert den westlichen Längsgrubenzug von Haus 2 (St. 1023-1216), die Pfosten der Ostwand von Einhegung II waren in den Füllungen der Längsgruben sichtbar. Im Westen integriert die Wand der Einhegung II mit zwei Pfosten (St. 1488. 1489) auch die östlichen Längsgruben von Haus 10 (St. 1377-1482); das Haus muss älter sein als diese. Die Einhegung II stand also in dieser Phase frei und ohne Bindung an ein be-nachbartes Haus im Gelände17. Da ihre östlichen Pfosten die (Teil-)Verfüllungen der dortigen Längsgruben über-schnitten, deren Versturz sicherlich Jahre bis Jahrzehnte gedauert hat, bezeugt diese Beobachtung die Langlebig-keit und Ortskonstanz derartiger Einrichtungen. Die Pfo-sten der Einhegung I waren sicherlich längst vergangen, offensichtlich aber nicht die Erinnerung daran oder eine eingeschränkte Nutzung, sonst hätte es mit Einhegung II keinen zweiten architektonischen Wiederaufbau ge-geben. Zur Abgrenzung des südlichen Vorplatzes nach Westen diente in dieser Zeit eine abgewinkelte Pfosten-reihe, die sich auffällig an der ehemaligen Längsgrube 1374 orientiert, die wohl noch als oberflächliche Delle erhalten war.
16 Der Normalfall, vgl. Lüning 2009, 151ff.17 Bisher sind alle Rechteckanlagen an Häuser angeschlossen gewesen. Eine hausferne Ausnahme stellt aber vielleicht ein Befund aus Bochum-Hiltrop dar, vgl. Lüning 2009, 176 Anm. 69.
Phosphatanalysen in der bandkeramischen Siedlung Altdorf -Aich, Ldkr. Landshut/Isar, Niederbayern
249
Eine letzte Nutzungsphase des Geländes stellt die große Grube 1474/1513 dar, die die Nordwestecke der jüngeren Rechteckanlage stört. Die zur ehemaligen Ein-friedung II gehörenden Pfosten 1474a und 1513a kamen erst unterhalb der Grube 1474/1513 zutage.
Die oben beschriebene, dreieckige Phosphatkonzen-tration (Farbtafel 1) kann sich nur auf die Spätzeit mit Einhegung II beziehen: Aus dem dreieckigen Viehpferch und dem kammerartigen Raum innerhalb von Haus 218 gelangte das Vieh in die jüngere Einhegung (II). Die innerhalb derselben gemessenen Phosphatwerte bilden keine geschlossene Fläche hoher Dichte, sondern einen Flickenteppich unterschiedlicher Intensitätsgrade (Farb-tafel 6). Direkt im Anschluß an Haus 2 zeichnet sich auf den ersten Blick ein Rechteck hoher Werte von etwa 6 m Breite ab, das auch die runde Grube 1122 umfasst und das nach Süden in eine außerhalb der Einhegung gelegene Konzentration übergeht. Beim östlichen Teil des Rechtecks ist unklar, was sich den Längsgruben von Haus 2 verdankt und was zum „Betrieb“ der Einhegung gehört. Die innerhalb der Einfriedung zentrale Grube 1122 ist im Norden, Westen und Süden von phosphat-armen Quadraten umringt und scheint daher eine eigene Phosphatquelle darzustellen. Damit zerfällt das genannte Phosphatrechteck in heterogene Herkünfte. Im Westen deckt sich die Längsgrubenkette 1482, 1481, 1330 und 1377 mit eigenen Phosphatkonzentrationen, ebenso die große und späte Nordwestgrube 1474/1513. Die Einhe-gungen können daher keine Viehpferche gewesen sein, bei denen man eine flächendeckende Phosphatdurchträn-kung erwarten würde.
Wegen ihrer zentralen Position in beiden Einfriedungen (I und II) dürfte Grube 1122 originär zum „Betrieb“ der Pfostenrechtecke gehören und mit ihrem Phosphatreich-tum die einzige sicher Zeugin der „Benutzungszeit“ dar-stellen19. Das aus dem Dreieckspferch dorthin getriebene Vieh kann nicht zahlreich gewesen und kann sich nicht lange in der Rechteckeinhegung aufgehalten haben, so dass es nahe liegt, hier einen „Viehverwertungsplatz“ anzunehmen, profan gesehen einen Schlachtplatz und kultisch gedeutet einen Opferplatz. Angesichts der Sel-tenheit dieser Einfriedungen und ihrer massiv-monu-mentalen Ausgestaltung ist jedoch eher an eine kultisch-soziale Einrichtung zu denken, beispielsweise an einen Versammlungsplatz mit rituellem Tieropfer.
Das zum Opfer bestimmte Vieh mußte längere Zeit, vielleicht Tage, Wochen oder Monate, in einem Pferch verbringen. Für die jüngere Einhegung (II) lag dieser Aufstell- und Warteplatz dicht östlich von Haus 2, im beschriebenen Dreieckspferch. Auf die Opferung in der älteren, mit Haus 2 gleichzeitigen Einhegung (I) wartete
18 Derartige separierende Unterteilungen sind auch andernorts bezeugt, vgl. Riedhammer 2003, 486.19 Nach den Grabungsnotizen hat es in der Grube keine auffälligen Funde gegeben, vgl. die Grubenbeschreibung bei Euler, Hausgrundrisse. Leider ist das Fundmaterial noch nicht bearbeitet.
das Vieh wahrscheinlich südlich davon im Bereich der großen, phosphatreichen Fläche westlich der Längsgrube 1023/1029 von Haus 2 (Farbtafel 6).
Es gibt nur wenige rechteckige Vergleichsbefunde aus der Bandkeramik, und jedenfalls war dieser Bautypus selten. Unter den acht wichtigsten Anlagen liegen sieben in der Altdorfer Größenordnung von etwa 100-200 m² Flächeninhalt (Einhegung II)20. Aus einer großen, mittel-neolithischen Doppeleinfriedung von Bochum-Hiltrop, die an einen Großbau der Rössener Kultur anschließt, hat Karl Brandt, weit vorausblickend, schon vor vier Jahr-zehnten zahlreiche Phosphatproben zur Untersuchung gegeben, sowohl aus dem Innern der beiden Einhegun-gen als auch aus dem Haus und aus der Umgebung der Baulichkeiten. Das Ergebnis stimmt mit dem Altdorfer Befund völlig überein: „Diese Untersuchung zeigte, dass der Phosphatgehalt gegenüber der Umgebung (außerhalb der Zäune, Langbau [das Rössener Haus, Verf.]) nicht zunimmt, wogegen bei Viehpferchen der Phosphatge-halt durch die Fäkalien der Tiere sprunghaft ansteigen müsste“ (Brandt 1960, 420).
2.3 Die Grubenöfen im Nordosten von Haus 2 in Grube 1112
Im Nordosten von Haus 2 lag die Oberkante des Pa-läobodens (Planum 1) bei 404,80 m ü. NN (Farbtafel 11). Mit je einem 15 cm starken Abhub erreichte man Planum 2 (404,65 m) und Planum 3 (404,50 m). Zwi-schen Planum 2 und 3 entnahm man die Proben für das oberste Phosphatplanum, wie üblich im 50 cm-Raster („Proben-Niveau 3+/2“) (Farbtafel 1). Weil die Ausgrä-ber hier eine „größere Tschernosemmulde“ erkannten (Stelle 1112) und der nordöstliche Hausabschluß unklar blieb, entschieden sie sich für zwei weitere Zwischen-plana mit Phosphatbeprobung (Meixner 1998b, 27). Beim Tiefergehen auf Planum 4 (404,38 m) kamen im dunklen Boden drei Rotlehmkonzentrationen zutage, und bei Stelle 1515 trat bereits der typische rote Außenring bandkeramischer Grubenöfen hervor; auch der nordwest-liche Rand der Grube 1112 zeichnete sich in Planum 4 teilweise schon ab. Zwischen den Plana 3 und 4 entstand das zweite Phosphatnetz mit der Bezeichnung „Proben-Niveau 4+/3-4“; darunter zwischen den Plana 4 und 5 das dritte mit der Bezeichnung „Proben-Niveau 4-/4-5“. In Planum 5 (404,20 m) wurde die rot verbrannte Lehm-tenne auf den drei Kieselrollierungen sichtbar, die die
20 Außer den bei Lüning 2009, 151ff. genannten Anlagen vgl. noch Vaux-et-Borset in Belgien (Riedhammer 2003, 484 Abb. 12). Rechteckig sind auch die beiden Teile einer großen Doppeleinhegung der Rössener Kultur in Bochum-Hiltrop (Brandt 1960, 418ff. Abb. 1; ders. 1967, 54ff. Taf. 13), dazu kommen aus Alt- und Mittelneolithikum einige polygonale und bogenförmige Einfriedungen (Riedhammer 2003).
Jens Lüning und Ludwig Reisch
250
Basis der drei Grubenöfen 1514, 1515 und 151621 dar-stellten (Farbtafel 10). Auch der Umriß der großen Grube 1112 wurde deutlicher22.
Wie dargelegt, sind die drei Grubenöfen am westlichen Rande der Grube 1112 von Bauschächten aus angelegt worden, die in der (Teil-)Verfüllung dieser Grube ausge-hoben wurden. Diese Schächte dienten anschließend für die nach Osten geöffneten Ofenkammern (Schüröffnun-gen) als Arbeitsgruben, die für den Betrieb der Gruben-öfen unerlässlich sind. An ihrer Basis lagen die Tennen (Brennflächen) der Öfen, davor die Arbeitsfläche, beides in Planum 5 (Lüning/Euler, Grubenöfen Abb. 6)23.
Die Phosphatverteilung im Bereich der drei Öfen zeigt im Planum, dass sich die Öfen, wie aus archäologischen Gründen zu erwarten, im obersten „Proben-Niveau 3+/2“ noch nicht abzeichnen; dieses Niveau liegt oberhalb der zusammengestürzten Ofenkuppeln (Farbtafel 7). Im 15 cm tieferen „Proben-Niveau 4+/3-4“, im Bereich der verstürzten Ofenkuppeln, tritt der nördlichste Ofen 1514 durch hohe Phosphatwerte hervor, und auch die beiden anderen haben einzelne Spitzenwerte, das gilt ebenso für die Fläche östlich vor den drei Öfen (Farbtafel 8); in dieser Tiefe waren, wie erwähnt, die Öfen auch ar-chäologisch erstmals sichtbar gewesen. Das unterste vorhandene „Proben-Niveau 4-/4-5“ lag im Bereich der Ofenfüllung und führt vor allem die Arbeitszone unmit-telbar östlich vor den drei Ofenöffnungen mit starken Phosphatanreicherungen vor Augen; innerhalb der Öfen sind hier leider nur randlich Proben entnommen worden (Farbtafel 9)24. Die Arbeitszone zeichnet sich rückblik-kend sicherlich auch schon im etwa 15 cm höher gele-genen „Proben-Niveau 4+/3-4“ ab (Farbtafel 8), so dass wohl mit einer gewissen „Kulturschichtbildung“ vor den Öfen zu rechnen ist. Aus dieser ist vermutlich Material in die Öfen hineingeflossen ist, als sie aufgegeben wurden; das wäre jedenfalls die einfachste Erklärung für die in Farbtafel 8 dargestellte, oberhalb der Brennfläche und Kieselrollierung gelegenen Phosphatanreicherung25.
Die Phosphatprofile durch den Ofenbereich wurden fiktiv aus den Messwerten der Plana gebildet, archäo-logische Profilschnitte gab es dort nicht (Farbtafel 10). Die Nord-Südprofile bestätigen, dass die Öfen phos-phatreicher sind als ihre Umgebung (Farbtafel 11-13),
21 Die Befundunterkante des Ofens 1516 liegt bei 404,07 m ü. NN. 22 Vgl. die genauere Befundbeschreibung bei Lüning/Euler, Grubenöfen. 23 Zur Funktion derartiger Arbeitsgruben siehe Lüning 2004, 36ff. Abb. 18.24 Die Öfen hätten auch noch tiefer, d.h. auf, zwischen und unter den Kieselrollierungen, beprobt werden müssen, denn erst hier, in der „eigentlichen Aktionsfläche“, trat beim Ofen von Neckenmarkt, Burgenland (Österreich) „schlagartig ein (Phosphat-)Maximum“ auf. Vgl. Lüning 2004, 58ff. Abb. 25.26.25 Vgl. die Aufhäufung eines Aschehaufens hinter dem Arbeitsplatz beim Ofen in Langweiler 16, Kr. Düren (Rheinland) bei Lüning 2004 Abb.18.
während die West-Ostprofile die Anreicherungszone vor den Ofenöffnungen deutlich hervortreten lassen (Farbta-fel 14-16). Dieser letztere Befund ist neuartig und kann am ehesten durch das Herausräumen von Asche und Glut erklärt werden, das am Ende jedes Backvorganges statt-fand. Diese Erklärung beruht auf der Annahme, dass die Phosphatanreicherung innerhalb und außerhalb der Öfen dieselbe Ursache gehabt hat, doch bedarf dieses ganze ofengebundene Phosphat noch einer genaueren boden-chemischen und funktionalen Begründung.
2.4 Haus 3 (Großbau Typ 1-3)
Das nur 9,40 m lange Haus ist konstruktiv dennoch ein dreiteiliger Großbau vom Typus 1-3 (ohne nordwestli-chen Wandgraben) (Farbtafel 1; 17). Es hat einen kurzen, eingliedrigen Nordwestteil bis zum ersten Innenjoch (QR 19), dann einen schmalen Korridor (bis QR 21), dann eine Krüppel-Y-Pfostenstellung im Mittelraum (bis QR 29) und zuletzt einen ebenfalls nur eingliedrigen Süd-ostraum (QR 29 bis QR 40). Ohne Rücksicht auf diese Raumgliederung ist der gesamte Grundriß phosphatarm; höhere Werte finden sich erst außerhalb davon im Bereich der beiderseitigen Längsgruben. Sowohl der südliche wie der nördliche Vorplatz sind arm an Phosphat.
2.5 Haus 13 (Kleinbau Typ 3)
Das 8 m lange Haus ist ein Kleinbau mit einer Quer-reihe (QR 23) im Mittelraum und je einem Zwischen-jochbereich im Norden und im Süden (Farbtafel 1; 18). Das ganze Gebäude erweist sich als extrem phosphat-arm; Konzentrationen beginnen seitlich erst im Bereich seiner beiderseitigen Längsgruben. Dem südlichen Vor-platz fehlt es ebenfalls an Phosphat, der nördliche kann als schmale Zwischenzone zu Haus 14 nicht beurteilt werden.
2.6 Haus 14 (Großbau Typ 1b oder Typ 1-3)
Von Haus 14 ist nur der Mittelteil mit einer Y-Pfosten-stellung und der Südostraum ergraben worden (Farbta-fel 1; 18). Der Grundriß hebt sich im Umfeld als eine phosphatarme Zone mit einigen unzusammenhängenden, höheren Werten heraus. Die westliche Längsgrube wird in Teilflächen durch höhere Werte geprägt, die östliche wirkt massiv phosphatreich, doch verhindert die nahe Grabungsgrenze im Osten ihre sichere Beurteilung.
Phosphatanalysen in der bandkeramischen Siedlung Altdorf -Aich, Ldkr. Landshut/Isar, Niederbayern
251
2.7 Haus 16 und 17
Die etwa 18 m langen Grundrisse 16 (Bautyp 1b oder 1-3) und 17 (Bautyp 1b) überlagern sich fast vollstän-dig, so dass man nur die Feststellung treffen kann, dass beide als ein phosphatarmes „Fenster“ zwischen ihren phosphatreichen westlichen und östlichen Längsgruben aufscheinen (Farbtafel 1; 19).
2.8 Südliche und nördliche Vorplätze der Häuser und Längsgrubenbereiche
Wo man den Häusern nördliche oder Vorplätze zu-weisen kann (Haus 2, 3, 13), sind diese arm an Phos-phat (Farbtafel 1). Hier fanden also Tätigkeiten statt, bei denen fast kein Phosphat anfiel. Die Längsgruben (Lgr.) können unheitlich mit phosphathaltigem Material verfüllt worden sein, so bei Haus 2 die dort einzig be-urteilbare westliche Lgr. 1029, bei Haus 3 die östliche Lgr. 1569/1244/1245, bei Haus 13 die beiderseitigen Lgr. 1439 und 1552/1553 und bei Haus 14 der westliche Längsgrubenzug 1663/1636/1575 (Farbtafel 1; 3; 18 und im Beitrag Euler, Hausgrundrisse, Abb. 16; 17; 27; 18). Sie können aber auch eine geschlossenere Phosphatanrei-cherung aufweisen, so die westliche Lgr. 1504 von Haus 3, der östliche Längsgrubenzug 1652/1627/1601 von Haus 14, die westlichen Lgr. 1220 und 1189 der Häuser 16 und 17 und ihr östliches Gegenüber 1124 (Farbtafel 1; 17-19 und im Beitrag Euler, Hausgrundrisse, Abb 16; 17; 27; 28). Bedenkt man, dass auch die „geschlosseneren“ Fälle einige niedrige Messwerte enthalten, kann man für die Längsgruben insgesamt eine phosphatchemisch un-einheitliche Verfüllung konstatieren.
2.9 Phosphatverteilung und sonstige Gruben
Es gibt mehrere Gruben, die nicht zu den Längsgruben gehören, und die mit hohen und mehr oder weniger ge-schlossen verteilten Phosphatkonzentrationen versehen sind. Das gilt zwischen den Häusern 10 und 2 für die inmitten des Pfostenrechtecks gelegene, runde Grube 1122 und den großen Grubenkomplex 1513/1474 nord-westlich davon (Farbtafel 1; 6) (Euler, Hausgrundrisse, Beilage 1; 2). Weiter östlich liegt zwischen den Häusern 3 und 16/17 die große rundliche Grube 1219, eine Ost- oder Westgrube, die hohe Phosphatmessungen erbrachte. Noch höher sind sie bei dem südöstlich davon befindli-chen Grubenkomplex 1190 und ebenso bei den Gruben 1260/1261 östlich der Häuser 16/17.
Andererseits kommen auch phosphatarme, sonstige Gruben vor. Dazu dürfte Grube 1555 nordöstlich von Haus 2 zu zählen sein, da die dort vorhandene Phos-
phatkonzentration offenbar weder mit ihr noch mit der benachbarten Längsgrube 1439 von Haus 13 etwas zu tun hat; die Stelle 1555 scheint also zumindest in ihrem Nordende phosphatarm gewesen zu sein. Auch der süd-lich davon gelegene, große Grubenkomplex 1112 hat eine phosphatschwache Nordhälfte.
2.10 Zusammenfassung zur Phosphatverteilung in Altdorf
Die Innenflächen aller Häuser sind arm an Phosphat und heben sich gegenüber dem Umfeld als helle Zonen heraus. Ein Unterschied zwischen den verschiedenen Haustypen besteht nicht, auch nicht zwischen ihren verschiedenen Innenräumen. Nur im Mittelraum von Haus 2 gibt es möglicherweise eine Konzentration, die auf „Küchenaktivitäten“ hinweist. Die Längsgru-ben enthalten regelhaft höhere Phosphatwerte als die Häuser, meist in Mischlage von stärker oder schwächer angereicherten Zonen. Bei den sonstigen Gruben gibt es mehr phosphatreiche als phosphatarme; ausgesprochen phosphatschwache, größere Gruben mögen vorhanden gewesen sein, sind aber in Altdorf wohl durch spätere phosphaterzeugende Aktivitäten überprägt worden.
In Altdorf wurde eine der seltenen bandkeramischen Pfosteneinhegungen entdeckt und beprobt; die zweipha-sige Anlage befindet sich zwischen den Häusern 2 und 10. Sie wies aus ihrer Benutzungszeit nur niedrige Phos-phatwerte auf, was die häufige Vermutung widerlegt, es habe sich bei diesem Typus um „Viehpferche“ gehandelt. Allerdings lag östlich von Haus 2 ein jüngerer und süd-lich vor dem Pfostenrechteck ein älterer, zur jeweiligen Einhegung gehöriger und wohl temporärer Viehstand-platz mit sehr hohen und die Fläche geschlossen bedek-kenden Phosphatwerten, möglicherweise ein Warteplatz für Schlacht- oder Opfertiere. Auch diese beiden Plätze müssen eingehegt gewesen sein, doch haben sich wohl nur vom jüngeren Pfostenspuren erhalten.
Es gelingt in Altdorf außerdem, eine „Stratigraphie“ zwischen Baulichkeiten und Phosphatverteilungen zu erschließen. Denn der dreieckige östliche „Viehwar-teplatz“ durchquert den Nordwestraum von Haus 2 in einer Art, dass dessen Bohlenwand nicht mehr gestanden haben kann, als die jüngere Pfosteneinhegung (II) und der Warteplatz „in Betrieb“ waren.
Auch drei Grubenöfen im nördlichen Bereich von Haus 2 müssen jünger als dieses sein aber älter als der drei-eckige Warteplatz, weil dessen Phosphatkonzentration ohne Störung über ihre Arbeitsgrube hinwegläuft. Die Öfen weisen im Innern eine hohe Phosphatkonzentration auf, ebenso die unmittelbar östlich vor ihren Öffnungen gelegenen Arbeitszonen. Es lässt sich hier also eine zwei-phasige Nachbenutzung des ehemaligen Hausstandortes erkennen.
Jens Lüning und Ludwig Reisch
252
Literaturverzeichnis
Beck 1988: K.-G. Beck, Die menschlichen Skelettfunde aus Schwanfeld bei Würzburg (Mainz 1988). Siehe Lüning, Gründergrab, Anhang 2.
Bleck 1965: R.-D. Bleck, Zur Durchführung der Phosphat-methode. Ausgrabungen und Funde 10, 1965, 213-218.
Bleck 1976 : R.-D. Bleck, Anwendungsmöglichkeiten phosphatanalytischer Untersuchungen im Bereich der Ur- und Frühgeschichte. Ausgrabungen und Funde 21, 1976, 259-268.
Brandt 1960: Titel: Einzäunungen an bandkeramischen und altrössener Bauten. Germania 38, 1960, 418-423.
Brandt 1967: K. Brandt, Neolithische Siedlungsplätze im Stadtgebiet von Bochum. Quellenschr. Westdt. Vor- u. Frühgesch. 8 (Bonn 1967).
Buttler/Haberey 1936: Die bandkeramische Ansiedlung bei Köln-Lindenthal. Röm.-Germ. Forsch. 11 (Berlin, Leipzig 1936).
Engelhardt u.a. 1998: B. Engelhardt/G. Meixner/M. Schaich, Linearbandkeramische Siedlung und Paläoböden von Aich, Gemeinde Altdorf, Landkreis Landshut, Niederbayern. Arch. Jahr. Bayern 1997 (Stuttgart 1998) 32-35.
Euler, Hausgrundrisse: D. Euler, Die Hausgrundrisse in der bandkeramischen Siedlung Altdorf-Aich, Ldkr. Landshut/Isar, Niederbayern (in diesem Band).
Flindt/Geschwinde 1997: St. Flindt/M. Geschwinde/B. Arndt, Ein Haus aus der Steinzeit. Archäologische Entdeckungen auf den Spuren früher Ackerbauern in Südniedersachsen. Wegweiser Vor- u. Frühgesch. Niedersachsen 19 (Oldenburg 1997).
Kaltofen 2003: A. Kaltofen, Die linienbandkeramische Siedlung von Schwiegershausen, Lkr. Osterode am Harz. Neue Ausgr. u. Forsch. Niedersachsen 24, 2003, 9-232.
Klooß, Pflanzenfunde: St. Klooß, Die verkohlten Pflanzenfunde aus der linienbandkeramischen Siedlung Altdorf-Aich, Ldkr. Landshut/Isar, Niederbayern (in diesem Band).
Lüning 1997: J. Lüning, Wohin mit der Bandkeramik? Pro-grammatische Bemerkungen zu einem allgemeinen Problemam Beispiel Hessens. In: C. Becker u.a. (Hrsg.), Chronos.Beiträge zur Prähistorischen Archäologie zwischen Nord-und Südosteuropa. Festschr. Bernhard Hänsel. Internat.Arch., Studia Honoraria 1 (Espelkamp 1997) 23-57.
Lüning 2000: J. Lüning Steinzeitliche Bauern in Deutschland. Die Landwirtschaft im Neolithikum. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 58 (Bonn 2000).
Lüning 2004: J. Lüning, Zwei bandkeramische Grubenöfen von der Aldenhovener Platte im Rheinland. In: Parerga Praehistorica. Jubiläumsschrift zur Prähistorischen Archäologie. 15 Jahre UPA. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 100 (Bonn 2004) 11-68.
Lüning 2009: J. Lüning, Bandkeramische Kultanlagen. In. A. Zeeb-Lanz (Hrsg.), Krisen-Kulturwandel-Kontinuitäten.Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Beitr. Internat.Tagung Herxheim bei Landau (Pfalz) 2007. Internat. Arch. 10 (Rhaden/Westf. 2009) 129-190.
Lüning 2011: J. Lüning, Gründergrab und Opfergrab: Zwei Be-stattungen in der ältestbandkeramischen Siedlung Schwan-feld, Ldkr. Schweinfurt, Unterfranken. In: J. Lüning (Hrsg.), Schwanfeldstudien zur Ältesten Bandkeramik. Universitäts- forsch. Prähist. Arch. (Bonn 2011) 7-100.
Lüning/Euler, Grubenöfen: J. Lüning/D. Euler, Die Grubenöfen in der bandkeramischen Siedlung Altdorf-Aich, Ldkr. Lands-Landshut/Isar, Niederbayern (in diesem Band).
Lüning/Reisch 2004: J. Lüning/L. Reisch, Phosphatuntersuchun-gen am Ofen von Neckenmarkt im Burgenland, Öster- reich. In: J. Lüning, Zwei bandkeramische Grubenöfen vonder Aldenhovener Platte im Rheinland. In: Parerga Prae-historica. Jubiläumsschrift zur Prähistorischen Archäologie.15 Jahre UPA. Universitätsforsch. z. Prähist. Arch. 100(Bonn 2004) 58-62.
Meixner 1998a: G. Meixner, Paläoböden und Siedlungsbefunde der Linearbandkeramik von Altdorf, Lkr. Landshut. In: Vorträge 16. Niederbayer. Archäologentag (Rahden/Westf. 1998) 13-40.
Meixner 1998b:Altdorf-Aich, Baugebiet „Kleinfeld IV“, Grabungsbericht für die Kampagnen 1996 und 1997 (2.3.1998). Akten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Außenstelle Landshut.
Pechtl 2008: J. Pechtl, Beiträge zu bandkeramischen Grubenöfen nicht nur aus Stephansposching, Lkr. Deggendorf. In: K. Schmotz (Hrsg.), Vorträge des 26. Niederbayerischen Archäologentages (Rahden/Westfalen 2008) 35-92.
Petrasch (1986), J. Petrasch, Alt- und mittelneolithische Grubenöfen aus Niederbayern. Ein Beitrag zur Rekonstruktion und Interpretation neolithischer Öfen in Mitteleuropa. Arch. Korrbl. 16, 1986, 135-139.
Riedhammer 2003: K. Riedhammer, Ein neuer mittelneolithischer Hausgrundriß mit Zaun aus Niederbayern. In: Archäologische Perspektiven. Analysen und Interpretationen im Wandel. Festschrift für Jens Lüning zum 65. Geburtstag. Internat. Arch. Studia Honoraria 20 (Rahden/Westf. 2003) 471-488.
Stäuble/Lüning 1999: H. Stäuble/J.Lüning, Phosphatanalysen
in bandkeramischen Häusern. Arch. Korrbl. 29, 1999, 169-187.
von Brandt 1988: D. von Brandt, Häuser. In: D. v. Brandt/J. Lüning/P. Stehli/A. Zimmermann, Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 8, Gemeinde Aldenhoven, Kr. Düren. Beitr. Neolith. Besiedlung Aldenhovener Platte III.
Gegenüberliegende Seite:Farbtafel 2: Altdorf-Aich. Haus 2 mit den Öfen 1514, 1515 und 1516 im NO (gerastert). M. 1: 100.
Farbtafel 3: Altdorf-Aich. Phosphatkartierung in Haus 2 mit Raumgliederung und Nummern der Querreihen. M. 1: 200.
Farbtafel 5: Altdorf-Aich. Die Häuser 2 und 10 und die dazwischen liegende Rechteckpalisade in zwei Bauphasen: Innen Phase I, außen Phase II. M. 1: 200.
Farbtafel 6: Altdorf-Aich. Phosphatkartierung in Haus 2 und im Zwischenbereich zu Haus 10 mit Rechteckpalisade: Innen Bauphase I, außen Bauphase II. M. 1: 400.
Farbtafel 7: Altdorf-Aich. Haus 2. Phosphatkartierung im Ofenbereich. Oberes Proben-Niveau (3+/2) zwischen Planum 2 und 3. M. 1: 100.
Farb
tafe
l 8:
Altd
orf-A
ich.
Hau
s 2. P
hosp
hatk
artie
rung
im O
fenb
erei
ch.
Mitt
lere
s Pro
ben-
Niv
eau
(4+
/3-4
) zw
isch
en P
lanu
m 3
und
4.
M. 1
: 100
.Fa
rbta
fel
9: A
ltdor
f-Aic
h. H
aus 2
. Pho
spha
tkar
tieru
ng im
Ofe
nber
eich
. U
nter
es P
robe
n-N
ivea
u (4
-/4-5
) zw
isch
en P
lanu
m 4
und
5.
M. 1
: 100
.
Farbtafel 10: Altdorf-Aich. Haus 2. Lage der Phosphatprofile 1-6 im Ofenbereich. M. 1: 100.
Farbtafel 11: Altdorf-Aich. Haus 2. Profil 1 (siehe Farbtafel 10). M. 1: 100.
Farbtafel 12: Altdorf-Aich. Haus 2. Profil 2 (siehe Farbtafel 10). M. 1: 100.
Farbtafel 13: Altdorf-Aich. Haus 2. Profil 3 (siehe Farbtafel 10). M. 1: 100.
Farbtafel 14: Altdorf-Aich. Haus 2. Profil 4 (siehe Farbtafel 10). M. 1: 100.
Farbtafel 15: Altdorf-Aich. Haus 2. Profil 5 (siehe Farbtafel 10). M. 1: 100.
Farbtafel 16: Altdorf-Aich. Haus 2. Profil 6 (siehe Farbtafel 10). M. 1: 100.
Farb
tafe
l 17
: Altd
orf-A
ich.
Pho
spha
tkar
tieru
ng in
Hau
s 3. M
. 1:
200
.Fa
rbta
fel
18: A
ltdor
f-Aic
h. P
hosp
hatk
artie
rung
in H
aus 1
3 un
d 14
. M. 1
: 200
.