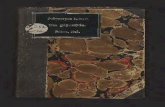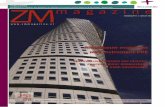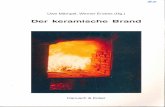Handschriftenfunde zu den Werken Liudprands von Cremona in bayerischen und österreichischen...
Transcript of Handschriftenfunde zu den Werken Liudprands von Cremona in bayerischen und österreichischen...
HANDSCHRIFTENFUNDE ZU DEN WERKENLIUDPRANDS VON CRE,MONA IN BAYE,RISCHEN UND
öStEnnEICHISCHEN BIBLIoTHEKEN
Von MarrHrAS M. Tsculnn
Von dem Paveser Diakon und späteren Bischof Liudprand von Cremona(920-972), der einer der wichtigsten Gewährsmänner für die Entstehung und
Tradierung des abendländischen Konstantinopelbildes im frühen Mittelalterist, kennen wir neben dem wichtigsten Werk, der Antapodosis, die sogenannte
Historia Ottonis, die sogenannte Relatio de legatione Constantinopolitana und
eine erst 1984 von Bernhard Bischoff veröffentlichte Homilie zum Osterfestl.
Nachdem schon Georg Heinrich Perrz (1839), Ernst Dümmler (1,877) und Jo-seph Becker (1915) eine Gesamtausgabe der damals bekannten Werke Liud-prands bei den Monumenta Germaniae Historica vorgelegt hatten, ist nun
nach diversen Arbeiten zu Autor und \X/erk und nach der Veröffentlichungeiner Studie zur autornahen Freisinger Handschrift der Antapodosis aus der
Feder des italienischen Mediävisten Paolo Chiesa2 eine Neuausgabe sämtlicher
Werke erschienen3.
Die hier vorgelegte Beschreibung der nach ihrem Alter angeordneten Hand-schriften (S. XVIII-XXXIX) und der im Mittelpunkt stehenden Antapodosis-
Überlieferung (S. XLII-LXXXII) gibt Anlaß, erneut über die Verbreitung die-
ses wichtigen ottonischen Geschichtswerkes nachzudenken. Zunächst bleibtfestzuhalten, daß die Überlieferung der Werke Liudprands vornehmlich auf
die Zeitspanne zwischen dem 10. und dem 12. bzw. 13. Jahrhundert be-
schränkt blieb und allein mit der Antapodosis in bisher 19 bekannten Textzeu-
gen, von denen 18 erhalten sind, ganz Mitteleuropa erfaßte. Es sind zwei
Überlieferungsstränge zt erkennen, die man dem lothringisch-bayerisch-
1 Bernhard Btscuorr, Eine Osterpredigt Liudprands von Cremona (um 960), in:DERS., Anecdota novissima. Texte des vierten bis sechzehnten Jahrhunderts (Quellenund Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters 7), 1984, 20-34 undTafel I.2 Liutprando di Cremona e il codice di Frisinga clm 6388 (Autographa Medii Aevi 1),
1994.I Liudprandi Cremonensis opera omnia (Corpus Christianorum Continuatio Media-evalis L56),1998.
60 Mattbias M. Tiscbler
österreichischen (Antapodosis) und dem lothringisch-belgisch-französischenRaum (Antapodosis; Antapodosis + Historia Ottonis bzw. umgekehrt) zuord-nen kann. Die von Franz Köhler im 19. Jahrhundert aufgefundenen Exzerpteder Antapodosis in der Handschrift Metz, Bibliothöque municipale, Ms. 145sind t944 durch Kriegseinwirkungen verlorengegangen. Hinzu tritt freilich einvon Paolo Chiesa übersehener Münchner Textzeuge, der am Ende dieses Auf-satzes vorgestellt werden soll. Mit sieben noch erhaltenen Textträgern scheintdie stets mit der Antapodosis verbundene Historia Ottonis im zuletzt genann-ten Überlieferungsraum kein seltener Text gewesen zu sein. Dies kann manvon der Relatio de legatione Constantinopolitana, die nur aus einer heute ver-lorenen, von dem Jesuiten Heinrich Canisius (um 1557-1610) zur Editio prin-ceps in einer Abschrift seines Ordensbruders Christoph Brouwer (1559-1617)herangezosenen mittelalterlichen Handschrift aus dem Trierer Dom bekanntist, und der Homilie zum Osterfest, die allein in einer zeitgenössischen, wohlin Fulda angefertigten und dann nach Freising vermittelten Kopie (München,Bayerische Staatsbibliothek, clm 6426, fol. 27'-33') überliefert ist, nicht be-haupten.
Die Beschreibung der Überlieferung und Rezeption eines Textes bedarf im-mer wieder der Kontrolle an den Handschriften selbst, da ihnen am ehestenneue Einsichten in seine Verbreitungswege und -umstände abgerungen werdenkönnen. Es darf daher nicht verwundern, wenn zu einigen Liudprand-Codices,die Paolo Chiesa mit Engagement beschrieben hat, neue Beobachtungen ge-macht werden können.
I
Die Antapodosis wurde in Bayern und Österreich in der originalen Fassung
$oseph Beckers ,,III. Klasse") verbreitet, auch wenn diese bereits schwereSchäden in der Überlieferung erlitten hattea. Ihre Bedeurung ist nach AlphonsLhotsky am ehesten daran zu erkennen, daß ihre Rezeprion weniger ,,mir dem
o . Vgl.Joseph- Br,crr,R, Textgeschichte Liudprands von Cremona (Quellen und Unter-
suchungen zur lateinischen Philologie des Miitelalters 3,2),lg}8,20fl: AIe Handschrif-ten dieser Textgruppe haben nur die Antapodosis und enden mit einer Ausnahme (Lon-don, British Library, Harl. 2688) bereits im III. Buch. Ferner haben sie dieselbe, i.*t-hlckqn und ei_gene gemeinsame Lesarten. \Weitere präzisierende Beobachtungen zur Ori-ginalität 4.t lt".4etand-Textes der hier vorliegenden Klasse machren Josäph BECKcR,Zur handschriftlichen Ueberlieferung Liudpränds von Cremona, in:- Neues Archiv(künftig: NA) 36 (1911) 209-211, und \W'alteiBnnscurN, Liudprands Griechisch und dasProblem einer überlieferungsgerechten Edition, in: Mitteilateinisches Jahrbuch 20(1985) 112-115, hier 113 f. mit Anm. 12.
Handscbriftenfunde zw den Werhen Liudprands von Cremona 61
Erwachen der Historiographie" in Österreich denn mit der ,,Vermählung des
Herzogs [Leopold VI.] mit der Byzantinerin Theodora [im Jahre 1203)" zutun habe, da die Schrift die einzige gewesen sei, ,,aus der man sich damals überOstrom belehren konnte"5. Eine genauere Beschreibung der Handschriftendieser Überlieferungsfamilie ermöglicht nicht allein eine nahezu lückenloseAufklärung der Überlieferungsumstände dieses Textes in Bayern und Öster-reich und eine Korrektur des von Lhotsky skizzierten Rezeptionsmodells,sondern gewährt auch neue Einsichten in die Frühgeschichte des Textes undseine Vermittlung in den genannten Überlieferungsräumen. Die ältesten erhal-tenen Zetgen sind V = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 427
und C = Klosterneuburg, Stiftsbibliothek, Cod. 7416. Beide Handschriftensind auch für die jeweils mitüberlieferte Vita Karoli Einhartsz voneinander un-
5 Alphons Luotsrv, Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs(MIOG Ergänztngsband l9),1,963,229.YgL. auch DEns., Umriß einer Geschichte der\Wissenschaftspflege im alten Niederösterreich (Forschungen zur Landeskunde vonNiederösterreich 17), 1964, 20 f .6 Cutrse, Liudprandi Cremonensis opera omnia (wie Anm. 3) XXUI-XXX. Chie-sas Inhaltsbeschreibung von V ist ungenau und unvollständig: Die Historia Hierosoly-mitana steht auf [o1.2'40". Es folgt auf fol. 40' die Epistola patriarchae Hierosolimitaniin exzerpierter Form und auf fol. 40'-41" der Brief des Kaisers Alexios I. Komnenos anGraf Robert von Flandern. Auf fol. 42'-7l stehen die Annales Mellicenses (RedactioClaustroneoburgensis, Handschrift B 3), die Continuatio Claustroneoburgensis I(Handschrift 3) und II (Handschrift A 2). Die Historia Romana des Paulus Diaconusreicht nur bis fol. 113'. Es folgen auf fol. 114'-119" Exzerpre aus der Historia Langobar-dorum des Paulus Diaconus und auf fol. 120'-t25'das III. Buch der Imago mundi desHonorius Augustodunensis. Ebenda, XXIXf.: Auch die Beschreibung von C isr fehler-haft. Die sog. ,,indicazione per la fascicolatura" auf fol. 105" (S. XXIX) ist die Angabeeines Lesepensums. Vergleichbare Eintragungen befinden sich auch auf fol. 99", l55uund 161'. In der Handschrift stehen ferner auf fol. 60'-69'die schon aus V bekanntenExzerpte aus der Historia Langobardorum und auf fol.191.'-202' die Continuatio Regi-nonis des Adalbert von St. Maximin.7 So schrieb er selbst seinen Namen; vgl. Vilhelm \(arraNsACH - \üilhelm LrvrsoN (f)- Heinz Löve, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger2, 1953,267 Anm. 337. Der harte Endvokal t wird nur im Lateinischen zwischen liquidaund Vokal - hier r und u -, also letztlich in intervokalischer Stellung zu d: Einhardus.Das hat einZeitgenosse Einharts, Smaragd von Saint-Mihiel, in seinem Liber in partibusDonati sogar an diesem Namen demonstriert, indem er schrieb: . .. Ainart ...,- Richart..., Stainbart ... Et ista omnia, cwm latinas d.cce?erunt syllabas, in linguam conoertunturlatinam boc modo: , . . Ainardus, Ricbardws, Stainhardws ... (hg. von Aldo MARSILI, DeSmaragdi opere, quod ,,Liber in partibus Donati" vulgo inscribitur, in: Studi mediolatinie volgari 211954171-96, hier 81). An diese Regel hielt sich auch der Schreiber, der Ein-harts Namen in das St. Galler Verbrüderungsbuch Stiftsarchiv, Class. I. Cist. C 3. B 55auf Seite 3 eingetragen hat (Abbildung in: Subsidia Sangallensia 1, hg. von Michael Bon-GoLTE - Dieter Grur,NIcs - Karl Scutr,tto, 1986, 111 Sp. a: vierter Name). Zur Identifi-zierung mit Einhart vgl. Dieter Grunmcu, Gebetsgedenken und anianische Reform -Beobachtungen zu den Verbrüderungsbeziehungen der Abte im Reich Ludwigs desFrommen, in: Monastische Reformen im 9. und 10. Jahrhundert (Vorträge und For-schungen 38), 1989, 79-106, hier 87 und92. Zum selben Lautproblem bei Ekkehart IV.
62 Matthias M. Tischler
abhängig aus einer verlorenen Vorlage p hervorgegangen. V selbst wiederumist der älteste Zeuge für die Verbindung aus Einharts Karlsleben (fol. 125'-132') wd Liudprands Antapodosis (fol. 132'-148'). Eine genauere lJntersu-chung der kodikologischen, paläographischen und inhaltlichen Aspekte dieserHandschrift kann ihren von Paolo Chiesa nicht ermittelten Entstehungsortverraten. Die in ihr anzutreffenden kleinen Minuskeln, die in Schriftgröße undDuktus zum Teil beträchtlich schwanken, sprechen die Sprache eines nochjungen österreichischen Skriptoriums vor der Mitte des 12. Jahrhunderts. Die-se nur vage Datierung läßt sich weiter präzisieren, wenn man die eigenständigeLage berücksichtigt, die schon bald zwischen die beiden Hauptteile der Hand-schrift (foI.2'-ltu und 75'-148") eingeschoben worden ist. Sie besteht aus zweiFolia und dem hinteren Blatt eines Bifoliums. Diese Blätter hat zu größerenTeilen eine im Codex sonst nicht nachweisbare Hand in bisweilen scharfemDuktus auf fol. 72r-73vb mit Isidors von Sevilla Chronicorum epitome8, eineruniversalen Herrschaftsliste, gefüllt und auf fol. 73"b-74'^ aus ostfränkisch-deutscher Perspektive um einen Katalog der merowingischen, karolingischen,ottonischen und salischen Herrscher bis zum ersten Stauferkönig Konrad III.ergänzte . Fol.74' blieb zu dreiviertel und {ol. 74" gänzlich unbeschrieben. Nunzeigen diese Blätter vor allem im Hinblick auf die Anlage des Schriftspiegelseine bemerkenswerte kodikologische Übereinstimmung mit der ersten Lage
des zweiten Handschriftenteils (fol. 75-82). Dies dürfte bedeuten, daß der ge-
samte Teil des Codex ab fol. 72 in einem einzigen Skriptorium angelegt und er-gänzt wurde. Dies ist umso weniger erstaunlich, als auch die Textfassung des
auf fol. '1,20'-1,25'überlieferten III. Buches der Imago mundi des HonoriusAugustodunensis wie der Herrscherkatalog auf fol. 73vb-74ra einen Bezug zuKonrad III. besitzt. Der Berichtszeitraum des Honorius-Textes reicht nämlichebenso nur bis zu Konrads Herrschaft, ohne daß dessen Regierungsjahre be-reits angegeben werden. Schon Georg Heinrich Pertz veranlaßte diese Beob-achtung zu einer Datierung der Handschrift in die Zeit ,,Kaiser" Kon-
von St. Gallen vgl.J. DuEr, Ekkehardus - Ekkehart. '§flie Ekkehart IV. seinen Namengeschrieben hat, in: Variorum munera florum. Festschrift H.F. Haefele, 1985,83-90,hier 89 f.8 Etymologiae V 36-39; Explicit: ... v. dccc.xxaiii Aeraclius dnnos xxü Huius .üo. et
.ää". anno religiosissimi principes (!) sisebuti in hyspania iwdei baptizantur. Zur Hand-schrift vgl. Theodor Mouusr,N (Hg.), MGH AA 11, 2,1894,418 Nr. 223.e Zur Lokalisierung und Datierung der Handschrift ,,Österreich ?, vor 1152* anhanddieses Textes vgl. Franz lJt ttsRrrRcurR, Die datierten Handschriften der Österreichi-schen Nationalbibliothek bis zum Jahre 1400 (Katalog der datierten Handschriften inlateinischer Schrift in Osterreich 1, 1), 1969, 23. Eine Abbildung von fol. 74'" ist veröf-fentlicht in: Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek biszum Jahre 1400 (Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Öster-reich 1, 2),1969,43 Abb. 31.
Handscbriftenfunde zw den Werben Liudprands von Cremona 63
rads III.10 Die Redaktion des Honorius-Textes dürfte noch vor Konrads Todim Jahr 1152 erstellt und niedergeschrieben worden sein. Da sich die Einzel-blätter 72-74 nach der Gestalt der Lagen des zweiten Handschriftenteils rich-ten, müssen die Folia 75-148 etwas früher beschrieben worden sein. Ihre Da-tierung ins zweite Viertel des 12. Jahrhunderts läßt sich mit dem Entwick-lungsstand der hieran beteiligten Hände vereinbaren.
Vährend aus den äußeren Merkmalen der Handschrift keine konkretenHinweise auf ihre mittelalterliche Provenienz zu gewinnen sind, ist aufgrundeines inneren Kriteriums ihre Entstehung in einem Dom- oder Chorherrenstiftin Erwägung zu ziehen. In Kapitel 24 der Vita Karoli, in dem Einhart vonKarls Lektüre der Civitas Dei berichtet, ist nämlich Augustins Name als einzi-ger in der gesamten Vita in Capitalis rustica hervorgehoben (fol. tZO"). DerGrund hierfür dürfte in der in den regulierten Chorherrenstiften besonders an-
zutreffenden Verehrung des Kirchenvaters liegen, der ihnen mit seiner Chor-herrenregel gleichsam das Lebensgesetz hinterlassen hatte. Zwei weitere Über-legungen können eine solche Provenienz erhärten. So ist seit langem bekannt,
daß Gerhoh von Reichersb erg (1092/1,093-1,169) für sein um 1158 begonnenes
Konzept der nur im Druck erhaltenen Reichersberger Annalen (bis 1167) undMagnus von Reichersberg (11195) für seine Chronik, die hierauf aufbauen
konnte, die Antapodosis des Liudprand in der hier vorliegenden Textfassung
benutztenll. Auch wenn eine Lokalisierung von V nach Reichersberg auf-grund der nur schmalen Handschriften-Überlieferung aus dem berühmtenChorherrenstift Schwierigkeiten bereitetl2, muß es zu denken geben, daß der
Codex auch die Kreuzzugsgeschichte des Robert von Saint-R6mi enthält, die
in der Reichersberger Chronik zum Jahr 1092 benutzt wurde und Gerhoh zu-dem ein eifriger Leser und Benutzer der Werke des Honorius Augustodunen-sis gewesen ist13, dessen Imago mundi in V in einer frühen Redaktion vorliegt.Ist es in Anbetracht der oben erschlossenen frühen Datierung der Handschriftder seit 1132 residierende Propst Gerhoh von Reichersberg gewesen, der auch
eine Vorlage mit Einharts Karlsleben und Liudprands Antapodosis in einer Bi-
'o ,,... Conrado III. imperatore saeculo XIL scriptus", vgl. MGH SS 2, 1829, 438.
" Vgl. Becrr,R, Textgeschichte Liudprands (wie Anm. 4) 37. Die beiderseitige Benut-zung erfolgte im Jahresbericht nt 921 (MGH SS 17, 1861, 443 Sp. b Z. 17-20 und 485Sp1. b Z. 2-B); vgl. Heinrich FrcHrrNeu, Studien zu Gerhoh von Reichersberg, in:MOIG 52 (1938) 1-56 (mit 2 Abb.), hter 47 und 51 Anm. 4.
t2 1624 ist die Bibliothek beim grolSen Klosterbrand untergegangen. Das Abbildungs-material, das zrsletzt Kurt Horrun, Mittelalterliche Buchkunst in Reichersberg, in: 900
Jahre Augustiner Chorherrenstift Reichersberg, 1,983, 295-312, bereitgestellt hat, zeigtAhnlichkeiten aber auch Unterschiede in einzelnen Formen der Schrift und läßt keinedefinitive Entscheidung für Reichersbe rg zlr.
1r Dies hat betont Ftcutr,Neu, Gerhoh von Reichersberg (wie Anm. 1l) 39.
64 Mattbias M. Tiscbler
bliothek des von seinem Stift bevorzq;ten Salzburger Kontaktraumsl4 aufge-funden hattel5?
Die vermutete Reichersberger Provenienz vor. V läßt sich mit weiteren Ar-gumenten untermauern, wenn es gelingt, die Herkunft jener verlorenen Hand-schrift F, auf die V und C zurückgehen, im Salzburger Umfeld wahrscheinlichzu machen. Hierfür kann die zweitälteste erhaltene Ableitung dieser Vorlage,die zugleich auch der zweitälteste Überlieferungszeuge für die Textverbindungaus Einharts Vita Karoli und Liudprands Antapodosis im Donauraum ist, guteDienste leisten. Dies ist der Klosterneuburger Codex C. Die bereits leicht goti-sierte Textminuskel des für die Kopie verantwortlichen Schreibers steht nurscheinbar im Widerspruch zu der noch traditionellen romanischen Ausstat-tung der Handschrift. Seine Schrift fügt sich nicht in das zeitgleiche öster-reichische Schriftpanorama. Vielmehr verrät sie französischen Einfluß. Bei ge-nauerem Hinsehen werden frühgotische Formen deutlich, die man im drittenViertel des 12. lahrhunderts, der wahrscheinlichsten Entstehungszeit derHandschrift, bei einem österreichischen Schreiber vergeblich suchen wird. Sosind die Bögen der Buchstaben b, h, m, n, o, p und q bereits spitzwinklig ge-schrieben. Weitere gotische Kennzeichen sind ein rundes d, dessen kurzeoberlänge am Übergang zum Rücken eine Brechung aufweist, ein g, dessenuntere Schleife bisweilen schon mit einem geraden Strich geschlossen wird, so-wie ein mbzw. n mit einem Knick im letzten Schaft, woraus sich später die ty-pische Schaftbrechung der gotischen Schrift entwickelte. Auch ist der Doppel-konsonant pp bereir.s stark angeschoben und bei r der Schaft häufig durch denDeckbalken gezogen. Andererseits ist die et-Ligatur noch nicht wie in der wei-terentwickelten gotischen Minuskel deformiert. Man wird die Schrift daher als
Minuskel des 12. Jahrhunderts mit frühgotischem Einschlag bezeichnen dür-fen. Ob man deshalb an eine Ausbildung des Schreibers in Nordfrankreichselbst denken muß, ist jedoch ungewiß. Das Ztsammenspiel mit der her-kömmlichen romanischen Initialtechnik des Codex läßt eher an die Arbeiteines von dort beeinflußten Kopisten denken. Dabei sind gerade in Kloster-neuburg französische Einflüsse wenig erstaunlich. Diese können von dem ehe-maligen Klosterneuburger Zögling und Propst Orto von Freising (ca. 1ll2-1158) oder dem Klosterneuburger Propst Marquard I. (1141-1167), einemBruder Gerhohs von Reichersberg, herrühren, da schon vor Otto Marquard inden frühen zwanziger Jahren des 12. Jahrhunderts, zu einer Zeit also, als der
1o Vgt. Peter Cl.tsseN, Gerhoch von Reichersberg. Eine Biographie, 1960, 58-78, vorallem 67 ff.
15 Ein Indiz für eine Salzburger Vorlage von V könnte sein, daß neben dem am An-fang der Metropolenliste in-Kapitel 33 der Vita Karoli verzeichneren Rom nur Salzburg(Iwwauiwm) mit einem Großbuchstaben geschrieben ist (fol. 131").
Handschriftenfwnde zu den Werken Liwdprands von Cremona 65
Chorherr Hugo von St. Viktor (11141) zu lehren begann, eine höhere Schule
in Paris besucht hatte16. Die Entstehung der Handschrift im dritten Viertel des
1,2. Jahrhunderts wird daher am wahrscheinlichsten sein, zumal schon die
kunstgeschichtliche Forschung aufgrund der Initialen eine solche Datierungangenommen hat. Der Codex dürfte wegen innerer Kriterien, auf die Paolo
Chiesa aufmerksam gemacht hat, vor 1158 oder 1159 und damit unter PropstMarquard I. entstanden sein. Dies wäre umso bemerkenswerter) als mit Klo-sterneuburg in nur geringem zeitlichen Abstand nach Reichersberg ein zweites
bedeutendes österreichisches Chorherrenstift Liudprands Antapodosis rezi-piert und dabei möglicherweise auf dieselbe, zumindest aber eine nahe ver-wandte Vorlage zurückgegriffen hätte. Vielleicht haben die engen personalen
Verflechtungen zwischen den beiden Stiften diese Textvermittlung begün-
stigt17. Berücksichtigt man, daß V und C auf eine gemeinsame Vorlage B
zurückgehen, so mag die Überlegung berechtigt sein, ob nicht auch C eine
Handschrift aus dem für Reichersberg so bedeutsamen Salzburger Umfeld zurGrundlage hatte. Zwar steckt die Erforschung der Übermittlungswege schrift-licher Kommunikation zwischen den hochmittelalterlichen BildungszentrenÖsterreichs noch zu sehr in den Anfängen, als daß man hierauf eine befriedi-gende Antwort geben könnte, doch sind immerhin zwischen Salzburg undKlosterneuburg künstlerische Verbindungen aufgedeckt worden, die sich auch
in einigen Initialen von C widerspiegeln. Der Salzburger Schule gehören insbe-
sondere die gelb unterlegte rote P-Initiale auf fol. 2'18 und das im charakteristi-schen Klosterneuburger graphischenZeichenstille gefertigte Autorenbildnis inder E-Initiale zu Beginn der Chronik Reginos auf fol. 108'an20. Der Zeichnerist auch in anderen Erzeugnissen des Klosterneuburger Scriptoriums nach-
weisbar und hat nach der Mitte des 12. Jahrhunderts gearb eitet2r . Auch die
" Vgl. Gerhard Rtll, Die Pröpste des Stiftes Klosterneuburg von der Gründung biszum Ende des 14. Jahrhunderts, in: Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N.F. 1 (1961)1l-68, hier 35 mit Anm. 7f.; Floridus RöuRrc, Die Brüder Gerhochs in Klosterneuburg,in: 900 Jahre Stift Reichersberg. Augustiner Chorherren zwischen Passau und Salzburg,1984,93-99, hier 93.
17 Neben Marquard ist hier Gerhohs Halbbruder Rudger zu nennen, der zunächst inReichersberg nachweisbar ist, 1158-1160 in Augsburg Dekan und schließlich ll67-1168Propst von Klosterneuburg war; vgl. FtcutENe.u, Gerhoh von Reichersberg (wieAnm. ll) 2l Anm. 6; Cr-essru, Gerhoch von Reichersberg (wie Anm. l4), 476 (Regi-ster).
18 Zu den hier greifbaren Salzburger Einflüssen vgl. Kurt HoLTrR, in: 1000Jahre Ba-benberger in Osterreich (Ausstellungskatalo g), 197 6, 574 f. Nr. 1 045.
" Vgl. Erich §iltNrLe R, Die Buchmalerei in Niederösterreich von 1 1 50-1 250, 1923, 9 f .20 Etwas verkleinert wiedergegeben bei \7tNr.Lr,R, Buchmalerei (wie Anm. 19)
Abb. 19, und jerzt in Farbe bei Alois HarorNcrR, Verborgene Schönheit. Die Buchkunstim Stift Klosterneuburg (Ausstellungskatalog), 1998, Abb. 11.
" Vgl. Ornamenta Ecclesiae 1 (Ausstellungskatalog), 1985, 80.
Mattbias M. Tischler
selbständige Federzeichnung einer Disputation auf den beiden Schlußblätternfol. gz'/81'des Klosterneuburger Cod. 311 stammt von ihm. Ferner läßt sichseine Hand in den Klosterneuburger Codices 21,9, 220, 253 und 258 feststel-len22. Als bedeutendste künstlerische Kraft seiner Schule liefert er die willkom-mene Bestätigung dafür, daß C tatsächlich in Klosterneuburg und zwar unterSalzburger Einfluß entstanden ist, auch wenn den ältesten positiven Beleg füreine Aufbewahrung der Handschrift im Stift erst eine Notiz aus dem späten
14. Jahrhundert erbringt, die auf der Schlußseite fol. 202' zu lesen ist Anno do-
mini M",ccc.77. Jobannes de ersprunn presbiter alias in probacione prolegit bunclibrum sub preposito cholomanno decano bartbolomeo.
Auch für den Liudprand-Codex Vi = Wien, Österreichische Nationalbiblio-thek, Cod. 40023 läßt sich unter Ausschöpfung weiterer mittelalterlicher undneuzeitlicher Quellen die von Paolo Chiesa nicht erkannte Provenienz er-
schließen. Die Handschrift ist nämlich eine im Rahmen des ordenstypischenMutter-Tochter-Verhältnisses im Zisterzienserkloster Heiligenkreuz etwa imzweiten Drittel des 13. Jahrhunderts, also während der Amtszeit Abt Egilolfs(1,228-1242), entstandene Kopie der Vorlage Z = Zwettl, Stiftsbibliothek, Cod.299,II24. Vorlage wie Abschrift enthalten im Gegensatz zuY und C nun zu-sätzlich die Historia persecutionis Africanae provinciae des Victor von Vita.Doch obwohl bereits Andreas Schwarcz im Rahmen seiner textgeschichtlichenUntersuchungen zur Überlieferung der Historia persecutionis bemerkte, daß
nach Ausweis der spätmittelalterlichen Kataloge in Kloster Heiligenkreuz einExemplar dieses Textes gelegen haben muß, war ihm entgangen, daß der vonihm ebenfalls berücksichtigte Zeuge Vi mit eben dieser Überlieferung, die er
22 Ornamenta Ecclesiae (wie Anm. 2l) 79f. Nr. A 24 und 81 (verkleinerte Farbabbil-dung von Cod. lt1, fol. 82'/83'); jetzt auch in: Hildegard.von Bingen 1098-1179 (Aus-stellungskatalog), 1998,717.YgL. auch Babenberger in Osterreich (wie Anm. l8) 575Nr. 1046.
23 CHIESA, Liudprandi Cremonensis opera omnia (wie Anm. 3) XXXVf. Auch hier istChiesas Inhaltsbeschreibung nicht ganz korrekt: Die Handschrift enthält auffol. 38'-40'die Passio septem martyrum.
2a CHtr,sa, Liudprandi Cremonensis opera omnia (wie Anm. 3) XXXII f. Der Inhaltvon Z ist hier ungenau beschrieben: Auf fol. 166'-168" steht die Passio septem mar-tyrum und auf fol.233'-242'folgen die schon aus V und C bekannten Auszüge aus derHistoria Langobardorum des Paulus Diaconus. Die bislang vorgeschlagene Datierungdes die Antapodosis überliefernden Handschriftenteils B kann insofern präzisiert wer-den, als der Text für die nicht wesentlich nach 1187 feruggestellte Zwettler Historiapontificum Romanorum herangezogen worden ist; vgl. Kurt Rost, Die Historia pontifi-cum Romanorum aus Zwettl, 1932, 126-128. Zur Datierung der Zwettler Papstge-schichte, die Bernhard Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus 1, 3, 1721, 327-396,ediert hat, vgl. Rosr, 132.
Handschriftenfunde zu den.Werken Liwdprands aon Cremona 67
als verloren ansah25, aufs engste zusammenhängt. Zugegebenermaßen ist aus
den kodikologischen Daten der Handschrift, insbesondere aus dem WienerBarockeinband, nichts Näheres über ihre mittelalterliche Provenienz in Erfah-rung zu bringen. Doch hatte Andreas Schwarcz nicht bemerkt, daß die origi-nale Textfolge, die Vi noch weitestgehend bietet, auch im Heiligenkreuzer Bi-bliothekskatalog von vor 1381 zu finden ist. Dort heißt es: Liber s,c,intilla-rum li. unus. De conflictu r.ticiorum et macbina virtwtwm. Metbodimws de prin-cipio seculi. Historia Affricana Indorum lsc. Vandalorwm) et gesta Karoli impe-
ratoris. Epistola lorbannis, presbiteri de Yndia ad imperatorem Constantino-politanurn, apocrifa26. Z*ar ist der Brief des Johannes Presbyter heute nichtmehr in der Handschrift überliefert, doch muß er sich ursprünglich in ihr be-
funden haben, da ihn die VorlageZ nach der Antapodosis des Liudprand nochheute enthält, Vi aber nicht mehr den ursprünglichen Lagenumfang am Ende
aufweist, was aus dem gegenüber Z vorzeitigen Textabbruch in der Antapodo-sis deutlich wird. Ferner sprechen die Schreibung ffiicana, die im originalenTitel der Historia persecutionis in Vi auf fol. 9' zu finden ist, und der nahezuzeitgleiche Randtitel auf fol. 40" zur Vita Karoli (lncipiunt gesta karuli impera-toris gloriosi) fijr eine Identifizierung des Katalogeintrags mit Vi. Auch daß dieam Ende der Handschrift stehende Antapodosis des Liudprand im Katalognicht verzeichnet wurde, braucht nicht zu verwundern, da der Textbeginn inder Handschrift allein durch eine Initiale, nicht aber durch einen Titel gekenn-
zetchnet ist. Aus dem Katalogeintrag geht ferner hervor, daß Vi auch am An-fang ursprünglich umfangreicher gewesen ist. Tatsächlich hat sich TheodorGottlieb bei seiner Katalogedition nicht geirrt, als er das Paragraphenzeichen,
das den Beginn einer Handschrift kennzeichnen sollte, bereits zwei Texte vorden Revelationes des Ps.-Methodius gesetzt hatte, so daß noch der (hier in der
Abteilung der Bücher Bedas verzeichnete) Liber scintillarwm li. wnus und das
§flerk De conflictu viciorum et machina virtwtum yoransingen. Daß dies rich-tig ist, bestätigt ein am Ende desselben Katalogs in der Abteilung Cronice zu
2s Und zwar angeblich durch Brand während der Türkenbelagerung \Wiens 1683; vgl.Andreas Scuvancz, Bedeutung und Textüberlieferung der Historia persecutionis Afri-canae provinciae des Victor von Vita, in: Historiographie im frühen Mittelalter, hg. vonAnton ScunnEn - Georg Scur,Isnr-nEttr,n, 1994, 115-140, hier 12I, 140. Nicht berück-sichtigt hat Andreas Scuvencz hierbei den Aufsatz Benedict GsELL, Das Stift Heiligen-kreuz und seine Besitzungen im Jahre 1683, in: Smdien und Mittheilungen aus dem Be-nediktiner- und Cisterzienser-Orden 4, 1 (1S83) 284-294;4,2 (1883) 81-89 und 330-343,hier 4,2 (1883) 82 (zu den Schäden in der Bibliothek).
'u Hg. von T_heodor Gorrltae, in: Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs(künftig: MBKO) l, 1915, 49 Z. 35-50 Z. 5. Der irn Apparat auf Seite 49 z.u Zerle 35 ge-gebene Hinweis, die mit dem Eintrag beschriebene Handschrift habe bis 50 2. 7, ge-reicht, ist wohl zu korrigieren. Vgl. hierzu im folgenden.
68 Mattbias M. Tiscbler
findender Hinweis: Historiam Affrice gentis et Indorwm require in ,tolwmine
scintillarwm Bede. Gesta Karoli imperatoris2T, nach dem sich die Historia per-
secutionis des Victor von Vita und alle hiermit verbundenen restlichen Texte
in einer Handschrift befanden, die mit ,,Bedas" Liber scintillarum begann.
Dieser Codex war übrigens schon im Heiligenkreuzer Standortkatalog, der
den Bibliotheksbestand von 1,363/1374 widerspiegelt, in der Abteilung der
Bücher Bedas als Scintille eiusdem verzeichnet28. Den beschriebenen Bindezu-
stand muß die Handschrift noch mindestens zwei Jahrhunderte besessen ha-
ben, da sie mit demselben Text auch im Jahre 1,576 begann, als Hugo Blotius
die Codices der \Wiener Hofbibliothek beschrieb, zu denen Vi inzwischen
gehörte: O 4241 Bedae presbyteri scintillae, iwncta historia Vandalorwm2e, Ca-
roli Magni et Lwitprandi. Liber in folio scriptus in membrana3). In der Hofbi-bliothek scheint dann der Text des Ps.-Beda abgetrennt worden zu sein, da er
in Sebastian Tengnagels Katalogbeschreibung (Wien, Österreichische Natio-nalbibliothek, Cod. 9351, fol. t11', laufende Nummer 47) nicht mehr auf-
scheint: Versus aliquot de Nummo. Prophetia Metbodio Martyri asscripta. Vic-
toris Historia persecwtionis Africanae. Caroli M. aita per Eginha.rturn. Cancell.
Luitprandi Ticinensis Hist. fol. memb. Die Suche nach der Blotius-Signatur
O 4241 unter den Wiener Handschriften blieb erfolglos. Möglicherweise war
sie nur im verschwundenen Teil der originalen Handschrift angebracht, da sie
Vi selbst nicht aufweist. Sprechen schon die bisher zusammengetragenen Indi-zien flj,r eine Identität des Viener Codex mit der im Heiligenkreuzer Katalog
genannten Handschrift, so mag ein bislang übersehener, hauchdünn geschrie-
bener Besitzeintrag auf fol. III'oben, der im rechten Teil beschnitten ist, seine
Herkunft aus dem Zisterzienserkloster im \Wienerwald bestätigen, da hierz:u
passend die Provenienz aus einem der Hl. Maria geweihten Kloster zu lesen
ist: Liber est sancte marie (es folgte wohl die Ortsbezeichnung, vielleicht übli-cherweise: ad sanctan't. crucen't). Der Besitzeintrag und die Seitentitel dürftenvon einer einzigen Hand des 14. Jahrhunderts stammen. Auch die jüngere Ge-
schichte der Handschrift kann ihre Provenienz aus dem Kloster Heiligenkreuz
bestätigen. Sie befand sich nämlich im 16. Jahrhundert im Besitz des tWiener
Bischofs Johannes Fabri (1530-1541), der dieZisterzienserabtei zu den primä-
27 MBKÖ (wie Anm. 26)742.13-15.28 Ebda, 30 2.7.2e In der Handschrift steht auf fol. 9' oben von Sebastian Tengnagels Hand geschrie-
ben: B. Victoris Vticensis Historia de Persecutione Vandalorum, weiter unten von einerspätmittelalterlichen Hand: Incipiunt ge sta Wandalctrwm.
'o Hg. von Hermann MT,NuARDT, Das älteste Handschriftenverzeichnis der'W'ienerHofbibliothek von Hugo Blotius 1576, 1957,40.
Handscbriftenfunde zu den Werleen Liwdprands oon Cremona 69
ren Anlaufstationen für seine Recherche kirchenrechtlicher Quellentexte zähl-te31, was wegen der Nähe des Klosters zu seinem Bischofssitz nicht verwun-dern muß. Schon Theodor Gottlieb hatte auf die Entführung HeiligenkreuzerCodices während der Reformationszeit hingewiesen32.
Die Überlieferungsumstände des in den genannten Handschriften tradiertenTextverbundes von Einharts Karlslebens und Liudprands Antapodosis könnenaus der Perspektive der Liudprand-Verbreitung weiter präzisiert werden. Derottonische Text wurde, wie bereits angedeutet, in Bayern und Österreich inder originalen Fassung verbreitet33. Die Transmission des genannten Textver-bundes setzt erkennbar erst im Laufe des 12. Jahrhunderts ein, ohne daß
zunächst Genaueres über den Ausgangspunkt bekannt ist, der der Aufbewah-rungsort einer recht alten Handschrift dieser beiden Texte gewesen sein kann.
Gerade die Textgestalt der Antapodosis in den beschriebenen österreichischen
Handschriften kann aber einige wertvolle Anhaltspunkte geben. So weist kei-ner der Liudprandtexte die sonst anzutre{fenden Glossen und nur an sieben
Stellen die Umschriften der von Liudprand verwendeten griechischen Buchsta-ben auf, was auf eine besondere Nähe z:um lJrtext hindeutet. Bemerkenswertist ferner die Tatsache, daß der Archetypus dieser Handschriften dem Ar-chetypus des Textes in einer schon von Joseph Becker erschlossenen erstenFassung am nähesten steht. Das verweist auf einen alten Überlieferungsort,von dem die bayerisch-österreichische Liudprand-Überlieferung ausgegangen
ist. \üfleitere Indizien liefert die Provenienzstruktur der genannten ältestenösterreichischen Einhart-Liudprand-Handschriften. Mit V, dessen Entste-hungsort wir vermutlich in Reichersb erg zu suchen haben, und C aus Kloster-neuburg konnten die beiden ältesten Vertreter einer österreichischen Hand-schriftenfamilie erschlossen werden, die beide in Chorherrenstiften geschrie-
ben worden sind. Ihre Entstehung verdanken sie also jener spirituellen undkulturellen Trägerschicht, die in Bayern und Österreich an der Wende vom 11.
nsm 12. Jahrhundert die Führungsrolle von den älteren Benediktinerklösternübernahm und diese im Laufe des 12. Jahrhunderts an die neuen Zisterzienser-klöster weiterreichte. Die jüngeren Zeugen derselben Textfamilie aus dem aus-
gehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhundefi, Z und Vi, stammen daherkaum zuf;llig aus den ZtsterzienserklösternZwettl und Heiligenkreuz. Damit
l1 Johannes FasRi verfaßte unter anderem einen ,,Catalogus abbatiarum et monasteri-
orum, apud quae extant perantiqui libri maxime acta antiquorum consiliorum" (hg. vonAlbert'W'nnurucnorr, Reise nach Italien im Jahre 1901, in: NA 27 ll902l565-604, hier597 f .), in dem auch auf Heiligenkreuz verwiesen wird: ... in monasterio S. Crwcis ordinisS. Benedicti (!) e.iwsdem lsc. Pataviensisf dioecesls (hg. von \Tr,RltINcuorE, 597).
" Vgl. MBKO (wie Anm. 26) 16 mit Anm. 1.
" Vgl. oben rnit Anm. 4.
/U Matthias M. Tischler
zeigt sich auch in der überlieferungsgeschichtlichen Makrostruktur der
bayerisch-österreichischen Einhart-Liudprand-Überlieferung jene kulturellePhasenverschiebung, die wir in der Ausbreitung der Schriftlichkeit in den neu-
en österreichischen Skriptorien und in der Entwicklung und Verbreitung der
österreichischen Annalistik beobachten können3a. Die österreichische Einhart-Liudprand-Überlieferung spielt sich in jenem Dreieck zwischen Klosterneu-burg, Zwettl und Heiligenkreuz ab, das man schon einmal als ,,Abschreibe-In-teressengemeinschaft" bezeichnet hat35. Sie ist in ihren Anfängen also minde-stens ein halbes Jahrhundert vor jene babenbergisch-byzantinische Eheverbin-dung zu datieren, auf die der Altmeister der österreichischen Geschichtsfor-schung Alphons Lhotsky als ihre vornehmliche Ursache hingewiesen hat, undsie hat ihren Ausgangspunkt an einem zentralen Ort des bayerisch-österreichi-schen Schwellenraums, der in den den neuen Chorherrenorden besonders för-dernden Diözesen Regensburg, Passau oder Salzburg gelegen hat36. MehrereGründe sprechen hierbei für eine Vermittlung der Antapodosis und der VitaKaroli von Regensburg aus über Salzburg in den Donauraum hinein.
Den Schlüssel für die Erschließung des Überlieferungsweges, den das Stem-ma für die Texte Einharts und Liudprands nachzeichnet, dürfte der Kloster-neuburger Codex C liefern, in dem kaum zufallig die Überlieferungsstränge
,,Einhart-Liudprand" (fol. 71'-107") und,,Regino-Continuatio Reginonis"(fol. tOS'-202') zusammenfließen. Dabei kommt der Tatsache, daß hier die
Chronik Reginos in einer spezifischen St. Emmeramer Redaktion vorliegt, be-sondere Bedeutung zu, da hiermit ein Einblick in die Vermittlung regensburgi-
schen Textgutes über das letztlich hinter C stehende österreichische Überliefe-rungszentrum Salzburg gewonnen ist, auf das wir bei der Rekonstruktion derverlorenen Vorlage B, die bereits Einharts Karlsleben mit Liudprands Antapo-dosis verband, gestoßen waren. Freilich läßt sich auch für die älteste erreichba-re Textgestalt der parallel mit Liudprands Antapodosis überlieferten Vita Ka-roli eine Regensburger Provenienz zumindest wahrscheinlich machen. So ist
'o Vgl. Franz-Josef Scultale, Die österreichische Annalistik tm 12. Jahrhundert, in:Deutsches Archiv (künftig: DA) 31 (1975) 144-203, hier 163-190 und 193; [§üilhelm\WatrrNsncrr -] Franz-Josef Scultelr,, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter.Vom Tode Kaiser Heinrichs V. bis zum Ende des Interregnum 1, 1976,216-224 und228.
35 So Heide DtnNST, Lateinisches Schrifttum im babenbergischen Österreich, in: Ba-benberger in Österreich (wie Anm. 18) 125-133,hier 126.
36 Auf den regionalen Austausch von Vorlagen im 1,2. und frühen 13. Jahrhundertüber die lokalen Schranken hinweg zwischen bayerischen und österreichischen Klösterndes Benediktiner-, Zisterzienser- und Prämonstratenserordens in den Diözesen Regens-burg und Passau hat schon Bernhard BtscHoEr', Paläographie des römischen Altertumsund des abendländischen Mittelalters, 21986, 282, aufmerksam gemacht.
Handscbrtftenfunde zw den Werken Liudprands r;on Cremona 71,
bislang übersehen'worden, daß das mit B nahe verwandte Karlsleben des tVie-
ner Einhart-Regino-Codex Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 639 aus
Viktring, dessen Vorlage scheinbar noch nicht mit Liudprands Antapodosis
verbunden war, wohl nicht, wie bisher angenommen wurde, in dem Kärntner
Zisterzienserkloster entstanden ist37. Vielmehr besitzt die Handschrift neben
ihren charakteristischen paläographischen Merkmalen eine Eigenheit, die fürihre Herkunft aus Regensburg oder zumindest für einen engen Bezug zu den
dort verfügbaren Texten den Ausschlag geben könnte. Der Viener Codex ist
nämlich die einzige heute bekannte Handschrift aus dem bayerisch-öster-
reichischen Raum, die Einharts Karlsleben allein mit Reginos Chronik (ein-
schließlich der Continuatio Reginonis des Adalbert von St. Maximin) in einer
Regensburger Fassung überliefert, während nahezu alle anderen verwandten
Handschriften Einharts Karlsleben mit Liudprands Antapodosis verbinden.
Nun hat im Rahmen seiner Studien zur Überlieferungsgeschichte der ChronikReginos von Prüm Wolf-Rridiger Schleidgen einen St. Emmeramer Codex als
Ausgangspunkt für die hier überlieferte Fassung wahrscheinlich machen kön-nen38, in dem ein Mönch dieses Klosters Reginos Nachricht zur Begräbnisstät-
te Kaiser Arnulfs zun lahr 899 von Altötting zu St. Emmeram korrigierthabe3e. Durch seinen Eingriff wurde aus: sepuhusque est bonorifice in odingas
rz So noch §(olf-Rüdiger ScHlurocnN, Die Überlieferungsgeschichte der Chronik des
Regino von Prüm (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte3l), 1977,82.
38 Dies ist seine Handschrift A lb; vgl. Scur-erDGEN, Regino von Prüm (wie Anm. 37)94.
re Schleidgens Beobachtungen hat Alois ScuurD, Die Herrschergräber in St. Em-meram zu Regensburg, in: DL 32 (1976) 333-369, hier 345 mit Anm. 74, nicht mehrberücksichtigen können, weshalb er den Eingriff in Reginos Nachricht mit dem Heraus-geber der Chronik Reginos Friedrich Kunzs noch einem Göttweiger Mönch.zuwies, daKunzs im Gegensatz zv Scur-r,rocr,N den Göttweiger Regino-Codex tWien, Osterreichi-sche Nationalbibliothek, Cod. 538 als Vorlage der restlichen österreichischen Regino-Überlieferung und damit auch der Regensburg-Viktringer Regino-Handschrift ansah;vgl. Friedrich Kunzp (Hg.), MGH SS rer. Germ. [50], i890, XIf. (Kurzbeschreibung derHandschriften) und XV (Stemma) sowie ScHt-Etocr,N, Regino von Prüm (wie Anm. 37)
94-96 und Stemma. Die Regensburger Bezüge der hier angesprochenen Regino-Fassungwerden noch deutlicher, wenn rnan beachtet, daß Cod. 538 aufgrund seines Schreibstilsin einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Regensburg-Prüfeninger Schrift des
forrgeschrittenen 12. Jahrhunderts steht; vgl. ScuI-ETDGEN, Regino von Prüm, Abb. 19,
was ebenda, B0f. nicht berücksichtigt ist. Der hier erkennbare Bezug nach Regensburg-Prüfening ist ein weiterer Beleg für die reformerische und kunstgeschichtliche Verbin-dung zwischen Prüfening und Göttweig unter dem Prüfeninger Professen und späterenAbt Werner von Göttweig (1150-1155), auf die hingewiesen hat Werner Tr,Lesro, Gött-weiger Buchmalerei des 12. Jahrhunderts. Studien zur Handschriftenproduktion eines
Reformklosters (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens undseiner Zweige, Ergänzungsband 37),'t995, 44-48. Die Regino-Handschrift hat Trlrsroaber nicht berücksichtigt.
72 Matthias M. Tischler
wbi et pater eius tumulatus iacet, die Formulierung: sepultwsque est honorificein radisbona (radispona C) in basilica sancti enr7nr7era.mmi (bemmerammi C)martyris quern ipse dum oixit mwltum ,ueneratus est40. Dieser redaktionelleEingriff, der vielleicht die Kenntnis der Regensburger Forrserzung der sog.Annales Fuldenses verrät4l, ist im Zusammenhang mit anderen vergleichbarenBestrebungen St. Emmerams zu sehen, Arnulfs ausdrücklichen Vunsch nacheinem Begräbnis im Regensburger Kloster zu betonen. Im Streit um die Loslö-sung des Klosters vom Regensburger Bischof im 11. Jahrhunderr wurde unteranderem auch die Autorität des spätkarolingischen Kaisers bemüht. Daher istArnulf sogar als Konventuale des Klosters in der Grundschicht des St. Emme-ramer Martyrolog-Nekrologs Augsburg, IJniversitätsbibliothek, Cod. I2 2" B
auf fol. 62'b zum 8. Dezemb er verzeichnet (um lo45)42. Aber schon in dem um1036 vollendeten ersten Buch von Arnolds von St. Emmeram Werk De mira-culis beati Emmerami und in der von Otloh stammenden älteren TranslatioS. Dionysii Areopagitae von ca. 1049 finden sich Textstellen, die den St. Em-meramer Begräbniswunsch des Kaisers zum Ausdruck brachtenas.
Schließlich gibt es sogar von Liudprands Antapodosis selbst eine von JosephBecker übersehene Regensburger Überlieferungsspur, deren Provenien z zu-gleich die Erklärung für die spezifische österreichische Einhart-Liudprand-Verbreitung liefern kann. Vilhelm \X/attenbach konnte für die sogenannrenAnnales Ratisponenses zum Jahr 894 nicht nur die Kenntnis der Antapodosis(I 30f.) nachweisen, sondern zugleich auch wahrscheinlich machen, daß dieseAnnalen von einem Kleriker des Regensburger Domstiftes niedergeschrieben
40 MGH SS rer. Germ. [50], 1890, 147 2.28f. und Anm. ,r.
al Diese berichten zum Jahr 9OO: Imperator urbe Radaspona diem ultimum clausit eth_onorifice in domo sancti Emmerammi martyris Christi ) swis sepelitwr (MGH SS rer.Germ. l7l, 1891,133 f.).
a2 Eine Abbildung dieser Seite befindet sich in: Eckhard Fnuss - Dieter GeugNicu -Joachim \ü/ot-lescs (Hg.), MGH Libri memoriales er necrologia N. S. 3,1986, Faksimi-le, fol. 62'.Zur Datierung der Grundschicht des Nekrologr rgl. ebda,Tl-76, vor allem76 (Fnarse).
a3 Demwm qwippe apwd Sanawm Emmerarnrnurn sibi iwssit preparari mausoleunt, quomortem obiturus ewm benignius in caelis baberet patrocinantim, quetn in terris utcum-que viaen_s et aalens sui suorwmque optaait, immo fecit fore potentim (MGH SS 4, 1841,551), und: Ad ultimum etiam idem imperator sepultr-ro, iro, locwm in ecclesia sdnctiEmmerami disponens corporis et animae swae pignus eid,em sancto committit (MGH SS30,2, 1934,827). Zu diesen beiden Stellen vgl. Andreas KRÄus, Die Translatio S. Diony-sii Areopagitae von St. Emmeram in Regeniburg (SB München 1972),1972,16 und i4.Die. Regensburger.Tradition scheint aber noch älter zu sein, wenn man folgende Text-stelle in der zwischen lOL2 und 1Ot8 entstandenen Chronik Thietmars ,on"MerseburgVI 4l berücksichtigt: Ibi tunc confratres de monasterio Cbristi martiris Emmerammi,qwod.Arnulfys_tmp_erator in honorem eius constrwxit bicque ad corporaliter pawsandum eI e g i t... (MGH SS rer. Germ. 191,1935,324 2.22-25).
Handscbriftenfwnde zu den Werh.en Liwdprands oon Cremona 73
*urderr44. Dieser Befund könnte die Frage aufwerfen, ob nicht eine etwaige
Provenienz yon Einharts Karlsleben und Liudprands Antapodosis aus der Re-
gensburger Dombibliothek (und nicht aus den Klosterbibliotheken des älteren
St. Emmeram oder des jüngeren Prüfening bei Regensburg) der einleuchtende
Grund dafür ist, warum die beiden Texte in Österreich zunächst nur in zwei
Chorherrenstiften nachweisbar sind. Zudem könnte die stets für den Aus-
tausch von handschriftlichen Vorlagen günstige, nie ganz entworrene Ver-flechtung der Klosterbibliothek St. Emmerams und der Regensburger Dombi-
bliothek ein bislang noch nicht erkanntes lothringisches Exemplar der Vita Ka-
roli, zumindest aber eine Kopie von St. Emmeram an den Regensburger Dom
gebracht habenas. Bereits Bernhard Bischoff vermutete, daß die unter Bischof
Baturich (817-847) ausgebaute Bibliothek von St. Emmeram zv großen Teilen
schon die Basis für die Büchersammlung des ottonischen Reformabtes Ram-
wold (975-1OOO) gebildet hata6. Nun ist aber ausgerechnet in dem ältesten er-
haltenen St. Emmeramer Bibliothekskatalog aus der Zeit Ramwolds, in der so-
genannten Adbreviatio librorum, die wohl bald nach 975, dem Beginn seines
Abbatiats, angelegt wurde, mit dem Eintrag Gesta karoli .r.47 d^s älteste Re-
gensburger Zeugnis für eine Vita Karoli erhalten, die übrigens ein Einzelbänd-
chen gewesen zu sein scheint. Konfrontiert man den hier erwähnten Titel Ge-
aa Und zwar, weil nur die Abfolge d.er Regensburger Bischöfe (und der Abte Prüfe-nings), nicht aber der St. Emmeramer Abte korrekt ist; vgl. MGH SS 17, 1861, 577. DerJahresbericht n: 894 ist ediert ebda, 582 f.
a5 Für den etwaige.r Üb"rgang einer Handschrift St. Emmerams an den Dom muß imAuge behalten werden, daß es trotz oder gerade wegen der Ablösung der Abtswürde St.
Emäerams von der Regensburger Bischofswürde durch \(olfgang immer wieder Übe.-griffe der Bischöfe auf das Kloster gab; vgl. Ferdinand J.r.NNeR, Geschichte der Bischöfevon Regensburg 1, 1883, 36147A; Rudolf Buoor,, Die rechtliche Stellung des KlostersSt. Emmeram in Regensburg zu den öffentlichen und kirchlichen Gewalten vom 9. biszum 1.4.Jahrhundert, Archiv für Urkundenforschung 5 (191a) ß3-238, hier 163-208.
ou Vgl. Bernhard BIscnorr, Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken inder Karolin gerzeit 2, 7980,271f .
o' lHg. von Christine Elisabeth INEtcur,N-EDEn, in: Mittelalterliche Bibliothekskatalo-ge Deutschlands und der Schweiz 4,1,1977,146 2.89. Mit Einharts Karlsleben hat denEirrtrrg bereits identifiziert Robert Forz, Le souvenir et la l6gende de Charlemagnedans ltmpire germanique m6di6val, 1950, 9, was Hans Frider HaErrlr, (Hg.), NotkeriBalbuli Glsta Karoli Magni Imperatoris (MGH SS rer. Germ. N.S. 12),21980, XLII,übersah. Auch Karl-Ernsi GurH, Carolus Magnus. Studien zur Darstellung Karls des
Großen in der deutschen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts, 1977,279 Lnm. 1.01.,
kennt diese Identifizierung nicht. Allein mit Notkers Gesta Karoli imperatoris, die aberkaum selbständig, das heißt ohne Einharts Vita Karoli überliefert sind, hat die Katalog-notiz gleichgesetit Joseph Davis KyLE, St. Emmeram (Regensburg) as a center of culturein thelate tönth century,7976,111. Eine Abbildung der Katalogseite mit dem zitiertenEintrag befindet sich in: Bayerische Frömmigkeit. Kult und Kunst in 14 Jahrhunderten(Ausstellungskatalog), 1.965,Tafel45 (Kommentar ebda, 31).
74 Matthias M. Tischler
sta mrt den heute bekannten Einhart-Handschriften, so wird man festhaltendürfen, daß gerade die südostdeutschen Einhart-Codices diese Überschriftaufweisen48. Aus Bernhard Bischoffs Charakterisierung des Ramwold-Ver-zeichnisses als Bestandsinventar, das im wesentlichen die karolingischenBücherschätze des Klosters verzeichnete, wäre zu folgern, daß diese Gesta ka-roli zumindest eine spätkarolingische Handschrift waren. Doch darf man nichtvergessen, daß unter Abt Ramwold und Bischof Wolfgang (972-994) die Gor-zer Reform in St. Emmeram Einzug hielt und daß auf diesem Wege auch einExemplar der Vita Karoli aus Lothringen nach Regensburg gelangt sein könn-te. Für seine Herkunft aus dem romanischsprachigen Raum könnte die nochnicht beachtete Verwendung des im ursprünglichen Titel überlieferten Sub-stantivs gesta als Singularwort (frz. ,,Ia geste") geltend gemacht werden, wiesich einem Überblick der verwandten Einhart-Überlieferung entnehmen läßt:
Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, LXV. 35: Incipit Gesta Karoli(Kopie: \Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3126: Incipit Gesta haroli
feliciter)'W'ien, ÖsterreichischeNationalbibliothek,Cod.42T: GestaKaroli(Kopie: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3522: Gesta Karoli)Klosterneuburg, Stiftsbibliothek, Cod. Z41: Gesta Karuli\X/ien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 639: Gesta karoli regis
magni.
Diese eben skizzierte Textvermittlung findet ihre Entsprechung in der Ver-breitung der in C und Vien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 639gleichfalls vertretenen bayerisch-österreichischen Regino-Überlieferung, dasheißt in der Verbreitung der Chronik mit der Continuatio Reginonis des Adal-bert von St. Maximin, die Schleidgen innerhalb des Gorzer Reformverbandesansiedeltea9. Di. oben angesprochene, verlorene Vorlage von V und C, also B,
a8 Bcreits Max Maxtltus, Geschichtliches aus mittelalterlichen Bibliothekskatalogen,in: NA 32 (1907) 647-709, hier 668 Anm. 4, hatte darauf hingewiesen, da{3 hinter äemT*.el Gesta zumeist Einharts und nicht Notkers Karlsleben iu vermuten ist, das oh-nehin so gut wie nie ohne Einharts Karlsbiographie überliefert ist.
ae Scslr,iDclN, Regino von Prüm (wie Anm. 37) 146. Da Handschrift A 1b ein St.Emmeramer Codex gewesen sein dürfte, kann seine Vorlage A 1 ein Trierer, das heißtSt. Maximiner, oder ein Gorzer Codex gewesen sein, was Sctrr-rrocpN seltsarnerweisenicht in Erwägung zog. l)er lothringische Ausgangspunkt der Regino-Überlieferung imAdalbert-Zweig (A) wird noch deutlicher, wenn wir für den sog. \üeihenstephane. to-dex Paris, Bibliothöque Nationale, Ms. lat. 5018 (A 2; Schleidgens Handichrif t P 2)Metz., St. Stephan als Provenienz in Erwägung ziehen. Hierfür sprechen die beiScsi-tt»csN abgebildete Metzer Initiale auf fol. 1' (zum Vergleich kann herangezogenwerden Hartmut HorruaNN, Bamberger Handschriften des 10. und des tt. Jährhün-derts [MGH Schriften 39], 1995,Tafe|116), die Textschrift (vgl. SculnocrN, Regino
Handscbriftenfunde zu d.en Werken Liudprands oon Cremona 75
ist daher möglicherweise eine Handschrift des Salzburger Domstiftes gewesen
und hatte einen noch älteren Regensburger Codex vergleichbarer Provenienz
zur Grundlage.Das Alter der inzwischen erkennbar gewordenen, verlorenen Regensburger
Urhandschrift mit Einharts Vita Karoli und der Antapodosis des Liudprand ist
noch unbestimmt. Als ihre älteste erhaltene Ableitung konnte immerhin die
vermutlich Reichersberger Handschrift V aus dem zweiten Viertel des
12. Jahrhunderts gesichert werden, Weitere Klarheit über jene Kreise, die an
der Erstellung und Verbreitung der in den genannten österreichischen Hand-schriften erkennbaren Textverbindung aus Einharts Vita Karoli und Liud-prands Antapodosis beteiligt waren, kann ein besonderer redaktioneller Ein-griff in dem hier überlieferten Karlsleben verschaffen, der zur Diskussion ge-
stelit werden soll. Sicher handelt es sich nicht um eine unbedachte Verände-
rung, wenn in Kapitel 19 Konstantin VI. (780-797) nicht mehr als imperatorGrecorum, sondern als rex Grecorwm bezeichnet wird. Dieser bislang nicht be-
achtete Eingriff in Einharts Karlsbiographie gehört wohl zu den Zeugnissen
des seit den vierziger Jahren des 12. Jahrhunderts greifbaren außenpolitischen
Konflikts der frühen Stauferära zwischen Konrad III. bzw. Friedrich Barba-
rossa und den byzantinischen Kaisern, der sich gerade auch im Gebrauch der
zutreffenden Flerrschertitel widerspiegelteso. Da der Eingriff schon in der vonRegensburg abhängigen Viktringer Flandschrift nachweisbar ist, wird man fürdie Bearbeitung der Vita Karoli in der vorliegenden Textfassung einen zu die-ser Zeit in Regensburg tätigen Redaktor, vielleicht konkret den wohl aus der
Sponheimer Stifterfamilie Viktrings stammenden königlichen Notar Albertsl
von Prüm, Abb. 16) und die Tatsache, dall die Handschrift schon im 16. Jahrhundertden französischen Gelehrten Pierre Pithou und Jacques-Auguste de Thou gehörte.
to Vgl. §Terner OuNsoRcE,, ,,Kaiser" Konrad IlI. Zur Gcschichte des staufischenStaatsgedankens, in: DcRs., Abendland und Byzanz, 19V9, 364-386, hier 374 und 378;Dr.Rs., Zu den außenpolitischen Anfängen Friedrich Barbarossas, ebda, 411433, hier431. Belege für rex Grecorwm aus der frühen Herrschaftszeit Barbarossas finden sich imKonstanzer Vertrag von L153 (hg. r,on Peter Rassov, Honor imperii. Die neue PolitikFriedrich Barbarossas 1152-1159,21961,117-1,20, hier 118f.) und im bekanntcn Ludusde Antichristo (hg. von Gisela VontvtaNN-PRore, Ludus de Antichristo [Litterae. Göp-pinger Beiträge zur Textgeschichte Nr. 82 IIl, 1981, 10 und 22: Regieanweisungen nachden Versen 100 und 200).
51 Friedrich Hnusnte.ur.r, Reichskanzlei unci Hofkapelle unter Heinrich V. und Kon-rad III. (MGH Schriften 14), 1956,279-293; Rainer Maria Hr,Rrl,unat*,Zrr Lebensge-schichte des frühstaufischen Notars Albert, in: f)A 20 (1964) 562-567;Kurr.ZatuNGER,Die Notare der Reichskanzlei in den ersten Jahren Friedrich Barbarossas, in: ebda 22(1966) 472-555,hier 498-525; Erich MEururN, Die Aachener Pröpste bis zum Ende derStauferzeit, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 78 (1966-1967) 5-95, hier32-37; Rainer Maria HenreNRatH, Der frühstaufische Notar Albert von Sponheim, in:ebda 80 (1970) 73-98, hier 78 und 80 (zu Beziehungen nach Regensburg); Hans Parzn,Artikel ,Albert', in: Lex. MA 1, 1,980,287 f .
76 Matthias M. Tischler
in Erwägung ziehen müssen, der wesentlichen Anteil an der genannten früh-staufis chen, ge gen By zanz gerichteten Kanzleiprop a gand a hatte52 .
Die ietzt erkennbare Vermittlung lothringischer Handschriftenvorlagennach Regensburg schon in ottonis cher Zeit läßt die von Joseph Becker nichtbis ins letzte gelöste Problematik der mit der parallel überlieferten Textfassungder Vita Karoli verbundenen Liudprand-Überlieferung der sogenannren ,,III.Klasse" und ihrer Herkunft in einem neuen Licht erscheinen. Schon Beckerhatte eine gewisse Affinität zwischen ihren Verrretern und den im ZweitenVeltkrieg verloren gegangenen ottonischen Metzer Liudprand-Exzerpten inder Handschrift Metz, Bibliothöque de la Ville, Ms. 145 feststellen könnens3.Dieser Befund kann nun aus der Perspektive des spätestens seit dem 12. Jahr-hundert parallel mit Liudprands Antapodosis überlieferten karolingischenKarlslebens eine Erklärung für die Herkunft einer letztlich lothringischenTextfassung der Antapodosis gerade in Bayern und Österreich liefern. Die lo-thringischen Bezüge dieser Redaktionsstufe der Antapodosis scheinen sich zuerhärten, wenn die erst vor einigen Jahren von Peter Christian Jacobsen in Er-wägung gezogenen personen- und gattungsgeschichtlichen Zusammenhängezwischen der von Liudprand 958-962 um ein sechstes Buch zu seiner erstenKonstantinopelreise (949) erweiterten Antapodosis und der Reisebeschreibungzur Legation des Johannes von Gorze nach Cordoba (953-956) in der Vita des
Johannes von Gorze und die aus ihr resultierende gegenseitige Befruchtung imMetzer bzw. Gorzer Reformkreissa zutreffen sollten.
II
Im Zusammenhang mit der bayerisch-österreichischen Einhart-Liudprand-Überlieferung kann auf einen neu aufgefundenen, von Paolo Chiesa noch nichtberücksichtigten Codex hingewiesen werden. Bereits einige Jahre bevor Guil-laume Petit (f 1526), Dominikaner aus der Normandie und Kustos der Biblio-thek Königs Franz I. in Blois, seine Erstausgabe der Antapodosis und HistoriaOttonis in Paris 1514 veröffentlichte, hat in Bayern der eifrige Quellensamm-ler Johannes Aventinus (1477-1,53a) die Antapodosis gekannt und als Ge-
t' vgl. Rainer Maria HERrrNRerH, Regnum und imperium. Das ,,Reich" in der früh-staufischen Kanzlei (1138-1155) (SB Wien 264Nr. 5), 196g, g.
- r BEci<-r,R, Textgeschichte Liudprands (wie Anm. 4) 25 und 36. Eine Abbildung von
fol.204'der verlorenen Merzer Handschrift ebda, Tafel I.5a Peter Christian JeconseN, Die Vita des Johannes von Gorze und ihr literarisches
Umfeld. Studien zur Gorzer und Metzer Hagiographie des 10. Jahrhunderrs, in: L'ab-baye de Gorze au X" siöcle, hg. von Michel PenrssE - Otto Gerhard OExLr,, 1993,25-50,hier 40 f.
Handscbriftenfwnde zu den Werken Liwdprands zton Crernona
schichtsquelle benutzt. Das für die österreichische Einhart-Liudprand-Über-lieferung gesicherte Stemma kann von Vi = Vien, Österreichische Nationalbi-bliothek, Cod. 400 ausgehend um einen Münchner Textzeugen ergänzt wer-den. Es handelt sich um die ausführlichen Exzerpte aus Einharts Karlsleben
und Liudprands Antapodosis, die sich Aventinus in der Handschrift München,Bayerische Staatsbibliothek, clm 120155, de- zweiten seiner fünf bekannten
Notizbücher (,,Adversaria" oder ,,Rhapsodiae" clm 967 und 1201-1204), aus
einem heute verlorenen Codex des bei Braunau am Inn liegenden Chorherren-stiftes Ranshofen56 notierte. Die Auszüge (= Mo) stehen in der 189 Blätterzählenden, etwa 33 x23-21cm großen Papierhandschrift auf den Seiten 138'-152" (Einhart)s7 und 153"-162' (Liudprand)s8. Aventinus dürfte sie zwischen
1509 und 1511 angefertigt haben, als er sich in Burghausen5e und insbesondere
in Ranshofen aufhielt, das gerade damals unter Propst Kaspar Türndl (1504-1529) einen blühenden Klosterhumanismus pflegte60. Die Provenienz der Ein-
s5 Maximilian voN FREynrRG, Ueber Aventins handschriftlichen Nachlaß, in: DEns.,Neue Beiträge zur vaterländischen Geschichte und Topographie 1,1.,1837, Z5-101, hier79 und 88f.; Theodor tWtsoeMANN,
Johann Turmair, genannt Aventinus, Geschicht-schreiber des bayerischen Volkes, 1858, 346-351; Catalogus codicum latinorum Biblio-thecae Regiae Monacensis 3, 1, 1868,233-235.
tu Vgl. Rudolf Gusy, Ranshofen, in: Alte Klöster in Passau und Umgebung, hg. vonJosef Osva ro, 2 1,95 4, 21 1,-221, .
57 Die schwankende Intensität der Exzerpierungsarbeit des Aventinus ist für die mehroder weniger wortgetreuen, bisweilen auch stärker paraphrasierten und stilistisch über-arbeiteten Auszüge aus folgenden Kapiteln verantwortlich - fol. 138': nur vereinzeltePhrasen aus Kap.2 und 3; fol. 138': Kap. 1 und 6 (einzelne '§ü'örter); fol. 139': Kap.3;fol. 139": Kap. 3, 5 (paraphrasiert) und 6 (stärker paraphrasiert, gegen Ende nicht ausEinhart); fol. 140'l': Kap. 7-9 (paraphrasiert) und 10 (nur eine diesbezügliche Übe.-schrift); fol. 141/": Kap. 10 (paraphrasiert mit einem Zusatz zu Pippins Taufeund Sal-bung zum König von Italien sowie zur Salbung Ludwigs zum König von Aquitanien)und 11 (paraphrasiert und mitZusätzen, z.B. dem Abschnitt De bello septimo Bawuari-co, versehen). Der Abschnitt fol. 142'-148u, der die Kap. 12-25 umfaßt, zeigt getreuereExzerpte, die nur bisweilen von paraphrasierenden Passagen abgelöst werden. Zusätze,die nicht aus Einhart stammen, finden sich nur auf fol. 142'-143' zu Kap. 13. Von fol.149'bis zum Schluß auf fol. l52laßt die Intensität der wortgetreuen Exzerpierung ausKap.26-33 wieder merklich nach. Auf fol. 149'-150' ist Einharts mageres Kap. 28 zuKarls Kaiserkrönung mit zahlreichen Zusätzen versehen.
58 Auch hier hat Aventinus in unterschiedlicher Intensität folgende Abschnitte exzer-piert bzw. paraphrasiert (nicht berücksichtigt sind hier die zahlreichen inhaltlichen No-tizen, die Aventinus an den Rändern ergänzt hat): I 5, I 13, I5,I 14-42; II 1-5, Il7-15,II 17-26,11 28-45,1I 66-73;lll 2{. rndIII 5-22.t' Vgl. Alois Scurvrto, Johannes Aventinus als Prinzenerzieher, in: Festschrift desAventinus-Gymnasiums Burghausen, 1980, 10-27,hier 19-21,. Hoc cbronicon in burgw-sio inoenimus postbdec Anno MDIX (se tilgt Mo) in decembri; postbac (l) in monachioanno MDXI in ianuario heißt es in der Handschrift auf fol. 55'.
'o Vgl. Gerald Srnauss, Historian in an age of crisis. The life and work of JohannesAventinus 1477-1534,1963,89-91,. Stnauss, 91, wollte die Einhart- und Liudprand-Ex-zerpte erst bei Aventinus' zweitem Besuch in Ranshofen Spätsommer l5l7 entstanden
78 Mattbias M. Tischler
hart- und damit auch der Liudprand-Exzerpte geht aus zwei Randnotizen auffol. 138' und L47' hervor, wo es: Ex cAnobio ransbofen ex Veteri libro, bzw.:Vita caroli Magni ex ransbofen cAnobio, heißt. Obwohl zunächst unklar ist,welche Handschrift Aventinus mit aetus liber konkret meinte, ergibt schon dieUntersuchung der Einhart-Exzerpte nicht nur eine enge Verwandtschaft seinerVorlage mit der vonZ = Zwettl, Stiftsbibliothek, Cod. 299 ausgehenden Üb..-lieferung, sondern insbesondere mit dem Heiligenkreuzer Codex Vi, mit demMo drei individuelle Fehler bzw. Abweichungen gemeinsam hat61:
fehlerhafte griechische Majuskel:exicpitoKa Z) exicpitoRa Yi. exic,pitoRa2.8)
Mo (vor der Korrektur) (Kap. 16 S. 20
verballhornte \Wortform:
attulam ... reliquit Zl atitilam ... reliquit Yi. Atitilam ... reliquit Mo (korrigiert,tilgt und reskribiert Aventinus) (Krp. 19 S. 24 Z. 7-9). Die Verschreibung in Vi wardurch die gleichbehandelten Schäfte -ttu- inZ verursacht worden.
§Tortumstellung:latinam ita didicit Zl ita latinam didicit Vi. Mo (Krp. 25 S. 30 Z. 4f .).
Aus diesen Leitfehlern ist zu folgern, daß der Ranshofener Codex wohlauch für die parallel überlieferten Liudprand-Exzerpte eine Abschrift oderAbleitung von Vi gewesen ist und daher nicht früher als um die Mitte des
13. Jahrhunderts entstanden sein kann. Tatsächlich bestätigt ein Lesartenver-gleich auch dieser Exzerpte ihre Verwandtschaft mit der von Chiesa rekon-struierten österreichischen Liudprand-Überlieferung, die von einer Vorlage B
ausgeht62:
Graphie (eines Eigennamens):
. -. quas clwsuras nominat vwlgws) ... quas clauswras nominat oulgws F. Mo (I 5, S. 8
2.1,71,f .)
sehen. Dagegen spricht, daß Aventinus schon in seinen 1511 verfaßten ersten Annalesducum Bavariae Liudprands Antapodosis verwertete; vgl. Alois Scurvrto, Die historischeMethode des Johannes Aventinus, Blätter für deutsche Landesgeschichte 1,1,3 (1,977)338-395, hier 378. Zu Kaspar Türndl vgl. Rudolf \Tolfgang ScHuror, Das AugustinerChorherrenstift Ranshofen. Seine Vorgeschichte und seine Geschichte, in: 900 JahreStift Reichersberg (wie Anm. 16) 139-148,hrer 144.
61 Die folgenden Zitate beziehen sich auf die maßgebende Einhart-Ausgabe von [Ge-org W,ttrz -l Oswald Hor-opn-Eccrn (Hg.), MGH SS rer. Germ. 125),1911.
62 Die folgenden Zitate sind nach der jetzt maßgebenden Liudprand-Edition vonCHm,sa, Liudprandi Cremonensis opera omnia (wie Anm. 3) nachgewiesen.
Handschriftenfwnde zu den Werken Liwdprands von Cremona 79
Franci itaque Oddonem ... regem constituwnt) Franci itaque ottonem ... regern con-
stitwunt 0.Mo (I 15, S. 18 Z.483f.)Vernaaola nominef venawola nomine p. oenauola Mo (I 20, S. 19 Z. 532)
Mediolanium . . . dirigit) mediolanwm . . . dirigit B. Mo (I24, S. 21, Z. 583)
Romarn, qua.ln Leonianam dicunt, ... oi capiwntf romam qudm (qwaMo) leoninam
dicwnt (vocantv) .. . vi capiunt F. Mo (I 27, 5. 22 Z. 614-616)
oipperina . .. calliditate) oiperina ... calliditate B. Mo (I 32,5.24 Z. 670f .)
Etserardws) eberbardws B. Eberbardus Mo (II 18, S. 43 2.402)Flwoius Atbesis) Flwviws addex B. Addex Fluviws Mo (II 40, S. 51.2.657)
exitatws) excitatus F. Mo (II 41, 5.51,2.670)
formonsa Papia) formosa papia F. Mo (III 3, S. 69 Z. 144 und S. 70 Z. 163)
Bruchardo... denwntiat, wt suiin awxiliumoeniatf pwrchardo... V. burkardo... C.
Bwrcbardo ... denuntiat (denunciat Yi) ut sibi in awxilium oeniat Z (Yi). Burcbar-
dum (nach der Korrektur) . . . in awxiliwm oocdt Mo (III 13, S. 73 Z. 265 f .)
per Tyrenwm maref per tirrenum rnd.re F. pu mare tyrrbenum Mo (III 16, S. 75
z.3r4f .)marcdm tenebat) marchiam (marcbinam Y) tenebat p. Mo (III 18, S. 75 Z. 328)
Textlücke:
cum Constantino ... Leonis imperatoris filio) imperatoris fehlt B. Mo (II 45, S. 53
2.727 f .)
rebellasse ... tunc fehlt p. Mo (II 45, S. 53 2.733 -II 66,5. 61 2.1001)indictione XII, sexta ferial indictione .VI. P. Mo (III 3, S. 70 Z. 165)
Metaplasmus:
fwgiit) fwgir B. Mo (I 34, S. 25 Z. 708 und lI 41, S. 5t Z. 671)
Kasuswechsel:
Exiens deniqwe Papial Exiens denique (denique fehlt Mo) papiarn. F. Mo (II 38,
s.51,2.641,f.)
Tempuswechsel:
contingit) contigit 9. Mo (I27,5.222.607).
Da Mo allein an zwei Stellen mit den aus C abgeleiteten Textzeugen, in allen
weiteren Fällen aber mit der aus Z (Yi) hervorgegangenen Überlieferung liest,
bestätigt sich die Verwandtschaft der Ranshofener Liudprand-Vorlage des
Aventinus mit dem Heiligenkretzer Codex Vi:
Matthias M. Tiscbler
Graphie (eines Eigennamens):
in Lotharingia) in lothringa Y. in luothringia C. in Luotringia Z (Yi). in LutringiaMo (II 18, S. 43 2.403). In Z (Vi) ist das w über das o gestellt, was Aventinus als
Korrektur mißverstanden hat.
a beato Hermagora] a beato bermachora V. C. a beato (beato fehlt Mo) ErmachoraZ (Yi). Mo (nach der Korrektur) (III 5, S. 70 2.186)Hermengardaf ermingarda V. C. Ermingard Z (Yr). Mo (III 7,5.71 Z. 209)
Wandelmodaf witandelmuoda Y. ouitandelmwoda C. winthandelmuoda Z (Yi).Wintbädelmwoda Mo (III 20, S. 7 5 Z. 340)
§Tortumstellung:
suis ut fidem dictis praeberetf wt suis fidem dictis praeberet V. C. ut fidem swis dictispraeberet Z (Yi). ut suis dictis fidem faceret Mo (I 32,5.24 Z. 679)
§(ortumstellung und Graphie:
swo in brolio) in swo brolio V. C. in suo brulio Z (Yi). Mo (III i,4,5.74 Z. zg2f .)
Fortlassen eines Präfix, Erweiterung des Ausdrucks und sflortumstellung:Fecerat namque lsibü ... praepotentissimum marcbionem, sibi oalde fidelem) Fece-
rat namque sibi . . . Potentissimwm marcbionem oalde sibi fidelem (fidum V) V. C.Fecerat namque sibi ... potentissinTum principem et marchionem oalde sibi fidelemZ (Yi). Conciliarat aero sibi ... potentissimum principem et marchionem oalde fide-lem Mo (II 35, S. 50 Z. 623-625)
Numeruswechsel:
gestus turpisY) gestws turpes C (2. Vi). Mo (I 33, 5.25 Z. 698)
Tempus- und Moduswechsel:
corrwperitf corrunxpit C (Z.Yi). corruplr Mo (II 39, S. 51. Z. 654). corrwnTperet Yscheint eine Tempusangleichung an das ebda Z. 652f . von dwm abhängige pergeret,
degeretque zu sein.
Attribut -> Adverb und Flüchtigkeitsfehler:
Nec iuoat Hwngarios solis bos urere flammis) Nec iwoat wngarios solwm bos wrere
flammis V. C. Nec iuvat wngarios solum nos urere flammis Z. (Yi). Mo (III 3, 69
2.141).
Aus diesen Beobachtungen läßt sich schließen, daß der Ranshofen er vetus li-ber aus dem gotischen Heiligenkreuzer Codex Vi abgeschrieben oder abgelei-tet worden sein muß und folglich eine in gotischer Minuskel geschriebene
Handschriftenfunde zu den Werhen Liudprands oon Cremona 81
Handschrift gewesen ist. Über die sonstige Beschaffenheit dieses Codex läßtsich kaum etwas ermitteln. Es ist lediglich bekannt, daß die RanshofenerHandschriften in der Regel eine nur bescheidene Ausstattung aufweisen unddas Bild eines durchschnittlichen Skriptoriums vermitteln6l. Auch die sonsti-gen Indizien, die die Exzerpte liefern, helfen kaum weiter. So ist es zweifelhaft,ob der in Capitalis quadrata von Aventinus geschriebene Titel DE cARoLo MAG-
ruo auf fol. 139'unten aus der Vorlage stammt, was sicherlich nicht für den auffol. 139" zu Beginn der eigentlichen Einhart-Exzerpte von jüngerer Hand mar-ginal nachgetragenen Titel Vita Carolj Magnj ex Eginbardo zutrifft. In jedem
Falle entspricht die Beobachtung, daß Ranshofen bei der Verbreitung der VitaKaroli und der Antapodosis nur eine rezeptive Rolle spielte, dem Eindruck,den der Kulturbetrieb des bayerischen Chorherrenstiftes seit dem 1,2.Jahrhun-dert, dem Gründungsjahrhundert, vermittelt. An eigenständiger Literaturpro-duktion ist aus Ranshofen zu jener Zeit überhaupt nichts bekannt geworden,obwohl gerade Propst Manegold (ca. 11,41, - vor 1158) als ffTusd.runx Parnassws
und scientiae theatrum gelobt wurde64. So fallt es schwer, über geistiges Um-feld und Entstehungsumstände der spätmittelalterlichen Vorlage des Aventi-nus etwas Genaues zu sagen. Vielleicht stand hinter der Kopie aber derWunsch, den alten Bezug des Stiftes zu den Karolingern auf literarischem'§7ege wiederherzustellen. Schon unter Ludwig dem Deutschen und noch im1,2. Jahrhundert war Ranshofen Pfalz bzw. Reichsgut. Bemerkenswert bleibt,daß sich auch in dem nur eine kurze Wegstrecke von Reichersberg entferntenAugustinerchorherrenstift Ranshofen einmal ein Codex mit der Textkombina-tion aus Einharts Karlsleben und Liudprands Antapodosis befunden hat.
Es ist der besonderen Fürsorge der Erben des Aventinus-Nachlasses zu ver-danken, daß man die eben geschilderten überlieferungsgeschichtlichen Beob-achtungen anhand des zweiten Bandes der Adversarien noch machen kann, istdieses Manuskript doch mit den restlichen vier der einstmals mindestens zehnBände umfassenden Abschriften- und Exzerptesammlung des Aventinus durchviele Hände gegangen. Nach der Mitte des 16. Jahrhunderts standen die Hand-schriften, die wohl an Aventinus' Freund und Förderer Leonhard von Eck(i480-1550) gekommen waren, einige Zeit Matr.hias Flacius Illyricus (1520-
t' Vgl. Elisabeth KLruM, Die romanischen Handschriften der Bayerischen Staatsbi-bliothek 1 (Textband), 1980, 131; Sigrid KRAueR, Die Bibliothek von Ranshofen imfrühen und hohen Mittelalter, in: The role of the book in medieval culture 2 (Bibliolo-gia 4), hg. von Peter GaNz,1986,4l-72.
uo Vgl. Michael H. Scuuro, Artikel ,Ranshofen', in: 2LThK 8,1963,991 (ohne Quel-lenangabe). Zu Ranshofen und Manegold vgl. Stefan lWr,rNnunrnn, Salzburger Bistums-reform und Bischofspolitik im 12.Jahrhundert, 1975, 7 5-79.
82 Matthias M. Tischler
1,575) zur Auswertung zur Verfügung6s. Später sind sie in den Sammlungender bayerischen Geschichtsforscher Wiguleus Hund (1514-1588) und Chri-stoph Gewold (1556-1,621) zu finden, bevor sie in die Kurfürstliche MünchnerHofbibliothek gelangten66. Während seiner Amtszeit als Hofbibliothekar(1,781,-1787) übersandte der ehemalige Pollinger Kanoniker und Stiftsbiblio-thekar Gerhoh Steigenberger die Adversarien seinem Lehrer und geistlichenVater, dem Pollinger Propst Franziskus Töpsl (1,744-1796), zur wissenschaftli-chen Bearbeitung6T. Nach Steigenbergers (L787) und Töpsls (1797) Tod kehr-ten die Bände aber nicht nach München zurück, und auch bei der Säkularisa-
tion in Polling 1803 wurden sie nicht vorgefunden. Vier von den fünf verblie-benen Bänden (clm 1201-1204) tauchten schließlich im frühen 19. Jahrhundertim Münchner Antiquariat Steyrer auf, wo sie der Handschriftenliebhaber KarlMaria Ehrenbert Freiherr von Moll (1760-1838) entdeckte. Doch erst seit 1837
bzw.1891 (clm967) stehen die Kopial- und Exzerptbücher des Aventinus wie-der in den Regalen der Königlichen Hofbibliothek, der heutigen BayerischenStaatsbibliothek zu München.
65 Latinas eiws lsc. Aoentinl Rapsodias, wt scis, dwdum dederas wswi. Si oalde cwpit Se-nd.tus ed.s recipere, restitwam schreibt Flacius 1561 an den Regensburger Superintenden-ten Nikolaus Gallus; vgl. Josef Vilhelm ScuuLrE, Zur Geschichte des AventinschenNachlasses, in: Monatsschrift für die Geschichte 'üTestdeutschlands 6 (1880) 265-272,hier 270; Otto Hantrc, Die Gründung der Münchener Hofbibliothek durch Al-brecht V. und Johann Jakob Fugger (Abhandlungen der Königlich-Bayerischen Akade-mie der'Wissenschaften, Philosophisch-philologische und historische Klasse 28 Nr. 3),t9t7, 159.t' Vgl. \(tEor,ltaNN, Johann Turmair (wie Anm. 55) 345f.; Henrrc, Münchener Hof-bibliothek (wie Anm. 65) l59f . Anm. 9.
67 Dies und alles weitere bei Alois ScHuto, Aventiniana aus dem Augustiner-Chorher-renstift Polling, in: ZBLG 44 (1981) 693-72l,hier 716-720.